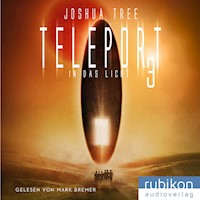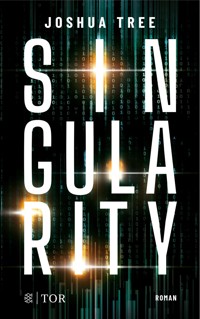
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Schafft sich die Menschheit selber ab? »Singularity« ist der neue Science-Fiction-Thriller von Bestseller-Autor Joshua Tree über die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Ende des 21. Jahrhunderts ist die Menschheit tief gespalten: Während die eine Hälfte medizinisch bestens versorgt ein langes Leben führt, ist die andere schlicht überflüssig. Bestenfalls als billige Arbeitskräfte haben die meisten Menschen ein karges Auskommen. Einer dieser Überflüssigen ist James, der als Hausdiener der neuen Elite anheuert. Von seinem neuen Herrn erhält er einen rätselhaften Auftrag: Er soll dessen vor zwanzig Jahren verschollene Tochter wiederfinden - in einer virtuellen Simulation. Schon bald muss er erkennen, dass nicht bloß die Grenzen von VR und Wirklichkeit verschwimmen, sondern auch die von Mensch und Maschine. Und ihm offenbart sich ein schreckliches Geheimnis, das die Zukunft und Vergangenheit der Menschheit in Frage stellt. Für Leser*innen von Marc Elsberg, Phillip P. Peterson, Daniel Suarez und Tom Hillenbrandt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Joshua Tree
Singularity
Roman
Über dieses Buch
Ende des 21. Jahrhunderts ist die Menschheit tief gespalten: Während die eine Hälfte medizinisch bestens versorgt ein langes Leben führt, ist die andere schlicht überflüssig. Bestenfalls als billige Arbeitskräfte haben die meisten Menschen ein karges Auskommen.
Einer dieser Überflüssigen ist James, der als Hausdiener der neuen Elite anheuert. Von seinem neuen Herrn erhält er einen rätselhaften Auftrag: Er soll dessen vor zwanzig Jahren verschollene Tochter wiederfinden – in einer virtuellen Simulation.
Schon bald muss er erkennen, dass nicht bloß die Grenzen von VR und Wirklichkeit verschwimmen, sondern auch die von Mensch und Maschine. Und ihm offenbart sich ein schreckliches Geheimnis, das die Zukunft und Vergangenheit der Menschheit in Frage stellt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Joshua Tree ist Kommunikationstrainer, Weltreisender und Wortmaler. Unterwegs mit Motorrad, Auto und Fahrrad, erkundet er unsere Welt – und die seiner Phantasie. Seine Thriller und Science-Fiction-Romane führen regelmäßig die Amazon-SF-Charts an.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© Joshua Tree Ltd.
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Guter Punkt, München, unter Verwendung von Motiven von Wisaad / gettyimages und a_Taiga / gettyimages
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491310-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
»Erst formen wir unsere Werkzeuge, dann formen die Werkzeuge uns.«
Marshall McLuhan
»Worin besteht also diese Singularität? Es handelt sich um einen zukünftigen Zeitabschnitt, in dem der technische Fortschritt so schnell und seine Auswirkungen so tiefgreifend sein werden, dass das menschliche Leben einen unwiderruflichen Wandel erfährt. Das ist weder utopisch noch dystopisch gemeint, aber diese Epoche wird viele für unseren Lebensinhalt grundlegende Konzepte und Vorstellungen umkrempeln – von Geschäftsmodellen bis zum menschlichen Lebenskreislauf, einschließlich des Todesbegriffs. Das Begreifen der Singularität wird unsere Anschauung der Vergangenheit und der Zukunft verändern. […] In der Singularität werden unser biologisches Denken und Dasein mit unserer Technik verschmelzen. Das Ergebnis ist eine nach wie vor menschliche Welt, allerdings jenseits unserer biologischen Wurzeln. Danach wird kein Unterschied mehr sein zwischen Mensch und Maschine, oder zwischen physikalischer und virtueller Realität.«
aus: »Menschheit 2.0« von Raymond Kurzweil, Autor, Erfinder und Leiter der technischen Entwicklung bei Google
Prolog
Luise saß auf dem Deck eines Katamarans und genoss einen vierzig Jahre alten Chardonnay zu ihrem Steak vom Kobe-Rind, das sie in einer Pfütze aus Blut und Fett mit ihrem Messer zerteilte. Das Fleisch war wunderbar marmoriert, und jeder Bissen, den sie sich andächtig in den Mund steckte, wurde von den erhabenen Blasgeräuschen der Wale begleitet, die sich im Wasser um das Boot tummelten.
Ein grüner Punkt in ihrem Sichtfeld hüpfte vor ihr auf und ab. Er war schon die ganze Zeit dort gewesen, doch irgendwann war es leicht, ihn zu ignorieren, auch wenn er nie ganz aus ihrer Wahrnehmung verschwand. Seufzend legte sie das Besteck auf der Stoffserviette neben ihrem Teller aus Bozener Marmor ab. Das Blut-Fett-Gemisch hinterließ rote Flecken im weißen Gewebe – wie in einem der dadaistischen Gemälde von Hans Arp.
Der Anblick winziger Tröpfchen, die den Stoff berührten und sich kreisförmig darin ausbreiteten, faszinierte Luise genug, um den um ihre Aufmerksamkeit ringenden Punkt noch einige Atemzüge lang zu ignorieren. Als sie es nicht mehr konnte, beendete sie seufzend die VR-Umgebung und öffnete die Augen.
Wie spät ist es?, dachte sie, und das Headmemory in ihrem Stammhirn blendete gehorsam die Uhrzeit ein. Sie legte sich in sanften Cremefarben auf den Himmel ihrer Koje, der aus geriffelten Platten eines echten kongolesischen Köcherbaums bestand. So ein Mist!
Es war bereits nach zehn, und ein verschlafener Seitenblick zeigte ihr auf der anderen Seite des Unterdecks zwei leere Kojen. Mit knackenden Gelenken schwang sie die Beine aus ihrer eigenen und landete auf den Füßen. Der Boden war angenehm kühl. Hastig zog sie ihr durchgeschwitztes Top aus und warf es angewidert in den Recycler, der neben dem kleinen Treppenaufgang zum Deck stand. Fluchend zog sie es wieder heraus, als sie sich daran erinnerte, dass es sich um einen einfachen Mülleimer handelte, der per Metallschelle an der Wand fixiert war.
»Schiffe«, murrte sie, »wie ich sie hasse.« Sie zog sich ein frisches Top aus der Sporttasche, die in einem Netz am Fußteil ihrer Koje hing, als wäre sie in einem Spinnennetz gefangen. Das Kleidungsstück war frisch gewaschen, roch aber bereits modrig. Nachdem sie es sich widerwillig übergestreift hatte, watschelte sie ungelenk zu der Nasszelle, die sie durch eine Plastikluke neben dem Treppenaufgang erreichte. Dort wusch sie sich das Gesicht, sah in den Spiegel und betrachtete eine Weile die Tropfen des gechlorten Wassers, die ihr über Stirn, Nase und Wangen rannen.
Das bist du, dachte sie und fühlte doch nichts beim Anblick ihres eigenen Gesichts, abgesehen vom leichten Kitzeln, das die Wassertropfen auf ihrer Haut hinterließen. Luise wandte sich vom Spiegel ab, warf eine Dentolantablette in einen der Plastikbecher auf dem Waschbecken und goss einen Schwall Wasser hinein. Nachdem sich die Brause aufgelöst hatte, gurgelte sie mit dem Inhalt und spuckte ihn wieder aus.
Als sie endlich aufs Deck und unter die allgegenwärtige Sonne der indonesischen Javasee trat, musste sie einige Male blinzeln, bis sich ihre Augen an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnt hatten.
Guowei und Daniel waren wieder einmal dabei, Vanessa zu umgarnen, die in knallrotem Bikini auf dem linken der beiden Ausleger lag und sich auf einem Handtuch sonnte. Guowei, der ihnen das Boot organisiert hatte, saß zu ihren Füßen und nuckelte immer wieder an einem Bier, während Daniel – mit freiem Oberkörper – an einer Winsch kurbelte, als könne er wirklich segeln.
Luise duckte sich unter dem Baum hindurch, der das große Hauptsegel aus Solarfolie straff hielt, und vorbei an der linken Want. Sie war beim Blick auf den blauen Ozean ein wenig enttäuscht, dass keine Wale sie begleiteten. Sie waren längst ausgestorben und wurden bloß noch in VR-Umgebungen lebendig gehalten, als eine digitalisierte Erinnerung.
»Guten Morgen, Luise!«, rief Daniel ihr zu und hielt an der Winsch inne, um ihr zuzuwinken. Auch Guowei prostete ihr mit seinem Bier zu, während Vanessa nicht einmal die Augen öffnete.
»Morgen«, erwiderte sie. »Habt ihr gut geschlafen?«
»Ja, ich bin den Tauchgang schon mal in der VR durchgegangen«, verkündete Guowei begeistert. Der Chinese war wie sie erst Anfang dreißig, aber viel erfahrener als sie. Er konnte nicht nur den alten Katamaran seines Vaters steuern, sondern auch tauchen.
»Und?«, fragte sie, weil ihr das am unverfänglichsten vorkam. Er und Daniel machten sich ohnehin oft genug über sie lustig, da musste sie ihnen nicht mehr Angriffsfläche bieten als unbedingt notwendig.
»Wir werden ungefähr für eine Stunde Sauerstoff haben. Mit Nitrox können wir ein wenig mehr Zeit gewinnen, wenn wir die unteren Stockwerke erkunden wollen.«
»Und du bist sicher, dass es keine Haie mehr gibt?«
Nun machte sich Vanessa erstmals bemerkbar, indem sie verächtlich schnaubte, weiterhin mit geschlossenen Augen und der Sonne auf ihrer bronzefarbenen Haut. »Komm schon, selbst als Deepnet-Verweigerin solltest du wissen, dass die längst ausgestorben sind. Mach dir nicht ins Hemd!«
»Tut mir leid, wenn manche von uns noch Gefühle haben«, giftete Luise zurück. Ihre Stimme klang in ihren eigenen Ohren deutlich schnippischer, als ihr lieb war.
Guowei und Daniel sahen betont weg, um nicht Partei ergreifen zu müssen, schließlich befanden sie sich in einem Dilemma: Mit perfekter Gen-Sequenzierung auf die Welt gekommen, war Vanessa ein echter Hingucker, den VR-Experten nicht besser hätten programmieren können. Luise hingegen war nur ganz hübsch, hatte aber diese natürliche Ausstrahlung, die ihre körperlichen Mängel ausglich.
»Gefühle sind überbewertet«, wiederholte Vanessa, und obwohl ihre Augen geschlossen waren, hätte Luise schwören können, dass sie gerade mit ihnen rollte. »So irrational. Wenn dir daran so viel liegt, kannst du dein Stipendium in Shanghai ja an den Nagel hängen und zu den Überflussmenschen aufs Land ziehen.«
»Und warum bist du dann hier?«
»Was?« Vanessa öffnete ein Auge und musterte sie kurz, bevor sie mit ihrem geschwungenen Mund zuckte und es wieder schloss.
»Diesen Trip. Mit einem Segelboot in ein Sperrgebiet fahren, um einen Tauchtrip zu veranstalten, ist nicht gerade ungefährlich.«
»Keine Ahnung, mir war langweilig.«
»Ah, die Prinzessin hat scheinbar also doch Gefühle. Denn vernünftig ist dieser Trip ganz sicher nicht.«
Vanessa beschränkte sich statt einer Antwort auf pikiertes Schweigen, und Guowei und Daniel lösten die angespannte Atmosphäre, indem sie begannen, das Tauchequipment vorzubereiten und dabei Witze zu reißen.
Luise stellte sich derweil auf die Spitze des rechten Auslegers und lauschte dem Rauschen der Gischt, die unter ihr vom Katamaran aufgepeitscht wurde. Das blaue Wasser teilte sich unter dem spitz zulaufenden Carbon, und die weißen Flocken der Gischt preschten vor wie eine Herde weißer Hengste, bis sie sich wieder mit den Fluten verbanden. Ein leichter Wind wehte ihr um die Nase und trug eine Mischung aus Salz und Algen mit sich, die für sie nach purer Freiheit roch. Die Jahre in Shanghai als Stipendiatin für Bioalgorithmik waren zu Anfang noch aufregend gewesen mit all den neuen Kommilitonen, doch das Arbeitspensum war so enorm, dass ihr schon bald der Kopf geraucht hatte. Guowei kennenzulernen war das beste, was ihr hatte passieren können, seine Abenteuerlust hatte sie angesteckt und dafür gesorgt, dass sie nicht jeden Abend in der VR abhing. Zwar waren die virtuellen Welten mittlerweile so hochauflösend und dank direktem Neuralinterface auch so gefühlsecht, dass man sie mit der Realität verwechseln konnte, aber echte Erfüllung fand sie dort nicht. Es war, als besäße ihr Gehirn einen Filter für unechte Dinge. Sie konnte eine noch so entzückende VR genießen, am Ende dachte sie meist: und jetzt?
Dieser Trip war anders. Er war nicht nur echt, mit all den Risiken, die ein Segeltörn mit sich brachte, sondern auch noch illegal. Kein Surrogat, sondern die volle Erfahrung eben. Eine Woche hatten sie von Singapur aus benötigt, wo sie durch die riesigen Flutmauern gen Osten gesegelt waren. Es kam ihr ewig vor, dass sie an der Marina auf den Steg des kleinen Yachthafens gelaufen waren, scherzend und johlend ob des anstehenden Abenteuers. Immer wieder hatte Guowei auf der folgenden Fahrt den Kurs geändert, um sie aus den Radarbereichen der großen Roboterschiffe herauszubringen, die wie schwimmende Städte mit ihren Containern beladen am Horizont entlangzogen.
Jetzt waren sie beinahe an ihrem Ziel angekommen: dem versunkenen Jakarta. Es schälte sich bereits in Form dunkler Monolithen aus dem Horizont und hob sich von dem graubraunen Matsch Javas ab. Die etwas unheimliche indonesische Hauptinsel – angeblich lebten dort noch einige Landtiere wie Affen, Lemuren, Wildschweine und sogar Schlangen – lag bereits seit Tagen zu ihrer rechten. Nach dem Zusammenbruch des Landes hatten sie vermutlich die durch das menschliche Massensterben freigewordenen Lebensräume rasch besetzen können. Sie fragte sich unwillkürlich, wie denn ihr natürlicher Lebensraum in einigen Jahren aussehen würde. Ob es wirklich der Arbeitsmarkt war mit all den Planzielen, den sich stetig wandelnden Technologien und ständigen Umschulungen? War sie wirklich dafür gemacht? Wollte sie so leben?
Die ultimative Sinnsuche am Ende der Welt, dachte sie, und der Spott, den sie gegenüber sich selbst spürte, legte sich unangenehm als Druck in ihrem Magen ab. Du bist viel zu jung für eine Midlife-Crisis.
Mit jeder Welle, die ihr Katamaran durchpflügte, kamen sie ihrem Ziel näher. Aus dunklen Schemen wurden nach und nach eckige Klötze, von denen einige über hundert Meter aus der Wasseroberfläche ragten. Es waren die Kronen der Hochhäuser, die einst Indonesiens wirtschaftliches und kulturelles Zentrum dominiert hatten. Jetzt waren sie die letzten Überbleibsel einer der ersten Städte, die dem Klimawandel zum Opfer gefallen waren. Guowei programmierte den finalen Kurs ein zu jenem Tauchspot, den er im Deepnet in einem Forum für Taucher entdeckt hatte, die so eine Art Geocaching betrieben. Die Steuersoftware des Bootes manövrierte sie daraufhin artig durch die ersten Ausleger Jakartas: die eher flachen Betonriesen, in denen die wachsende Mittelschicht der Stadt gewohnt hatte. Die Fenster waren leer, das Glas von Wind und Wellen zerstört. Eine gespenstische Ruhe lag über der versunkenen Metropole, die zu einer tiefen Stille wurde, sobald sie sich dem Zentrum näherten, wo die Wolkenkratzer des ehemaligen Finanzdistrikts sich dichter aneinanderreihten. Das Meer war hier ruhiger als draußen, und die kleinen Wellen und sanften Strömungen gluckerten und seufzten zwischen den Ruinen mit ihren gähnend leeren Augen.
»Echt gespenstisch«, befand Daniel, und Luise erschrak. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass er sich hinter sie gestellt hatte.
»Ja«, erwiderte sie und sah an einem von Algen und Schimmel bedeckten Hochhaus empor, das links an ihnen vorbeizog wie das Bein eines Riesen. Sein Schatten verdeckte für eine Minute die Sonne, während sie lautlos an ihm vorbeifuhren. »Denkst du, dass sie uns erwischen?«
»Nein, das denke ich nicht. Dieses Gebiet gehört zur chinesischen Schutzzone, und die haben noch nie viel Interesse an den versunkenen Städten Südostasiens gezeigt. Ich wette, dass hier schon eine Menge Abenteuertaucher hergekommen sind. Werden sie erwischt, dann zahlen sie eben Bestechungsgelder. Oder erklären den Behörden, wer ihr Vater ist.« Luise wusste, dass er auf Guowei anspielte, dessen Vater ein erfolgreicher Manager bei Tencent war. »Und wenn mal jemand verschwindet, dann sind sie ohnehin fein raus, weil keine Versicherung dafür aufkommen wird, wenn jemand in ein Sperrgebiet gesegelt ist.«
»Wie beruhigend«, sagte sie.
»Siehst du das da?«, fragte Daniel, und Luise drehte sich zu ihrem Kommilitonen um, damit sie seinem ausgestreckten Zeigefinger folgen konnte. Er deutete auf ein Hochhaus, dessen Spitze zwanzig oder dreißig Stockwerke aus dem Wasser ragte und gerade zwischen zwei näher stehenden Gebäuden vorbeizog.
»Ein weiterer Wolkenkratzer?«
»Nein, nein, auf dem Dach war etwas. Warte, ich schicke es dir.«
Luise erhielt eine Anfrage in ihrem Headmemory von einem als verlässlich markierten Kontakt. Sie nahm an, und kurz darauf öffnete sich eine visuelle Referenz, die ihr einen Punkt auf dem Dach des Gebäudes markierte – aus einer etwas anderen Perspektive, schließlich war Daniel größer als sie und stand hinter ihr.
»Was ist das? Sieht aus wie eine Antenne und da drunter … ist das ein Mensch?«, fragte sie überrascht und erschrocken zugleich. Als sie instinktiv zurückschreckte, wäre sie beinahe über die Reling ins Meer gestürzt, hätte Daniel sie nicht geistesgegenwärtig aufgefangen.
»Ach was, deine Augen spielen dir einen Streich. Entspann dich«, erwiderte er, als sei nichts geschehen. Im selben Moment drehte der Katamaran sanft und führte sie durch die beiden Hochhäuser hindurch auf genau jenen Wolkenkratzer zu, den sie eben angestarrt hatten. Sobald sie durch die Schatten fuhren, sahen sie wieder zum Dach hinauf, konnten jedoch aufgrund des veränderten Winkels nichts mehr erkennen.
»Leute, macht euch fertig!«, rief Guowei vom Steuerruder am Heck. Erst jetzt bemerkte Luise, dass Vanessa immer noch auf dem anderen Ausleger lag, als würde sie sich sonnen, obwohl es in den Schatten der Giganten aus Beton und Stahl kaum noch direkte Sonneneinstrahlung gab.
Gemeinsam mit Daniel kletterte sie über den Ausleger an den Wanten vorbei zu ihrem chinesischen Freund, der ihr Tauchequipment bereits vor der Leiter vorbereitet hatte. Sie zogen sich nackt aus und streiften dann ihre Skinsuits durchs Wasser, indem sie sich in die Reling hängten. Es war einfacher, sie anzuziehen, wenn sie nass waren, so viel wusste Luise schon über das Tauchen. Nachdem sie auch ihre Flossen und die BCD-Weste mit dem Sauerstofftank übergezogen hatte, griff sie nach ihrer blauen Tauchermaske und dem Schnorchel, die in einem Eimer mit Süßwasser lagen.
»Vanessa?«, fragte Guowei. »Wir wären dann so weit.«
»Geht schon mal ohne mich, ich will mich noch ein bisschen entspannen.«
»Was? Wir haben nur einen Tauchgang. Wir können froh sein, wenn wir nicht mittendrin von einer Patrouille aufgegriffen werden.«
»Ich habe keine Lust.«
»Lasst sie«, brummte Luise. »War doch klar, dass sie am Ende kneift.«
Daniel und Guowei warfen sich einen kurzen Blick zu und zuckten dann nach kurzem Zögern mit den Achseln.
»Gut, gehen wir«, sagte Guowei. »Das wird großartig!«
»Wir haben da oben auf dem Dach was Komisches gesehen«, entgegnete Daniel und deutete an der verwitterten Fassade entlang nach oben.
»Was denn?«
»Keine Ahnung, sah jedenfalls seltsam aus.«
»Nun ja, es gab keinen Alarm, und ich höre noch keine Drohnen heranrauschen, also war es vermutlich nichts Wichtiges.« Luise fand, dass Guowei klang, als wolle er sich selbst davon überzeugen, aber auch sie hatte nicht vor, wegen so einer Kleinigkeit kurz vor dem Ziel einen Rückzieher zu machen.
»Wir sind doch zum Tauchen hier, oder? Also: Tauchen wir!«
»Das ist mein Mädchen«, sagte Guowei und grinste über beide Ohren. Daniel zuckte mit den Achseln und setzte ein Lächeln auf, auch wenn ihr sein letzter Blick nach oben nicht entging.
Sobald sie ihre Masken aufgesetzt hatten, gaben sie sich das Okay-Zeichen, indem sie Daumen und Zeigefingerspitze zusammenbrachten, und sprangen über die Leiter am Heck hinab in die warme Javasee.
Zuerst sah Luise nichts als weiße Luftbläschen vor ihrem Gesicht, doch dann hob ihre aufgeblasene BCD sie auch schon wieder über die Wasseroberfläche. Sie hielt den Deflator mit der rechten Hand hoch und drückte den Knopf, mit dem sie die Luft aus der Weste lassen konnte. Kurz darauf sank sie wie ein Stein hinab. Sobald ihr Kopf im Wasser war und sich das Meer über ihrem Scheitel sammelte, wurde es still, und nur noch das gleichmäßige, hohle Rauschen ihres Atems drang an ihre Ohren. Vor ihr sah sie Guowei und Daniel lautlos durch das dunkle Blau hinabgleiten wie versenkte Statuen.
Die Umgebung, in die sie hinabtauchten, war von der ersten Sekunde an befremdlich und beklemmend. Das Hochhaus war wie eine schwarze Wand, vor der sie in die Dunkelheit hinabglitt, nur um bei einem Blick nach unten festzustellen, dass es dort nicht nur dunkler wurde, sondern vor allem auch gruseliges Zeug herumstand: verlassene Autos, so rostig und von Algen überwuchert, dass man sie bloß noch an ihrer Form erkennen konnte, Fahrräder, die an Straßenschildern abgestellt waren, und jede Menge Schlamm, Schlick und Unrat. All das war keine vierzig Meter unter ihr und zeugte vom Untergang einer ganzen Stadt. Die Zwanzigmillionenmetropole war evakuiert worden, nachdem der erste Versuch einer Flutmauer im Jahr 2030 gescheitert war. Große Teile der Stadt waren abgesackt wie bei einem Erdbeben.
Als die erste skelettierte Wasserleiche an ihr vorbeischwebte, erschrak Luise so heftig, dass sie zu strampeln begann und sofort Auftrieb bekam. Einzig das beherzte Eingreifen von Guowei und Daniel bewahrte sie davor, sich ernsthafte Dekompressionssymptome einzuhandeln.
Beruhige dich, sendete Daniel per Textnachricht an ihr Headmemory. Dass es aufregend werden würde, wussten wir doch.
Schon, antwortete sie und atmete tief durch ihr Mundstück ein, hielt die Luft an und atmete ganz langsam wieder aus, um sich zu beruhigen. Aber das sind verdammte Leichen!
Ja. Schon irre. Das hier war einmal ein bedeutender Handelsknoten in Südostasien. Bis das Meer sich alles zurückgeholt hat.
Wie poetisch, dachte sie spöttisch, und ihr Headmemory übersetzte die Gedanken in Text.
Tja, wenigstens etwas, das die Algorithmen uns noch nicht entrissen haben.
Hey, Leute, sendete Guowei. Seht ihr das?
Luise sah es. Unter ihnen, etwa zehn Meter entfernt, leuchtete ein winziges rotes Licht. Es befand sich bei einer Tür im Erdgeschoss, wo der breite Bürgersteig wellenförmig verzogen war. Wie drei Geister schwebten sie darauf zu, senkten sich als stumme Zeugen der Vergangenheit in dieses Massengrab hinab. Sie sah dabei nicht einen einzigen Fisch. Es gab nur noch sehr wenige Arten, die der massiven Übersäuerung der Weltmeere trotzten, doch diese lebten in den Tiefseegräben, die niemals Sonnenlicht sahen.
Bis ihre Flossen sachte den von einem Algenteppich überzogenen Grund berührten, musste sie noch zweimal Druck ausgleichen, indem sie Luft in ihre geschlossene Nase drückte. In zappelnden Wolken aus Bläschen löste sich ihre verbrauchte Atemluft aus dem Mundstück und trat den langen Weg nach oben an, wo ihr Katamaran … Moment! Wo war der Katamaran? Als sie das letzte Mal hochgeschaut hatte, waren die beiden langen Schatten der Ausleger noch exakt über ihnen gewesen.
Da ist ein Licht über der Tür, sendete Daniel und streckte wie in Zeitlupe einen Arm aus. Luise sah zu ihm und dann auf die runde Stahltür in der Fassade, die irgendwie merkwürdig aussah, weil sie geradezu glänzte und keinerlei Anzeichen von Algenbewuchs aufwies.
Man! Das ist abgefahren! Guoweis Text war großgeschrieben. Ich wusste, dass an diesen Koordinaten aus dem Forum was dran ist!
Luise sah zwischen der Tür und der Wasseroberfläche hin und her und sah auf ihrem Unterarmdisplay, dass sie doppelt so viel Luft verbraucht hatte wie geplant.
Leute, wo ist das Boot?, fragte sie schließlich, doch es kam keine Antwort, und sie wusste auch wieso: Das rote Licht über der runden Stahltür leuchtete nicht mehr rot, sondern grün, und die Stahltür öffnete sich ganz langsam zur Seite. Dahinter erwachte ein grelles Licht, das sie so sehr blendete, dass sie ihre Augenlider fest zusammenpressen musste. Nachbilder schemenhafter Silhouetten tanzten vor ihren geschlossenen Augen, und als sie sie wieder öffnete, versuchte sie zu schreien. Alles, was herauskam, war ein steter Strom an Luftbläschen, die durch die Wassermassen hinauftrieben.
Vor ihr trieb eine Gestalt, die sie aus dem Fernsehen kannte und die jeder Mensch auf dem Planeten sofort erkannt hätte: Dieumon Moreau. Er hielt ein Handterminal vor sich, den Daumen auf einem roten Knopf und lächelte selig. Auf seinem T-Shirt, das vom Wasser ganz aufgedunsen war, stand: Gehe nicht zur Marina, betrete nicht das Boot.
Inmitten all der Wasserblasen, die ihre Schreie vor ihrem Gesicht tanzen ließen, sah sie erst jetzt, dass der Billionär tot, sein Grinsen erstarrt und der Blick aus den hervorquellenden Augen gebrochen war. In seiner Brust klaffte ein Loch, und im Hintergrund, jenseits des Durchgangs, sah sie durch eine Scheibe zwei Frauen mit kurzgeschorenen blonden Haaren hinter einer Glasscheibe in Neurofeedbackanzügen liegen. Auf einem Monitor dahinter erkannte sie unklar einen blinkenden Satz: »Start erfolgreich.«
Einige Minuten später trieb eine einsame blaue Tauchermaske auf den Wellen gen Osten, ein stummer Zeuge von etwas, das nie ein Mensch erfahren würde.
1 James
James betrachtete sein Spiegelbild so eingehend, als versuche er, ein komplexes Muster zu ergründen. Die wulstige Narbe, die sich von seiner Stirn bis über die linke Wange zog wie ein senkrechter Strich – rosafarben und glänzend –, fuhr er mit einem Finger nach. Jeder Zentimeter löste eine Reihe von Emotionen aus, die sich jedoch uralt und verbraucht anfühlten. Was früher ein nicht zu bändigender Orkan gewesen wäre, war heute unter einer Schicht mühsam erlernter Selbstkontrolle verborgen.
»James!«, hörte er seinen Namen durch das Treppenhaus schallen und wischte mit der Hand vor der Wand über dem Waschbecken entlang, woraufhin sie sich entspiegelte und wieder matt wurde. »Kommst du bitte herunter?«
»Ich komme!«, rief er, wusch sich die Hände und zögerte. »Wie wird das Wetter heute?«
Die Wand verwandelte sich in ein Bild der Skyline New Yorks, über der vereinzelte Wolken dahinzogen. Der Himmel war blau.
»Für den Nachmittag sind Schauer gemeldet, einsetzend ab 16.11 Uhr mit Niederschlagsmengen von drei Millimetern. Es wird wieder trocken ab 18.02 Uhr bei Temperaturen von 17,2 Grad Celsius«, antwortete die Haus-KI in angenehmem Bariton.
»Danke«, sagte James, und das Bild verschwand. Heute war sein Tag gekommen, das wusste er. Der nächste Schritt stand bevor, war längst überfällig. Mit gestrafften Schultern verließ er das Badezimmer und kehrte in den Flur im ersten Stock des alten Farmgebäudes zurück, das seine Hosts als Rückzugsort von der Stadt nutzten. Die uralten Eichenholzdielen knarzten unter seinen formangepassten Schuhen, als wollten sie gegen seine Anwesenheit protestieren. Ehe er sich der Treppe mit dem dunklen Teppich zuwandte, machte er einen Schritt nach links und sah durch den schmalen Türspalt des Kinderzimmers in Leonies Bett. Die Fünfjährige schlief mit offenem Mund und entspanntem Gesicht unter ihrer Decke, die mit lachenden Teddybären bestickt war. Die KI überwachte zwar jeden Schritt der Kleinen, aber James hatte sich in den letzten zwei Jahren so sehr an sie gewöhnt, dass es ihn beruhigte, mit eigenen Augen zu sehen, dass es ihr gutging.
Als er ins Erdgeschoss ging und auf die Küche zuhielt, stoppte ihn die Stimme der KI, die von überall und nirgendwo zu kommen schien.
»James? Claudia und Robert erwarten dich im Wohnzimmer. Bitte schließe die Tür hinter dir, damit Leonie nicht wach wird.« Über der Tür zum Wohnzimmer blinkte überflüssigerweise ein roter Pfeil. Er zuckte mit den Achseln und folgte der Aufforderung.
Claudia und Robert saßen auf dem Sofa aus Memoryfoam, der sich ihren Körperformen angepasst hatte, so dass sie einige Zentimeter darin versanken. Unter dem alten Fachwerk und den lehmverputzten Wänden sahen sie aus wie Fremdkörper – zwei makellos schöne Menschen mit alterslosen Gesichtern und straffen Muskeln in hautenger Nanoseide. Noch vor einhundert Jahren hatten hier Bauern gelebt, die Felder bestellt und Traktoren per Hand gesteuert.
»Hallo, James«, begrüßte Leonies Mutter ihn und deutete auf den Sessel vor dem Sofa. »Bitte setz dich doch.«
Er gehorchte wie immer, ließ sich auf dem Memoryfoam nieder und spürte nicht einmal, wie sich das intelligente Material unter ihm verformte und anpasste. Es war so gemütlich, dass er am liebsten geseufzt hätte.
»Wir müssen dir etwas mitteilen«, fuhr Claudia fort und faltete die Hände auf den übereinandergeschlagenen Beinen. James mochte es nicht, wenn sie so langsam sprach, obwohl es ihm dabei half, sie zu verstehen. Zu wissen, dass sie es für ihn tat, sorgte jedes Mal dafür, dass er sich dumm fühlte, was im Vergleich zu seinen Hosts aus jedem erdenklichen Blickwinkel zutreffend war.
Da sie eine Pause machte, erwartete sie wohl von ihm, dass er etwas antwortete, also entschied er sich zu nicken.
»Wir haben deine Dienste wirklich sehr geschätzt, seit Jefferson und Sarah dich zu uns gebracht haben. Auch deine Fürsorge gegenüber Leonie war wundervoll, und wir haben es keine Sekunde lang bereut, uns damals für dich entschieden zu haben. Was wir dir jetzt sagen, tun wir nicht, weil du uns enttäuscht hättest, sondern aufgrund deiner vortrefflichen Dienste.« Claudia sah zu Robert und richtete einen ganzen Schwall Hochfranzösisch an ihn, der so schnell war, dass James schwindelig wurde. Auch diese Demonstration ihrer kognitiven Überlegenheit mochte er nicht besonders.
»Wir haben dir doch davon erzählt, dass wir heute bei passenden Voraussetzungen einen Ausflug machen werden, zu dem wir dich gerne mitnehmen möchten«, erklärte Robert und lächelte freundlich. »Es geht um ein Treffen mit einem ganz besonderen Freund von mir, den ich lange nicht gesehen habe, und wir möchten diesem Freund vorschlagen, dass du künftig bei ihm wohnst.«
Dass ich für ihn arbeite, übersetzte James für sich selbst. Er hatte keine Wahl, das war ihm klar, trotzdem nickte er, als würde er seine Zustimmung erteilen, um der Etikette Genüge zu tun. Nach zwanzig Jahren hätten sie wie Eltern für ihn sein können, doch sie waren nichts als Fremde. Schlimmer noch: Sie gehörten nicht einmal derselben Spezies an.
»Wer ist dieser Mann?«, fragte er, als ihm klarwurde, dass sie eine stärkere Reaktion von ihm erwarteten, obwohl er genau wusste, um wen es sich handelte.
»Ein sehr wichtiger in New York. Einer der besten Algorithmiker, die wir im NAB haben«, antwortete Robert mit gutmütigem Lächeln. »Es wird dir bei ihm sicher sehr gut gefallen.«
»Ich bin eine Art Bezahlung für einen Gefallen, schätze ich?« James schmunzelte in sich hinein, als sich die Augen seines Gegenübers kaum merklich weiteten, obwohl er noch immer lächelte, als wäre nichts gewesen. Es hatte seine Vorteile, wenn man schon über zwanzig Jahre bei den Verbesserten lebte und sie studierte –, egal wie schlau sie zu sein glaubten, sie waren nicht undurchschaubar.
»Ich habe dir doch gesagt, dass er klüger ist als die anderen«, sagte Claudia in perfektem Mandarin an ihren Ehemann gerichtet. Sie wechselten immer ins Chinesische, wenn sie sichergehen wollten, dass er sie nicht verstand. Das war auch der Grund gewesen, weshalb er die vermutlich schwierigste Sprache, die es gab, heimlich gelernt hatte. Obwohl sie eindeutig einen Vorwurf artikuliert hatte, lächelte sie James noch immer an, als ob nichts gewesen sei. Es war wirklich erstaunlich, wie sie das machten.
»Nur weil ich ihm beigebracht habe, wie man eine logarithmische Integration berechnet, heißt das noch lange nicht, dass er intelligent ist. Sogar ein Affe kann Memory spielen, wenn er dafür Futter bekommt«, gab Robert zurück und wandte sich wieder an James, sein Lächeln unberührt wie zuvor. Auf Englisch fuhr er fort: »Ach, mein lieber James, so ist es nicht. Wir glauben einfach, dass es dir bei ihm besser gehen wird. Er ist ein echter Nostalgiker, er sammelt Smartphones, Bücher und USB-Sticks.«
»Ach so.« James nickte und tat, als sei er nun beruhigt. »Dann danke ich euch sehr, dass ihr so gut für mich sorgt. Es ist mir eine Ehre, dass ich diese Möglichkeit bekomme. Danke für euer Vertrauen.«
»Er ist wirklich niedlich«, seufzte Claudia auf Mandarin. »Ich hätte ihn am liebsten behalten, Leonie spielt so gerne mit ihm.«
»Die Freude war ganz unsererseits.« Robert beugte sich vor und tätschelte James’ Hand – eine ungelenke Geste, als fühle er sich damit nicht wohl. »Wir treffen uns heute Abend mit unserem Freund. Sein Name ist Stuart, und er bedeutet für meine Firma möglicherweise alles. Deshalb wollen wir uns von unserer besten Seite zeigen, in Ordnung?«
»Natürlich«, versicherte James ihm und nickte ernst. Stuart Marquandt, dachte er und lächelte in sich hinein. Das wurde aber auch Zeit. »Treffen wir Stuart in einer VR-Umgebung?«
»O nein. Das Wetter sieht gut aus, und ich hatte Claudia einen Rundflug versprochen, wenn die Aussicht schön ist.« Robert bedachte seine Frau mit einem liebevollen Seitenblick. »Darum verbinden wir das Angenehme mit dem Nützlichen. Und du darfst mitfliegen, James!«
»Wirklich?«
»Ja, natürlich. Zum Abschied soll es dir an nichts mangeln, mein Lieber!«
»Das ist sehr großzügig«, sagte James und bemühte sich um eine besonders ergriffene Miene.
»Aber das ist noch nicht alles«, sagte Claudia und grinste mit diebischer Vorfreude im Gesicht. »Wir haben noch ein Abschiedsgeschenk für dich!«
»Wirklich? Das wäre aber nicht nötig gewesen!«
»O doch«, erwiderte sie und machte eine sehr gönnerhafte, wegwerfende Handbewegung, ehe sie Robert zunickte. Der ging hinüber zu der in die Wand integrierte Druckereinheit, die aussah wie ein metallisch eingefasster Hohlraum im Lehm. Auf der Unterseite gab es ein kleines Gitter.
»Sam«, sagte der Hausherr und zwinkerte James über die Schulter zu. »Stell uns bitte das Abschiedsgeschenk für unseren Freund her, ja?«
»Natürlich, Robert«, antwortete die Haus-KI und klang geradezu begeistert. »Ich bin mir sicher, dass er sich sehr darüber freuen wird.«
»Ich mir auch!« Es klickte ein paarmal an der Schwelle des Hörbaren, und dann senkte sich das Gitter von der Größe eines Suppentellers ab und tauchte wieder auf, diesmal mit einem Armband darauf. James wusste genau, was das war, und musste unwillkürlich schlucken. Nach einem kurzen Schreck stellte er zu seiner Erleichterung fest, dass Claudia gerade zu ihrem Mann geschaut und es nicht bemerkt hatte.
»Du weißt vermutlich nicht, was das ist«, sagte Robert, nachdem er das Armband genommen hatte und zu ihnen zurückkehrte. Als er sich gesetzt hatte, reichte er es James. Einen Moment lang hielten sie es beide fest, als würden sie damit Tauziehen.
»Nein«, log er. »Was ist das?«
»Das ist ein SmartMate«, kam Claudia ihrem Mann zuvor. »Eine persönliche Assistenz-KI, die alle deine Erfahrungen aufzeichnet und die Daten mit dem Deepnet teilt. Willkommen in New York.«
»Oh, das ist …«, stammelte James und tarnte sein Entsetzen als Sprachlosigkeit. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke für euer Vertrauen! Dann bin ich jetzt Teil des Datenstroms?«
»Teil des Deepnets, ja«, freute sich Robert und zwinkerte Claudia zufrieden zu. »Wir haben Sam gefragt, ob das eine gute Idee ist, und sie war sich sicher, dass du dich ganz hervorragend einfügen und die Cloud bereichern wirst.«
»Es ist mir eine Ehre.«
»Du hast es dir verdient, mein Lieber.« Robert ließ das Armband los und klopfte ihm auf die Schulter. Es war noch immer einschüchternd, in dieses makellose Gesicht zu blicken, diesem ebenso makellosen Körper gegenüberzusitzen, der so kraftvoll und alt war und eine Intelligenz beherbergte, die James nicht einmal annähernd begreifen konnte.
»Ich habe doch nur meinen Job gemacht«, erwiderte er und winkte ab. Das SmartMate wog schwer in seiner Hand, als wäre es aus Blei gegossen.
»Na los, leg es ruhig an!«, forderte Robert ihn auf und nickte.
»Ach nein, das würde ich lieber ganz in Ruhe machen, damit ich euch nicht störe. Außerdem muss ich noch das Haus putzen, bevor wir losfliegen.«
»Unsinn«, entgegnete Claudia. »Das brauchst du nicht an deinem letzten Tag. Wir regeln das schon.«
Ihr habt einen Roboter gekauft, wie die meisten anderen auch, übersetzte James. Die sind zwar nicht so niedlich wie ich, aber dafür vorhersehbar und kontrollierbar.
»Danke! Was muss ich denn tun?« Er stellte sich dumm und erntete dafür verständlicherweise herablassende Blicke. Dass sie es nicht einmal böse meinten, war das Schlimmste daran.
»Du drückst deinen Daumen auf das kleine Display, das dient als initialer DNA-Abgleich, dann ist der SmartMate auf dich geprägt. Alles andere kannst du per Sprachsteuerung erledigen. Der integrierte Algorithmus konstruiert eine artifizielle Umgebung, die alle deine Eingaben und Erfahrungen in Code umwandelt und mit dem Deepnet synchronisiert.«
»Robert«, ermahnte Claudia ihn.
»Ah, entschuldige bitte, James. Wenn es um Technik geht, dann vergesse ich mich manchmal. Ich wollte nicht so kompliziert klingen«, seufzte Robert. »Es ist so: Mit dem SmartMate bist du nie wieder allein, und jede Sekunde deines Lebens ist mit Bedeutung aufgeladen, weil du den Datenstrom bereicherst. Nichts ist bedeutungslos, verstehst du?«
»Und das Beste ist«, fügte Claudia hinzu, »dass der SmartMate nicht nur dich an das Deepnet koppelt, sondern auch das Deepnet an dich! Das heißt, dass die integrierte KI dein neuer bester Freund wird. Sie kann dir immer sagen, was die beste Entscheidung für dich ist, was dich glücklich macht. Sie wird dich bald besser kennen als du dich selbst, glaub mir.«
»Wirklich?«, fragte James ungläubig, als sei er ganz fassungslos vor Glück. »So einfach ist das?«
»So einfach ist das«, bestätigte Robert mit offensichtlichem Stolz darüber, dass er mit seinem Geschenk so zielsicher ins Schwarze getroffen hatte. Sie konnten ihn nicht lesen, worauf wiederum James nicht wenig stolz war, doch das würde sich ändern, sobald er den SmartMate aktiviert hatte. Wenn er erst einmal dem Datenstrom beigetreten war, würden sie jede seiner Hormonschwankungen, jede Hirnwelle in seinem Kopf auslesen und interpretieren. Eine Horrorvorstellung. Er musste sich eine Ablenkung ausdenken, und zwar schnell.
»Was ist, willst du es nicht ausprobieren?«, fragte Claudia, nach einer kurzen Zeit des Schweigens, und sah Robert fragend an. Der hob bloß die Schultern und zuckte dann zurück, als hätte ihn ein Blitz getroffen, als James anfing zu weinen. Es fiel ihm nicht besonders schwer, die Tränen fließen zu lassen. Es war ein ganz natürlicher Vorgang, den seine Hosts nicht verstanden, und er hatte schon vor langer Zeit sehr viel Übung darin gesammelt.
»Ichhabedirdochgesagtdasserinstabilgewordenist! Duhättestihmniemalsalldiesesachenbeibringendürfen! Einemüberflussmenschenmathematikbeizubringenistinfamimbestenfall! Dulässteinenaffendochauchnichtmiteinemmaschinengewehrspielenoder?«, schimpfte Claudia in ihrem normalen Sprechtempo mit Robert, nachdem sie ihn einige Augenblicke unsicher angestarrt hatten. »Jetztweinter! Wassollenwirdennjetztmachen? Stelldirmalvordaswäreinleoniesgegenwartpassiert! Dannwäresievollkommentraumatisiert!«
»Willstduetwainsinuierendassichschulddaranbindassereinenemotionalenausbrucherleidet? EristeinüberflussmenschwashastdudennerwartetdasssichseinIQvoneinemaufdenanderentagvervierfacht?«, erwiderte Robert ungehalten. James hatte auch bei ihm Mühe, alles zu verstehen. In ihrer Muttersprache konversierten sie so schnell miteinander, dass es seine Auffassungsgabe beinahe überstieg.
»Es tut mir leid«, schluchzte er und rieb sich mit den Daumen die Tränen aus den Augenwinkeln. »Ich wollte das nicht, es ist bloß so, dass ich noch nie solch ein tolles Geschenk bekommen habe. Genau genommen habe ich noch nie ein Geschenk bekommen. Wenn ich jetzt dieses großartige Gerät sehe, dann bin ich einfach gerührt. Bitte entschuldigt vielmals diesen Ausbruch.«
»Das ist schon in Ordnung. Wir wussten nicht, dass es so ergreifend für dich ist. Ist diese … Sache jetzt vorüber?«
»Ja, ich denke schon«, schniefte James und vermied betont den Blick zum Armband. »Vielleicht kümmere ich mich besser erst darum, wenn ich alleine bin. Schließlich möchte ich die kleine Leonie nicht erschrecken. Sie soll keinen falschen Eindruck bekommen. Nächste Woche ist schon ihre Prüfung in höherer Mathematik, nicht wahr?«
»Richtig«, bestätigte Robert nickend und rang sich ein Lächeln ab, bevor er in die Hände klatschte und aufstand, offenbar erleichtert darüber, diese Szene hinter sich lassen zu können. »Wenn du so freundlich wärst und uns zwei Taschen mit Kleidung für das Dinner heute Abend packen und sie zum Flex bringen könntest?«
»Natürlich!«, beeilte sich James zu sagen und sprang auf. Er überlegte, dabei das Armband fallen zu lassen, aber dann hätten sie ihm bloß ein neues gedruckt. Jetzt, da er seinem Ziel so nahe war, durfte er nicht riskieren, einen Fehler zu machen. Er musste alles ruhig bis zum Ende durchspielen. »Noch mal: Ich danke euch von Herzen.«
Claudia lächelte und machte eine wegwerfende Handbewegung. Ehe James sich zur Tür umdrehte, sah er gerade so aus den Augenwinkeln, wie das Lächeln aus ihrem Gesicht verschwand.
Zurück bei der Treppe nahm er die Stufen ganz vorsichtig, damit sie nicht zu sehr knarzten und Leonie aufweckten. Er war noch nicht ganz oben, als er sich das Armband vom Handgelenk riss.
»Magst du den SmartMate nicht?«
James erschrak heftig und hob den Blick, als er Leonies verschlafene Stimme hörte. Sie stand vor der obersten Treppenstufe, hielt in einer Hand ihren Teddy Trinity und in der anderen ihre Kuscheldecke Plankton. Das blonde Haar stand wirr in sämtliche Richtungen ab, und ihr Gesicht hatte den immer gleichen trotzigen Ausdruck angenommen, der sie stets mürrisch aussehen ließ. Dabei war sie ein herzerwärmend liebes Kind.
»O doch, er ist wirklich toll«, versicherte er ihr, nachdem sich der Schreck gelegt hatte, und zwinkerte ihr zu. »Deine Eltern sind wirklich sehr großzügig.«
»Nee«, machte die Fünfjährige. »Sie wollen nicht, dass ich Razor Mania spiele! Immer muss ich in die Lernumgebungen gehen, obwohl alle meine Freunde Razor Mania spielen. Das ist wirklich unfair!«
»Was habe ich dir gesagt? Erst die Arbeit, dann die VR.« James fuhr ihr durch die Haare, was sie mit einem finsteren Blick quittierte. Trotzdem nahm sie die Hand, die er ihr hinstreckte, nachdem sie Plankton und Teddy mit einiger Mühe zwischen die Finger der anderen geschoben hatte.
»Machen wir einen Ausflug?«, fragte Leonie, während sie zu ihrem Zimmer gingen.
»Ja, wir machen einen Flug nach New York.«
»Oh, wirklich?«
»Wirklich! Aber nur, wenn du artig deine Lernumgebung abschließt. Level sechs, oder?«
»Level sieben!«, rief sie empört.
»Level sieben schon?«, fragte er beeindruckt. »Macht ihr da schon Differentenrechnung?«
»Differentialrechnung«, korrigierte sie ihn, und die Beiläufigkeit, mit der eine Fünfjährige ihn ins intellektuelle Abseits stellte, versetzte ihm einen Stich. Obwohl es nicht das erste Mal war, konnte er sich daran einfach nicht gewöhnen. Es würde nicht mehr lange dauern, dann würde sie mehr Sprachen als er beherrschen, mehr Fremdwörter kennen und ihn in Politik, Geschichte und so ziemlich allem anderen in den Schatten stellen – von Naturwissenschaften ganz zu schweigen.
»Ah, natürlich. Du wirst den Test bestehen, keine Sorge.«
»Tom wird mich schon daran erinnern«, versicherte Leonie ihm und tippte mit Trinitys Nase auf ihren eigenen SmartMate. »Ich hoffe, dass ich bald ein Headmemory bekomme, dieses alte Ding ist wirklich langsam.«
»Du hast ja in nicht allzu ferner Zukunft Geburtstag, ich bin sicher, dass du dich so lange gedulden kannst.« In Wahrheit wurde James schlecht bei dem Gedanken, dass dem kleinen Mädchen, das er wirklich liebgewonnen hatte, ein elektronisches Gerät in den Schädel implantiert werden würde. Als er den Zug hinter sich gelassen und in New York zu arbeiten angefangen hatte, waren die Regeln noch anders gewesen. Implantate hatte es erst gegeben, wenn die Kinder – beziehungsweise Jugendlichen – ausgewachsen waren, damit es nicht zu Komplikationen kam. Mittlerweile hatte sich die Technik sprunghaft weiterentwickelt, die Buchsen wurden jetzt aus morphenden Materialien gebaut, die sich im Nanosekundenbereich an das sie umgebende Gewebe anpassten.
»Fliegst du mit uns?«, fragte Leonie hoffnungsvoll und begann, aufgeregt auf und ab zu hüpfen, als er nickte. Dabei sah sie für einen Moment lang aus wie das kleine Kind, das sie eigentlich war, trotz all der genetischen Verbesserungen, die man ihr pränatal spendiert hatte. Dass es das letzte Mal sein würde, dass sie einander sahen, sagte er ihr nicht.
2 Adam
Die jungen Fische gingen als Erste an Land. Nach siebzehn Stunden Fahrt in Zug 117 und noch einmal fünfzehn Stunden Wartezeit, weil draußen ein Supersturm tobte, waren sie ganz hibbelig. Nicht die alten Fische, sie saßen oder lagen noch in ihren Betten oder standen in den vielen dunklen Winkeln des Waggons, um sich mit gedämpften Stimmen zu unterhalten.
Adam war einer der jungen Fische und hüpfte aufgeregt vor der roten Tür auf und ab, über der ein kleines gelbes Lämpchen leuchtete, das eben noch rot gewesen war.
»Nicht so weit vorlaufen, Adam, hörst du?«, rief seine Mutter Maeve ihm zu. Sie stand irgendwo vor den Nasszellen, aber er konnte sie nicht sehen, weil ihn die anderen Kinder so dicht umdrängten. Also beschränkte er sich auf ein fröhliches Nicken und verfiel in ein langgezogenes »Ahhh«, als das Lämpchen plötzlich grün aufflackerte und die verstärkte Rolltür erst knackte und ächzte und sich dann nach oben hin öffnete.
»Was denkst du, wo wir sind, Adam?«, fragte seine beste Freundin Utah, die direkt neben ihm stand. Ihre kleinen Hände hielten sich fest umschlossen und erdeten ihn und seine Aufregung zumindest ein klitzekleines bisschen.
»Ich weiß nicht«, gab er zurück und reckte den Kopf von rechts nach links, um einen ersten Blick auf die Landschaft zu erhaschen, doch die Kinder vor ihm mussten schon dreizehn oder vierzehn Jahre alt sein, so groß wie sie waren. »Vielleicht in Kanada?«
»Kanada?«
»Ja. Mom hat gesagt, dass es dort echten Schnee gibt.«
»Schnee?«
»Ja, das ist, wenn Gott aus dem Regen Watte macht.«
»So wie die Füllung in unseren Kissen?«, fragte Utah und machte ein erstauntes Gesicht.
»So hat sie gesagt.« Er nickte aufgeregt. Die jungen Fische standen so dicht um sie herum, dass sie sich kaum noch bewegen konnten. Als das Rolltor beinahe die Hälfte seines viel zu langen Weges nach oben hinter sich gebracht hatte, ging ein geradezu ekstatisches Zittern durch die Gruppe. Es war ansteckend. Adam konnte das Kribbeln in seinen Händen spüren, dieses Flattern in seinem Magen, dass es gleich losgehen würde.
Als es denn geschah, war es wie ein Dammbruch. Das Rolltor war gerade hoch genug, dass die vorderen Reihen sich nicht den Kopf stießen, und schon platzten die jungen Fische an Land – wie von einem unsichtbaren Wasserfall getragen. Adam hielt Utahs Hand ganz fest, und sie sprangen gemeinsam hinab auf einen knirschenden Kiesboden. Sie mussten schnell rennen, um nicht von den nachrückenden Kindern erdrückt zu werden. Seine Beine fühlten sich vom vielen Sitzen und den wenigen Bewegungsmöglichkeiten im Zug schwer an, aber diese Schwere schüttelte er rasch ab. Seine Begeisterung trug ihn wie auf Schwingen.
Wie eine Einheit scherten die beiden flink nach links aus, folgten der wilden Hatz an der Seite und liefen Slalom um die riesigen Beine einer Metallspinne herum, der sie keinen zweiten Blick schenkten. Sie hatten nur Augen für die Ausgabe.
Die Ausgabe war ein so großer Container, dass sogar die Spinnen dagegen klein aussahen. Eine Hälfte war wie ein großes Fenster und besaß einen breiten Schlitz, vor den die Flut junger Fische anbrandete. Hände wurden hochgereckt, und das Geschrei war laut. Die Geister hinter dem Schlitz spuckten in stetem Rhythmus flache Päckchen mit buntem Aufdruck aus, die von den vielen Fingern geschnappt wurden. Jeder nahm nur eines, weil sonst die Spinnen böse brummten, und machten sich davon.
Endlich gelang es Adam mit Utah im Schlepptau, sich ganz nach vorne zu drängeln und die freie Hand nach dem Schlitz auszustrecken. Dafür musste er sich auf die Zehenspitzen stellen und bemerkte zum ersten Mal, dass der Boden auffällig nachgab. Es war nicht wichtig. Nicht jetzt, wenn sie Zucker bekamen.
»Zuckaaa!«, riefen einige der jungen Fische, die ungeduldig nachdrängten. Der Ruf war ansteckend. »Zucka! Zuckaa!«
Adam musste sich gegen den Rücken eines anderen Jungen drücken, da er von hinten angeschoben wurde und kaum noch Luft bekam. Doch dann geschah es endlich: Etwas, das sich wie eine Verpackung anfühlte, berührte seine nach oben gereckte rechte Hand, und er schnappte mit den Fingern zu wie eine Schlange mit ihrem Kiefer.
»Ich hab’s!«, frohlockte er und riss den flachen Beutel herunter, um ihn sich gegen die Brust zu drücken. Ein Seitenblick zu Utah verriet ihm, dass sie leer ausgegangen war, aber von zwei deutlich größeren Fischen beinahe zerdrückt wurde, die ungeduldig wurden und sich vordrängelten.
Kurzentschlossen zwängte er sich zwischen ihnen hindurch und drückte seine Freundin aus der Menge heraus. Sie protestierte nicht, sondern japste nach Luft, sobald sie dem Pulk aus Leibern entkommen waren.
»Ich habe keinen Zucker!«, stöhnte Utah entgeistert und machte ein langes Gesicht.
»Hier!« Er wedelte mit seinem flachen, runden Beutel, auf den ein einfaches weißes ›Z‹ gedruckt war. »Du kannst die Hälfte von mir abhaben.«
»Wirklich?« Die Enttäuschung in ihren Augen verwandelte sich in Begeisterung. Adam konnte förmlich sehen, wie die Sorge von ihr abfiel.
»Klar.« Er nahm wieder ihre Hand, die er im Gedränge verloren hatte, und lief mit ihr an dem Container vorbei nach links. Zum ersten Mal sah er sich dabei um, befreit von der Aufregung, jetzt wo er seinen Zucker hatte. Der Zug hatte inmitten einer Brachlandschaft gehalten, die von knöcheltiefem Matsch bedeckt war. In der Entfernung sah er eine Bergkette hinter einem dichten Schleier nasser Luft. Wälder gab es keine, anders als bei ihrem letzten Stopp. Lediglich ein Feld aus verkohlten Baumstümpfen erstreckte sich auf der ansonsten tundraähnlichen Landschaft. Sechs Spinnen standen wie ein Spalier zwischen Ausgabecontainer und Zug, der sich nach Süden die Gleise entlangschlängelte wie ein klobiger Wurm. Die Roboter waren mindestens doppelt so groß wie die Erwachsenen und machten Adam Angst. Manchmal träumte er davon, wie sie ihn aus dem Zug zerrten und mit ihm davonliefen. In Wirklichkeit bewegten sie sich allerdings sehr behäbig und vorsichtig. Seine Sorge, dass sie mit ihren Metallbeinen auf ihn treten und ihn zerschmettern könnten, hatte sich nie bewahrheitet.
»Denkst du, dass das hier ein Sturm war?«, fragte Utah und zog ihn zu einem umgestürzten Baumstamm, auf den sie sich setzten. Von hier konnten sie mit ein wenig Abstand das Gedränge vor dem Ausgabecontainer verfolgen. Sie hatten dieses Mal Glück gehabt, dass ihr Waggon direkt davor gehalten hatte. Von vorne und weiter hinten am Zug rannten noch immer junge Fische herbei, riefen »Zucka! Zuckaaa!«. Von hier aus sah es beinahe komisch aus.
»Bestimmt.« Adam nickte und riss den Zuckerbeutel auf. Die fingerdicke Oblate zog er geradezu andächtig aus dem entstandenen Riss und warf das Papier fort. Er brach die dunkelbraune Masse in der Mitte durch und reichte Utah eine Hälfte. Sie klatschte freudig in die Hände und umarmte ihn, bevor sie sich das eine Ende in den Mund steckte und darauf zu kauen begann. Adam tat es ihr gleich und genoss die herrliche Süße und den Geschmack auf seiner Zunge. Laut dem alten Karpfen handelte es sich dabei um Blaubärgeschmack. Er hatte zwar keine Ahnung, was ein Blaubär sein sollte, aber er schmeckte wirklich phantastisch. Eine Drohne mit vier kleinen Rotoren sauste über sie hinweg, und zwei weitere gesellten sich aus der anderen Himmelsrichtung hinzu, bevor sie zu dritt zum weit entfernten Heck des Zuges davonjagten.
»Boaaah!«, machte Utah und strahlte vor Begeisterung. »Voll tief!«
»Mhm«, schmatzte er und sah den Fluggeräten nach, die über die Köpfe der vielen tausend Fische hinwegflogen, die sich entlang der Gleise zum Ausgabecontainer bewegten. Adam fand, dass sie wie die Pinguinherde aus seinem Buch Boubaka, der Pinguin aussahen. »Es regnet hier bestimmt oft.«
Utah betrachtete das matschige Umland und nickte. »Besser als die Wüste im Süden. Ich hasse den Sand.«
»Ich mag ihn. Er kitzelt zwar, aber dafür ist es immer warm, und ich muss nicht frieren.«
»Wir haben doch die Jacken aus dem letzten Wagen.«
»Ja, schon«, gab er zu und lutschte lange an seiner halben Oblate. »Aber sie sind so eng.«
»Die Wolken sehen hier irgendwie komisch aus«, wechselte Utah das Thema und deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger nach oben. Adam folgte ihrer Geste und musterte die dunklen Wolkenberge, die sich über ihnen auftürmten wie graue Watte. Wenn es wirklich einen Supersturm gegeben hatte, dann gehörten sie bestimmt dazu und zogen fort. Er konnte immer noch in seinen Armen und Beinen das Wackeln und Vibrieren des Waggons spüren, während sie darauf gewartet hatten, dass das Wetter vorbeizog.
»Es regnet nicht«, stellte er schließlich fest und schlürfte einen Tropfen Süße auf, der von seiner Unterlippe über das Kinn ausbüxen wollte. Als ihr Zug das letzte Mal in einem Regengebiet gehalten hatte, hatte sich ein hässlicher roter Ausschlag auf seiner Haut gebildet. Bis die Medikamente aus dem letzten Wagen kamen, dauerte es beinahe zwei Tage, in denen er sich wund gekratzt hatte.
Den Rest ihres Zuckers lutschten sie schweigend. Die Drohnen aus dem ersten Waggon schwärmten nun deutlich zahlreicher durch die Luft, und der Zug setzte einige hundert Meter zurück, nachdem alle Insassen ausgestiegen waren. Auf der anderen Seite der Gleise konnte Adam jetzt einen riesigen Fabrikkomplex aus rotem Backstein und Wellblech ausmachen. In einigen der Wände klafften große Löcher.
»Was ist das?«, fragte Utah staunend. »So viele Gebäude!«
»Ich weiß nicht«, gab Adam zu und nuckelte gedankenversunken an seiner Oblate, bevor er aufstand und sich auf wackeligen Beinen auf den umgestürzten Baumstamm stellte, um besser über die Wartenden hinwegsehen zu können. »Das sieht aus wie eine Stadt!«
»Nee. Eine Stadt ist doch ganz anders. Da gibt es viele Türme!«
»Vielleicht ist es eine kleine«, schlug er vor und ließ den Blick über den großen zerfallenen Komplex schweifen. »Aber hier lebt keiner mehr, glaube ich.«
»Denkst du, dass die Menschen hier auch in einen Zug umgezogen sind?«
»Bestimmt. Vielleicht gab es bei ihnen keinen Zucker mehr oder keinen Download.«
»Glaubst du wirklich, dass es Orte ganz ohne Download gibt?«
»Der alte Karpfen hat das mal gesagt.« Adam zuckte mit den Achseln und hüpfte von dem Baumstamm hinab, um sich wieder neben sie zu setzen.
»Ach, der erzählt immer so komische Sachen von früher. Ich glaube, er ist sehr verwirrt«, sagte Utah und schüttelte den Kopf. »Papa sagt, dass er wegen seines Alters so ist. Angeblich ist er schon siebzig!«
»Guck mal!«, rief Adam aus und zeigte auf eine Gestalt in weißer Kleidung, die aus einer Tür auf der Rückseite des Ausgabecontainers stieg. Es handelte sich um eine Frau mit langen blonden Haaren, deren schwarze Stiefel und Handschuhe einen scharfen Kontrast zu ihrem weißen hautengen Einteiler bildeten. Sie ging im Matsch in die Hocke und überwand die fünf Meter bis zum Dach mit einem einzigen Satz.
»Woooah«, machten er und Utah gleichzeitig und starrten der Administratorin mit offenem Mund hinterher. Die Menge vor der Ausgabe war bereits ruhiger geworden, aber jetzt, wo die weiße Frau zu sehen war, verstummten auch die letzten Rufe. Stattdessen wurden nun noch mehr Hände nach oben gereckt, als versuchten sie alle, die Administratorin zu berühren, obwohl sie unerreichbar über ihnen stand. Sie hob die Arme und nickte einige Male in jede Richtung, bevor sie zu sprechen begann.
»Bürger von Zug 117, ich begrüße euch an eurem neuen Einsatzort. Wir danken euch für euren Dienst für den nordamerikanischen Bund! Euer letzter Einsatz ist schon etwas länger her, aber das liegt nur daran, dass ihr so wunderbare Leistungen erbringt, dass die Administration für euch die besten und wichtigsten Orte reserviert.«
Die Menge klatschte und jubelte. Sobald die Administratorin wieder die Arme hob, wurde es erneut ruhig. Ihre Stimme war laut und durchdringend.
»Unsere Aufgabe besteht darin, die Überreste dieser Chemiefabrik hinter euch zu entfernen. Sie verschmutzen unsere wunderbare Umwelt und verpesten die Luft, die unsere Kinder atmen.«
Buhrufe wurden laut, und die Administratorin nickte, bevor sie eine kurze Pause einlegte.
»Bürger von 117: Weil dieser Einsatz wichtig ist, habe ich etwas für euch ausgehandelt. Als bester Zug in diesem Herbst könnt ihr wirklich stolz sein. Darum gibt es morgen einen Download der Stufe zwei und nach unserem Einsatz hier einen weiteren der Stufe eins für alle. Wie klingt das?«
Wieder jubelte die Menge, und auch Adam und Utah hüpften von ihrem Baumstamm, um aufgeregt mit den Armen zu wackeln.
»Download! Download! Download!«, skandierten sie vor dem Ausgabecontainer, und ihre Rufe dröhnten so laut, dass es bestimmt noch in den Wolken zu hören war. Die Downloads waren nicht für Kinder, aber es gab immer welche von den jüngeren Erwachsenen, die sie gegen einen Teil ihrer Rationen für ein paar Minuten mit ihren VR-Linsen spielen ließen. Adam liebte es ganz besonders, im Meer zu schwimmen, und freute sich schon darauf, endlich erwachsen zu sein und selbst zum Download gehen zu dürfen, statt am Fenster zu stehen und zuzusehen, wie es die großen Fische taten.
»Ich freue mich mit euch«, verkündete die Administratorin, und man konnte beinahe hören, wie sie dabei lächelte. »Aber ich habe noch mehr gute Nachrichten mitgebracht.«
»Oooh! Aaah!«, machte die Menge.
»Aufgrund eures Fleißes und eurer großen Entbehrungen für unser Land habe ich ein neues Medikament mitgebracht. Direkt aus den Laboren in San Francisco.«
»San Francisco! San Francisco!« Zuerst wurde der Name der Stadt gerufen, dann ehrfürchtig gewispert.
»Die Administration hat gesagt: Ohne Zug 117 hätten wir niemals die Chance bekommen, der Klimakatastrophe, die die Chinesen uns eingebrockt haben, so lange zu trotzen. Wir sind die Opfer eines Betrugs, meine Freunde, aber die Administration lässt sich das nicht bieten. Sie akzeptiert nicht, dass ein Regime des Bösen in Asien unsere Umwelt zerstört und unsere Downloads zu blockieren versucht. Sie sagt: Nein! Nicht mit uns!«
Die Menschen zwischen Ausgabecontainer und Gleisen jubelten und pfiffen. Wütende Rufe mischten sich darunter, und Adam sah einige Fäuste, die gen Himmel gereckt wurden. Als sich die Aufregung wieder etwas gelegt hatte, nickte die Administratorin, bevor sie weitersprach.
»Weil euer Zug, liebe Freunde von 117, nie aufgibt und sich als mutiger und tapferer als alle anderen herausgestellt hat, seid ihr die Ersten, die das neue Medikament aus San Francisco bekommen. Es handelt sich um eine Tablette gegen Krebs und gegen Ausschlag, damit der saure Regen, der aus China zu uns herüberzieht, eurer Haut nichts mehr anhaben kann. Wie klingt das für euch?«
Nun kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Viele Männer und Frauen warfen begeistert ihre Arme in die Luft. Einige begannen »N.A.B.«, die Abkürzung für Nordamerikanischen Bund, zu skandieren. Adam hatte lange Zeit eine Mütze mit den drei Buchstaben und ihrer Landesfahne mit den roten und weißen Streifen und dem großen Stern auf blauem Grund besessen.
»N.A.B.!«, rief er aus voller Kehle, und auch Utah folgte seinem Beispiel. Es war berauschend, mit der Menge einzustimmen, mitzuschwingen und all die Anspannung und Langeweile der letzten Tage herauszubrüllen. »N.A.B.! N.A.B.! N.A.B.!«
Die Administratorin reckte immer wieder eine Faust hoch und nickte unentwegt, bis sie beschwichtigend die Hände hob und sich die Menge etwas beruhigte. Adam grinste Utah begeistert an und stopfte sich den Rest seiner Oblate in den Mund.
»Wichtig ist, dass wir diesen Arbeitseinsatz beenden und die Ruinen der alten Fabrik entfernen. Sie stammt aus einer Zeit, bevor die Administration unser Land wieder stark gemacht und verteidigt hat. Lassen wir nicht zu, dass dieses Symbol überkommener Schwäche unsere Natur weiter kaputt macht. Arbeiten wir heute und belohnen uns mit dem Download!«
Erneut riefen vereinzelte Männer und Frauen geradezu ergriffen »Download!«, doch dieses Mal nur kurz, denn die Spinnen setzten sich in Bewegung. Sie liefen geschickt durch die Menge und kletterten mit ihren mechanischen Beinen auf den Zug, wo sie die wuchtigen Transportcontainer öffneten, um die Arbeitswerkzeuge herauszuholen.
Adam und Utah waren noch zu klein, um zu arbeiten. Erst in einigen Jahren, mit sechzehn, durften sie selbst mitmachen. Er hasste den Gedanken, dass es noch so viele Jahre dauerte. Die Arbeit sah zwar nicht besonders spannend aus – stundenlang mit Spitzhacken auf Steine und Metall eindreschen und dann die Trümmer mit Schaufeln und Schubkarren zu den Spinnen bringen –, aber dafür gab es Zucker und den Download. Adam wollte wieder mit den bunten Schildkröten schwimmen und durch Wälder spazieren, und zwar länger als ein paar Minuten. Dafür würde er härter und länger arbeiten als die Erwachsenen. Die wurden immer so schnell müde und schlecht gelaunt.
»Gleich geht die Arbeit los«, seufzte Utah. »Was machen wir?«
»Komm, wir fragen eine Spinne, bis wohin wir spielen dürfen.«
»Boah, du willst mit einer Spinne sprechen?« Seine Freundin machte große Augen.
»Natürlich!«, sagte er großspurig und hoffte, dass sie nicht aus seiner Stimme heraushören konnte, wie aufgeregt er war. Die Vorstellung, sich vor einen riesigen Roboter zu stellen, der so bedrohlich aussah, ließ ihm die Knie zittern. »Thekla, die Schwester vom dicken Bill, hat gesagt, dass sie schon mit einer geredet hat.«
Adam hielt ihr eine Hand hin, die sie erst argwöhnisch musterte, doch schließlich achselzuckend ergriff. »Ist gut. Ich komme mit. Lieber spreche ich mit einer Spinne, als wieder einen Schlag zu bekommen.«
»Genau.« Es fröstelte ihn, als er daran zurückdachte, wie sie im letzten Winter zum ersten Mal zu weit vom Einsatzort fortgelaufen waren, um einen kleinen Vogel zu verfolgen. Am Rande eines großen stinkenden Moors hatte sie plötzlich ein unsichtbarer Schlag getroffen und ihnen die Haare zu Berge stehen lassen. Seine Mom hatte ihm daraufhin erklärt, dass die Welt sehr gefährlich sei, wenn sie sich zu weit vom Zug entfernten. Der alte Karpfen hatte etwas von Strom erzählt und ›den verdammten Faschisten‹, aber Adam hatte nicht verstanden, wovon der grauhaarige Kauz eigentlich sprach.
Adams Blick fiel auf eine Spinne, die neben dem Ausgabecontainer stand, keine hundert Meter von ihnen entfernt. Dreimal atmete er tief durch und straffte dann die Schultern, reckte das Kinn hoch und ging los, Utahs Hand fest von seiner umschlossen. Die Wärme ihrer Berührung gab ihm Mut, zumal er auf keinen Fall einen Rückzieher machen durfte, jetzt, wo er sich so weit aus dem Fenster gelehnt hatte.
Mit schmatzenden Geräuschen ihrer Stiefel im Schlamm setzten sie einen Fuß vor den anderen, und mit jedem Schritt fiel es ihm schwerer, bis sie schließlich vor einem der acht massigen Beine der Spinne standen. Ihr Rumpf war groß und aus braunem Metall. An der Vorderseite klebte eine Schüssel mit mehreren Augen, die sich daraus vorwölbten und das Tageslicht reflektierten.
Unsicher, was er tun sollte, räusperte Adam sich und klopfte dann mit den Knöcheln seiner rechten Hand vorsichtig gegen das vor ihm stehende Bein. Es war steinhart und kalt. Als sich die Spinne rasch drehte und dabei herumwirbelte, erschrak er heftig und stürzte auf den Hosenboden. Einige der umstehenden Wartenden begannen zu lachen und zu kichern.
»Alles okay?«, fragte Utah und half ihm zurück auf die Füße.
»Ja«, brummte Adam und warf den Erwachsenen einen wütenden Blick zu. Er würde es ihnen schon zeigen! Gegen Tränen anblinzelnd, die sich hinter seinen Augen zu stauen begannen, stemmte er seine Fäuste in die Hüften und sah der Spinne direkt in ihr gruseliges Gesicht. Angst, die in ihm aufschrie und Panik auslösen wollte, kämpfte er mit seinem Zorn und seiner Sturheit nieder.
»Hallo, Spinne«, sagte er schließlich und war stolz darauf, wie fest seine Stimme klang.
»Hallo, Bürger«, antwortete der Roboter. Er klang beinahe wie ein Mensch. Ein Mann, um genau zu sein, ein bisschen wie der alte Karpfen. »Wie kann ich dir helfen?«
»Ich will fragen«, meinte Adam und warf einen Blick voller Genugtuung zu den Erwachsenen, »bis wohin wir spielen können.«
»Danke für deine Frage, Bürger. Der gesicherte und autorisierte Bewegungsbereich beträgt dreihunderteinundzwanzig Meter rechts und links der Bahnschienen und maximal fünfhundert Meter vor und hinter dem jeweils ersten und letzten Waggon.«
»Danke für diese Antwort.« Adam nickte, wie die Großen es immer taten, und sah mit stolzgeschwellter Brust zu den Erwachsenen, die sich lächelnd wieder abwandten. Warum sie lächelten, wusste er nicht, vermutlich hätten sie es sich selbst nicht getraut und versuchten jetzt, ihre Scham zu überspielen.
»Wow«, freute sich Utah und grinste ihn breit an. »Du hast wirklich mit einer Spinne geredet!«