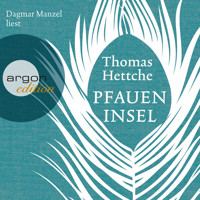11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein einsames Haus in den Bergen und eine Naturkatastrophe, nach der ein Schweizer Kanton sich plötzlich lossagt von unserer Gegenwart: »Sinkende Sterne« ist ein virtuoser, schwebend-abgründiger Roman, in dem eine scheinbare Idylle zur Bedrohung wird und der uns tief hineinführt in die Welt der Literatur selbst. Thomas Hettche erzählt, wie er nach dem Tod seiner Eltern in die Schweiz reist, um das Ferienhaus zu verkaufen, in dem er seine Kindheit verbracht hat. Doch was realistisch beginnt, wird schnell zu einer fantastischen, märchen-haften Geschichte, in der nichts ist, was es zu sein scheint. Ein Bergsturz hat das Rhonetal in einen riesigen See verwandelt und das Wallis zurück in eine mittelalterliche, bedrohliche Welt. Sindbad und Odysseus haben ihren Auftritt, Sagen vom Zug der Toten Seelen über die Gipfel, eine unheimliche Bischöfin und Fragen nach Gender und Sexus, Sommertage auf der Alp und eine Jugendliebe des Erzählers. Grandios schildert Hettche die alpine Natur und vergessene Lebensformen ihrer Bewohner, denen in unserer von Identitätsfragen und Umweltzerstörung verunsicherten Gegenwart neue Bedeutung zukommt. Im Kern aber kreist die musikalische Prosa dieses großen Erzählers um die Fragen, welcher Trost im Erzählen liegt und was es in den Umbrüchen unserer Zeit zu verteidigen gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thomas Hettche
Sinkende Sterne
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Thomas Hettche
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Thomas Hettche
Thomas Hettche wurde in einem Dorf am Rande des Vogelsbergs geboren und lebt in Berlin. Seine Essays und Romane, darunter »Der Fall Arbogast« (2001), »Die Liebe der Väter« (2010), »Totenberg« (2012) und »Pfaueninsel« (2014) wurden in über ein Dutzend Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Premio Grinzane Cavour, dem Wilhelm-Raabe-Preis, dem Solothurner Literaturpreis und dem Josef-Breitbach-Preis. Sein letzter Roman »Herzfaden« (2020) stand auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis und wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein einsames Haus in den Bergen und eine Naturkatastrophe, nach der ein Schweizer Kanton sich plötzlich lossagt von unserer Gegenwart: »Sinkende Sterne« ist ein virtuoser, schwebend-abgründiger Roman, in dem eine scheinbare Idylle zur Bedrohung wird und der uns tief hineinführt in die Welt der Literatur selbst.
Thomas Hettche erzählt, wie er nach dem Tod seiner Eltern in die Schweiz reist, um das Ferienhaus zu verkaufen, in dem er seine Kindheit verbracht hat. Doch was realistisch beginnt, wird schnell zu einer fantastischen, märchenhaften Geschichte, in der nichts ist, was es zu sein scheint. Ein Bergsturz hat das Rhonetal in einen riesigen See verwandelt und das Wallis zurück in eine mittelalterliche, bedrohliche Welt. Sindbad und Odysseus haben ihren Auftritt, Sagen vom Zug der Toten Seelen über die Gipfel, eine unheimliche Bischöfin und Fragen nach Gender und Sexus, Sommertage auf der Alp und eine Jugendliebe des Erzählers.
Grandios schildert Hettche die alpine Natur und vergessene Lebensformen ihrer Bewohner, denen in unserer von Identitätsfragen und Umweltzerstörung verunsicherten Gegenwart neue Bedeutung zukommt. Im Kern aber kreist die musikalische Prosa dieses großen Erzählers um die Fragen, welcher Trost im Erzählen liegt und was es in den Umbrüchen unserer Zeit zu verteidigen gilt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: Giovanni Segantini, »The Punishment of Lust«, 1891; © National Museums Liverpool/Bridgeman Images
ISBN978-3-462-32124-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
1
Wie der Wind losbrach und an mir zerrte, als ich aus dem Auto stieg. Wütend fuhr er mir ins Gesicht, dass mir die Luft wegblieb, beißend kalt tobte er um mich her wie eine Hundemeute, die etwas bewachte, von dem ich nicht wusste, was es war. Wie die dürren, langen Äste der Lärchen dumpf aneinanderkrachten und sich brausend schüttelten. Ich fürchtete mich, als wäre ich wieder das Kind, das ich hier gewesen bin, und beeilte mich, durch die Schneereste die Treppe hinab zum Haus zu kommen, während der Wind über mich hinwegfauchte. Er kam über den Berg und fegte über das Dach, fing sich in den Mauerecken, griff in die geschlossenen Läden, die klapperten und in ihren Scharnieren quietschten, und verebbte mit hohlem Seufzen in der Türlaibung, in die ich mich hineinpresste, um ihm zu entgehen. Als ich wieder zu Atem gekommen war, wagte ich einen Blick hinab ins Tal. Noch glomm der Himmel rot über dem Scherenschnitt der fernen Gipfelkette im Westen, doch schon verschwand der stumpfe Stein im Dunkel der anbrechenden Nacht. Nur das Weisshorn, auf dem der Schnee niemals schmilzt, zog das letzte Licht gespenstisch an und leuchtete fahl herüber, als gäbe es dort oben, auf seinem Gipfel, einen anderen Tag.
Spinnen hatten ihre Netze in den Türsturz gewebt, zusammengebackener goldgelber Flor aus Lärchennadeln im windstillen Schatten der Schwelle. Ich schloss die Augen. Im Wagen, wusste ich, tickte noch der heiße Motor von der Fahrt herauf, doch er würde leiser werden und kalt und schließlich verstummen, und dann würde es sein, als hätte der Wagen immer schon hier gestanden, auf diesem Parkplatz am Rande des Lärchenwaldes hoch über dem Tal der Rhone. Erst ein halbes Jahrhundert ist es her, dass man die Straße in die Bergflanke gesprengt hat, mal schmaler, mal breiter, mit Ausweichstellen und Serpentinen und Brücken, von der Stadt im Talgrund ins Dorf herauf und weiter bis hierher zu dem Maiensäß auf tausendfünfhundert Meter. In einer sanften Kurve legt sie sich um den Hügel, hinter dem sich die kleine Schar Häuser vor den Ostwinden verbirgt, und endet auf dem Parkplatz vor einer Phalanx von einem halben Dutzend verrosteter Garagentore. Daneben ein Gebäude aus Sichtbeton mit Rampen und Treppen aus feuerverzinkten Stahlgittern, auf dem Dach die durchhängenden Kabel einer Seilbahn, die in den Wald hinein verschwinden. Ihr Betrieb wurde schon kurz nach der Eröffnung in den siebziger Jahren als unrentabel wieder eingestellt, und nur zwei der Chalets hat man tatsächlich gebaut, die sich auf jenem bunten Prospekt des Architekturbüros über den ganzen Hang verteilt hatten, der meine Eltern damals dazu bewog, eines davon zu kaufen. Aufgewachsen bin ich in der westdeutschen Provinz, aber als Kind habe ich alle Ferien hier verbracht.
Ich strich über das Lederläppchen, das der Vater eines Tages über das Schloss genagelt hatte, ich stand als Knabe dabei. Jetzt klappte ich es hoch, und es brach mürbe um die verrosteten Nägelchen herum ab. Das ist der Beweis, dachte ich. Beweis wofür? Dass es mich gibt? Vorsichtig steckte ich den Schlüssel ins Schloss, das tatsächlich nicht verstopft war und sich schließen ließ, als wäre ich nur kurz weggewesen und nun wieder zurück. Noch einmal hielt der Vater die Zeit an, wie er es für mich als Kind immer getan hatte. Doch die Tür klemmte. Wieder und wieder rüttelte ich am Türgriff, warf mich mit aller Kraft gegen das Türblatt.
Mein Rütteln setzte sich fort im Innern des Hauses, lief eilig durch die lange verlassenen Räume, verteilte sich im dunklen Flur und in den beiden Schlafzimmern, im Muff der Daunendecken auf den alten Matratzen und den vergessenen Playmobiltieren in meinem Kinderzimmer, ein Löwe, eine Giraffe, ein Bär, im Bad an der Nordseite des Hauses, zwei grüne Waschbecken an der bis zur Decke ebenso grün gekachelten Wand, runde Spiegel über den Becken und Lampen aus Rauchglas, die Zahnputzgläser in verchromten Wandhalterungen darunter und der ebenso verchromte Dorn für den kleinen Magneten, den die Mutter immer nach unserer Ankunft fast als Erstes in das neue Seifenstück gebohrt hatte. Auf der Ablage Vaters Nassrasierer, angetrocknete Bartstoppeln noch zwischen den Klingen. Als Kind hatte ich ihm gern beim Rasieren zugesehen, irgendwie entblößt stand er da in seinem Feinrippunterhemd vor dem Spiegel, den weißen Schaum auf den Wangen, und wie er den Rasierer über die Haut führte und immer wieder unter dem laufenden heißen Wasser abspülte. Lange hatte ein letzter Tropfen am Wasserhahn gehangen in dem verlassenen, unendlich stillen Haus, unentschieden, ob er fallen solle oder nicht, bis er verdunstet war.
Die Eltern hatten großen Wert darauf gelegt, dass auch in diesem Neubau alles ihrer Vorstellung eines Schweizer Chalets entsprach, die Decken holzgetäfelt und von Zierbalken überspannt, breite Dielen und ein offener Kamin, eine Kommode mit Bauernmalerei, um den rustikalen Esstisch Stühle mit herzförmigen Ausschnitten in den Lehnen und eine Lampe mit rotkariertem Stoffschirm darüber. An den Wänden längst farbstichig gewordene Fotos von Murmeltieren, vom Weisshorn und der Bella Tola. Ich warf mich gegen die Tür, und das Wummern drang bis in die dunklen Ecken hinter den Möbeln, wo die Chitinpanzer unzähliger Generationen von Insekten den Fußboden bedeckten. Der Staub auf dem Tisch, auf den Stühlen. Der eisige Stein des schon ewig ausgekühlten Kamins. Auf der Anrichte das glimmende blaue Kristallglas des schweren Aschenbechers. Wenn es sonnig war, huschte seit Jahr und Tag ein Lichtstreifen unter den Läden des großen Südfensters herein und wischte über den Boden hin wie das lautlose Pendel einer unsichtbaren Uhr.
Wie früher mit den Eltern hatte ich die A5 nach Süden genommen, die Grenze in Basel überquert, hatte Bern passiert und die Autobahn schließlich bei Spiez verlassen, linkerhand der Thunersee, war ins Kandertal hinaufgefahren und dann auf dem offenen Pritschenwagen des Autozuges durch den Lötschberg transportiert worden, der den Kanton Bern vom Kanton Wallis trennt. In meiner Kindheit habe ich diese Fahrt geliebt, und der Gedanke an sie ist so etwas wie mein Einschlaflied gewesen, das mich bei jeder Gelegenheit beruhigte, in meinen kindlichen Verzweiflungen und auch später immer dann, wenn ich mir vorstellte, vor irgendetwas in meinem Leben fliehen zu müssen und wieder wie als Kind im völligen, Dunkel des Berges zu verschwinden, durchgerüttelt auf den alten Schienen, während vor den Autofenstern der nackte Fels vorüberhuscht, dessen Konturen nicht mehr sind als ein Glimmen im Schwarz. Die Zeit scheint in diesem Rasen lange nicht zu vergehen, bis endlich die Helligkeit des Tunnelausgangs zunächst einen zähen Moment lang nur zu ahnen ist, nichts als eine Empfindung von Helligkeit, die sich dann bestätigt, einen leuchtenden Punkt im Schwarz setzt, in den der Zug sich hineinzustürzen beginnt, bis das Licht von der anderen Seite des Berges den Stollen schließlich ganz erhellt und man wieder hinausfährt in den Tag.
Aber diesmal war alles anders. In vorsichtigem Schrittempo fuhr der Zug in eine Art Stahlkäfig hinein, und während noch die Bremsen quietschten, hörte ich polternde Stiefel auf den Pritschen, dann tauchte ein Soldat neben dem Seitenfenster auf, seine große Stabtaschenlampe tastete den Innenraum des Wagens ab und verharrte schließlich mit blendendem Licht einen Moment auf meinem Gesicht. Mit einer knappen Geste bedeutete der Uniformierte, die Scheibe zu öffnen. Wie ich sicher wisse, sei die Einreise ins Wallis reglementiert, erklärte er, und ich beeilte mich, ihm meinen Ausweis und den Brief hinauszureichen, den ich vor zwei Wochen erhalten hatte. Der Soldat las ihn mit steinerner Miene, nickte mir dann zu und lief grußlos weiter. Er arbeitete sich den ganzen Zug entlang, drei andere Soldaten, Maschinenpistolen im Anschlag, folgten ihm dabei.
Ich atmete tief durch, als sich der Zug wieder in Bewegung setzte, aus dem Käfig hinausfuhr und den Bahnhof Goppenstein erreichte, unter dessen aufwendigen Betonsubstruktionen aus Pfeilern und Rampen für Gleise und Zufahrten sich im Sommer ein Flüsschen bergab stürzt, und die im Winter unter meterhohem Schnee verschwinden. Wie immer fuhren die Wagen im Schrittempo von den Pritschen herunter, doch die Glasfront des Kiosks mit den öffentlichen Toiletten war bis auf schmale Sichtschlitze zugemauert, und die bunten Reklameschilder für Eis und Snacks waren verschwunden, mitten auf dem Rangierplatz ein auffälliger Soldat, ein muskulöser Hüne mit rotem Barett, der etwas von einem Landsknecht hatte, breitbeinig und unbeweglich, die Hände in die Hüften gestützt. Über ihm flatterte die rotweiße Walliser Fahne mit den dreizehn Sternen an einem Mast, den man in den Asphalt gesetzt hatte. Mit ungeduldigem Winken forderte er mich zum Weiterfahren auf, und ich beeilte mich, der Aufforderung Folge zu leisten.
Irgendwann, als ich Serpentine für Serpentine die steile Straße ins Tal hinabfuhr, erspähte ich dann weit unten zum ersten Mal den See. Langsam rückte er immer näher. Alles, was ich über das Unglück gelesen hatte, ging mir dabei durch den Kopf, und ich spürte meine zunehmende Beklemmung. Kurz über dem Örtchen Steg endet die Straße einfach im Wasser, verschwindet hinab in den Ort, den es nun nicht mehr gibt. Die Wagen stauten sich auf einem improvisierten Parkplatz, Soldaten wiesen uns ein, ich stieg aus. Offenbar warteten wir auf eine Fähre. Ich sah einen stählernen Ponton, der in den See hineinragte, dahinter die Dachhaube des Kirchturms im düsteren Wasser, das grau und milchig unter tiefen Wolken an das schwappte, was nun sein Ufer ist, und konnte nicht aufhören, in dieses kalte Grau zu starren, erst das Hupen der anderen Wagen riss mich aus meinen Gedanken.
Der See war auch das Erste, woran ich denken musste, als ich am nächsten Morgen erwachte, unendlich beruhigend stieg das alte Aroma meines Kinderzimmers aus der Bettwäsche, die so lange unberührt im Schrank gelegen und in die ich mich am Abend verkrochen hatte. Ich warf die schwere Daunendecke von mir und tappte nackt durch das Haus. Es war noch eiskalt vom Winter in den seit Jahren ungeheizten Räumen, aber durch die große Schiebetür im Wohnzimmer kam die Sonne herein, vor Kälte zitternd öffnete ich sie, trat hinaus auf den Balkon und stellte mich in das wärmende Licht. Der Himmel war strahlend blau, die Luft windstill, vom Sturm des gestrigen Abends nichts mehr zu spüren. Der Frühling kam, doch auf den Gipfeln ringsum, bis hinab zur Baumgrenze, lag noch blendender Schnee. Darunter das breite, südliche Tal, in das ich hinabsah wie in eine Spielzeugwelt. Der mäandernde Fluss und die Dörfer, die Straßen zwischen ihnen, die Aprikosenplantagen, an den Hängen der Wein, darüber der Lärchenwald, der im Herbst golden wird. Wie als Kind suchte ich rhoneabwärts die beiden Burghügel von Sion, die Hoteltürme und Liftanlagen von Crans-Montana und ahnte in der Ferne Martigny, wo einst die römische Legion der Provinz Vallis Poenina stand. Dort führt der Weg zum Großen Sankt Bernhard hinauf und über den Pass nach Italien.
Und talaufwärts der See. Ich versuchte mich an die Berichte über den Bergsturz zu erinnern, an die Bilder, die durch die Medien gegangen waren, von dem verheerenden Murgang, durch den das ganze Tal blockiert worden war. Ich hatte die Katastrophe kaum zur Kenntnis genommen und mir nicht einmal das genaue Datum gemerkt. Die Rhone hatte sich wohl in Windeseile aufgestaut, ein halbes Dutzend Dörfer war im Wasser versunken, der Lötschbergtunnel geflutet worden, es hatte Tote gegeben. Und nun glitzerte der See, der dabei entstanden war, dort unten in der Sonne, als wäre er immer schon dort, die Kantonalstraße nur noch eine Erinnerung, die Weiler Gampinen und Agarn verschwunden. Das Wasser leckte den Schwemmkegel am Illgraben hinauf bis gen Feithieren und Pletschen, und irgendwo bei Leuk, direkt unter mir und deshalb nicht zu sehen, endete wohl die Wasserfläche, deren bedrohliche Gleichgültigkeit machte, dass ich nicht aufhören konnte hinabzustarren. Ein Falke tauchte auf und begann in weiten Schwüngen über dem Tal zu kreisen. Und als ich mich frierend endlich von seinem Anblick losmachte und wieder hineinging ins Haus, stand mir im Glas der Schiebetür plötzlich mein Spiegelbild gegenüber. Mitleidig betrachtete ich mein weißes Fleisch, meine weiche Brust und wie mein Bauch sich über mein Geschlecht wölbte, und wusste, es hätte mich weniger überrascht, wäre statt meiner tatsächlichen Gestalt die jenes Jungen im Glas aufgetaucht, der ich hier einmal gewesen bin.
Alles war wie immer, und doch hatte sich offensichtlich etwas grundlegend verändert. Die Soldaten mit den Maschinenpistolen, der Stahlkäfig, der Landsknecht mit dem roten Barett unter der Walliser Fahne. Der See. Mein Telefon hatte keinen Empfang. Den ganzen Tag ging ich mit dem Blick auf das Display von Zimmer zu Zimmer, vor das Haus, auf den Parkplatz, immer wieder auf den Balkon, doch das Telefon blieb offline, und ich starrte hinab auf den See, als wäre er mit der Stille im Bunde. Schaltete das alte Küchenradio ein, doch über das ganze Frequenzband war nur Rauschen zu hören, die analogen UKW-Sender waren längst abgeschaltet. Einen Fernseher haben meine Eltern nie besessen. Schließlich blieb ich vor dem alten Festnetztelefon stehen. Ich selbst hatte den Vertrag nach dem Tod meines Vaters gekündigt. Und doch nahm ich den orangenen Hörer mit dem Spiralkabel ab, und meine Hand erinnerte sich im selben Moment wieder daran, dass er ein wenig schwerer wird, wenn die Kontakte ganz herausgeglitten sind. Eingeholt von der Vergangenheit, presste ich gegen jede Logik die Muschel ans Ohr. Sinnlos, wie routiniert mein Zeigefinger in die Löcher der Wählscheibe fasste, sie drehte, losließ und wartete, während sie mit einem klackenden Geräusch zurückschnurrte, bevor ich die nächste Nummer wählte. Die Leitung war tot.
Die Stille hatte die Farbe der Nacht und legte sich mir so kalt auf die Haut, dass es mich ängstigte. Drunten im Tal stieg jetzt das Schwarz aus dem Spiegel des unheimlichen Sees. Meretschihorn, Schwarzhorn, Rothorn, zählte ich mir die Namen der jetzt unsichtbaren Gipfel draußen vor dem Fenster auf und goss mir ein Glas von Vaters Pinot ein, von dem ich noch ein paar Flaschen gefunden hatte. Das schwarze Display des Smartphones auf dem Couchtisch zeigte dieselbe Nacht wie das große Fenster zum Balkon. Daneben lag der Brief aus Leuk, den ich vor zwei Wochen erhalten hatte. VORLADUNG prangte über dem Anschreiben. Ich sei als deutscher Staatsbürger und Besitzer einer Parzelle in der Gemeinde Leuk gemäß Artikel 276 GemG–SGS/VS175.1 verpflichtet, auf dem Gemeindeamt Leuk, Rathausplatz 1, persönlich zur Einvernahme zu erscheinen. Datum und Uhrzeit. Unterzeichnet von Jesko Zen Ruffinen, Kastlan von Leuk und Bannerherr der Sieben Zenden. Immer wieder wanderte mein Blick zu dem Wappentier der Stadt im Briefkopf, dem Greifen mit dem erhobenen Schwert.
Das Schreiben war der Anlass herzukommen, aber nicht der Grund. Wenige Tage, bevor ich es im Briefkasten fand, hatte mich die Vizepräsidentin der Universität in ihr Büro gebeten und mir erklärt, man sehe, so leid ihr das tue, keine Perspektive mehr für mich an der Hochschule. Es sei meine Verantwortung als Lehrender, einen offenen Raum zu gestalten, in dem die Studierenden konstruktiv, abwägend, mit angemessenem Ton und Sensibilität an einen Diskurs herantreten und daran teilhaben könnten. Meine Fixierung auf Texte eines westlichen Kanons, mein Beharren auf überholten Qualitätsvorstellungen und mein sexistischer Sprachgebrauch verunmögliche das jedoch. Es habe Proteste gegeben. Die Odyssee, versuchte ich eine hilflose Entgegnung, ich hätte ein Seminar zur Odyssee angeboten. Das Lächeln der Vizepräsidentin schwebte starr in der Luft.
Jede Kulturrevolution versteht den moralischen Terror, den sie ausübt, wie Robespierre als Ausfluss von Tugend. Ein Satz Pasolinis schoss mir durch den Kopf: Io sono una forza del passato. Was denn aus meinen Studenten werde, fragte ich. Es handle sich ja wohl, wenn sie richtig informiert sei, nur noch um einen Studierenden, entgegnete die Vizepräsidentin trocken, und damit hatte sie natürlich recht. Am Semesteranfang war nur eine Handvoll Studenten im Seminar erschienen und nach drei Wochen lediglich Dschamīl übriggeblieben. Wir hatten weitergemacht, als wäre das ganz normal. Um ihn, einen syrischen Flüchtling, den ich für begabt hielt, tat es mir leid. Dennoch hatte ich genickt, und damit war das Gespräch beendet gewesen. Als der Brief aus Leuk kam, hatte ich ohne nachzudenken gepackt, um die Stadt zu verlassen.
Ein kalter Wind fuhr mir ins Gesicht und unter das Hemd, als ich die Balkontür öffnete und ins Dunkel hinaustrat. Der See eine opake schwarze Fläche. Ich hielt mich an der Brüstung fest, legte den Kopf in den Nacken, suchte die Sterne über dem Haus, musste an den Falken denken, den ich am Morgen gesehen hatte, und erinnerte mich wieder daran, wie verständnislos Tony Soprano seine Therapeutin ansieht, als sie seufzt: The falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The centre cannot hold. Lange habe ich nicht begriffen, dass meine Generation die letzte ist, die im amerikanischen Jahrhundert geboren wurde, dessen Ende Joan Didion in jenem Buch beschreibt, dem sie diese Verse von Yeats voranstellte. Der Falke hört den Falkner nicht. Die Dinge zerfallen. Die Mitte kann nicht halten. Das erste Mal im Kino war ich 1977, Star Wars, und als ich dreißig Jahre später, im siebten Teil, den zerstörten Sternenkreuzer aus jenem ersten Kinofilm wiedersah, begriff ich, dass dies die Trümmer meiner Jugend waren, die nun in einer neuen Gegenwart herumlagen. Die Ruinen einer Welt, an deren Zerstörung meine Generation Anteil hat. Wir haben Schuld an dem, was jetzt geschieht. Wie fasziniert wir waren von Lyotards Abgesang auf die großen Erzählungen. Wie begeistert wir Nietzsche zitierten, die Wahrheit sei ein Heer von Metaphern. Was uns interessierte, war der Raum von Freiheit jenseits jeder Moral. Doch die Klugheit des Ästhetizismus ist immer schon auch seine Dummheit gewesen.
Ich leerte die Neige aus der Flasche ins Glas und trank den letzten Schluck. Aber wann, fragte ich mich, ist meine Jugend, ohne dass ich es überhaupt bemerkt hätte, denn zu Ende gegangen? Vielleicht in jener Silvesternacht des Jahrtausendwechsels in Rom, es war warm, der Ocker der Häuser glomm, und ich war sechsunddreißig Jahre alt. Einzig besorgte uns, die Computer könnten durch Programmierfehler Schwierigkeiten mit der Zeitumstellung haben. Das Pantheon im Lachen der Menschen aus ganz Europa, das bald eine gemeinsame Währung einführen würde. Nichts wussten wir von all dem, was kommen würde. So fern diese Welt heute. Weiße Papierballons, erleuchtet von kleinen Kerzen, glitten in Schwärmen lautlos durch den Nachthimmel über die Stadt, und wir, an der Balustrade aus samtenem Travertin, sahen staunend zu, ein Glas Sekt in der Hand, vor uns die Stadt mit ihren Kuppeln. Ich erinnerte mich an Papageien, die keckernd durch die Nacht flirrten, grüne Sittiche, deren Vorfahren irgendwann ihren Besitzern entflohen sein mussten und am Tiber heimisch geworden waren.
Dichtes Brombeergestrüpp hatte das Fenster des Arbeitszimmers im Keller zugewuchert, irgendwann hat Vater wohl aufgehört, die Büsche zurückzuschneiden, konnte wohl auch nicht mehr hier herunter. Im Dämmerlicht an der Wand das kolorierte Foto meines Onkels Albert, des jüngsten Bruders meines Vaters, in Wehrmachtsuniform. Die Erzählung seines Todes 1942 in Russland war in meiner Kindheit die erste Imagination einer großen Ferne. An den Rahmen gesteckt ein altes Passbild meiner Mutter und eines der Großeltern, vielleicht aus Anlass ihrer goldenen Hochzeit. Der Großvater im Dreiteiler mit Krawatte, die Großmutter mit dünnem Haar und Dutt in schwarzer oberhessischer Tracht. Der Raum hat so gar nichts von dem Alpengepränge des Wohnzimmers, und doch hielt sich mein Vater, der sich dieses Haus eigentlich nicht hatte leisten können und den Rest seines Leben dafür arbeiten und sparen musste, am liebsten hier unten auf. Wie, fragte ich mich, hatte der Traum wohl ausgesehen, den er, der nicht Ski fuhr und die Berge immer nur von der Terrasse aus betrachtete, sich hier unbedingt hatte verwirklichen wollen?
Das Reißbrett, das den kleinen Raum fast vollständig ausfüllte, ist eines der wenigen Dinge, die Vater mitnahm, als die Eltern das Haus verkauften, in dem ich aufgewachsen bin, und hierher zogen. Seit ich denken kann, waren darauf die Konstruktionszeichnungen der Maschinen befestigt, mit denen sich mein Vater gerade beschäftigte, nun war das Blatt darauf leer. Rechts unten das Signet der Firma, für die er sein Leben lang gearbeitet hat: ein Anker in einem Kreis, die Jahreszahl 1731 und darüber BUDERUS’SCHE EISENWERKE. Diese Zeichnung ist nur zu den aus beigefügten Unterlagen ersichtlichen Zwecken bestimmt und dem Empfänger zur persönlichen Verwendung anvertraut. Sie darf deshalb nicht vervielfältigt und nicht ohne Zustimmung dritten Personen überlassen oder weitergegeben werden. Ich setzte mich an den Schreibtisch und hörte die Stille, die der Vater gehört haben muss, wenn er hier unten war, eine innere Stille, die in mir dröhnte, und erinnerte mich an jenen Moment eine Weile nach seinem Tod, als ich plötzlich spürte, wie etwas durch mich hindurchschmolz, durch mich und durch den Raum, in dem ich in diesem Augenblick war, und etwas von großer Schwere tropfte heiß ins Dunkel hinab, schmerzhaft und endgültig.
Ich war nicht hier, als er starb, und kam auch nicht zur Beerdigung, ließ alles von dem Notar organisieren, der sich schon lange um die Belange meiner Eltern gekümmert hatte. Er löste das Konto auf, und ein paar Wochen später erhielt ich eine Überweisung aus der Schweiz, die gänzlich abstrakte Summe einer Rechnung, die ohne mich gemacht worden war. Das Versprechen, ihn zu besuchen, das ich meinem Vater immer wieder gab, als er mich nach dem Tod der Mutter öfter anzurufen begann, war nicht ernst gemeint, und da Arbeit ihm stets das Wichtigste gewesen war, konnte ich mich auf sein Verständnis für meine Ausreden verlassen. Ohne dass es eine medizinische Indikation gegeben hätte, wurde er in Jahresfrist selbst zum Pflegefall. Wieder versprach ich zu kommen und tat es nicht. Irgendwann mochte er nicht mehr telefonieren, seine Pflegerin rief mich dann gelegentlich per Skype an und hielt Vater die Kamera vor das Gesicht, was ihm unangenehm war. Als ich seinen eingefallenen Greisenmund zum ersten Mal sah, ertrug ich den Anblick kaum. Die letzten Zähne waren ihm ausgefallen, und das neue Gebiss wollte nicht halten. Ich verstand kaum, was er sagte, starrte nur auf seine Zunge, die gespenstisch gewachsen zu sein und im Mund keinen Platz mehr zu finden schien. Ununterbrochen rotierte sie über die Lippen und die eingefallenen Wangen. Bei unserem letzten Gespräch war der verwaschene Frotteepullover, den er trug, voller Speisereste. Die Hörgeräte hielten offenbar nicht in den Ohren, sondern baumelten neben den Ohrläppchen, die viel größer geworden waren, wie die Zunge, dachte ich, wie bei Toten.
Ich würde nicht mehr erfahren, was ihm dieses Haus bedeutet hatte. Traurig zog ich die oberste Schublade des Schreibtisches auf. Eine Plastiklupe mit eingebautem Lämpchen, ein Locher, ein halbes Dutzend Lesebrillen mit Etuis, ein Tesaroller aus rotem Plastik, ein billiger Taschenrechner mit großen Tasten, ein stählernes Rollmaßband, ein Nagelknipser, Eukalyptusbonbons, ein alter Füller, Heftstreifen, einige Münzen, eine Pappschachtel mit Werbekugelschreibern, eine Blechschachtel der Firma Schwan-Stabilo mit Bleistiften, ein Klebestift, eine durchsichtige Dose mit Büroklammern, ein Durchschreibbuch, eine Pappschachtel mit Reißbrettstiften, eine leere lederne Brieftasche mit grünem Seidenfutter, Radiergummis, eine Schere, vertrocknete Kastanien, ein Tütchen kohlensaures Natron, ein goldenes Federmesser, ein halbes Dutzend Schlüssel, alle ordentlich mit kleinen Anhängern versehen, beschriftet mit der Handschrift meines Vaters.
Und zwischen all dem Kram plötzlich ein Schächtelchen, das mir bekannt vorkam. Ich nahm es aus der Schublade und öffnete den Deckel. Eine antike Scherbe lag darin, und sofort erinnerte ich mich wieder, wie der Vater sie mir geschenkt und wie ich sie als Kind sorgsam in dem Schächtelchen auf Watte gebettet hatte, als wäre sie kostbar. Dabei war es lediglich eine Replik aus dem Shop des Archäologischen Museums in Sion, der Kantonshauptstadt, in dem wir einmal waren. Meine Eltern gingen nie mit mir ins Theater oder ins Konzert, Kultur spielte für sie keine Rolle, insofern war jener Museumsbesuch während eines Sonntagsbummels etwas Besonderes gewesen. Wie gebannt ich die Scherbe damals in der Vitrine betrachtet und den Begleittext gelesen hatte. Der Krug, zu dem sie einmal gehörte, stammte aus dem dritten oder vierten Jahrhundert, aus Karthago oder Leptis Magna, ich erinnerte mich nicht mehr genau, jedenfalls aus einer jener prunkvollen römischen Städte am Rande der afrikanischen Wüste, wo die Karawanen der Garamanten einliefen mit dem Nachschub an Löwen und Elefanten für die römischen Arenen. Gefunden aber hat man sie hier im Rhonetal, in der Asche einer römischen Feuerstelle, die man unter der Kirche Sankt Stephan in Leuk ausgegraben hat. Ich drehte die Scherbe in der Hand und erinnerte mich, wie ich mir als Junge jenes nächtliche Feuer vorzustellen versucht hatte, im rauen Wind. Auf den Gipfeln erster Schnee. Woher kamen diese Menschen, hatte ich mich staunend gefragt, wohin waren sie unterwegs? Was wussten sie vom marmorglitzernden Leptis Magna am südlichen Meer? Eine stecknadelkopfkleine Sehnsucht spürte ich da zum allerersten Mal.