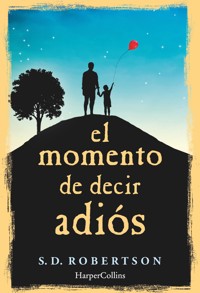7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Will hat seiner kleinen Tochter Ella geschworen, immer für sie da zu sein. Und er tut alles dafür, um sein Versprechen zu halten. Bis zu dem Tag, an dem er tödlich verunglückt. Aber selbst der Tod kann das Band zwischen Vater und Tochter nicht zerreißen. Will erhält eine letzte Chance, um Ella Lebewohl zu sagen. Doch wie kann er den Menschen ziehen lassen, dem sein Herz gehört?
"Herzzerreißend gut, mit vielen Momenten, die einen zum Lachen bringen" - The Sun
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
S. D. Robertson
Solange ich in deinem Herzen bin
Roman
Aus dem Englischen vonAllys Olsen
HarperCollins®
HarperCollins® Bücher
erscheinen in der HarperCollins Germany GmbH,
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright © 2017 by HarperCollins
in der HarperCollins Germany GmbH
Titel der englischen Originalausgabe:
Time To Say Goodbye
Copyright © S. D. Robertson 2016
erschienen bei: Avon Books
Published by arrangement with Avon,
an Imprint of HarperCollins Publishers, LLC
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner GmbH, Köln
Umschlaggestaltung: büropecher, Köln
Redaktion: Anna Hoffmann
Titelabbildung: HarperCollins; Joaquim Junior, EyeEm,
khoa vu / Getty Images; shutterstock
ISBN eBook 978-3-95967-631-1
www.harpercollins.de
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
www.readbox.net
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle handelnden Personen in dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Für Claudia und Kirsten
1. KAPITEL
14:36 Uhr, Donnerstag, 29. September 2016
Sterben stand nicht auf dem Zettel, den ich an diesem Nachmittag noch geschrieben hatte. Zweifellos hatte die Fahrerin des Geländewagens auch nicht vorgehabt, einen Radfahrer umzubringen. Aber es war passiert. Ihr riesiger schwarzer Wagen schlingerte auf mich zu – und erfasste mich frontal. Keine Zeit zu reagieren. Nur ein schreckliches Kreischen, ganz kurz das Gefühl zu fliegen und plötzlich ein lähmender Schmerz. Dann verlor ich das Bewusstsein.
Auf einmal stand ich auf dem Pflaster und sah zu, wie zwei Sanitäter darum kämpften, meinen geschundenen, blutüberströmten Körper wiederzubeleben. Verzweifelt hoffte ich, sie würden es schaffen, ich ging sogar etwas näher heran, um im richtigen Moment vielleicht wieder zurück in meine Haut springen zu können. Alles zwecklos. Minuten später wurde ich für tot erklärt.
Aber ich bin doch noch hier! sagte ich mir. Nur als was? Und dann dachte ich an Ella. Was würde mit ihr geschehen, wenn ich tot war? Sie wäre ganz allein, von beiden Eltern verlassen. Und ich hatte ihr geschworen, dass das niemals geschehen würde.
„Wartet! Gebt nicht auf!“, brüllte ich die Sanitäter an. „Nicht aufhören! Ich bin noch hier. Ihr müsst es weiter versuchen. Ihr wisst nicht, was ihr da macht! Verdammt noch mal, gebt mich nicht auf! Ich bin nicht tot!“
Ich schrie mir die Lunge aus dem Leib, bettelte und flehte sie an, weiterzumachen, weiter zu versuchen, Leben in meinen reglos daliegenden Körper zu pumpen. Aber sie konnten mich nicht hören. Für sie war ich unsichtbar und ironischerweise auch für die Schaulustigen, die sich an der Polizeiabsperrung versammelt hatten – einige fuchtelten mit Smartphones herum, ganz versessen darauf, einen Blick auf den toten Typen zu erhaschen.
Aus schierer Verzweiflung versuchte ich, einen der Sanitäter zu packen. Aber als meine Hand seine rechte Schulter berührte, wurde ich von einer unsichtbaren Kraft nach hinten geschleudert. Alle viere von mir gestreckt, lag ich auf dem Asphalt. Ich war benommen, doch komischerweise verspürte ich keinerlei körperlichen Schmerz. Ich rappelte mich auf und versuchte es mit dem Kollegen des Mannes noch mal, wieder wurde ich zu Boden geworfen. Was zum Teufel ging hier vor?
Dann sah ich die Fahrerin, die mich getötet hatte. Unter den wachsamen Blicken eines jungen Streifenpolizisten rauchte sie eine Mentholzigarette nach der anderen. „Es war ein Unfall“, sagte sie zwischen den Zügen. „Das Navi war runtergefallen und lag auf dem Boden, neben meinen Füßen. Ich wollte es nur wieder aufheben, als … Oh Gott, ich hab immer noch vor Augen, wie sein Gesicht an die Windschutzscheibe geprallt ist. Was hab ich nur getan? Kommt er wieder in Ordnung? Sagen Sie mir, dass er durchkommt.“
„Sehe ich aus, als wäre mit mir alles in Ordnung?“, fragte ich. Ich stellte mich vor sie, starrte ihr ins Gesicht und versuchte, sie durch meine Willenskraft dazu zu bringen, mich wahrzunehmen. „Hat es den Anschein, als würde ich durchkommen? Sie haben mich umgebracht. Ich bin tot. Nur wegen eines blöden Navis. Sehen Sie mich an, verflucht noch mal! Ich stehe vor Ihnen!“
Sie hätte großartig aussehen können, wäre da nicht Erbrochenes auf ihren hochhackigen Schuhen und in den geglätteten Haaren gewesen. Leichenblass war sie, und sie zitterte so furchtbar, dass ich es nicht übers Herz brachte, sie weiter zu beschimpfen. Sie wusste auch so, was sie getan hatte.
„Warum bin ich noch hier?“, brüllte ich zum Himmel.
„Weißt du, wie spät es ist?“, fragte ein Polizist den anderen.
„Gleich drei.“
Verdammt. Schulschluss. Ellas Grundschule war zu Fuß gute fünfzehn Minuten von hier entfernt; es war wie ein Reflex, ich fing an zu rennen.
Die letzten paar Nachzügler gingen gerade durchs Schultor, als ich ankam. Die Auswirkungen meines Unfalls zeigten sich bereits an einer riesigen Autoschlange, die sich die eine Spur der Vorstadtstraße entlangschleppte. In den Autos sah ich an Autofenstern platt gedrückte Nasen und neugierige Blicke. Ich hetzte zum Hinterausgang des Schulgebäudes, wo Ella warten würde, und sah sie da ganz allein stehen und verlassen vor sich hin schauen. „Hier drüben, Liebling!“, rief ich winkend und rannte über den menschenleeren Schulhof. „Es ist alles in Ordnung. Ich bin jetzt hier.“
Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Warum sollte sie mich wahrnehmen, wenn es sonst niemand konnte? Meine sechsjährige Tochter sah einfach durch mich hindurch.
Warum sollte sie mich sehen, wenn mich sonst niemand sehen konnte? Dass meine sechsjährige Tochter durch mich hindurchguckte, brachte mich ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen.
„Ella, Daddy ist hier“, sagte ich zum x-ten Mal. Ich hatte mich vor sie hingekniet, sodass wir uns von Angesicht zu Angesicht befanden, aber ich traute mich nicht, sie zu berühren, nach dem, was ich mit den Sanitätern erlebt hatte. Ihre Lippen waren rau, und ihre rechte Hand, mit der sie die Hello-Kitty-Brotdose umklammerte, war mit rotem Filzstift beschmiert. Ich schnappte nach Luft, als mir klar wurde, dass ich nicht in der Lage sein würde, sie daran zu erinnern, ihren Lippenbalsam zu benutzen, und ich konnte ihr auch nicht mehr helfen, „die dreckigen Pfoten zu schrubben“, wie wir es immer genannt hatten.
Sie merkte nicht, dass ich da war, sondern schaute erwartungsvoll zum anderen Ende des Schulhofs.
Hinter Ella kam Mrs. Afzal aus der Schultür. „Ist er immer noch nicht da, Liebes? Dann solltest du jetzt besser reinkommen.“
„Er kommt gleich“, sagte Ella zu ihrer Lehrerin. „Vielleicht ist die Batterie in seiner Armbanduhr schon wieder leer.“
„Komm. Wir gehen ins Büro und rufen ihn an.“
Panik durchzuckte mich, als ich mir vorstellte, wie mein Handy hinten im Krankenwagen klingelte, während mein toter Körper abtransportiert wurde. Wie einer der Sanitäter – noch mit meinen Blutspritzern auf seinem grünen Hemd – meine Taschen danach durchwühlte. Wie lange mochte es noch dauern, bis Ella erfuhr, was passiert war?
Ich wollte den beiden gerade ins Gebäude folgen, als mir jemand auf die Schulter klopfte. Erschrocken drehte ich mich um.
„Hallo, William. Tut mir leid, dass ich mich so angeschlichen habe. Ich … äh … ich bin Lizzie.“
Eine stämmige kleine Frau in einem trutschigen grauen Kostüm und einem beigen Trenchcoat stand vor mir, einen Arm hatte sie ausgestreckt, um mir die Hand zu schütteln. Vorsichtig, weil ich wieder einen heftigen Stoß aufs Pflaster befürchtete, griff ich nach ihrer dicklichen Hand. Trotz der ungewöhnlich warmen Septembersonne fühlte sie sich kühl an.
„Woher kennst du meinen Namen?“, fragte ich. „Und wie kann es sein, dass ich dich anfassen kann?“
„Als du gestorben bist, bin ich zu dir geschickt worden. Wahrscheinlich hast du einige Fragen.“
„Was bist du? Eine Art Engel? Das kannst du einem anderen erzählen.“
Lizzie, die grob geschätzt Ende zwanzig war, fuhr sich mit der Hand durchs wellige schwarze Haar, das im Nacken locker zusammengebunden war. Ihre Nase zuckte – ich musste an ein Kaninchen denken.
„Äh, nein. Ich bin kein Engel. Wir sind im selben Team, aber die sind weiter oben in der Hackordnung. Betrachte mich als eine Art Reiseführerin. Diese Zeit kann ziemlich verwirrend sein. Ich bin hier, um deinen Übergang vom Leben zum Tod so reibungslos wie möglich zu gestalten. Wie kommst du bis jetzt zurecht?“
„Nun ja, ich bin tot. Abgesehen von dir kann mich keiner sehen. Nicht mal meine kleine Tochter, die gleich erfahren wird, dass sie Vollwaise ist. Wie komme ich da wohl zurecht?“
„Stimmt. Tut mir leid. Kann ich irgendwas tun, um dir zu helfen?“
„Wie wär’s denn, wenn du mich wieder lebendig machen würdest und stattdessen diese verdammte durchgeknallte Autofahrerin mitnimmst? Es ist ihre Schuld, dass ich hier bin.“
Sie schüttelte den Kopf. „Das ist nicht möglich, fürchte ich. Kann ich vielleicht irgendetwas anderes für dich tun?“
„Kannst du mir helfen, mich mit Ella zu verständigen? Wenn ich wirklich ein Geist bin, kann man mich dann nicht unter bestimmten Umständen sehen? Ich muss Ella mitteilen, dass ich noch hier bin, dass ich sie nicht verlassen habe.“
„Das G-Wort benutzen wir eher nicht. Es hat zu viele negative Konnotationen. Der Begriff Seele ist uns lieber.“
„Was auch immer. Das ist Haarspalterei. Kann ich nun mit Ella reden oder nicht?“
„Sie kann dich nicht sehen oder hören. Das hast du selber gesagt. Das wird also leider nicht funktionieren. Ich bin hier, weil ich dich auf die andere Seite hinüberführen und dir zeigen soll, wie es dort läuft.“
„Und wenn ich nicht mitkommen will?“
„Hier ist nichts mehr für dich.“
„Was ist denn mit meiner kleinen Tochter? Sie braucht mich.“
„Du bist nicht mehr für sie verantwortlich, William. Du hast keinen Einfluss mehr auf ihr Leben. Du bist jetzt nur noch Seele. Was für dich auf der anderen Seite wartet, ist so unglaublich, dass es nicht in Worte zu fassen ist.“
„Du hast meine Frage nicht beantwortet. Was ist, wenn ich nicht mitkommen will? Zerrst du mich strampelnd und schreiend hinter dir her?“
„Ich bringe dich nirgendwohin, wo du nicht hinwillst.“
„Also kann ich bleiben?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Das ist deine Wahl.“
„Und wenn ich mit dir gehe? Kann ich es mir dann noch anders überlegen und wieder zurückkommen?“
„Nein. Rückreisen sind nicht vorgesehen.“
„Und wie ist es andersrum? Wenn ich jetzt nicht mit dir gehe, kann ich dann später kommen?“
Lizzie zögerte einen Moment, ehe sie nickte. „Es gibt eine Gnadenfrist.“
„Na, so kommen wir doch zusammen. Wie lange?“
„Kommt drauf an.“ Sie sah zum Himmel hoch. „Das wird ganz oben entschieden. Ich werde wieder auf dich zukommen müssen.“
„Gut. Dann komme ich auch wieder auf dich zu. Wie erreiche ich dich?“
Als ich das sagte, wurde ich vom Geplapper zweier Lehrerinnen abgelenkt, die an uns vorbeigingen. Ich drehte mich ganz kurz zu ihnen um, und als ich mich Lizzie wieder zuwenden wollte, war sie verschwunden.
Verwirrt schaute ich mich um. „Hallo? Bist du da? Kannst du mich noch hören? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Und warum kann ich keinen berühren – nur dich?“
Ich rechnete fest damit, dass sie wieder auftauchen würde, doch das tat sie nicht. „Na toll. Dann bin ich wohl auf mich gestellt.“
Ich hatte meine einzige Tochter im Stich gelassen. Ich hatte das Versprechen gebrochen, das ich ihr unzählige Male gegeben hatte. Meistens wollte sie es hören, wenn sie abends im Bett lag, mich eindringlich ansah und nach ihrer Mutter fragte.
„Daddy, du wirst mich doch nie verlassen, oder?“
„Nein, natürlich nicht, Schatz. Ich bleibe hier. Ich verlasse dich nie.“
„Versprichst du das?“
„Ich verspreche es. Aus tiefstem Herzen.“
Offensichtlich hatten sie in der Schule etwas herausgefunden. Ella wurde vom Flur vor dem Schulbüro wieder in ihre Klasse gebracht, wo Mrs. Afzal sie mit Buntstiften und Papier beschäftigte. Die Lehrerin lächelte die ganze Zeit, aber ich konnte das Mitleid in ihrem Blick sehen. Sie sagte Ella, es habe ein Problem gegeben, sie müsse noch eine Weile in der Schule warten.
„Wann kommt mein Daddy denn?“
„Ich weiß nicht genau, wie lange du warten musst, Ella. Aber ich bleibe bei dir, bis du abgeholt wirst.“
„So spät ist er noch nie gekommen. Letztes Mal, als die Batterie von seiner Uhr kaputt war, hat er sich nur ein kleines bisschen verspätet. Ich war noch nicht mal die Letzte auf dem Schulhof.“
Mrs. Afzal kniete sich neben Ella auf den Boden. „Was malst du da?“
„Eine Eiswaffel. Sehen Sie, da sind die Schokostreusel, und gleich mal ich noch rote Soße dazu. Daddy hat gesagt, ich krieg heute ein Eis nach dem Abendessen, weil bei den alten Weibern Sommer ist.“
Meine Mutter kam schließlich und holte Ella ab. Für ihre Enkelin versuchte sie irgendwie, Haltung zu bewahren, und tat so, als wäre alles ganz normal. Doch ich konnte den Schmerz in ihren Augen erkennen. Sie wusste es. Normalerweise hätte sie mit Mrs. Afzal über ihre eigene Zeit als Grundschullehrerin geplaudert. Heute nicht.
„Nana!“, rief Ella. Sie rannte auf ihre Großmutter zu und umarmte sie fest. „Ich wusste gar nicht, dass du mich heute abholst. Daddy hat sich total verspätet.“
Ich sah das Zucken im Gesicht meiner Mutter, die Ella fest an ihren schmächtigen Körper drückte. Aber sie bemühte sich, ihren Schmerz zu verbergen und sich nichts anmerken zu lassen, während sie das Schulgebäude mit Ella an der Hand verließ.
Ich ging so nah an sie heran, wie ich konnte – ohne sie zu berühren: „Hallo, Mum“, flüsterte ich ihr zu, „ich hab’s vermasselt. Es tut mir so leid. Ich brauche dich, du musst jetzt für mich auf Ella aufpassen.“
Mum fuhr Ella nach Hause. Dort setzten sie sich ins Wohnzimmer. Ich musste beobachten, wie Tränen über die Wangen meiner Mutter rollten. Ich wusste, was gleich passieren würde, und es machte mir schreckliche Angst. Aber es half nichts. Ella würde gleich die Wahrheit erfahren.
„Was ist los, Nana? Warum weinst du? Was ist los? Ist Daddy okay?“
„Nein, Schatz. Ich muss dir etwas Furchtbares erzählen.“
„Was denn? Was ist passiert? Hat er sich verletzt? Ist er im Krankenhaus?“
Die Tränen liefen in Strömen über Mums Gesicht. Ich konnte den Anblick kaum ertragen. „Es gab einen schrecklichen Unfall, mein Schatz. Daddy war sehr schwer verletzt und … es tut mir so leid … er ist gestorben.“
Einen Moment lang war Ella ganz still, dann sagte sie: „Wie meinst du das? Was für ein Unfall war das?“
„Daddy fuhr auf seinem Rad. Er ist … er ist gestürzt.“
„Gestürzt? Wie? Was hat ihn verletzt?“
„Ein Auto.“
„Wo ist er jetzt? Ist er ins Krankenhaus gekommen?“
„Nein, Liebling. Er ist gestorben. Er ist nicht mehr da. Er ist im Himmel. Bei deiner Mummy.“
Ella stand auf. „Das kann nicht sein. Er geht nachher mit mir Eis essen. Er kommt nur ein bisschen zu spät. Man darf nicht lügen, Nana. Das tut man nicht. Soll ich dir mein neues Haarband zeigen? Ich hol es mal. Es liegt in meinem Zimmer.“
Sie rannte aus dem Wohnzimmer und die Treppe hoch. Mum blieb verstört zurück.
„Geh ihr hinterher!“, rief ich.
Aber in diesem Moment klingelte Mums Handy. „Hallo? Oh, Tom, du bist es. Gott sei Dank. Bist du noch immer auf dem Polizeirevier?“
Ich ließ Mum mit Dad reden und ging nach oben in Ellas Zimmer. Vor einem Jahr hatte sie mich überredet, es leuchtend pink zu streichen. Zuerst konnte ich nicht sehen, wo sie war, dann hörte ich ein Rascheln in dem Prinzessinnenschloss, das ich ihr zum vorletzten Geburtstag geschenkt hatte. Eigentlich wollten wir das rosa Spielzelt abbauen, weil sie es schon eine Zeit lang nicht mehr benutzt hatte, so hatten wir es vor Kurzem besprochen. Doch als ich jetzt durch den Fensterschleier ins Zelt sah, hockte sie da drinnen. Sie drückte ihr Lieblingskuscheltier Kitten an sich und starrte auf den Boden.
Ich kniete mich direkt vors Fenster. „Ich wünschte, du könntest mich hören, Ella. Du bist meine Welt, mein Ein und Alles. Ich bin für dich da, und ich bleibe bei dir.“
„Ich weiß, du bist nicht tot, Daddy“, sagte sie. Ich erschrak.
„Ella?“ Ich streckte den Arm ins Zelt, um sie zu berühren, um Kontakt herzustellen – nur um im hohen Bogen durch die Luft zu fliegen und auf der anderen Seite des Zimmers mit dem Rücken an die Wand zu knallen. Wieder kein Schmerz, aber es war nun endgültig klar, dass ich niemanden berühren konnte.
„Bitte, komm bald nach Hause, damit Nana sieht, dass sie sich irrt“, fuhr sie fort, denn sie hatte gar nicht gemerkt, was eben passiert war. „Du hast versprochen, dass du mich nie verlässt. Und ich weiß, das war ehrlich gemeint. Bitte, komm nach Hause, Daddy. Ich vermisse dich.“
2. KAPITEL
Sieben Stunden tot
Mum und Dad beschlossen, die Nacht in meinem Haus zu verbringen, damit Ella in ihrem gewohnten Umfeld bleiben konnte. Sie quartierten sich in dem mickrigen dritten Zimmer ein, das kaum größer war als das Doppelbett, das darin stand. Mir wäre es lieber gewesen, sie hätten in meinem Zimmer geschlafen, aber das fanden sie unangemessen – und meine Einwände konnten sie ja nicht hören.
Ich war zunehmend verzweifelt darüber, dass mich niemand wahrnehmen konnte. Die einzige Bestätigung meiner Existenz lieferte der Hund meiner Eltern, Sam, der zusammen mit Dad eintraf. Der sonst so friedliche King Charles Spaniel bellte andauernd und lief im Kreis herum, wenn wir im selben Raum waren. Zuerst hatte ich Hoffnung, ich könnte durch ihn vielleicht Kontakt zu meiner Familie herstellen. Doch bald zeigte sich, dass die Aussichten auf ein Lassie-ähnliches Verhalten eher trübe waren. Sam war nicht gerade der schlauste Hund der Welt. Abgesehen davon hatte er schon zu meinen Lebzeiten nicht viel für mich übriggehabt, und der Tod hatte daran nichts geändert. Jeder Versuch, Sam zu meinem Verbündeten zu machen, führte nur dazu, dass er umso lauter bellte. Also gab ich es bald auf.
Einen weiteren hoffnungsvollen Moment erlebte ich, als ich feststellte, dass ich mich im Spiegel sehen konnte. Meine Mutter putzte sich gerade im Badezimmer die Zähne. Ich musste seit meinem Unfall schon an Spiegeln vorbeigegangen sein, aber jetzt bemerkte ich mein Abbild darin zum ersten Mal.
„Hey“, rief ich und hüpfte wie ein Irrer winkend auf der Stelle. „Sieh doch, Mum! Ich bin hier!“
Aber sie konnte mein Spiegelbild ebenso wenig sehen, wie sie meine Stimme hören konnte.
Ich wartete, bis Dad kam, und versuchte noch mal, auf mich aufmerksam zu machen. Als er sich die Zähne putzte und sich das Gesicht wusch, stellte ich mich direkt neben ihn. Da war ich nun, klar wie der helle Tag, direkt neben ihm. Ich bat ihn, mich anzuschauen. Aber offenbar war ich der Einzige, der mein Spiegelbild sehen konnte.
Wenigstens schien ich unversehrt zu sein. Ich war erleichtert, keine Spur von den Verletzungen entdecken zu können, die ich bei dem Unfall abbekommen hatte.
„Das fühlt sich alles so unwirklich an“, sagte Mum zu Dad, nachdem sie zu Bett gegangen waren. „Ich denke immer … ich hoffe immer … ich wache auf, und es war alles nur ein böser Traum.“
Dad nahm ihre Hand und seufzte tief.
„Ich fühle mich wie betäubt“, fuhr sie fort. „Nach dem ersten Schock, nachdem ich Ella erzählt habe, was geschehen ist, kommt es mir vor … Ach, ich weiß nicht. Als ob das alles jemand anderem passiert. Nicht mir. Warum weine ich jetzt nicht? Ich habe das Gefühl, ich reagiere nicht so, wie ich sollte.“
„Es gibt keine richtige Art zu reagieren“, antwortete Dad. „Eltern sollen ihre Kinder nicht überleben.“
„Aber wie fühlst du dich, Tom?“
Wieder seufzte er. „Ich setze einen Fuß vor den anderen. Wir müssen stark sein, für Ella.“
Ich konnte es nicht ertragen, ihrem Gespräch noch länger zuzuhören. Irgendwie kam es mir vor, als würde ich lauschen, also ging ich in Ellas Zimmer. Als ich mich neben ihr Bett auf den Boden setzte, stürzte eine Flut von Ängsten auf mich ein.
Wie in aller Welt sollte dieses zerbrechliche kleine Mädchen ohne mich zurechtkommen? Würde es mir je gelingen, zu ihr durchzudringen – und wenn nicht, wie sollte ich weiter ohne Kontakt zu ihr in dieser Zwischenwelt existieren?
Gott, ich bin tot, dachte ich. Die schreckliche Wahrheit wurde mir langsam bewusst. Ich bin tatsächlich tot. Mein Leben ist vorbei. Ich werde Ella nie wieder in die Arme nehmen. Ich werde ihr nie wieder die Haare flechten, beim Zähneputzen helfen oder eine Geschichte vorlesen. All diese kleinen Dinge, die für mich immer ganz selbstverständlich waren, sind verloren. Für immer.
Dann dachte ich an den Unfall. Warum zum Teufel war ich überhaupt mit dem Rad gefahren?
Ella hustete im Schlaf. Ich schaute auf ihr rosiges Gesicht und die blonden Locken, die zerzaust auf dem Kissen lagen. Ein Blick auf meine schlafende Tochter genügte, um mich aus dem Sumpf von Selbstmitleid herauszukatapultieren. „Hör auf damit“, sagte ich. „Hör auf, dir leidzutun. Sie ist das Einzige, das jetzt noch wichtig ist.“
Ich hatte keine Ahnung, ob Geister – oder Seelen, wie Lizzie uns nannte – schlafen konnten. Besonders müde war ich nicht. Aber ich legte mich neben das Bett auf den Boden und versuchte, einen klaren Kopf zu bekommen. Den brauchte ich am nächsten Tag, wenn ich erneut versuchen würde, Ella auf mich aufmerksam zu machen. Es dauerte eine Weile, aber schließlich dämmerte ich weg.
Am nächsten Morgen wachte ich allein in Ellas Zimmer auf. Offenbar war sie schon aufgestanden. Bestürzt stellte ich fest, dass die Tür geschlossen war. In meinem bisherigen Dasein als Seele musste ich erfahren, dass ich keinerlei Einfluss auf die Menschen und Dinge um mich herum nehmen konnte. Das hieß, ich war gefangen. Ich erinnerte mich an eine Szene aus dem Film Ghost – Nachricht von Sam, in der der Typ, den Patrick Swayze spielt, lernen muss, durch eine geschlossene Tür zu gehen. Das war eine ziemlich windige Informationsquelle, aber wonach sollte ich mich sonst richten?
Also ging ich mit vorgestreckten Armen zur Tür und versuchte, die Hände durch das Holz zu drücken. Nichts. Allerdings wurde ich nicht zurückgeschleudert wie bei dem Versuch, Ella oder die Sanitäter zu berühren. Ich kam nur nicht durch die Tür. Als Nächstes probierte ich, die Türklinke nach unten zu drücken, ebenfalls vergeblich. Weder konnte ich greifen noch Druck ausüben. Ich spürte nichts.
Bei meinem nächsten Versuch stellte ich mir bildlich vor, wie ich durch die Tür ging, wie durch etwas Flüssiges. Ich warf mich sogar schreiend gegen das Türblatt, weil ich hoffte, meine Wut würde verborgene Kräfte freisetzen. Aber nichts funktionierte. Ich saß wirklich in der Falle.
Wenig später kam Ella und holte sich einen Pullover aus dem Schrank. Da konnte ich das Zimmer auf herkömmlichem Weg verlassen.
Kurz nach dem Mittagessen hörte ich es an der Haustür klopfen. Es klang nach dem „Todesklopfen“. Ich hatte schon damit gerechnet. Zu Beginn meiner Laufbahn als Journalist hatte ich ziemlich häufig selbst an den Haustüren von hinterbliebenen Angehörigen gestanden, um aus ihrem Schicksal eine Story für die Lokalzeitung zu machen. Ich wäre niemals auf den Gedanken gekommen, dass nur wenige Jahre später meinetwegen geklopft werden könnte. Aber die Art, wie ich zu Tode gekommen war, und die tragische Konstellation meiner zurückgelassenen Familie luden die Reporter förmlich ein.
„Machst du auf, Tom?“, rief Mum von oben, wo sie Ella die Haare kämmte.
„Mach ich“, rief Dad, drückte die Zigarette aus, die er an der Hintertür geraucht hatte, und schlurfte durch den Flur. Er war ein fülliger Mann, doch er gehörte zu den Glücklichen, die eine solche Figur stattlich wirken ließ. Seinen markanten Gesichtszügen und den breiten Schultern hatte er es zu verdanken, dass er gut aussah, obwohl er viel zu viel auf die Waage brachte. Er liebte es, gut zu essen und zu trinken, und er hatte es nie eilig, irgendwohin zu kommen. Heute bewegte er sich sogar noch langsamer als sonst.
Er öffnete gemächlich die Tür – und eine attraktive junge Frau Mitte zwanzig stand vor ihm. Sie hatte ihr schönstes mitfühlendes Lächeln aufgesetzt.
„Guten Tag“, sagte sie. „Es tut mir furchtbar leid, Sie zu stören. Ich bin Kate Andrews vom Evening Journal. Wir haben von dem schrecklichen Unfall gehört, dem William Curtis zum Opfer gefallen ist. Ich wollte mich erkundigen, ob ein Familienmitglied eventuell zu einem kurzen Gespräch bereit wäre. Wir möchten einen Artikel zu seinem Gedenken veröffentlichen.“
Ich lächelte vor mich hin. „Gedenken“ – diesen Begriff hatte ich bei ähnlichen Gelegenheiten auch immer benutzt, denn ich hatte festgestellt, dass es die effektivste Art war, die Familie mit ins Boot zu holen.
Dad, der während seiner Zeit als Anwalt ein hartnäckiges Misstrauen gegen die Presse entwickelt hatte, verlangte ihren Ausweis zu sehen. Nachdem er einen Blick darauf geworfen hatte, ließ er die junge Frau auf der Schwelle stehen und zog ab, um sich mit Mum zu beraten.
„Komm schon, alter Mann“, sagte ich. Der Journalist in mir fand es unhöflich, ihr ein Interview zu verweigern. „Mach es dem Mädchen nicht so schwer.“
„Was meinst du?“, fragte er Mum. „Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.“
„Warum nicht?“
„Willst du wirklich, dass unsere Privatangelegenheiten in der Zeitung breitgetreten werden?“
„Will hätte das so gewollt, da bin ich mir sicher. Schließlich war er selbst Journalist. Es ist doch nur richtig, dass die Lokalzeitung einen Artikel zu seinem Gedenken bringt.“
„Und wenn sie nun alles verdrehen?“
„Das passiert wohl eher, wenn wir gar nicht mit ihnen reden, oder? Es wird einen Artikel geben, so oder so, Tom. Sie werden das nicht einfach ignorieren. Da ist es besser, wir bestimmen den Inhalt, soweit wir können.“
„Also, ich will nichts damit zu tun haben. Sprich du mit ihr, wenn es unbedingt sein muss. Aber lass dir keine Worte in den Mund legen und sag bloß nichts über den Unfall – erst recht nichts über die Schuldfrage. Ich gehe so lange mit Ella spazieren, ich möchte nicht, dass sie da mit reingezogen wird.“
Ich beschloss zu bleiben und mir das Interview anzuhören.
„Danke, dass Sie bereit sind, sich mit mir zu unterhalten“, sagte Kate, die an dem Tee nippte, den Mum ihr aufgebrüht hatte, ehe die beiden sich ins Wohnzimmer begeben hatten. Mum war leger gekleidet, in dunkelblauer Strickjacke und Jeans. Mir fiel auf, dass sie noch Lippenstift aufgelegt und sich die kurzen dunklen Haare gekämmt haben musste. Sie bemühte sich nach Kräften, einen gefassten Eindruck zu machen.
„Schon in Ordnung. Das scheint mir doch das Richtige zu sein, schließlich war Will auch Journalist.“
„Tatsächlich? Das wusste ich nicht. Für wen hat er denn gearbeitet?“
„Er war Reporter bei der Times. Früher war er in der Redaktion in London, aber vor sechs Jahren ist er wieder zurück in den Norden gezogen und war als freier Mitarbeiter tätig. Er arbeitet immer noch hauptsächlich für die Times – oh, er hat für sie gearbeitet –, aber er hatte auch Aufträge von anderen großen Zeitungen und einigen Zeitschriften. Es wundert mich, dass Sie ihn nicht kennen.“
Kate kam nicht zu Wort, bevor meine Mutter nicht die Geschichte meines gesamten beruflichen Werdegangs über ihr ausgeschüttet hatte, von meiner Zeit als Lokalreporter bei einer Wochenzeitung bis zu meiner bis vor Kurzem aktuellen Tätigkeit bei der Times. Irgendwann gelang es ihr aber doch, eine Frage zu meinem Privatleben einzuwerfen. Ich sah, wie ihre Augen aufleuchteten, als Mum ihr erklärte, dass ich alleinerziehender Vater gewesen war – und dass Ellas Mutter auch nicht mehr lebte.
„Ah, jetzt haben wir dein Interesse geweckt“, sagte ich und spähte ihr über die Schulter auf die stenografierten Notizen. „Ja, daraus wird eine gute Story. Wenn man Zeitungen verkaufen will, gibt es nichts Besseres als eine tragische Familiengeschichte. Wer weiß, vielleicht schafft die Story es sogar auf die Titelseite.“
„Wie verkraftet Ella das?“, fragte Kate. „Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie sie sich fühlen muss.“
Ich wurde wütend. „Spar dir dieses geheuchelte Mitgefühl!“, brüllte ich. „Halt Ella da raus. Sie ist doch noch so klein.“
Mum rutschte unruhig auf der Couch herum. „Ich … darauf möchte ich nicht eingehen.“
„Natürlich“, sagte Kate, „das verstehe ich. Wie geht es denn Ihnen und Ihrem Mann? Es muss doch ein furchtbarer Schock gewesen sein.“
Beruhige dich, sagte ich mir, denn ich war ziemlich überrascht darüber, wie schnell ich die Nerven verloren hatte. Alles okay. Mum schafft das schon. Das Mädchen macht seine Arbeit, weiter nichts. Ich hätte genau dieselben Fragen gestellt.
„Ja“, flüsterte Mum. Sie atmete ein paarmal durch, ehe sie hinzufügte: „So ganz haben wir es noch nicht realisiert. Wir sind beide noch im Schock. Keiner rechnet doch damit, seine Kinder zu überleben. Uns kommt es so vor, als würden wir auf Autopilot laufen und für Ella alles zusammenhalten.“
Sobald Kate die Informationen hatte, die sie für ihre Story brauchte, fragte sie Mum, ob sie sich für den Artikel ein Foto von mir ausleihen könne. Nun ja, eigentlich bat sie um ein Foto von mir mit Ella, aber Mum war so vernünftig, das abzulehnen. Sie kramte in ihrer Handtasche und holte eine kleine lederne Brieftasche mit Fotos ihrer Liebsten heraus. Darunter war ein altes Bild von mir, das ich nie besonders gemocht hatte. Sie starrte eine Weile darauf, und ich befürchtete schon, sie würde anfangen zu weinen. Aber nachdem sie sich ein wenig Luft zugefächert und noch ein paarmal tief durchgeatmet hatte, gewann sie ihre Fassung zurück.
„Wie wäre es damit? Es ist schon etwas älter, aber es ist ein schönes Foto von ihm. Seine schönen blauen Augen kommen darauf so gut zur Geltung.“
„Ja, das Foto ist ideal.“
„Er hat sich nicht viel verändert, abgesehen von den paar grauen Haaren, die dazugekommen sind. Die ersten hatte er schon in seinen Zwanzigern. Wahrscheinlich war das der Stress. Er war gut aussehend, finden Sie nicht?“
Ich wurde verlegen, weil Kate gar nichts anderes übrig blieb, als ihr zuzustimmen.
„Sie passen drauf auf, nicht wahr?“, sagte Mum. „Das Foto bedeutet mir viel. Ich muss es unbeschädigt wiederbekommen.“
„Selbstverständlich. Ich bringe es in ein paar Tagen zurück, wenn Ihnen das recht ist. Und noch einmal: mein herzliches Beileid. Ich hoffe, die Beerdigung verläuft erträglich.“
„Ich danke Ihnen. Sie machen etwas Nettes aus dem, was ich Ihnen erzählt habe, nicht wahr? Noch mehr Aufregung wäre wirklich das Letzte, das wir jetzt brauchen können.“
Kate setzte wieder ihr mitfühlendes Lächeln auf. „Selbstverständlich. Der Artikel erscheint morgen in der Zeitung. Auf der Website sollte er dann auch stehen.“
Nur ein paar Minuten später hörten Mum und ich Dad und Ella von ihrem Spaziergang heimkommen. Ella war in Tränen aufgelöst.
„Was in aller Welt ist passiert?“, fragte Mum, als wir beide an die Haustür gelaufen waren.
Dad hatte sich Ella über die linke Schulter gelegt, und da er außer Atem war und schwitzte, hatte er sie wahrscheinlich ein ganzes Stück des Weges getragen. An seinem rechten Arm zerrte Sam an der Leine und bellte wie üblich.
Mum nahm ihre Enkelin auf den Arm. Sie war zwar viel kleiner und dünner als Dad, aber sie war schon immer ziemlich stark gewesen. Irgendwann hatte sie angeblich auch mal geraucht, so wie er, doch ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Sie war die Gesundheitsbewusste von den beiden, achtete auf eine ausgewogene Ernährung und war wie ein kleiner Dynamo: immer in Bewegung. Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an.
„So, meine Kleine, komm mal zu Nana. Was hast du denn, mein Schatz? Was ist los?“
„Sie hat einen Schreck gekriegt, Ann. Mehr nicht. In ein paar Minuten geht es ihr wieder besser.“
„Was meinst du damit, Tom? Was hat sie erschreckt? Jetzt erzähl mir doch um Himmels willen, was passiert ist.“
„Keine große Sache. Wir haben einen schönen Spaziergang gemacht, bis … Wir sind an der alten Bahnstrecke entlanggegangen, damit ich Sam von der Leine lassen konnte. Für den Rückweg haben wir die Hauptstraße genommen. Unglücklicherweise haben wir da einen kleinen Zusammenstoß miterlebt. Ein Auto hat ein anderes beim Ausparken gestreift. Keiner hat sich etwas getan, aber es war ziemlich laut, und, na ja, es hat Ella eindeutig an das erinnert …“
„Lass gut sein, Tom, ich verstehe schon! Was hast du dir dabei gedacht? An der Hauptstraße mit ihr spazieren zu gehen! Komm, Ella. Wir setzen uns jetzt ein bisschen ins Wohnzimmer. Grandad holt dir was zu trinken. Möchtest du Saft?“
Ella nickte unter Tränen.
„Hast du gehört, Tom? Und kannst du Sam bitte nach hinten in den Garten bringen? Ich verstehe nicht, warum er andauernd bellt. So geht das schon, seit wir ihn hierhergebracht haben.“
„Das ist meine Schuld“, sagte ich. Ich sah zu, wie meine Mutter versuchte, Ella zu trösten. „Es ist alles meine Schuld. Bitte, wein doch nicht, Ella. Alles ist gut. Daddy ist da.“ Aber sie konnte mich nicht hören, ich war ihr noch immer verborgen. Dabei wollte ich sie so furchtbar gern in die Arme nehmen und ihr die Tränen von den Wangen wischen. Es brach mir das Herz. Ich nahm mir vor, das nächste Mal, wenn ich mit ihr alleine sein würde, alles zu versuchen, um zu ihr durchzudringen.
Die Gelegenheit bot sich erst, als sie an diesem Abend im Bett lag. Nachdem sie gebadet und eine Geschichte vorgelesen bekommen hatte, deckte Mum sie zu und gab ihr einen Gutenachtkuss.
„Möchtest du über irgendwas sprechen, bevor du dich schlafen legst?“, fragte Mum.
„Nein. Alles gut.“
„Na, aber wenn du reden willst – besonders über deinen Daddy –, dann bin ich für dich da. Grandad auch. Das weißt du doch, oder?“
„Ja.“
„Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf gut. Lass dich nicht von den Schlafläusen beißen.“
Ella schüttelte den Kopf, sie sah sehr traurig aus. Das hatte ich immer zu ihr gesagt, wenn ich sie ins Bett gebracht hatte. Vermutlich hatte ich diesen Satz als kleiner Junge von meiner Mutter gehört.
Als Mum aufstand und aus dem Zimmer gehen wollte, schoss Ella kerzengerade im Bett hoch. „Ist mein Nachtlicht an, Nana?“
„Ja, Liebes. Das haben wir zusammen angemacht, bevor ich die Geschichte vorgelesen habe. Wenn ich das große Licht ausschalte, siehst du es.“
„Und das Licht auf dem Flur? Das machst du doch nicht aus, oder? Daddy lässt das immer für mich brennen. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist.“
„Keine Sorge. Wir lassen es für dich an.“
„Die ganze Nacht?“
„Die ganze Nacht.“
Sobald Mum unten war, kniete ich mich neben das Bett. „Ella?“, flüsterte ich in ihr Ohr. „Kannst du mich hören? Hier ist Daddy. Ich bin noch da. Ich habe versprochen, dich nie zu verlassen. Und ich halte mein Wort. Kannst du mich spüren?“
Nichts. Nichts deutete darauf hin, dass sie auch nur irgendwie meine Anwesenheit wahrnahm. Ihre großen Augen, die genauso wunderschön blassgrün waren wie die ihrer Mutter, waren weit offen, starrten aber ausdruckslos an die Decke. Mit einem Seufzer stand ich auf und begann, im Zimmer auf und ab zu gehen. Was konnte ich tun, um zu ihr durchzudringen? Wenn der Hund mich spüren konnte, dann müsste es Ella doch auch irgendwie möglich sein – ganz egal, was Lizzie mir erzählt hatte. Was war denn mit all den Leuten, die behaupteten, Geister gesehen zu haben? Irgendwas musste doch dran sein an diesen Geschichten. Und sagte man nicht, dass Kinder empfänglicher für solche Dinge waren als Erwachsene?
Ironischerweise hatte ich vor meinem Tod absolut nicht an Übersinnliches geglaubt. Als Journalist hatte ich mich hinter einer Mauer von Skepsis verschanzt. Ich erinnerte mich, wie ich immer mit Kollegen über Leute gelacht hatte, die anriefen und ihre Spukgeschichten erzählten. Spinner hatten wir sie genannt. Jetzt sah ich das Ganze aus einer anderen Perspektive.
Außer dem bisschen, das Lizzie mir erzählt hatte, beruhte mein gesamtes Wissen über Geister – ich meine Seelen – auf fiktiven Geschichten aus Büchern und Filmen. Doch was ich gerade durchmachte (und ich hatte mit der Analyse erst angefangen, nachdem der Schock, tot zu sein, ein wenig abgeklungen war), hatte rein gar nichts mit den Büchern oder Filmen zu tun, die ich kannte. Sosehr ich mich auch bemühte, ich bekam noch immer keinen Patrick Swayze zustande und konnte nach wie vor nicht durch Türen und Wände gehen. Ich konnte rumlaufen, sitzen und mich hinlegen, aber das war’s dann auch schon. Und darauf zu achten, ja nicht hinter verschlossenen Türen eingesperrt zu werden, war mir schon in Fleisch und Blut übergegangen – wenn ich denn welches hätte. Mein Tastsinn war verschwunden. Ich war wie unter Narkose, betäubt. Ich kam mir irgendwie substanzlos vor und wie in einer großen Blase eingeschlossen, die mich von der Welt ringsum trennte. Und trotzdem, wenn ich nicht gerade versuchte, auf diese Welt einzuwirken, fühlte ich mich nicht so viel anders als vor meinem Tod.
Allerdings war da noch das Problem, dass ich Leute nicht anfassen konnte. Inzwischen hatte ich es ja schon häufiger versucht, und jedes Mal war ich wieder mit der gleichen Wucht zurückgeschleudert worden. Das tat mir nicht weh, haute mich aber trotzdem um – die beteiligte Person bekam jedoch nie etwas davon mit. Geruchs- und Geschmackssinn hatten mich auch verlassen, ich verspürte weder Hunger noch Durst. Alles, was ich noch konnte, war sehen und hören.
Mit Lizzie war das allerdings anders gewesen. Ich wusste noch deutlich, dass ich gefühlt hatte, wie sie mir auf die Schulter getippt hatte. Und an ihren kühlen Handschlag im warmen Sonnenschein erinnerte ich mich auch. Was soll’s, dachte ich. Sie ist nicht mehr hier. Ich habe sie weggeschickt.
Also, welche Möglichkeiten hatte ich, zu meiner Tochter durchzudringen? Ich konnte das Licht nicht zum Flackern bringen, ich konnte keine Gegenstände verrücken oder mich sonst wie bemerkbar machen. „Komm schon, Ella“, sagte ich. „Hilf mir. Gib mir ein Zeichen, dass du mich spüren kannst. Ich bin hier, Liebling.“
Ganz plötzlich stieg Ella aus dem Bett, und ich musste ihr ausweichen. Sie kniete sich an die Stelle, an der ich gerade eben noch gesessen hatte. Zuerst wusste ich nicht, was sie vorhatte, bis sie anfing, leise zu sprechen: „Gott? Bist du da? Ich heiße Ella. Der Religionslehrer in der Schule sagt, wir können so mit dir reden, wenn wir traurig sind. Ist mein Daddy bei dir? Nana sagt das. Sie sagt, er ist im Himmel. Ich vermisse ihn wirklich, weißt du? Ich dachte, vielleicht könntest du ihn ja bald zurückkommen lassen. Er hat gesagt, er kauft mir ein Eis. Nana und Grandad passen auf mich auf, aber ich möchte trotzdem gern, dass er nach Hause kommt. Ich wünschte, ich wäre nicht mehr traurig. Amen.“
Ihre Worte durchbohrten mich wie Nadeln. Sie ermutigten mich, weiter zu ihr zu sprechen. Verzweifelt sehnte ich mich danach, zu ihr Kontakt aufzunehmen, aber was ich auch sagte und wie ich es auch sagte, es hatte keine Wirkung. Sie konnte mich immer noch nicht hören. Trotzdem blieb ich an ihrem Bett und flüsterte ihr Geschichten von Gruffalos, gefangenen Prinzessinnen, tanzenden Hunden und einer Katze namens Mog zu. Geschichten, die ich ihr so oft vorgelesen hatte, dass sie sich in mein Gedächtnis eingebrannt hatten. Noch lange nachdem Ella eingeschlafen war, erzählte ich weiter und hoffte wider alle Hoffnung, dass sie mich hören und sich getröstet fühlen würde.
„Gute Nacht, mein wunderschönes Mädchen“, sagte ich schließlich, als mein Repertoire erschöpft war. Ich beugte mich so weit, wie ich mich nur traute, über das Bett, in dem sie jetzt ganz tief schlief, und hauchte ihr einen Gutenachtkuss auf die Stirn.
„Nacht, Daddy“, murmelte sie.
3. KAPITEL
Einen Tag tot
Ich konnte es nicht glauben. Sie hatte geantwortet! Ich hatte „Gute Nacht“ gesagt – sie hat meine Stimme gehört und „Nacht“ gemurmelt. Spontan hätte ich mit Rufen und Schreien reagiert und gehofft, sie würde davon aufwachen und mich sehen. Doch ich verhielt mich ganz ruhig. Erstens, weil ich Angst hatte, meine Stimme würde wieder keinerlei Reaktion hervorrufen, zweitens, und das war eigentlich der Hauptgrund, wollte ich ihren Schlaf nicht stören. Sie sah so friedlich aus, und ich wusste, wie sehr sie ihre Nachtruhe brauchte. Hab Geduld, sagte ich mir. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
Ich war so aufgeregt, hatte wieder Hoffnung. Wenn ich zu ihr durchdringen konnte, wenn sie schlief, dann hatte ich doch bestimmt auch eine Chance, es zu schaffen, wenn sie wach war.
Es war Zeit, Kontakt zu Lizzie aufzunehmen, fand ich. Sie hatte mir den Eindruck vermittelt, es wäre gar nicht möglich, dass Ella mich sehen oder hören könne, aber jetzt, nach diesem Erlebnis, war ich mir sicher, dass sie sich irrte. Ich brauchte ein paar Informationen.
Ich ging die Treppe hinunter, schlich an der geschlossenen Küchentür vorbei, hinter der Sam schlief, und betrat das Wohnzimmer. Das Licht vom Treppenflur reichte nicht bis hierher, es war also dunkel im Raum. Doch ich kannte mich ja aus, ließ mich auf meinem ledernen Lieblingssessel nieder und erinnerte mich daran, wie bequem der immer gewesen war. Jetzt fühlte ich gar nichts. Behaglichkeit oder Unbehagen waren in meinem derzeitigen Zustand nicht voneinander zu unterscheiden. Und ich konnte den Sessel ebenso wenig in die Liegeposition bringen, den Fernseher einschalten oder den Roman vom Tisch nehmen, den ich ein paar Abende zuvor auf dem Couchtisch liegen gelassen hatte – als ich noch nicht ahnte, dass ich nie erfahren würde, wie er ausging.
„Hallo?“, sagte ich. „Bist du da, Lizzie? Hörst du mich? Ich muss mit dir reden.“
Ein Klick und alle Lampen gingen an. Lizzie hockte auf der Couch, sie sah genauso aus wie bei unserer letzten Begegnung: Kostüm, Trenchcoat, Pferdeschwanz.
Sie lächelte. „Hallo, Fremder. Du liebst die Dunkelheit, oder?“
„Nicht besonders, aber offenbar bin ich nicht in der Lage, so einfache Dinge zu tun, wie das Licht anzuschalten. Im Gegensatz zu dir. Wie funktioniert das? Kann ich das lernen, oder bleibe ich so hilflos? Ich hatte nicht angenommen, dass ich so … nutzlos sein würde.“
„Man sollte nie von irgendwelchen Annahmen ausgehen. Damit macht man sich nur zum Idioten.“
Ich wartete darauf, dass sie fortfuhr – und mir ein paar Informationen über meinen Zustand als Seele geben würde –, aber es kam nichts. Ich ertrug das Schweigen, solange ich konnte, und warf ihr meinen bemitleidenswertesten Blick zu, weil ich darauf setzte, dass das ihren Widerstand brechen würde. Doch es nützte nichts, sie starrte mich nur an.
„Nun mach schon“, jammerte ich. „Gib mir irgendwas. Sag mir wenigstens, warum ich immer, wenn ich jemandem zu nahe komme, gegen die nächstliegende harte Oberfläche geschleudert werde. Was hat es damit auf sich?“
Lizzie zog eine Grimasse. „Ja. Das kann unangenehm sein. Am besten vermeidet man so was. Ich fürchte, dagegen kannst du nichts machen. Du kannst einfach nicht da sein, wo ein lebender Mensch ist.“
„Na toll. Sonst noch was?“
Sie schüttelte den Kopf. „Dein Aufenthalt als Seele – hier auf Erden – ist vorübergehend. Doch wenn du einverstanden bist, mit mir zu kommen – weiterzugehen –, dann bekommst du alle Antworten, die du brauchst. Aber vergiss nicht, lange gilt dieses Angebot nicht mehr, die Uhr tickt.“
„Wie lange noch?“
„Das ist noch nicht entschieden. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich etwas erfahre. Höre ich da einen Sinneswandel heraus? Du musst dich langsam einsam fühlen, so ganz allein.“
„Ich bin nicht allein. Ich bin bei Ella und meinen Eltern.“
„Die können dich nicht sehen.“
„Und darüber wollte ich mit dir reden.“
„Oh.“
Ich rutschte auf die Sesselkante vor. „Ich hatte einen Durchbruch.“
Lizzie zog eine Augenbraue hoch. „Wie das?“
„Als Ella ins Bett gegangen und gerade weggedämmert war, habe ich ihr einige ihrer Lieblingsgeschichten erzählt. Ich dachte, sie könnte mich nicht hören, aber ich habe es trotzdem gemacht. Es fühlte sich richtig an, also habe ich ewig weitererzählt. Schließlich habe ich ihr Gute Nacht gesagt – und sie hat mir geantwortet.“
„Sie hat dir Gute Nacht gesagt? Ich dachte, sie schlief.“
„Ja. Es war, als würde sie im Schlaf reden.“
„Das war wahrscheinlich nur Zufall. Vielleicht hat sie gerade geträumt, dass du ihr Gute Nacht sagst. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie von dir träumt, weil ihr Gehirn die Geschehnisse verarbeitet.“
„Im selben Augenblick? Wirklich? Das glaube ich nicht. Ich bin überzeugt davon, dass sie mich hören konnte, zumindest unterbewusst. Wenn ich mich da einklinken kann, warum kann ich dann nicht zu ihr durchdringen, wenn sie wach ist? Sieh dir doch mal den Hund an, der weiß, dass ich noch da bin.“
„Der Hund?“
„Sam, der Spaniel meiner Eltern. Er hört einfach nicht auf, mich anzubellen, Lizzie. Ich lass mich nicht abspeisen. Sag mir die Wahrheit. Bitte. Ich flehe dich an.“
Lizzie setzte sich gerade hin und richtete ihre schokoladenbraunen Augen auf mich. Ihre Nase zuckte wieder so komisch kaninchenartig, vermutlich war das ein Tick. Die Pause war lang, bevor sie sagte: „Es ist kompliziert.“
„Was soll das heißen?“
„Über bestimmte Dinge darf ich nicht mit dir sprechen. Mein Job ist, dir dabei zu helfen, weiterzugehen.“
„Aber wenn Sam mich wahrnehmen kann, warum kann sie es nicht?“
„Sie ist kein Hund.“
„Bin ich froh, dass wir das geklärt haben. Nun komm, Lizzie, stell dich mir nicht in den Weg. Du weißt doch, worauf ich hinauswill.“
„Ich gebe nur die Fakten wider. Diese Dinge funktionieren für Tiere anders als für Menschen.“
„Das kannst du mir nicht antun. Ich hab doch nur dich. Hast du denn kein Herz? Wir reden hier von meiner sechsjährigen Tochter. Ella hat mir das Versprechen abgenommen, dass ich sie niemals verlasse, dass sie niemals allein sein wird, und jetzt hat sie das Gefühl, ich hätte sie im Stich gelassen. Sie denkt, ich hätte mein Versprechen gebrochen und sie verlassen, ohne mich von ihr zu verabschieden. Das wird sie doch ihr Leben lang verfolgen.“
„Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Wenigstens hat Ella ihre Großeltern, die sich um sie kümmern. Die beiden lieben sie offensichtlich sehr.“
„Ja, aber das sind meine Eltern, nicht ihre. Ich bin ihr Vater. Bitte, Lizzie. Stell dir vor, du wärst Ella. Würdest du mich denn nicht wiedersehen wollen? Würdest du nicht die Wahrheit wissen wollen? Du musst doch auch mal einen Vater gehabt haben.“
Lizzie starrte auf ihre Hände. So würde ich was erreichen.
„Nun komm“, sagte ich. „Gib mir irgendeine Information. Ich hab doch recht, oder? Eine Verständigung mit Ella ist doch möglich? Gib es zu.“
„Ich kann nichts machen.“
Das Licht ging aus.
„Lizzie?“, sagte ich. „Bist du da?“ Aber ich kannte die Antwort schon. Am liebsten hätte ich vor Ärger losgebrüllt.
„Du bist mir eine schöne Reiseführerin“, rief ich ins verlassene Wohnzimmer hinein. Dann fielen mir die beiden Zauberworte wieder ein: Nacht, Daddy. Sie weckten meine Leidenschaft und gaben mir wieder Zuversicht.
Lizzie hätte klipp und klar sagen können, dass es nicht möglich war und niemals möglich sein würde, mit meiner Tochter zu kommunizieren. Aber das hatte sie nicht getan. Ich konnte also hoffen.
4. KAPITEL
Sechs Tage tot
In den nächsten Tagen gab es kein weiteres Erfolgserlebnis. Ich versuchte es immer wieder, erreichte jedoch nichts. Vielleicht hätte ich die Gelegenheit gleich ergreifen müssen, als sie sich geboten hatte. Vielleicht hätte ich versuchen sollen, Ella zu wecken. Ich befürchtete sogar, dass Lizzie ihre Finger irgendwie mit im Spiel hatte, um zu verhindern, dass Ella mich hörte. Dennoch gab ich nicht auf. Tag und Nacht blieb ich an Ellas Seite und redete immerzu mit ihr, so als könnte sie mich hören.
Damit war ich so beschäftigt, dass ich dem Zeitungsartikel zu „meinem Gedenken“ kaum Beachtung schenkte, als er schließlich erschien. Ich stellte nur fest, dass ihm wohl ein relativ prominenter Platz in der Zeitung eingeräumt worden war. Mum schien mit den Formulierungen ganz zufrieden zu sein.
Für das große Ganze war dieser Artikel nicht wichtig. Von weitaus größerer Bedeutung war, dass Ella völlig neben sich stand. Sie hatte starke Stimmungsschwankungen. In einem Moment wirkte sie fröhlich, spielte mit ihren Puppen oder rannte mit Sam durch den Garten, im nächsten Moment brach sie wegen irgendeiner Kleinigkeit in Tränen aus – oder, noch schlimmer, sie wurde ganz still und in sich gekehrt.
Eines Nachts machte sie ins Bett, das war schon ewig nicht mehr passiert, und sie war tief verstört, als sie aufwachte und es merkte. Es brach mir das Herz, mit anzusehen, wie sie hektisch versuchte, um drei Uhr morgens selbst das Laken zu wechseln. Zum Glück wurde Mum wach und eilte zu ihrer Rettung herbei. „Was machst du denn da, mein armes Würstchen, das brauchst du doch nicht selber zu machen. Dazu bin ich doch da. Warum hast du mich denn nicht gerufen?“
Mit hochrotem Kopf lief Ella zu ihrem Prinzessinnenschloss und versteckte sich.
„Das macht doch nichts, Schatz. So was passiert mal. Das ist ganz normal.“
„Das war ich nicht“, sagte sie kleinlaut. „Das muss Kitten gemacht haben.“
Auch tagsüber hatten Mum und Dad alle Hände voll zu tun: mit der Polizei, die die Strafverfolgung der SUV-Fahrerin wegen des Unfalls mit Todesfolge eingeleitet hatte, mit dem Staatsanwalt, der für die Untersuchung zuständig war, und mit dem Bestattungsinstitut, das meine Trauerfeier ausrichtete. Dann galt es auch noch die Vormundschaft für Ella zu beantragen und meinen Nachlass zu ordnen. Wie gut, dass ich Dads Rat gefolgt war und ein Testament gemacht hatte. Das vereinfachte die Dinge.
Meine Eltern waren sehr bemüht darum, immer positiv zu bleiben und für Ella alles zusammenzuhalten, aber ich konnte sehen, wie schwer ihnen das fiel. Dad rauchte und trank mehr denn je – und Mum, die sonst das blühende Leben war, sah aus wie jemand, der seit Wochen nicht geschlafen hatte. Meine Eltern wohnten noch immer in meinem Haus, obwohl ihnen die Bequemlichkeiten ihres eigenen Zuhauses fehlten. Nach der Beerdigung würden sie umziehen, das hatten sie mit Ella besprochen. Die Fahrt zu ihrem Haus dauerte mit dem Auto nicht länger als zwanzig Minuten, Ella konnte also zunächst noch in ihrer alten Schule bleiben.
Ein paar Tage behielten meine Eltern Ella zu Hause, aber dann wollte sie wieder zur Schule gehen. Ich beschloss, sie zu begleiten und darauf zu achten, dass es ihr gut ging, aber ich blieb nicht lange dort. Ich fühlte mich wie ein Eindringling. Das war ihr Territorium – ihre ganz persönliche Zeit weg von zu Hause –, darauf hatte sie immer Wert gelegt. Schon seit der Vorschule hatte sie lieber für sich behalten, was sie dort erlebt hatte. Ich fragte sie jeden Tag, was sie gemacht hatte, und sie antwortete, daran könne sie sich nicht erinnern. Zuerst fand ich das seltsam, aber viele Eltern erzählten mir, dass es bei ihren Kindern nicht anders war.
Wie dem auch sei, ich blieb an diesem ersten Tag etwa eine Dreiviertelstunde bei ihr. Anfangs war sie sehr still, und nach der Schulversammlung in der Aula musste sie auf dem Weg zurück in die Klasse ein bisschen weinen. Aber es ging gleich besser, nachdem ihre beste Freundin Jada sie in den Arm genommen und ihr versprochen hatte, auf sie aufzupassen. Dann machte ich mich auf den Heimweg, nur um vor meinem Haus festzustellen, dass Mum und Dad weggefahren waren und ich nicht reinkonnte.
Fantastisch. Ich setzte mich auf die Stufe vor der Tür, legte den Kopf in die Hände und tat mir selber leid. Es fing an zu regnen. Eigentlich hätte ich frieren und nass werden müssen da draußen, schließlich hatte ich seit meinem Tod immer nur die ausgefransten Jeans und das T-Shirt angehabt, aber ich empfand nur diese Taubheit. Irgendwie wünschte ich mir, die würde auch meinen Verstand befallen, nur da war ich nämlich noch zu Gefühlen fähig. Aber was blieb dann von meiner Menschlichkeit? Der Schmerz, den mir Ellas Kummer bereitete, war mein Antrieb, ich war fest entschlossen, mich weiter um sie zu kümmern.
Da bemerkte ich einen schwarzen Audi auf der Straße. Vor meinem Haus fuhr er langsamer, aber wegen der dunklen Fenster konnte ich nicht ins Innere des Wagens sehen. Ein paar Minuten später kam er aus der anderen Richtung zurück und parkte auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Jetzt war ich neugierig geworden; ich stand auf, um mir den Wagen genauer anzusehen und herauszufinden, wer drin saß. Genau in diesem Moment raste ein mir unbekannter dunkelblauer Ford Fiesta heran, bremste ab und bog auf meine Einfahrt ein.
„Verdammte Scheiße“, brüllte ich und hechtete zur Seite. Um ein Haar hätte mich der Wagen erwischt. Ich hatte keine Ahnung, was passieren würde, wenn ich von einem fahrenden Auto überrollt wurde – und auch keine besondere Lust, es herauszufinden. Ich rappelte mich auf und sah den Audi in der Ferne verschwinden. Eine jüngere, etwas größere Ausgabe meiner Mutter stieg aus der Fahrertür des Fiesta. „Lauren“, sagte ich, „ich hätte es wissen müssen.“