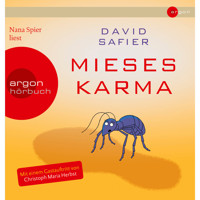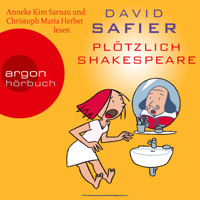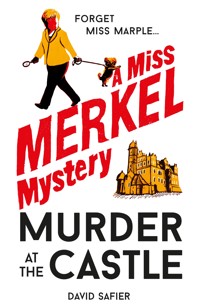9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist stärker, die Liebe oder das Schicksal? David Safier erzählt in diesem dramatischen und zärtlichen Roman die Geschichte seiner Eltern: Sie führt uns vom Wien des Jahres 1937, durch die Gefängnisse der Gestapo, nach Palästina, wo sein Vater Joschi als Barmann und Spion arbeitet und schließlich zur See fährt. Seine Mutter Waltraut wächst als Tochter eines Werftarbeiters in Bremen auf, erlebt Kriegszeit, Trümmerjahre und Wirtschaftswunder. Bei ihrer ersten Begegnung ist Waltraut eine junge alleinerziehende Witwe, Joschi zwanzig Jahre älter als sie. Wenig spricht dafür, dass die beiden sich ineinander verlieben und ein gemeinsames Leben wagen - ein Leben geprägt von steilen Höhenflügen und dramatischen Schicksalsschlägen. «Nie wäre ich auf die Idee gekommen, über meine Eltern zu schreiben, wenn sie nicht das Leben von großen Romanfiguren geführt hätten. » David Safier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
David Safier
Solange wir leben
Roman
Über dieses Buch
Was ist stärker, die Liebe oder das Schicksal?
David Safier erzählt in diesem dramatischen und zärtlichen Roman die Geschichte seiner Eltern: Sie führt uns vom Wien des Jahres 1937 durch die Gefängnisse der Gestapo nach Palästina, wo sein Vater Joschi als Barmann und Spion arbeitet und schließlich zur See fährt. Seine Mutter Waltraut wächst als Tochter eines Werftarbeiters in Bremen auf, erlebt Kriegszeit, Trümmerjahre und Wirtschaftswunder. Bei ihrer ersten Begegnung ist Waltraut eine junge alleinerziehende Witwe, Joschi zwanzig Jahre älter als sie. Wenig spricht dafür, dass die beiden sich ineinander verlieben und ein gemeinsames Leben wagen – ein Leben, geprägt von steilen Höhenflügen und dramatischen Schicksalsschlägen.
«Nie wäre ich auf die Idee gekommen, über meine Eltern zu schreiben, wenn sie nicht das Leben von großen Romanfiguren geführt hätten.» David Safier
Vita
David Safier, 1966 geboren, zählt zu den erfolgreichsten Autoren Deutschlands. Seine Romane, darunter «Mieses Karma», «Jesus liebt mich» und «Miss Merkel», erreichen Millionenauflagen im In- und Ausland. Aber auch sein Buch über den Aufstand im Warschauer Ghetto «28 Tage lang» wurde von der Presse hochgelobt. Als Drehbuchautor erhielt David Safier sowohl den Grimme-Preis als auch den International Emmy. David Safier lebt und arbeitet in Bremen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Bilder vom Autor; Svetoslava Madarova/Trevillion Images
Die Fotos im Tafelteil stammen aus dem Privatbesitz des Autors
ISBN 978-3-644-01082-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
In Liebe
1997
«Soll ich ihn ins Grab schubsen?», fragte meine betrunkene Mutter schwankend. Mit ihn war der alte Rabbiner gemeint, der gerade das Totengebet sprach, und mit Grab das offene meines Vaters.
«Soll ich ihn ins Grab schubsen?», wiederholte sie, als hätte ich sie nicht gehört, dabei war ihre Frage selbst dem Rabbiner nicht entgangen, der deshalb nun etwas lauter wurde. Er betete auf Hebräisch, einer Sprache, die weder meine Mutter noch ich verstanden. Vermutlich auch nicht die aus der ehemaligen Sowjetunion stammenden Männer, die alle ein paar Mark bekommen hatten, damit zehn erwachsene Juden den Minjan für das Kaddisch bilden konnten. Die meisten hielten mit Einkäufen gefüllte Lidl-Tüten in der Hand.
«Soll ich? Soll ich?», meine Mutter trat kichernd hinter den Rabbiner. Vermutlich dachte sie, mein Vater hätte das ebenfalls lustig gefunden. Ein Rabbi, der ins Grab fällt, das wäre genau sein Humor gewesen. Obwohl er ein Urenkel eines Wunder-Rabbiners aus Brzesko war und im Vorstand der Jüdischen Gemeinde Bremens gesessen hatte, war mein Vater nicht sonderlich religiös gewesen. In Jerusalem hatte er 1946 sogar mal einen Rabbiner verprügelt. Dennoch hätte er es bei seiner eigenen Beerdigung nicht amüsant gefunden, wenn die Ehefrau den Rabbi in sein Grab gestoßen hätte. Und über die Lidl-Tüten hätte er sich aufgeregt.
Der Rabbi wurde in seinem Vortrag schneller. Anscheinend schätzte er die Gefahr, in ein Scharmützel mit meiner Mutter zu geraten, als hoch ein. Zu Recht. Ich nahm ihre Hand und führte sie ein paar Schritte weg. Meine Frau Marion ergriff die andere Hand. Ich tat es, um meine Mutter zu kontrollieren, meine Frau, um ihr Trost zu spenden. Dabei konnte niemand meine Mutter trösten. Seit dem Tod meiner Schwester vor vier Jahren war etwas in ihr zu Bruch gegangen. Und nun hatte mein Vater sich auch noch das Leben genommen. Aus Liebe zu ihr.
Der Rest der Beerdigung verlief ohne Zwischenfälle. Der Rabbi verließ das Grab mit ernster Miene, ohne ein Wort des Trostes für uns. Die angeheuerten Sowjet-Juden schlurften mit ihren Lidl-Tüten davon. Und so standen wir nun zu dritt am Grab, das von zwei Friedhofsgärtnern zugeschüttet wurde. Meine Frau und ich wollten zurück zu unserem zweijährigen Sohn, auf den eine Babysitterin vom ‹Oma-Hilfsdienst› aufpasste. Der eigentlichen Oma bestellte ich ein Taxi und versprach ihr, am nächsten Morgen um zehn vorbeizukommen, einer Uhrzeit, in der sie lediglich ein oder zwei Dosenbiere intus hatte.
«Man sollte keine Kinder in die Welt setzen», sagte sie plötzlich.
Ich verstand, aus welchem Schmerz heraus sie die Worte sprach. Und auch meine Frau, immerhin die Mutter eines kleinen Kindes mit dem Wunsch nach einem zweiten, nahm es ihr nicht übel. Wir ließen den Satz unkommentiert und geleiteten meine erschöpfte Mutter zum Ausgang. Das Taxi war bereits da. Doch sie stieg nicht ein. Stattdessen sagte sie leise zu mir: «Dein Vater hatte zwei uneheliche Kinder. Eins in Wien. Und eins in Israel.»
Es traf mich nicht, kam mir nur unwirklich vor.
«Seine erste Frau und er waren in Haifa sehr eng befreundet mit einem Paar. Alle konnten sehen, dass deren Baby von Joschi stammte.»
Es war das erste Mal, dass meine Mutter mir gegenüber die erste Ehefrau meines Vaters erwähnte. Von deren Existenz wusste ich nur von meinem Onkel Charlie, der mir erzählt hatte, was für ein feiner Mensch Dora gewesen war und dass er nie hatte verstehen können, warum mein Vater sie für meine Mutter verlassen hatte.
Ich dachte nach: Mein Vater hatte 1939 gerade noch rechtzeitig aus Wien fliehen können. Ein dort geborenes Kind von ihm müsste etwa 30 Jahre älter sein als ich, und vermutlich, wie so gut wie alle in der weitverzweigten Familie meines Vaters, wäre es im Holocaust umgekommen.
Meine Mutter stieg ohne ein weiteres Wort ins Taxi. Ich wiederholte, dass wir uns morgen sehen würden, schloss die Tür und schaute dem Wagen nach, wie er auf dem Kopfsteinpflaster der kleinen Straße am Friedhof davonruckelte.
Gab es diese Kinder überhaupt?
Meine Eltern hatten mir nie von ihrem Leben vor meiner Geburt erzählt. Mein Vater hatte seine Eltern nicht mal mit einem Wort erwähnt. Mir wurde sogar bis zu meinem zwanzigsten Geburtstag verheimlicht, dass meine Schwester nicht die Tochter meines Vaters war. Allerdings hatte ich das schon selbst mit elf Jahren herausgefunden, als ich im Kleiderschrank meines Vaters einen Schuhkarton mit Postkarten aus aller Welt entdeckte, die mein zur See fahrender Vater geschrieben und an Waltraut und Gabi Kampe adressiert hatte. Der Mädchenname meiner Mutter war Behrens, das wusste ich.
Hatte mein Vater ihr die unehelichen Kinder gebeichtet? Oder hatte sie die Information von meiner Tante und meinem Onkel? Oder hatte sie sich das Ganze nur ausgedacht, wie so viele Geschichten, die sie im Laufe ihres Lebens mit einer solchen Intensität erzählt hatte, dass sie nach einer Weile selbst daran glaubte, allen voran jene, dass sie aus einem Adelsgeschlecht stammte?
Was wusste ich schon über das Leben meiner Eltern? Außer dass es oft grausam war? Und manchmal wundervoll? Und dass sie sich liebten?
1937–1938
Am Abend, an dem die kleine Waltraut in einem Bremer Arbeiterhäuschen ihre ersten Schritte machte, saß Joschi als junger Mann im Theatersaal des Hotel Stefanie in der Wiener Taborstraße und sah sich eine Aufführung des Jüdisch-Politischen Cabaret an. Seine Schwester Rosl moderierte auf der Bühne gerade das letzte Lied des Abends an: «Der ideale Nazi ist blond wie Hitler, schlank wie Göring, schön wie Goebbels und heißt Rosenberg.»
Die Zuschauer lachten, und das Sextett begann zu der schmissigen Melodie von ‹Habanera› aus der Oper ‹Carmen› ihren Evergreen ‹An allem sind die Juden schuld› zu singen: «Ob das Telefon besetzt ist, die Badewanne leckt, ob dein Einkommen falsch geschätzt ist …»
Die fünf Männer und die rothaarige Rosl trugen Frack und Fliege wie die ‹Comedian Harmonists›, die Joschi um so vieles lustiger fand als die politischen Witze der Gruppe auf der Bühne, in der seine Rosl durch Stimme und Schönheit herausragte. Er war nur zu dem Auftritt gekommen, weil er seine Schwester mal wieder sehen wollte. Seit sie vor einem Jahr ihren viel älteren Wasserballer geheiratet hatte und aus der kleinen Wohnung der Familie Safier in der Rotensterngasse 23 gezogen war, hatte sie sich rar gemacht. Joschi hätte früher nie gedacht, dass er Rosl einmal vermissen würde, so oft hatten die beiden sich in dem gemeinsamen kleinen Zimmer gestritten.
«Dass der Schnee so furchtbar weiß ist, und dazu, was sagt man, so kalt, dass dagegen Feuer heiß ist …»
Joschi gab der Ehe mit dem Wasserballer keine zwei Jahre. Entweder würde Rosl hinter dem Verkaufstresen seines Sportgeschäfts Lamberg nahe des Naschmarkts vor Langeweile meschugge werden oder der Wasserballer sie erwürgen, weil sie ständig etwas zu meckern hatte. Vermutlich sogar beides. Joschi war der Einzige, der ihr Gestänker ertrug. Weil er sie liebte. So wie er seine Eltern liebte. Seine Mutter Scheindel, die mit Strenge und dem Wunsch nach Bildung für ihn seinem Leben eine Richtung gegeben hatte, auch wenn er den von ihr vorgesehenen Weg nicht gerade flotten Schrittes beschritt. Und seinen Vater Israel, der sich schon vor Ewigkeiten damit abgefunden hatte, dass seine Frau, Rosl und er nicht auf ihn hörten.
Joschi liebte seine Familie, wie er bisher noch kein Mädchen geliebt hatte. Und Rosl, davon war er überzeugt, würde niemals im Leben einen Mann mehr lieben können als ihre Träume von der Bühne und von einem Leben in Palästina.
«Und glaubst du’s nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld!»
Das Lied war zu Ende, die Vorstellung auch, und das Publikum klatschte. Am lautesten Joschi. Nicht etwa, weil er das Lied so mochte. Nein, er war einfach gut im Klatschen. Er bekam in Theatern und Cabarets oft freien Eintritt, wenn er sich als Claqueur verdingte. Deshalb verbrachte er viele Abende auf diese Weise. Obwohl er einige Texte berühmter Kabarettisten wie Karl Farkas oder Fritz Grünbaum schon fast auswendig konnte, schüttete er sich selbst noch beim zehnten Mal über die albernsten Wortspiele aus, wie zum Beispiel das über den Staatsvertrag von Locarno: «Der Locarno-Pakt». «Er packt? Wo will er denn hin?»
Als die Gäste den Hotelsaal verließen, ging Joschi zu seiner Schwester. Sie strahlte ihn an. Cabaret war ihr Leben, der Applaus ihr Elixier. Wenn sie strahlte, war Rosl noch schöner als ohnehin. Für Joschi war es kaum zu glauben, dass sie die Tochter der kleinen, dürren Mutter und des blassen Vaters war, der so wenige Haare besaß, dass keine Kippa groß genug war, die kahle Platte zu bedecken. Mama Scheindel hatte sich spät im Leben dazu entschlossen, Mutter zu werden, und zu diesem Zweck den fünf Jahre jüngeren Israel Safier geheiratet. Für einige in der polnischen Heimat, aus der die beiden vor dem Ersten Weltkrieg nach Wien geflohen waren, war dieser Altersunterschied zwischen Frau und Mann unerhört gewesen.
Es gab Momente, in denen Joschi selbst nicht glauben konnte, dass er von diesen beiden Alten abstammte, war er doch ein fescher Junge. Davon war er überzeugt, aber das zeigte auch sein Erfolg bei den Frauen. Mit dem perfekt sitzenden Anzug, den sein Vater ihm genäht hatte, der exakt richtigen Menge an Pomade im Haar und dem langen Trenchcoat, den er außer an heißen Sommertagen wie diesen trug, wirkte Joschi nicht wie der arme Jude, der er war. So dachte er jedenfalls.
«Was macht das Studium, Joschi?», fragte Rosl. Während die Geschwister mit den Eltern hauptsächlich Jiddisch redeten, sprachen sie untereinander ausschließlich Deutsch. Sie verstanden sich als Juden einer neuen Generation.
«Keinen Spaß», antwortete er.
«Es soll auch keinen Spaß machen.»
«Wäre aber schöner.»
«Du musst aufhören, so faul zu sein.»
«Wer sagt denn, dass ich faul bin?»
«Bist du es etwa nicht?»
Joschi hätte jetzt gerne tausend Argumente hervorgebracht, warum er nicht faul war, aber die Wahrheit war, dass er nie Bauingenieur hatte werden wollen. Es war halt ein besseres Schicksal, als Schneider zu sein wie der Vater. Und er hatte seine Eltern mit der Entscheidung glücklich gemacht. Ganz besonders die Mama, deren Vater Henoch Klapholz in Brzesko sogar Bürgermeister gewesen war, während der Vater von Papa Israel ein Leben als Vagabund geführt hatte. Letzteres hätten die beiden Kinder nie erfahren, wenn Mama Scheindel es ihrem Mann nicht mal in einem Wutanfall an den Kopf geworfen hätte.
Beide Großväter hatten Joschi und Rosl nie kennengelernt, genauso wenig wie die 18 Tanten und Onkel, die noch in Polen lebten, und deren unzählige Kinder. Bei den weiteren Verzweigungen der Familie – allein Großvater Henoch hatte sieben Geschwister – wurde es für alle Beteiligten unübersichtlich. Nur jene Verwandten, die ebenfalls vor den Wirren des Ersten Weltkriegs nach Wien geflohen waren, und deren Sprösslinge kannten Joschi und Rosl. Und das war immer noch genug Mischpoke.
Die Eltern waren nur so lange glücklich über Joschis Studium, bis sie sich zu sorgen begannen, wie sie die hohen Gebühren zusammenkratzen sollten. Joschi selbst trug nur wenig dazu bei, er lieferte lediglich die Hosen und Anzüge aus, die sein Vater in der Küche der winzigen Wohnung schneiderte oder ausbesserte, wofür er ein kleines Trinkgeld kassierte. Die Gebühren waren besonders hoch, weil der in Wien geborene Joschi nicht als österreichischer Staatsbürger galt, sondern als Pole wie Rosl und seine Eltern. Und das, obwohl der Landstrich, aus dem die Familie stammte, zur Zeit der Flucht noch zu Österreich-Ungarn gehörte.
Wenn sie Österreicher gewesen wären, wären sie alle gewiss glücklicher gewesen.
«Ich bin nicht faul.»
Rosl verzog verächtlich das Gesicht, wie es nur eine andere Person auf der ganzen Welt sonst tun konnte.
«Jetzt siehst du aus wie Mama», sagte Joschi und wusste, dass er damit seine Schwester auf die Palme bringen konnte.
«Ich bin nicht wie Mama!», protestierte sie von der Palme hinab.
Es war ein Phänomen. Joschi liebte seine Schwester, und er war sich auch ziemlich sicher, dass sie ihn liebte, und dennoch brauchten sie beide in der Regel weniger als eine Minute, um in einen Streit zu geraten. Wenn sie sich früher bei ihrer Mutter – nie beim Vater – über den jeweils anderen beschwerten, hatte die nur geantwortet: «Pack schlägt sich, Pack verträgt sich», und die beiden hatten sich tatsächlich vertragen oder besser gesagt verbündet, um gemeinsam gegen die Mutter zu protestieren, dass sie alles andere wären als ein Pack!
«Hast du eine Freundin?», änderte Rosl das Thema und versetzte damit, vermutlich absichtlich, den nächsten Nadelstich.
«Gerade nicht.»
«Du brauchst mal eine, mit der du länger als eine Woche zusammen bist.»
«So wie du mit dem alten Wasserballer?», versuchte nun auch Joschi sie zu piesacken.
«Der Wasserballer heißt Paul. Und er ist erst 37. Ein bisschen Ernsthaftigkeit in deinem Leben würde dir guttun.»
«Du bist wirklich wie Mama.»
Rosl stieg die Zornesröte ins Gesicht. Joschi erwartete, dass sie wie ein Schwarm Rohrspatzen zu schimpfen beginnen würde, doch sie sagte nur: «Servus, ich muss mich umziehen.» Ohne eine Antwort von ihm abzuwarten, ging sie hinter die Bühne. Es war in der Tat wie immer: Er freute sich auf sie, und am Ende trennten sie sich im Streit.
Als Joschi auf die bunt erleuchtete Taborstraße trat, wurde seine Laune gleich wieder besser. Auf den Straßen war viel los, insbesondere junge Menschen tummelten sich, aber auch ein paar fromme Juden palaverten miteinander auf dem Gehsteig. Die drückende Junihitze des Tages war einer angenehmen Brise gewichen. Sie roch nach den Bergen, in denen Joschi noch nie war. Er zog sein Jackett aus, warf es lässig über die Schulter und ging langsam die Straße in Richtung Rotensterngasse. Seine Eltern, die in ihren jeweiligen Heimatorten Brzesko und Dębica ohne fließend Wasser und Strom gehaust hatten, waren unendlich dankbar für diese Wohnung, die sie mit ihren Kindern bewohnen durften. Wenn Rosl als Heranwachsende gemeckert hatte, dass der Goi von der Etage unter ihnen das Klo am Ende des Gangs zu lange besetzte, verwies Mama Scheindel stets auf die vielen aus dem Osten geflüchteten Juden, die nahe am Prater in Bretterbuden hausten. Und darauf, dass Rosl sich glücklich schätzen konnte, zur Schule gehen zu dürfen, und dass Joschi sogar das Gymnasium besuchen konnte. Dass Rosl sich für wesentlich klüger hielt als ihren Bruder und statt seiner auf das Gymnasium hätte gehen wollen, hatte sie nur einmal im zarten Alter von elf Jahren gewagt auszusprechen. Danach hatte Mama Scheindel ihr eine Tracht Prügel verabreicht.
Im Gymnasium war Joschi zwar nicht sehr eifrig gewesen, aber helle genug, um ohne großen Aufwand zu bestehen. Beinahe wäre er allerdings ein Jahr vor der Matura wegen wiederholtem Schwänzen von der Schule geflogen – der Hausmeister hatte ihn einmal sogar zufällig im Schwimmbad erwischt –, doch Scheindel hatte dem Rektor auf Jiddisch klargemacht, dass ihr Sohn zwar ein Depp war, aber eine Ohrfeige der Mutter besser sei, als ihm das Leben zu verbauen. Sie hatte Jiddisch gesprochen, weil sie in ihrer Muttersprache viel besser fluchen konnte, was die halbe Rotensterngasse alle paar Tage bezeugen konnte. Ihre Stimme trug mindestens bis Haus Nummer 9, in dem die böhmischen und tschechischen Nutten mit Schweinen hausten, echten und menschlichen.
«Lass mi gehn, du Oasch!», hörte Joschi von der anderen Straßenseite eine Frau rufen. Sie sah dümmlich aus und war sehr dick. Vor ihr ein Bär von einem Mann mit groben Pranken.
«Wia host mi gnannt?», fragte der Bär drohend.
«Oasch, du Voidepp!»
Ansatzlos verpasste er der Frau eine Ohrfeige.
Joschi überkam der Zorn. Eine Frau schlug man nicht! Egal, ob sie einen ‹Oasch› nannte oder ‹Voidepp› oder ‹Fetzenschädel›.
Die Dicke stürzte zu Boden, schlug sich das Knie auf und jaulte. Joschi sah sich um. Keiner der Passanten kam der Frau zu Hilfe. Im Gegenteil, wer in der Nähe war, wechselte die Straßenseite. Der Bär beugte sich über die Frau, packte sie am Kragen und sagte: «Oide, steh auf oder i prack da no ane!»
Wenn Joschi der Frau nicht half, würde ihr keiner helfen. Dass er gegen einen so großen Kerl kaum eine Chance hatte, kam ihm durchaus in den Sinn. Doch was hatte er für eine Wahl, er konnte ja nicht einfach zuschauen. So rannte er über die Straße, stürzte sich auf den Mann und riss ihn zu Boden. Der Bär war so überrascht, dass er erst einmal gar nicht reagierte. Dafür tat es die Frau, trotz ihres blutenden Knies rappelte sie sich blitzschnell auf: «Lass mein Mann in Ruah!», und schlug mit beiden Händen auf Joschi ein. Er versuchte, die Schläge der Frau abzuwehren, und hielt sich die Arme vors Gesicht. Dabei entging ihm, dass der Bär, der inzwischen wieder auf den Beinen war, zu einem gezielten Faustschlag ausholte. Joschi wurde schwindelig. Er versuchte sich auf den Beinen zu halten, doch ein weiterer Schlag traf ihn, diesmal gegen das Jochbein. Darauf ging er zu Boden, und die Frau trat ihm ein paarmal in den Bauch. Anschließend schimpfte sie: «Gö, jetzt hoast a Gsicht wia a eingehaute Wiatshaustür», und spazierte mit ihrem Kerl davon.
Pack schlägt sich, Pack verträgt sich – dachte Joschi, als er sich noch auf den warmen Gehsteigplatten krümmte.
«Du bist ja ein echter Held», hörte er eine junge Frauenstimme freundlich spotten. Er versuchte hochzublicken. Aber alles tat noch zu weh, um die Augen richtig öffnen zu können.
«Komm, ich helfe dir hoch.»
Verschwommen erkannte er eine ausgestreckte Hand und ergriff sie. In diesem Moment berührte er zum ersten Mal seine erste große Liebe.
Es war eine junge Brünette, die ihm aufhalf, und Joschi fand, dass sie aussah wie der Filmstar Hedy Lamarr, die schönste Jüdin Wiens. Auch wenn Rosl die Ansicht vertrat, dass die Lamarr nicht halb so hübsch war, wie alle glaubten, und zudem, dass sie eine Verräterin war. Lamarr war zum katholischen Glauben übergetreten, um einen Waffenhändler zu heiraten, in dessen Haus auch Mussolini und Hitler ein und aus gingen. Dennoch war sie Joschis Traumfrau. Und das schon, seit er sich mit fünfzehn Jahren heimlich ins Kino gemogelt hatte, um den Skandalfilm ‹Ekstase› zu sehen, in dem die Lamarr sich selbst befriedigte. Rosl vertrat im Übrigen auch die Ansicht, dass einen Jungen wie Joschi und Männer ganz allgemein solche weiblichen Aktivitäten nichts angingen.
Nun hielt also ein bezauberndes Wesen seine Hand, das der Lamarr in Schönheit in nichts nachstand. Sie hatte wunderschöne, lebendig strahlende braune Augen, das linke wurde sogar von einem leichten Grünstich veredelt. Das Kinn war spitz, was ihr Gesicht besonders markant machte. Ihr blaues Sommerkleid war aus feinstem Stoff und ihre schlichte Kette mit Davidstern aus Gold. Und wie sie duftete, nach Rosen, oder waren es Orchideen? Erst letzte Woche hatte er im botanischen Garten der Universität an Orchideen geschnuppert. Alles an ihr strahlte Wohlstand aus, und mit einem Mal wurde Joschi bewusst, dass er eben doch wie ein armer Jude aussah.
«Tut es noch weh?», fragte die Brünette, die Joschi in Gedanken bereits Hedy nannte. Sie lächelte ihn halb mitfühlend, halb amüsiert von seiner ‹Heldentat› an. Dann löste sie ihre Hand. Am liebsten hätte Joschi sie sofort wieder ergriffen.
«Hab schon Übleres weggesteckt», antwortete Joschi, der noch nie auch nur im Ansatz so einen Schlag hatte wegstecken müssen.
«Dann ist ja gut», lächelte Hedy und wandte sich zum Gehen.
«Du willst schon gehen?», der Gedanke entsetzte Joschi zu seinem eigenen Erstaunen sehr.
«Gut beobachtet.»
«Ich kann dich begleiten.»
Hedy lachte.
«Was gibt es da zu lachen?»
«Willst mich beschützen?»
«Selbstverständlich.»
«So wie die Frau eben?»
Das traf Joschi.
«Ich kann schon allein auf mich aufpassen», sagte Hedy und machte sich auf den Weg in Richtung Donau. Joschi schloss sofort zu ihr auf: «Aber das musst du nicht.»
«Du bist ein hartnäckiger Jude.»
«Ein galanter.»
«Ich bin mit einem Mann hier», sagte Hedy.
«Ich sehe keinen.»
«Dennoch ist es so.»
«Und wo ist er dann?»
«Zu einer Autorufsäule, um ein Taxi zu holen. Ich wollte noch eine rauchen, aber dazu kam ich nicht. Wegen dir.» Hedy holte eine Zigarette aus ihrer roten Handtasche. Joschi hatte das Rauchen nie attraktiv gefunden, außerdem war es teuer. Aber nun hätte er gerne eine Zigarette dabeigehabt, um gemeinsam mit diesem Wunder von Frau zu rauchen. Oder wenigstens Streichhölzer, um ihr Feuer zu geben.
Natürlich besaß sie ein edles, goldenes Feuerzeug.
«Ich würde dich nie allein lassen», sagte Joschi großspurig.
Hedy sah ihn an, als ob ihr das Versprechen gefiel, und sagte fast schon zärtlich: «Du bist wirklich ein galanter Jude.»
Joschi lächelte.
«Oder einer, der falsche Versprechungen macht.»
«Ich mache nie falsche Versprechungen!», empörte sich Joschi.
Jetzt sah Hedy wieder amüsiert drein.
Neben den beiden hielt ein Taxi, die hintere Tür ging auf und ein blonder Mann in teurem Anzug rief von der Hinterbank: «Steig ein, Ruth.»
Joschi fand, dass Hedy ein viel besserer Name für dieses wunderbare Wesen war. Ruth klang zu sehr nach alter Jungfer.
«Servus, galanter Jude.»
«Sehen wir uns wieder?»
«Du willst mich wiedersehen?»
«Morgen Abend um sieben am Pratereingang?»
«Ruth!», rief der Mann.
«Weißt was, du tapferer Held, irgendwann, an einem Abend in diesem Sommer, steh ich um sieben am Pratereingang.»
Sagte sie, stieg ins Taxi und brauste davon.
Joschi schaute ihr nach. Bis das Taxi über die Donaubrücke fuhr. In die Welt der Christen und der reichen Juden. Und er fragte sich, wie viele Abende er wohl am Eingang des Praters warten müsste.
Am letzten Sommertag ging Joschi mit Dubravka zum Prater, einer Böhmin, die nicht so anmutig wie Hedy war, dafür aber einen großen Busen besaß. Zwölf Tage in Folge hatte er um sieben Uhr abends auf Hedy gewartet, dann war es ihm zu dumm geworden. Nichtsdestotrotz war er noch an einigen weiteren Tagen um diese Uhrzeit am Prater vorbeispaziert und hatte versucht, sich einzureden, er würde nur einen Umweg machen, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Nun also war der Sommer vorbei, das Semester hatte wieder begonnen und das Studium schien noch öder zu werden als bislang. Joschi sehnte sich nach Ablenkung. Dubravka schenkte in einem Heurigen in Oberlaa aus und hatte Joschi gleich vom ersten Augenblick an fesch gefunden, wie er da bei einem Ausflug mit seinem Studienkollegen Otto auf der Holzbank saß und ihr Komplimente machte, die sie noch nie gehört hatte – ‹Du hast die schönsten Grübchen der Welt› –, und ihr ein großzügiges Trinkgeld gab. Rosl fand immer, Joschi könne nicht mit Geld umgehen. Joschi antwortete ihr auf diesen Vorwurf stets: «Ich gebe es für das aus, was das Leben ausmacht.» Und heute war das eben eine böhmische Kellnerin.
Dubravka deutete gerade voller Vorfreude auf das Riesenrad, als Joschi Hedy am Eingang entdeckte. Was dachte die Kuh sich? Dass er die Böhmin stehen lassen und fröhlich auf sie zustürmen würde, auf ewig dankbar, dass ihre Hoheit sich bequemte, dem armen Juden eine Audienz zu erweisen?
Mit unterdrücktem Groll ging er auf Hedy zu, fest entschlossen, haarscharf mit Dubravka am Arm an ihr vorbeizuschlendern, sie dabei nicht zu beachten und einen wunderbaren Abend ohne sie zu verbringen. Doch just, als er sie passieren wollte, sagte Hedy: «Ich war schon dreimal um sieben hier. Wo warst du, Held?»
Joschi sah Dubravka nicht einmal mehr an.
Anstatt irgendwo einzukehren und Geld auszugeben – Hedy war sichtlich darauf bedacht, sich nicht von Joschi aushalten zu lassen –, flanierten die beiden nebeneinander, und Joschi erzählte seine besten Prater-Geschichten: Wie er als Kind auf dem Riesenrad versucht hatte, auf die vorbeigehenden Menschen zu spucken, und es ihm ausgerechnet bei dem Riesenradbetreiber gelang. Wie er im Frühjahr eine der Damenkapellen mit einer Brezel dirigierte, ohne natürlich auch nur ein bisschen Ahnung von Musik zu haben, die Damen aber den Spaß mitmachten und der ganze Biergarten tanzte, bis sein Studienfreund Otto vom Tisch fiel und sich dabei den Knöchel brach, was die gute Stimmung ein wenig trübte. Selbstverständlich erzählte Joschi auch seine Lieblingsgeschichte, wie er als Vierzehnjähriger ein schwarzes Zelt sah, auf dem in großen scharlachroten Lettern stand: WIEN BEI NACHT. So wie jeder normale Knabe in diesem Alter wollte Joschi die hoffentlich nackten, gewiss aber halb nackten Frauen sehen. So zahlte er Eintritt und ging mit klopfendem Herzen in das stockdunkle Zelt hinein. Nach den ersten Schritten hörte er eine Stimme rufen: «Imma weida!» Joschi tat, wie ihm geheißen, immer wieder angetrieben von der Stimme. Bestimmt drei Minuten lang. Aber es blieb dunkel, keine einzige nackte oder auch nur halb nackte Frau wurde angeleuchtet. Nicht einmal Musik wurde von einem Grammofon gespielt. Da sah Joschi auf einmal Licht. Nicht von einer Lampe, unter der sich eine Dame räkelte, sondern einfach nur Tageslicht, das durch einen Schlitz im Zelt fiel. Die Stimme rief: «Weida, weida!» Joschi ging auf das Licht zu, begriff enttäuscht, dass der Schlitz der Ausgang war, drückte die Plane zur Seite und trat wieder ins Freie. Dort stand ein fast zahnloser Mann, der ihm im breitesten Wienerisch zuraunte: «Ned plappern und Goschn hoidn. Des is a gueter Schmäh für alle Burschis – gö? Du wüst jo ned dastehn wia a Depp.»
«Aber du», lächelte Hedy Joschi nun an der Stelle an, auf der einst das Zelt und jetzt eine Schießbude stand, «erzählst mir davon?»
«Bin ja keine vierzehn mehr.»
«Gott sei Dank, sonst bekäme ich auch Ärger mit der Polizei.»
Joschi musste über den Scherz lachen. Die einzige Frau, die ihn sonst zum Lachen bringen konnte, war Rosl.
Ach, hoffentlich war Hedy nicht so streitsüchtig wie seine Schwester.
Nachdem Joschi seine Prater-Anekdoten verfeuert hatte, fand er, dass es an der Zeit war, Hedy ein Kompliment zu machen. Aber was für eins? Sie war so anders als alle anderen Frauen, da konnte er ihr wohl kaum mit ‹Du hast die schönsten Grübchen der Welt› kommen. Obwohl sie die besaß. Wie auch die schönsten Augen, Haare, Beine … Auf den Busen traute Joschi sich nicht zu schauen. Er entsann sich des besten Ratschlags, den Rosl ihm im Umgang mit Mädchen gegeben hatte: «Besser, als ihnen Komplimente zu machen, ist, ihnen zuzuhören.» Natürlich fand Rosl so etwas gut, sie wollte immer, dass man ihren Ergüssen lauschte, und ihr Wasserballer musste sich sicher mehr davon anhören, als ihm lieb sein konnte. Joschi hatte im Laufe der Jahre aber festgestellt, dass Mädchen es in der Tat schätzten, wenn man sich für sie interessierte. Oder es auch nur vorgab. So hatte er Dubravka beim Spaziergang von der Tramstation zum Prater nach ihren Träumen gefragt, die Frage aber schnell bereut, weil sie von einer großen Familie mit mindestens fünf Kindern sprach. Ein weiterer Grund, warum es richtig war, die Böhmin stehen zu lassen.
Hedy wirkte nicht wie jemand, die Kinder haben wollte.
«Was sind deine Träume?», fragte Joschi.
«Na, du bist ja neugierig.»
«Frage ich halt etwas anderes: Was machst du so?»
«Nichts.»
«Nichts?»
«Nach der Matura war ich ein Jahr lang reisen. Paris, London, Boston … Was schaust du so?»
Joschi kam sich mit einem Mal klein vor. Aber er riss sich zusammen, machte aus der Not einen Scherz: «Auch ich war schon auf Reisen.»
«Ach ja?»
«Zum Schulausflug in den Wienerwald.»
«Zwei Weltenbürger schlendern über den Prater», lachte Hedy. Joschi lachte mit und fragte dann: «Was hast du jetzt vor, immer weiter nichts zu machen?»
«Meine Mutter will, dass ich Ärztin werde wie mein Vater.»
«Und?»
«Mein Vater will auf keinen Fall, dass ich Ärztin werde.»
«Sondern?»
«Dass ich gut heirate.»
«Den Blonden im Taxi?»
«Den schätzt mein Vater gar nicht.»
Das gefiel Joschi.
«Warum nicht?»
«Arbeitet als Sekretär für Kanzler Schuschnigg.»
«Da hat dein Vater wohl Angst, dass er bald von Hitler arbeitslos gemacht wird.»
«Haben wir das nicht alle?»
Joschi dachte nicht gerne an Politik, das verdarb die Laune.
«Ich will Bücher schreiben», sagte Hedy.
«Oh.» Joschi musste an Esther aus seiner Matura-Klasse der Zwi-Perez-Chajes-Schule denken. Die hatte Geschichten über Palästina geschrieben und wie dort ein jüdischer Staat entstehen würde. Doch obwohl sie immer vom Auswandern geredet hatte, lebte Esther noch in der Leopoldstadt und arbeitete in einem Schreibwarengeschäft. Joschi konnte sich nicht vorstellen, dass auch Hedy Geschichten über Zionisten schrieb, die den Wüstenboden fruchtbar machten.
«‹Oh›, sagst du? Traust du mir das nicht zu?», Hedy lächelte, als ob ihr seine Reaktion nichts ausmachen würde.
«Ich trau dir alles zu», sagte Joschi wahrheitsgemäß.
«Und du tust gut daran», lachte sie und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
Der erste richtige Kuss folgte, als die beiden sich eine Zuckerwatte teilten. Joschi hatte ein wenig der klebrigen Masse am Lippenrand, und Hedy bot sich an, ihn davon zu befreien. Gegen sie, fand Joschi, war Blücher bei der Schlacht an der Katzbach ein Zauderer ersten Ranges gewesen.
Als die Sonne unterging, betraten sie eine noble Wohnung in der Ringstraße. Hedys Eltern waren zu einem Ärztekongress nach Salzburg gefahren. Im Herrenzimmer, das aus der Familie eigentlich nur ihr Vater betreten durfte, führte Hedy ihrem Besuch vor, wie man einen Cognac schwenkte und eine kubanische Zigarre rauchte. Joschi musste viel husten und sie noch mehr darüber lachen.
Kurz vor Mitternacht zeigte sie ihm ihr Zimmer.
Was für ein wunderbares Ende des Sommers.
Ausgerechnet an Joschis Geburtstag wollte Hedy ihn endlich ihren Eltern vorstellen. Die Aussicht, den Abend auf diese Weise zu verbringen, ließ Joschi nicht gerade in Jubelstürme ausbrechen. Zumal er deswegen nicht wie üblich den gemeinsamen Geburtstag mit seinem Vater – beide waren am ersten Februar geboren – im Café Central bei leckerem Palatschinken verbringen konnte. Außerdem ahnte er, dass er in den Augen dieser wohlhabenden Menschen nicht bestehen würde, wenn schon der Kanzlersekretär, den Hedy nach dem zweiten Schäferstündchen mit Joschi abserviert hatte, nicht gut genug war. Hedy hatte ihn vorgewarnt, dass ihr Vater mittlerweile über nichts anderes als Politik sprach und ihre Mutter ein Nervenbündel war, seit jemand «Jude» an die Tür der Praxis geschmiert hatte.
Joschi war in der Hinsicht so einiges gewöhnt. An seiner Technischen Universität sangen Burschenschaftler immer öfter antisemitische Hasslieder, und obwohl Joschi sich deswegen am liebsten mit ihnen geprügelt hätte, folgte er, wie so viele jüdische Studenten, dem Rat der Eltern und versuchte, nicht aufzufallen. Rosl hingegen fand, dass dieser Ratschlag den Juden noch nie geholfen hatte, und engagierte sich in der Betar, in der junge Juden für das zukünftige Leben in Israel trainierten. Sie lernten dabei nicht nur Hebräisch – Joschi hatte es bereits auf dem Gymnasium gelernt – oder wie man das Land bestellte, sondern auch, wie man Waffen benutzte. Von seiner Schwester würde Joschi Hedys Eltern jedenfalls nicht erzählen, denn in der Regel verachteten jene Juden, deren Familien schon seit Generationen in Wien lebten, die Zionisten.
Wenn es nach Joschi gegangen wäre, hätte er seinen Geburtstag allein mit Hedy begangen. Aber es half ja nichts, er liebte diese Frau, und er ging davon aus, dass sie ihn auch liebte, obwohl sie es noch nie gesagt hatte. Irgendwann würde sie es tun, auf ewig konnte man Liebe nicht für sich behalten. Er musste durch diesen Abend nun mal durch. Außerdem würde der ein Zuckerschlecken im Vergleich zu der Herausforderung, Hedy irgendwann seiner Mutter vorzustellen, denn kein Mädchen konnte in ihren Augen gut genug für ihn sein, während der Wasserballer, der Rosl geheiratet hatte, ein Gottesgeschenk für sie gewesen war.
Als Joschi im nasskalten Wetter in der Ringstraße ankam, fror er trotz des Trenchcoats, in dem er wie ein Gangster aus einem amerikanischen Film und nicht wie ein Schneider aussah, oder präziser, wie der Schneiderssohn, der er war. Hedy wartete vor dem Haus auf ihn. War er zu spät? Er blickte auf die Armbanduhr, ein Geschenk seiner Eltern zur Matura, damit er wenigstens zur Universität nicht immer zu spät kommen würde. Es war liebenswert, dass seine Eltern dachten, das hinge von einer Uhr ab. Er lag gut in der Zeit. Er war sogar fünf Minuten zu früh, damit er noch eine Beruhigungszigarette rauchen konnte. Hedy hatte ihn zu diesem Laster nach einem Stelldichein im Wienerwald verführt, seitdem war jede Zigarette auch eine Erinnerung an jenen wundervollen Waldbesuch.
Als Joschi zu ihr trat und sie gerade fragen wollte, warum sie bei dem Wetter ohne Mantel vor der Tür stand, steckte Hedy sich eine Fluppe an und rückte von ihm ab. Es war, als ob sie nicht wollte, dass er sie überhaupt berührte. Sie wirkte fahrig, und Joschi befürchtete mit einem Mal das Schlimmste, ohne eine Idee davon zu haben, was das sein könnte.
«Was ist?», fragte er.
Hedy antwortete nicht.
Er wollte sie in den Arm nehmen. Sie wich aus.
«Was ist los?»
«Ich bin schwanger.»
Sein Magen zog sich zusammen. «Schwanger?»
«Das wollte ich mit schwanger ausdrücken.»
Da redete ganz Wien, wie sich das Leben ändern würde, wenn – nicht mal mehr ‹falls› – die Nazis kämen, und seins war bereits in diesem Augenblick ein anderes geworden.
An das Abendessen mit Hedys Eltern war nicht mehr zu denken. Sie drückte die Zigarette aus, erklärte, dass sie ihren Eltern sagen würde, Joschi habe eine Magenverstimmung, und verschwand ohne ein weiteres Wort ins Haus. Wenn Joschi nicht so überfordert gewesen wäre, hätte er wohl erkannt, dass sie es noch viel mehr war. So aber stand er nur wie betäubt da: Er brauchte Hilfe. Jemanden, der ihm aus dieser Situation, der er nicht gewachsen war, irgendwie heraushalf. Oder einen Menschen, mit dem er sich betrinken konnte. Studienfreund Otto war immer für den Suff zu haben, aber der würde nur alle Einzelheiten zum Verkehr mit Hedy erfahren wollen, die ihm Joschi vorenthielt – im Gegensatz zu den Details seiner früheren Liebschaften.
Mit Papa reden?
Am gemeinsamen Geburtstag?
Schöne Feier. Und was sollte der ihm für Ratschläge geben, er war so viel älter gewesen, als Rosl sich ankündigte, und hatte in einem kleinen polnischen Schtetl gelebt, nicht in einer Metropole, die Gefahr lief, den Nazis in die Hände zu fallen. Und Mama würde ihm nur Vorwürfe machen, da er nun sein Studium würde abbrechen müssen und alle Mühe, ihm ein besseres Leben zu ermöglichen, damit vergebens war. Ein angesehener Bürger Wiens hätte er werden können, wie es ihr Vater Henoch in Brzesko gewesen war. Nun, vielleicht nicht ganz so angesehen, aber immerhin.
Joschi spürte, wie sich nicht nur sein Magen zuschnürte, sondern auch der Hals. Er musste mit jemandem reden. Mit wem nur? Mit wem? Mit wem?
Rosl.
Wenn alles nicht half, dann eben Rosl.
Sie würde seine Angst vor so viel Verantwortung verstehen. Der Wasserballer bedrängte sie, endlich ein Kind zu bekommen, und sie zeigte ihm stets den Vogel.
Joschi rannte zum Sportgeschäft des Schwagers, weil es näher lag als deren Wohnung. Es musste zwar schon geschlossen sein, aber vielleicht machte Rosl noch die Kasse.
Joschi rannte und rannte, bis er nicht mehr konnte und atemlos weiterging. Über den Naschmarkt, von da in eine Nebenstraße zum Sportgeschäft Lamberg, wo noch Licht brannte. Die Tür war schon geschlossen, aber er klopfte an die Scheibe. Rosl, die gerade Tennisschläger aufhängte, sah in seine Richtung, beendete trotz seines energischen Hämmerns seelenruhig ihre Tätigkeit und öffnete erst dann die Tür.
«Es ist was passiert», keuchte Joschi.
«Doch nicht mit Papa?»
«Nein, nein …»
Rosl war erleichtert. Sie war zwar ein harter Knochen und zeigte nur Emotionen, wenn sie diese theatralisch zelebrieren konnte, doch wenn es um die Gesundheit des Papas ging, machte sie sich stets Sorgen. Dabei hatte der, bis auf den einen Schwächeanfall im letzten Jahr, nie dazu Anlass gegeben. Das Asthma der Mama hingegen hatte bei ihr nie auch nur eine einzige mitfühlende Reaktion ausgelöst.
«Ist dein Wasserballer da?», fragte Joschi, nun schon weniger außer Atem.
«Paul», Rosl betonte den Namen laut und deutlich, «trainiert die erste Mannschaft.»
«Gut.»
«Also, was hast?»
Joschi erzählte ihr von Hedy, von deren Existenz Rosl bisher noch nichts wusste, dann von der Schwangerschaft und endete damit, dass nun sein Leben zu Ende sei. Auch Joschi hatte einen Hang zur Theatralik, ohne sich, im Gegensatz zu seiner Schwester, dessen bewusst zu sein.
Rosl sah ihn ernst an. Joschi erwartete eine Standpauke, dass er Trottel eben hätte aufpassen sollen, und machte sich bereit, ihrem Geschimpfe mit einem eigenen Ausbruch zu begegnen. Er sah sich schon türeschlagend das Sportgeschäft verlassen, um sich doch mit dem Studienfreund zu betrinken, als Rosl im ruhigen, ernsten Ton sagte: «Du bist nicht der Erste, dem das passiert. Dein Leben ist auch nicht vorbei. Also reiß dich verdammt noch mal zusammen, übernimm Verantwortung und mach das Beste daraus! Das haben schon ganz andere als du hinbekommen.»
«Mit andere meinst du Papa?»
«Wen denn sonst?», grinste Rosl.
Joschi musste lachen. Es war die beste Standpauke seines Lebens.
Joschi stand inmitten der Menge, die im strahlenden Sonnenschein dem Führer Adolf Hitler auf seinem Weg zum Heldenplatz zujubelte. Männer saßen in noch kahlen Bäumen, Kinder schwenkten Hakenkreuzfähnchen, und es schien, als ob ganz Wien, mal abgesehen von den Juden, sich herausgeputzt hatte. Der Goi in ihrem Haus in der Rotensterngasse trug schon seit der Rücktrittserklärung des Kanzlers Schuschnigg eine Hakenkreuzbinde und grüßte die Familie Safier im Treppenhaus nicht mehr.
Während sich alle Juden, die Joschi kannte, in ihren Wohnungen versteckten, hatte er sich vorgenommen, Hitler zu sehen. Hedy hatte ihn für verrückt erklärt, ihr war allerdings zu speiübel, um den Vater ihres Kindes, der ihr bisher keinen Antrag gemacht hatte, zurückzuhalten. Joschis Hoffnung, Hedys Vater würde sie bis zum Ende seines Studiums unterstützen, war von dem stolzen Mann zerschlagen worden. Hedys Mutter hatte ihm zwar versprochen, dass er sich keine Sorgen machen solle, sie würde ihren Benjamin schon weichklopfen, aber das war bereits einige Wochen her.
Für Rosl war die Angelegenheit klar: Der Alte wollte einfach nicht daran erinnert werden, dass er für die Österreicher genauso ein Jude ist wie sie. Der Gedanke, dass ein Enkelkind von ihm ein halber Pole sein würde, nachdem er, seine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sich mühsam in die feine österreichische Gesellschaft hochgearbeitet hatten, war ihm schlicht unerträglich.
Joschi war egal, was für Hedys Vater unerträglich war oder nicht. Der Mann verbaute ihm einen Ausweg aus dem Dilemma, das ihm mehr und mehr die Kehle zuschnürte. Tagsüber konnte Joschi sich einreden, dass er schon einen Weg finden würde. Doch es gab schlaflose Nächte, in denen er sich angsterfüllt wünschte, Hedy würde das Kind verlieren. Dann würde der Druck wie weggeblasen sein und er wieder frei atmen können. Für diese Gedanken schämte er sich zutiefst. Und er verachtete sich dafür, dass er sie dennoch in seinen dunkelsten Stunden nicht verdrängen konnte.
Als Hitlers offene Limousine vorbeifuhr, konnte Joschi keinen Blick auf ihn erhaschen. Er stand einfach zu weit hinten, auch hörte er weder die vorbeimarschierenden Truppen, noch sah er deren Fahnen und Standarten. Die Männer um ihn herum brüllten jedoch ausgelassener als bei jedem Fußballspiel, die Frauen waren in Ekstase, wie er es sonst nur einmal erlebt hatte, als Willi Forst bei der Premiere von Königswalzer Kusshände werfend über den roten Teppich geschritten war. Allerdings wirkten die Frauen hier bedrohlicher. Als ob sie Joschi auf Befehl hin in Stücke reißen würden. Dennoch ertappte er sich dabei, wie er am liebsten mitgejubelt hätte. Mitgetragen von der Masse. Wie wundervoll wäre es, ein Teil von dieser Menge zu sein. Das unermessliche Glück über den Anschluss, das die Wiener empfanden, herausschreien zu können. Noch nie hatte Joschi sich so sehr gewünscht dazuzugehören. Und noch nie hatte er sich in seinem Wien so allein gefühlt.
Joschi und Hedy saßen rauchend auf den Treppenstufen vor ihrer Haustür. Es nieselte an diesem warmen Frühlingstag. Aber selbst bei strahlendem Sonnenschein hätten sie innerlich gezittert. Die Nazis hatten Hedy und ihre Eltern gedemütigt. Mit Zahnbürsten musste die Familie gemeinsam mit anderen wohlhabenden Juden das Kopfsteinpflaster in der Nebenstraße putzen, begleitet vom Gejohle und den Beschimpfungen der Nachbarn, des Metzgers, der Bäckersfrau und sogar einiger Patienten des Vaters. Einem von ihnen hatte der Arzt nach einem Infarkt das Leben gerettet. Jetzt wurde er von ihm bespuckt.
Joschis Familie war es seit dem Anschluss nicht so übel ergangen. An das Sportgeschäft Lamberg hatte bisher noch keiner eine Parole geschmiert. Vielleicht, so hatte Rosl gescherzt, war den Nazis mittlerweile die Farbe ausgegangen. Selbst der Goi im Haus trug zwar stolz seine Hakenkreuzbinde, hatte aber noch niemanden beleidigt oder gar geschlagen. Als Österreicher durfte man inzwischen ungestraft seine jüdischen Nachbarn verprügeln. Mama Scheindel und Papa Israel gingen im Treppenhaus mit gesenktem Blick an dem Nachbar vorbei, und auch Joschi vermied es, ihn anzusehen. Nicht aus Angst, sondern weil er nach dem, was die Nazis Hedy und ihren Eltern angetan hatten, dem Kerl sonst eine geschmiert hätte.
«Meine Eltern und ich gehen nach Paris», sagte Hedy zwischen zwei Zigarettenzügen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden kaum ein Wort gewechselt.
«Ihr habt Visa?»
«Kosteten die besten Ringe meiner Mama.»
«Könnt ihr noch mehr besorgen?»
«Papa sagt, wir brauchen allen Schmuck, um in Paris zu überleben.»
«Hast du ihn denn gefragt?»
«Ich könnte ihn mit Mama dazu bringen, dass du mitkommen kannst.»
«Dann tu es.»
«Würdest du denn deine Eltern zurücklassen?»
Joschi wusste nicht, was schäbiger war: seine Familie in Wien allein zu lassen oder seine Zukünftige und das gemeinsame Kind in Paris. Er zog tief an seiner Zigarette. Spürte dem Rauch bis tief in die Lungen nach, in der vergeblichen Hoffnung, die richtige Antwort zu finden.
«Es gibt auch», sagte Hedy leise, «eine andere Lösung.»
«Und was für eine?»
Hedy antwortete nicht.
«Sag schon.»
Sie hielt ihr Gesicht dem feinen Regen entgegen. Wollte sie sich etwa von ihm trennen? Liebte sie ihn nicht mehr? Hatte sie es je getan? Rosl dachte, Hedy hätte sich nur mit ihm eingelassen, um ihren Vater zu provozieren.
Rosl konnte manchmal einen solchen Schwachsinn reden!
Liebte er Hedy?
Joschi spürte in sich hinein.
Ja, er liebte sie. Die Schwangerschaft und die Nazis hatten seine Gefühle für sie überlagert, aber sie waren noch da. Sollte er sie überzeugen, in Wien zu bleiben? Bei ihm? Hier? Ohne ihr etwas bieten zu können? Ohne sie beschützen zu können? War das die andere Lösung, die sie meinte? Das konnte man doch keiner Frau antun, die man liebte.
Er wollte Hedy einen Kuss auf die Wange geben, da erklärte sie: «Ich lass das Kind wegmachen.»
Joschi ging wie benommen durch die Taborstraße, vorbei an den Theatern, in denen Juden nicht mehr auftreten durften. In welche Kabaretts und Theater sollte man noch gehen, wenn man etwas Gutes sehen wollte? Sollte Hans Moser etwa auf der Bühne Selbstgespräche führen? Wie erging es dem eigentlich, der Schauspieler hatte ja eine jüdische Frau? Der Filmstar Heinz Rühmann hatte seine verlassen. Joschi mochte nicht denken, dass der Moser auch so ein feiger Hund war wie der Deutsche.
Dabei war, dachte Joschi, er doch selbst einer. Er hatte Hedy nicht gebeten, das Kind zu behalten. Ihr nur angeboten, sie zu dem Freund ihres Vaters, der die Abtreibung vornehmen würde, zu begleiten. Als ob dies eine Kavalierstat wäre.
Sie hatte abgelehnt.
Die beiden hatten noch eine Weile stumm dagesessen. Dann musste Joschi heim, bevor es dunkel wurde, zu gefährlich sonst für einen Juden. Sie hatten sich nicht wie früher voneinander verabschiedet. Nicht mit einem Kuss. Sie hatten sich lediglich umarmt. Wie Schicksalsgefährten, deren Wege sich trennen würden. Sie vereinbarten ein letztes Treffen für Ende der Woche vor Hedys Abreise nach Paris.
Sollte er ihr zum Abschied etwas schenken, fragte er sich.
Abschied.
Von Hedy, die ihn nicht liebte. Und einem Kind, das sie beide nicht liebten.
Joschi blieb stehen. Diesmal war es nicht der Magen, der sich zusammenzog, wie an jenem Tag, als er von Hedys Schwangerschaft erfuhr, auch nicht der Hals, sondern das Herz.
Sie beide verwehrten einer Seele das Leben.
Es war Hedys Entscheidung, aber er hatte nichts getan, um sie umzustimmen. War sogar, schäbiger Hund, der er war, kurz erleichtert gewesen.
Henoch.
Dieser Name für das Ungeborene, das für ihn bislang unwirklich war, schoss ihm durch den Kopf. Mama Scheindel, die nichts von dem Kind wusste und nun auch nie mehr davon erfahren würde, hätte sich über ihn gefreut.
Wenn er jemals einen Sohn bekommen würde, würde er ihn Henoch nennen.
Und eine Tochter Rosl.
Am Wochenende suchte er, wie verabredet, Hedy auf. Zur Erinnerung an ihn wollte er ihr das beste Feuerzeug schenken, das er in den Trafiken der Leopoldstadt hatte finden können. Jedenfalls das Beste, das er sich hatte leisten können.
Joschi klingelte an der Tür. Niemand öffnete. Er klingelte noch einmal. Und noch mal. Er beschloss zu warten. Nach einer halben Stunde kam eine Nachbarin, verscheuchte ihn von den Stufen und mahnte ihn, seine drei Kippen einzusammeln. Am liebsten hätte er sie gefragt, ob sie zu den Schweinen gehörte, die gejohlt hatten, als Hedy auf den Knien die Straße putzen musste. Aber er fragte stattdessen, ob sie die Familie gesehen habe, und bekam zur Antwort, dass sie schon vor zwei Tagen mit Sack und Pack ihre Wohnung verlassen habe.
Hedy hatte ihm offensichtlich ein falsches Datum gesagt. Gab es noch mehr Lügen? In Bezug auf die Abtreibung? Nein, gewiss nicht. Und dennoch hoffte ein kleiner Teil von Joschi zu seiner eigenen Überraschung, dass das Kind noch lebte.
Drei Wochen später kam eine Postkarte aus Paris. Zwei Zeilen. Hedy ging es gut. Und die Prozedur war erfolgreich gewesen. Alles Gute. Bring dich in Sicherheit.
Er legte die Postkarte in die Schublade seines Nachttischs und sah sie nie wieder an.
Wie?
Wie sich in Sicherheit bringen?
Rosl hatte sie alle überzeugt, Anträge zur Ausreise zu stellen. Nach Panama. Dabei hatte sie stets nach Palästina gewollt. Doch die Engländer würden in ihrem Mandatsgebiet nie im Leben freiwillig Juden aufnehmen. Ob die Deutschen die Anträge ins neue Gelobte Land bewilligen würden? Womöglich. Sie wollten ja die ‹Parasiten› loswerden, und da wäre es doch großartig für sie, wenn die Panamarer ihnen die abnehmen könnten. Oder hießen die Menschen dort Panamaer? Rosl meinte, es hieße Panamesen wie Chinesen. Sie alle wussten rein gar nichts über Panama, außer dass es da diesen Kanal gab.
Joschi wollte nicht nach Panama. Genauso wenig wie nach Palästina. Oder sonst wo hin. Nicht mal nach Paris. Er wollte in Wien bleiben. Vielleicht würde es sich mit den Nazis doch irgendwie leben lassen. So wie mit dem Goi im Haus.
Vielleicht würde Hitler auch beim nächsten Reichsparteitag auf der Bühne Charleston tanzen.
Wenn er nach Panama käme, müsste er sich ein neues Leben aufbauen. Wie immer das auch aussehen mochte. Dafür wäre es klug, etwas von dem alten Leben in der Hand zu haben. Sein Maturazeugnis zum Beispiel. Und Studienbescheinigungen. Er hatte die Bestätigung, dass er sein Studium aufgenommen hatte. Besser noch wären möglichst viele Dokumente über bestandene Prüfungen, aber er hatte bisher lediglich ‹Mathematik I› und ‹Mathematik II› gerade so geschafft. Doch noch war die Universität für Juden nicht geschlossen. So lernte Joschi Tag und Nacht für die drei nächsten Prüfungen. ‹Hochbau I› bestand er, ‹Darstellende Geometrie› ebenfalls. Die dritte war ‹Baustoffkunde›. Für seine Verhältnisse exzellent vorbereitet, war Joschi auf dem Weg zur Technischen Universität. Bereits aus einigen Hundert Metern Entfernung hörte er das Gejohle. Gewiss wieder die Burschenschaftler. Er müsste versuchen, einen großen Bogen um sie zu machen und dann den Prüfungsraum zu erreichen.
Als Joschi auf den Vorplatz trat, sah er, wo sich die johlenden Studenten befanden: Der Lärm drang aus den offenen Fenstern eines Raums im zweiten Stock. Gut so, das würde es ihm einfach machen, den Kerlen nicht zu begegnen. Der Prüfungsraum lag in einem weit entfernten Trakt.
Joschi ging weiter in Richtung Eingang, da hörte er: «Und eins! Und zwei! Und drei! Und Judenschwein!»
Bei dem Wort schaute er nach oben. Und sah, wie die Burschenschaftler einen Menschen aus dem Fenster warfen. Samuel, ein jüdischer Student höheren Semesters, mit dem Joschi sich vielleicht dreimal unterhalten hatte. Er schrie. Bis er auf dem Kopfsteinpflaster aufschlug.
Joschi drehte sich erst weg, dann zwang er sich hinzuschauen: Samuel lag mit blutendem Schädel auf dem Pflaster. Die Beine standen in einem seltsamen Winkel vom Körper ab. Aber er atmete noch. Für wie lange?
Joschi wollte ihm zu Hilfe kommen. Da hörte er wieder: «Und eins! Und zwei! Und drei! Und Judenschwein!»
Ein weiterer Student wurde aus dem Fenster geworfen – ihn kannte Joschi nicht.
Dieser Mann gab keinen Laut von sich. Er war paralysiert vor Angst. Als er aufschlug, sah Joschi nicht hin. Hörte nur sein Röcheln.
Joschi konnte dem Kommilitonen nicht helfen, ohne den Mob auf sich aufmerksam zu machen. Er sah zu ihnen hoch, wie sie an den offenen Fenstern lachten und geiferten. Am äußersten Fenster stand sein Studienfreund Otto.
«Und eins! Und zwei …!»
Joschi drehte sich um und rannte los …
«… und drei! …»
… besann sich jedoch schnell eines Besseren. Das Laufen würde ihn verraten, er wechselte in einen eiligen Schritt.
«… und Judenschwein!»
Er hörte den Schrei.
Er hörte den Aufschlag.
Er hörte das Johlen.
Meinte sogar Ottos Lachen herauszuhören.
Joschi drehte sich nicht um.
Ging davon.
Und nie wieder in die Universität.
1939–1945
In dem Sommer vor Kriegsbeginn, als die Safiers in Wien nur für das Nötigste die Wohnung verließen, ging die drei Jahre alte Waltraut in Bremen jedes Wochenende mit der Familie zum Waller See. So auch an diesem heißen Augusttag. Papa Hinrich lag in der prallen Sonne, seine Haut bereits gefährlich gerötet. So erholte er sich am liebsten von den harten Schichten auf der Deschimag-Werft, die für ihn und seine Tischlerkumpanen nur ‹Use Akschen› hieß und auf der sie Holz für die vielen neuen U-Boote zurechtsägten. Ab und zu richtete Hinrich sich auf, um eine Flasche Bier mit den Zähnen zu öffnen, was die kleine Waltraut und ihren fünf Jahre älteren Bruder Klaus immer wieder zum Lachen brachte.
Diesmal lachte auch Friedrich mit. Er war so alt wie Waltraut, wirkte aber zarter als sie. Er war mit Tante Brigitte zu Besuch in Bremen, die eigentlich keine echte Tante war, sondern die Base von Waltrauts Mama Henriette.
Während Tante Brigitte im blauen Badeanzug dasaß und sogar eine neumodische Sonnenbrille aufgesetzt hatte, trug die blasse Mama einen Schlapphut und ein langärmeliges Kleid. Sie mochte die gleißende Sonne nicht und wollte eigentlich immer, dass die Familie ihr Lager im Schatten aufschlug. Doch sie konnte sich nie gegen ihren Hinrich durchsetzen, der sie wegen ihrer Sonnenallergie einmal vor den Kindern Nosferatu genannt hatte. Als Waltraut daraufhin fragte: «Was ist Nosssferratuuu?», verbat Henriette ihrem Mann, den Kindern zu erklären, was ein Vampir ist. Die Kleinen sollten keine Albträume bekommen.
Tante Brigitte hörte bei mitgebrachtem Filterkaffee nicht auf, Henriette davon zu erzählen, wie das Leben in deren beider Heimatstadt Essen jährlich besser wurde, seitdem die Nationalsozialisten das Ruder übernommen hatten und ihr Schorsch bei der Stern-Brauerei Arbeit gefunden hatte. Schorsch erhielt die Kästen sogar zum Vorzugspreis.
«Dann soll er mal», lachte Hinrich, «ein paar mitbringen!» Er richtete sich auf und sagte zu seinen Kindern: «Wir gehen jetzt baden.»
«Au ja!», rief Klaus, der sich über jede gemeinsame Aktion mit seinem Papa freute, waren sie doch so selten.
Die kleine Waltraut war weniger begeistert. Sie mochte es nicht, dass Papa die Kinder gerne in die Höhe warf und oft sogar auch ins Wasser. Klaus konnte schwimmen, aber sie musste vom Vater dann immer herausgezogen werden, damit sie nicht ertrank.
«Friedrich bleibt bei den Handtüchern», sagte Tante Brigitte, «mein Kleiner ist noch zu schwach nach der Lungenentzündung.»
«Der Knabe fängt sich aber auch ständig etwas ein», antwortete Papa ohne Mitgefühl.
«Hinrich!», schimpfte die Mama, aber Papa ging nicht darauf ein und rief seinen Kindern zu: «Der Letzte im Wasser ist ein Friedrich!»
Papa rannte los. Klaus folgte. Die kleine Waltraut aber blieb bei den Handtüchern und sah Friedrich an. Er verstand anscheinend nicht, dass ihr Papa ihn gerade gemein behandelt hatte, und dennoch hätte sie am liebsten seine Hand genommen, um ihn zu trösten. Stattdessen setzte sie sich hin und nuckelte. An ihrem Zeigefinger. Sie war das einzige Kleinkind in Bremen-Walle, das dafür nie den Daumen benutzte.
Nach einer halben Stunde rief Mama Henriette mit ihrem zarten Stimmchen: «Zeit für die Stullen.» Aber Hinrich und Klaus hörten sie nicht, der Vater warf den Sohn gerade besonders weit ins Wasser. Daher stellte sich Tante Brigitte auf und brüllte, so laut sie konnte: «Hinrich! Klaus! Stullleeen!»
Der kleine Friedrich hielt sich neben ihr die Ohren zu. Mama Henriette reichte ihm ein Brot mit Leberwurst; Waltraut, die auf einem kleinen Handtuch neben ihm saß, fand, das Brot roch eklig. Kein Wunder, der Essenskorb lag doch schon seit einer Weile in der Sonne, nur bedeckt mit einem weißen Handtuch.
«Wer als Letzter bei den Handtüchern ist», rief Hinrich, «ist ein Friedrich!»
Waltraut fand ihren Vater so gemein.
Sie sah zu Friedrich, der an der Wurststulle mehr lutschte als aß. Sie schmeckte ihm nicht, aber er traute sich nicht, etwas zu sagen.
Waltraut nuckelte wieder am Zeigefinger.
Hinrich und Klaus liefen aus dem Wasser. Dabei wartete der Papa nicht auf seinen vom Schwimmen erschöpften Sohn. Der sollte sich ruhig anstrengen, um mitzuhalten. Wie sollte sonst ein Mann aus ihm werden?
Klaus bemühte sich nach Leibeskräften, aber schon nach den ersten Schritten war der Rückstand zu groß. Das ärgerte ihn. Er wollte so sein wie Papa! Dem Kleinen schossen die Tränen in die Augen. Er hörte auf zu laufen und schlurfte nur noch durch den Sand. Hinrich rief ihm zu: «Mach nicht schlapp, kleiner Mann!»
Klaus rannte wieder los, vielleicht könnte er doch noch aufholen, aber Hinrich lief sogar noch schneller und warf sich lachend auf das Handtuch. Klaus trottete daraufhin beschämt und mit den Tränen ringend zu den anderen. Als er ankam, fragte Friedrich ihn mit vollem Mund: «Wollen wir nachher Ball spielen?»
Tante Brigitte wandte sich zu ihrem Sohn: «Du solltest dich nicht so anstrengen, du solltest lieber …»
Bevor sie weitersprechen konnte, trat Klaus voller Wut gegen Friedrichs Ball. Der flog weit weg. Vor Schreck fing Friedrich an zu weinen.
Waltraut hörte auf zu nuckeln, sie erhob sich, nahm sich eine Stulle aus dem Korb und warf sie ihrem großen Bruder an den Kopf.
Hinrich lachte, als die Unterseite mit der Leberwurst an Klaus’ Stirn klebte, während die andere Hälfte über seine Nase rutschte und zu Boden fiel. Brigitte musste sich ebenfalls ein Grinsen verkneifen, nur Mama Henriette schimpfte: «Waltraut!» Im Gegensatz zu Hinrich hatte sie ihrer Tochter nie den Spitznamen Traudel gegeben, sondern sie immer nur Waltraut genannt. Mal lieb, mal streng wie jetzt. Sie hatte den Namen damals ausgesucht, weil sie dachte, dass er für eine starke und mutige Frau stand: die, die sich in den Wald traut! Dass der Name sich aus den Worten ‹waltan› und ‹trud› herleitete – stark und Herrscherin – und deswegen für eine starke, mutige Frau stand, wusste Henriette nicht. Wie auch? Sie war nur sechs Jahre in der Schule gewesen, bevor sie in der Bäckerei der Eltern mit hatte anpacken müssen. Aber stark sollte Waltraut sein. Musste sie sein! Nicht so wie Karla, die 1933 im Alter von nur fünf Monaten an dem, was die Ärzte ‹Epidemische Genickstarre› nannten, gestorben war.
Klaus’ Kopf wurde knallrot. Er wischte sich das Brot von der Stirn und pfefferte Waltraut eine Ohrfeige.
Waltraut war noch nie geschlagen worden.
Ihr kamen die Tränen, aber sie wollte auf gar keinen Fall heulen. Nicht vor allen anderen. Nicht vor Klaus. Schon gar nicht vor Friedrich, der vor lauter Schreck über die Ereignisse aufgehört hatte zu weinen. Waltraut machte die Augen zu, um die Tränen zurückzuhalten. Sie spürte, wie sie hinter den Lidern brannten.
«Deine Kleine», sagte Tante Brigitte zu ihrer Mama, «ist keine Heulsuse.»
«Die ist eine Löwin», lachte Papa Hinrich.
Löwin – das gefiel Waltraut.
Und besonders, dass ihr Papa stolz auf sie war.
Kein Safier ging nach Panama. Alle Anträge auf Ausreise waren abgeschmettert worden. Aber Rosl bekam überraschend die Möglichkeit, nach Palästina zu gehen. Weil sie in der Betar war und Dr. Perl, Rechtsanwalt und langjähriges Mitglied der zionistischen Organisation, es wie durch ein Wunder geschafft hatte, für 386 junge Juden Visa für Griechenland zu erhalten. Von einer Insel bei Athen sollte es weiter ins Gelobte Land gehen mit einem Schiff namens ‹Artemissia›. Die letzten Kilometer müssten die jungen Menschen schwimmen, um illegal einzuwandern – keine Reise für Alte.
Rosl hatte gejubelt, als sie davon erfahren hatte. Dass sie ihren Ehemann verließ, betrübte sie kaum. Auch schämte sie sich nicht, die Eltern allein zu lassen, wie Joschi es getan hätte. Mama und Papa freuten sich über Rosls Fluchtmöglichkeit. Als sie sich von ihnen in der Rotensterngasse 23 verabschiedete, umarmten sich alle und es flossen Tränen. Dann ließ Rosl sich von ihrem Paul zum Wiener Bahnhof kutschieren, mit Joschi auf der Rückbank.
Von überallher strömten junge Juden zum Bahnhof. Jeder nur mit einem Rucksack, mehr durften sie nicht mitbringen. Die Rucksäcke hatten die Eltern mit allem Sinnigen und Unsinnigen bis zum Bersten gefüllt. Mama Scheindel hatte für ihre Tochter einen mäßig genießbaren Kuchen gebacken, den sie an die Mitreisenden verteilen würde.
Rosl stieg aus dem Wagen, gab Paul noch einen Kuss, und die beiden versprachen sich gegenseitig, dass sie sich wiedersehen würden. Sie drückte Joschi an sich und versprach ihm ebenfalls, ihn wiederzusehen. Er vermochte nicht daran zu glauben.
Rosl ging, wie Hunderte Betar-Mitglieder auch, beschwingt in das Bahnhofsgebäude. Joschi beschloss, ihr zu folgen, um die Abreise zu beobachten. Es war ihm zwar verboten, den Bahnhof zu betreten – die Nazis hatten zur Bedingung gemacht, dass die Operation unter dem Radar lief –, aber wenn einer geschickt darin war, sich ohne Befugnis irgendwo Zutritt zu verschaffen, dann war das ja wohl er.
Joschi sah, wie ein Pressefotograf abgefangen wurde. Die Polizisten nahmen dem Mann die Kamera ab, und Joschi nutzte das Durcheinander, um unbemerkt vorbeizuhuschen.
Im Bahnhof stand der Zug für die Betar zur Abfahrt bereit. Die aufgekratzten jungen Menschen stiegen ein und suchten sich Plätze. Joschi versteckte sich auf einem anderen Bahnsteig hinter einer Werbewand, auf der eine gemalte blonde Frau einen weißen Pelz in der Hand hielt und ‹Global› anpries, das Motten und Mottenbrut tötete. Von hier aus konnte er die ganze Szenerie gut überblicken.
SS-Leute betraten das Gleis und stiegen auf ein extra für diesen Anlass erbautes Podest. Joschis Atem stockte, als er ihren Anführer erkannte. Es war Adolf Eichmann. Der Mann, in dessen Händen das Schicksal eines jeden Juden in Wien lag.