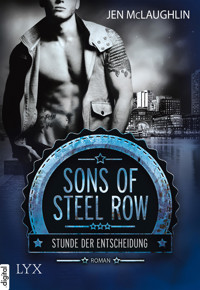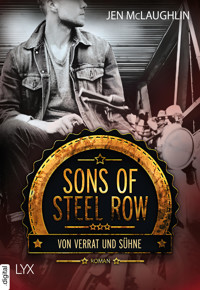
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Steel-Row-Serie
- Sprache: Deutsch
Chris O’Brien hat das Unaussprechliche getan: Er hat seinen besten Freund verraten und wollte ihn töten, um in der Hierarchie der Sons of Steel Row aufzusteigen und seinen Vater stolz zu machen. Doch der Mordversuch missglückt, und Chris wird angeschossen. Verletzt und mit einem Kopfgeld im Nacken ist er nun auf der Flucht. Als er in eine Apotheke einbricht, um sich selbst zu verarzten, wird er von Molly Lachlan auf frischer Tat ertappt. Die beiden kennen sich von früher und Molly ist Chris‘ große Liebe - allerdings ahnt sie nichts von seinen Gefühlen. Für Molly ist Chris der attraktiv-gefährliche ehemalige Nachbar, den sie mit nach Hause nimmt, damit er sich von seiner Schusswunde erholen kann. Doch schon bald entwickelt Molly tiefe Gefühle für den Biker, die sie nicht für möglich gehalten hatte. Chris zeigt ihr Seiten, die sie faszinieren und an das Gute in ihm glauben lassen. Es dauert allerdings nicht lange, bis die Gang, die Chris töten will, ihn aufspürt und damit auch Molly in höchste Lebensgefahr bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmung123456789101112131415161718192021 222324252627EpilogDanksagungDie AutorinDie Romane von Jen McLaughlin bei LYXImpressumJEN MCLAUGHLIN
Sons of Steel Row
Von Verrat und Sühne
Roman
Ins Deutsche übertragen vonStefanie Zeller
Zu diesem Buch
Chris O’Brien hat das Unaussprechliche getan: Er hat seinen besten Freund verraten und wollte ihn töten, um in der Hierarchie der Sons of Steel Row aufzusteigen und seinen Vater stolz zu machen. Doch der Mordversuch missglückt, und Chris wird angeschossen. Verletzt und mit einem Kopfgeld im Nacken ist er nun auf der Flucht. Als er in eine Apotheke einbricht, um sich selbst zu verarzten, wird er von Molly Lachlan auf frischer Tat ertappt. Die beiden kennen sich von früher, und Molly ist Chris’ große Liebe – allerdings ahnt sie nichts von seinen Gefühlen. Für Molly ist Chris der attraktiv-gefährliche ehemalige Nachbar, den sie mit nach Hause nimmt, damit er sich von seiner Schusswunde erholen kann. Doch schon bald entwickelt Molly tiefe Gefühle für den Biker, die sie nicht für möglich gehalten hatte. Chris zeigt ihr Seiten, die sie faszinieren und an das Gute in ihm glauben lassen. Es dauert allerdings nicht lange, bis die Gang, die Chris töten will, ihn aufspürt und damit auch Molly in höchste Lebensgefahr bringt.
Für all diejenigen, die sich in Lucas Donahueaus dem ersten Band verliebt haben.
1
Chris
Es gibt Momente, da sollte man einen ehrlichen und schonungslosen Blick auf sein Leben werfen und sich eingestehen, dass man in der Scheiße steckt, und zwar richtig tief. Und dass man aus eigenem Verschulden jetzt in dieser Gasse hinter einem abgewrackten Waschsalon liegt, den Tod vor Augen. Weil man die falschen Entscheidungen getroffen, Mist gebaut, Dinge getan hat, die man am liebsten ungeschehen machen würde.
Denn das hatte ich. Und deswegen hatte ich es verdient.
Allein zu sterben und so gewaltsam, wie mein ganzes Leben gewesen war.
Ich drehte meinen Kopf zur Seite, um Blut auszuspucken, und es landete auf der Betonmauer neben mir. Ich musste lachen, als es fast wie ein Smiley aussah. Warum auch nicht? Doch mein Lachen ging in ein Stöhnen über, als mir ein Stich durch die Rippen fuhr. Ich presste die Hände auf den Brustkorb, rollte mich vorsichtig herum und starrte finster in den Himmel hinauf. Der raue Beton drückte sich in meinen schmerzenden Rücken. Von den nahen Docks wehte der Geruch von wochenaltem Müll und verrottenden Rattenkadavern herüber.
Es war eine mondlose Nacht und keine Wolke am Himmel. Die Sterne leuchteten auf mich herunter – immer gleich, immer da –, als verhöhnten sie mich, weil ihnen eine strahlende Zukunft winkte. Während ich diese Nacht vermutlich nicht überleben würde.
Weil ich versucht hatte, meinen besten Freund umzubringen.
Und er hatte mich am Leben gelassen.
Lucas Donahue hätte mich töten sollen, statt mir nur eine Kugel zu verpassen und die Rippen zu brechen. Er war wie ein Bruder für mich gewesen, und ich hatte versucht, ihn reinzulegen. Was ihn beinahe alles gekostet hätte. Er hätte mich kaltblütig erschießen sollen wie einen tollwütigen Hund. Denn mehr war ich nicht. Ich hatte es verdient. Doch stattdessen hatte er Erbarmen gehabt und mich gehen lassen.
Aber warum? Ich verstand es nicht.
Schon in dem Moment, als er mich seine Wohnung lebend verlassen ließ mit einem zusammengeknüllten blutverschmierten Blatt Papier in der Hand, das mir zu allem verhelfen konnte, was ich je hatte haben wollen, wusste ich, dass ich einen Riesenfehler gemacht hatte. Niemals hätte ich mich an meinem Blutsbruder vergreifen dürfen, um in einer Gang aufzusteigen, die mich irgendwann mit großer Wahrscheinlichkeit über die Klinge springen lassen würde. Weil ich so blöd gewesen war, meinem Vater zeigen zu wollen, dass ich härter war als er. Dass ich ihn auf seinem eigenen Terrain schlagen konnte. Kalt sein konnte. Gnadenlos. Ein Killer.
Das war ich auch. Nur nicht bei Lucas.
Der Verrat an Lucas war das Einzige, was ich in meinem Leben bereute. Normalerweise machte ich mir keine Gedanken über hätte, könnte, sollte. Das brachte nie etwas. Aber wenn ich die Zeit zurückdrehen und alles, was ich Lucas angetan hatte, ungeschehen hätte machen können …
Ich würde es sofort tun.
In meiner Hosentasche steckte der blutbefleckte Zettel, auf dem Lucas’ Nachfolger benannt wurde, so wie ich es hatte haben wollen. Damit war Lucas raus, gehörte nicht mehr zur Gang. Doch als sein jüngerer Bruder Scotty dann plötzlich mit der Waffe in der Hand dastand, wusste ich, dass ich nicht gewinnen konnte, egal wie es ausging.
Aber um die Wahrheit zu sagen, es war mir schon vorher klar gewesen, dass ich einen Fehler gemacht hatte.
Lucas hatte mich so voller Hoffnung angesehen, als er dachte, ich sei gekommen, um ihm zu helfen, dass ein Teil von mir in dieser Wohnung gestorben war, zusammen mit den anderen Männern. Und dann, als ihm aufging, dass ich von Anfang an hinter allem gesteckt hatte …
… da gab es kein Zurück mehr.
Es war zu spät gewesen.
Zu spät, um zu sagen: »Weißt du was, Mann? Lass gut sein. Vergessen wir das alles.« In der Sekunde, als Lucas begriff, dass ich versuchte, ihn aus dem Weg zu räumen, weil ich scharf auf seinen Job war, war ich ein toter Mann, egal, ob er den Abzug drückte oder nicht. Die ganze Zeit hatte ich gedacht, unsere Freundschaft sei nur ein Zweckbündnis gewesen. Dass Lucas seine Beziehungen zu mir und Dad benutzt hatte, um in die Gang zu kommen. Dass er nur mein Freund geblieben war, weil er es sich nicht leisten konnte, diese Beziehung aufs Spiel zu setzen.
Doch Lucas hatte sich von mir verraten gefühlt, das war nicht gespielt gewesen. Trotzdem hatte er mich leben lassen. Mein eigener Vater hätte nur gelacht und mir ins Gesicht geschossen, nicht aber Lucas. Und da begriff ich, dass ich mich bei dem Versuch zu beweisen, dass ich besser war als er, in meinen Vater verwandelt hatte.
Es gab nichts auf der Welt, was mich mit mehr Abscheu erfüllte.
Meine Wut darüber hatte ich an Lucas ausgelassen. Um ihn dazu zu bringen, mich abzuknallen, mich von meinem Elend zu erlösen. Doch es hatte nichts genutzt. Er hatte ehrenhaft gehandelt. Selbst nach dem ganzen Mist, den ich ihm angetan hatte, wollte er nicht meinen Tod und hatte Scotty befohlen, mich gehen zu lassen … und ich war gegangen.
Jetzt gab es keinen Lucas mehr.
Offiziell war er tot. Scotty hatte dafür gesorgt. Doch in Wahrheit hatte er zu diesem Zeitpunkt Boston und den Slum, den wir Steel Row nannten, vermutlich schon Meilen hinter sich gelassen – während ich, dem Macht wichtiger als Bruderschaft gewesen war, dabei war, in der schlimmsten Gegend von Southie abzukratzen.
Ich hätte Lucas’ Leben leben sollen. Er war der Typ Mann, für den Freunde und Familie immer an erster Stelle kamen. Der Typ Mann, der dir, weil ihr euch als Kinder Blutsbrüderschaft geschworen hattet, auch dann noch den Arsch rettet, wenn du gerade versucht hast, ihn abzuknallen.
Und hier war ich nun, ein verdammter Idiot.
Jeden Moment würde mein Handy klingeln, weil man mir die Nachricht von Lucas’ »Tod« überbrachte. Man würde erwarten, dass ich entsetzt wäre. Außer mir vor Wut. Vor Trauer. Und die Sache war die: All das war ich, obwohl er gesund und munter war.
Weil ich ein Monster geworden war.
Ich lachte wieder. »Ruhe in Frieden, Lucas Donahue.«
Als wäre das das Stichwort gewesen, summte mein Handy. Ich verzog das Gesicht, zwängte unter Schmerzen die Finger in die Hosentasche und holte mein iPhone heraus, um mit zusammengekniffenen Augen einen Blick auf das Display zu werfen. Ich seufzte. Es war Tate, das Oberhaupt der Sons of Steel Row, meiner Gang. Jetzt hieß es gut schauspielern. »Hallo?«
»Wo bist du?«, fragte Tate mit harter Stimme.
Ich mühte mich in eine sitzende Stellung und lehnte mich mit dem Rücken an die Betonwand, neben das blutige Smiley. »Ich bin ein paar Bitter-Hill-Typen in die Quere gekommen. Versuche mich gerade ein bisschen zu erholen, bevor ich zurückfahre. Warum? Was ist los?«
»Gerade sind schlechte Nachrichten reingekommen … Wegen Lucas.«
Ich rieb mir die pochende Stirn. Keine Ahnung, was Scotty ihm schon gesagt hatte. Aber ich durfte mich nicht verplappern. »Wo ist er?«
»Es tut mir leid, aber er ist tot.« Tate gab ein Knurren von sich. »Die beschissenen Bitter-Hill-Leute haben ihn und sein Mädchen ausgeschaltet. Dann haben sie den ganzen Laden abgefackelt, sodass nur noch Knochen und Asche übrig sind, aber der Abgleich mit den zahnärztlichen Unterlagen ist eindeutig. Lucas ist tot.«
Ich blinzelte. Wie zum Teufel waren sie an die Zahnarztakten herangekommen – und so schnell? Nach dem Überfall hatte ich das Haus noch eine Weile im Auge behalten, weil ich wissen wollte, ob Lucas und Heidi auch wirklich ihr Wort hielten und verschwanden. Scotty hatte ihnen mit einem Lächeln nachgewunken. Sie waren tot und trotzdem … Oh Scheiße. Verfickte Scheiße.
Jetzt ergab alles einen Sinn.
Scotty war ein bisschen zu schnell bereit gewesen, mein Geheimnis zu wahren. Und die Art, wie er seine Waffe gehalten hatte, als er in Lucas’ Wohnung geplatzt war … das sagte alles. Über seine wahre Identität. Und seine Haltung, ganz gerade und stramm, der feste Griff um die Pistole – so wie man es auf der Akademie lernt. Scotty war ein verfluchter Cop.
In den Augen von Steel Row war das schlimmer als das, was ich getan hatte. Schlimmer als Verrat.
Wenn ich Tate davon erzählte, wäre Scotty nicht nur innerhalb einer Stunde tot und seine Leiche so zerstückelt, dass sie nicht wieder zusammengesetzt werden könnte. Meine Stellung in der Gang wäre sicherer denn je, wenn ich ihn auffliegen ließ. Dann gehörte Lucas’ Posten mir, und Dad wäre endlich stolz auf mich.
Meine Zukunft wäre gesichert, ein für alle Mal.
Aber er war Scotty Donahue, Lucas’ kleiner Bruder …
Der Bruder des Mannes, dem ich Unrecht zugefügt hatte.
»Chris?«, sagte Tate laut. »Bist du noch dran?«
Ich hatte wohl zu lange geschwiegen. Doch er würde meinen Schreck darüber, dass Scotty ein Bulle war, für Trauer über Lucas’ Tod halten. Ich räusperte mich. »J-ja. Ich bin nur … Ich kann nicht … Ich werde sie alle kaltmachen. Jeden Einzelnen von ihnen. Jetzt gleich.«
»Nein.« Etwas donnerte auf Holz. Höchstwahrscheinlich auf Tates Schreibtisch aus Walnussholz. Er liebte den Luxus so sehr, wie ich die Frauen liebte. »Wir müssen klug vorgehen. Uns haben schon genug Cops im Visier, es müssen nicht noch mehr werden, weil wir einen Gangkrieg in Steel Row anfangen. Das ist der sichere Weg in den Knast. Ich denke, wir haben alle genügend Zeit darin verbracht.«
Das war sie. Die Gelegenheit, meinen Verdacht über Scottys Nebenjob zur Sprache zu bringen. Es wäre so einfach. Sehr viel einfacher, als Lucas zu erschießen. »Was erwartest du? Die haben meinen besten Freund umgebracht. Ich … ich … ich kann nicht einfach nichts tun.«
»Das musst du aber, bis wir einen idiotensicheren Plan haben. Bis dahin …« Es krachte erneut, und ich hörte jemanden mit leiser Stimme etwas sagen. »Okay, ja. Dein Dad hat vom Flughafen aus angerufen. Er hat vorgeschlagen, dass du dir eine Auszeit nimmst, und ich habe zugestimmt. Halt eine Weile den Ball flach. Geh saufen, such dir was zum vögeln. Was immer nötig ist, damit du wieder klarsiehst.«
Ich knirschte mit den Zähnen. Typisch. Mein Dad hatte sofort angenommen, dass ich schwach sei, nicht belastbar. Und schlimmer noch: Wenn er wüsste, dass ich versucht hatte, Lucas auszuschalten – und gescheitert war –, dass sein Tod nur vorgetäuscht war, wäre er nicht so schnell dabei, mich zu schützen. »Bist du sicher? Brauchst du mich nicht? Ich meine … Herrgott. Lucas.«
»Ich weiß.« Tate seufzte. »Kümmere dich um dich. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir überlegen, wie wir weiter vorgehen, und sobald wir etwas Konkretes haben …«
»Ich will der Erste sein, der den Abzug drückt.«
»Versprochen.«
»Danke.« Ich blickte hinunter auf mein blutgetränktes T-Shirt und die braune Lederjacke. Wenn ich die Schusswunde nicht rasch nähte, wäre es bald aus mit mir. »Das weiß ich zu schätzen.«
»Ist doch klar.«
Die Leitung war tot. Ich ließ die Hand auf den Oberschenkel sinken. Schon das Telefon zu halten, kostete mich zu viel Anstrengung. Tat zu weh. Aber das war gar nichts verglichen mit dem Schuldbewusstsein, das mir die Luft abschnürte. Ich schlug den Kopf gegen die Wand, so fest, dass ich erneut Sterne sah. »Verdammte Scheiße, Scotty.«
Wusste er denn nicht, in welche Gefahr er sich brachte? Als Polizeispitzel in einer Gang? Wenn Tate das herausfand …
Mit zusammengebissenen Zähnen stemmte ich mich schwankend auf die Beine.
Ich hatte viel Blut verloren, und wenn ich nicht tatsächlich in dieser dunklen Ecke sterben wollte, musste ich dringend etwas unternehmen. Es gab eine Apotheke außerhalb von Steel Row, im schicken Teil der Stadt, den die Southies gewöhnlich mieden. Doch diese arbeitete für die Sons, dank meinem Dad und seiner Vorliebe für das Glücksspiel. Wenn ich es durch die Hintertür schaffte, kam ich vielleicht an Verbandszeug und Schmerzmittel, um mich selbst zusammenzuflicken, und dann …
Dann was?
Ich hatte keine verdammte Ahnung.
Sollte ich darauf vertrauen, dass Scotty, der Cop, mich nicht an Tate verpfiff? Dass er ihm nicht von meinen Lügen und meinem Verrat berichtete? Wenn er es täte, wäre das mein Todesurteil, egal was Dad sagte. Ich wäre ein toter Mann. Und was noch schlimmer wäre: Wenn Scotty seinen Vorteil nutzte – und mich den Bullen auf einem Silbertablett servierte. Ich hatte so viel Scheiße auf dem Gewissen, dass es kein Problem für ihn wäre, mich im Knast verschwinden zu lassen. Oder ich verriet Tate Scottys schmutziges kleines Geheimnis zuerst und lud damit die Verantwortung auf meine Schultern, dass noch jemand aus der Donahue-Familie »verschwand«.
Oder … ich tauchte einfach unter.
Und wartete ab, bis sich alles wieder beruhigt hatte.
Überstürzte Entscheidungen sind nie gut. Bitter Hill würde nach dem Tod von vier ihrer Leute zurückschlagen, das war so gut wie sicher. Und es würde mich treffen. Zwar hatte ich Phil und seine Männer, die ich angeheuert hatte, um Lucas auszuschalten, zur Verschwiegenheit verpflichtet, doch das hieß nicht, dass sie nicht irgendwem gegenüber die Klappe aufgerissen hatten.
Etwas anderes war von Typen wie ihnen nicht zu erwarten.
Ich stolperte die Gasse hinunter. Jeder Schritt war qualvoller als der vorherige. Lucas hatte mich beinahe umgebracht. Wahrscheinlich wäre das besser gewesen. Ich hatte den Tod verdient. Vielleicht sollte ich mich einfach hier auf den Boden legen und verbluten. Eine friedliche Art zu sterben für einen Mann wie mich. Ich würde einfach mein schwarzes Blut über den schmutzigen Beton laufen lassen, bis von mir nur noch eine vertrocknete Hülle übrig war.
Doch mein verdammter Überlebensinstinkt hatte etwas dagegen.
Der Verrat an meinem besten Freund war unverzeihlich, das stimmte. Aber jetzt einfach aufgeben und mich vom Teufel in die Hölle zerren lassen? Das konnte ich nicht. Und Scotty, der Idiot, hatte bei der ganzen Sache auch eine Menge zu verlieren. Wenn er nicht wollte, dass seine Tarnung aufflog, brauchte er mich. Damit ich seine Geschichte stützte.
Wenn er ihnen erzählte, dass ich ebenfalls dort gewesen war, musste ich das bestätigen.
Nur so konnte ich Scotty schützen.
Ich musste meine Rolle spielen. Tate und die anderen von Steel Row erwarteten, dass ich Rache wollte, dass ich bitter war und wütend. Das kriegte ich hin. Für eine Versöhnung mit Lucas war es zu spät, ich konnte ihm nicht mehr sagen, wie leid mir alles tat. Aber ich konnte Scotty retten.
Weil ich es Lucas schuldete.
Eine Kleinigkeit, eigentlich. Nicht annähernd genug, um all meine Taten wiedergutzumachen, oder die Lügen, die ich auf der Suche nach Macht und Dads Anerkennung erzählt hatte.
Aber immerhin etwas.
Und das musste genügen.
Schwer atmend, die Hand auf meine blutende Schulter gepresst, trat ich um die Ecke. Als sich alles vor meinen Augen zu drehen begann, lehnte ich mich gegen eine raue Backsteinmauer. Ich brauchte ein paar Sekunden, um Kräfte zu sammeln.
Um sicherzugehen, dass ich nicht das Bewusstsein verlor …
»Sieh mal einer an, wen haben wir denn da?«, sagte eine Männerstimme hinter mir aus dem Dunkel. Verdammt, ich kannte diese Stimme. Reggie, ein Bitter-Hill-Lieutenant, war der Einzige, der sonst noch meinen Plan gekannt hatte. Und damit der Einzige, der wusste, warum seine Kollegen gestorben waren, und wie. Obwohl er dieses Wissen vermutlich nicht weitergegeben hatte, denn ein Paktieren mit Steel Row wäre auch sein und Phils sicherer Tod. »Chris O’Brien, verletzt und allein.«
Ich grinste. »Reggie, gut, dich zu sehen, Mann.«
»Wo sind meine Männer, O’Brien?«
»Ja, was das angeht …« Ich zuckte die Achseln und ignorierte den Schmerz, der schon bei dieser kleinen Bewegung durch meine Schulter schoss. »Offenbar war Lucas nicht so einfach auszuschalten, wie ich gedacht hatte. Es wurde hässlich und es gab Verluste, aber er ist tot.«
Reggie rieb sich das Kinn und kam näher. Sein Haar war so schwarz wie seine Augen. Als er direkt hinter mir stehen blieb, versteifte ich mich. Ich mochte es nicht, wenn jemand in meinem Rücken war. Vor allem nicht Typen wie er – Typen wie ich. »Lass mich raten. Steel Row denkt, das waren wir, und du bist aus allem raus.«
»Ich habe keine beschissene Ahnung. Bisher habe ich noch nichts gehört. Ich hab ganz schön was abbekommen, falls es dir entgangen sein sollte.« Ich richtete mich auf und drückte mich von der Wand ab. »Aber sobald ich weiß, wer dafür dran glauben soll, lass ich es dich wissen.«
Reggie lachte leise. »Ja, sicher doch. Du hältst mich wohl für blöd.«
Na ja, eigentlich … »Nicht doch, Mann.«
»Warum sollte ich dir glauben?«
Obwohl es wehtat, zuckte ich mit den Achseln. »Warum nicht? Du hast ein paar Männer verloren, dafür aber Lucas Donahue kaltgemacht. Das ist doch gar nicht mal so schlecht.«
»Weißt du, was ich gar nicht mal so schlecht finden würde?« Er schnipste mit den Fingern, und zwei Männer traten aus der Dunkelheit. »Tötet ihn. Und seid nicht zimperlich.«
Er ging weg, ohne sich noch einmal umzudrehen, um sich zu vergewissern, dass seine Männer den Befehl auch befolgten. Ich griff nach meiner Waffe – doch dann fiel mir ein, dass Lucas sie mir abgenommen hatte. »Scheiße.«
Reggies Leute grinsten. Einer zog eine Glock mit einem Schalldämpfer hervor. »Willst du noch ein paar letzte Worte sagen?«
Es tut mir leid, Lucas. Ich zwang mich zu einem Grinsen und ging langsam auf sie zu. Als die Hand an der Waffe zu zittern begann, sah ich meine Chance gekommen. Ein Mann, der zögerte, war leicht zu überwältigen. »Unterschätze nie jemanden, der nichts zu verlieren hat.«
Ich warf mich auf ihn, und wir trafen mit einem Knall auf dem Boden auf – buchstäblich, denn die Pistole ging los. Wundersamerweise traf die Kugel den Mann, der gerade seinem Kumpel zu Hilfe eilte. Er ging zu Boden, sein Leib verkrampfte sich, und er würgte Blut. Der Mann unter mir fluchte und verpasste mir einen üblen rechten Haken gegen die Nase. Gegen die Schwärze anblinzelnd, rollte ich mich zur Seite, aber zu spät.
Nun würde ich doch in dieser Gasse sterben.
Und ich hatte es verdient.
2
Molly
Es ist Samstagabend, und du sitzt in der Schule und benotest Klassenarbeiten. Soll das alles sein, was du aus deinem Leben machst, Molly? »Ich unterrichte und forme kleine Lebewesen«, murmelte ich.
Das stimmte, und doch belog ich mich selbst. Ich war hier, an meinem freien Tag, weil ich Ablenkung brauchte und es unerträglich für mich war, allein zu Hause zu sitzen. Blinzelnd wandte ich mich wieder den Bildern auf meinem Schreibtisch zu. Eine blau-rote Katze funkelte mich böse aus ihren hellgrünen Augen an. Ich hatte den Kindern gesagt, sie sollten das Tier in den Farben ausmalen, wie sie auch bei echten Katzen vorkamen, und dies war bei dem entzückenden kleinen Johnny herausgekommen. Ich wusste nicht, ob ich von seiner unvoreingenommenen Kreativität beeindruckt sein sollte, besorgt, dass er tatsächlich irgendwann einmal eine solche Katze gesehen haben könnte, oder froh, dass er beim Ausmalen so schön innerhalb der Umrisslinien geblieben war.
Also zeichnete ich ein lächelndes Gesicht darauf und ging zur nächsten Katze über.
Die war grau mit blauen Augen und sehr realistisch. Noch ein lächelndes Gesicht.
Seufzend lehnte ich mich auf dem Stuhl zurück, rieb mir die Stirn und sah aus dem Fenster. Mist. Während ich über der farbigen Katze und all den anderen davor gesessen hatte, war es dunkel geworden. Der Himmel war schwarz, ohne einen Anflug von Farbe.
Zeit, nach Hause zu gehen.
Ich würde mir ein Glas Elmo Pio Moscato eingießen und versuchen zu vergessen, dass ich heute vor fünf Jahren hatte zusehen müssen, wie mein einziger nächster Verwandter, meinVater… gestorben war. Versuchen, nicht an den gnadenlosen Mann zu denken, der den Quick-E mart überfallen hatte, in dem mein Vater nur schnell hatte Milch kaufen wollen. Und dass mein Vater das Leben einer Mutter und ihres kleinen Kindes gerettet … und es mit seinem bezahlt hatte.
Alles nur, weil irgendein Gangster beweisen musste, dass er ein skrupelloser Killer war.
Und die Krönung des Ganzen war, dass mein Vater, nachdem meine Mutter an Krebs gestorben war, als ich noch ein kleines Kind war, immer nur Männern wie dem, der ihn getötet hat, hatte helfen wollen. Sie zu rehabilitieren, ihnen eine bessere Art zu leben zu zeigen.
Es hatte ihn – buchstäblich – umgebracht.
Tja, Ironie des Schicksals. Der Schütze hatte mir an diesem Tag alles genommen, und ich konnte nichts tun, das daran etwas geändert hätte. Ich war allein, Dad war tot und …
Und … ja, das fasste es wohl ganz gut zusammen.
Es klopfte an der Tür, und ich blickte auf. »Herein.«
»Hallo«, sagte Hollie Yardley, ebenfalls Lehrerin an dieser Schule und meine Freundin. »Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du noch da bist. Gehst du bald?«
»Ja, ich glaube schon. Eigentlich jetzt.«
Sie lächelte. »Hast du Lust, auszugehen? Rachel und ich wollten in den Club, um zu tanzen und etwas zu trinken. Und vielleicht findet sich auch jemand Attraktives für einen Flirt. Bist du dabei?«
Das war so ungefähr das Letzte, worauf ich heute, am Todestag meines Vaters, Lust hatte, aber ich zwang mich trotzdem zu einem Lächeln, weil ich Hollie mochte. »Danke, aber ich glaube, ich gehe nach Hause und arbeite die letzten Folgen von The Walking Dead ab.«
Hollie verlor ihr Lächeln nicht, aber ich sah den Ausdruck in ihren Augen. Der, der sagte, dass ich nie etwas anderes tat, als nach Hause zu gehen und vor dem Fernseher zu sitzen. Doch das war mein Leben. Dort war ich glücklich, und dort wollte ich sein. Warum sollte ich abends ausgehen, wenn alle Mörder und Irren unterwegs waren, um mich in irgendeiner zwielichtigen Bar von irgendeinem zwielichtigen Typen anmachen zu lassen, wenn ich gemütlich auf meiner Couch sitzen konnte, mit einem Glas Wein und meiner rothaarigen Katze auf dem Schoß?
Nein, danke.
»Na gut, vielleicht nächstes Mal?«, sagte Hollie.
Ich nickte. »Auf jeden Fall.« Lügnerin. Und wir beide wussten es. »Sag mir Bescheid.«
Nachdem sie gegangen war, rieb ich mir wieder die schmerzende Stelle zwischen den Augenbrauen. Okay, ja, es war nicht spurlos an mir vorübergegangen, als ich meinen Vater auf dem Bürgersteig hilflos hatte verbluten sehen. Vielleicht war das wirklich der Grund, warum es mir schwerfiel, mich unter Menschen zu begeben und mich zu amüsieren, warum ich nicht so offen und kontaktfreudig wie Hollie war. Irgendwie fand ich es verrückt, sich in der Öffentlichkeit zu betrinken und darauf zu vertrauen, dass niemand die verlangsamten Reflexe und erhöhten Pheromone ausnutzte.
Manche Menschen nannten das möglicherweise Paranoia.
Ich nannte es: am Leben bleiben.
Ich schluckte schwer, stemmte mich vom Schreibtisch hoch und stand auf. Normalerweise arbeitete ich samstags nicht, doch heute hatten sich alle Lehrer gemeinsam um die Frühlingsdekoration im Haus gekümmert, da die Frühlingsferien am nächsten Mittwoch begannen. Weil die Sonne schon vor Stunden untergegangen war, holte ich den Pfefferspray hervor. Dies war keine üble Gegend, und ich hielt mich stets fern von Steel Row im Süden der Stadt, wo Mord und Totschlag regierten – und wo mein Vater ermordet worden war –, aber trotzdem.
Man kann nicht vorsichtig genug sein.
Das hatte mich das Leben auf die harte Tour gelehrt, mit Blut. Geh keine unnötigen Risiken ein. Denke nach. Und um Gottes willen, bring dich nicht in gefährliche Situationen. Spiel nicht die Heldin. Helden werden getötet.
Als ich den leeren, dunklen Flur hinunterging, knallte eine Tür hinter mir zu. Ich zuckte zusammen, mein Puls raste. Als ich herumfuhr, den Pfefferspray gezückt, schnitt ich mir die Hand an der scharfen abgebrochenen Ecke eines Regalfachs.
»So ein Sch… Ich brach ab. »Scheibenkleister.«
Es war zwar unwahrscheinlich, dass jetzt am Wochenende Kinder anwesend waren, aber ich hatte keine Lust, meinen Job wegen eines schockierten Erstklässlers zu verlieren, weil ich zur falschen Zeit geflucht hatte. Ich schüttelte die schmerzende Hand und betrachtete sie genauer. Als Blut aus der Wunde tropfte, machte ich eine feste Faust. Die Krankenschwester war an einem Samstagabend nicht da, und sie schloss immer die Tür ab, wenn sie ging. Ich war also auf mich selbst gestellt. Offenbar musste ich doch noch auf dem Weg nach Hause einen Halt machen.
Dank meiner eigenen Dämlichkeit.
Was würde Dad sagen, wenn er wüsste, dass ich vor meinem eigenen Schatten Angst hatte? So wollte ich nicht leben, und auch er hätte sich sicher etwas anderes für mich gewünscht. Sein Leben lang hatte er anderen geholfen, und nun konnte ich nicht mal mir selbst helfen. Ich war es leid, zurückzuschauen. Ich wollte nach vorne blicken. Von jetzt an.
»Ein guter Rat, Molly«, flüsterte ich in den leeren Flur hinein. Ich schüttelte den Kopf. Jetzt redete ich schon mit mir selbst.
Tatsächlich schaffte ich es aus der Schule heraus, ohne weiter körperlich Schaden zu nehmen. Als ich im Wagen saß, legte ich die verletzte Hand in meinen Schoß und ließ den Motor an, erleichtert, als sein Dröhnen die Stille füllte. Normalerweise mochte ich die Stille. Sie beruhigte mich. Aber heute Abend … nicht.
Ich hätte mit Hollie ausgehen sollen.
Bis zur Apotheke war es nicht weit. Ich sprang aus dem Wagen, einen alten Burberry-Schal um die Hand gewickelt, um Doc Rutgers weißen Fliesenboden nicht mit Blut vollzutropfen. Gerade wollte ich nach dem Pfefferspray greifen … da hielt ich inne. Schluss mit der Angst wegen dieser einen Nacht vor fünf Jahren, als mein Vater starb. Schluss mit der Angst, Risiken einzugehen, und dafür lieber mehr meinem Vater gleichen.
Angst brachte mir gar nichts ein, außer einem Schnitt in der Hand.
Es war an der Zeit, dass ich mich änderte, zu Ehren meines Vaters.
Ich schlug die Tür zu und ging den Weg zum Eingang hinauf. Die Außenbeleuchtung war an, doch die Apotheke wirkte leer. Vor der Tür blieb ich stehen. Meine Nackenhaare stellten sich auf. Mir war … als würde mich jemand beobachten. Als würde dort draußen in der Dunkelheit jemand auf eine Gelegenheit lauern, um … ja, was zu tun?
Ich fuhr mir mit der Zunge über die trockenen Lippen und rief: »H-hallo?«
Niemand antwortete. Weil niemand da war. Na so was …
Kopfschüttelnd zog ich an der Eingangstür, doch sie rührte sich nicht. Mit gerunzelter Stirn beschirmte ich mit beiden Händen die Augen, wobei der Schmerz mich kurz zusammenzucken ließ, und spähte hinein. Was ich sah, jagte mir einen eiskalten Schauder durch die Adern und den Rücken hinunter und lähmte mich für einen Moment.
Ganz in meiner Nähe, dort, wo sich das Erste-Hilfe-Zeug befand, war der Gang mit etwas Rotem verschmiert. Es sah aus, als hätte einer meiner Schüler mit roter Fingerfarbe gemalt. Mullbinden waren über den ganzen Boden verstreut, zusammen mit einem Desinfektionsmittel, Faden und … einer Nadel. Dahinter entdeckte ich eine offene Flasche Wasser und ein leeres orangefarbenes Tablettenfläschchen mit geöffnetem Deckel. Weiße Tabletten lagen in dem Blut, wie Cheerios in roter Milch. Ich starrte einfach nur wie gebannt darauf, weil …
Jemand war in Doc Rutgers Apotheke eingebrochen und hatte Medikamente gestohlen. Jemand, der sehr stark blutete. Und da er allem Anschein nach nicht ins Krankenhaus gefahren war, um sich dort versorgen zu lassen, dann bedeutete das zweierlei.
Es handelte sich um jemanden, der gesucht wurde oder von jemandem angeschossen worden war, der gesucht wurde. Mit einer Schusswunde ging man nicht zum Arzt, es sei denn, man wollte von der Polizei befragt werden.
Und wer immer es war, war möglicherweise noch hier. Ganz in der Nähe.
Ich schlug die Hand vor den Mund und trat keuchend zurück. Hinter mir fiel etwas auf die Straße. Nach Luft schnappend, fuhr ich herum und griff automatisch nach meinem Pfefferspray. Natürlich vergeblich, weil ich ausgerechnet heute Abend beschlossen hatte, kein Angsthase mehr zu sein. Na toll.
Ich suchte hektisch die Dunkelheit hinter mir ab, hielt Ausschau nach Anzeichen von Gefahr. Abgesehen von dem Geräusch – das alles Mögliche hatte sein können –, war da aber nichts. Den Blick fest geradeaus gerichtet, ging ich langsam weiter, die Hand immer noch vor dem Mund. Falls da draußen irgendwo ein blutender Krimineller war, wollte ich ihm ganz bestimmt nicht in einer dunklen Gasse begegnen.
Um genau zu sein, wollte ich ihm gar nicht begegnen.
Ein Stöhnen durchbrach die Stille, wurde aber schnell unterdrückt. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Mein Herz hämmerte. Auch ohne Harvardstudium hätte ich kapiert, woher das schmerzerfüllte Stöhnen gekommen war … oder von wem. Denn nun sah ich voller Schrecken, dass gleich neben der Apotheke, nur ungefähr einen Meter von mir entfernt, ein Mann aus dem Dunkel hervortrat.
Na ja, eher hervortaumelte.
Er machte einen Schritt vorwärts, dann einen weiteren, einen unsicheren Fuß vor den anderen setzend, in der rechten Hand eine Furcht einflößende Pistole. Er hatte dunkelbraunes Haar und war groß. Bestimmt über eins neunzig. Muskulös. Tattoos. Buchstaben auf den Knöcheln beider Hände. Steel Row las ich und fühlte mich an etwas erinnert, das ich aber nicht einsortieren konnte. Als wenn das nicht gereicht hätte, um mir zu zeigen, welcher Gang er angehörte, trug er eine dunkelbraune Lederjacke, das Zeichen der Sons of Steel Row, sowie ein rotes Halstuch, das das der Bloods war. Steel Row, eine Gegend, in der es viel Kriminalität und Armut gab, wurde von einer skrupellosen Gang regiert. Sie nannten sich die Sons of Steel Row.
Wenigstens würde ich der Polizei eine genaue Beschreibung geben können …
Aus dem Jenseits.
Ich wagte nicht, mich zu rühren, und wünschte, ich wäre unsichtbar. Er hatte den Kopf gesenkt und sich noch nicht in meine Richtung gewandt. Mit ein bisschen Glück würde er einfach zurück in die Dunkelheit wanken und mich in Ruhe lassen. Dann könnte ich mich wegschleichen, um …
Langsam hob der Mann den Kopf.
Es schien so, als würde es ihn große Anstrengung kosten. Beinahe zu große. Und es dauerte so lange, dass ich, als es ihm endlich gelungen war, bereits begriffen hatte, warum mir diese Tattoos und das braune Haar so bekannt vorgekommen waren. Und ich wusste auch, warum ich nicht kehrtgemacht hatte und weggerannt war. Ich musste ihn instinktiv erkannt haben.
Chris O’Brien. Killer, Bandenmitglied und früher mal der umwerfend gut aussehende Nachbarsjunge.
Trotz ihrer Verbindungen zu Steel Row wohnte die Familie in unserem reichen Stadtteil. Als ich fünfzehn war, kauften sie das größte Haus in der Nachbarschaft – was zufälligerweise genau neben dem unseren lag. Wir alle wussten, dass ihr Geld schmutzig war, und auch, dass es besser war, nicht laut zu verkünden, was wir davon hielten. Und ihr Sohn, Chris, war ebenso gefährlich wie sexy – und glauben Sie mir, das wollte was heißen.
Sexuelle Spannung, heiße Blicke, das war er.
Als er achtzehn wurde, zog er aus, aber nach dem Tod meines Vaters stattete er mir immer, wenn er am Wochenende bei seinen Eltern war, einen kurzen Besuch ab. Jeden Sonntagnachmittag tat er mir irgendeinen kleinen Gefallen, obwohl es ein ganz schöner Weg von ihrem Haus zu meinem war. Er mähte den Rasen, wusch meinen Wagen oder putzte die Fenster mit dem Hochdruckreiniger.
Und stets dankte ich ihm mit einem Lächeln, ohne ihn jedoch weiter zu ermutigen. Nie gab ich ihm einen Anlass zu glauben, seine Nettigkeit würde ihm mehr einbringen, denn so war es nicht. Nicht bei mir. Wenn ich dem Verlangen, das er in mir auslöste, nachgegeben hätte, wäre es so gewesen, als würde ich mit dem Feind schlafen. Er war kein guter Mensch. Aber er war attraktiv, das konnte ich nicht leugnen, trotz seiner Neigung, Menschen umzubringen. Die braunen Haare und Augen, die dunklen Tattoos auf seiner blassen Haut, der Bartschatten, der seine Wangen bedeckte.
Sein kantiger, harter Kiefer.
Der wohl zu hart gewirkt hätte, wenn da nicht dieses Grübchen im Kinn gewesen wäre. Diese kleine weiche Delle, dieser charmante kleine Makel, ließ ihn menschlicher aussehen. Aber ich wusste es besser. Er war mehr Monster als Mensch. Wie alle Männer seiner Art. Tief in seinem Inneren, trotz der nachbarschaftlichen Freundlichkeit und dem umwerfend schönen Lächeln …
… war er ein Killer. Er würde immer ein Killer sein.
Aber er war verletzt.
Blut tropfte aus seinem Ärmel, und um ein Loch in der Jacke hatte sich ein dunkler Fleck ausgebreitet. Er war bleich, das war sogar in der Dunkelheit zu erkennen. Unter einem Auge schimmerte die Haut schon blau, und seine Nase schien gebrochen zu sein. Er sah aus, als wäre er von einem Laster überfahren worden. Aber Laster verschossen keine Kugeln, deswegen waren sie wohl in diesem Fall unschuldig.
Er war angeschossen worden.
Mein Herz zog sich zusammen, ich wollte ihm helfen. Doch das würde gegen meine Regel verstoßen, ihn nicht zu nah an mich heranzulassen. Männer wie er hinterließen eine Spur der Zerstörung, und ich wollte nicht, dass es mich traf. Ich hatte nicht vor, zu einem seiner vielen Opfer zu werden. Er lebte in seiner Welt, ich in meiner. Die beiden hatten nichts miteinander gemein. So wie wir.
Aber er blutete.
Mit angehaltenem Atem trat ich einen Schritt zurück, wider alle Vernunft hoffend, dass er mich im Dunkeln nicht sehen konnte. Doch bei der ersten Bewegung hob er die Waffe und zielte auf mich. »Wer immer Sie sind, verschwinden Sie und vergessen Sie, dass Sie mich gesehen haben, sonst schieße ich. Gehen Sie. Und zwar sofort.«
Ich hob die Hände und rührte mich nicht.
Ich hätte tun sollen, was er gesagt hatte. Ich hätte mich umdrehen und weggehen sollen. Wenn ein Mann eine Waffe auf einen richtet und sagt, man solle verschwinden, dann verschwindet man und denkt nicht lange nach. Man steigt in seinen Wagen und fährt weg, bevor er seine Meinung ändert und doch abdrückt.
Aber dies war nicht irgendein Mann. Dies war Chris O’Brien.
Und er war schwach.
Ich wollte schon losgehen, bereit, seinen Anweisungen Folge zu leisten, doch dann erstarrte ich. Was hätte mein Vater getan? Hätte er einem Mann in Not den Rücken gekehrt oder hätte er ihm geholfen? Natürlich kannte ich die Antwort auf diese Frage.
Ich zögerte also nicht länger, sondern tat das Gegenteil von dem, was Chris mir befohlen hatte. Ich ehrte das Andenken an meinen Vater und tat, was er getan hätte. Ich trat näher. »C-Chris? Ich bin es. Molly Lachlan.«
Die Pistole rührte sich nicht. Er blinzelte mich an. »Molly?«
»Ja.« Noch ein kleiner Schritt. »Siehst du? Ich bin es.«
Trotzdem blieb die Pistole, wo sie war. »Shit.«
»Bist du okay?«, fragte ich mit leiser und so harmloser Stimme, wie es mir angesichts der Umstände möglich war. »Ich meine, ich weiß, dass du nicht okay bist. Ich kann sehen, dass du verletzt bist und blutest, und du bist eingebrochen … aber bist du okay?«
Er lachte. Der Klang war so schwer zu ertragen wie der Anblick seines aschfarbenen Gesichts. »Nein. Ich bin ganz und gar nicht okay.«
»Tut mir leid.« Ich schluckte heftig. »Brauchst du Hilfe?«
»Nein.« Endlich senkte er die Waffe. Seine Hand zitterte kein bisschen, obwohl er dem Tode ziemlich nah war. Er sank gegen die Hauswand, als wäre die Anstrengung, aufrecht zu stehen, zu groß. »Geh einfach nach Hause und vergiss, dass du mich gesehen hast.«
Als er sich abwandte, schlug mein Herz schneller. Selbst schwach und verletzt übte der Mann eine unwiderstehliche sexuelle Anziehungskraft auf mich aus, die unmöglich zu leugnen war. Ich rührte mich nicht vom Fleck. »Ich kann dich nicht hierlassen.«
»Klar kannst du.« Er wies schwach auf mein Auto. »Du gehst einfach zu deinem schicken Wagen, lässt den Motor an, trittst aufs Gas und fährst los.«
Ich zögerte, schüttelte dann aber den Kopf.
Aus irgendeinem Grund war ich immer mehr davon überzeugt, dass meine Entscheidung richtig war. Mein Instinkt sagte mir, dass Chris zwar ein gefährlicher Mann war, für mich aber keine Gefahr darstellte. Ich machte noch einen Schritt auf ihn zu, hinein ins Licht der Straßenlaterne.
Er hob wieder die Waffe und zielte auf mich. »Zwing mich nicht dazu, Molly. Ich will dir nicht drohen müssen. Geh einfach.«
Andererseits …
»Du würdest nicht auf mich schießen.« Ich hielt die Hände hoch, und mein Herz raste so sehr, dass es wehtat, denn auch wenn neunundneunzig Prozent meines Verstandes mir sagten, dass er es nicht tun würde, gab es immer noch dieses eine Prozent, das mich anflehte, die Flucht zu ergreifen, und zwar schnell. »Aber wenn du willst, dann los. Drück den Abzug. Ich kann dich nicht aufhalten.«
Er senkte nicht den Blick. An seiner Wange zuckte ein Muskel. Die Pistole blieb, ohne zu schwanken, auf mich gerichtet, und es war eine Kälte in ihm, die mir neu war. Jetzt bekam ich es doch mit der Angst zu tun. Möglicherweise hatte ich mein Blatt überreizt. Weil ich das Andenken meines Vaters ehren wollte. Damit er stolz auf mich war.
Würde ich dafür jetzt den höchstmöglichen Preis bezahlen?
»Verdammt, Prinzessin.« Aber er ließ die Waffe sinken und schüttelte den Kopf. »Warum bist du dir so sicher, dass ich dich nicht erschieße?«
Prinzessin? Wie kam er denn darauf? »Ich weiß nicht. Es ist einfach so.«
»Tja …« Sein Blick fiel auf meine Hand. »Du blutest. Warum blutest du?«
»Was?« Überrascht sah ich an mir herunter. Vor lauter Aufregung hatte ich ganz vergessen, warum ich überhaupt zur Apotheke gefahren war. »Oh. Das. Ja, ich habe mich an der Kante eines Regalfachs geschnitten. Ich wollte Verband und Tape kaufen.«
»Hier.« Chris schob die Pistole in eine Hosentasche und griff in die andere. Dann trat er näher und hielt mir Mullbinden und Klebeband hin. »Da. Ich habe das letzte genommen.«
Ich blinzelte ihn an. Mein Blick blieb an seiner blutgetränkten Jacke hängen und dem Rot, das durch sein Shirt gesickert und seine Hand hinuntergelaufen war. Er war dabei zu verbluten und machte sich Sorgen um meine Hand? »Nichts für ungut, aber ich glaube, du brauchst es dringender als ich.«
»Mir egal, ich bin unwichtig.« Er wedelte damit und funkelte mich böse an. »Nimm es.«
Ich streckte die Hand aus und gehorchte. Als unsere Finger sich berührten, durchfuhr mich das Verlangen wie ein elektrischer Schlag. Ich schnappte nach Luft. Er versteifte sich. Hatte er es ebenfalls gespürt? Ich riss die Hand zurück und brachte ein bisschen mehr Abstand zwischen uns. So viel zumindest, dass ich nicht mehr sein männliches, nach Holz duftendes Cologne riechen konnte – oder sein Blut. »Danke.«
Leise stöhnend sank er gegen die Hauswand. »Ich habe eine Frage.«
Meine Finger schlossen sich fester um das Tape. »Und welche?«
»Glaubst du, dass alle Menschen gerettet werden können?« Er blickte mit gerunzelter Stirn hoch zum Himmel. »Dass sie sich zum Besseren ändern können, obwohl sie schreckliche Dinge getan haben?«
Ich dachte an den Mann, der meinen Dad getötet hatte. Nein, für ihn war keine Rettung möglich, dessen war ich mir sicher. Jahrelang hatte ich versucht, ihn menschlicher aussehen zu lassen. Vielleicht hatte er eine Familie zu versorgen und war nur deshalb in der Gang. Vielleicht war er obdachlos, und die Gang hatte ihn aufgenommen. Ich dachte, wenn ich seine Motive irgendwie nobler machte, wäre es einfacher für mich, den Tod meines Vaters zu akzeptieren.
Leider erfolglos. Dadurch wurde alles nur noch schlimmer.
Deswegen war meine einzige Antwort für Chris auch: »Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.«
»Tja.« Er lachte leise. »Ich auch nicht.«
Und wieder richtete er seinen finsteren Blick hinauf zu den Sternen. Auf einmal verspürte ich den Impuls, ihm über die dunklen Bartstoppeln zu streichen. Ich fragte mich, ob sie sich weich oder kratzig anfühlten. Und aus irgendeinem Grund wollte ich es sehr gern herausfinden.
Aber er war ein Killer.
Ich hätte gehen sollen. Mein Verbandszeug nehmen, in den Wagen steigen und Chris O’Brien für immer vergessen … und die Tatsache, dass er erkennbar zu schwach war, um sich selbst zu versorgen. Und doch gab mir seine Frage zu denken. Hatte er Zweifel? Wollte er sich womöglich bessern? Eigentlich glaubte ich nicht an Schicksal oder göttliches Wirken, aber vielleicht hatte mein Vater mich heute Abend in diese Gasse geführt. Vielleicht sollte ich hier sein und diesem Mann helfen.
Denn er war verletzt.
Heute Abend hatte Chris das wenige Verbandszeug, das er gefunden hatte, mit mir geteilt. Jahrelang hatte er mir immer wieder Gefallen getan, ohne je eine Gegenleistung zu verlangen. Wie der Vater, so die Tochter, vermutlich stimmte der Spruch, denn unter keinen Umständen würde ich mich von jemandem, der Hilfe nötig hatte, abwenden. Ich konnte Chris nicht einfach sich selbst überlassen. Nicht, wenn dies möglicherweise der Moment war, der all seine zukünftigen Entscheidungen bestimmte. Er brauchte nur einen kleinen Anstoß von jemandem, dem er wichtig genug war, um ihm diesen Anstoß zu geben. Und unerklärlicherweise …
… war dieser Jemand ich.
3
Chris
Schwer atmend blickte ich hinauf in die Dunkelheit über uns, um Molly nicht ansehen zu müssen. Von dort oben machte sich Orion in seiner verdammten selbstgerechten Pose, die beschissene Keule in der Hand, über mich lustig, denn er erinnerte mich wieder an Scotty und die Tatsache, dass er ein Cop war. Genau so hatte er in der Tür zu Lucas’ Wohnung gestanden. Herrisch und mutig und selbstgerecht dreinblickend.
Nach Typen wie Orion und Scotty wurden Sternbilder benannt. Man erzählte sich Geschichten über sie, sang noch Hunderte von Jahren später Lieder über ihre Tapferkeit, schrieb Bücher über sie. Und vermutlich bekamen sie auch immer das richtige Mädchen. Mädchen wie Molly Lachlan.
Sie verkörperte in meinen Augen all das, was unerreichbar für mich war.
Sie war anständig. Schön. Erfolgreich. Mutig. Reich wie Krösus, aber durch sauberes Geld. Ihr Vater war Arzt gewesen, bis er gestorben war, hier in meinem Stadtteil. Aus einem Grund, der mir enorm zu schaffen machte. Und jedes Mal, wenn ich sie sah, versuchte ich, für diese Schuld Buße zu tun. Obwohl es gar nicht meine Schuld gewesen war.
Klar, ich tötete, ohne lange zu überlegen, aber niemals jemanden, der es nicht verdient hatte. Diese Männer lebten in derselben Welt wie ich. Sie kannten die Risiken genauso wie ich. Wir alle wussten, dass wir höchstwahrscheinlich bei irgendeinem Machtkampf draufgehen würden und dass unser Tod absolut niemanden juckte.
Ich empfand keine Reue. Leben, die ich ausgelöscht hatte, raubten mir nicht den Schlaf. Ich war Mitglied einer Gang, ich kannte nur das. Mehr würde ich nie kennenlernen. Anders als Lucas hatte ich nicht das Bedürfnis, alles hinter mir zu lassen. Auch ich räumte in der Stadt auf, genau wie die Cops, aber auf meine Art.
Ich tötete Männer wie den, der Mollys Vater getötet hatte. Und dadurch wurde die Welt ein kleines bisschen besser.
An Unschuldigen hatte ich mich nie vergriffen und würde es auch nie mit Absicht tun, aber wenn jemand auf mich schoss, schoss ich zurück, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich schoss nicht vorbei. Scotty war da nicht anders. Wie oft hatte er zugesehen, wie einer seiner »Brüder« abgeknallt wurde, und gewusst, dass es seine Schuld war? Wie oft hatte er seine Polizistenkumpel einen Mann niederschießen lassen, der ihm sein Leben anvertraut hatte … und wie viele schlaflose Nächte hatte er deswegenverbracht?
Keine einzige würde ich wetten. Schließlich war es ja doch nur ein weiterer Dreckskerl, der von der Fahndungsliste der Bostoner Polizei gestrichen werden konnte. Was mich anging, gab es also keinen großen Unterschied zwischen mir und den Cops.
Mir fehlte nur die glänzende Polizeimarke, hinter der ich mich verstecken konnte.
Nachdem ich Orion noch ein letztes Mal in Gedanken verflucht hatte, wandte ich mich wieder Molly zu. Ihr braunes Haar schimmerte sogar im Dunkeln. Sie hatte die leuchtenden haselnussbraunen Augen auf mich gerichtet. Es waren kleine goldene Tupfen darin. Sie hatte unbestreitbar die schönsten Augen, die ich je gesehen hatte.
Wie überhaupt alles an ihr wunderschön war.
Seit Jahren bewunderte ich sie aus der Ferne und wünschte im Stillen, ich könnte gut genug für sie sein. Dass ich eine Chance bei ihr hätte, und sei sie noch so klein.
Aber die hatte ich nicht. Weil ich eben nicht gut genug war.
Und wir beide wussten es.
Also warum zum Teufel haute sie nicht ab?
»Zwing mich nicht, die Waffe wieder auf dich zu richten.« Ich drückte mich von der Wand ab, um gerade vor ihr zu stehen. Sie sollte nicht sehen, wie schwach ich war.
»Wir wissen beide, dass du sie nicht benutzen wirst«, sagte sie schnell und biss sich auf die Unterlippe.
Als ich auf sie zuging, griff ich in meine Hosentasche. Ein richtiges Holster hatte ich nicht; die Pistole hatte ich von dem toten Bitter-Hill-Typen, den ich irgendwo in einer dunklen Ecke zum Verrotten liegen gelassen hatte. Wenn ich ihr erst Angst machen musste, damit sie sich in Sicherheit brachte, kein Problem. Aber sie hatte recht: Ich würde ihr nicht wehtun. Niemals. »Hör zu, Prinzessin. Ich …«
Sie erhob missbilligend den Finger und runzelte die Stirn, so als wäre ich nicht gerade im Begriff, ihr buchstäblich die Pistole an den Kopf zu setzen und ihr zu sagen, dass sie sich verpissen sollte. »Nenn mich nicht so. Ich bin keine Prinzessin.«
Ich nahm die Hand von der Pistole und ließ sie in der Tasche stecken. »Geh einfach. Mach, dass du wegkommst.«
»Das kann ich nicht.«
Ich hob verblüfft die Schultern, ohne mir anmerken zu lassen, wie sehr die Bewegung, die an den von mir selbst gesetzten Nähten zog, schmerzte. »Warum nicht, zum Teufel?«
»Weil du Hilfe brauchst.« Sie kam näher, den Verband immer noch an die Brust gedrückt. »Lass mich dir helfen.«
Ich verstand sie nicht. Was wollte sie von mir? Menschen waren nicht von Natur aus altruistisch. Warum sollte sie mir helfen wollen, wenn ich ihr keine Gegenleistung bieten konnte? Ich war nicht daran gewöhnt, dass Menschen so handelten, auch nicht Frauen. Meine eigene Mutter hatte zugesehen, wie Dad mich meine ganze Kindheit lang schlug, ohne auch nur ein einziges Mal dazwischenzugehen. Ohne mich je anschließend zu verarzten. Aber jetzt stand Molly vor mir und weigerte sich, mich zurückzulassen …
Ich kapierte es nicht.
»Du kannst mir nicht helfen.«
»Ich kann dich nach Hause fahren.« Ihre Stimme war so weich, so musikalisch, dass ich am liebsten die Augen geschlossen hätte, um nur auf sie zu lauschen. Doch dann hätte ich wohl endgültig das Bewusstsein verloren. »Lass mich das wenigstens tun.«
»Die Leute von Bitter Hill haben mich aus dem Hinterhalt angegriffen, und dann haben sie …« Ich blickte an mir herunter. Überall Blut und Schweiß. Das sah nicht gut aus. »Na ja, das mit mir gemacht. Die wissen, wo ich wohne, deswegen ist es bei mir zu Hause nicht mehr sicher. Aber danke für das Angebot. Und jetzt weg mit dir.«
Sie kam noch ein bisschen näher. Diese Augen, die ich so sehr liebte, musterten mich. Augen, die es verdienten, dass man Gedichte und Lieder über sie schrieb, dass man sie auf Papier verewigte. »Dann bringe ich dich in ein Hotel.«
»Ich habe meine Brieftasche verloren.« Ich hatte keine Ahnung wo, ahnte aber, dass sie in Lucas’ Wohnung verbrannt war, zusammen mit den beiden Leichen, die wir für Lucas und Heidi ausgegeben hatten. Und denen, die ich dort zurückgelassen hatte – die Männer von Bitter Hill, die ich angeheuert hatte, um Lucas zu töten. Stattdessen war er ihnen zuvorgekommen, doch mich hatte er verschont. Warum hatte er mich verschont? »Das heißt, keine Kohle. Aber noch mal danke für das Angebot.«
»Ich bezahle.«
Ich biss die Zähne aufeinander. »Auf keinen Fall. Ich will keine Almosen.«
»Das sind keine Almosen. Wir sind Freun…« Sie brach ab und presste die Lippen aufeinander. Richtig so. Wir waren keine Freunde. »Ich meine …«
Sie verstummte, weil sie offensichtlich nicht wusste, was »wir« waren.
Ich dagegen schon.
Wir waren nichts. Flüchtige Bekannte.
Ihre wahren Freunde verbluteten nicht in irgendwelchen dunklen Gassen, weil Krankenhäuser für sie tabu waren. Und sie töteten keine Menschen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und fühlten nicht einen Hauch von Scham deswegen. Das Einzige, was ich bereute, war das, was ich mit Lucas gemacht hatte. Alles andere? Gehörte zum Job.
Auch die beiden Männer, die ich erst vor einer Stunde erledigt hatte.
Es war reines Glück, dass ich das überlebt hatte. Hätte die Waffe des Typen, den ich gewürgt hatte, nicht versagt … Ich hatte ihm das Genick gebrochen, die Waffe genommen und die Kugel aus dem Lauf befreit. Wenn Reggie meinen Tod wollte, musste er schon erfahrenere Leute schicken.
Leute, die auch mit Überraschungen klarkamen.
Denn Typen wie ich starben nicht so leicht.
Endlich fand Molly ihre Stimme wieder. »Ich meine … Ich will dir helfen. Du hast so oft Arbeiten für mich im Haus erledigt und nie etwas dafür verlangt«, endete sie.
Ich zuckte mit den Achseln, doch die frischen Nähte taten sauweh, deshalb lehnte ich mich wieder an die Mauer – so beiläufig wie möglich. »Ich hab nie etwas verlangt, weil ich nichts wollte. Außerdem würde man deinen Namen mit meinem in Verbindung bringen, falls man mich findet. Dann wärst du in Gefahr. Noch einmal: danke, aber nein danke.«
»Du kannst kaum aufrecht stehen«, fuhr sie mich an. Weil ich ein stures Arschloch war, richtete ich mich augenblicklich auf, um ihr zu beweisen, dass sie sich irrte. Sie machte ein finsteres Gesicht. »Was ist mit dem Haus deiner Eltern?«
»Da ist es nicht sicher. Außerdem sind sie nicht da.« Ich spannte den Kiefer an. »Selbst wenn, würde ich nicht dort aufkreuzen, nachdem ich … Ich kann ihnen nicht gegenübertreten, jetzt, da ich …« Als ich mich wankend ein Stück von ihr entfernte, hätte ich fast das Gleichgewicht verloren. Mein Bewusstsein drohte mir mehr und mehr zu entgleiten, je länger ich dort stand und mit ihr diskutierte, aber mir fehlte die Kraft, einfach wegzugehen. »Ich kann einfach nicht. Du hast deiner moralischen Pflicht jetzt Genüge getan, also verpiss dich jetzt endlich.«
»Nein.«
Ich zog eine Augenbraue hoch. »Nein?«
»Nein! Ganz richtig.« Sie kam mit großen Schritten auf mich zu. »Nein.«
»Hör zu, Prinzessin. Ich weiß nicht, was du in mir siehst, aber stell dir das Schlimmste vor, das du kennst, und multipliziere es mit ungefähr einer Million: Das bin ich.« Ich steckte die Hände in die Hosentaschen und packte meine Waffe, konnte mich aber nicht überwinden, sie wieder auf sie zu richten. »Frauen wie du gucken aus dem Fenster ihrer Villa in ihrer schicken Wohngegend und glauben, sie wüssten, was es heißt, ein Krimineller zu sein, dort draußen um sein Leben zu kämpfen. Wenn du es tätest, würdest du jetzt zu deinem Auto rennen, so schnell dich deine zehn Zentimeter Limited-Edition-Louboutins mit den roten Sohlen tragen, glaub mir. Du würdest nicht einen Blick zurückwerfen.«
Sie sah mich erstaunt an, dann hinunter auf ihre Schuhe, als fragte sie sich, woher ich wusste, was es für eine Marke war. Ich wusste viel. Es war mein Job, mich darüber auf dem Laufenden zu halten, wie teuer leichtes Diebesgut war. »Hast du mich jetzt genug beleidigt?«
»Ich habe gerade erst angefangen«, entgegnete ich. Sarkasmus schwang in jedem einzelnen Wort mit. »Ich kann die ganze Nacht so weitermachen.«
Sie starrte mich nachdenklich an, und keine Ahnung warum, aber mir wurde unter ihrem Blick heiß. Er war nicht verführerisch gemeint, nicht mal sexy, aber irgendwie … war er es doch. Weil sie es war, die mich so ansah, und ich sie mehr wollte, als aus diesem Drecksloch herauszukommen.
Aber welche Gefühle sie auch in mir auslöste, welche Wünsche sie in mir weckte, ich würde ihnen nicht nachgeben. Frauen wie sie brauchten keinen Typen wie mich, der ihnen das Leben zur Hölle machte.
Sie verschränkte die Arme vor der Brust, die dadurch nach oben gedrückt wurde. »Komisch, für mich sieht es so aus, als könntest du dich keine Minute länger auf den Beinen halten.«
Jeder anderen Frau hätte ich gezeigt, wie sehr sie sich irrte. Mit einer frechen Antwort, die sie wütend und gleichzeitig scharf auf mich gemacht hätte. Darin war ich gut. Ich wusste, wie Frauen tickten und wie man sie vor Lust zum Beben brachte – und sich selbst zu fragen, wie sie so tief sinken konnten, dass sie mit einem Loser aus Steel Row ins Bett gingen. Aber nicht Molly.
Also zog ich nur eine Augenbraue in die Höhe.
Sie errötete, als sie sagte: »Komm mit zu mir nach Hause.« Sie streckte die Hand aus und berührte mich an meiner unverletzten Schulter. »Ich ziehe die Vorhänge zu, niemand wird dich sehen. Du kannst das Gästezimmer haben und dich ausruhen. Morgen ist ein neuer Tag.«
Was war nur mit dieser Frau los? »Auf keinen Fall.« Ich wich vor ihr zurück und schüttelte ihre Hand ab. »Geh nach Hause. Vergiss mich. Ich habe dich schon vergessen.«
Schön wär’s. ich würde sie niemals vergessen.
»Chris …«
Ich begann, im Zickzack durch die Gasse zu taumeln. Wenn sie nicht ging, musste ich es eben tun. Aber ich schaffte nur ein paar Schritte, bevor ich Sternchen sah und mir schwarz vor Augen wurde. »Scheiße.«
Blind sank ich gegen eine Mauer, die glücklicherweise so nah war, dass ich nicht stürzte. Im selben Moment setzte sie sich in Bewegung. Ich hörte ihre teuren Absätze auf dem Beton klappern. Dann schlang sie mir den Arm um die Taille und stützte mich, als könnte sie mich tatsächlich auffangen, wenn ich fiel.
Dabei würde ich sie wie einen Käfer zerdrücken.
»Was hast du nur vor?«, fauchte sie.
»Ich hau ab«, lallte ich. Offenbar setzte die Wirkung des Vicodin, das ich vorhin genommen hatte, ein. Zumindest lullte es den Schmerz und das Hirn ein. Falls mich jetzt jemand fand und kaltmachte, würde es mir nichts mehr ausmachen, weil ich zu weggetreten war. Gar kein so übler Tod. »Du willst ja nicht abhauen, weil du eine hübsche, kleine Prinzessin bist.«
»Ich sehe, dass die Schmerzmittel angefangen haben zu wirken«, bemerkte sie in tadelndem Ton, wie eine Erzieherin, die ein Kind ausschimpft, weil es auf den Tisch statt auf das Blatt Papier gemalt hat. Wenn mir das als Kind passierte, schlug Dad mich jedes Mal grün und blau. Was mich nicht davon abhielt, es wieder zu tun. So stur war ich. »Du hast viel Blut verloren und vermutlich schon länger nichts mehr gegessen. Es ist ein Wunder, dass du dich noch aufrecht halten kannst … halbwegs zumindest. Bringen wir dich erst mal in Sicherheit.«
»Du musst kein Mitleid mit mir haben. Ich kann nirgendwohin, weil ich etwas getan habe, das du schrecklich finden würdest. Egal was mit mir geschieht, egal in welcher Gasse ich sterbe, ich habe es verdient, und die Welt wird ohne mich ein besserer Ort sein. Mach dir keine Gedanken.«