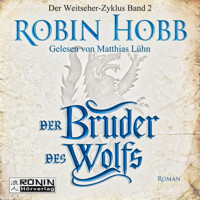12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Regenwildnis-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Die letzten Drachen verlassen sich auf sie – doch für Gold würden Menschen alles tun. Die Fortsetzung der Regenwildnis-Saga, die mit »Wächter der Drachen« begann.
Die Brut der großen Drachin Tintaglia und ihre menschlichen Hüter haben ihr Ziel noch nicht erreicht. Die verlorene Drachenstadt Kelsingra scheint in unerreichbarer Ferne. Doch ein Zurück gibt es nun nicht mehr, denn Drachenjäger sind ihnen auf den Fersen. Plötzlich müssen sich die Drachen neben den Gefahren der Regenwildnis auch noch der Skrupellosigkeit und Gier der Menschen stellen. Misstrauen zu ihren Hütern flammt auf. Zu Recht! Denn unter ihnen sind Verräter, die für Gold alles tun würden.
Die New-York-Times-Bestsellersaga »Regenwildnis« von Robin Hobb ist unabhängig von der Weitseher-Saga lesbar und erscheint komplett bei Penhaligon:
1. Wächter der Drachen
2. Stadt der Drachen
3. Kampf der Drachen
4. Blut der Drachen
Dieser Roman ist bereits unter dem Titel »Drachenkämpfer« auf Deutsch erschienen. Er wurde für diese Ausgabe komplett überarbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 912
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Die Brut der großen Drachin Tintaglia und ihre menschlichen Hüter haben ihr Ziel noch nicht erreicht. Die verlorene Drachenstadt Kelsingra scheint in unerreichbarer Ferne. Doch ein Zurück gibt es nun nicht mehr, denn Drachenjäger sind ihnen auf den Fersen. Plötzlich müssen sich die Drachen neben den Gefahren der Regenwildnis auch noch der Skrupellosigkeit und Gier der Menschen stellen. Misstrauen zu ihren Hütern flammt auf. Zu Recht! Denn unter ihnen sind Verräter, die für Gold alles tun würden.
Autorin
Robin Hobb wurde in Kalifornien geboren, zog jedoch mit neun Jahren nach Alaska. Nach ihrer Hochzeit zog sie mit ihrem Mann nach Kodiak, einer kleinen Insel an der Küste Alaskas. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte. Seither war sie mit ihren Storys an zahlreichen preisgekrönten Anthologien beteiligt. Mit »Die Gabe der Könige«, dem Auftakt ihrer Serie um Fitz Chivalric Weitseher, gelang ihr der Durchbruch auf dem internationalen Fantasy-Markt. Ihre Bücher wurden seither millionenfach verkauft und sind Dauergäste auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Robin Hobb hat vier Kinder und lebt heute in Tacoma, Washington.
Die Regenwildnis-Saga von Robin Hobb ist unabhängig von der Weitseher-Saga lesbar und erscheint komplett bei Penhaligon:
1. Wächter der Drachen
2. Stadt der Drachen
3. Kampf der Drachen
4. Blut der Drachen
Die Chronik der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Die Gabe der Könige
2. Der Bruder des Wolfs
3. Der Erbe der Schatten
Das Erbe der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Diener der alten Macht
2. Prophet der sechs Provinzen
3. Beschützer der Drachen
Das Kind der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Die Tochter des Drachen
2. Die Tochter des Propheten
3. Die Tochter des Wolfs
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Robin Hobb
Stadt der Drachen
Roman
Deutsch von Simon Weinert
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Dragon Haven (Rain Wilds Chronicles Book 2)« bei Spectra, New York.Dieser Roman ist bereits unter dem Titel »Drachenkämpfer« auf Deutsch erschienen. Er wurde für diese Ausgabe komplett überarbeitet.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Copyright der Originalausgabe © 2010 by Robin HobbCopyright dieser deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.Redaktion: Alexander GroßCovergestaltung und -illustration: © Max Meinzold, www.meinzold.de, unter Verwendung eines Motivs von Eky Studio/Shutterstock.comHK · Herstellung: MRSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-27092-6V002www.penhaligon.de
PROLOG
Die Menschen waren in Aufruhr. Sintara spürte das penetrante Hin und Her ihrer Gedanken, lästig wie ein Schwarm Stechmücken. Die Drachin fragte sich, wie die Menschen überhaupt hatten überleben können, wenn sie ihre Gedanken nicht für sich behalten konnten. Die Ironie dabei war, dass sie weder die Kraft noch den Verstand hatten, die Gedanken ihrer Artgenossen zu verstehen – und das, obwohl sie keine Grille, die ihnen im Kopf herumspukte, für sich behalten konnten. Torkelnd stolperten sie durch ihr kurzes Leben und verstanden dabei weder ihresgleichen noch sonst ein Wesen auf der Welt. Welch ein Schock war für Sintara die Erkenntnis gewesen, dass die Menschen keine andere Möglichkeit der Verständigung hatten, als Laute auszustoßen und anschließend, wenn das Gegenüber antwortete, zu raten, was es mit seinen Lauten wohl meinte. »Sprechen« nannten sie das.
Kurz verzichtete sie darauf, das Bombardement an kreischenden Stimmen auszublenden, um herauszufinden, was die Drachenhüter derart in Aufruhr versetzt hatte. Wie üblich waren ihre Sorgen völlig unzusammenhängend. Einige fürchteten um die kranke Kupferdrachin – als ob sie ihr in irgendeiner Weise helfen könnten. Sintara fragte sich, warum sie um die sieche Kupferne herumscharwenzelten, anstatt ihren Pflichten gegenüber den anderen Drachen nachzukommen. Sie hatte Hunger, und heute hatte ihr niemand etwas gebracht. Noch nicht einmal einen Fisch.
Lustlos stapfte sie zum Fluss hinab. Doch es gab nicht viel zu sehen außer einem Streifen Kies und Schlick, Schilf und ein paar dürren Schösslingen. Ein paar matte Sonnenstrahlen fielen ihr auf den Rücken, spendeten aber kaum Wärme. Keinerlei Wild trieb sich hier herum. Vielleicht gab es ein paar Fische, doch die Anstrengung, die nötig wäre, um einen zu fangen, war das kurze Vergnügen, ihn zu fressen, nicht wert. Wenn ihr allerdings jemand einen Fisch brächte …
Sie dachte daran, Thymara zu rufen und ihr aufzutragen, für sie auf die Jagd zu gehen. Nach dem, was Sintara von den Hütern gehört hatte, würden sie wohl so lange an diesem verlassenen Ufer verharren, bis der Kupferdrache entweder wieder auf den Beinen oder tot war. Sollte der Rote sterben, gäbe es eine ordentliche Mahlzeit für den Drachen, der als Erster zur Stelle war. Und das wäre Mercor, erkannte sie mit einiger Bitterkeit. Der Golddrache hielt Wache. Sintara spürte, dass er Gefahr für den Kupfernen argwöhnte, doch er hütete seine Gedanken und ließ weder die Drachen noch die Hüter wissen, was er dachte. Das allein schon ließ Sintara stutzig werden.
Wäre sie nicht so wütend auf ihn gewesen, hätte sie ihn rundheraus gefragt, welche Gefahr er fürchtete. Aber er hatte den Hütern ihren wahren Namen verraten, ohne dass sie ihn gereizt hatte. Nicht nur Thymara und Alise, ihren eigenen Hütern, hatte er ihn verraten, was schlimm genug gewesen wäre. Nein, er hatte ihren Namen hinausposaunt, als wäre das sein gutes Recht. Dass er und die meisten anderen Drachen beschlossen hatten, ihren Hütern ihren wahren Namen anzuvertrauen, war ihr völlig egal. Mochten sie ruhig so blauäugig und vertrauensselig sein, das kümmerte sie nicht. Sie mischte sich nicht in die Angelegenheiten zwischen Mercor und seiner Hüterin ein. Wieso aber hatte er sich dann die Freiheit genommen, ihre Beziehung zu Thymara ins Ungleichgewicht zu bringen? Jetzt, da das Mädchen ihren wahren Namen kannte, blieb Sintara nur zu hoffen, dass es mit diesem Wissen nichts anzufangen wusste. Kein Drache vermochte zu lügen, wenn jemand mit seinem wahren Namen die Wahrheit forderte oder den Namen bei einer Frage richtig einsetzte. Gewiss vermochte der Drache die Antwort zu verweigern, aber er konnte nicht lügen. Genauso wenig war ein Drache in der Lage, eine Abmachung zu brechen, die er mit seinem wahren Namen geschlossen hatte. Mercor hatte diesem Menschlein mit der Lebensspanne eines Fisches eine unverschämte Machtfülle verliehen.
Sintara fand am Fluss eine freie Stelle und legte sich auf die von der Sonne gewärmten Steine, schloss die Augen und seufzte. Sollte sie schlafen? Nein. Auf dem kühlen Grund zu schlummern, war nicht sonderlich verlockend.
Widerwillig öffnete sie erneut ihren Geist, um zu erfahren, was die Menschen vorhatten. Jemand jammerte, weil er Blut an den Händen hatte. Die ältere ihrer beiden Hüterinnen war innerlich zerrissen, weil sie sich nicht entscheiden konnte, ob sie zu ihrem Ehemann zurückkehren und ihr Leben in Langeweile beschließen oder mit dem Kapitän des Schiffes schlafen sollte. Sintara stieß ein angewidertes Brummen aus. Da gab es überhaupt nichts zu entscheiden. Alise zerbrach sich den Kopf über Kinkerlitzchen. Es spielte keine Rolle, was sie tat, genauso wenig, wie es eine Rolle spielte, wo sich eine Fliege hinsetzte. Das Leben eines Menschen war lächerlich kurz. Vielleicht veranstalteten sie deshalb einen solchen Lärm, solange sie am Leben waren. Vielleicht war dies ihre einzige Möglichkeit, sich ihrer eigenen Bedeutung zu versichern.
Gewiss gaben auch Drachen Laute von sich, aber sie waren nicht auf diese Laute angewiesen, um ihre Gedanken auszudrücken. Klang und Lautäußerungen waren nützlich, um das Wirrwarr eines menschlichen Geistes zu durchdringen und die Aufmerksamkeit anderer Drachen zu erlangen. Klang war nützlich, um einen Menschen überhaupt einmal dazu zu bringen, sich auf das zu konzentrieren, was man ihm sagen wollte. Die Geräusche der Menschen hätten Sintara gar nicht so sehr gestört, wenn die Gedanken dieser Wesen nicht derart hervorsprudeln würden, während sie zur gleichen Zeit versuchten, die Bedeutung durch das Gekreische zu vermitteln. Manchmal war dieses zweifache Ärgernis so groß, dass sie sich wünschte, diese Kreaturen ein für alle Mal fressen zu können.
Sie verschaffte ihrem Unmut mit einem leisen Grollen Luft. Die Menschen waren nutzlose Plagegeister, und doch hatte das Schicksal es gefügt, dass die Drachen abhängig von ihnen waren. Nachdem die Drachen sich aus Seeschlangen in ihre jetzige Gestalt verwandelt hatten, waren sie aus ihren Hüllen geschlüpft und in einer Welt erwacht, die nicht zu ihren Erinnerungen passen wollte. Keine Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte waren vergangen, seit die letzten Drachen auf Erden gewandelt waren. Als missgestaltete Karikaturen ihrer selbst waren sie aus den Kokons gekrochen, und da sie nicht fliegen konnten, waren sie am sumpfigen Flussufer zwischen Wasser und dem undurchdringlichen Wald gefangen gewesen. Widerwillig hatten die Menschen ihnen geholfen, hatten ihnen Tierkadaver zum Fressen gebracht und ihre Anwesenheit geduldet, während sie darauf gelauert hatten, dass die Drachen entweder starben oder die Fähigkeit erlangten fortzugehen. Jahrelang hatten sie, eingepfercht zwischen Fluss und Bäumen, Hunger gelitten, weil sie nur das Nötigste zum Überleben bekommen hatten.
Und dann hatte Mercor einen Plan ausgeheckt. Der Golddrache hatte die Mär einer halb vergessenen Stadt eines uralten Volkes verbreitet, deren reiche Schätze ihrer Entdeckung harrten. Keiner der Drachen hatte dabei Gewissensbisse gehabt, entsprach doch die Erinnerung an Kelsingra, der Uraltenstadt, deren große Gebäude auch Drachen Platz boten, der Wahrheit. Wenn man die Menschen mit Erzählungen über Berge blinkender Schätze locken konnte, dann erfand man diese eben dazu.
Und so war die Falle gestellt, das Gerücht gestreut, und nach einiger Zeit hatten die Menschen den Drachen angeboten, ihnen bei der Suche nach der verlorenen Uraltenstadt Kelsingra zu helfen. Man stellte eine Expedition aus einem Flusskahn, mehreren Booten und einem Trupp Jäger zusammen. Dazu kamen Hüter, die sich um die Bedürfnisse der Drachen kümmern sollten, während die Reise flussaufwärts ging – zu einer Stadt, an die sich die Geschuppten nur noch in ihren Träumen einigermaßen deutlich erinnern konnten. Doch die schmierigen kleinen Kaufleute, die in Cassarick das Sagen hatten, wählten dafür natürlich nicht ihre besten Leute aus. Nur zwei richtige Jäger hatten sie angeheuert, um über ein Dutzend Drachen zu ernähren. Die »Hüter«, die die Händler ausgesucht hatten, waren größtenteils Jugendliche und Außenseiter, die in den Augen der Regenwildnisbewohner besser nicht leben und sich schon gar nicht vermehren sollten. Denn die jungen Leute waren mit Schuppen und Auswüchsen gezeichnet, was die anderen Regenwildnisbewohner nicht gerne sahen. Immerhin konnte man den Hütern zugutehalten, dass sie die Drachen folgsam und fleißig versorgten. Aber die Menschen besaßen keine Erinnerungen ihrer Vorfahren und schlitterten lediglich mit dem bisschen Wissen durchs Leben, das sie während ihrer kurzen Existenz aufgeschnappt hatten. Darum war es mühsam, sich mit ihnen zu unterhalten, auch wenn Sintara gar nicht erst die Absicht hatte, ein geistvolles Zwiegespräch mit ihnen zu führen. Ein schlichter Befehl wie »Bring mir Fleisch« wurde meist mit Gejammer beantwortet, weil es angeblich ach so schwer war, Wild zu finden – oder mit Fragen wie: »Hast du nicht erst vor einer Stunde etwas gegessen?« Als könnten solche Worte sie dazu bewegen, ihre Bedürfnisse zu überdenken.
Unter den Drachen war allein Sintara so weitsichtig, sich statt einem zwei Hüter als Diener zu halten. Das ältere Menschenweibchen, Alise, war als Jägerin nicht zu gebrauchen, aber sie war eifrig – wenn auch nicht sonderlich geschickt – um die Körperpflege der Drachin bemüht und begegnete ihr mit dem gebührenden Anstand und Respekt. Thymara dagegen, die Jüngere der beiden, war zwar die beste Jägerin unter den Hütern, aber sie besaß ein aufsässiges, widerspenstiges Wesen. Mit zwei Dienerinnen konnte Sintara sich einigermaßen darauf verlassen, dass stets eine zugegen war, wenn sie etwas brauchte, zumindest für die kurze Zeit eines Menschenlebens. Das würde hoffentlich genügen.
Den größten Teil eines Mondzyklus waren die Drachen im flachen Wasser nahe dem dicht bewachsenen Ufer flussaufwärts gestapft. Der Waldrand entlang des Stroms war von Ranken und Kriechgewächsen und einem Gewirr aus ausladenden Wurzeln überwuchert, die es den Drachen unmöglich machten, sich trockenen Fußes fortzubewegen. Die Jäger ruderten voraus, die Hüter folgten in ihren Booten. Das SeelenschiffTeermann, ein langer, flacher Kahn, der nach Drachen und Zauberei roch, bildete den Abschluss. Mercor war ganz fasziniert von dem sogenannten »Seelenschiff«. Sintara und die meisten anderen Drachen dagegen fanden den Kahn beunruhigend und beinahe anstößig. Denn der Rumpf des Gefährts war aus Hexenholz, das eigentlich kein Holz war, sondern die Überreste des Kokons einer toten Seeschlange. Die Bretter, die man aus diesem »Holz« gewann, waren extrem hart und widerstandsfähig gegen Wind und Wetter. Die Menschen maßen dem Material einen großen Wert bei. Doch es roch nach dem Leib und den Erinnerungen eines Drachen. Wenn eine Seeschlange die Hülle wob, die sie beschützen sollte, während sie sich in einen Drachen verwandelte, fügte sie dem Gemisch aus Sand und Lehm, das sie mit ihrem Speichel hervorwürgte, auch ihre Erinnerungen hinzu. Deshalb war dieses Holz eine Ablagerung von Erinnerungen. Für Sintaras Geschmack sahen die auf den Schiffsrumpf gemalten Augen viel zu wissend drein, und die Teermann bewegte sich viel müheloser gegen die Strömung als jeder herkömmliche Kahn. Sie machte stets einen Bogen um das Schiff und sprach kaum mit seinem Kapitän. Allerdings zeigte der Mann auch wenig Neigung, mit den Drachen zu reden. Kurz blieb dieser Gedanke in ihrem Geist hängen. Hatte er etwa einen Grund, ihnen aus dem Weg zu gehen? Im Gegensatz zu einigen anderen Menschen schien er von den Drachen nicht eingeschüchtert zu sein.
Oder abgestoßen. Da fiel ihr Sedric ein, und sie stieß ein höhnisches Schnauben aus. Der penible Händler aus Bingstadt trottete hinter ihrer Hüterin Alise her, trug Stift und Papier bei sich, zeichnete Drachen und schrieb die bruchstückhaften Erkenntnisse auf, die Alise ihm diktierte. Denn er war von so schwachem Geist, dass er die Drachen nicht einmal verstand, wenn sie ihn ansprachen. Wenn Sintara mit ihm redete, hörte er nur »Tiergeräusche«, die er unverschämterweise mit dem Muhen einer Kuh verglichen hatte! Nein, Kapitän Leftrin war ganz anders als Sedric. Er war weder taub für die Drachensprache, noch hielt er die Drachen seiner Aufmerksamkeit für unwürdig, wie es schien. Aber warum ging er ihnen aus dem Weg? Hatte er etwas zu verbergen?
Nun, er war ein Narr, wenn er glaubte, er könnte einem Drachen etwas verheimlichen. Sie schob die kurze Sorge beiseite. Drachen vermochten den Geist eines Menschen so leicht zu durchschauen, wie eine Krähe einen Misthaufen durchstöberte. Sollte Leftrin oder irgendein anderer ein Geheimnis haben, sollte er es ruhig hüten. Die Menschen lebten so kurz, dass es kaum der Mühe wert war, einen von ihnen kennenzulernen. Uralte waren einst würdige Gefährten der Drachen gewesen, denn sie hatten um einiges länger als Menschen gelebt, und sie waren klug genug gewesen, um zum Lob der Drachen Lieder und Gedichte zu verfassen. In ihrer Weisheit hatten sie die öffentlichen Gebäude und selbst einige ihrer Privatpaläste so errichtet, dass sie Drachen als Gäste empfangen konnten. Sintara erinnerte sich an gemästetes Vieh, an warme Zufluchtsstätten, wohin sich die Drachen vor dem Winter hatten zurückziehen können, an Bäder mit Duftöl, die das Jucken der Schuppen linderten, und viele andere Annehmlichkeiten, die die aufmerksamen Uralten für sie ersonnen hatten. Es war eine Schande, dass sie aus der Welt verschwunden waren. Jammerschade.
Sintara versuchte, sich Thymara als Uralte vorzustellen, aber es war ihr nicht möglich. Ihrer jungen Hüterin mangelte es an der richtigen Einstellung gegenüber Drachen. Sie war respektlos, trotzig und viel zu sehr mit ihrer Eintagsfliegenexistenz beschäftigt. Zwar besaß sie Temperament, konnte damit jedoch so gar nicht umgehen. Die ältere Hüterin, Alise, deren Elend und verborgene Unsicherheit Sintara auch jetzt deutlich spürte, war sogar noch weniger geeignet. Eine Uraltenfrau brauchte etwas von der Entschlossenheit und dem Feuer einer Drachenkönigin. Hatte eine ihrer Dienerinnen das Zeug dazu? Was wäre nötig, um sie aufzurütteln, ihren Eifer auf die Probe zu stellen? Lohnte es sich, sie herauszufordern, um zu sehen, aus welchem Holz sie geschnitzt waren?
Etwas irritierte sie. Widerstrebend öffnete sie die Augen und hob den Kopf. Sie rollte sich auf die Beine, schüttelte sich und legte sich erneut hin. Als sie den Kopf wieder ablegte, erregte eine Bewegung zwischen den hohen Binsen ihre Aufmerksamkeit. Wild? Sie richtete den Blick darauf. Nein. Nur zwei Hüter, die den Uferstreifen verließen und in den Wald gingen. Sintara erkannte sie. Die eine hieß Jerd und war die Hüterin von Veras. Für eine Menschenfrau war die Dienerin des Gründrachen hochgewachsen, und auf dem Scheitel wuchs ihr ein blonder Haarschopf. Thymara mochte Jerd nicht. So viel wusste Sintara, auch wenn sie den Grund dafür nicht kannte. Der andere war Greft. Sintara schnaubte leise durch die Nüstern, denn mit Kalos Hüter konnte sie wenig anfangen. Auch wenn Greft den blauschwarzen Hünen versorgte und blitzblank putzte, traute Kalo ihm doch nicht über den Weg. Bei Greft hatten alle Drachen ein ungutes Gefühl. Thymara fühlte sich zu ihm hingezogen und hatte gleichzeitig Angst vor ihm. Er faszinierte sie, und Thymara ärgerte sich über diese Faszination.
Sintara schnupperte, erhaschte die Witterung der beiden Hüter und ließ die Augen halb zufallen. Sie wusste, wohin sie unterwegs waren.
Da kam ihr ein verblüffender Gedanke. Plötzlich erkannte sie eine Möglichkeit, ihre beiden Hüterinnen auf die Probe zu stellen. Aber wäre es die Mühe wert? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Erneut streckte sie sich auf dem warmen Felsen aus und wünschte sich vergebens, sie läge auf einem sonnenheißen Sandstrand. Sie wartete.
Fünfter Tag des Gebetsmondes
IMSECHSTENJAHRDESUNABHÄNGIGENHÄNDLERBUNDS
Von Erek, Vogelwart in Bingstadt,
an Detozi, Vogelwart in Trehaug
Beigefügt ein Schreiben von Händler Polon Meldar an Sedric Meldar, um herauszufinden, ob alles in Ordnung ist, und um sich nach dem Zeitpunkt seiner Rückkehr zu erkundigen.
Detozi,
es scheint da eine gewisse Besorgnis hinsichtlich zweier Bürger aus Bingstadt zu geben, die Cassarick besuchen wollten, nun aber offenbar tiefer in die Regenwildnis gereist sind. Zwei beunruhigte Elternpaare haben mich heute separat aufgesucht und für rasche Informationen einen Bonus in Aussicht gestellt. Ich weiß, dass Ihr kein sonderlich gutes Verhältnis zum Vogelwart in Cassarick habt, aber vielleicht könntet Ihr dieses eine Mal Eure Verbindungen spielen lassen, um etwas über den Verbleib von Sedric Meldar oder Alise Kincarron Finbok in Erfahrung zu bringen. Die Finbok-Dame kommt aus einer wohlhabenden Familie. Gute Neuigkeiten würden wohl fürstlich entlohnt werden.
Erek
1
VERGIFTET
Der schmatzende graue Matsch zerrte an ihren Stiefeln und ließ sie nur langsam vorankommen. Alise musste zusehen, wie Leftrin sich von ihr entfernte und auf die zusammengedrängten Hüter zuging, während sie sich abmühte, ihre eingesunkenen Füße zu befreien und ihm zu folgen. »Eine Metapher für mein ganzes Leben«, grummelte sie ärgerlich und beschleunigte entschlossen ihre Schritte. Kurz darauf kam ihr der Gedanke, dass sie es noch vor wenigen Wochen nicht nur als ein Abenteuer, sondern als regelrechte Herausforderung betrachtet hätte, das Flussufer zu überqueren. Heute war es nur ein morastiger Streifen Land, den es zu überwinden galt, und noch nicht einmal ein besonders schwieriger. »Ich verändere mich«, murmelte sie vor sich hin. Ein Kribbeln überlief sie, als sie spürte, dass Himmelspranke ihr zustimmte.
Hörst du alle meine Gedanken?, fragte sie die Drachin, erhielt aber keine Antwort. Mit Unbehagen rätselte sie, ob Himmelspranke auch von ihrer Schwärmerei für Leftrin und den Einzelheiten ihrer unglücklichen Ehe wusste. Fast im selben Moment beschloss sie, diese Geheimnisse zu wahren, indem sie nicht mehr daran dachte. Dann merkte sie jedoch, wie zwecklos dies war.Kein Wunder, dass die Drachen eine so schlechte Meinung von uns haben, wenn sie jeden unserer Gedanken lesen können.
Ich kann dir versichern, dass die meisten eurer Gedanken zu belanglos sind, als dass wir uns überhaupt eine Meinung darüber bilden. Himmelsprankes Antwort strömte in Alises Geist. Voller Bitterkeit fügte die Drachin hinzu: Mein wahrer Name ist Sintara. Nachdem Mercor ihn hinausposaunt hat und alle anderen ihn kennen, kann ich ihn dir auch verraten.
Es war aufregend, mit einem so großartigen Wesen von Geist zu Geist zu sprechen. Alise wagte es mit einem Kompliment. Ich bin überglücklich, endlich deinen wahren Namen zu hören, Sintara. Sein herrlicher Klang ist deiner Schönheit würdig.
Steinernes Schweigen beantwortete ihren Gedanken. Sintara hörte sie sehr wohl, aber sie begegnete ihr mit Leere. Um diese zu überbrücken, stellte Alise erneut eine Frage. Was ist mit dem braunen Drachen geschehen? Ist er krank?
Die Kupferdrachin ist bereits so aus ihrer Hülle geschlüpft, und sie hat zu lange überlebt, antwortete Sintara gefühllos.
Sie?
Behellige mich nicht weiter mit deinen Gedanken!
Alise hielt sich gerade noch zurück, bevor sie eine Entschuldigung dachte. Das hätte die Drachin nur noch mehr verärgert. Zudem war sie beinahe bei Leftrin angelangt. Die Gruppe der Hüter, die sich um den Braunen versammelt hatten, löste sich gerade wieder auf. Der große Golddrache und seine kleine Hüterin mit den rosafarbenen Schuppen blieben als Einzige zurück, als sie neben Leftrin trat. Bei ihrem Näherkommen hob der Golddrache den Kopf und richtete die funkelnden schwarzen Augen auf sie. Alise spürte, wie sein Blick sie zurückdrängte.
Unvermittelt wandte Leftrin sich zu ihr um.»Mercor möchte, dass wir den Braunen allein lassen«, sagte er.
»Aber der Arme braucht vielleicht unsere Hilfe. Hat jemand herausgefunden, was er hat? Oder sie?« Sie fragte sich, ob Sintara sich geirrt oder sie gar auf den Arm genommen hatte.
Zum ersten Mal richtete der Golddrache das Wort direkt an sie. Seine tiefe Stimme dröhnte wie Glockenschläge und ließ ihre Brust erbeben, während sie ihren Geist erfüllte. »Relpda leidet an Parasiten, die sie von innen auffressen, und ein Räuber hat sie überfallen. Ich halte bei ihr Wache, damit gewiss niemand vergisst, dass Drachen immer noch die Angelegenheit von Drachen sind.«
»Ein Räuber?« Alise war entsetzt.
»Geht«, befahl Mercor schroff. »Das hat euch nicht zu kümmern.«
»Kommt mit mir«, legte Leftrin ihr mit Nachdruck nahe. Der Kapitän reichte ihr den Arm, zog ihn dann aber abrupt zurück. Ihr wurde schwer ums Herz. Sedrics unglückselige Worte hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Zweifellos hatte Sedric es für seine Pflicht gehalten, Leftrin daran zu erinnern, dass sie eine verheiratete Frau war. Nun, sein Tadel hatte den Schaden bereits angerichtet. Nie wieder würde es zwischen ihr und Leftrin so ungezwungen und entspannt sein. Sie würden beide immerzu daran denken, was schicklich war. Wenn Hest, ihr Gatte, plötzlich leibhaftig bei ihnen aufgetaucht wäre, hätte sie seine Gegenwart auch nicht stärker empfinden können als ohnehin schon.
Noch hätte sie ihn mehr hassen können.
Das war ein Schock. Sie hasste ihren Ehemann?
Ihr war klar gewesen, dass er ihre Gefühle verletzte, dass er sie vernachlässigte und demütigte, dass sie verabscheute, wie er sie behandelte. Aber dass sie ihn hasste? Nie zuvor hatte sie sich gestattet, so über ihn zu denken, fiel ihr auf.
Hest war gut aussehend und gebildet, charmant und wohlerzogen. Gegenüber anderen. Sie durfte sein Geld nach ihrem eigenen Gutdünken ausgeben, solange sie ihn in Frieden ließ. Ihre Eltern glaubten, sie hätte eine gute Partie gemacht, und die meisten Frauen, die sie kannte, beneideten sie.
Und sie hasste ihn. Das war es also. Eine Zeit lang war sie schweigend neben Leftrin hergegangen, bevor er sich räusperte und ihren Gedankengang unterbrach. »Verzeiht«, entschuldigte sie sich reflexartig. »Ich war mit meinen Gedanken woanders.«
»Ich glaube nicht, dass wir die Lage irgendwie ändern können«, sagte er traurig, und sie nickte, denn sie bezog seine Worte auf ihren inneren Aufruhr. Doch als er weitersprach, änderte sich die Bedeutung. »Ich glaube nicht, dass der Braunen noch irgendjemand helfen kann. Entweder sie überlebt es, oder sie stirbt. Und bis sie sich für das eine oder andere entscheidet, sitzen wir hier fest.«
»Mir fällt es schwer, ein Weibchen in ihr zu sehen. Ihre Krankheit ist dann doppelt traurig. Es gibt nur so wenige weibliche Drachen. Mir ist es gleich. Mir ist es gleich, dass wir hier festsitzen, wollte ich sagen.« Sie wünschte sich, er würde ihr den Arm reichen. Sie hätte ihn sofort ergriffen.
Die Grenze zwischen Land und Wasser verschwamm. Der Morast wurde tiefer und nasser, bis er in den Fluss überging. Kurz vor den Wellen blieben sie stehen, und Alise spürte, wie ihre Stiefel einsanken. »Wir können wohl nirgendwohin entkommen, nehme ich an?«, sagte Leftrin.
Sie sah zurück. Der Uferstreifen war von niedergetrampeltem Gras bedeckt und wurde von einer Barriere aus Treibholz und Dickicht begrenzt. Dahinter begann der eigentliche Wald. Von ihrem Standort aus wirkte er undurchdringlich und unheimlich. »Wir könnten es mit dem Wald probieren …«, hob sie an.
Leftrin ließ ein tiefes, freudloses Lachen hören. »Das habe ich nicht gemeint. Ich sprach von Euch und mir.«
Ihr Blick begegnete seinem. Sie war verblüfft, dass er es so unverblümt angesprochen hatte. Und dann entschied sie, dass Sedrics Einmischung vielleicht doch ein Gutes hatte, nämlich dass sie aufrichtig miteinander waren. Schließlich gab es für keinen von beiden mehr einen Grund, ihre Gefühle füreinander zu verschweigen. Sie wünschte sich den Mut, seine Hand zu ergreifen. Stattdessen sah sie ihm einfach ins Gesicht und hoffte, dass er in ihren Augen lesen konnte. Er konnte es und seufzte schwer.
»Alise. Was sollen wir tun?« Obwohl die Frage rhetorisch gemeint war, beschloss sie, darauf zu antworten.
Sie waren ein paar Schritte gegangen, bevor sie die richtigen Worte fand. Er blickte beim Gehen zu Boden. Sie sah ihn von der Seite an, und mit ihren Worten gab sie alle Kontrolle auf, die ihr bisheriges Leben bestimmt hatte. »Ich möchte das tun, was Ihr tun möchtet.«
Sie beobachtete, wie er das Gesagte verarbeitete. Eigentlich hatte sie erwartet, dass es wie ein Segen für ihn wäre, aber er nahm es wie eine Last auf. Sein Gesicht wurde sehr ruhig. Er hob den Blick. Vor ihnen lag der Flusskahn am Ufer und schien Leftrin mitleidsvoll anzublicken. Als er antwortete, galt das vielleicht nicht nur ihr, sondern auch dem Schiff. »Ich muss das tun, was richtig ist«, sagte er voller Bedauern. »Für uns beide«, fügte er hinzu, und sein Tonfall hatte etwas Endgültiges.
»Ich lasse mich nicht nach Bingstadt zurückschippern!«
Er lächelte mit einem Mundwinkel. »Oh, das ist mir durchaus bewusst, meine Liebe. Niemand wird Euch irgendwohin schippern. Wenn Ihr irgendwohin geht, dann aus freiem Entschluss, oder Ihr geht nirgendwohin.«
»Gut, dass Euch das klar ist«, sagte sie und versuchte, stark und unabhängig zu klingen. Sie griff nach seiner schwieligen Hand, umfasste sie fest und spürte ihre Rauheit und Kraft. Wiezur Antwort drückte er behutsam die ihre. Dann ließ er sie los.
Der Tag schien wie eingetrübt. Sedric schloss die Augen und öffnete sie wieder. Doch es half nichts. Schwindel erfasste ihn, und er hielt sich an der Wand seiner Kammer fest. Unter seinen Füßen schien der Kahn zu schwanken, obwohl er wusste, dass das Schiff am Ufer lag. Wo war nur der verdammte Türgriff? Er konnte ihn nirgends entdecken. Flach atmend lehnte er sich gegen die Wand und kämpfte gegen den Brechreiz an.
»Fehlt Euch etwas?«, erklang an seinem Ellbogen eine tiefe Stimme, die ihm nicht unbekannt war. Es kostete ihn einige Anstrengung, seine Gedanken zu ordnen. Carson, der Jäger. Der mit dem rotblonden Vollbart. Dem gehörte die Stimme.
Sedric holte vorsichtig Luft. »Ich weiß nicht. Ist etwas mit dem Licht? Mir scheint es so düster zu sein.«
»Heute ist ein strahlender Tag, Mann. So hell, dass ich nicht lange auf die Wellen schauen kann.« Die Stimme klang besorgt. Warum? Er kannte den Jäger kaum.
»Mir kommt es dämmrig vor.« Sedric bemühte sich, normal zu reden, aber er hörte die eigene Stimme nur schwach und wie aus weiter Ferne.
»Eure Pupillen sind so klein wie Stecknadelköpfe. Hier, nehmt meine Hand. Dann legen wir Euch aufs Deck.«
»Ich will nicht auf dem Boden sitzen«, wehrte Sedric sich kraftlos. Sollte Carson ihn überhaupt verstanden haben, so scherte er sich nicht darum. Der große Mann packte ihn an den Schultern und setzte ihn sanft, aber bestimmt auf das schmutzige Deck. Sedric wollte sich gar nicht ausmalen, was die rauen Planken mit seiner Hose anrichten würden. Immerhin schwankte die Welt nicht mehr ganz so sehr. Er lehnte den Kopf gegen die Wand und schloss die Augen.
»Ihr seht aus, als hätte man Euch vergiftet. Oder eine Droge gegeben. Ihr seid so bleich wie das weiße Flusswasser. Ich bin gleich wieder zurück. Ich besorge Euch etwas zu trinken.«
»Tut das«, hauchte Sedric. Der Jäger war ein tiefer Schatten in einer dunklen Welt. Seine Schritte entfernten sich auf dem Deck, und selbst von diesen leichten Erschütterungen wurde Sedric übel. Dann war Carson verschwunden, und Sedric spürte ein weiteres Beben. Schwächer und nicht so regelmäßig wie die Fußtritte. Es war noch nicht einmal ein Beben, dachte er. Es war anders. Etwas Böses, das auf ihn gerichtet war. Etwas hatte erfahren, was er dem braunen Drachen angetan hatte, und jetzt war es hasserfüllt. Etwas Altes, Mächtiges und Finsteres saß über ihn zu Gericht. Sedric kniff die Augen fester zu, doch dadurch schien ihm das Böse nur näher zu kommen.
Die Schritte kehrten zurück und wurden immer lauter. Er spürte, dass sich der Jäger neben ihm hinkauerte. »Hier, trinkt das. Das wird Euch wieder auf die Beine bringen.«
Sedric nahm den heißen Becher entgegen, aus dem scheußlicher Kaffeegeruch stieg. Er führte ihn an die Lippen und nippte. Da bemerkte er den beißenden Geschmack des Rums, der in den Kaffee gemischt war. Um nicht auf die eigenen Kleider zu spucken, schluckte er das Zeug würgend hinunter. Dann musste er husten. Keuchend schnappte er nach Luft und öffnete die tränennassen Augen.
»Ist es jetzt besser?«, fragte ihn der gehässige Mistkerl.
»Besser?«, erwiderte Sedric aufgebracht. Nun klang seine Stimme kräftiger. Mit einem Blinzeln vertrieb er die Tränen, worauf er Carson neben sich erkennen konnte. Der Mann hatte einen rotblonden Bart, heller als sein wild zerzaustes Haupthaar. Seine Augen waren nicht braun, sondern schwarz, was viel seltener war. Mit zur Seite geneigtem Kopf lächelte er Sedric an. Wie ein Cockerspaniel, war Sedrics bösartiger Gedanke. Beim vergeblichen Versuch aufzustehen schabten seine Stiefel über den Boden.
»Dann bringen wir Euch erst einmal in die Küche, was?« Er nahm Sedric den Becher aus der Hand, fasste ihn am Oberarm und zog ihn mit erstaunlicher Leichtigkeit auf die Beine.
Sedric schwamm der Kopf. »Was ist los mit mir?«
»Woher soll ich das wissen?«, fragte ihn der Jäger leutselig. »Habt Ihr letzte Nacht zu viel getrunken? Vielleicht habt Ihr in Trehaug schlechten Fusel gekauft. Und wenn das Zeug aus Cassarick stammt, dann ist es auf jeden Fall Fusel. Die machen dort aus allem Alkohol, aus Wurzeln und Obstschalen. Stützt Euch bei mir auf – jetzt wehrt Euch doch nicht so! Ich weiß von einem Kerl, der Fischhäute destillieren wollte. Nicht einmal den ganzen Fisch, nur die Haut. Er war überzeugt, dass es klappen würde. Hier, passt auf Euren Kopf auf. Setzt Euch an den Tisch. Wenn Ihr was esst, wird Euch das sicher guttun, da werdet Ihr wieder nüchterner.«
Sedric fiel auf, dass Carson einen Kopf größer war als er selbst. Und um einiges kräftiger. Wie eine Mutter, die ein bockiges Kind an seinen Platz führt, lotste der Jäger ihn übers Deck, in das Deckshaus und an den Küchentisch. Der Mann hatte eine tiefe, rumpelnde Stimme, die etwas Beruhigendes hatte, wenn man nicht auf seine ungehobelte Ausdrucksweise achtete. Sedric setzte die Ellbogen auf der klebrigen Tischplatte auf und stützte das Gesicht in die Hände. Es roch nach Fett, Rauch und altem Essen, was einen weiteren Schwall Übelkeit bei ihm verursachte.
Carson machte sich in der Küche zu schaffen, tat etwas in eine Schale und goss heißes Wasser aus einem Kessel darüber. Dann blieb er eine Weile daneben stehen und rührte mit einem Löffel darin herum, bevor er die Schale an den Tisch brachte. Sedric hob den Kopf. Als er die Pampe sah, stieß es ihm plötzlich auf. Mit einem Mal hatte er wieder den schweren, metallischen Geschmack des Drachenbluts in Mund und Nase. Wieder fürchtete er, das Bewusstsein zu verlieren.
»Danach werdet Ihr Euch besser fühlen«, sagte Carson verständnisvoll. »Hier, esst etwas davon. Das wird Euren Magen wieder einrenken.«
»Was ist das?«
»In heißem Wasser aufgeweichter Zwieback. Ist im Bauch wie ein Schwamm, wenn man einen übersäuerten Magen hat oder vor einem anstrengenden Arbeitstag schnell ausnüchtern muss.«
»Das sieht widerlich aus.«
»Stimmt. Esst es trotzdem.«
Er hatte noch nichts gefrühstückt, und noch immer schmeckte er Drachenblut. Alles wäre besser als das, dachte er bei sich. Damit griff er zu dem breiten Löffel und rührte in der Schale herum.
Da kam Davvie, der Junge des Jägers, ins Deckshaus. »Was ist los?«, fragte er. In seinem Tonfall lag etwas Drängendes, das Sedric verblüffte. Er schob sich einen Löffel mit vollgesogenem Schiffszwieback in den Mund. Nur die Konsistenz war seltsam, aber es besaß keinen Geschmack.
»Nichts, was dich zu kümmern hätte, Davvie.« Carson war streng mit dem Jungen. »Und du hast Arbeit zu erledigen. Mach schon und flick die Netze. Ich wette, dass wir heute sowieso nicht mehr von hier wegkommen. Deshalb lassen wir ein Netz in die Strömung, um vielleicht ein oder zwei Fische herauszuziehen. Das geht aber nur, wenn das Netz repariert ist. Also mach schon.«
»Und er, was ist mit ihm?« Die Stimme des Jungen klang beinahe anklagend.
»Ihm ist schlecht. Nicht, dass es dich etwas anginge. Geh an deine Arbeit und misch dich nicht in die Angelegenheiten von Älteren und Höhergestellten. Raus mit dir.«
Zwar schlug Davvie die Tür nicht wirklich zu, aber er schloss sie doch kräftiger, als es nötig gewesen wäre. »Kinder!«, rief Carson angewidert aus. »Sie glauben zu wissen, was sie wollen, aber wenn man es ihnen geben würde – na ja, dann würden sie merken, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Aber Ihr wisst bestimmt, was ich meine.«
Sedric schluckte die zähe Teigmasse in seinem Mund hinunter. Immerhin hatte sie den Geschmack des Drachenbluts aufgesaugt. Er nahm einen zweiten Löffel. Dann erst merkte er, dass Carson ihn anstarrte und auf eine Antwort wartete. »Ich habe keine Kinder. Ich bin nicht verheiratet«, sagte er, bevor er sich einen weiteren Löffel in den Mund schob. Carson hatte recht gehabt. Sein Magen beruhigte sich, und sein Kopf wurde klarer.
»Das habe ich auch nicht angenommen.« Carson schmunzelte, als hätte Sedric ihm einen Witz zugeflüstert. »Ich habe auch keine Kinder, aber Ihr habt auf mich den Eindruck gemacht, als hättet Ihr Erfahrung mit Jungen wie Davvie.«
»Nein, habe ich nicht.« So dankbar Sedric dem Jäger für das primitive Hausmittel auch war, wünschte er sich doch, Carson würde den Schnabel halten und verschwinden. In seinem Kopf schwirrten viel zu viele Gedanken, die er gerne erst geordnet hätte, bevor er sein Gehirn mit höflicher Konversation belastete. Carsons Bemerkung über eine mögliche Vergiftung hatte ihn beunruhigt. Was hatte er sich nur dabei gedacht, Drachenblut in den Mund zu nehmen? Er konnte sich nicht mehr an den Impuls erinnern, der ihn dazu verleitet hatte, nur daran, dass er es getan hatte. Eigentlich hatte er dem Biest lediglich ein paar Schuppen und Blut abnehmen wollen. Drachentrophäen waren ein Vermögen wert, und auf ein solches Vermögen hatte er es abgesehen. Stolz war er nicht auf seine Tat, aber er hatte es tun müssen. Er hatte keine andere Wahl gehabt. Hest und er würden Bingstadt nur dann den Rücken kehren können, wenn er das Geld zusammenhatte, um diesen Schritt zu finanzieren. Mit Drachenschuppen und Drachenblut vermochte er sich das Leben zu erkaufen, von dem er stets geträumt hatte.
Als er sich vom Schiff geschlichen hatte, um dem kranken Drachen die begehrten Kostbarkeiten zu nehmen, hatte alles so einfach ausgesehen. Die Kreatur lag offensichtlich im Sterben. Wen sollte es schon kümmern, wenn Sedric ein paar Schuppen mitnahm? Der Glaskolben hatte schwer in seiner Hand gelegen, als er mit Blut gefüllt war. Er hatte beabsichtigt, ihn dem Fürsten von Chalced als Mittel gegen dessen Gebrechen und vorgerücktes Alter zu verkaufen. Nie hatte er daran gedacht, selbst davon zu trinken. Er konnte sich weder an den Wunsch noch an den Entschluss erinnern, davon zu trinken.
Drachenblut wurde eine außergewöhnliche Heilkraft zugeschrieben, aber wahrscheinlich war es wie viele andere Arzneien auch giftig. Hatte er sich tatsächlich vergiftet? Würde er wieder gesund werden? Er wünschte, jemanden fragen zu können. Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass Alise es wissen könnte. Nachdem sie so viel über Drachen geforscht hatte, wusste sie bestimmt etwas über die Wirkung von Drachenblut auf den Menschen. Aber wie konnte er sie darüber ausfragen? Konnte man die Frage so formulieren, dass er sich nicht verriet?
»Hilft der Brei Eurem Magen ein wenig?«
Ruckartig hob Sedric den Kopf und bereute es sofort. Kurz war ihm schwindlig, dann sah er wieder klar. »Ja. Ja, das tut er.« Ohne den Blick von ihm abzuwenden, setzte sich der Jäger ihm gegenüber. So eindringlich starrten ihn Carsons schwarze Augen an, als wollte er ihm in den Kopf schauen. Sedric sah auf die Schale hinab und zwang sich, einen weiteren Löffel der Pampe zu essen. Seinem Magen tat sie zwar gut, aber das Zeug hinunterzuwürgen, war weniger angenehm. Wieder beäugte er den aufmerksamen Jäger. »Danke für Eure Hilfe. Aber ich möchte Euch nicht von Euren Pflichten abhalten. Ich komme gewiss auch ohne Euch zurecht. Wie Ihr bereits gesagt habt, habe ich bestimmt etwas Schlechtes gegessen oder getrunken. Deshalb braucht Ihr Euch wegen mir keine Umstände mehr zu machen.«
»Das bereitet mir keine Umstände.«
Wieder wartete Carson ab, als rechnete er mit einer Antwort Sedrics. Dem fehlten die Worte, und er senkte den Blick auf sein »Essen«. »Mir geht es besser. Danke.«
Dennoch blieb der Jäger sitzen, aber Sedric weigerte sich, erneut von der Schale aufzublicken. Stetig schob er sich kleine Bissen in den Mund und tat so, als verlange ihm das all seine Aufmerksamkeit ab. Die Wachsamkeit des Jägers verwirrte ihn, und als Carson sich endlich erhob, stieß Sedric einen leisen Seufzer der Erleichterung aus. Im Vorbeigehen legte Carson ihm von hinten eine schwere Hand auf die Schulter, beugte sich zu ihm herunter und flüsterte ihm ins Ohr: »Wir sollten uns einmal unterhalten. Ich vermute, wir haben mehr Dinge gemeinsam, als Ihr ahnt. Vielleicht sollten wir uns etwas mehr vertrauen.«
Er weiß Bescheid. Der Gedanke brachte ihn völlig aus der Fassung, und er hätte sich beinahe an dem vollgesogenen Brotstück in seinem Mund verschluckt. »Vielleicht«, brachte er heraus und spürte, dass der Jäger kurz etwas fester zupackte. Und als Carson die Hand von ihm nahm und hinausging, lachte der Jäger leise. Nachdem die Tür zugefallen war, schob Sedric die Schale von sich und barg den Kopf in den Armen. Und jetzt?,fragte er die Dunkelheit in seinen Armbeugen. Was jetzt?
Der braune Drache sah tot aus. Thymara hätte sich ihm so gerne genähert, um ihn eingehender zu betrachten, aber der Golddrache, der neben ihm Wache hielt, ließ sie davor zurückschrecken. Seit sie das letzte Mal vorbeigekommen war, hatte sich Mercor kaum gerührt. Seine funkelnden schwarzen Augen waren auf sie gerichtet. Obwohl er nichts sagte, spürte sie, wie er sie mit seinen Gedanken verscheuchte. »Ich mache mir doch nur Sorgen um sie«, sagte sie laut. Sylve hatte sich gegen das Vorderbein des Drachen gelehnt und döste. Beim Klang von Thymaras Stimme öffnete sie jedoch die Augen. Nach einem entschuldigenden Blick zu Mercor kam sie zu Thymara herüber.
»Er ist argwöhnisch«, sagte sie. »Er glaubt, dass jemand die braune Drachin absichtlich verletzt hat. Deshalb hält er Wache, um sie zu beschützen.«
»Um sie zu beschützen oder um sie gleich fressen zu können, wenn sie stirbt?« Thymara gelang es, kein bisschen anklagend zu klingen.
Sylve zeigte sich nicht beleidigt. »Um sie zu beschützen. Er hat zu viele Drachen sterben sehen, seit sie aus den Hüllen geschlüpft sind. Und es gibt so wenige Weibchen, dass selbst die zurückgebliebenen und verkümmerten beschützt werden müssen.« Sie ließ ein eigenartiges Lachen hören und fügte hinzu: »So wie bei uns.«
»Was?«
»Wie bei uns Hütern. Wir sind nur vier Frauen, und der Rest sind Jungs. Mercor meint, dass die Männer uns beschützen müssen, ganz gleich, wie verunstaltet wir sind.«
Dieser Satz machte Thymara sprachlos. Ohne dass es ihr bewusst war, fasste sie sich ins Gesicht und betastete die Schuppen, die ihr Kinn und ihre Wangenknochen bedeckten. Sie dachte darüber nach, was aus dieser Aussage folgte, und entgegnete unverblümt: »Wir dürfen weder heiraten noch beischlafen, Sylve. Mercor mag die Regeln vielleicht nicht kennen, aber uns sind sie bekannt. Die meisten von uns sind von Geburt an von der Regenwildnis gezeichnet, und wir alle wissen, was das bedeutet. Ein kürzeres Leben. Sollten wir schwanger werden, wären die Kinder größtenteils nicht überlebensfähig. Dem Brauch gemäß hätte man uns nach der Geburt aussetzen sollen. Es ist ja kein Geheimnis, warum wir für diese Expedition ausgewählt wurden – nicht nur, um auf die Drachen aufzupassen. Sondern auch, um uns loszuwerden.«
Sylve starrte sie lange an. Dann erwiderte sie leise: »Es stimmt, was du sagst, zumindest war das mal so. Aber Greft meint, dass wir die Regeln ändern können. Er sagt, dass Kelsingra, wenn wir dort ankommen, unsere Stadt sein wird, wo wir gemeinsam mit den Drachen leben werden. Und dort werden wir unsere eigenen Gesetze machen. Gesetze für alles.«
Die Leichtgläubigkeit des Mädchens entsetzte Thymara. »Sylve, wir wissen doch noch nicht einmal, ob Kelsingra überhaupt noch existiert. Wahrscheinlich ist es unter Schlamm begraben wie die anderen Uraltenstädte. Ich habe nie so recht daran geglaubt, dass wir es erreichen werden. Ich denke, wir können noch am ehesten darauf hoffen, dass wir einen Ort finden, an dem die Drachen leben können.«
»Und dann?«, fragte Sylve. »Lassen wir sie dort und kehren nach Trehaug zurück? Um was zu tun? Sollen wir zurückgehen, um in Schande und im Schatten zu leben und uns dafür zu entschuldigen, dass wir existieren? Das werde ich nicht tun, Thymara. Viele Hüter haben gesagt, dass sie das nicht machen werden. Wo immer unsere Drachen sich niederlassen, da werden auch wir bleiben. Dort wird unsere neue Heimat sein. Mit neuen Gesetzen.«
Ein lautes Knallen lenkte Thymara ab. Die beiden Mädchen wandten sich um und sahen, wie Mercor sich streckte. Er hatte die goldenen Schwingen gehoben und breitete sie zu ihrer vollen Spannweite aus. Thymara war nicht nur über die Größe überrascht, sondern auch über die Zeichnung, die den Augen eines Pfaus glich. Erneut schlug er mit den Flügeln, worauf ihr ein scharfer und nach Drache riechender Luftzug ins Gesicht fuhr. Unbeholfen faltete er sie wieder zusammen, als wäre er mit den Bewegungen nicht vertraut. Er legte sie flach an den Leib und nahm erneut die wachsame Haltung neben der Braunen ein.
Plötzlich war sich Thymara bewusst, dass Mercor und Sylve sich unterhalten hatten. Obwohl der Drache keinen Laut von sich gegeben hatte und Thymara ausgeschlossen gewesen war, spürte sie einen Gedankenaustausch. Sylve sah sie entschuldigend an und fragte: »Gehst du heute noch jagen?«
»Vielleicht. Sieht nicht so aus, als würden wir heute noch aufbrechen.« Sie zwang sich, nicht an das Unvermeidliche zu denken, nämlich, dass sie hier festsitzen würden, bis die Braune tot war.
»Falls du jagen gehst und etwas Frischfleisch …«
»Ich gebe, was ich kann«, entgegnete Thymara hastig. Sie kämpfte gegen das Gefühl der Reue an, das sie angesichts ihrer Zusage sofort überkam. Fleisch für Sintara und Fleisch für die kranke Braune und den zurückgebliebenen Silberdrachen. Warum hatte sie sich nur freiwillig dazu bereit erklärt, sich um die beiden zu kümmern? Sie schaffte es ja nicht einmal, Sintara satt zu bekommen. Und nun hatte sie im Grunde versprochen, Fleisch für Sylves Golddrachen Mercor zu besorgen. Sie hoffte, dass die Jäger ebenfalls auf die Pirsch gehen würden.
Seit die Drachen ihre erste Beute erlegt hatten, hatten sie gelernt, selbst ein wenig zu jagen und zu fischen. Allerdings war keiner von ihnen ein herausragendes Raubtier. Denn eigentlich jagten Drachen aus der Luft und humpelten der Beute nicht auf dem Boden hinterher. Dennoch hatten alle gewisse Erfolge zu verzeichnen. Dass sie zur Abwechslung einmal frisch erlegtes Fleisch und Fisch hatten fressen können, war anscheinend nicht spurlos an ihnen vorübergegangen. Sie waren zwar schlanker, aber muskulöser. Während Thymara an den Drachen vorbeischritt, betrachtete sie die Geschöpfe kritisch. Überrascht stellte sie fest, dass sie den Bildern von Drachen, die sie auf unterschiedlichen Uraltenartefakten gesehen hatte, schon viel ähnlicher sahen. Kurz blieb sie stehen, um die Kreaturen zu bewundern.
Arbuc, ein grün-silberner Drache, plantschte im flachen Ufergewässer. Hin und wieder stieß er seinen Kopf unter Wasser und brachte Alum, seinen Hüter, damit zum Lachen. Dieser watete neben ihm her und hielt einen Fischspeer einsatzbereit, obwohl der herumtollende Drache wahrscheinlich sämtliche Beute vertrieben hatte. Dann breitete Arbuc die Flügel aus. Sie waren ihm viel zu lang, aber er schlug dennoch damit, sodass Wasser aufspritzte und auf Alum herabregnete. Der Hüter schrie auf, worauf der Drache innehielt und verdutzt dreinschaute. Von den erhobenen Flügeln tropfte es herab. Nachdenklich sah Thymara ihn an.
Unvermittelt machte sie kehrt und hielt nach Himmelspranke Ausschau. Sintara, nicht Himmelspranke, rief sie sich missmutig ins Gedächtnis. Warum hatte es ihren Stolz so sehr verletzt, als sie erfahren hatte, dass andere Drachen ihren wahren Namen nicht vor ihren Hütern verheimlicht hatten? Wahrscheinlich hatte Jerd den Namen ihrer Drachin vom ersten Tag an gekannt. Sylve ebenfalls. Thymara knirschte mit den Zähnen. Sintara war zwar die Schönste von allen, aber warum musste sie nur einen derart schwierigen Charakter haben?
Die Blaue lag trostlos auf einem morastigen Streifen Schilf und Gras. Ihr Kopf ruhte auf den Vorderpranken, während sie auf die Bewegungen im Wasser starrte. Mit keiner Regung deutete sie an, Thymaras Anwesenheit bemerkt zu haben, bis sie plötzlich sagte: »Wir sollten weiterziehen, anstatt hier zu warten. Wir haben nur noch wenige Tage, bevor der Winterregen einsetzt, und dann steigt das Wasser, der Fluss strömt schneller. Wir sollten die Zeit davor ausnutzen, um Kelsingra zu finden.«
»Dann meinst du, dass wir die braune Drachin zurücklassen sollen?«
»Relpda«, erwiderte Sintara, und eine Ahnung von Rachsucht war plötzlich zu spüren. »Warum sollte ihr wahrer Name geheim bleiben, wenn meiner allgemein bekannt ist?« Sintara hob den Kopf, streckte die Vorderläufe und fuhr die Krallen aus. »Und sie wäre nicht braun, sondern kupferfarben, wenn sie richtig gepflegt würde. Sieh her. Meine Kralle ist eingerissen. Das kommt vom vielen Laufen auf den Steinen im Wasser. Ich möchte, dass du Zwirn besorgst und sie zusammenbindest. Dann trägst du eine Teerschicht auf, wie du es beim Schwanz des Silberdrachen getan hast.«
»Lass sie mich mal ansehen.« Die Kralle war ausgefranst und weich, weil sie zu lange im Wasser gewesen war. An der Spitze war sie gespalten, aber glücklicherweise ging der Riss nicht bis zum Fleisch. »Ich frage Kapitän Leftrin, ob er etwas Zwirn und Teer übrig hat. Und da wir schon einmal dabei sind, lass uns dich mal genauer anschauen. Sind die anderen Krallen noch heil?«
»Sie weichen ein wenig auf«, gestand Sintara, streckte Thymara auch die andere Pranke entgegen und fuhr die Krallen aus. Die Hüterin biss sich auf die Lippen, während sie sie untersuchte; die Krallenspitzen waren allesamt leicht ausgefranst, wie hartes Treibholz, das in der Feuchtigkeit allmählich zerfaserte. Der Gedanke an Holz brachte sie auf eine mögliche Lösung. »Vielleicht könnten wir sie ölen. Oder glasieren, damit sie das Wasser abweisen.«
Ruckartig zog die Drachin die Pranke zurück, und um ein Haar hätte sie Thymara dabei umgestoßen. Dann warf sie selbst einen Blick auf ihre Klauen und gab kühl zurück: »Vielleicht.«
»Steh bitte auf und streck dich. Ich muss dich nach Schmutz und Schmarotzern absuchen.«
Die Drachin grummelte missmutig, kam der Bitte aber nach, wenn auch nur langsam.
Bedächtig schritt Thymara um Sintara herum. Mit diesen Veränderungen hätte sie nicht gerechnet: Der Drache hatte abgenommen, war aber muskulöser geworden, und obwohl der ständige Aufenthalt im Wasser den Schuppen nicht guttat, wurde das Wesen durch den Kampf gegen die Strömung kräftiger. »Breite bitte deine Schwingen aus«, sagte Thymara.
»Lieber nicht«, antwortete Sintara steif.
»Willst du, dass sich darunter Schmarotzer einnisten?«
Wieder grummelte die Drachin, ließ dann aber ihre Flügel erzittern, um sie schließlich anzuheben. Die Spannhäute klebten aneinander wie bei einem Regenschirm, der zu lange in der Nässe gelegen hat. Es roch unangenehm. Die Schuppen darunter sahen kränklich aus, und ihre faserigen Ränder hatten weiße Flecken wie Laub, das anfängt zu schimmeln.
»Das ist nicht gut«, rief Thymara entsetzt aus. »Wäschst du die denn nie? Oder schüttelst sie mal aus und bewegst sie ein bisschen? Deine Haut braucht Sonne und muss gründlich geschrubbt werden.«
»So schlimm sind meine Schwingen doch gar nicht«, schnaubte die Drachin.
»Sie stinken, und in den Falten hat sich Feuchtigkeit gesammelt. Lass sie wenigstens so lange ausgebreitet, bis ich die Sachen geholt habe, um deine Klaue zu verbinden.« Sintaras würdevolles Gebaren missachtend, griff sie einen der fingerdicken Knochen und klappte die Schwinge ganz aus. Die Drachin wollte sie wieder zu sich heranziehen, aber Thymara hielt hartnäckig dagegen. Sintara daran zu hindern, den Flügel anzulegen, ging viel zu leicht. Sie hätte viel kräftiger sein müssen. Thymara suchte nach dem richtigen Wort dafür. Rückbildung. Die Muskeln bildeten sich zurück, weil sie nicht beansprucht wurden. »Sintara, wenn du dich nicht um deine Schwingen kümmerst, wie ich es dir sage, wirst du sie bald überhaupt nicht mehr bewegen können.«
»Wage es nicht, so etwas auch nur zu denken!«, zischte Sintara sie an. Sie schlug einmal kräftig mit dem Flügel, sodass er Thymara entglitt und sie mit den Knien im Morast landete. Das Mädchen sah zu der Drachin auf, die entrüstet die Schwingen zusammenfaltete.
»Warte. Warte, was ist das? Sintara, breite die Flügel noch einmal aus. Lass mich darunterschauen. Das sah aus wie eine Raspelschlange!«
Die Drachin hielt inne. »Was ist eine Raspelschlange?«
»Sie leben in den Baumkronen, dünn wie Zweige, aber lang. Sie schlagen blitzschnell zu, und sie haben auf ihrer Schnauze einen Zahn – wie ein Eizahn. Damit beißen sie zu, klammern sich fest und bohren ihren Kopf hinein. So bleiben sie dann hängen und fressen. Ich habe Affen gesehen, die hatten so viele Raspelschlangen, dass es aussah, als hätten sie hundert Schwänze. Normalerweise bilden sich rund um die Köpfe Entzündungen, und die Tiere sterben daran. Das sind gemeine Viecher. Spreize deinen Flügel und lass mich nachsehen.«
Direkt vom Flügelansatz hing ein langer, hässlicher Schlangenkörper herab. Als Thymara all ihren Mut zusammennahm, um das herabbaumelnde Tier zu berühren, zappelte es wild hin und her, und Sintara stieß einen schrillen Schmerzenslaut aus. »Was ist das? Mach das weg!«, rief die Drachin, steckte den Kopf unter den Flügel und schnappte nach dem Schmarotzer.
»Halt! Nicht beißen, du darfst nicht daran zerren! Wenn du sie herausziehst, reißt du ihr den Kopf ab. Dann bleibt er in deinem Fleisch und verursacht eine furchtbare Entzündung. Lass sie, Sintara. Lass sie los, ich kümmere mich darum.«
Sintaras Augen waren wie zwei sich drehende Kupferscheiben und funkelten. Doch sie kam der Aufforderung nach. »Mach das weg«, sagte die Drachin mit gepresster, wütender Stimme, und Thymara zuckte zusammen, als sie unter Sintaras Zorn auch ihre Angst spürte. Einen Atemzug später fügte diese zischend hinzu: »Beeil dich! Ich spüre, wie es sich bewegt. Es versucht, sich tiefer einzugraben, um sich in meinem Fleisch zu verstecken.«
»Sa steh uns bei!«, rief Thymara aus. Vor Ekel würgte es sie, und sie versuchte, sich die Erklärung ihres Vaters ins Gedächtnis zu rufen, wie man Raspelschlangen wieder loswurde. »Kein Feuer, nein. Wenn man ihnen mit Feuer kommt, fressen sie sich nur tiefer hinein. Es war etwas anderes.« Verzweifelt grub sie in ihren Erinnerungen, und dann fiel es ihr ein: »Whisky. Ich muss schauen, ob Kapitän Leftrin Whisky an Bord hat. Rühr dich nicht.«
»Beeil dich«, flehte Sintara.
Thymara lief zum Schiff, bemerkte unterwegs aber den Kapitän, der mit Alise über den Uferstreifen schlenderte. Da änderte sie ihren Kurs, rannte auf die beiden zu und rief: »Kapitän Leftrin! Kapitän Leftrin, ich brauche Eure Hilfe!«
Als Alise und ihr Begleiter Thymaras Stimme hörten, wandten sie sich um und eilten ihr entgegen. Ganz außer Atem kam sie bei ihnen an. »Was ist passiert?«, fragte Leftrin besorgt, worauf sie keuchend herausbrachte: »Eine Raspelschlange. Bei Sintara. Die größte, die ich je gesehen habe. Hat sich in ihren Rumpf verbissen. Unterm Flügel.«
»Diese verdammten Miststücke!«, schimpfte er, und Thymara war froh, dass sie ihm nichts weiter erklären musste.
Sie schnappte japsend nach Luft. »Mein Vater hat sie mit Gebranntem dazu gebracht, sich zu lösen.«
»Ja, gut, aber Terebenöl wirkt besser. Das kannst du mir glauben, denn ich musste mal eine aus meinem Bein entfernen. Komm, Mädchen. Ich habe welches an Bord. Alise! Wenn einer der Drachen eine Raspelschlange hat, kann es gut sein, dass die anderen auch welche haben. Sagt den Hütern, dass sie ihre Drachen untersuchen sollen. Und auch die Braune, die nicht mehr aufsteht. Schaut mal an ihrem Bauch nach. Sie suchen sich eine weiche Stelle, wo sie gut durchkommen, und graben sich dort ein.«
Leftrin eilte zum Schiff zurück, und Alise war froh, eine Aufgabe zu haben. Eifrig hastete sie über das Gelände, von Hüter zu Hüter, und verbreitete seine Anweisung. Greft entdeckte sogleich eine Raspelschlange, die verdeckt vom Hinterlauf an Kalos Bauch hing. An Sestican hatten sich drei dieser Schmarotzer geheftet. Kurz hatte Alise den Eindruck, sein Hüter Lecter würde in Ohnmacht fallen, als dieser die drei Schlangenleiber aus dem Fleisch des Drachen herausragen sah. Sie fuhr ihn an, um ihn aus seiner Schreckensstarre zu reißen, und erklärte ihm, er solle seinen Drachen zu Sintaras Lager führen und dort auf Leftrin warten. Offenbar war der Junge verblüfft darüber, dass sie einen so strengen Tonfall anzuschlagen vermochte. Er schluckte, fasste sich und kam ihrer Aufforderung nach.
Doch auch sie musste ihren Schock hinunterschlucken, bevor sie weiterhastete. Als sie bei Sylve und ihrem Golddrachen anlangte, der die Braune bewachte, musste sie kurz innehalten, um wieder Mut zu fassen. Es fiel ihr nicht leicht, Mercor anzusprechen – am liebsten hätte sie kehrtgemacht und wäre geflohen. Es dauerte einen Augenblick, bis ihr klar wurde, dass dieser Impuls nicht von ihrer Feigheit herrührte, sondern von dem Drachen ausging. Sie straffte die Schultern und schritt auf ihn und seine Hüterin zu.
»Ich komme, um die braune Drachin auf Schmarotzer zu untersuchen. Einige andere Drachen sind von Raspelschlangen befallen. Deine Hüterin sollte dich absuchen, während ich bei der Braunen nachsehe.«
Eine Weile starrte der Goldene sie nur an. Wie vermochten schwarze Augen nur derart zu funkeln?
»Raspelschlangen?«
»Das ist eine parasitische Wühlschlange. Thymara meint, sie kennt sie aus den Baumkronen. Allerdings glaubt sie, dass diese hier aus dem Fluss kommen. Sie sind viel größer. Das sind Schlangen, die sich festbeißen und in den Körper hineinfressen, um sich zu ernähren.«
»Widerlich!«, erwiderte Mercor. Unvermittelt erhob sich der Golddrache und breitete die Flügel aus. »Mich juckt es, wenn ich nur daran denke. Sylve, such mich sofort nach diesen Kreaturen ab.«
»Ich habe dich heute von Kopf bis Fuß geputzt, Mercor. Ich glaube, dass mir eine solche Schlange aufgefallen wäre. Aber ich sehe trotzdem nach.«
»Und ich muss mir die Kupferdrachin vornehmen und überprüfen, ob sie welche hat«, sagte Alise mit Nachdruck.
Eigentlich hatte sie mit Widerspruch von Mercor gerechnet, doch der schien von dem Gedanken, selbst von diesen Schmarotzern befallen zu sein, vollkommen abgelenkt.
Alise trat zu der teilnahmslosen, eingefallenen Kupferdrachin. Diese lag so, dass es schwer, wenn nicht unmöglich war, ihren Bauch zu untersuchen. Und Sylve hatte recht. Das Wesen war so gleichmäßig mit Schlamm bedeckt, dass man meinen konnte, es wäre Absicht. Erst musste Alise diese Schicht entfernen, wenn sie irgendetwas erkennen wollte.
Hilflos sah sie zu Sylve hinüber, doch das kleine Mädchen war voll und ganz mit Mercor beschäftigt. Im nächsten Moment schämte sie sich bereits. Was war mit ihr los? Hatte sie das Regenwildnismädchen herbeizitieren wollen, damit es die Drachin putzte und Alise die Kreatur untersuchen konnte, ohne sich die Hände schmutzig zu machen? Welch arroganter Gedanke! Jahrelang hatte sie behauptet, eine Expertin auf dem Gebiet der Drachen zu sein, doch bei der ersten Gelegenheit, sich um einen zu kümmern, schreckte sie vor etwas Dreck zurück? Nein, nicht Alise Kincarron!
Nicht weit vom Liegeplatz der Drachin war ein Fleck mit Schilfgras, das noch nicht niedergetrampelt war. Die Halme mit ihren gefiederten Ähren reichten Alise bis zur Hüfte. Sie zog ihr kleines Messer aus dem Gürtel, schnitt ein halbes Dutzend davon ab und wickelte sie zu einem groben Bündel zusammen. Zurück beim Liegeplatz, begann sie, die Drachin kräftig damit abzubürsten, ausgehend von der oben liegenden Schulter.
Bei dem Schlamm handelte es sich um getrockneten Schlick aus dem Fluss, und er löste sich erstaunlich leicht. Alises grobe Bürste legte Kupferschuppen frei, die hübsch glänzten. Dabei gab Relpda keinen Laut von sich, aber Alise meinte, vage Dankbarkeit von der lang gestreckten Drachin zu spüren. Da strengte sie sich noch mehr an und fuhr mit kräftigen Bürstenstrichen weiter über die Wirbelsäule. Natürlich war ihr die Größe der Drachin immer bewusst gewesen, nun spürte sie die Ausmaße auch in allen Knochen. Die Mannschaft fiel ihr ein, zu deren wiederkehrenden Pflichten es gehörte, das Deck der Teermann zu schrubben. Und dies war noch ein kleiner Drache. Über die Schulter warf sie einen Blick auf Mercor mit seiner goldglänzenden Schuppenhaut und machte sich bewusst, wie klein dagegen das rosa geschuppte Mädchen war, das sich um ihn kümmerte. Wie viel Zeit verwendete Sylve wohl jeden Abend für ihre Aufgabe?
Als hätte Sylve ihren Blick gespürt, wandte sie sich zu ihr um. »Er ist sauber, jeder Fingerbreit. Keine Schlangen. Jetzt kann ich Euch mit Relpda helfen.«
Aus Stolz wollte Alise eigentlich antworten, dass sie allein zurechtkam. Stattdessen hörte sie sich sagen: »Danke.« Und sie klang tatsächlich äußerst dankbar. Sylve lächelte sie an, und kurz reflektierten ihre Lippen blitzend das Sonnenlicht. War etwa auch ihr Mund geschuppt? Ruckartig wandte Alise den Blick ab und bürstete weiter. Eine feine Schlammkaskade rieselte von Relpdas Hüfte auf die feuchte Erde. Als sie Sylve zum ersten Mal gesehen hatte, war das Mädchen ihr noch nicht so schuppig erschienen. Veränderte es sich in der gleichen Weise wie die Drachen?
Als Sylve sich zu Alise gesellte, hielt auch sie eine Schilfbürste in der Hand. »Das ist wirklich eine gute Idee. Bisher habe ich Äste von Nadelbäumen genommen, wenn es welche gab. Und wenn nicht, habe ich Blätterbüschel benutzt. Aber damit geht es viel besser.«
»Wenn ich Zeit hätte, die Halme und Blätter zu verflechten, würde es noch besser gehen. Aber ich glaube, damit bekommen wir es auch hin.« Es fiel Alise schwer, zu schrubben und gleichzeitig zu reden. Während der Jahre in Hests Haus war sie verweichlicht. Als Mädchen hatte sie stets beim Reinemachen geholfen, da ihre Familie sich nicht viele Diener hatte leisten können. Jetzt fühlte sie den feuchten Schweiß auf ihrem Rücken, und sie bekam allmählich Blasen an den Händen. Auch die Schultern taten ihr bereits weh. Na, dann sollte es eben so sein! Ein bisschen schwere Arbeit hat noch niemandem geschadet. Und wenn sie sich die Hautpartien ansah, die sie schon gereinigt hatte, empfand sie Stolz.
»Was ist das? Was ist das? Ist das ein Schlangenloch?« Die Angst und die Sorge in Sylves Stimme schienen auf ihren Drachen überzuspringen. Mercor stapfte herbei und schwenkte seinen großen Kopf herab, um an einer Stelle am Hals des Kupferdrachen herumzuschnüffeln.
»Wie sieht es denn aus?«, fragte Alise, die nicht wagte, näher zu treten, solange der Golddrache so konzentriert darauf starrte.
»Eine wunde Stelle. Der Schmutz ringsum war feucht, vielleicht von Blut. Im Moment blutet sie nicht, aber …«
»Etwas hat sie hier gestochen«, sagte Mercor. »Aber es ist kein ›Schlangenloch‹, meine Liebe. Dennoch, das Blut riecht eigenartig, deshalb muss sie viel Blut verloren haben.«
Alise war wieder zu einem klaren Gedanken fähig. »Ich glaube nicht, dass Schlangen ein Loch machen und hineinkriechen. Sondern sie stecken ihren Kopf hinein und saugen Blut.«
Mercor blieb völlig regungslos. Sein Kopf schwebte noch immer über dem Kupferdrachen, die Augen schwarz auf schimmerndem Schwarz. Dennoch hatte Alise den Eindruck, als würde die Schwärze in ihnen langsam herumwirbeln. Dann schien er für einige Momente abwesend zu sein. Mit einem Schütteln, das seine Schuppen durchlief und Alise mehr an eine Katze als an ein Reptil erinnerte, kehrte er zurück, und sie spürte erneut seine geistige Präsenz. Sie staunte. Wenn er nicht kurz von ihr abgelassen hätte, hätte sie nie begriffen, wie sehr er sie beeinflusste, wenn er sich auf sie konzentrierte.
»Ich weiß nichts über Raspelschlangen. Von dem, was du beschreibst, habe ich vor langer Zeit gehört, und damals nannte man sie Wühler. Sie graben sich tief ein. Womöglich sind sie gefährlicher als die Raspelschlangen.«
»Sa steh uns bei«, sagte Sylve leise. Mit dem Schilfschrubber in der Hand stand sie einen Moment stumm da. Dann ging sie um die Drachin herum und stieß sie an. »Relpda!«, rief sie, als wollte sie durch die Teilnahmslosigkeit der Drachin dringen. »Roll dich auf den Rücken. Ich will deinen Bauch sehen. Dreh dich um!«