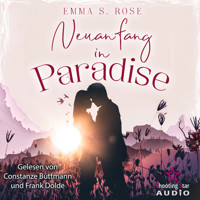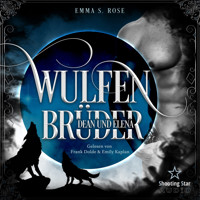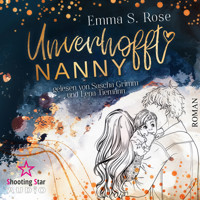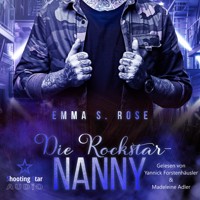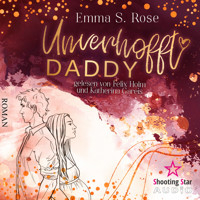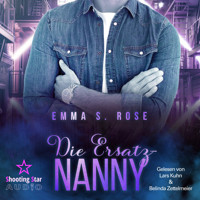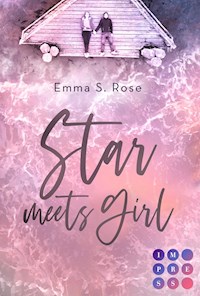
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
**Herzklopfen und Blitzlichtgewitter** Seit sie denken kann, lebt die achtzehnjährige Nele auf der kleinen Nordseeinsel Nütjeoog, wo jeder jeden kennt und kein Geheimnis sicher zu sein scheint. Noch nicht bereit, fürs Studium die Vertrautheit ihrer Heimat zu verlassen, genießt sie als Aushilfe im Laden ihrer Tante die idyllische Abgeschiedenheit. Doch als plötzlich ein Fremder auf der Insel auftaucht, gerät Neles Leben aus den Fugen: Der wortkarge junge Mann strahlt eine Anziehungskraft aus, der sie sich einfach nicht entziehen kann. Unbeirrt von seinem verschlossenen Verhalten, versucht Nele hinter seine Fassade zu blicken – bis ein gemeinsamer Ausflug aufs Festland mit einer Horde kreischender Fans endet. Denn Jasper Kaiser ist zufällig Hauptdarsteller einer bekannten Telenovela und damit ein Star ... Der Schauspieler von nebenan Zwischen Meeresbrise, Kamerageknipse und prickelnden Gefühlen. Die perfekte Liebesgeschichte für alle, die regelmäßig von ihrem eigenen Star träumen. //»Star meets Girl« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Emma S. Rose
Star meets Girl
**Herzklopfen und Blitzlichtgewitter**Seit sie denken kann, lebt die achtzehnjährige Nele auf der kleinen Nordseeinsel Nütjeoog, wo jeder jeden kennt und kein Geheimnis sicher zu sein scheint. Noch nicht bereit, fürs Studium die Vertrautheit ihrer Heimat zu verlassen, genießt sie als Aushilfe im Laden ihrer Tante die idyllische Abgeschiedenheit. Doch als plötzlich ein Fremder auf der Insel auftaucht, gerät Neles Leben aus den Fugen: Der wortkarge junge Mann strahlt eine Anziehungskraft aus, der sie sich einfach nicht entziehen kann. Unbeirrt von seinem verschlossenen Verhalten, versucht Nele hinter seine Fassade zu blicken – bis ein gemeinsamer Ausflug aufs Festland mit einer Horde kreischender Fans endet. Denn Jasper Kaiser ist zufällig Hauptdarsteller einer bekannten Telenovela und damit ein Star …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© Claudia Warneke Fotografie
Geboren und aufgewachsen ist Emma S. Rose im schönen Ostwestfalen. Schon als Kind wollte sie nichts sehnlicher, als später einmal Bücher schreiben. Zunächst jedoch studierte sie Soziale Arbeit und arbeitete unter anderem in der Suchthilfe, ehe sie beschloss, ihren Traum zu verwirklichen. Im Mai 2014 erschien ihr Debütroman. Mittlerweile ist sie hauptberuflich Autorin und kann sich ein Leben ohne Schreiben nicht mehr vorstellen.
Für meine Familie, die mich gleichzeitig erdet und mir Flügel verleiht
Kapitel 1
Zitternd blicke ich auf die aufgewühlte See. Der Wind reißt an meiner Kapuze, dröhnt in meinen Ohren und versucht mit aller Macht mich mit sich zu ziehen. Ich kenne die Urgewalt der Natur, bin mit ihr aufgewachsen, und doch überrascht es mich immer wieder aufs Neue, wie rau die Wetterextreme sein können. Ich stehe breitbeinig hier, meine Schuhe fest vergraben im nassen, schweren Sand – und genieße es.
Wenn andere sich in ihre Häuser verkriechen, den Ofen anheizen und darauf warten, dass sich die Lage bessert, werfe ich mir nicht selten meinen Mantel über und wage mich nach draußen. Das hier ist mein Element. Ich weiß, worauf ich mich einlasse, wenn ich mich gegen den reißenden Wind stemme und den Deich erklimme. Und mir ist klar, dass ich vorsichtig sein muss. Ich halte immer ausreichend Abstand zum Meer, wenn es zu aufgewühlt ist. Dann, in diesen wenigen Augenblicken, in denen ich stocke, mein Gesicht in den Regen halte, die kalten Tropfen schwer auf meinem Gesicht spüre und erschaudere, weiß ich, dass ich lebendig bin.
Ich bin ein Inselkind durch und durch, erkenne die Natur als Teil meines Lebens an, nicht als meinen Feind, bin dankbar für das Leben, das ich führen darf … dankbar und demütig.
Auch heute halte ich inne, beobachte die Schaumkronen auf den Wellen, die sich am Strand brechen und rauschend zurückziehen, nur um erneut anzugreifen. In der Ferne sehe ich ein riesiges Containerschiff, das beinahe mit dem Horizont verschmilzt. Auch dort geht das Leben weiter, selbst wenn es stürmt und wie aus Kübeln schüttet. Froh, wenigstens sicheren, ruhigen Boden unter den Füßen zu haben, winke ich dem Schiff zu, obwohl ich weiß, dass mich keiner sehen wird.
Ich lächle. Meine Haut prickelt, so kalt ist mir mittlerweile, und mein Schal ist zwar fest um meinen Hals gewickelt und in die Kapuze gestopft, aber ich merke doch, wie der Wind daran zerrt. Es wird Zeit zu gehen. Zeit, die nassen Sachen loszuwerden und eine heiße Dusche zu nehmen, ehe ich mich dem Rest dieses verbliebenen Tages widme.
Ich komme regelmäßig hierher, nicht nur, wenn es stürmt. Das hier ist mein kleiner Strandabschnitt. Er gehört nicht wirklich mir, aber ich fühle mich ihm besonders verbunden. Seit Jahren schon nehme ich mir hier beinahe täglich einen Moment Zeit für mich, erinnere mich daran, wie dankbar ich für mein Leben auf der kleinen Nordseeinsel sein kann, das sicherlich nicht für jeden geeignet ist, und erde mich dadurch immer wieder aufs Neue.
»Bis morgen«, flüstere ich, komme mir dabei nicht einmal sonderlich dämlich vor. Manche reden mit ihren Haustieren oder sich selbst, ich rede mit der Nordsee.
Schließlich wende ich mich ab, um mich wieder den Deich hochzukämpfen.
Auf der Spitze ist der Sturm noch schlimmer; ich klammere mich an dem eiskalten Geländer fest und eile die ausgetretenen Steinstufen hinab. Beinahe gerate ich ins Straucheln, aber mit jedem Schritt, den ich weiter nach unten gelange, wird es leichter.
Als ich am Fuß der Treppe ankomme, atme ich kurz durch und hebe einmal mehr mein Gesicht in Richtung Himmel. Auch hier ist der Regen eisig kalt, aber der Wind wenigstens eine Spur schwächer. Keine Menschenseele befindet sich auf der schmalen Straße, die sich in sanften Kurven Richtung Inselinneres schlängelt. Das flache Gras beugt sich dem Wind, die knorrigen Büsche werden durchgeschüttelt. So wie ich. Vermutlich bin ich wirklich die einzige Bewohnerin Nütjeoogs, die sich gerade freiwillig draußen aufhält. Morgen werde ich mir bestimmt wieder ein paar Sprüche anhören müssen. Aber das ist okay. So bin ich – und so ist mein Leben auf der kleinen friesischen Insel vor der Nordseeküste.
Ein breites Lächeln erhellt meine Züge, während ich mich gegen den Wind stemme und den kurzen Fußmarsch Richtung Zentrum hinter mich bringe. Angst vor Autos, die mir plötzlich entgegenkommen, muss ich nicht haben. Die Insel ist Kfz-frei, man begegnet maximal Fahrradfahrern, und selbst die halten sich in Grenzen. Insbesondere an Tagen wie diesen.
Diejenigen von uns, die auf dem Festland arbeiten, lassen ihren Wagen am Hafen stehen, an dem es dafür extra Langzeit-Parkplätze gibt. Ich selbst habe nicht einmal einen Führerschein, obwohl meine Tante mich letztes Jahr praktisch dazu nötigen wollte. Bisher sehe ich darin keinen Sinn. Irgendwann wird sich das vielleicht ändern … sollte ich die Insel verlassen. So richtig verlassen.
Ich erschaudere, schiebe diesen bedrückenden Gedanken eilig beiseite, ergänze meinen Plan um eine Tasse heißen Kakao und freue mich auf das prickelnde Gefühl, das einsetzt, sobald die eisige Kälte weicht.
Bin ich seltsam, weil ich so etwas mag? Weil ich mich in solchen Momenten besonders lebendig fühle? Weil ich es nicht für nötig erachte, die weite Welt zu erobern? Weil mich mein kleiner Inselfleck auf der riesigen Landkarte mehr als glücklich macht? Manche würden das vielleicht behaupten. Ich jedoch bezeichne mich eher als genügsam, lebensbejahend und »glücklich im Moment verweilend«. Schon früh habe ich mich dazu entschieden, den positiven Blick aufs Leben zu bewahren. Das Glas ist halb voll, nicht halb leer, der Sturm gehört ebenso zu unserem Leben wie die Sonne. Und wann immer ich mich gegen die raue Naturgewalt stemme, flutet mich ein pures Glücksgefühl – wohlwissend, dass schon bald die Sonne folgen wird und ich sie umso mehr zu schätzen weiß.
Die Endorphine halten noch an, als ich das Haus erreiche, in dem ich mein bisheriges Leben verbracht habe.
Es liegt am Rand des Zentrums. Eingehüllt von einem natürlichen Zaun aus Büschen und flacher Hecke erhebt sich das alte Kapitänshaus mutig gegen die Urgewalten. Es gehört zu den ersten Bauten, die überhaupt auf Nütjeoog errichtet wurden, weshalb es noch den traditionellen Charme ausstrahlt: rote Backsteine, ein Reetdach mit spitzem Zwerchgiebel mittig über der Eingangstür, eher flach gebaut, dafür lang gezogen. Früher befanden sich im östlichen Teil Stallungen, doch die wurden schon vor einiger Zeit zu Wohnraum umgebaut. Wir besitzen keine Tiere, auch wenn ich mir als Kind über Jahre verzweifelt einen Hund gewünscht habe – oder Ziegen. Mittlerweile verstehe ich die Entscheidung meiner Eltern, auch wenn meine Sehnsucht nach einem Vierbeiner ungebrochen ist. Irgendwann, wenn ich diese Entscheidung allein treffen kann, werde ich es tun. Bis dahin begnüge ich mich mit den zahlreichen Tieren, die unsere Insel bevölkern.
»Nele?«
Die klare Stimme meiner Mutter ertönt aus der Küche, sobald ich unser Haus betrete. Es riecht nach deftigem Eintopf und Zimt, und die angenehme Holzofenwärme überzieht meine nasskalte Haut mit dem erwarteten Prickeln.
»Ja, ich bin’s«, erwidere ich, während ich Mantel und Stiefel abschüttele und im Eingangsbereich zurücklasse. Dann tapse ich durch den breiten Flur und wende mich nach rechts, wo sich die riesige Wohnküche befindet. Wie erwartet steht meine Mutter am Herd, rührt in einem großen Topf, der bestimmt ausreichend Essen für eine ganze Schiffsbesatzung beinhaltet, und lächelt mich milde an.
»Du warst schon wieder am Strand.« In ihren Worten klingt kein Tadel mit. Meine Eltern haben früh aufgehört mir ausreden zu wollen, dass ich mich bei Wind und Wetter rausschleiche. Vielleicht weil sie begriffen haben, dass ich stets vorsichtig bin und Unwettern mit Respekt begegne. Vielleicht aber auch, weil sie es schlicht und ergreifend aufgegeben haben – in dem vollen Bewusstsein, dass ich den Dickschädel meiner Tante Maren geerbt habe.
Ich trete neben sie, schiebe meine Hand unter den Saum ihres Fleecepullovers und entlocke ihr einen schrillen Schrei. Grinsend wackle ich mit den Augenbrauen. »Jepp, zumindest kurz. Ist echt windig draußen, aber wir hatten es schon schlimmer.«
Die Augen meiner Mutter funkeln. Sie sind ebenso sturmgrau wie das Meer vorhin, und ich liebe es zu wissen, dass ich diese schöne Schattierung geerbt habe. Neugierig werfe ich einen Blick in den Topf – und seufze zufrieden. Möhren-Kartoffel-Eintopf gehört zu meinen liebsten Gerichten und passt perfekt zu einem Tag wie heute.
Schritte ertönen hinter mir. Im ersten Moment überrascht es mich, tagsüber ist mein Vater selten daheim, doch dann verdrehe ich grinsend die Augen. Klar: Ihn hat das Wetter mehr in die Knie gezwungen als mich oder die restlichen Bewohner der Insel. Er arbeitet für die Werft, die einen Großteil der Fähren in dieser Gegend stellt. Normalerweise ist er für den Pendelverkehr von Nütjeoog zum Festland zuständig, springt auch mal auf anderen Strecken ein. Aber da unsere Insel bei Wetterlagen wie dieser hier vom Festland abgeschnitten ist, muss er wohl oder übel einen Tag Urlaub einlegen. Für einen Mann wie meinen Vater nicht gerade einfach. Er wirkt gehetzt, so als bräuchte er dringend eine Aufgabe. Bestimmt hat er den halben Tag in seiner Werkstatt verbracht, wo er alte Möbel restauriert oder andere kleinere Holzarbeiten erledigt, wenn er mal etwas Zeit findet.
»Hey, Papa«, begrüße ich ihn.
Er nickt mir zu, seine Mundwinkel zucken. Dann lässt er sich schwer seufzend auf die Eckbank sinken.
Ich wende mich lächelnd ab. Das war seine Version friesischer Herzlichkeit.
Meine Tante kommt zur Tür reingeschneit. Sie wohnt in einer gemütlichen, aber winzigen Wohnung über dem Inselladen, den sie seit bald zehn Jahren führt, und wenn sie nicht gerade hinter der Kasse steht, hält sie sich häufig bei uns auf. Sie behauptet, es liege an der großen Auswahl an Büchern. Ich weiß, es liegt daran, dass wir einen Kamin haben und meine Mutter besser kocht.
Wie immer, wenn Maren da ist, wird es laut und fröhlich. Sie ist die ältere Schwester meiner Mutter, aber wenn man deshalb vermutet, dass sie die vernünftigere ist, hat man sich geschnitten. Wo meine Mutter eher still und zurückhaltend ist, ist Maren laut und forsch. Sie hat ihr Haar flammendrot gefärbt, seit ich denken kann, und die wilden Locken umfliegen ihren Kopf wie Feuer, nur ab und an gebändigt durch ein buntes Tuch, das sie sich wie ein Stirnband umbindet. Meist trägt sie eine Latzhose, auch wenn die ihrer rundlichen Figur nicht unbedingt schmeichelt, und dazu karierte Hemden und Stiefel. Sie befindet sich irgendwo zwischen burschikos und superweiblich und es gibt keinen Menschen, zu dem ich mehr aufsehe als zu ihr. Auch wenn ich meine Eltern liebe und sie mir viel mitgegeben haben – Maren ist es, die meine lebensbejahende Einstellung gefördert hat. Meine Liebe zur Natur, zu den Selbstverständlichkeiten des Lebens, die gar nicht so selbstverständlich sind. Und zu Büchern.
Meine Tante ist einfach spitze.
Gerade gibt sie wieder ihre Anekdoten des Tages zum Besten. Auf Nütjeoog wohnen aktuell 97 Menschen. Urlauber verirren sich so gut wie nie zu uns, obwohl wir für den unwahrscheinlichen Fall ein paar einfache Ferienwohnungen zur Verfügung haben. Das hat zur Folge, dass die Leute, die ihren Laden frequentieren, immer dieselben sind, und so sieht es auch mit den Anekdoten aus. Und doch schafft sie es, sie so zu verpacken, dass wir alle lachen müssen – genauer gesagt: leichtes Schmunzeln im Falle meines Vaters –, ohne dass sie irgendjemanden blamiert. So ist sie, mein Sonnenschein von Tante.
»Wie sieht es mit deinen Studienplänen aus, Nichtchen?«, wechselt Maren so plötzlich das Thema, dass all meine Zuneigung für sie kurzfristig verpufft.
Meine Mutter hebt fragend die Augenbrauen, mein Vater brummt leise. Beide widmen sich weiterhin ihrem Eintopf, während ich mich augenblicklich in die Ecke getrieben fühle. Hitze schießt mir in die Wangen, als ich Marens Blick begegne. Sie lächelt mich offen an.
»Alles beim Alten«, gebe ich zurück, klinge dabei etwas atemlos.
»Nele …«
»Maren!« Entschlossen falle ich ihr ins Wort, deute mit dem Löffel auf sie und schüttle den Kopf. »Nicht heute, okay? Seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hat sich nichts Wesentliches geändert, und ich kann deine Argumente mittlerweile im Schlaf herunterbeten. Wenn wir das nächste Mal im Laden stehen, kannst du mich gern wieder bearbeiten. Aber heute Abend will ich einfach nur mein Leben genießen.«
Obwohl ich sie darum gebeten habe, kann sie nicht klein beigeben. Natürlich nicht. Marens Augenbrauen treffen sich in der Mitte, ihre Nase wird kraus. »Du tust so, als wäre es dein Untergang fortzugehen. Dabei ist es genau das, was du willst. Leben. Du weißt, dass Nütjeoog nicht alles ist …«
»Jepp, weiß ich. Und ich werde auch fortgehen … irgendwann.« Eilig widme ich mich wieder meinem Eintopf, der plötzlich einiges an Geschmack eingebüßt hat. Dennoch schiebe ich mir eine riesige Menge in den Mund, um erst einmal nicht mehr reden zu müssen.
Obwohl Maren sich offenbar damit zufriedengibt und wieder völlig abrupt das Thema wechselt, ist der Schaden angerichtet. Seufzend lasse ich meinen Blick durch die urige Küche schweifen. Unsere Sitzecke ist durch offenes Gebälk eingerahmt. Die Fliesen sind terrakottafarben, einige von ihnen haben schon Sprünge – Zeugen all der Jahre voller Leben in diesem Haus. Die Küche ist ebenfalls alt, aber robust und mit neuen Geräten ausgestattet. Während die Wand hinter mir nur von einem riesigen Ölgemälde beherrscht wird, das die raue See an einem Sturmtag wie diesem darstellt, sind die anderen über und über mit Fotos bedeckt. Schwarz-weiß, bunt, sepia. Die Vorfahren meiner Eltern, wir, Momentaufnahmen einer traditionsreichen Familie, die hier schon lebt, seit Nütjeoog besiedelt wurde. Hier fühle ich mich zu Hause. Das hier ist der Inbegriff von Heimeligkeit. Wann immer ich daran denke, die Insel verlassen zu müssen, um zu studieren, wird mir ganz mulmig zumute. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das Leben anderswo sein wird. Ich liebe es hier, habe alles, was ich brauche. Allein die Vorstellung, mich vom Meer zu entfernen, stresst mich bereits. Und wie soll ich da mit dem Leben in einer Stadt zurechtkommen?
Seit meinem Schulabschluss im vergangenen Jahr liegt meine Tante mir damit in den Ohren, dass ich »die Welt erobern soll«. Das will ich ja auch. Grundsätzlich. Aber ich will auch den richtigen Zeitpunkt dafür abpassen, und tief in meinem Innersten spüre ich, dass ich noch nicht so weit bin. Es hat mich einiges an Überzeugungskraft gekostet sie dazu zu überreden, mich in ihrem Laden arbeiten zu lassen. Ich habe es geschickt angestellt, habe begründet, dass ich mir so einen finanziellen Puffer für den Start ansparen und ein wenig erwachsener werden will. Letzteres Argument hat sie zum Lachen gebracht – in ihren Augen bin ich das bereits viel zu sehr für mein Alter –, aber am Ende hat sie sich geschlagen gegeben, wenn auch nur unter der Bedingung, dass ich es im kommenden Jahr angehe. Seitdem löchert sie mich regelmäßig mit Fragen: Wo soll es hingehen? Welche Studienrichtung? Wie sind deine Pläne?
Es macht mich jedes Mal ganz nervös. Wie soll ich bloß entscheiden, wie ich mir den Rest des Lebens vorstelle, wenn ich gar keine Ahnung habe, was mir fehlt?
Zum Glück sind meine Eltern in dieser Hinsicht entspannter. Solange ich bleiben will, kann ich bleiben. Wenn ich gehen will, kann ich auch das tun. Sie sind mit meinen Entscheidungen einverstanden, egal wie sie ausfallen. Allerdings hege ich den Verdacht, dass sie mich besser verstehen können als Maren. Während meine Mutter zwar ebenfalls zum Studieren fortgegangen ist, nur um dann direkt wieder zurückzukehren, hat sich mein Vater nur ein einziges Mal weiter als einhundert Kilometer von Nütjeoog entfernt, und zwar, um meine Mutter wieder auf die Insel zurückzuholen.
Ich persönlich finde das sehr romantisch, Marens Meinung gebe ich lieber nicht wieder. Schon seltsam eigentlich, dass sie diejenige ist, die mich in meiner charakterlichen Entwicklung so begleitet und meine Inselliebe gefördert hat, und nun will ausgerechnet sie mich verscheuchen.
Nach dem Essen kümmere ich mich um den Abwasch, während Maren und mein Vater rüber ins Wohnzimmer gehen. Es ist noch größer als die Küche und zweigeteilt. Es gibt einen Bereich mit Sofa und Fernseher und dazu noch einen Lesebereich – deckenhohe Regale, zwei samtbezogene Ohrensessel und ein kleines Tischchen, auf dem man Teetassen und Gebäck abstellen kann. Oder, wie in diesem Fall, Whiskeygläser. Offenbar ist wieder einer dieser Abende. Mittig im Raum steht der alte, aber voll funktionstüchtige Kamin mit dem riesigen, rußverschmierten Sichtfenster. Feuerholz ist ein gewisser Luxus auf Inseln wie dieser, weshalb der Ofen nur an kalten, ungemütlichen Tagen feuert – so wie heute.
***
Als ich eine Weile später zu ihnen stoße, haben sich Maren und mein Vater schon in einvernehmlichem Schweigen arrangiert, während meine Mutter es sich mit ihrem Nähzeug auf dem Sofa bequem gemacht hat. Leise Musik von »Grobschnitt« spielt im Hintergrund, wird aber immer wieder vom scharfen Rütteln des Windes übertönt, der scheinbar an Intensität zunimmt, so wie es der Wetterbericht angekündigt hat.
Ich zögere nicht allzu lange, schnappe mir mein aktuelles Buch und kuschle mich in die andere Ecke des breiten Sofas. Meine Mutter lächelt mir flüchtig zu, ehe sie sich wieder ihrem Projekt widmet. Und ich? Erschaudere, weil ich mich so geborgen fühle. Das hier ist es, was mir gefällt. Familienleben. Wortlose Kommunikation. Prasselnde Kaminwärme, während draußen ein Wintersturm tobt. Und wenige Hundert Meter weiter die Nordsee – das Tor zu Freiheit und Sehnsucht. Wieso sollte ich das frühzeitig hinter mir lassen?
Mir fällt keine Antwort ein. Also schiebe ich meine Vereinbarung mit Maren beiseite und konzentriere mich auf den Moment. So ist das Leben doch viel schöner.
Kapitel 2
Die Uhren auf Nütjeoog ticken anders, irgendwie langsamer. Der Dorfladen öffnet erst um neun Uhr, Beschwerden hat es deshalb noch nie gegeben, auch wenn ein Großteil der Inselbewohner sicherlich schon deutlich früher wach ist. Seit ein paar Jahren haben wir eine kleine Backstube, die im Großen und Ganzen von Milla betrieben wird. Sie verkauft meist schon etwas früher ihre Waren durch ein kleines Fenster, das zur Gasse führt. Erst wenn Maren die große Eingangstür öffnet, verschließt Milla das Fenster und tritt an den Tresen. Wer früher frische Brötchen haben möchte, backt sie selbst. So einfach ist das hier. Und es hat nie für Probleme gesorgt.
Als ich an diesem Morgen den Laden betrete, winkt Milla mir lächelnd zu. Sie ist zehn Jahre älter als ich, lässt mich das aber nie spüren. Ich freue mich jeden Tag sie zu sehen, und das nicht nur, weil sie wie immer bereits einen Kaffee und ein Schokobrötchen für mich bereithält.
»Deine Tante ist hinten im Büro. Scheinbar gab es ein paar Lieferschwierigkeiten. Der Sturm hat alles etwas durcheinandergebracht.«
»Oh, okay. Weißt du, worum es geht?« Mit gerunzelter Stirn lasse ich meinen Blick durch den weitläufigen offenen Raum schweifen. Erst einmal sieht es nicht so aus, als würde etwas fehlen. Die meisten Regale sind befüllt, wenn auch nicht voll.
Milla zuckt mit den Schultern. »Sie wirkte nicht allzu beunruhigt. Wird also halb so wild sein.«
Wieder einmal versuche ich, Milla einen Fünfer zuzuschieben, und wie jedes Mal wehrt sie ihn ab. Es ist zu unserer lieb gewonnenen Routine geworden, eine, mit der ich nicht brechen will, auch wenn ich mittlerweile mehr als begriffen habe, dass dieser erste Kaffee und das Brötchen aufs Haus gehen.
»Danke«, rufe ich ihr zu, schnappe mir den Mehrwegbecher, in dem ich meinen Kaffee hier immer trinke, sowie das Brötchen, und marschiere zur Kasse, um es mir dort für den Fall bequem zu machen, dass ein erster Kunde den Laden betritt, während Maren noch hinten ist. Da uns nach wie vor nur wenige Meter trennen, plaudern Milla und ich weiter, als würde ich immer noch neben ihr stehen. Nur eben ein bisschen lauter. Zunächst geht es um den Sturm, dann über das Wochenende. Milla hatte offenbar geplant, ihre neue Flamme auf dem Festland zu besuchen, woran das Unwetter sie gehindert hat. Nun macht sie sich Sorgen, er könnte das Interesse verloren haben.
In Sachen Männern und Beziehung habe ich nicht allzu viele Erfahrungen, wenn man von Ben absieht, mit dem ich in der achten Klasse Händchen gehalten und heimlich geknutscht habe. Dennoch gebe ich mein Bestes, beruhige Milla und spiele die Allwissende. Sie ist freundlich genug, mich nicht darauf hinzuweisen, oder vielleicht sehnt sie sich auch nur ganz verzweifelt nach meinen Worten. Scheinbar mag sie den Typ ziemlich gern.
Als würden ihr meine Pseudoberuhigungen reichen, wechselt sie plötzlich abrupt das Thema. »Hast du mitbekommen, dass wir einen Neuzugang haben?«
Ich hebe fragend eine Augenbraue. Da ich gerade eben in das Schokobrötchen gebissen habe, ist mehr nicht drin.
Milla lacht auf. Ihre Augen funkeln.
Was? Wir haben doch eben noch von ihrer Flamme auf dem Festland gesprochen? »Er muss direkt vor dem großen Sturm angekommen sein. Wohnt in der kleinen Ferienwohnung bei den Richters.« Obwohl niemand sonst da ist und sie es dadurch viel schwerer macht, sie zu verstehen, senkt sie verschwörerisch ihre Stimme. »Er sieht gut aus und niemand weiß so recht, was er will. Scheinbar hat er die Wohnung gestern nur verlassen, um eine Weile an den Strand zu gehen. Bei dem Wetter!«
Nun ist es an der Zeit, auch meine zweite Augenbraue zu heben. Zum einen, weil Milla mir gegenüber so tut, als wäre das so abwegig – ausgerechnet! – und zum anderen, weil sie offenbar so beeindruckt von ihm ist, obwohl es vorher noch die ganze Zeit über ihren Freund vom Festland ging. Zugegeben, hier passiert selten etwas Aufregendes. Wenn wir also einen »Neuzugang« haben, wie sie es so schön bezeichnet hat, wird das für Aufsehen sorgen. Aber verglichen mit dem, was außerhalb der Insel geschieht, handelt es sich da immer noch um einen Sturm im Wasserglas. Ich grinse bei diesem Gedanken, leere meinen Mund und setze zu einer Antwort an. »Er scheint ja zumindest hart im Nehmen zu sein. Gut so, denn das geht ja hier nicht anders.« Bedeutungsvoll lege ich den Kopf schräg, wofür Milla mir die Zunge herausstreckt. Lachend nehme ich einen Schluck Kaffee.
Als kurze Zeit später meine Tante in den Verkaufsraum tritt, wirkt sie zum Glück nicht ganz so gestresst wie befürchtet. Dennoch eilt sie auf direktem Weg zu mir, legt mir eine Hand auf die Schulter und seufzt.
»Was fehlt?«, frage ich sie ohne Umschweife.
Sie schüttelt den Kopf. »Eigentlich nichts Dramatisches. Ein paar Drogerieartikel werden knapp, außerdem Margarine und einige Gewürze. Alles Dinge, die wir meist länger auf Vorrat haben. Grundsätzlich ist das Lager relativ leer, aber alles noch im grünen Bereich. Normalerweise wäre die Nachlieferung für vorgestern terminiert gewesen. Ich dachte, das würde sich auf heute verschieben, aber scheinbar hat unser Zulieferer es einfach als ›ausgefallen‹ abgehakt. Unser Lagerbestand reicht aber nicht für die nächsten Wochen. Es war ziemlich viel Telefoniererei nötig, aber ich konnte ihnen Feuer unter dem Hintern machen. Jetzt kommen die Sachen spätestens Freitag.«
»Es geht aber nicht um Klopapier, oder?«, witzele ich – und erstarre, als Marens Miene ernst wird. »Ehrlich? Das könnte zu einem echten Problem werden …«
Meine Tante lacht so abrupt auf, dass mir sofort mein Fehler bewusst wird: Ich bin ihr wieder einmal auf den Leim gegangen. Grummelnd ramme ich ihr meinen Ellenbogen in die Seite, just als das helle Glöckchen am Eingang ertönt. Augenblicklich richte ich mich auf, wohlwissend, dass jeder Bewohner der Insel mich und meine Tante ausreichend kennt, um unsere Kabbelei richtig einzuordnen. Gerald schlurft näher, einer der ältesten Bewohner der Insel, und wenn ich es richtig erkenne, trägt er noch seinen Pyjama.
Maren und ich wechseln einen fragenden Blick. Nicht zum ersten Mal befürchte ich, seine Verwirrtheit könnte mehr sein als eine pure Alterserscheinung. Da er aber nicht sonderlich durcheinander wirkt – zumindest nicht mehr als sonst –, verkneife ich mir jeden Kommentar und tue so, als wäre es absolut normal, ihn in einem hellblau-weiß gestreiften Zweiteiler zu begrüßen.
Lustigerweise kauft er ausgerechnet Klopapier, dazu ein Rätselheft und eine Tafel Schokolade. Während Maren und er schnacken, suche ich Millas Blick, doch die ist in der Backstube verschwunden. Gerald ist ihr Nachbar. Ich sollte mich später mal genauer nach ihm erkundigen. Früher hatte er einen Hund namens Jockel, auf den ich ein paar Mal aufpassen durfte, wenn er aufs Festland gefahren ist. Dafür hat er mir immer einen Fünfer zugesteckt. Gott, was kam ich mir groß und zuverlässig vor! Erst viel später habe ich herausgefunden, dass sein Hund auch problemlos hätte allein bleiben können. Der alte Mann wollte mir einfach einen Gefallen tun, weil ich Hunde so sehr liebte – und dafür hat er mich auch noch bezahlt! Auch wenn unser Kontakt wieder geringer wurde, als der arme Jockel starb, ist er mir doch ans Herz gewachsen, und ich werde es ihm nie vergessen, wie gut er mir damals getan hat. Hoffentlich ist alles in Ordnung bei ihm.
***
Der Vormittag verläuft unspektakulär. Die nächste Lieferung frischer Waren kommt erst morgen früh mit der ersten Fähre, die auch meinen Vater abholen wird; ich habe also nichts zu tun. Nur gelegentlich plätschern die Bewohner herein, die meisten von ihnen gehen zu Milla. Obwohl wir massig Zeit haben, um zu plaudern, umgeht Maren das Thema Studium. Stattdessen beobachte ich, wie sie zwischendurch stöhnend in ihre Nasenwurzel kneift.
Ich grinse. »Na, war wohl doch ein Whiskey zu viel gestern, hm?«
Maren verdreht die Augen. »Zwei Gläschen. Mehr nicht, du vorlautes Ding. Das sollte ich vertragen können.«
Ich zucke mit den Schultern. »Der Kater fragt nicht nach der Menge, er kommt einfach angeschlichen.«
»Sagt das Mädchen, das ja schon soooo viel Erfahrung mit Alkohol hat.«
Ich nehme ihre Worte nicht persönlich, im Gegenteil. Mir ist klar, dass Maren meine Entscheidung, wenig bis gar nichts zu trinken, respektiert, auch wenn hier gern mal eine Menge Hochprozentiger fließt, sobald die Inselgemeinschaft Gründe dafür findet.
Und wenn man es darauf anlegt, findet man sehr viele davon.
Ich klopfe ihr tröstend auf die Schulter und mache mich auf, das Innenleben der Regale zu ordnen, die Produkte alle nach vorn zu ziehen und nach ihrer Haltbarkeit zu überprüfen. Nicht gerade eine erfüllende Aufgabe, aber immerhin eine Beschäftigung an diesem Tag, der wesentlich schleppender verläuft als erwartet. Eigentlich hätte ich gedacht, dass sie alle in den Laden eilen und sich darüber austauschen, was der Sturm angerichtet hat. Aber wie auch bei mir geht für viele das normale Tagesgeschehen weiter, und das führt einige von uns aufs Festland, wo sie ihren geregelten Jobs nachgehen, sofern das Wetter es zulässt.
Am frühen Nachmittag kommen ein paar mehr Bewohner vorbei, um Kleinigkeiten einzukaufen, vor allem aber, um zu plaudern. Milla hat schon vor einer Weile zwei Stehtische vor ihren Tresen gestellt, die meiste Zeit finden sich dort ein paar Leute ein, um bei Kaffee und einem süßen Teilchen zu quatschen. Ich lausche mit halbem Ohr den Gesprächen, die sich alle um Alltägliches drehen, kassiere ab, wann immer jemand mit seinem Einkauf zu mir kommt, während Maren entweder im Büro sitzt oder sich zu den anderen an den Stehtisch stellt. Es ist ruhig und gemütlich, ohne besondere Vorkommnisse, wenn man von dem Pyjamabesuch heute Morgen absieht, und genau das Richtige, um in eine neue Woche zu starten …
Bis um kurz nach vier einmal mehr das Glöckchen läutet und von einem zischenden Laut aus Millas Richtung untermalt wird.
Milde interessiert hebe ich den Blick – und halte erstaunt inne. Augenblicklich weiß ich, dass es sich um »den Neuzugang« handeln muss, dafür braucht es nicht Millas Augenakrobatik, mit der sie mir auffällig unauffällige Botschaften zusenden will. Ich kann gar nicht anders, als den Mann anzustarren, obwohl es mir peinlich ist, aber mit einem Mal verstehe ich Millas Reaktion. Verdammt, ich tue es ihr gleich, spüre, wie mir Hitze in die Wangen steigt.
Der Fremde sieht verdammt gut aus.
Normalerweise bin ich alles andere als oberflächlich. Für mich liegt die Qualität eines Menschen nicht in seinem Äußeren. Aber wer schaut nicht gern hin, wenn er einen hübschen Anblick präsentiert bekommt? Und dieser Fremde fällt definitiv in diese Kategorie.
Seltsamerweise spüre ich, wie mein Puls sich beschleunigt und meine Handinnenflächen feucht werden. Auch etwas, das ich nicht von mir kenne. Ich hatte nie große Probleme im Umgang mit Männern, ob gut aussehend oder nicht, und ich wüsste nicht, wieso ausgerechnet dieses Exemplar mich auf die Probe stellen sollte. Dennoch trockne ich meine Hände an der Jeans ab, fahre mir anschließend eilig durch meine Haare, um die Strähnen aufzulockern – und fange Millas Blick ein. Er besagt klar und deutlich: »Habe ich es dir nicht gesagt?« Und, untermalt von ihren wackelnden Augenbrauen: »Erwischt!«
Ich seufze auf.
All das scheint der Fremde jedoch nicht zu bemerken. Ohne die kleine Versammlung an den Stehtischen zu begrüßen, wendet er sich abrupt nach links und verschwindet in den Tiefen des Verkaufsraums. Nicht ein einziges Mal verliere ich ihn aus den Augen. Er ist so hochgewachsen, dass er jederzeit zwischen den Regalen aufragt, trägt eine Strickmütze, doch am Saum ringeln sich dunkelbraune Locken, die feucht wirken, als würde es draußen regnen – oder als wäre er eben erst der Dusche entsprungen.
Wieso auch immer ich überhaupt einen Gedanken daran verschwende?
Obwohl es maximal fünf Grad warm ist, trägt er nur einen dicken schwarzen Hoodie, der einen seltsamen Kontrast zu der Wollmütze bildet – dann fällt mir ein, dass er bei den Richters wohnt, und deren Haus steht nur zwei Straßen weiter. Offenbar handelt es sich bei dem Fremden um einen besonders harten Kerl.
Milla zischt – ich wende mich ihr widerstrebend zu und begegne ihrem breiten Grinsen.
Verdammt! Offenbar hat sie mich wieder beim Starren ertappt. Eilig wende ich mich ab, konzentriere mich für einen kurzen Moment auf den Tresen und die Zeitschrift, in der ich zwischendurch blättere. Die Buchstaben verschwimmen vor meinen Augen, also schiebe ich sie beiseite – und zucke zusammen, als plötzlich eine dunkle, volltönende Stimme direkt vor mir erklingt. Mein Blick ruckt in die Höhe und ich erkenne, dass der gut aussehende Fremde vor mir steht. Nun, aus direkter Nähe, jagt mein Puls neuen Rekorden nach. Es fällt mir schwer, mich auf meinen eigenen Namen zu konzentrieren, geschweige denn auf eine freundliche Erwiderung, als ich in seinen Augen versinke, die sich irgendwo auf der Farbskala zwischen braun und grün befinden. Sein Gesicht, eingerahmt von der dunklen Strickmütze und den feinen Locken am Saum, ist markant und von einem Dreitagebart bedeckt, den ich erstaunlicherweise sexy finde, obwohl ich es normalerweise glatt und weich mag. Aber am schönsten ist sein Mund. Dürfen Männer überhaupt so volle Lippen haben? Ist das nicht uns Frauen vorbehalten? Und wieso wirkt es an ihm so attraktiv?
Ja, er ist definitiv neu hier. Ich könnte mich auf jeden Fall erinnern, wenn ich ihm schon einmal über den Weg gelaufen wäre. Plötzlich bin ich unsicher, ob ich mir wünschen sollte, dass er länger bleibt oder lieber doch direkt wieder verschwindet.
»Hallo?«
Er spricht schon wieder … mit dieser rauen Stimme. Allerdings wirkt er jetzt irritiert, und seine Augenbrauen verschwinden fast unter der Mütze. Oh, richtig. Ja. Ich habe immer noch nicht reagiert, ihn nur angestarrt. Kann es noch peinlicher werden?
»Moin«, erwidere ich schwach und senke meinen Blick auf seine Einkäufe. Unwillkürlich lache ich auf.
»Gibt es ein Problem?«, meint er.
Wieder treffen sich unsere Blicke. Diese Tiefe in seinen Augen … ich atme durch, konzentriere mich auf das Wesentliche – freundlich sein, Nele! – und zucke mit den Schultern. »Nein. Was ist verkehrt an Gummibärchen, Fanta, Chips und Ravioli?«
Für einen Moment wirkt er so, als müsste er mich abschätzen und wäre unsicher, ob ich seinem Urteil standhalte oder nicht – dann breitet sich ein so charmantes Grinsen in seinem Gesicht aus, dass es mir buchstäblich den Atem nimmt. Wieso genau muss ich mich ausgerechnet jetzt in einen solchen Deppen verwandeln? »Richtig erkannt. Freut mich, dass wir einer Meinung sind.«
Mühsam weiche ich seinem Blick aus, weil ich dadurch wesentlich konzentrierter bin, doch meine gerade erlangte Souveränität gerät einmal mehr ins Wanken, als er die knapp fünf Euro mit einem Hunderter bezahlen will. Ich zögere minimal, vermeide aber nach wie vor einen direkten Blick in sein Gesicht, und als er kurz darauf das Wechselgeld nimmt, die Gummibärchen und die Flasche in seine Bauchtasche schiebt und den Rest so davonträgt, spüre ich, wie mir eine verräterische Schweißperle über die Stirn läuft.
Der Fremde macht noch einen Halt bei Milla. Während ich mich von diesem seltsam peinlichen und intensiven Moment erhole, komme ich in den Genuss zu beobachten, wie auch Millas Fassung ins Wanken gerät. Mein Puls rast immer noch übertrieben schnell und erst jetzt, wo uns einige Meter trennen, nehme ich den leicht würzigen Geruch wahr, den er zurückgelassen hat. Als wäre er wirklich direkt aus der Dusche gesprungen, um sich seine »gehaltvolle« Mahlzeit abzuholen.
Verwirrt beobachte ich, wie er sich ein paar Brötchen einpacken lässt und dann auf direktem Weg verschwindet. Kein Plausch mit den Anwohnern, die ihn alle mehr oder weniger verstohlen anstarren, kein Abschiedsgruß. All das stempelt ihn ziemlich deutlich als »den Neuen« ab, nicht als Teil der Gemeinschaft mit ihren eigenen Regeln.
Ich atme tief durch, sacke auf meinem Stuhl zusammen und kneife die Augen zu. Insgesamt war der Fremde nicht länger als zehn Minuten hier, und doch fühlt es sich so an, als hätte er stundenlang meine Aufmerksamkeit beansprucht.
Witzigerweise scheinen die alten Herrschaften am Stehtisch ihn bereits wieder vergessen zu haben, Milla und ich tauschen jedoch einen leidgeprüften Blick.
Kurzerhand überprüfe ich den Verkaufsraum. Er ist leer gefegt, also verlasse ich meinen Platz hinter der Kasse und schlendere zu meiner Kollegin hinüber, den Mehrwegbecher in der Hand. Sie erkennt meine Absicht, schnappt sich ein Mandelhörnchen und nimmt den Becher wortlos entgegen. Während die Kaffeemaschine lautstark mahlt, seufzt sie verzückt auf. »Er ist unglaublich, oder?«
»Das trifft es nicht einmal ansatzweise«, murmle ich, immer noch einigermaßen durcheinander. »Ich habe mich total blamiert.«
»Ach, Quatsch!« Mitfühlend reicht sie mir den Kaffee.
Ich puste in die dunkle Flüssigkeit. »Doch. Ich habe noch nie so blöd auf einen Mann reagiert. Keine Ahnung, was mit mir los war. Du hättest mich vorwarnen sollen.«
»Was denn?« Milla grinst mich unschuldig an. »Das kann man nicht in Worte fassen. Wie hätte ich dich darauf vorbereiten sollen? Ausgerechnet dich?«
Ein Außenstehender würde diesen Kommentar vielleicht falsch auffassen. Ich jedoch weiß, wie sie es meint. Wie schon gesagt, ich gebe normalerweise nicht viel auf Äußerlichkeiten, das geht in beide Richtungen. Verlegen zucke ich mit den Schultern und breche die schokoladenüberzogene Spitze vom Hörnchen ab. »Tja, es gibt immer die berüchtigte Ausnahme. Du hast gesagt, er wohnt bei den Richters? Dann ist er sowieso bald wieder weg.« Meine Gedanken schweifen zu seinem Einkauf und meine Mundwinkel zucken. Dafür, dass er so groß und schlank ist, ernährt er sich ziemlich mies. Ein weiterer Hinweis darauf, dass er sich lediglich Urlaub gönnt? Er wäre nicht der Erste, der in dieser Zeit sämtliche Vorsätze ziehen lässt.
»Ja, vermutlich.« Milla klingt, als würde sie diesen Umstand sehr bedauern, und seltsamerweise stelle auch ich fest, dass ich nichts dagegen hätte, dieses hübsche Gesicht wiederzusehen. Trotz meines peinlichen Aussetzers.
Das Glöckchen an der Tür läutet, und ich wende mich eilig ab, um zur Kasse zu schlendern. Hörnchen und Kaffee nehme ich mit – ausnahmsweise ohne zu versuchen, Milla dafür zu bezahlen. Sie hat mich praktisch ins offene Messer laufen lassen. Was mich betrifft, sind wir damit quitt.
Kapitel 3
Im Laufe der Woche kommt der Fremde noch ein paar Mal in den Laden. Jedes Mal wirkt er gehetzt, trägt die Mütze oder eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen und kauft ein paar Kleinigkeiten ein. Mal Tiefkühl-Fast-Food, mal Obst oder Aufschnitt, aber immer nur gerade so viel, dass er es problemlos ohne Tasche nach Hause tragen kann. Beim dritten Mal weise ich ihn darauf hin, dass er auch mit Karte bezahlen kann, wenn er das will, denn ehrlich gesagt ist das für uns auch am einfachsten, aber er geht gar nicht darauf ein und bezahlt weiter bar.
Also lasse ich ihn gewähren.
Maren fängt sich einen Infekt ein, weshalb ich sie komplett im Laden vertrete. Einerseits vermisse ich die Gesellschaft meiner Tante, andererseits freue ich mich, dass ich für eine Weile komplett mit dem Studienthema verschont bleibe.
Gerald taucht noch zweimal auf, beide Male normal gekleidet und geistig klar, weshalb ich die Eskapade mit dem Pyjama wieder verdränge. Jeder von uns hat mal einen schrägen Tag. Ich bin die Letzte, die dafür kein Verständnis hat.
Meine Tradition, nach Ladenschluss einen Abstecher an den Strand zu machen, halte ich auch in dieser Woche ein, obwohl ich wesentlich später als sonst Feierabend mache. Die Verantwortung, mich um die Kasse zu kümmern, lastet schwerer auf meinen Schultern als gedacht, gleichermaßen erfüllt es mich mit Stolz, dass Maren mich mit dieser Aufgabe betraut hat. Früher habe ich ab und an im Laden ausgeholfen, seit nunmehr einem halben Jahr arbeite ich fest an fünf Tagen in der Woche hier. Mittlerweile kenne ich nahezu alle Arbeitsschritte, kann sogar die Warenlieferung begleiten. Die Vorstellung, das hier einfach für immer zu machen, ist ebenso reizvoll wie der Gedanke, dadurch die Insel nicht mehr verlassen zu müssen. Gleichzeitig ist es jedoch total unrealistisch. Maren wird niemals zulassen, dass ich meine berufliche Zukunft so ausrichte, selbst wenn es mein tiefster Wunsch wäre. Und selbst ich bin nicht in der Lage zu verdrängen, dass ich mich gerade einfach in eine bequeme, sichere Vision hineinsteigere, weil mir die anderen Optionen so viel Respekt abringen.
***
Donnerstag ist es wieder fast dunkel, als ich den Laden hinter mir absperre. Müdigkeit steckt mir tief in den Knochen. Auch heute war kein Tag mit übermäßigem Andrang, und doch spüre ich, wie sehr sich die Last der Verantwortung auswirkt. Für einen kurzen Moment überlege ich sogar, ob ich den Ausflug zum Strand zugunsten eines ausgiebigen Schaumbads verschieben sollte, straffe dann aber meine Schultern und ziehe mir die Kapuze über den Kopf.
Nein, ich will mir den Kopf freipusten lassen, und wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Baden kann ich im Anschluss immer noch.
Im Vergleich zum Sturm vergangener Woche geht heute nur ein laues Lüftchen, aber dafür herrscht ein feiner Niederschlag, wie Sprühregen, der unangenehm auf jedem Zentimeter Haut prickelt, der dem Wetter ausgesetzt ist. Es kann nicht viel wärmer als fünf Grad sein und ich bohre meine Fäuste tief in die Jackentaschen, während ich den kurzen Fußmarsch zum Deich antrete.
Einer der Vorteile, wenn man auf einer kleinen Insel wohnt? Die Wege sind nie weit, egal welche Richtung man einschlägt. Innerhalb weniger Minuten habe ich das Zentrum hinter mir gelassen. Nur vereinzelte Höfe säumen die kleine Straße, allesamt mit weitläufigen Grundstücken, auf denen Schaukeln quietschend in der Brise wiegen oder flache Stallungen den Tieren Schutz für die Nacht bieten. Nütjeoog weist eine erstaunliche Menge an Kühen und Hühnern auf, weshalb wir weder Milch- noch Eiermangel haben. Egal wann.
Ich kuschle mich tiefer in die Jacke. Niemand sonst ist auf den Straßen unterwegs, obwohl es noch nicht einmal sechs Uhr ist. Dafür sind die Fenster der Häuser hell erleuchtet und strahlen Heimeligkeit aus.
Anstatt mich deshalb isoliert zu fühlen, muss ich lächeln. Ich fühle mich nie einsam, auch wenn sich ein Großteil meiner Schulfreunde über das gesamte Land ergossen hat und daher Maren und Milla am ehesten als meine engsten Sozialkontakte bezeichnet werden können. All die Inselbewohner gehören zu meinem Bekanntenkreis, es gibt niemanden, den ich nicht kenne.
Außer den Fremden.
Augenblicklich macht mein Herz einen Satz, sobald meine Gedanken sich in seine Richtung vortasten. Ich schüttle über mich selbst den Kopf, froh den Deich erreicht zu haben. Eiligen Schrittes erklimme ich die groben, lang gezogenen Stufen. Um diese Uhrzeit ist leider Ebbe, aber auch der Anblick des endlosen Strandes hat eine beruhigende Wirkung auf mich. Der Sand strahlt förmlich in der Dämmerung, und die salzige Luft erinnert mich an die endlose Weite, die sich vor mir erstreckt. Für einen Moment bleibe ich auf der Spitze des Deiches stehen und blicke in die Ferne. Ich befinde mich auf jener Seite der Insel, die nicht dem Festland zugewandt ist, was bedeutet, dass es keinen Fixpunkt am Horizont gibt. Wäre ich auf der anderen Seite, würde ich blinkende Lichter auf dem Festland erkennen – Zivilisation, die sich tief bis ins Landesinnere zieht. Jetzt verliert sich mein Blick in der Dämmerung, die tintenschwarz wird, ehe sie den Horizont küsst. Langsam schreite ich den Deich hinab, ein falscher Schritt könnte mich direkt auf den Hosenboden befördern. Aber ich komme schon so lange hierher, ich kenne die Gegend blind, weiß, wo die Stufen ausgetreten oder sogar weggebrochen sind und wo ich einen größeren Schritt machen muss.
Dieses Wissen ist beruhigend und einlullend zugleich.
Langsam löse ich mich vom Deich und betrete den Sandabschnitt. Manchmal reicht es mir, nur einen Blick in die Ferne zu werfen. Obwohl ich müde bin und der Sprühregen unangenehm, zieht es mich heute dennoch weiter. Eigentlich seltsam, wenn man bedenkt, dass ich ursprünglich mit dem Gedanken gespielt habe, den kleinen Abstecher ausfallen zu lassen. Aber ich habe schon früh gelernt, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen – und das rät mir weiterzugehen.
Es dauert einen Moment, ehe ich realisiere, was sich da vor meinen Augen auftut. Erst ist es nicht mehr als ein Schatten, der sich kaum merklich von der Dämmerung abhebt. Doch je näher ich komme, desto deutlicher erkenne ich eine zusammengekauerte Gestalt, die etwa zehn Meter weiter am Boden sitzt.
Ich atme überrascht ein.
Zögerlich trete ich näher. Es ist nicht das erste Mal, dass ich hier auf andere Menschen treffe, wieso auch nicht. Dieser Abschnitt ist schließlich nicht für mich allein vorgesehen. Dennoch ist es seltsam, ausgerechnet jetzt jemandem zu begegnen. Die Dunkelheit wird immer dichter, und es ist kalt und ungemütlich. Wer, bitte schön, sitzt dann gern am Strand?
»Moin. Dir ist klar, dass du dir wahrscheinlich eine Blasenentzündung holst, oder?«
Keine Reaktion.
Ich hebe fragend die Augenbrauen und wäge meine Optionen ab. Eigentlich geht es mich nichts an, wenn jemand beschließt, sich am frühen Abend hier niederzulassen. Andererseits denke ich an Gerald. Was, wenn er wieder einen seiner seltsamen Momente durchlebt und beschlossen hat, dem Wetter zu trotzen? Eine Verkühlung wäre in diesem Fall noch die harmloseste Konsequenz. Unschlüssig balle ich meine Hände in den Taschen – dann trete ich vor und lasse mich kurzerhand neben der Gestalt zu Boden sinken. Erst im letzten Moment bemerke ich die Decke, auf der er sitzt. Oder sie.
»Hey.«
Die Gestalt zuckt heftig zusammen – und wendet sich mir zu. Die Lichtverhältnisse sind mehr als katastrophal, aber es ist weniger sein Gesicht als vielmehr der Geruch, der ihn verrät. Ich realisiere meinen Fehler, als es bereits zu spät ist. Erschrocken zucke auch ich zusammen, während mir klar wird, dass ich mich gerade total grenzüberschreitend und naiv ausgerechnet neben den Fremden habe fallen lassen.
Wie oft muss ich mich in seiner Nähe eigentlich noch blamieren?
Er macht eine Bewegung, die ich als Entfernen von Kopfhörern deute. Erst jetzt nehme ich die leise Musik wahr, ehe sie abrupt verstummt. Deshalb also hat er nicht reagiert.
»Entschuldige«, plappere ich eilig drauflos. »Ich habe dich für jemand anderen gehalten.«
Etwas leuchtet in seinem Schoß auf – sein Smartphone. Nur kurz erhasche ich einen Blick auf den Sperrbildschirm, irgendein schrill-buntes, bildschirmfüllendes Graffiti, dann konzentriere ich mich ganz auf sein Gesicht, das nun dank der spärlichen Lichtverhältnisse halb im Schatten liegt. Sein Bart ist ein wenig dichter geworden, seine Stirn in tiefe Falten gelegt. »Machst du so etwas häufiger?«
Obwohl mir seine Irritation nicht entgeht und ich nach wie vor entsetzt über die Größe des Fettnäpfchens bin, in das ich mich kopfüber gestürzt habe, wage ich die Flucht nach vorn. »Was genau meinst du? Mich zu Fremden zu gesellen und so zu tun, als wären wir beste Freunde?«
»Ich hoffe sehr, dass du deine besten Freunde anders behandelst. Aus heiterem Himmel aufzutauchen und ihnen beinahe einen Herzinfarkt einzujagen ist nicht gerade eine wertschätzende Art und Weise, Zuneigung auszudrücken.«
Ich kann nicht anders – und pruste los. »Vielleicht solltest du die Musik ein wenig leiser stellen. Dann sind solche Schockmomente wesentlich unwahrscheinlicher.«
Darauf hat er offenbar nichts zu erwidern.
Ich setze lächelnd nach. »Das Geräusch des Meeres ist sowieso viel schöner.«
»Ja, klar.« Er lacht leise auf. »Wenn nicht gerade Tiefstand herrscht.«
Da hat er allerdings recht. Meine Gedanken rasen fieberhaft. Nun, da sich mein Schock etwas legt, erkenne ich das Potenzial der Situation. Die Lichtverhältnisse spielen mir in die Karten, der Zauber seiner intensiven Augen hat hier keine Wirkung. Vielleicht ist das der perfekte Moment, um ihn etwas besser kennenzulernen. Zumindest so weit, dass er für mich nicht mehr der ominöse Fremde ist.
»Was tust du hier?«, beginne ich wenig diplomatisch. Natürlich erhalte ich nicht mehr als ein Schnauben zur Antwort. »Sorry, das war ein wenig forsch. Ich meine nur …«
»Schon gut«, fällt er mir beinahe schroff ins Wort. Ich bilde mir jedoch ein, etwas aus seiner Stimme herauszuhören. Was genau, kann ich nicht sagen. »Ich sitze am Strand.«
Wow! Diese Antwort ist … vermutlich genau richtig auf meine unverschämte Frage, gleichermaßen empfinde ich sie als beinahe beleidigend für meine Intelligenz. Plötzlich höre ich ein schwappendes Geräusch – und dann sehe ich, wie er eine Flasche ansetzt und einen tiefen Schluck nimmt.
Vermutlich handelt sich nicht um Fanta.
Meine Alarmglocken schrillen los. Weniger von der Art »Sieh zu, dass du von hier verschwindest«, eher auf die soziale »Was ist los mit dir«-Weise. Einer der Nachteile, wenn man auf einer friedlichen Insel aufwächst: Man hat einen naiven Glauben an das Gute im Menschen. Während andere die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden, wenn sie wüssten, dass ich allein mit einem Fremden im Dunkeln am Strand sitze, der offensichtlich Alkohol zu sich nimmt, frage ich mich, was ihn eigentlich antreibt. Plötzlich kommt er mir sehr einsam vor.
»Und du trinkst«, stelle ich also fest. Gott sei Dank klingt keine Missbilligung in meiner Stimme mit.
»Gut erkannt, Sherlock.«
Wieder dieses Schweigen, aber plötzlich spüre ich ausreichend Motivation, um nicht nachzugeben. »Also gut, noch mal von vorn. Wieso sitzt du hier im Dunkeln allein am Strand? Du kannst weder das Meer als Ausrede vorschieben noch das Wetter.« Passenderweise erschaudere ich im richtigen Moment, weil die Kälte wellenförmig durch meine Klamotten dringt. Das Schaumbad habe ich dringender nötig denn je.
Ein Teil von mir erwartet keine Antwort, weshalb ich umso überraschter bin, als er sich leise räuspert.
»Was interessiert es dich? Bist du auf der Jagd nach einer guten Story?«
Von dieser seltsamen Reaktion fühle ich mich augenblicklich vor den Kopf gestoßen. Leise zischend rücke ich ein Stück von ihm ab. »Wie bitte? Nein! Wir haben selten Urlauber auf der Insel. Vielleicht ist es mein Fehler, dass ich es gewohnt bin die Menschen zu kennen, mit denen ich das Leben teile. Ich bin ganz sicher nicht auf der Suche nach irgendeiner Story oder einer anderen Möglichkeit, mir das Maul zu zerreißen. Hier kümmert man sich umeinander. Entschuldige bitte, wenn ich dich automatisch eingeschlossen habe.«
Stille. Ohrenbetäubende Stille. Eine Windböe zerrt an meiner Kapuze, und erst jetzt bemerke ich, dass sie mir längst vom Kopf gerutscht ist. Feuchtigkeit sickert mir den Nacken hinab, aber all das spielt kaum eine Rolle, weil die Hitze, die mich erfüllt, vordergründig ist. Einmal mehr fühle ich mich seltsam in seiner Gegenwart. Während ich zuvor meine Nervosität kaum einordnen konnte, bin ich jetzt erstaunlich irritiert. Eine Gefühlsregung, die ich so intensiv gar nicht von mir kenne.
Es dauert einen Moment, aber schließlich kommt Bewegung in seine Gestalt – der seltsame Kerl wirft den Kopf in den Nacken und lacht. Keine Ahnung, ob es das wirklich besser macht. Gereizt presse ich meine Lippen aufeinander und mache Anstalten aufzustehen, doch urplötzlich legt sich seine Hand um meinen Arm.
»Nein, warte. Bleib. Bitte!«
»Wieso sollte ich?«, erwidere ich langsam. »Du erweckst nicht gerade den Eindruck, als wäre dir meine Gesellschaft recht.«
Er atmet tief durch, aber sein Griff lockert sich nicht ein bisschen. »Stimmt. Mist, es tut mir leid. Du bist die erste Person seit längerer Zeit, mit der ich mehr als ein paar Worte gewechselt habe. Scheint, als hätte ich meine Manieren endgültig vergessen.«
Etwas in seinem Tonfall lässt mich innehalten. Er klingt gequält und es scheint so, als hätten seine Worte noch eine ganz andere Bedeutung. Augenblicklich beruhigt sich die sengende Hitze in meiner Magengrube und ich sacke in mich zusammen. »Na gut. Einen Moment bleibe ich noch, obwohl ich diejenige bin, die nun eine Blasenentzündung riskiert. Du kannst mir ja beweisen, dass du doch Manieren besitzt.«
»Und wie genau soll ich das anstellen?«
Ich wende mich ihm zu – und erstarre beim Anblick seines markanten Kiefers. Seine vollen Lippen haben sich zu einem hinreißenden kleinen Lächeln gekräuselt, und es juckt mir in den Fingern, durch die dunkelbraunen Löckchen zu fahren, die seinen Kragen berühren. Diese seltsamen Anwandlungen nehmen mir eine gute Portion meiner Selbstsicherheit. Kurzerhand schiebe ich meine Hände unter meinen Po. »Ich weiß nicht. Du könntest dich vorstellen. Wenn wir schon so viel miteinander reden, wäre es nett, dich gedanklich nicht mehr als ›den Fremden‹ bezeichnen zu müssen.«
»›Der Fremde‹, ja?« Er lacht auf, es klingt seltsam ironisch. »Du weißt nicht, wer ich bin?«
Was stimmt nicht mit ihm? »Okay, du bist ein Urlauber. Ich halte dir zugute, dass du nicht wirklich weißt, wie das Leben auf einer kleinen Insel funktioniert. Vermutlich kommst du aus einer größeren Stadt und kennst diese Art von Zusammenleben nicht. Ja, es wurde bereits über dich geredet, weil es eben selten vorkommt, dass sich ein Urlauber hierher verirrt.« Und noch dazu so ein gut aussehender, füge ich gedanklich hinzu, verkneife mir diesen Kommentar aber wohlweislich. »Dennoch können wir alle keine Gedanken lesen und mit den Richters hast du dir noch dazu eher zurückgezogene Vermieter gesucht. Also nein, es tut mir leid. Meine Insel-Superkräfte reichen nicht aus, um deinen Namen zu erraten.«
Wow! Ich atme tief durch. Woher kam das denn jetzt? Meine Mundwinkel zucken, ich schüttle den Kopf, um die Hitze loszuwerden, und rede bedeutend langsamer und ruhiger weiter. »Ich mache mal den Anfang – ich bin Nele. Und du?«
Verspätet recke ich ihm meine Hand entgegen, rechne gar nicht damit, dass er sie ergreift – und atme erleichtert auf, als er genau das doch tut. Seine Finger sind erstaunlich heiß, sein Druck angenehm fest. Für einen kurzen Moment schütteln wir einander förmlich die Hände und als wir damit aufhören, hält er mich einen Moment länger gefangen als nötig, ehe meine Hand zwischen uns ins Leere plumpst.
»Ich bin Jasper.« Es klingt zögernd, beinahe fragend.
Ich lächle ihn an. »Ein schöner Name.«
»Meine Eltern haben ein Faible für Norddeutschland«, erwidert er zu meiner großen Überraschung. »Eigentlich meine gesamte Familie. Ich habe früher oft hier oben Urlaub gemacht.«
Das erstaunt mich noch mehr. »Hier? Auf Nütjeoog?« Ich würde mich doch an jemanden wie ihn erinnern, oder etwa nicht?
Er lacht leise auf. »Nein. Nicht auf dieser Insel, obwohl meine Großeltern das immer geplant hatten. Aber die anderen kenne ich alle. Auf Norderney waren wir besonders oft …«
Ich unterbreche ihn mit einem lautstarken Schnauben. »Am besten fängst du jetzt auch noch von Sylt an. Das ist eine komplett andere Welt.«
»Ich weiß.« Er klingt so ernst und aufrichtig, dass mein Einwand einfach so in der Dunkelheit verpufft. »So viel habe ich mittlerweile festgestellt.« Ich will nachhaken, als er plötzlich einfach so auf die Beine springt und mir seine Hand entgegenreckt. Oder zumindest deute ich den Schatten so, der dicht vor meinem Gesicht auftaucht. »Ebenso stelle ich fest, wie spät es geworden ist. Komm, Zeit nach Hause zu gehen. Ehe du wirklich eine Blasenentzündung bekommst und der Laden daher morgen geschlossen bleibt. Du scheinst diese Woche ja allein zu sein.«
Etwas an seinen Worten berührt mich. Nach nur wenigen Sekundenbruchteilen des Zögerns ergreife ich seine Hand und lasse mich schwungvoll in die Höhe ziehen. So schwungvoll, dass ich gegen ihn stolpere.
»Hoppla«, murmelt er mit seiner tiefen Stimme und stabilisiert mich.
Erstaunt schnappe ich nach Luft. Er ist wirklich groß, mindestens einen Kopf größer als ich, und außerdem kräftig gebaut.
Außerdem riecht er gut, ganz anders, als ich es je an einem Mann wahrgenommen habe. Und das, obwohl unverkennbar der scharfe Hauch von Alkohol in seinem Atem mitschwingt.
Ein tiefes Schaudern erfasst mich, während er sich bückt und die Decke vom Boden klaubt. Wie merkwürdig es sich anfühlt, hier neben ihm zu stehen, merkwürdiger noch, als neben ihm auf dieser klammen Decke zu sitzen.
Schweigend machen wir uns auf den Weg zum Deich. Mittlerweile ist es stockdunkel, aber Jasper verwendet sein Handy nicht, um uns den Weg zu leuchten. Ich bräuchte sowieso keine Navigation, auch wenn meine Sinne durch seine Anwesenheit leiden. Und obwohl er getrunken hat, sind auch seine Schritte fest und sicher. Nicht ein Mal gerät er ins Straucheln.
Woran ich es bemerke? Er geht so nahe neben mir, dass sein Arm immer wieder meinen streift. Jedes Mal durchfährt mich dabei ein heftiges Schaudern.
Noch immer schweigend erklimmen wir den Deich. Wie üblich bleibe ich auf der Spitze stehen, wende mich noch einmal dem Meer zu und atme tief durch. Jasper kommentiert es nicht, wartet aber auf mich, ehe wir uns gemeinsam wieder an den Abstieg machen.
Hier hinter dem Deich ist die Dunkelheit weniger dicht, aber immer noch dicht genug, um kaum die Hand vor Augen zu sehen. Nun startet Jasper doch die Taschenlampenfunktion seines Handys, und wir schreiten die schmale Straße hinab in Richtung Zentrum. Erst als wir die ersten Höfe erreichen und die Lichter aus den Fenstern uns den Weg leuchten, steckt er sein Handy beiseite. Und erst, als wir den ersten Lichtschein einer der wenigen Laternen erreicht haben, bleiben wir wieder stehen. Plötzlich bin ich unschlüssig, wie wir uns voneinander verabschieden sollen.
»Da vorn wohne ich«, murmle ich und deute vage hinter mich, obwohl es ihn vermutlich nicht einmal interessiert.
Zum ersten Mal, seit wir wieder mehr Licht haben, wage ich einen direkten Blick in sein Gesicht, und sofort spüre ich dieses seltsame Prickeln an meiner Wirbelsäule. Wieso genau muss er so attraktiv sein? Und warum muss mein hormongesteuerter Körper mich permanent darauf hinweisen?