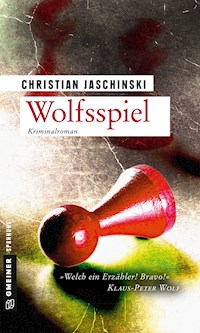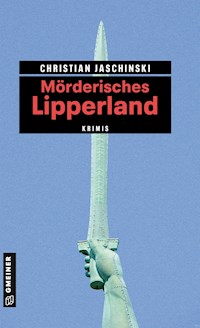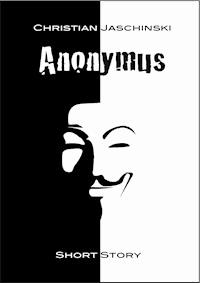Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Starck-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
"Ein echter Pageturner! Man kann nicht aufhören zu lesen." Klaus-Peter Wolf WAS BIST DU BEREIT FÜR DEINE TOCHTER ZU TUN? Eine verschwundene Tochter. Eine geheime Organisation. Ein rätselhaftes Konto. Ein Ex-Staatsanwalt zwischen Auftragsmördern. Alles war ihm genommen worden. Seine Frau. Seine Tochter. Sein Ruf und die Karriere. Als Andreas Starck aus dem Gefängnis freikommt, möchte er nur eines: endlich seine Tochter Greta wieder in die Arme schließen, die er jahrelang nicht gesehen hat. Doch das Recht dazu wird ihm verweigert. Starck hat genug. Nicht nur wurde dem Ex-Staatsanwalt seine Frau genommen, jetzt versucht auch noch jemand, ihn der gemeinsamen Zukunft mit seiner Tochter zu berauben. Entschlossen beginnt er, den eigenen Fall neu zu untersuchen, unterstützt von einem eigenwilligen Kommissar. Doch zu spät merkt er, dass er damit mächtige Gegner verärgert … Als Starck entdeckt, dass er von einem Auftragsmörder verfolgt wird, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Wer will ihn vernichten? Was haben sein verstorbener Vater und eine Bank in Zürich mit all dem zu tun? Vor allem aber – kann er seine Unschuld beweisen und die Tochter zurückgewinnen? Vergeltung, Vaterliebe und Korruption im Rechtssystem. Ein Thriller, bei dem sich zeigt, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint! Der fulminante Auftakt zur neuen Thriller-Reihe "STARCK – Staatsanwalt im Schatten".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Jaschinski
STARCK und der erste Tag
Thriller
Über das Buch
WAS BIST DU BEREIT, FÜR DEINE TOCHTER ZU TUN?
Eine verschwundene Tochter. Eine geheime Organisation. Ein rätselhaftes Konto. Ein Ex-Staatsanwalt zwischen Auftragsmördern.
Alles war ihm genommen worden. Seine Frau. Seine Tochter. Sein Ruf und die Karriere.
Als Andreas Starck aus dem Gefängnis freikommt, möchte er nur eines: endlich seine Tochter Greta wieder in die Arme schließen, die er jahrelang nicht gesehen hat. Doch das Recht dazu wird ihm verweigert.
Starck hat genug. Nicht nur wurde dem Ex-Staatsanwalt seine Frau genommen, jetzt versucht auch noch jemand, ihn der gemeinsamen Zukunft mit seiner Tochter zu berauben. Entschlossen beginnt er, den eigenen Fall neu zu untersuchen, unterstützt von einem eigenwilligen Kommissar. Doch zu spät merkt er, dass er damit mächtige Gegner verärgert …
Als Starck entdeckt, dass er von einem Auftragsmörder verfolgt wird, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Wer will ihn vernichten? Was haben sein verstorbener Vater und eine Bank in Zürich mit all dem zu tun? Vor allem aber – kann er seine Unschuld beweisen und die Tochter zurückgewinnen?
Vergeltung, Vaterliebe und Korruption im Rechtssystem. Ein Thriller, bei dem sich zeigt, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint!
Der fulminante Auftakt zur neuen Thriller-Reihe »STARCK – Staatsanwalt im Schatten«.
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2024 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2024
Lektorat: Bernadette Lindebacher
Korrektorat: Angelika Wiedmaier
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Umschlaggestaltung: Alin Mattfeldt
Umschlagmotiv: © Pixel-Shot/ Shutterstock
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI books GmbH
Made in Germany
ISBN: 978-3-98679-040-0
Homepage: maximum-verlag.de
Facebook: /MaximumVerlag
Instagram: @maximumverlag
Widmung
Für meine Mutter
Dora Jaschinski
1937–2024
Wahrheit und Dichtung
Während die Schauplätze dieser Geschichte zum überwiegenden Teil real sind, hat der Autor sowohl die Handlung als auch die agierenden Personen frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Geschehnissen, lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die sachliche und örtliche Zuständigkeit im Justizvollzug regeln in Deutschland die Vollstreckungspläne der jeweiligen Bundesländer. Bezüglich der JVA Düsseldorf am Standort Ratingen stimmen im Buch Fiktion und Realität nicht überein.
Wer Zürich kennt, wird sich fragen, ob die beschriebene Privatbank im Utoschloss verortet ist, das sich am gleichnamigen Quai befindet. Die Antwort auf diese Frage ist ein energisches »Jein« – das Gebäude diente als Inspiration, aber sowohl Raumaufteilung als auch das Rosettenfenster über dem Portal wurden so geschildert, dass die Architektur der Geschichte dient.
Die Geschichte der Bardi, Peruzzi und Medici, wie sie im Roman erzählt wird, stimmt in weiten Teilen mit den historischen Überlieferungen überein. Teilweise wurde sie aber etwas abgeändert und für die Hintergrundgeschichte neu interpretiert.
Vor fünf Jahren
Hinter sich hört sie heiser die zwölf Zylinder blubbern.
Giftig. Bullig. Aggressiv.
Sie weiß, dass es ein Zwölfzylinder ist, weil sie große Motoren liebt. Seit sie fünf war, hat ihr Vater sie jeden Sonntag mit in seine Werkstatt genommen, wo er mit großer Hingabe an seinem schnittigen Oldtimer schraubte, einem dunkelroten 1965er Jaguar E-Type. Geduldig hat er ihr jeden Handgriff, jeden Arbeitsschritt, jede Funktion erklärt.
Sie weiß auch, dass der silbergraue Bentley Continental GT in ihrem Rücken sie mit seinem lautstarken Auftritt meint.
Was will er ihr damit sagen?
Ihr drohen? Und falls dem so ist – warum?
Bereits gestern hat sie den Eindruck gewonnen, dass dieser Wagen sie verfolgt. Und will, dass sie das auch weiß. Ansonsten hätte der Verfolger vermutlich ein unauffälligeres Fahrzeug gewählt.
Also ist sie selbstbewusst über die Straße und auf das Auto zugegangen, um den Fahrer anzusprechen. Der einfach wegfuhr.
Das Tessiner Kennzeichen ließ sie für einen Moment an romantische Kurzurlaube am Lago Maggiore im Frühling denken.
Heute hingegen überwiegt die Sorge.
Sie hatte es Andreas sofort erzählen wollen. Besonders in dieser Zeit, nach all den merkwürdigen Vorkommnissen. Aber er hatte einen langen Tag im Gericht gehabt, sodass es schon spät war, als sie sich endlich müde an ihn kuschelte und ihre Beobachtung und Bedenken hätte schildern können.
Nun ist der Wagen wieder da.
Heute Mittag ist sie ein paar Minuten zu spät dran.
Ärgert sich über sich selbst. Der Kindergarten liegt nur eine Straße weiter. Ihre Tochter Greta geht erst seit ein paar Tagen für zwei Stunden am Vormittag dorthin und wartet sicher längst auf die Mama. Das Abschlusslied haben sie bestimmt auch schon gesungen.
Sie ist wütend darüber, dass der Wagen ihr schon wieder auflauert. Den Fahrer kann sie hinter den Spiegelungen auf der Windschutzscheibe nicht erkennen, als sie aussteigt, um ihn zur Rede zu stellen.
Als sie mitten auf der Straße ist, heult die starke Maschine auf und der Wagen rast los. Direkt auf sie zu.
Sie will wegrennen, dreht sich panisch um, erkennt ihren Fehler. Ein Absatz bricht ab. Passanten bleiben stehen. Fassungslose Schreie. Sie hört sie nicht.
Wenn so etwas in Filmen passiert, wundert sie sich immer darüber, dass die Leute auf der Straße anfangen wegzulaufen und nicht einfach in den Schutz der parkenden Autos fliehen.
Im selben Moment trifft sie der wuchtige Kühlergrill.
Sie liegt auf der Straße.
Alles tut weh.
Speere bohren sich in ihr Innerstes.
Greta!
1. Kapitel
Eine schwere Tür. Ein langer Gang. Der Geruch nach Reinigungsmitteln. Nicht wie im Krankenhaus. Trotzdem charakteristisch. Eine weitere Tür. Das Ritual der Formalitäten. Wieder eine Tür. Gute Wünsche.
Endlich schloss sich die letzte Tür hinter ihm.
Dann war er draußen.
Er hatte überlebt. Doch sein Leben war das Einzige, was ihm geblieben war. Alles andere hatten sie ihm genommen.
Andreas Starck stand vor der JVA Düsseldorf und sog tief die feuchte Morgenluft ein.
Er lächelte bitter.
So bekommt die Redewendung ›unter freiem Himmel‹ eine ganz eigene, neue Bedeutung.
Gestern war ein goldener Herbsttag gewesen. Kühl und klar. Seinen letzten Hofgang hatte Starck gemeinsam mit Duncan in der Mittagssonne unternommen, die hell und ungehindert zwischen Zäune und Hafthäuser schien. Aber über Nacht hatte der Wind gedreht und blies nun warm aus Südwesten dunkle Regenwolken über die Stadt.
Gegenüber auf dem Randstreifen wartete ein Taxi. Nicht auf ihn.
Wer immer du bist, du hast es gut. Kommst aus dem Gefängnis und kannst dir gleich ein Taxi leisten. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der heute entlassen wird. Oder bist du ein Besucher, der dekadent das Taxi warten lässt?
Es hatte eine Zeit in Starcks Leben gegeben, da war es für ihn normal gewesen, genug Geld für ein Taxi zu haben. Ob nun beruflich auf Spesen oder privat einfach so. Zum Flughafen, zur Oper oder zum Feiern bei Freunden – Geld war kein Problem gewesen. Doch diese Zeit war schon lange vorbei, und das alte Leben gab es nicht mehr. Ebenso wenig wie die Freunde, die gar keine Freunde gewesen waren.
Als sich der Wind der öffentlichen Meinung drehte und ihm die negativen Schlagzeilen des Boulevards wie Sturmböen ins Gesicht peitschten, war es zu unbequem geworden, neben und zu ihm zu stehen. Einige Beziehungen, die die Flut der Verleumdung noch nicht aus seinem Leben gespült hatte, endeten dann an den Gefängnismauern. Aus beruflicher Erfahrung wusste er, dass ein Besuch im Gefängnis kein Sonntagsspaziergang war, und so …
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Starck ging zur Haltestelle vor der Justizvollzugsanstalt, um den Pendelbus zur S-Bahn-Haltestelle Düsseldorf Rath zu nehmen. Er hatte nur einen leichten Rucksack mit Waschzeug und Wechselkleidung bei sich, die für drei Tage ausreichen sollte.
Bis auf wenige Ausnahmen hatte er alle seine Bücher an Mitgefangene verschenkt. Nur einige waren ihm ans Herz gewachsen. Er hatte sie häufig gelesen und mit Anmerkungen versehen. In einsamen und schweren Stunden waren sie ihm wertvolle Begleiter geworden, sodass er es nicht über sich gebracht hatte, sie fortzugeben. Stattdessen hatte er sie mit seinen anderen Habseligkeiten schon einmal nach Detmold geschickt, wo sie auf ihn warteten.
Fast alle Insassen hatten eine genaue Vorstellung davon, was sie als Erstes machen wollten, sobald sie aus dem Gefängnis kamen. Oder taten zumindest so. Der erste Burger oder das erste Bier. Selbst bestimmen, wie lange sie schlafen wollten. Alltäglichkeiten bekommen in der Haft eine andere Dimension. Wieder selbst Auto fahren. Und natürlich Sex mit jemandem, den man sich selbst aussuchen konnte.
Das alles war Starck egal. Klar freute auch er sich auf ein gutes Essen und ein bequemes Bett. Für ihn waren das jedoch lediglich Oberflächlichkeiten. Er hatte andere Prioritäten und lang schon einen Plan geschmiedet, den es nun umzusetzen galt. Er freute sich auch auf ein bekanntes freundliches Gesicht, wenngleich ihm nur wenige Bezugspersonen geblieben waren.
Egal, bei dem, was in Düsseldorf noch zu tun war, wollte er ohnehin allein sein.
Nur noch wenige Haltestellen. Sein Herz schlug schneller. Natürlich war er aufgeregt. Das hatte er nicht anders erwartet. Jetzt wurde Realität, was er sich über einen langen Zeitraum hinweg nur hatte vorstellen können. Starck atmete tief ein. Und wieder aus. Immer wieder. Es half nichts.
Je näher er dem Friedhof kam, desto schlimmer wurde es. Wie würde es sein, das erste Mal vor Danielas Grab zu stehen?
Der Bus war voll besetzt, und Starck hatte nur noch einen Stehplatz gegenüber der hinteren Tür bekommen. In seiner Nähe saßen zwei Teenager, die auf ihren Handys daddelten. Starck schätzte die beiden Mädchen auf höchstens sechzehn, obwohl sie unter Zuhilfenahme von übertrieben viel Make-up älter wirken wollten.
Ein Mann auf einem Fensterplatz trug eine randlose Brille und knetete hin und wieder seine feingliedrigen Hände über der dünnen Aktenmappe, während er nachdenklich hinausschaute. Schräg gegenüber saß eine ältere Dame, deren bordeauxroter Filzhut mit einer goldfarbenen Hutnadel in ihrem lockigen weißen Haar befestigt war. Als Starck einstieg, hatte sie kurz zu ihm herübergesehen und ihn freundlich angelächelt.
Ein Rollator stand halb im Gang, halb auf der Stehplatzfläche. Starck ordnete ihn der Dame zu. Er hielt sich an der Stange fest, die zwischen Dach und Boden verschraubt war, und schaute aus dem Fenster. Beobachtete, wie die Welt, die Stadt, das Leben dort draußen an ihm vorüberzogen.
Der Bus hielt, die Türen gingen auf, und zwei junge Männer stiegen ein. Kapuzenpullis unter Bomberjacken im Seidenblouson-Stil, tiefhängende Jogginghosen und ungeschnürte weiße Basketballschuhe. Klischee pur.
Augenblicklich spürte Starck, dass es Ärger geben würde. Was nicht an der Kleidung lag und auch nicht daran, wie die beiden sich großspurig nach einem Sitzplatz umsahen.
»Yo, Digga. Was gehd’n hier? Kein Platz für den Boss im fetten Benz?« Blondierter Undercut, dicke Silberkette.
»Schwöre, Bruder. Kein Respekt.« Schwarzer Vollbart, Wollmütze.
Die zwei schauten herausfordernd in die Runde, Arme vor der Brust gekreuzt, Kinn herausfordernd vorgestreckt. Der Bus fuhr an, und es ruckte leicht. Was weder Starck noch die Neuankömmlinge aus dem Gleichgewicht brachte.
Alle Fahrgäste wandten den Blick ab, sahen auf den Boden, aus dem Fenster oder holten geschäftig ihre Handys heraus.
Starck nahm die aggressiven Schwingungen sofort wahr. Genau so hatte es zwischen Mitgefangenen auch oft begonnen und nicht selten für mindestens einen der Beteiligten auf der Krankenstation geendet.
»Ich muss sowieso an der nächsten Station raus«, sagte die alte Dame couragiert und sah die beiden Halbstarken freundlich an. »Dann kann einer von Ihnen meinen Platz haben.«
»Ach wirklich, Oma?« Undercut legte demonstrativ seine Hand so um die Haltewunschtaste, dass diese fast verdeckt war. Wer den Knopf nun für die nächste Haltestelle drücken wollte, musste sich entweder mit dem Kerl auseinandersetzen oder jemanden vorne oder weiter hinten im Bus bitten, für ihn zu drücken.
»Ja.« Die ältere Dame blieb freundlich. »Auch wenn ich nicht Ihre Oma bin – würden Sie trotzdem bitte drücken?«
»Pffff«, schnaubte Wollmütze. »Voll nich, Bruder.«
»Junger Mann«, sagte die ältere Frau, »wenn wir jetzt nicht drücken, hält der Bus nicht an meiner Haltestelle.«
»Und? Wo is das Problem?«
»Entschuldigung!« Starck wandte sich ruhig an Undercut. »Drücken Sie jetzt bitte, oder darf ich das übernehmen?«
»Alter. Mach ma kein Stress.«
»Die Dame möchte aussteigen, und einer von uns drückt jetzt den Halteknopf.«
»Ich nich. Du nich.« Seine Hand verdeckte weiterhin den Halteknopf.
Starck machte blitzschnell einen Schritt nach vorne und drückte fast im selben Moment kraftvoll zu. Sofort informierte die LED-Anzeige darüber, dass der Bus nun an der nächsten Haltestelle halten würde.
Undercut heulte vor Schmerz auf und hielt sich die gequetschte Hand. Starck entdeckte im Augenwinkel ein bekanntes Bewegungsmuster. Wollmütze hatte ein Messer gezogen. Ein Aufschrei ging durch den Bus.
Gleichzeitig nahm Starck wahr, wie die beiden Mädchen interessiert von ihren Handys aufschauten und der Mann am Fenster die Augen aufriss. Hier entwickelte sich eine willkommene Abwechslung zum tristen Alltag in öffentlichen Verkehrsmitteln – auch wenn die Situation gleichzeitig furchteinflößend war. Die Faszination des Bösen.
Starck drehte sich blitzschnell um. Er hatte im Gefängnis vier Messerangriffe überlebt und ein knappes Dutzend beobachtet. Diese Erfahrung hatte seine Sinne geschärft. Wollmütze war ein Amateur. Ein Angeber, der erwartete, dass das Herumgefuchtele mit einer Klinge die Menschen einschüchterte. Starck half das. Ein effektiver Messerangriff kam schnell und direkt. Ohne Vorwarnung durch ein Augenblinzeln oder die verräterische Bewegung der Schulter. Noch in Wollmützes Ausholbewegung hatte Starck sich ihm zugewandt. Als die Klinge dann geradeaus vorzuckte, war es nicht schwer, dem Stich seitlich auszuweichen und das Handgelenk mit seiner Linken zu packen. Mit der Rechten griff er Wollmütze in die obere Schlüsselbeinvertiefung und drückte beherzt zu. Der Möchtegern-Messerstecher stöhnte laut auf, sackte auf die Knie und ließ die Waffe los.
Undercut machte einen Schritt auf die Kämpfenden zu, um seinem Kumpel zu Hilfe zu eilen. Starck rammte ihm mit voller Wucht die rechte Hacke auf den Fuß und spürte, wie etwas innerhalb des weißen Sportschuhs nachgab. Anschließend kickte er das Messer weg.
»Mein Fuß ist gebrochen, du Arsch, mein Fuß ist gebrochen«, jammerte Undercut.
Irgendwo raunte jemand: »Dann merkt er jetzt wenigstens nicht mehr, dass ihm die Hand wehtut.«
Die Lautsprecheranlage knackte, dann war der Busfahrer zu hören: »Was ist da hinten los?« Vermutlich konnte er auf seinem Bildschirm nicht genau erkennen, ob die Auseinandersetzung Auswirkungen auf die Fahrt hatte.
»Hier machen zwei Jungs Stress«, antwortete eine Männerstimme.
Eines der Mädchen bückte sich, griff mutig nach dem Messer und versteckte es hinter dem Rücken. Weiter vorne wurde getuschelt.
Der Bus wurde langsamer, und Wollmütze blickte aus glasigen Augen stumpf in die Gegend. Vermutlich nahm er nicht mehr viel wahr. Starck hievte ihn an seinen ehemaligen Stehplatz. Undercut heulte noch immer und hielt sich mit beiden Händen den malträtierten Fuß. Wortlos presste Starck den rechten Daumen auch in Undercuts Schlüsselbeinvertiefung. Der sackte auf die Seite und lag nun gemeinsam mit seinem Kumpel auf der Stehplatzfläche.
»Das nenn ich mal Zivilcourage«, sagte die Dame mit dem Filzhut und ein paar Plätze weiter wurde applaudiert.
Starck winkte ab. »Jemand sollte Polizei und Notarzt rufen. Wir sind ja sowieso gleich am Krankenhaus.« Das Benrather Krankenhaus markierte die vorletzte Haltestelle, bevor Starck rausmusste. Er hatte jedoch längst entschieden, hier schon auszusteigen, um möglichen Kontakt mit medizinischem Personal oder der Polizei zu vermeiden.
Der Mann am Fenster suchte in der Aktenmappe nach seinem Handy, aber das engagierte Mädchen war schneller.
Richtung Busfahrer rief Starck: »Keine Sorge. Die beiden sind jetzt ungefähr zehn Minuten ruhig.«
Der Bus hielt, neigte sich langsam gen Bordstein und die Türen öffneten sich.
Andreas Starck sah die ältere Dame freundlich an: »Brauchen Sie Hilfe beim Aussteigen?«
Sie drückte sich langsam von ihrem Sitz hoch. »Wenn Sie mir mit dem Rollator helfen könnten?«
2. Kapitel
Der Waran war anpassungsfähig. Wusste immer, welche Frisur, welche Kleidung, welches Fahrzeug, welches Equipment, vor allem aber welches Verhalten ihn unauffällig mit der Umwelt verschmelzen ließ.
Erstes Prinzip: Anonymität.
Außerdem war er geduldig. Wie sein tierischer Namensgeber. Warten ohne aufzufallen gehörte zum Geschäft. Das richtige Timing war entscheidend. Nur so war er zuverlässig, ohne dass sein Verhalten vorhersagbar wurde. Fehler konnte er nicht leiden, sich nicht leisten und sie unterliefen ihm auch nicht. Seine Auftraggeber nannten das Erfolg, für den sie bereit waren, viel Geld zu bezahlen.
Der Waran definierte darüber sein zweites Prinzip: Effektivität.
Ein Friedhofsgärtner räumte vertrocknete Kränze von einem frischen Grab, und fünfzig Meter weiter schnitt ein älteres Ehepaar in vertrauter Zweisamkeit wuchernde Buchsbaumkugeln in Form.
Den traurigen Alten, der zusammengesunken auf einer Parkbank nicht unweit der Kompostsammelstelle saß und manchmal vor sich hin brabbelte, beachteten sie nicht.
»Und?« Die Stimme kam hart und fordernd aus dem Kopfhörer, der mit dem Telefon in seiner Jackentasche verbunden war.
»Er ist seit heute Morgen draußen.« Der Waran hob kurz den Kopf, ließ den Blick unter der Krempe des gammeligen Huts hinüber zu seiner Zielperson schweifen, um dann wieder scheinbar gedankenleer einen Meter vor sich auf den moosigen Kies zu starren. Nach außen blieb er ganz in der Rolle des verwirrten alten Mannes.
»Was macht er?«
»Ist auf dem Friedhof und hockt seit einer Stunde vor dem Grab seiner Frau.«
»Das war zu erwarten.«
»Richtig. Allerdings gab es einen kleinen Zwischenfall auf dem Weg hierher.«
»Bedeutsam?«
»Weiß ich noch nicht. Kleine Rangelei im Bus. Er ist dann ein paar Stationen zu früh ausgestiegen, weil er erst noch den Gentleman geben musste.« Der Waran bemühte sich, seine Stimme nicht allzu verächtlich klingen zu lassen. Wenn die alte Frau mit dem Rollator in den Bus hineingekommen ist, hätte sie auch gut wieder alleine aussteigen können. Wozu brauchte sie also Starcks Hilfe? Ineffektiv!
»Überwachungskameras?«
»Ist hier in öffentlichen Verkehrsmitteln so üblich.«
Der Mann am anderen Ende der Verbindung schwieg einen Moment. Dann fragte er: »Hat er Sie bemerkt?«
»Natürlich nicht.«
»Noch nicht!«
»Wie verabredet. Sie entscheiden, wann.«
»Halten Sie mich auf dem Laufenden.«
Der Waran schaltete das Telefon vollständig aus. SIM-Karte, Handy und Akku würde er später unbrauchbar machen und an verschiedenen Orten entsorgen. Er verwendete niemals eine Karte oder ein Mobiltelefon für zwei Telefonate. Erstes Prinzip.
Sechshundertfünfzig Kilometer südlich der Parkbank nahm Giacomo Moretti langsam und konzentriert das Telefon vom Ohr. Genoss sodann den fantastischen Blick durch die bodentiefen Panoramascheiben auf den sonnenbeschienenen Zürichsee.
Kontrolle war alles!
3. Kapitel
Das Haus war von einer hüfthohen Mauer umgeben, hinter der immergrüne Koniferen, Rhododendren und Lorbeerbüsche den Blick auf das Anwesen verwehrten. Der Zugang war nur über das große Schwingtor oder für Fußgänger auch durch die Tür möglich, die sich daneben befand.
Andreas Starck war vom Friedhof an der Urdenbacher Allee hinunter an das Benrather Schlossufer und dann ein Stück am Rhein entlanggegangen. Aufgrund des Nieselwetters waren außer ihm kaum andere Fußgänger unterwegs. Zwischen Tennisclub und dem Gebäude des Rudervereins hatte ihn eine Joggerin überholt.
Sicherheit wurde in der Nähe zum Benrather Schloss großgeschrieben, was kunstvoll geschmiedete Zäune und Überwachungskameras eindrucksvoll bezeugten. In einigen Vorgärten versuchten prächtige Stammrosen inmitten üppiger Lavendelbüsche von augenfälligen Security-Maßnahmen abzulenken.
Starck schüttelte den Kopf. Vordergründig ging es immer nur um eines: Ausübung von Macht. Wer die Mauer baute, hatte die Macht. Wer über den Schlüssel zur Tür verfügte, konnte entscheiden, wer hindurchgehen durfte. Und so wurden Zäune mit dem stets gleichen Ziel um Grundstücke gezogen. Entweder weil die, die drinnen waren, nicht raus durften, oder weil die, die draußen waren, nicht rein sollten. Wenn man etwas tiefer bohrte, stellte sich die Frage, ob nicht vielmehr Angst dahintersteckte. Entweder, weil die, die sich draußen aufhielten, Angst vor denen hatten, die drinnen waren, oder weil die, die sich drinnen befanden, Angst hatten vor denen, die draußen waren. Das galt aus Starcks Sicht gleichermaßen für Gefängnisse, Villen oder totalitäre Staaten.
Er selbst hatte gedacht, dass seine Gefängnistür eine doppelte Funktion erfüllen, ihn einsperren, aber auch ruhig schlafen lassen sollte. Was sich bereits in der dritten Nacht seiner Haftzeit als böser Irrtum herausgestellt hatte.
Das Leben wäre schöner und einfacher, wenn sich die Menschen weniger hassen und mehr respektieren würden. Starck drückte auf die Klingel, die sich in dem massiven Pfosten neben dem Tor befand, und schaute in die Fisheye-Kamera, die darüber angebracht war.
»Du bist draußen?«, fragte eine Frauenstimme durch die Gegensprechanlage.
Die Tür blieb verschlossen.
»Ja.« Starck lächelte traurig, als ihm die Doppeldeutigkeit der Frage bewusst wurde. »Seit heute Morgen. Lässt du mich rein, Maja?«
»Benedikt ist nicht da.« Seine Schwiegermutter hatte sich schon immer gerne hinter ihrem Mann versteckt, der von Anfang an gegen die Hochzeit ihrer Tochter Daniela mit Starck gewesen war. Sie hatten ihm vom ersten Date an zu verstehen gegeben, dass sie sich etwas Besseres für ihre Tochter gewünscht hatten. Jemanden, der vielleicht sogar noch etwas reicher war als sie selbst. Oder wenigstens adelig.
Deshalb wunderte es Starck nicht, dass er nicht einmal begrüßt wurde. Auch das Misstrauen überraschte ihn nicht. Dennoch tat es weh.
»Hast du Angst vor mir?«
»Ich …«
Starck spürte ihr Zögern und befürchtete bereits, dass sie ihn tatsächlich hier stehen lassen würde. Da schwang mit einem elektronischen Summen die Tür auf.
4. Kapitel
Susanne Starck liebte es, auf dem Wochenmarkt vor dem Detmolder Rathaus frisches Obst, Gemüse und Fleisch zu kaufen. Deshalb ging sie an allen drei Markttagen hin. Dienstags, donnerstags und samstags. So brauchte sie jeweils nur wenig einzukaufen und konnte spontan überlegen, was sie als Nächstes kochen wollte. Nach dem Tod ihres Mannes wohnte sie allein in der alten Villa im oberen Bereich der Bülowstraße, und der lange Spaziergang hinab in die Stadt und zurück, die recht steile Bandelstraße wieder hinauf, hielten sie fit.
Nicht dass sie sich mit neunundsechzig schon alt fühlte. Vielmehr fühlte sie sich allein und manchmal mit allem ein wenig überfordert. Es ist viel passiert, die letzten Jahre. Sie hatte oft geweint, aber sie schaute nun nach vorne. Ihr Sohn würde nach Hause kommen.
Einerseits war es vielleicht merkwürdig, wenn ein über Vierzigjähriger wieder bei seiner Mutter einzog. Andererseits musste Andreas dann nicht in eine üble Ein-Zimmer-Wohnung, die ihm – so vermutete Susanne Starck misstrauisch – von den Behörden zugewiesen werden würde. Wahrscheinlich würde Andreas ohnehin nur vorübergehend wieder in seinem Elternhaus wohnen, aber Susanne Starck freute sich trotzdem, dass sie ein wenig Gesellschaft bekam.
Sie stieg die Treppe zur Haustür hinauf, stellte die Einkäufe ab und steckte den Schlüssel ins Schloss. Es hakte schon wieder. Erst beim dritten Versuch klappte es. Sie musste sich dringend darum kümmern, dass Schmiermittel ins Schloss kam. Nimmt man dafür Silikonöl? Oder Graphit?
In ihre Gedanken vertieft, schenkte sie dem blauen Touran keine Beachtung, der schräg hinter ihr, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, angelassen wurde und langsam davonfuhr.
5. Kapitel
Die gepflasterte Zufahrt schwang sich in einem weiten Bogen vom Eingangstor bis zu dem strahlend weißen Prachtbau, der von der Straße aus nicht zu sehen war. Die Feuchtigkeit hatte den Granit dunkel gefärbt. In den unregelmäßigen Fugen des Natursteinverbundes zeigten sich nicht ein einziger Grashalm oder auch nur ein Anzeichen von Moosbewuchs. Links und rechts säumten Formschnittgehölze und perfekt gestutzte Buchsbäume die gediegene Auffahrt.
Als Starck die gewaltige alte Kastanie erreichte, unter deren Dach sich der Weg gabelte, hielt er sich links. Der rechte Abzweig führte zu den Garagen und der Werkstatt.
Seine Schwiegermutter stand zwischen den Säulen des Portikus, mit dem der neoklassizistische Bau die Besucher mehr beeindrucken als willkommen heißen wollte. Immerhin erwartete sie Starck selbst in der Tür und hatte nicht »das Mädchen« geschickt, wie Maja und Benedikt Behrenburg ihre Hausangestellte nannten.
»Und, wie geht es Greta?«, fragte Maja Behrenburg leise und vorsichtig, fast schon lauernd.
Sie hatte Starck nichts angeboten. Keinen Kaffee, kein Wasser. Nichts. Noch nicht einmal die nasse Jacke hatte sie ihm abgenommen. Er war hier nicht willkommen. Immerhin hatte seine Schwiegermutter ihn eingelassen.
Bei ihrer Frage musste Starck an sich halten: »Im Ernst, Maja? DU fragst MICH, wie es Greta geht?« Was habt ihr dafür getan, dass Greta nicht in eine Pflegefamilie kommt?
»Hör zu … Wenn … also … ja, du hast recht.« Sie knetete ihre Hände auf den übereinandergeschlagenen Knien. »Wie geht es dir? Du siehst gut aus. Das Gefängnis scheint dir nicht geschadet zu haben. Wenngleich ich dich … irgendwie … naja … größer in Erinnerung habe.«
Seinen leichten Rucksack hatte Starck auf den schwarz-weißen Marmorboden gestellt, der wie ein riesiges Schachbrett den gesamten Raum ausfüllte. Er selbst saß Maja auf einem Monstrum aus Leder und Edelstahl gegenüber. Nichts an diesem Sitzmöbel war gemütlich.
»Das liegt wahrscheinlich an der Frisur«, sagte Starck, ignorierte ihren spöttischen Unterton und fuhr sich mit der Hand über den rasierten Schädel. An seiner Körpergröße von einsneunundachtzig würde sich während der Haft vermutlich nichts geändert haben. Bart- und Kopfhaare hatte er sich der Einfachheit halber mit dem Rasierer gleichmäßig auf drei Millimeter getrimmt. Das ging schnell und war praktisch. Nichts mehr mit den braunen Locken, die Daniela so geliebt und in zärtlichen Momenten verwuschelt hatte. »Und ein bisschen abgenommen habe ich wohl auch. Aber es geht nicht um mich, Maja. Ich weiß, dass ich nie gut genug für Daniela war. Aber jetzt …«
»Du hast sie umgebracht!«, zischte Maja. Fünf Jahre alter Schmerz brach sich Bahn. »Du hast nicht gut genug auf sie aufgepasst. Sie ist tot. Hörst du. Sie ist tot! Seit fünf Jahren müssen wir ohne unsere Tochter leben. Eltern sollten ihr Kind nicht beerdigen müssen. Das ist widernatürlich. Es war deine Aufgabe, auf unser Kind aufzupassen nach der Hochzeit.« Mit jedem Wort wurde sie lauter. »Wenn du schon unbedingt Verbrecher jagen musstest, dann hättest du auch besser für unsere Tochter sorgen können. Für ihre Sicherheit. Ihr Leben. Und für unsere Enkeltochter. Nicht einmal dein eigenes Kind konntest du beschützen! Was bist du nur für ein Ehemann und Vater!«
So plötzlich, wie der Sturm an Vorwürfen gekommen war, endete er auch wieder. Maja Behrenburg war völlig außer Atem nach den schnellen, harten Worten. Sie lehnte sich wieder zurück und faltete zitternd die Hände im Schoß.
Starck atmete langsam aus und sagte dann ganz leise in die entstandene Stille: »Das also glaubt ihr? Warum seid ihr dann nicht zu mir gekommen und habt mit mir darüber gesprochen?«
»Wozu? Das ist ja wohl mehr als offensichtlich. Wenn du nicht gewesen wärst, dich in deinem Job als Staatsanwalt nicht mit diesem Abschaum abgegeben hättest … Außerdem … das Gefängnis ist bestimmt ein furchtbarer Ort. Was also hätten wir dort zu suchen gehabt?« Voller Abscheu blickte sie ihn an.
»Ja.« Starck bemühte sich, ruhig zu bleiben. »Es gibt schönere Orte als das Gefängnis. Aber trotz allem sind wir eine Familie.« Er hörte selbst, wie hohl seine Worte klangen. Familie. Das sollte sich warm anfühlen. Nach Geborgenheit. Stattdessen strahlte sein Gegenüber nichts als Verachtung und Hass aus. Das ganze Haus schien ihn zu verspotten. Die Behrenburgs hatten ihm nie das Gefühl gegeben, willkommen zu sein. Oder dass sie sich darüber freuten, dass Daniela jemanden gefunden hatte, der sie liebte. Das hatte ihre Beziehung belastet. Dennoch wären sie niemals auf die Idee gekommen, deshalb die Ehe infrage zu stellen.
Die Abneigung konnte er nicht nur bei seinen Schwiegereltern spüren. Auch Danielas Bruder hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er Starck nicht mochte. Standesdünkel, weil Starck nicht aus einer erfolgreichen Unternehmerfamilie stammte? Sein Vater war »nur« Sparkassenvorstand gewesen. Und Starck selbst »nur« Staatsanwalt und nicht Partner in einer internationalen Sozietät. Daniela hatte seine Vermutung immer bestritten. Allerdings konnte sie auch keinen anderen Grund für diese Ablehnung anführen.
»Du hast sie umgebracht«, wiederholte Maja Behrenburg unnatürlich gefasst. Und ergänzte nach einem kurzen Moment: »Natürlich nicht direkt. Aber es ist deine Schuld.«
Ein »Wieso bist du noch am Leben und sie nicht?« stand unausgesprochen im Raum.
Das Gehirn ist sehr kreativ, wenn es um das Konstruieren von Erklärungen geht. So gesehen, ja, so gesehen hat Maja sogar recht. Dreimal um die Ecke gedacht, bin ich schuld an Danielas Tod.
Starck griff im Aufstehen nach seinem regennassen Rucksack, der auf dem wertvollen Marmorboden einen feuchten Fleck zurückließ. Dann beantwortete er endlich Majas eingangs gestellte Frage.
»Es sind merkwürdige Dinge vorgefallen, als Greta nach Danielas Tod und meiner Verhaftung in ihre Pflegefamilie gekommen ist«, sagte Starck bereits im Stehen. »Ich bin … ich war … Staatsanwalt. Kein Familienrechtler. Dennoch ist bei allem Durcheinander eines klar – das Verfahren ist niemals im Leben sauber abgelaufen. Da stimmt etwas nicht. Und ich werde aufdecken, was.«
Maja Behrenburg fixierte ihn mit einem durchdringenden Blick. »Finde Greta. Und melde dich, wenn du mehr weißt.«
Er hätte nicht hierherkommen dürfen. Ich habe es für Daniela getan. Und für Greta.
Wem machte er hier eigentlich etwas vor?
6. Kapitel
Es gehörte zu seinen Aufgaben, alles über seine Zielpersonen zu wissen. Sich Einzelheiten zu merken, fiel ihm leicht. Eidetisches Gedächtnis nannte man das. Der Waran musste niemals etwas aufschreiben.
Aber das war nicht seine einzige Begabung. Er konnte noch viel mehr. Englisch, Spanisch, Russisch und Mandarin sprach er fließend. Mit zwölf hatte er dreimal in Folge Jugend musiziert am Klavier und zweimal Jugend forscht gewonnen. Schon als Kind liebte er Herausforderungen. Aber es wurde ihm schnell langweilig. Mit fünfundzwanzig hatte er bereits an der RWTH Aachen in theoretischer Teilchenphysik promoviert. Aber auch das bedeutete ihm nichts. Es war ihm immer noch langweilig, und er suchte nach einer richtigen Herausforderung.
Eidetiker, so hatte er schon früh gelesen, hätten in der Regel soziale Störungen. Wenn er daran dachte, womit er sein Geld verdiente, musste er feststellen, dass die Psychologen wohl nicht so ganz unrecht hatten. Das war schon ein bisschen lustig. Allerdings hatte er sich eine bürgerliche Fassade aufgebaut, die nichts dergleichen vermuten ließ.
Einmal, kurz vor seinem dreizehnten Geburtstag, half er seiner Mutter beim Kochen. Er sollte die Möhren vorbereiten. Als er sie mit dem scharfen Gemüsemesser zerteilte, fragte er sich, wie es sich wohl anfühlte, einen Finger abzuschneiden. Er setzte an und schnitt sich langsam den vorderen Teil der rechten Ringfingerkuppe ab. Er blutete alles voll, seine Mutter schrie wie am Spieß, während er sich selbst fasziniert beobachtete. Wie von außen. So, als wäre er ein anderer. Schmerz fühlte er keinen. Was nicht nur am Schock lag. Auch beim Zahnarzt brauchte er keine Betäubung.
Die Ärzte und seine Eltern nannten es »Krankheit«, er selbst bezeichnete es lieber als »berufsadäquate Körperstruktur«. Nach der Diagnose hatte er auf eigene Faust weiter geforscht und entdeckt, dass der Fachbegriff »kongenitale Analgesie« lautete und mit dem mutierten SCN9A-Gen zusammenhing.
Manchmal jedoch war es gefährlich, keinen Schmerz zu spüren.
Bereits bei seinem zweiten Auftrag hatte er es mit einem Machete schwingenden, türkischen Drogenboss in Frankfurt zu tun bekommen. Der Waran sollte ihn für eine italienische Familie aus dem Verkehr ziehen, die von Darmstadt aus die Mainmetropole nebst Umland kontrollieren wollte. Was ihm auch gelang, allerdings zu dem Preis, dass der Typ ihn im Todeskampf mit der Machete erwischte. Fast wäre er verblutet, weil die Wunde nicht schmerzte und er sich erst sehr spät, fast zu spät, den Druckverband anlegte.
Seitdem vermied er in seinen Planungen zu intensiven Körpereinsatz.
Aber wenn es nötig wurde, war er im Vorteil. Die meisten Menschen kämpften falsch. Sie kämpften mit Angst vor Schmerz und begingen deshalb Fehler. Das passierte ihm nie.
Der Waran machte keine Fehler. Denn er hatte seine Prinzipien definiert und hielt sich akribisch daran. Erstens: Anonymität – niemand durfte wissen, wer er war oder wo er seinen Lebensmittelpunkt hatte. Zweitens: Effektivität – er nahm ausschließlich Aufträge an, deren Erfüllung ihn bei kalkulierbarem Risiko reicher und zufriedener werden ließ. Und schließlich sein drittes Prinzip: Effizienz – manchmal war die Vorbereitung aufwendiger oder das Material teurer, aber nur mit perfekter Planung konnte er jeden Auftrag optimal ausführen. So wählte er penibel Mittel, Wege und Maßnahmen aus, bei denen er sicher sein konnte, dass er sein selbst gestecktes oder vom Auftraggeber vorgegebenes Ziel auch tatsächlich erreichte.
Unter keinen Umständen verstieß er gegen diese Regeln.
Zu Beginn seiner Karriere war es ihm innerhalb von wenigen Wochen gelungen, seine alte Identität vollständig aus allen Registern und Verzeichnissen zu löschen, indem er seinen Tod vortäuschte. Die nächste Herausforderung hatte darin bestanden, neue Identitäten zu schaffen, die es ihm erlaubten, Konten zu führen oder Fahrzeuge anzumelden.
Er liebte es, unsichtbar zu sein. Zumindest für die Menschen, für die er unsichtbar sein wollte. Und das waren fast alle.
Bis auf zwei.
Zwei Menschen waren ihm wichtig. Zwei aus fast acht Milliarden. Für diese beiden tat er alles.
Darum galt für alle anderen: Niemand war vor ihm sicher.
Der Waran konnte warten.
Geduldig.
Lange.
Unentdeckt.
Dann schlug er zu.
7. Kapitel
Das Messer glitt durch das zarte Fleisch. Blut lief heraus.
Es war perfekt.
Eigentlich.
Dennoch ekelte er sich.
Starck lehnte sich zurück, atmete langsam aus und beobachtete die anderen Gäste des Restaurants. Geschäftsleute und Pärchen. Er war der Einzige, der allein an einem der Tische saß. Den Platz am Ecktisch hatte er bewusst ausgewählt, um eine Wand im Rücken und den Restaurantbetrieb vor sich zu haben.
Dann wandte er sich wieder dem Steak zu, das vor ihm auf dem Teller lag. Bleu. So hatte er es früher immer gemocht. Mit dunklen Grillstreifen.
Die Assoziationen, die der Anblick jetzt in ihm wachrief, schnürten ihm die Kehle zu. Er hatte viel blutiges Fleisch gesehen im Gefängnis. Und dunkle Striemen, die sich auf der Haut von Mitgefangenen abzeichneten. Dinge, die er sich in seiner Zeit als Staatsanwalt nicht einmal hatte ausmalen können.
In deutschen Gefängnissen passierte so etwas nicht. Das kannte man nur aus düster-brutalen Filmen. Meist amerikanischen. Hatte er zumindest gedacht, solange er sich nicht selbst in Haft befand.
Einerseits hatte Starck in seiner Zeit als Staatsanwalt selbstverständlich die Position vertreten, dass die Freiheitsstrafe abschreckend wirken sollte. Andererseits hatte er sich in der rechtswissenschaftlichen Diskussion stets zum links-liberalen Flügel gezählt, der Resozialisierung als Vollzugsziel in den Mittelpunkt der Überlegungen stellte. Schließlich konnte man getrost bezweifeln, dass etwas Positives dabei herauskam, wenn man Straftäter mit Straftätern im geschlossenen Vollzug zusammensperrte.
Wenngleich er als Wirtschaftsstraftäter und ehemaliger Strafverfolger sicherlich noch in einer der harmloseren Abteilungen der Haftanstalt untergebracht gewesen war, hatte er dort mehr über Verbrechen gelernt als während seines Diensts als Staatsanwalt.
»Alles in Ordnung bei Ihnen?« Ein Kellner unterbrach Starcks Gedankengang.
Er sah auf. »Ja, danke.« Einen Moment später entschied er sich um. »Es tut mir leid, aber wäre es wohl möglich, dass Sie das Steak noch einmal auf den Grill legen? Ich hätte es doch lieber gut durch.«
Der Kellner zog die Augenbrauen hoch und sagte höflich: »Sehr gerne.« Was wohl nicht ganz der Wahrheit entsprach.
Starck nahm einen Schluck Bier und seine Gedanken schweiften zurück in die Vergangenheit.
Niemals im Leben hätte er sich vorstellen können, dass ihn ein solcher Albtraum ereilen würde.
Alles war ihm genommen worden. Seine Frau. Seine Tochter. Sein Ruf und die Karriere. Offiziell. Vor Gericht. Die Presse hatte ihn sogar schon an den Pranger gestellt, noch bevor das verlogene Urteil gesprochen worden war, mit dem auch seine Freiheit für fünf lange Jahre endete.
Es waren die dunkelsten Tage, Wochen und Monate gewesen. Von einem Tag auf den anderen war nichts mehr so gewesen, wie es war. Das Leben mit den Menschen, die ihm alles auf dieser Welt bedeuteten: seine wundervolle und geliebte Daniela und ihre süße Tochter Greta. Sie war erst zwei gewesen, als er sie das letzte Mal gesehen hatte.
Fassungslos hatte er die Urteilsverkündung über sich ergehen lassen müssen. Anschließend die Überstellung aus der Untersuchungshaft in die Haftanstalt, in der er seine Strafe verbüßen sollte. Der erste Tag wie in Trance, weil alles neu war, während er versuchen musste, sich einzugewöhnen. Nachts hatte er nicht schlafen können, weil er sich nach wie vor den Kopf zermarterte, wie alles hatte so kommen können. Die Müdigkeit am zweiten Tag, gepaart mit dem langsam in seine wunde Seele sickernden Gedanken, dass er die Situation zunächst akzeptieren musste, weil alle Rechtsmittel bereits ausgeschöpft waren.
In der dritten Nacht dann die entsetzliche Erkenntnis, dass nicht einmal sein nacktes Leben noch etwas wert war. Als sich die Tür öffnete, hatte er Wärter erwartet. Aber es waren keine Wärter. Es waren Bestien.
Bestien in Menschengestalt.
Sie wollten ihn.
Und sie wollten ihm Schmerz zufügen. Ihn leiden sehen.
Panisch hatte er sich gewehrt. Die Angst hatte ihm ungeahnte Kräfte verliehen. Allein, es hatte nichts genutzt.
Sie waren in der Überzahl. Rücksichtslos. Brutal.
Mitgefangene, gedeckt und unterstützt von Wärtern. Eine perfide Kombination.
Dass er diese Nacht überstanden, nein, überlebt hatte, war ausschließlich Duncan zu verdanken.
Der riesige Duncan, vor dem alle Respekt hatten. Dem niemand zu widersprechen oder sich in den Weg zu stellen wagte.
Bis heute wusste Starck nicht, warum Duncan das getan hatte. Als Antwort auf diese Frage hatte Duncan jedes Mal nur freundlich gelächelt und gesagt: »Hätte ich dich den Nazis überlassen sollen?«
All diese Strukturen hatte Starck anfangs nicht ansatzweise verstanden. Sozusagen das Darknet der Unterwelt, in dem sich kriminelle und offizielle Interessen mischten. Es ging um Macht und Politik. Und wie das eine das andere beeinflusste. Sex, Geld und manchmal brutale Gewalt waren nur Mittel zum Zweck. Instrumente derjenigen, die anderen den eigenen Willen aufzwängen wollten.
Es war ein mehr als beängstigendes Szenario. In seinem Job als Staatsanwalt hatte Starck natürlich geahnt, dass es diese tiefschwarze Welt eines kriminellen Paralleluniversums gab, das als treibende Kraft auf einer verdeckten Ebene hinter Verbrechen und Verbrechern lag, die er verfolgt und angeklagt hatte. Doch mit der Verurteilung war der Vorhang zerrissen, und es graute ihm vor der zerstörerischen Wucht ungesetzlicher Energie, die die Gesellschaft, wie Starck sie kannte, beherrschen und ausbeuten wollte.
Duncan saß lebenslänglich im Gefängnis. Er erinnerte einen zunächst rein äußerlich an Ving Rhames, und wenn man ihn dann näher kannte, auch an eine von Rhames’ Paraderollen: den Computerexperten Luther Stickell aus Mission Impossible.
Was auch eine gute Umschreibung für Starcks eigenes Leben war – Mission Impossible. Eine Mammutaufgabe lag vor ihm.
Wie sollte er herausfinden, wo Greta war? Vor allem aber, wie sollte er sie wiederbekommen? Ohne festen Job? Ohne eigene Wohnung? Und ohne finanzielle Mittel, da sein gesamtes Privatvermögen beschlagnahmt und eingefroren war.
Würde er es schaffen, sich zu rehabilitieren? Aufklären, wer ihm das alles angehängt hatte? Die wahren Täter zur Strecke bringen? Danielas Mörder finden und ihn seiner gerechten Strafe zuführen?
Duncan hatte Starck unterstützt, wo er nur konnte. Aber offensichtlich kam auch Duncan nicht an alle Antworten heran. Duncans Netzwerk war an seine Grenzen gestoßen.
Gemeinsam hatten sie einen Plan entwickelt.
Es war ein merkwürdiger Abend. Ein noch merkwürdigeres Gefühl.
Der erste Abend in Freiheit.
Und er hatte niemanden zum Reden.
Ich vermisse das Gefängnis, dachte Andreas Starck. Nach nicht einmal zehn Stunden. Und ich vermisse es, eingesperrt zu sein. Die vertrauten Gesichter der Jungs und des Wachpersonals. Die gewohnten Abläufe. Die überschaubare Fläche der Zelle und die reduzierte Ausstattung.
Kann das sein?
Ich sollte doch froh sein, draußen zu sein.
Und nun? Streife ich einsam durch Düsseldorf und muss mich jedes Mal erst räuspern, bevor ich etwas zu jemandem sage. Weil ich meiner Stimme nicht traue, nachdem ich sie über Stunden nicht benutzt habe.
Habe ich das jetzt gedacht oder aus Versehen laut gesagt?
Ein Pärchen ging Hand in Hand fünfzig Meter vor Starck. Die beiden beachteten ihn nicht.
Doch! Es ist gut, draußen zu sein. Handlungsfähig. So kann ich endlich alles aufklären.
Es war nicht mehr weit bis zur Jugendherberge, die wie auf einer Warft zwischen Rheinallee und Düsseldorfer Straße lag. Der Fluss war nur einen Steinwurf entfernt, und im Hintergrund hörte Starck das gleichmäßige Rauschen des Verkehrs auf der Rheinkniebrücke.
Vor dem dunkel geklinkerten Bau befand sich direkt eine Bushaltestelle, aber Starck hatte es vorgezogen, zu Fuß zu gehen. Durch die Innenstadt, über die Rheinbrücke und danach ein Stück am Ufer des Rheins entlang, wo er sich kurz auf eine Bank gesetzt und auf das vorbeifließende, düstere Nass gestarrt hatte. Der Wind hatte ihm die Abgase eines tief im Wasser liegenden Frachtschiffs in die Nase getrieben.
Wasser und Feuer. Die zwei Elemente. Bändigte man sie, konnte man Gutes damit tun. Durst löschen. Wärme erzeugen. Im Übermaß hatten sie vernichtende Kraft.
Und dennoch. Wasser und Feuer faszinierten Menschen seit jeher. Hatte man den Blick erst aufs Meer oder Lagerfeuer gerichtet, konnte man sich nur schwerlich wieder davon losreißen.
8. Kapitel
Starck saß nach vorn gebeugt auf dem mit hellbeiger Bettwäsche bezogenen Bett, die Ellenbogen auf die Oberschenkel und das Kinn in die Hände gestützt. Er saß einfach da. Starrte auf die Zimmertür, die er von innen öffnen und durch sie hindurch den Raum verlassen konnte.
Wann immer er wollte. So oft er wollte.
Er schüttelte den Kopf, ließ sich rückwärts mit ausgebreiteten Armen aufs Bett fallen und atmete schwer aus. Leichter fühlte er sich trotzdem nicht.
Einsamkeit tat unfassbar weh.
Nachdem er sich ausgezogen und die Zähne geputzt hatte, lag Starck mit unter dem Kopf verschränkten Armen im Bett und starrte durch die Dunkelheit Richtung Zimmerdecke.
Auf der anderen Seite der Zimmertür hörte Starck Jugendliche, die lachend den Flur entlanggingen. Glas klirrte gegen Glas. Alkohol war hier natürlich verboten, aber das hielt die jungen Leute sicherlich nicht davon ab, sich ein paar Bier zu gönnen.
Welch ein Kontrastprogramm zu der allabendlichen und nervtötenden Geräuschkulisse in seinem Gefängnisblock. Eine nicht enden wollende Kakofonie aus Scheppern, wenn Metall auf Metall traf, wütendem Schreien, verzweifeltem Weinen, unflätigem Fluchen, verbunden mit der lähmenden Stille absoluter Trostlosigkeit.
Seine Gedanken wanderten zu Duncan Carrey, der zu den ganz wenigen Menschen gehörte, zu denen Starck in der Zeit hinter Gittern Vertrauen gefasst hatte.
Er wusste nicht mehr, wie oft er die Ungereimtheiten der Geschehnisse mit Duncan durchgegangen war. Auf unzähligen Hofgängen hatte der erfahrene Duncan ihm immer wieder neue und kluge Fragen gestellt, damit sich Starcks Gedankenkarussell nicht irgendwann überdrehte, heiß lief und sich festfraß.
Starck erinnerte sich an das erste längere Gespräch einen Tag nach dem nächtlichen Übergriff, als wäre es gestern gewesen.
Fünf Jahre war das jetzt bereits her.
»Was ist los, Alter? Du siehst heute besonders scheiße aus.« Der schwarze Hüne mit Glatze und Reibeisenbass gesellt sich zu Starck, obwohl es wie aus Kübeln regnet. Was beide Männer nicht davon abhält, ihre »Freistunde« auch tatsächlich im Freien zu verbringen. »Und versuch ja nicht, mir weiszumachen, das läge am Wetter.«
»Danke«, sagt Starck nur, weil er nicht darüber reden will.
»Immer dasselbe mit euch Frischlingen. Ihr Jungs müsst noch viel lernen. Über das Leben. Über das Leben im Knast. Irgendwann über das Leben nach dem Knast. Na los, Mann. Erzähl dem alten Duncan, was dich bedrückt. Sonst platzt du noch.«
Starck schüttelt den Kopf. Weiß nicht, ob er Vertrauen zu dem Mann haben soll.
Vielleicht war die Rettungsaktion in der Nacht zuvor nur eine List, eine Finte, um an ihn heranzukommen.
Wer kann das schon sagen? Nach den unbegründeten Anschuldigungen, dem abgekarteten Prozess und nun, in der Haft, traut Starck niemandem mehr.
»Du glaubst wohl, dass du Schwäche zeigst, wenn du es mir erzählst. Verstehe ich. Ist aber völliger Quatsch. Und ich verstehe auch, dass man hier drin nicht jedem trauen kann.«
»Ich … das ist es nicht.«
»Doch, doch. Das ist es. Schon okay. Aber überleg mal: Wer hat dir den Arsch gerettet in der Nacht, als sie dich holen wollten?«
»Dafür werde ich dir auch immer dankbar sein … mehr als dankbar …« Fast hätte sich Starck zu einem unvorsichtigen »Ich schulde dir was« hinreißen lassen. Früh genug merkt er, dass es unklug wäre, das laut auszusprechen.
»Seh ich aus, als wollte ich ’nen Dankbarkeitsorden? Gequirlte Scheiße, Mann. Glaubst du vielleicht, damit hätte ich mir neue Freunde gemacht? Never, Alter! Aber den arischen Arschlöchern und ihren Wärterfreunden muss auch mal jemand sagen, dass sie sich die Bäume zum Dranpissen nicht aussuchen können. Im Moment reicht meine Macht noch weit genug. Duncan ist safe!«
Starck braucht einen Moment. »Okay. Hab ich verstanden. Ich muss … noch etwas nachdenken.«
Genervt schüttelt Duncan den Kopf. »Hör zu. Wenn du dich im Spiegel sehen könntest, wäre dir sofort klar, dass mit dir was nicht stimmt. Nicht, dass hier in diesem Puff irgendjemand geistreich aus der Wäsche guckt. Aber Alter, hey! Du siehst halt besonders abgefuckt aus.« Duncan kichert leise, was bei seinem Stimmvolumen mehr wie das gierig-hungrige Knurren eines Raubtiermännchens klingt. »Aber, so what! Du warst doch so ein schlauer Rechtsverdreher. Da solltest du eigentlich wissen, dass laut nachdenken tausend Mal besser ist, als den Kram immer nur zwischen den Schädelplatten hin- und herzuschieben, bis du weich in der Birne wirst.«
»Ja. Vielleicht.«
»Blödmann.« Duncan dreht sich um und trottet in die Richtung zurück, aus der er vorhin gekommen ist. Nach einem längeren Spaziergang ist ihm bei diesem Wetter wohl nicht zumute.
Kurz bevor Duncan die Tür zum Hafthaus erreicht, sagt Starck, gerade laut genug, dass es bis zu Duncan dringt: »Ich bin unschuldig.«
Duncan bleibt stehen. Mit dem Rücken zu Starck. »Was?«
»Ich bin unschuldig.« Etwas lauter.
»Was hast du gesagt?«
»Hast du was an den Ohren? ICH BIN UNSCHULDIG!«
»Ha!«, dröhnt es durch den Regen über den Hof. »Heilige Scheiße!« Duncan dreht sich zu Starck um und wiegt den gewaltigen Schädel hin und her. »… das habe ich ja noch nie gehört. Ein Unschuldiger. Im Gefängnis. Dass ich das noch erleben darf.«
»Schon klar.«
»Ja, Mann. Du als Ex-Staatsanwalt weißt doch sehr genau, wie geil unser Rechtssystem ist. Offensichtlich so geil, dass du und ich und noch so um die achthundert unschuldige Vollpfosten es sich hier mal so richtig gemütlich machen. Vollpension auf Steuerzahlers Kosten. Voll stylo noch dazu. Muss ja auch – so knapp zehn Kilometer nördlich der Kö!«
Starck nickt. Die Königsallee in Düsseldorf ist nun wirklich das Allerletzte, woran er im Moment denken würde. Aber Duncan hat recht, was für seine Fähigkeit spricht, den Überblick zu behalten. So nah liegen Reichtum und Elend beieinander »Okay. Verstanden.«
»Echt jetzt? Das hoffe ich für dich. Damit können wir für den Anfang arbeiten.« Duncan spreizt Zeige- und Mittelfinger zu einem großen »V« ab, richtet die beiden Finger auf seine Augen, dreht dann die Hand und zeigt zu Starck. Wiederholt die Bewegung ein zweites Mal. »Wir sehen uns.«
»Wir sehen uns«, sagt Starck mehr zu sich selbst als zu Duncan.
9. Kapitel
»Guten Morgen, …«, er beugte sich ein wenig vor, um das Namensschild besser lesen zu können, »Frau Schmitz.«
»Morgen. Setzen Sie sich schon einmal. Ich bin gleich so weit.« Ohne hochzuschauen, stocherte die Sachbearbeiterin hinter ihrem hellgrauen Schreibtisch abwechselnd auf der Tastatur herum oder sortierte beschriebene A4-Blätter in abgegriffene Pappmappen ein. Schmutzig gelb. Schmutzig grün. Schmutzig grau.
Starck hatte unruhig geschlafen, war schon vor allen anderen im Speisesaal der Jugendherberge gewesen, um nun mit leichtem Herzklopfen dieses wichtige Gespräch zu führen. Zunächst blieb ihm aber nichts anderes übrig, als sich auf einen der beiden Besucherstühle zu setzen und zu warten. Das ehemals helle Holz der Armlehnen war dunkel, dreckig und abgegriffen und der bunt gemusterte Bezug mit allerlei geometrischen Formen hatte sicherlich auch schon bessere Tage gesehen. So wie Starck und seine Familie. Aber das war lange vorbei und dies war nun der Tag, die Stunde und der Ort, wo sich erstmals wieder alles zum Besseren wenden sollte.