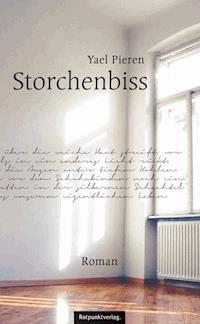
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Da ist ein Paar im Goldenen Eck im Jahr 1970, das eigentlich lieber allein wäre; da ist in der heutigen Zeit in einer Stadt am Rhein eine junge Frau, die eine leere Wohnung bezieht und alles hinter sich gelassen hat; da ist ein Mann, der im Jahr 1964 schon sechzehn verschiedene Füllfederhalter in die Hand genommen hat, um aufzuschreiben, wie alles begann. Alle sind sie Teil einer Geschichte und alle ringen sie darum, die Geschichte zu erzählen. Sie nimmt ihren Anfang 1955, in der armen Schweiz, wo eine ganze Familie sich ein einziges Bett teilt, eine Familie, die bald keine mehr ist, weil die Kinder fortgeschickt, fremdplatziert werden. Ein Haus brennt ab und wird an anderer Stelle wieder aufgebaut. Eine Frau verliert bei einem Treppensturz einen Finger, gewinnt dadurch aber die Liebe eines Mannes. Im Nacken eines Säuglings zeigt sich nach der Geburt ein Storchenbiss, und der Vater erkennt etwas Wahres in diesem rötlichen Fleck. Yael Pieren entwirft in ihrem ersten, höchst beeindruckenden Roman ein sich verdichtendes Gefüge von Figuren, die im Gestern verstrickt sind, aber im Heute leben wollen. In einer berauschenden Sprache erzählt sie vom Zuwenig und vom Zuviel des Lebens, von Liebe und Abhängigkeit, von der Suche nach Worten, der Suche nach Wahrheit. "Noch bin ich ein Kopf voller Ideen und ein Körper voller Widerwillen mit zwei Füßen, die nicht wissen, in welche Richtung sie zu laufen haben. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, wer ich sein könnte, und es gibt nur diese eine Tatsache, nur diese eine Zeitrechnung."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yael Pieren
Storchenbiss
Yael Pieren
Storchenbiss
Roman
Die Autorin dankt herzlich:
Raùl, Daniela und Tristan, die mir geholfen haben,diesem Text einen Kern, eine Form und letztendlichauch einen Namen zu geben.
Julia für die schönen Aufnahmen.
Salome und Jonas für den Mut zu Scheitern.
Liza, Aïcha, Maya, Lukas und Francescafür ihren Humor, ihren Ansporn und ihre Gesellschaft.
Der Verlag dankt dem Migros-Kulturprozentfür die finanzielle Unterstützung.
© 2012 Rotpunktverlag, Zürichwww.rotpunktverlag.ch
E-Book ISBN: 978-3-85869-495-9Mobi ISBN: 978-3-85869-496-6
Für Georg
Eins
Meine Wohnung ist zweiundzwanzig Quadratmeter groß. Am Tag der Schlüsselübergabe, noch bevor ich den Raum einzurichten begann, habe ich sie präzise ausgemessen. Draußen vor der Tür stapelte ich meine wenigen Kisten, klein und handlich und sorgfältig beschriftet in Großbuchstaben. Lange stand ich im leeren Raum, betrachtete die hellen Flecken an der Wand, wo vorher Bilder gehangen hatten, und ging den feinen Rissen in der Decke nach. Ich spürte keine Eile, dieses kahle Zimmer zu füllen. Mir war wohl im Gedanken, dass die vorigen Bewohner ihre Spuren hinterlassen hatten.
Sie ist ein wenig größer, als mir der Vermieter laut Vertrag zugesprochen hat. Deshalb habe ich auch darüber hinweggesehen, dass sich der Hahn im Schüttstein nicht richtig schließen lässt. Ein paar Tage ging es nur, nun höre ich sein Tropfen schon lange nicht mehr.
Vor dem Fenster zur Straße steht ein kleines Tischchen mit zwei Stühlen, an dem ich morgens Kaffee trinke. Das Bett mit der weißen Wäsche, direkt unter der Dachschräge, hat mir die Frau von nebenan überlassen. Besteck, Teller, Tassen, Töpfe, Glühbirnen, Nachttisch, Kleiderständer, Lederschuhe sind alles Geschenke oder Leihgaben. Ich möchte in absehbarer Zeit jeden Gegenstand mit einem eigens von mir ausgesuchten ersetzt haben. Zu diesem Zweck steht ein altes Bierglas auf der Küchenablage, in das ich mein abfallendes Kleingeld lege. Auch das Glas ist ein Geschenk. Bislang liegen nur sehr wenige Münzen drin. Unabgeschlossene Fahrräder finde ich überall und nehme sie für kurze Zeit in meinen Besitz, bevor ich sie wieder am selben Ort abstelle. So ist es, glaube ich, kein Diebstahl.
Ich habe meine Hausschuhe mitgebracht, meinen Lichtbildausweis und ein paar meiner Kleider. Auf den Winter bin ich schlecht vorbereitet. Mein einziger Mantel ist nicht wirklich warm, mehr schön, mit riesigem Kragen, der die Schultern umspielt, keine Kapuze, die Ärmel reichen gerade so bis zum Handgelenk. Ich besitze weder Handschuhe noch einen Schal, noch warme Wollsocken, und ich habe auch nie zu den Mädchen gehört, die sich der Kälte wegen dicke Pullis überstreifen.
Neben der Dusche auf dem Lavabo liegt ein Kamm, mit dem ich mir nach dem Aufstehen die Haare entwirre. Ich wasche sie mit derselben Flüssigseife, die ich auch zum Reinigen meiner Kleider benutze. Die Einfachheit meines Alltags gefällt mir. Manchmal, wenn kein aufmerksames Auge mich verfolgt, trage ich die Pullover, Hemden, Hosen und Kleider so lange, bis ich sie in eine Ecke stellen könnte. Dann fülle ich sie in einen Papiersack, trage sie die Straße runter in den Waschsalon und verbringe den Nachmittag damit, ihnen beim Herumschleudern in der Trommel zuzusehen. Es sind sieben Stück. Zwei schwarze Pullover, ein weißes Hemd, ein Paar Jeans, zwei Sommerkleider, ein blaues und ein rotes, und mein Mantel. Meine Unterwäsche, natürlich. Vielleicht zählt sogar auch noch mein Hut dazu.
Die Schneekugel auf dem Fensterbrett ist auch ein Geschenk, das einzige, das ich nicht ersetzen möchte. Mein Bruder hat sie als kleiner Junge für mich mitgenommen. Genau genommen hat er sie geklaut, in einem Spielwarenhandel. Nachdem ich das herausgefunden hatte, plagte mich jahrelang das schlechte Gewissen und ich wollte sie unbedingt zurückbringen. Ich infizierte meinen Bruder mit dem großen Mitleid der alten Verkäuferin gegenüber. Sie hatte nie Kundschaft. Sie saß stets alleine hinter der Kasse am Eingang und stierte zum Fenster hinaus, zwischen dicken, schmutzigen Spinnweben hindurch. In meinen kindlichen Träumen waren die Viecher ihre einzigen Gesellen, sie sprach mit ihnen und suchte sich aus der Überzahl elend verendeter Insekten ihr Mittagessen aus. Wir sind ein paar Mal vor ihrem Fenster hin- und hergegangen, ohne den Laden je zu betreten. Er hat sich nicht getraut und ich wollte meine Schneekugel nicht hergeben. Die Besitzerin starb dann. Ein kleines Schild an der Tür teilte von ihrem überraschenden Ableben mit, daran kann ich mich noch gut erinnern. Sie starb inmitten ihrer Holzklötze, Karten, Brettspiele, Stofftiere und Puppen, einfach so, in einem einzigen Moment. Lange blieb alles an seinem Platz und der Staub wütete um die unberührt gebliebenen Stücke. Fast ein ganzes Jahr dauerte es, bis der Laden geräumt wurde. Sie fuhren mit einem Lastwagen vor und entsorgten die Spielwaren in großen, schwarzen Säcken. Seither sehe ich dieses Geschenk als meinen rechtmäßigen Besitz an.
Es liegt neben dem einzigen Buch, zu dessen Kauf ich mich durchringen konnte; fast dreihundert Seiten voller falsch gezeichneter Karten, Irrtümer über das Gesicht der Welt, die unsere moderne Technologie nun der Lächerlichkeit preisgibt. Beim Blättern stelle ich mir die Angst vor, über den Rand der Erde zu fallen, oder den Stolz, einen schier übermächtigen Flecken Land zu bewohnen, der auf heutigen Karten verloren unter einem Kontinent klebt.
Es ist eines der wenigen Bücher überhaupt in meiner Wohnung. Als ich herkam, dachte ich mir, sie mitzunehmen, wenn sie auf der Straße ausliegen, und an der Wand entlang zu stapeln, aber irgendwie mag ich doch keines davon behalten, habe ich es einmal gelesen. Ich lege sie dorthin zurück, wo ich sie gefunden habe, oder stecke sie wahllos und ohne Notiz in fremde Briefkästen. Unter meinem Bett bleibt nur, was beim Saubermachen druntergekehrt und dann vergessen wurde.
Manchmal denke ich, in dieser kleinen Wohnung und dem Raum und der Zeit darum lebe ich sehr unserem menschlichen Naturell entsprechend. Unserem gesellschaftlichen auch, heute. Ich nehme Dinge mit, sie werden mir gegeben, ich benütze sie und lege sie wieder ab. Es gibt fast nichts, an dem ich hänge. Natürlich bin ich stolz auf mein rundes Tischchen und seine zwei Stühle, aber es würde mich auch nicht stören, wenn es zu Bruch ginge. Ich liebe es, meinen Mantel zu tragen und den Kragen aufzustellen, mir scheint, als ginge ich sehr viel aufrechter in ihm als sonst, und wie er mir in Zugluft um die Beine streift, lässt mich die Kälte gut ignorieren. Trotzdem glaube ich nicht, dass ich traurig wäre, wenn die Naht risse oder ihn jemand einfach mitnähme. Es ist so: Die Dinge bedeuten mir nicht sehr viel. Sie sind wie Nahrung, die ich zu mir nehme, verdaue und wieder ausscheide. Der Mechanismus der Abnützung ist ein notwendiges Übel, wenn man leben möchte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dieser Tatsache gegenüber je einen Widerwillen empfunden zu haben. Gelebt habe ich immer gerne.
Fragt man mich nach meinen Besitztümern, so hole ich weit aus und sage, ich besäße sehr viel. Vielleicht, weil es eigentlich nur ganz wenig ist und ich alles bis ins kleinste Detail kenne. Es kann aber auch sein, dass ich mich daran gewöhnt habe, mir die Dinge einfach zu nehmen, und ich so in Momenten der Überheblichkeit davon ausgehe, daß mir sowieso fast alles gehören könnte, wenn ich denn nur wollte.
Mein wertvollster Besitz wäre meine Schneekugel. Das ist sie wirklich. Drehe ich sie, stelle ich mir meinen Bruder vor, gestochen scharf in allen Linien und sehr lebendig. Ich bräuchte sie dazu nicht, ich habe ein fabelhaftes Gedächtnis, es bedürfte wahrscheinlich nicht einmal größerer Anstrengung, um ihn mir einfach so in Erinnerung zu rufen; aber es ist ein Ritual, ich möchte es nicht anders. Er soll nur mit dieser Schneekugel für einen kurzen Moment wieder da sein, egal wie oft am Tag ich sie drehe. Er soll nicht herumspuken. Ich möchte nicht mit Geistern leben.
*
In meiner Wohnung ist es fast immer still. Manchmal pfeift der Wasserkessel. Das Haus ist sehr hellhörig und ich bin unfreiwilliger Zeuge vom Leben meiner Nachbarn. Ich weiß, wann sie duschen, wann sie zur Toilette gehen, wann sie Liebe machen und wann sie streiten. Trotzdem dringen all diese Geräusche nicht vor, nicht weit. Ich kann im Bett liegen und mir selbst beim Atmen zuhören. Wie ich schneller atme, mein Herzschlag sich beschleunigt. Wie ich wieder zur Ruhe komme. Es wiederholt sich ein paar Mal. In meinem Kopf rasen die Gedanken, aber ich befreie mich irgendwann davon. Meine Fähigkeit diesbezüglich ist ein Rätsel, die Geburt meiner Fantasie. Sie bäumt sich auf und wehrt sich gegen Erinnerungen, die nicht vergessen werden können. Ich nehme den Bildern ihre Farben und Konturen und sie verschwimmen ineinander und formen sich zu etwas Neuem, zum Bild einer Welt, die mir gehört. Oder es zumindest einmal getan hat. Es ist nun nicht mehr notwendig, in Hirngespinste zu flüchten, wie ich es früher zu tun pflegte. Ich erlaube mir diese Minuten als mutwilliges, kurzes Träumen. Es ist eine Beschäftigung ohne jeden Tiefgang.
Weil sie Stille gewohnt ist, erschrickt meine Wohnung, habe ich einmal Besuch. Sie wehrt sich gegen den Wirrwarr an Stimmen, sie wird klein und stickig und unsauber. Mein Besuch und ich, mehr als zwei Personen vertragen die wenigen Quadratmeter nicht, trinken gemeinsam Kaffee an meinem Tischchen. Man sagt, dass die Aussicht sehr schön sei und das Parkett gefalle. Es wird etwas mitgebracht, Kekse, Tee, Reis und an Abenden eine Flasche Wein. War der Besuch einmal da, kommt er meist wieder. Ihm gefällt der Stuck an der Decke und um die nackte Glühbirne und die Abwesenheit jeglicher Restriktionen, was das Rauchen anbelangt. Die Dusche ist winzig, aber das heiße Wasser versiegt nie. Im Winter kommt manch einer bloß dessentwegen. An gewissen Tagen scheint es mir ein entsetzliches Geläuf, aber die meiste Zeit verbringe ich doch alleine. Ich möchte dann nicht lesen, und es gäbe keine Musik, die man hören könnte. Ich treibe dieses Spiel mit mir selbst und meinem Atem. Ich wundere mich über die Stille. Ich wundere mich darüber, dass sie so laut sein kann, und ich wundere mich über ihr Betteln um Aufmerksamkeit zwischen den Lärmpausen. Es entspricht ihr so gar nicht.
Mein Besuch sieht sich beim ersten Mal oft lange um, bis er merkt, dass es tatsächlich die Musik ist, die dem Raum fehlt, und nicht ein Bild an der Wand und die Vorhänge am Fenster. Er kneift die Augen unter der Sonne zusammen und fragt mich, ob mich diese Ruhe denn nicht in den Wahnsinn treibe. In solchen Momenten fühle ich mich ein klein wenig erhaben. Ich habe eine Leidenschaft, die ich mit niemandem teile. Ich möchte nicht, dass sie einer versteht. Es unterscheidet und trennt mich von ihnen und ich bewahre mir etwas.
Ich könnte die Menschen, die durch diese Tür gehen, nicht als meine Freunde bezeichnen, und doch schätze ich ihre vorübergehende Gesellschaft ungemein. Wir sprechen über vieles oder fast gar nichts. Wir trinken. Rauchen. Ich habe mir das angewöhnt und es füllt viel leeren Gesprächsraum. Es sind Leute da, mit denen das Schweigen schwerfällt, und da helfen die Zigaretten. Alleine rauchen ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe viele Feuerzeuge von überall her. Sie sind die Souvenirs von Reisen, auf denen ich selbst nie war, und so sind sie auch die Ideen für ein Leben, das ich noch führen könnte. Ich könnte Städte besuchen und mich von ihren Monumenten beeindrucken lassen. Ich könnte in der Natur verloren gehen, die ich in ihrer Gefahr gar nicht kenne. Ich dringe in diese Postkarten ein. Ich steige wie durch ein Fenster in eine fremde Welt. Am liebsten in Gedanken bloß.
Die Menschen, die durch diese Tür gehen, nehmen ein Stück von mir mit. Ich bin selten alleine gewesen in meinem Leben, aber wenn, dann war ich gut darin. Mir schien, als nehme man immer zu viel von mir. Als denke und entscheide und fühle und urteile man für mich. Jetzt setze ich langsam zusammen, wer ich bin, und verteidige es auch. Es fällt mir nicht mehr schwer, etwas fortzugeben. Eine Ansicht, einen Denkanstoß oder auch eine Einstellung. Einen Teil meines Lebens und meiner Geschichte. Wie es wirklich war, könnte ich gar nicht erzählen, nicht ihnen. Ich wäre nur diese Wahrheit für sie. Und noch bin ich nicht viel mehr. Noch bin ich ein Kopf voller Ideen und ein Körper voller Widerwillen mit zwei Füßen, die nicht wissen, in welche Richtung sie zu laufen haben. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, wer ich sein könnte, und es gibt nur diese eine Tatsache und nur eine Zeitrechnung, in der ich bis jetzt gelebt habe. Vielleicht weil ich so wenig in Zukunftsgedanken gelebt habe, gibt dieses Gestern das Heute nicht her. Ich sehe es so. Ich möchte es nicht, aber ich bin überwältigt von allem, was jetzt hier ist. Wenn ich mir heute Schuhe kaufe, dann werden sie mir auch in zwanzig Jahren noch passen. Allein dieser Gedanke könnte mich nächtelang wach halten.
Die Stille und der Atem und mein Spiel mit ihnen ist der Versuch, etwas zu finden. Einen Teil von mir, der unberührt geblieben ist. Wie ich mich über die Stille wundere, so auch darüber, tatsächlich hier zu stehen.
Ich sehe meine Füße an. Ich stehe vor dem Fenster, ich könnte hinaussehen und all dem Treiben folgen, das vorbeizieht. Aber ich sehe nur meine Füße an.
Restaurant Zum goldenen Eck, ein festlich gekleidetes Pärchen mit ledernem Schuhwerk an einem der drei runden Tische zu je zwei Plätzen, April 1970:
Ein Abend, an dem sie ihr Kleid über die weiche Haut streift, vor dem Spiegel Haare, Gesicht und Hals in ein anderes Licht rückt, zu leiser Musik Zehen tanzen, sie die Augen unter tiefem Kohlenschwarz versteckt und schließlich vor dem Schuhebinden noch einmal überprüft, ob fünfzehn Zigaretten in der silbernen Schachtel liegen, ist ein Schritt hinaus aus unserem eigentlichen Leben. Wir bevorzugen es, alleine zu sein, nur wir beide, hinter geschlossenen Türen. Dort legen wir ab, was wir sorgfältig einstudiert haben: Lachen, Manieren, Gestik. Wir locken hervor, was sich unter den Blicken anderer tief versteckt hat, und kehren zurück zu uns selbst.
Wir bewegen uns ungeschickt auf dem Klangteppich, den wir beim Gang über die Schwelle des Restaurants betreten haben. Es ist ein anderer, der ihr den Mantel von den Schultern hebt, und die Augen vieler Männer folgen meiner statt ihren Bewegungen. Ihr Blick geht abwesend durch den Raum; sie müht sich nicht, den Ort und seine Menschen in Erinnerung zu behalten.
Das Geklirre des Bestecks, Gläser zum Prost gehoben und wieder abgestellt, das Schneiden des Fleisches, das Entzünden eines Streichholzes, Haut, Haare, Hände, ineinandergreifend und aneinander vorbei, ein Lachen, das echt nicht so schnell verklingen könnte, die winzigen Füße eines Säuglings, umschlossen und bespielt von den Fingern seiner Mutter, dieser Knäuel von Stimmen, von Geschrei, Unmut, Freude, Liebelei. Sie schwenkt ihr Weinglas und sieht der Mücke beim Ertrinken zu. Wir spannen eine Stille um uns und sprechen kein Wort. Wir sind da. Wir erlauben uns, nicht anwesend zu sein, nicht in Gedanken.
Wir nehmen alles auf und hören jedes Wort, unsere zur Schau gestellten Gesichter lassen ein und geben wieder, was sich gehört; ein kurzes Stirnrunzeln, ein Lächeln, eine Andeutung von Zärtlichkeit an den Partner gerichtet. Um diesen Kern in uns, den wir nicht preisgeben wollen, spannt sich eine Taubheit, die wir anderen zu durchdringen verwehren. Sich die Hälfte eines Ganzen wissend, macht uns verletzlich. Nicht immer gelingt die Flucht ins Schauspiel. Je größer die Nähe zueinander ist, desto vehementer verteidigen wir den Kern unserer Person, wächst aber auch die Angst, bloßgestellt und nackt zu sein, entschiede sich der andere zu gehen.
Ich verliere mich nicht in einer einzigen, feinen Bewegung, die sie vollzieht, verfolge nur das ungelenke Nesteln an der silbernen Schachtel, um im richtigen Moment das Feuerzeug zu zücken, sie nicht straucheln zu lassen in Unaufmerksamkeit.
Ich rücke meine Krawatte zurecht, zupfe Haare weg, die sich an unsere Kleider geheftet haben, unangenehm getrieben vom Stoff, der sich fremd an meine Haut reibt. Es sind die Kleider anderer Menschen mit unseren Gesichtern und im Besitz einer Geschichte, die Fleisch um ihre erdachten Knochen wachsen lässt. Erdige, schöne Gestalten, kurz eingefangen mit dem Blick und wieder vergessen. Als solche geben wir uns aus, wir kennen sie, als wären wir sie selbst. Wir bitten sie hinein, bis Stunden später die Tür wieder ins Schloss fällt. Aus Fensterritzen, losen Parkettbögen, Küchenschränken und Rissen in der Decke kehrt dann eine Erleichterung ein. Wir entledigen uns unserer Kleider und unserer Spielfiguren, koppeln die Taubheit und alle zur Schau gestellte Zärtlichkeit ab.
In diesem Restaurant benötige ich nicht mehr als einen einzigen Blick und ich könnte es beschreiben, ganz genau so, wie es mich gerade umgibt. Ich weiß alle Zahlen, Plätze, Gesichter, Ausdrücke, Augenfarben. Ich durchlaufe sie in meinem Kopf, berechne Distanzen, spinne unsichtbare Seile, bis irgendwann jeder Gegenstand mit dem anderen verbunden ist und sich alle verfangen in diesem Netz, nur ich nicht, nur sie nicht, nur wir beide bleiben vollkommen unberührt. Gefangen und frei in einem Vakuum, in einem toten Raum, der nichts beherbergt außer uns.
Sie verfolgt die Stimmen. Ihr geübtes Ohr dringt in Gespräche und Schweigen ein und generiert ein Bild. Wir sehen uns manchmal an, wir wissen, es wird von uns verlangt, und schon sinke ich unter den Augen der anderen Männer zusammen, deren Blick nach langer Verlorenheit an ihr mich zwangsläufig für meine Nichtachtung straft. Wie ich es wage, sagt er ganz ohne Worte, meine Freundin keines Blicks zu würdigen, nicht ihre Halskette zu bestaunen, die aus dreihundertsiebenundsechzig winzigen Goldringen gefertigt wurde, und nicht ihr Kleid anzusehen, nicht das Verrutschen der Träger beim Anheben der Gabel, nicht ihr Gesicht, das ich in jeder kleinen Einzelheit zeichnen könnte, exakt so, wie sie vor mir sitzt, wie eine Fotografie, ein Spiegel, der diejenigen einfängt, die sich zu einer Betrachtung ihrer eigenen Gestalt haben hinreißen lassen.
Wie würde es wohl sein, sie wieder zum ersten Mal sehen zu dürfen. Sich der Illusion hinzugeben, ich erkunde ihren Körper, wieder und wieder, und wäre ganz Auge, das sich in seiner Faszination nicht abwenden kann. Sie dürfte das Einzige sein, an das ich mich jeden Tag aufs Neue erinnern muss. Ich fragte sie nach ihrem Namen, wanderte den endlosen Venensträngen entlang, drehte die Haare zwischen meinen Fingern und versuchte sie zu zählen und verlöre mich dabei.
*
Akzeptiert, es ist nicht möglich, den Menschen zu entgehen. Wenn wir um ihre Anwesenheit bitten, versuchen wir uns in ihr gesellschaftliches Treiben einzuschleichen, uns ihr Verhalten anzueignen. Wir bleiben scheu in unserer Begutachtung, unserer Studie und dürften nicht so erleichtert sein, den Türknopf unserer Wohnung im Handballen zu spüren. Wir sitzen an diesem Tisch und trinken wie die anderen und sehen einander an oder sprechen kein Wort, aber es hört nie auf, Schauspiel zu sein.
Den wenigen Menschen, die uns kennen, scheint unser Leben in der Stadt grotesk. Erzählen wir ihnen, dass wir beide weit draußen gelebt haben, so verstehen sie nicht, dass wir von dort weggegangen sind. Ich versuche, es ihnen zu erklären, ich sage, es sei das Flüstern der Leute dort gewesen, die alles einnehmende Stille, der man nicht entfliehen kann. Nirgends sonst kann man auf eine solche Art verschwinden wie unter einem Pulk, kann man so leise sein, als wenn um einen alles palavert, streitet, liebt, raucht, frisst, schnauft. Wenn in der Stadt die Tür ins Schloss fällt, kehrt eine Ruhe ein, die man uns dort nicht zugestehen würde. Entflieht man dem Getümmel, fragt es nach nichts.
Wir besuchen dieses Restaurant zu jedem Monatsende hin. In der Annahme, wir erwarteten durch unser regelmäßiges Kommen eine besonders zuvorkommende Behandlung, werden wir stets an denselben Tisch gesetzt. Man bringt Blumen und eine neue Kerze, begrüßt uns mit Namen und erkundigt sich nach unserem Befinden.
Serviert man uns das Essen, zuckt kurz das Auge, lupft sich die Wimper. Das Vorenthalten meiner Freude zu schälen, zu schneiden, zu kochen, zu braten, zu pochieren, anzurichten und dann verschwinden zu lassen, setzt mein Schauspiel für einen Moment außer Kraft. Sie reckt ihre Finger über den Tisch und legt sie auf meinen Handrücken, und ihre erlernte Gewöhnung an die Bewirtung imponiert mir.
Nach einem gemeinsamen Essen zu Hause legen wir die schmutzigen Töpfe ein, polieren die Gläser, packen ab, was nicht gegessen wurde, trocknen mit dem Küchenlappen alles nach. Wir gehen auf den Markt und sehen jeden Apfel an, bis uns einer gefällt, und drehen jede Weinflasche und zeichnen durch jedes Staubkorn mit unserem Zeigefinger. In einem vollständigen Akt können wir uns ganz und gar verlieren, in aller Freude und Hingabe, wie wir auch glauben, einander in einer Gänze verstanden zu haben, die niemand nachempfinden kann. Daraus leiten wir ab, über den anderen zu stehen, unter ihnen, wo genau ist nicht wichtig. Wir sind losgelöst von ihren Idealen und Zwängen, tief in uns finden sie keinen Raum, keine Luft zum Existieren. Uns ist ein Platz, der niemandem sonst gehört.





























