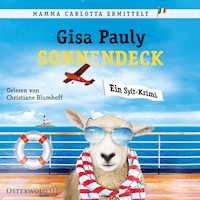10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Insel-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Die Sängerin von Sylt.
Aletta wird auf Sylt groß, doch ihren großen Traum, Sängerin zu werden, wollen ihre Eltern ihr nicht erlauben. Kaum ist sie volljährig, verlässt sie die Insel und wird eine gefeierte Künstlerin. Im Jahr 1914 wird sie vom Kurdirektor eingeladen. Das Konzert, das Aletta gibt, wird ein rauschender Erfolg – und eine große Enttäuschung, denn weder ihre Eltern noch ihre ältere Schwester Insa sitzen im Publikum. Erst am nächsten Tag erfährt sie, dass ihr Vater tot und ihre Mutter Witta sterbenskrank ist. Auf dem Sterbebett will ihre Mutter Aletta ein Geheimnis verraten, das diese schon seit langem umtreibt, doch Insa schreitet ein, bevor es zu diesem Geständnis kommt. Wenig später bricht der Krieg aus, und plötzlich ist Aletta auf Sylt gestrandet. Sie versucht alles, um hinter das Geheimnis ihrer Mutter zu kommen ...
Sylt zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Eine dramatische Familiensaga um ein tödliches Geheimnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Sammlungen
Ähnliche
Gisa Pauly
STURM ÜBER SYLT
Die Insel-Saga
- Leseprobe -
Impressum
ISBN 978-3-8412-0568-1
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, März 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2013 bei Rütten & Loening, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin
unter Verwendung der Motive von: © akg-images/L.Gurlitt, Bridgeman/The Maas Gallery, London, © Elise Beaudry/iStockphoto
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Inhaltsübersicht
I.
II.
I.
1914
Es war so wie vor zehn Jahren. Der Himmel war genauso blass und durchscheinend, zarte Wolkenschleier verhüllten die Sonne, die nur ein heller Fleck war, von dem keine Wärme ausging. Ein kühler Sommertag! Der Wind hatte auch damals beinahe still gestanden, so wie heute. Er war da, bewegte sich über dem Schiff hin und her, nahm seine Kraft aber nicht aus den Wolken, sondern aus der Fahrt des Raddampfers. Die Geschwindigkeit des Fortbewegens war es, die die Windstärke bestimmte! Aus dem Sturm, der noch vor zwei Wochen gewütet hatte, war dieser kraftlose Fahrtwind geworden. Auf der Insel würde es womöglich windstill sein. Eine Seltenheit! Damals war es ihr vorgekommen, als wollte der Wind sie nicht von ihrer Heimat wegtreiben, jetzt kam es ihr so vor, als wollte er sie nicht willkommen heißen. Oder sollte sie die Angst vor der Rückkehr verlieren, zu der es eigentlich nie hatte kommen sollen?
Sie spürte, dass Ludwig hinter sie trat. Aber sie veränderte ihre Haltung nicht, blieb, an die Reling gelehnt, stehen und drehte sich nicht um. Sie zeigte ihm nur, dass ihr seine Nähe guttat, indem sie leise seufzte.
Aletta Lornsen war eine mittelgroße Frau, schlank, aber nicht zierlich, sondern von kräftiger Statur. Sie hatte braune Haare, in die die Sonne manchmal blonde Tupfer setzte und die bei Dunkelheit, und wenn sie straff zurückgekämmt waren, fast schwarz wirkten. Ihr Gesicht war schmal, ohne zart zu sein, die Nase winzig, ihre Wangen waren flach wie die einer Rekonvaleszentin, die gerade wieder zu Kräften kommt. Doch ihr Mund war breit und lachend, ihre Lippen waren voll und verlockend, die Stirn prägte sich über starken Brauen aus, so dass sie stark und gesund aussah, wenn es ihr gutging, aber auch elend und sterbenskrank wirken konnte, wenn es schwere Tage gab. Ihre Augen waren von einem stumpfen Grau, trugen aber braune und grüne Splitter, die sie interessant und ihren Blick sogar ein wenig rätselhaft machten.
Ludwig sagte oft: »Bei dir hat die Natur nicht gewusst, was sie wollte. An einem Tag solltest du ein zartes, elfengleiches Wesen werden, am anderen eine Frau, die ihren Mann stehen kann. Und am Ende bist du beides geworden.«
Er legte ihr die warme Stola um und umschlang sie mit beiden Armen, um sie zu wärmen. »Freust du dich auf Sylt?«
Aletta wollte nicken und den Kopf schütteln, gleichgültig die Schultern zucken und die Mundwinkel verächtlich herabziehen, alles auf einmal. Aber ihr gelang weder das eine noch das andere. Vorfreude und Angst, Schuldgefühle und Selbstzufriedenheit hielten sich die Waage. Ludwigs Frage war nicht zu beantworten.
»Hoffentlich ist das Hotel komfortabel«, sagte sie stattdessen.
Sie spürte, dass Ludwig lächelte. »›Das Miramar‹ ist das erste Haus am Platz.«
»Die Sturmflut von 1909 soll es schwer ramponiert haben.«
»Das ist fünf Jahre her. Und nicht das Hotel wurde beschädigt, sondern die Düne vor dem Hotel. Sie wurde von dem Sturm weggefegt. Da sieht man, wie leichtsinnig es ist, so nah am Meer zu bauen.«
Aletta merkte, wie gut es ihr tat, über etwas so Sachliches wie den Bau des »Miramar« zu reden. Sie atmete tief ein, richtete ihren Oberkörper auf, baute ihre Stütze auf, als müsste sie sich schon jetzt auf ihr Konzert vorbereiten. In den Jahreszahlen fühlte sie sich sicher, in den Debatten über den Dünenschutz auch, und über vergangene Sturmfluten redete sie gern, wenn sie über Sylt sprechen wollte und Sehnsucht nach ihrer Insel hatte. Nur über die Menschen, auf die sie in den nächsten Tagen treffen würde, redete sie nicht. Ludwig blieb immer wieder ohne Antwort, wenn er sie fragte, was ihr diese Rückkehr nach Sylt bedeutete. Mittlerweile hatte er sich damit abgefunden, dass er mit Aletta, wenn sie Heimweh hatte, über die Sturmfluten von 1909 reden musste, über den Brand der Kaiserhalle im September 1911 und die im Oktober folgende Sturmflut, die die gesamten Strandanlagen ins Meer gerissen hatte.
»Der Besitzer des ›Miramar‹ hat eine Strandmauer bauen lassen«, sagte er, drängte sich dicht an Aletta heran und legte sein Kinn auf ihre Schulter. »Jetzt kann nichts mehr passieren. Keine noch so schwere Sturmflut kann der Strandmauer etwas anhaben.«
Seine Stimme klang zuversichtlich, aber Aletta wusste, dass er sich zum Optimismus zwang. Gegen die Naturgewalten mochte Sylt sich gewappnet haben, aber was war mit der Gewalt von kriegerischen Auseinandersetzungen? Ludwig hatte sie seit der Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Frau Sophia mehr als einmal bedrängt: »Fahr nach Sylt! Versöhn dich mit deiner Familie! Wenn du es wirklich willst, dann zögere nicht mehr! Jetzt ist der richtige Zeitpunkt! Wer weiß, was kommt!«
Und so war dem Kurdirektor die Nachricht zugegangen, dass man die letzte seiner unzähligen Einladungen nun endlich annehmen wolle. Allerdings unverzüglich! Westerland musste die Vorbereitungen auf das große Ereignis, das Konzert von Aletta Lornsen, in größter Eile treffen.
1904 war sie noch mit dem Plattbodensegler übers Watt gefahren. An Veras Seite! Gemeinsam hatten sie sich auf den Boden gekauert, Aletta mit dem Rücken zur Insel, mit dem Blick zum Festland, ihre Vergangenheit im Rücken, ihre Zukunft vor Augen. Und Vera hatte immer wieder gesagt: »Du musst sie zwingen. Irgendwann werden sie sich zwingen lassen.«
Wenn Aletta die Tränen gekommen waren, hatte sie in die Segel gesehen, auf das große »S« geblickt, das jedes Segel trug, das »S«, das für »Sylt« stand. Aber wenn sie der Tränen Herr geworden war, hatte sie wieder vorausgeschaut. Und Vera hatte erneut gesagt: »Es ist richtig, dass du sie zwingst. Es geht nicht anders.«
Die Plattbodensegler waren mittlerweile von den Raddampfern abgelöst worden. Von Hamburg nach Hörnum fuhr seit 1905 sogar das große Turbinenschiff »Kaiser«, das für sage und schreibe zweitausend Decksgäste zugelassen war. Aber so viel Neues hatte Aletta nicht gewollt, so viel sollte sich nicht geändert haben seit ihrer Flucht von Sylt. Der Raddampfer war Fortschritt genug. Er näherte sich der Insel langsam und schwerfällig, wie es für sie richtig war, die beiden Schaufelräder links und rechts des Schiffskörpers mühten sich geräuschvoll ab. Es war ein urwüchsiges Vorankommen, nicht so zielstrebig wie auf der »Kaiser«, langsamer, schwerfälliger, aber doch unbeirrt. Das flache, breite Schiff, das durch die Schaufelräder noch breiter erschien, als es war, hatte Aletta sofort Vertrauen eingeflößt. Auch dass der Kapitän sich nicht in einem Steuerhaus verbarg, um seine Arbeit von den Passagieren abgeschirmt zu verrichten, gefiel ihr. Dieses Schiff wurde von der Brücke aus geführt, die nicht nur so genannt wurde, sondern wirklich eine war. Sie reichte von Steuerbord nach Backbord, von einem Radkasten zum anderen und führte über die Köpfe der Passagiere hinweg. Dort stand der Kapitän, Wind und Wetter noch schutzloser ausgesetzt als die Passagiere. Wenn das Wetter jedoch so gut war, ruhig und trocken wie an diesem Tag, dachte jeder nur daran, wie einfach die Fahrt geworden war, seit die Plattbodensegler aus dem Dienst genommen worden waren.
Die Reise nach Sylt war auch in anderer Hinsicht bequemer geworden. Es gab nun durchgängige Bäderzüge von Altona nach Hoyer, der Kutschenbetrieb war völlig eingestellt worden. Schon nach gut vier Stunden war man von Hamburg in Hoyer-Schleuse angekommen, wo die Raddampfer ablegten. Allerdings fuhren sie tideabhängig, nur einmal, höchstens zweimal täglich und nur bei Tageslicht. Doch Ludwig hatte die Reise gut geplant und dafür gesorgt, dass sie in Hoyer nur eine knappe Stunde zu warten brauchten, bis sie den Raddampfer besteigen konnten. Eineinhalb Stunden dauerte die Überfahrt nach Munkmarsch, zu wenig Zeit, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen, die sich mit dem Entschluss, diese Reise zu wagen, erneut vor Aletta erhoben hatte. So, als hätte ihre Vergangenheit nur in einer Ecke ihres Lebens heimlich auf diesen Tag gewartet, obwohl Aletta geglaubt hatte, dass sie ihre Kindheit und Jugend längst vor die Tür ihres neuen Lebens gesetzt hatte.
Ihr Körper versteifte sich, als die Mole von Munkmarsch in Sicht kam. Sie wickelte den fliederfarbenen Seidenschal fester um den Hals, den sie von Ludwig zur Premiere von Fidelio geschenkt bekommen hatte und der seitdem ihre Stimme wärmte, wie sie es nannte. Ludwig begann, ihre Arme zu streicheln und sanft ihren Nacken zu kneten, aber ihre Haltung veränderte sich nicht, während sie den Menschen, die sich auf der Mole drängten, entgegensah. Sie blieb angespannt.
»Sie werden nicht kommen«, flüsterte Ludwig. »Vielleicht zum Bahnhof, aber sicherlich nicht nach Munkmarsch.«
Ob er recht hatte? Aletta hoffte sogar, dass sie auch am Ende der Inselbahnfahrt nicht auf sie warteten. Wirklich auf Sylt angekommen sein würde sie erst, wenn das Konzert vorbei war. Wenn sie ihren Triumph gefeiert hatte! Wenn alle einsehen mussten, dass sie damals richtig gehandelt, dass sie gar nicht anders gekonnt hatte! Wenn sie es mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört hatten. Alle! Jetzt fühlte sie sich noch klein und schwach, dann erst würde sie ihrer Familie unverwundbar entgegentreten können. Die Eltern würde sie zwingen, stolz auf sie zu sein, und Insa würde sie zwingen, zu lächeln und etwas Anerkennendes zu sagen.
Wieder sprach Aletta sich unhörbar vor, was Vera ihr schon vor zehn Jahren eingeprägt hatte: »Du musst sie zwingen! Und glaub mir, sie werden sich zwingen lassen.«
Ach, Vera! Sie hätte sich nicht ausmalen können, was danach geschah ... Im Shanty-Chor waren keine Mädchen und Frauen zugelassen. Wer seinen Gesang einem Publikum zu Gehör bringen wollte, für den gab es nur die Möglichkeit, dem Kirchenchor beizutreten, den Pfarrer Frerich leitete, der zwar von Musik wenig verstand, dafür umso mehr von den Problemen, Nöten, Vorlieben und Ansichten der ihm anvertrauten Schäfchen. Was er billigte, unterstützte er; was ihm missfiel, versuchte er zu unterbinden. Damit, so meinte er, wurde er seiner seelsorgerischen Aufgabe mehr als gerecht. Er erkannte zwar Alettas Talent, war aber derselben Ansicht wie ihre Eltern: »Der Deern dürfen keine Flausen in den Kopf gesetzt werden.«
Ein Sylter Mädchen durfte singen, wenn es fröhlich war, wenn es Gott gefällig sein wollte oder die Arbeit mit dem Gesang besonders flott von der Hand ging. Aber singen um des Singens willen? Singen, um ein Talent zu beweisen? Singen womöglich, um damit Geld zu verdienen und auf Ruhm und Ehre zu hoffen? Das fand Pfarrer Frerich genauso indiskutabel wie Alettas Eltern.
Aber immerhin war er bereit, sie gelegentlich ein Solo singen zu lassen. »Der liebe Gott wird sich was dabei gedacht haben, als er dir diese schöne Stimme gab.«
Und als sie am Petritag in der Kirche das Ave-Maria singen durfte, war Vera Etzold unter den Zuhörern. Bis zu diesem Tag hatte niemand gewusst, dass sie die erste Sopranistin am Stadttheater von Göttingen gewesen war. So lange, bis sie sich mit einem wohlhabenden Fabrikanten verlobte, der selbstverständlich verlangte, dass sie ihre Karriere zugunsten der Familie aufgab. Die Ehe währte allerdings nicht lange, denn Veras Mann wurde schon zwei Jahre nach der Hochzeit das Opfer eines Raubüberfalls. Doch da in ihren Kreisen eine Witwe genauso wenig wie eine verheiratete Frau einem Broterwerb nachging, war es Vera nicht gelungen, auf die Bühne zurückzukehren. Dass sie unter ihrer unerfüllbaren Sehnsucht litt, wusste niemand. Erst recht keiner von denen, die sie wegen ihres Reichtums und ihres bequemen Lebens beneideten.
Direkt nach dem Ave-Maria war sie zu Aletta gekommen und hatte sie in ihr Hotel eingeladen. »Du musst aus deiner Stimme etwas machen. Wenn du willst, arbeite ich mit dir.«
Und ob Aletta wollte! Aber instinktiv begriff sie, dass sie mit keiner Unterstützung rechnen konnte, dass man ihr diese Flausen so schnell wie möglich austreiben würde. Und obwohl sie erst zehn Jahre alt war, hatte sie bereits die Weitsicht, zu erkennen, dass ihr Wunsch, wenn er erst einmal abgelehnt worden war, nicht mehr heimlich zu verfolgen sein würde. Also erzählte sie den Eltern nichts von dem wahren Grund dieser Einladung. »Ich weiß nicht, warum ich zu ihr kommen soll, aber einer so vornehmen Dame kann ich den Wunsch unmöglich abschlagen.«
Dieser Ansicht waren ihre Eltern ebenfalls. Und als die Mutter vermutete, dass Vera Etzold ein Dienstmädchen brauchte, das ihr gelegentlich zur Hand ging, reichte sie ihrer Tochter damit ahnungslos eine Lüge, nach der Aletta gierig griff. Lange sollte das Lügen von da an zu ihrem Leben gehören. Und all das andere, für das sie sich heute schämte! Für den Gesang war sie zu einem schlechten Menschen geworden, das hatte Pfarrer Frerich ihr später unmissverständlich klargemacht. Aber er hätte sich seine Worte sparen können. Aletta wusste selbst, was sie getan hatte. Jahrelang! Immer wieder! Und gebeichtet hatte sie es nur ein einziges Mal. Das war, als Vera gesagt hatte: »Nun wird es Zeit, sie zu zwingen. Du bist so weit!«
In die Menschenmasse kam Bewegung, als der Dampfer sich der Mole näherte. Etwa hundert Meter war die Mole lang, und Aletta mochte sich nicht vorstellen, wie viele Menschen es waren, die dort warteten. Dichtgedrängt standen sie, um dem Raddampfer entgegenzusehen. Aletta war es, als bewegte sie sich auf eine Gefahr zu, die sich nicht zu erkennen geben wollte.
»Ich hatte dem Kurdirektor gesagt, dass er über deine Ankunft schweigen soll«, murmelte Ludwig.
Aletta antwortete nicht, starrte schweigend auf die Menschen, die ihnen entgegenblickten, allesamt dunkel gekleidet, die Männer mit Hüten, die Frauen mit Tüchern, die ihre Köpfe bedeckten. Allmählich wurde aus der Menschenmasse eine Masse von vielen Menschen, einzelne waren zu erkennen, einige traten aus der Menge heraus, indem sie winkten, Hüte schwenkten, auf und ab sprangen.
»Es hilft nichts«, sagte Ludwig und löste sich von Aletta. »Du musst lächeln.«
Er trat einen Schritt zurück und blickte nun über ihren Kopf der Ankunft entgegen. Auf ihr Schweigen reagierte er nicht, er wusste um ihre Gefühle und brauchte keine Erklärungen.
Noch bevor das Schiff anlegte, wichen die ersten Reihen der Wartenden zurück, nur zwei Personen blieben stehen – der Kurdirektor und seine Gattin, die es sich nicht nehmen lassen wollten, Aletta Lornsen als Erste auf Sylt willkommen zu heißen. Heimgekehrt nach zehn Jahren! Alettas Wunsch, den Fuß ohne viel Aufhebens auf heimatliche Erde setzen zu dürfen, war von Kurdirektor Wülfke anscheinend nicht ernst genommen worden. Vermutlich hatte er mit seiner Frau darüber gesprochen, dass der Anstand es gebührte, die berühmte Sängerin angemessen zu empfangen, diese wiederum hatte mit ihrer Nachbarin darüber beraten, wie man sich zu diesem Zwecke aufzuputzen habe ... und im Nu hatte ganz Westerland Bescheid gewusst.
Aletta wickelte die Stola eng um ihren Körper, während sie darauf wartete, dass das Schiff vertäut wurde. Sie fror. Tief in ihrem Innern wurde sie von einer Kälte gequält, die ihre Anspannung erstarren ließ, obwohl die Erwartung ihr die Hitze auf die Wangen trieb. Die Jubelrufe, die ihr entgegenklangen, erwiderte sie mit einem Lächeln, in dem sie Übung hatte, ihre Haltung drückte Hochmut aus, auch darin hatte sie Übung. Nur keine Vertraulichkeiten, kein Anbiedern an die Bewunderer ihrer Kunst! Das hatte sie längst gelernt.
Ein tieferes Lächeln galt lediglich dem Ehepaar Wülfke, außerdem einer früheren Nachbarstochter, deren Bild sie aus der Menge ansprang, und der Besitzerin des Stuben-Ladens, in dem Alettas Mutter fast täglich eingekauft hatte. Rosi Nickels war klein und unscheinbar, aber sie schrie so laut Alettas Namen, dass sie zu den wenigen gehörte, die ein freundliches Winken erntete.
»Nicht suchen«, flüsterte Ludwig ihr zu. »Wenn sie da sind, müssen sie auf dich zukommen. Nicht umgekehrt!«
Wie gut er Aletta kannte! Er wusste, dass sie versucht war, den Blick über die Menge schweifen zu lassen, nach dem steifen Hut ihres Vaters Ausschau zu halten, nach dem schwarzen Kopftuch ihrer Mutter, nach Insas dicken blonden Zöpfen, die sich niemand so kunstvoll auf den Kopf stecken konnte wie sie. Aletta hielt den Blick auf den Kurdirektor gerichtet, auch nach Pfarrer Frerich hielt sie nicht Ausschau und nicht einmal nach Jorit Lauritzen. Wenn sie auch schuldbeladen diese Insel verlassen hatte, nun kehrte sie hocherhobenen Hauptes zurück. Was sie getan hatte, ließ sich wiedergutmachen. Was die Eltern und ihre Schwester ihr dagegen vorwerfen würden, brauchte sie nicht wiedergutzumachen. Es würde an ihnen sein, sie um Verzeihung zu bitten.
Dass weder der Kurdirektor noch seine Gattin ihre Familie erwähnte, fiel Aletta erst auf, als sie bereits, flaniert von den beiden, die Inselbahn bestieg, die sie nach Westerland bringen sollte. Aber sie machte es so, wie Ludwig es ihr geraten hatte. Sie fragte nicht nach ihren Eltern und ihrer Schwester, erkundigte sich nicht nach ihrem Wohlergehen und gab mit keiner Silbe, keinem Blick zu verstehen, dass sie nichts von ihren nächsten Angehörigen wusste, dass sie keine Ahnung hatte, wie es ihnen in den letzten zehn Jahren ergangen war, dass sie nicht einmal wusste, ob die drei noch gesund waren. Ob sie dem Kurdirektor weismachen konnte, dass sie deswegen nicht fragte, weil sie über alles Bescheid wusste? Oder war ihm und allen Syltern längst bekannt, dass es in den vergangenen zehn Jahren keinerlei Kontakt zwischen Aletta und ihrer Familie gegeben hatte? Womöglich hatte ihre Mutter bei jeder Gelegenheit darüber geklagt, ihr Vater zornig gebrummt, wenn er nach seiner Jüngsten gefragt worden war, und Insa hatte vermutlich so unnachgiebig geschwiegen, dass alle bald Bescheid wussten. Aber das musste Aletta egal sein. Sie hatte alles genau mit Ludwig abgesprochen. Bisher waren sämtliche Entscheidungen, die er für sie getroffen hatte, richtig gewesen. So würde es auch in diesem Fall sein. Aletta war froh, seine Schritte zu hören, seine Nähe zu spüren, sein Rasierwasser zu riechen und gelegentlich im linken Augenwinkel das Auffliegen seines weiten Mantels zu erkennen. Ludwig war bei ihr! Und sie wusste, er würde niemals von ihrer Seite weichen.
Auch sein Rat, sich bei ihrer Ankunft auf Sylt bescheiden zu kleiden, war richtig gewesen. In Wien, wo sie beide seit Jahren lebten, trug sie gern ausgefallene Mode, die sie am liebsten in Paris bestellte, wo besonders elegante Kleidung entworfen wurde. In ihren Koffern führte sie leichte Straßenkleider mit, in Lila und Blau, eines sogar mit einem extravaganten Muster aus Tupfen und Runen. Ein großer Koffer war allein dazu da, ihre Hüte aufzunehmen, zwei Strohhüte, mehrere Filzhüte und sogar einen weißer Zylinder, der in Wien zurzeit der allerletzte Schrei war. Auf Sylt würde man sich vermutlich auch über ihren Spazierstock wundern, der zum Glück in den größten ihrer Koffer gepasst hatte. In Wien war in diesen Tagen eine Ausgehtoilette erst mit einem auffälligen Spazierstock perfekt. Natürlich musste sein Knauf aus Gold oder Emaille gefertigt und mit Edelsteinen verziert sein. Ludwig hatte für ihren Spazierstock sogar antike Smaragde aufgetrieben. In Wien hatte sie damit Aufsehen erregt ...
Aletta hatte alles eingepackt, womit sie ihre Eltern und ihre Schwester beeindrucken wollte. Jetzt allerdings, als sie den dunkel und schlicht gekleideten Syltern gegenüberstand, schämte sie sich ihres Wunsches, Aufsehen und Bewunderung zu erregen. Gut, dass sie auf Ludwig gehört und sich für ein schlichtes Reisekostüm aus einem zwar teuren, aber strapazierfähigen und damit vernünftigen Wollstoff entschieden hatte. Dunkelbraun war es und erinnerte mit keinem Accessoire an die Tango-Mode, die zurzeit in den Metropolen der letzte Schick war. Der taillenkurze Bolero, den sie über das schlichte Kleid gezogen hatte, wirkte anmutig und solide zugleich, dem Hut hatte sie auf Ludwigs Anraten vor ihrer Abreise die Federn abgenommen, ihre Stola war zwar aus einem feinen Wollstoff, aber zum Glück schlicht gearbeitet und kam ohne überflüssiges Beiwerk wie Nerzumrandung, Seidenbesatz oder kunstvolle Stickereien aus. Die Kälte in ihrem Innern löste sich allmählich, die Hitze auf ihren Wangen verging. Es war, als hätte sie soeben die Bühne betreten und damit ihr Lampenfieber überwunden.
»Willkommen!«, rief ein Mann in ihrer Nähe.
»Bravo!«, stimmte ein anderer ein, als hätte sie bereits ihre letzte Koloratur gesungen.
Die meisten der Umstehenden hielten sich jedoch zurück und starrten Aletta nur neugierig an. Lediglich Getuschel und Gekicher waren zu hören, Frauen wiesen sich gegenseitig auf Alettas Erscheinung hin, auf Einzelheiten ihrer Garderobe und auf die drei Kofferträger, die mit ihrem Gepäck beladen waren. Männer starrten ihr nach und fixierten Ludwig mit wissenden Blicken.
Erst als Aletta im Zug saß, kam Leben in die Menge. Nun drangen freundliche Rufe durchs Abteilfenster, es wurde gewinkt und gelacht. Einige drängten sich in die anderen Waggons, um mit ihr gemeinsam die Fahrt nach Westerland anzutreten, die meisten jedoch blieben an der Mole zurück.
Zu Alettas Erleichterung übernahm Ludwig die Konversation mit dem Kurdirektor, und seine Frau ließ schnell erkennen, dass sie froh war, schweigen zu dürfen. Sie fühlte sich der Gegenüberstellung mit einer gefeierten Sängerin nicht gewachsen und gab es nach ein paar Allgemeinplätzen schnell auf, ein gemeinsames Gesprächsthema zu finden. Nachdem sie Platz genommen hatten, war aus Frau Wülfkes Mund einiges herausgesprudelt, was sie sich offenkundig vorher zurechtgelegt hatte, aber als von Aletta nur ein schwaches Echo zurückkam, fühlte sie sich nicht bewogen, das Gespräch in Gang zu halten. Dass die berühmte Sängerin aus dem Fenster sah und sich auf diese Weise von der Frau des Kurdirektors abwandte, machte es beiden leicht. Die Fahrt dauerte nur eine knappe Viertelstunde, es war also nicht viel Zeit zu überbrücken.
Als die Inselbahn sich in Bewegung setzte, war der Abstand zu den Syltern, die zu Alettas Empfang an die Mole gekommen waren, groß genug, um sich mit einem freundlichen Winken dafür zu bedanken. Und der Abstand war ebenfalls groß genug, um nun doch heimlich nach bekannten Gesichtern Ausschau zu halten. Unterhalb ihrer breiten Hutkrempe erschienen flüchtig ehemalige Nachbarn, Schulkameraden und Geschäftsleute, zu denen sie früher von der Mutter geschickt worden war, um Besorgungen zu erledigen. Die Gesichter ihrer Angehörigen aber waren nicht dabei. Auch Pfarrer Frerich, Jorit Lauritzen und seine Schwestern konnte sie nicht ausmachen.
Zufrieden lehnte Aletta sich zurück, zog den Seidenschal vom Hals und schloss kurz die Augen, um zu zeigen, dass sie damit einverstanden war, von der Frau des Kurdirektors nicht unterhalten zu werden, weil die lange Reise sie erschöpft hatte. Sie hörte Ludwig mit Herrn Wülfke über das Attentat von Sarajewo reden und über die Idee, Sylt durch einen Eisenbahndamm mit dem Festland zu verbinden.
»Es geht jetzt los mit den Vorbereitungen für den Bau des Damms«, erzählte Wülfke stolz. »Die amtlichen Planungen sind abgeschlossen. Der preußische Landtag hat die Mittel dazu genehmigt. Zehn Millionen für elf Kilometer!«
»Möglicherweise ein wenig voreilig«, sagte Ludwig, »gerade jetzt mit den Bauvorbereitungen zu beginnen. Wenn es Krieg gibt ...«
Aber Wülfke ließ Ludwig nicht aussprechen. »Schon seit Jahren rüstet Europa auf, ohne dass etwas geschieht. Bisher wurde immer ein diplomatischer Kompromiss gefunden. Warum nicht auch diesmal?«
»Irgendwann ist die Diplomatie am Ende«, antwortete Ludwig. »Die Krupp AG in Essen hat längst schwere Artillerie produziert, auch Schiffsgeschütze für moderne Flotten. Ganz Europa ist auf einen Krieg eingerichtet.«
»Die Tat dieses verbohrten serbischen Nationalisten soll der Grund für einen Krieg sein?« Kurdirektor Wülfke sah seinen Gesprächspartner spöttisch lächelnd an.
Aber Ludwig blieb ernst. »Nicht der Grund, aber der Auslöser.«
»Umso wichtiger wird dieser Damm sein. Der Seeweg nach Sylt ist umständlich, vor allem die unzuverlässige Verbindung zwischen Hoyer-Schleuse und Munkmarsch. Ein Damm ist im Falle eines Krieges von strategischer Bedeutung. Bei einer Mobilmachung müssen Soldaten samt Kriegsmaterial so schnell wie möglich nach Sylt gebracht werden.«
Ludwig nickte. »Zur Verteidigung der Nordwestflanke.«
»Wenn sich das bis zum Winter hinzieht, wird es schwierig«, bestätigte Wülfke. »Die Fährverbindungen sind im Winter noch unzuverlässiger. Und die Arbeiten am Dammbau werden nicht so schnell fertiggestellt werden können.«
»Es wird nicht bis zum Winter dauern«, murmelte Ludwig.
Aber obwohl er leise gesprochen hatte, wurde er von Wülfke mit einem warnenden Blick in Richtung der beiden Damen getadelt, und er beendete das Gespräch sofort. Ludwig sah ein, dass der Kurdirektor recht hatte. Der Krieg war kein Thema für Frauen und erst recht kein Thema für diese Stunde der Heimkehr nach Sylt.
Der Zug fauchte durch die Munkmarscher Heide. Einige Bauersleute, die auf den Feldern arbeiteten, unterbrachen ihre Tätigkeit und winkten der Inselbahn und ihren Insassen zu. In einem der Männer, die ihren Holzrechen durch die Luft schwenkten, erkannte Aletta einen früheren Klassenkameraden, und sie winkte lachend zurück. Erk hatte sicherlich längst den Hof seines Vaters übernommen, die große Scheune, die dazu gehörte, hatte in den letzten zehn Jahren vermutlich noch manchem Liebespaar Zuflucht geboten. Dort hatte sie Jorit gestanden, dass sie ihre Flucht plante, dort hatte er versucht, sie davon abzuhalten. Bis zu diesem Tag war er ihr Verbündeter gewesen, hatte als Einziger gewusst, dass sie nicht als Dienstmädchen zu Vera Etzold ging, sondern von ihr Gesangsunterricht erhielt. Er hatte sein Versprechen gehalten und niemandem etwas verraten, aber als er hörte, dass der Gesang ihn von Aletta trennen sollte, war Schluss gewesen mit seiner Loyalität. Nein, so weit sollte sie es nicht treiben, und wenn, dann wollte er dabei sein.
»Ich komme mit«, hatte er mit entschlossener Stimme gesagt.
Aber da hatte Aletta längst eingesehen, dass Jorit nicht mehr zu ihrem Leben gehören konnte, nicht zu dem Leben, das Vera ihr ausgemalt hatte. In diesen letzten Tagen auf Sylt hatte sie das Maß ihrer Lügen vollgemacht und auch Jorit betrogen, damit er nicht im letzten Augenblick ihre Pläne zerstörte, aus Enttäuschung darüber, dass er selbst nicht einbezogen worden war.
Tausendmal hatte Aletta sich später vorgestellt, was in ihm vorgegangen sein mochte, als er feststellte, dass sie ohne ihn die Insel verlassen hatte. Wochen später hatte sie ihm einen Brief geschrieben, aber Vera hatte verhindert, dass sie ihn abschickte. »Lass die Vergangenheit hinter dir! Wir haben ein großes Ziel! Nur daran darfst du denken. Also schau nicht zurück.«
Aber Aletta hatte zurückgeschaut. Immer wieder, Abend für Abend vor dem Einschlafen, Morgen für Morgen nach dem Aufwachen und erst recht nach Veras plötzlichem Tod. So lange, bis sie Ludwig begegnet war. Er hatte vieles vergessen lassen, was bis dahin auf ihr gelastet hatte. Sie betrachtete ihn lächelnd, ohne dass er es bemerkte. Ludwig Burger! Sie hatte sich sofort in ihn verliebt ...
Er war ein Mann von 35 Jahren, nur sechs Jahre jünger als der Kurdirektor, aber um viele Jahre jugendlicher aussehend. Im Gegensatz zu Wülfke hatte er noch volles Haar, war schlank und muskulös, während der Kurdirektor es angemessen fand, seine herausragende Stellung durch Stattlichkeit zu betonen. Über seinem gewölbten Bauch spannte sich die Weste, die Jacke seines dunklen Anzugs hatte er nicht geschlossen, entweder weil er um die Knöpfe fürchtete oder weil er den Schmuck der schweren Uhrkette zeigen wollte.
Ludwig trug einen dunklen Wollanzug, die Jacke geschlossen, von der Weste war nur der obere Knopf zu sehen. Sein weißes Hemd mit dem hohen Kragen war trotz der langen Reise makellos, die dunkle Krawatte zeigte keine Falte. Der kleine Schnurrbart passte zu seiner eleganten Erscheinung. In Wien trug er ihn an den Seiten länger und zwirbelte ihn hoch, wie es zurzeit Mode war, aber für die Reise nach Sylt hatte er ihn gestutzt. Ein weiteres Zeichen seiner Weitsicht und Anpassungsfähigkeit. Ludwig Burger hatte nichts dagegen, aufzufallen, aber er vermied es unter allen Umständen, wenn durch das Exponierte seiner Stellung ein anderer herabgewürdigt wurde. Sein kantiges Gesicht wurde von braunen Augen dominiert, die von dichten Brauen beschattet und von Wimpern bekränzt wurden, um die Aletta ihn heimlich beneidete. Seine Nase war kurz und breit, sein Mund sehr ausdrucksvoll mit der schmalen Oberlippe, die beinahe unter seinem Schnäuzer verschwand, und einer vollen Unterlippe. Das Grübchen im Kinn nahm seinem markanten Gesicht das Strenge, gab ihm etwas Spitzbübisches, was durchaus zu seinem Wesen passte.
Kurdirektor Wülfke versuchte, mit dem zu punkten, was er zu bieten hatte, seiner Stellung, seinem Einfluss, seinem Vermögen, ohne zu ahnen, dass Ludwig Burger all dies ebenfalls besaß. Aber er ließ es sich nicht anmerken und sah den Kurdirektor jedes Mal anerkennend an, wenn dieser durchblicken ließ, dass er ein Mann war, der etwas erreicht hatte, ein Mann, auf den seine Frau stolz sein konnte, kein Mann, der hinter einer Frau zurücktrat, weil sie berühmt war.
Dass Frau Wülfke stolz auf ihren Mann war, ließ sich nicht übersehen. Sie nickte zu allem, was er sagte, und zog pikiert die Mundwinkel herab, wenn er Ludwig über mehrere Sätze zu Wort kommen ließ. Kurz vor Westerland aber fing sie den Bick ihres Mannes auf, der ihr bedeutete, dass sie sich um Aletta zu kümmern habe, die aus dem Fenster blickte und auf den Kurdirektor womöglich einen gelangweilten Eindruck machte.
Frau Wülfke riss sich zusammen und begann aufzuzählen, was sich vor den Abteilfenstern zeigte, die Namen der Bauern, an deren Feldern sie vorbeifuhren, die Namen der Hausbesitzer, die an der Bahnstrecke wohnten, sie wies auf Häuser hin, die erst kürzlich entstanden waren, auf Hotels, von denen viele in den letzten zehn Jahren eröffnet hatten, und erzählte Aletta etwas von dem Fremdenverkehr, der Jahr für Jahr zunahm. Als wollte sie auch etwas zu den politischen Ereignissen sagen, berichtete sie davon, dass auf allen öffentlichen Gebäuden der Insel die Fahnen auf Halbmast gesetzt worden seien. »Noch an dem Tag, an dem der Mord in Sarajewo geschah. Als die Botschaft in Westerland eintraf, spielte gerade das Kurorchester. Aber selbstverständlich wurde das fröhliche Unterhaltungsprogramm sofort unterbrochen. Der Dirigent ließ den Trauermarsch und die österreichische Hymne spielen.«
Als der Ostbahnhof in Sicht kam, erlaubte sie sich die Frage, die ihr vermutlich schon lange auf den Nägeln brannte, die sie aber nicht zu stellen gewagt hatte, weil ihr Mann nicht damit einverstanden gewesen wäre. Nun aber war er derart in das Gespräch mit Ludwig Burger vertieft, in dem es um die Unabhängigkeit Albaniens ging, dass sie es wagte: »Ist es im ›Miramar‹ erlaubt, dass ein unverheiratetes Paar ein gemeinsames Zimmer bezieht?«
Aletta wusste nicht, ob sie sich über diese Frage amüsieren oder ärgern sollte. Schließlich stellte sie fest, dass es weder das eine noch das andere Gefühl in ihr gab. Während sie nur hochmütig die Schultern zuckte und Frau Wülfke mit dieser nonverbalen Antwort abspeiste, dachte sie darüber nach, ob diese Frage etwa auch ihre Eltern bewegte. Erneut wurde ihr bewusst, was sich in den vergangenen zehn Jahren verändert hatte. Sie hatte vergessen, dass ihr Leben nicht nur glanzvoller, ereignisreicher, bemerkenswerter geworden war, sondern auch schamloser, anrüchiger. Jedenfalls für eine Sylter Familie, der es immer darauf angekommen war, ein anständiges, gottesfürchtiges Leben zu führen. Als sie sich entschlossen hatte, endlich die Einladung des Kurdirektors anzunehmen, ein Konzert auf ihrer Heimatinsel zu geben, hatte sie nicht daran gedacht, was ihre Eltern dazu sagen würden, dass sie in Wien mit einem Mann zusammenlebte, mit dem sie nicht verheiratet war. Natürlich würden sie nicht damit einverstanden sein, würden sich womöglich ihrer Tochter schämen, sie verurteilen und sich in sämtlichen Befürchtungen bestätigt sehen.
Aletta spürte, wie die Angst sich schmerzhaft durch ihren Leib zog. Sie kam nach Sylt, um sich die Liebe ihrer Eltern und ihrer Schwester zurückzuholen. Sie war so sicher gewesen, dass die drei nun einsehen mussten, dass sie ihr Unrecht getan hatten. Sie mussten einfach! Oder war es möglich, dass die Bedeutung ihrer Rückkehr an der Frage verkam, ob eine anständige Frau ein eheähnliches Verhältnis ohne den Segen der Kirche, des Staates und ihrer Familie einging?
Die Angst verstärkte sich, nagte an der Sicherheit des Triumphes und verschlang ihn schließlich. Ihrer Angst standen mit einem Mal keine Bedeutung, kein Sieg, kein Recht mehr gegenüber.
Aletta hatte darauf bestanden, das Zimmer zu beziehen, das Vera Etzold früher Sommer für Sommer bewohnt hatte. Es lag in der ersten Etage, direkt der breiten Treppe gegenüber, die vom Erdgeschoss heraufführte. Hoteldirektor Busse, einer der Söhne des Hotelgründers Otto Busse, hatte Aletta und Ludwig vor dem Hotel empfangen, hinter ihm hatte sich ein Teil des Personals aufgestellt, kerzengerade, die Hände auf dem Rücken. Die Schürzen flatterten auf, denn der Wind hatte aufgefrischt, die weißen Hauben der Mädchen gerieten in Gefahr, als eine Windbö vom Meer herüberwehte. Aber keines von ihnen löste sich aus der strammen Haltung, um das äußere Erscheinungsbild zu sichern. Viel mochte sich auf Sylt verändert haben, das »Miramar« war das Gleiche geblieben. Vor zehn Jahren hatte Aletta vor Staunen kaum einen Schritt in das Hotel setzen mögen, aber auch jetzt, nach einem Abstand von unzähligen Luxushotels, war es immer noch ein besonders schönes und komfortables Haus.
Sie stand am Fenster, kehrte dem Meer den Rücken zu und betrachtete das Zimmer, in dem sich ihr Schicksal entschieden hatte. Tatsächlich war es beinahe unverändert geblieben. Die dunklen Möbel waren noch dieselben, die brokatenen Vorhänge und rotgemusterten Teppiche ebenfalls. Nur ein paar Accessoires waren dazugekommen. Die gepolsterten Sitzflächen der Stühle waren erneuert worden, die drei Silberleuchter auf einem der Beistelltische hatte es früher nicht gegeben, und der Samowar, den Vera gern benutzte, war verschwunden. Aletta schloss die Augen, meinte das leise Brodeln des kochenden Wassers zu hören, das Zischen, wenn Vera den Tee in die Tassen laufen ließ, ihr leises Wehklagen, weil sie sich jedes Mal die Finger verbrannte und oft schon zu klagen begann, bevor es geschah, und am Ende sogar dann, wenn der Tee in der Tasse war, ohne dass das kochende Wasser ihr auf die Finger getropft war. Ihr Jammern gehörte zur Benutzung des Samowars dazu, so wie der Tee, den sie aus Keitum kommen ließ, weil ihr kein anderer schmeckte.
Als Aletta zum ersten Mal in diesem Zimmer gestanden hatte, war sie überwältigt gewesen von der Eleganz und der Selbstverständlichkeit, mit der Vera mit diesem Luxus umging. Sie hatte Aletta Tee angeboten, als wäre sie ein gleichrangiger Gast, aber noch bevor der erste Schluck getrunken war, hatte sie Aletta gebeten, das Ave-Maria noch einmal zu singen. Und dann noch mal und ein weiteres Mal ... danach hatte sie sich eine Meinung gebildet.
Aletta drehte sich dem Meer zu, als sie hörte, dass Ludwig aus dem Bad kam. Sie erwartete, dass er an ihre Seite trat, aber er ging zur Tür und sagte: »Der Hoteldirektor stellt mir sein Telefon zur Verfügung. Ich muss ein paar Gespräche führen.«
»Weil es Krieg geben könnte?«, fragte Aletta, ohne sich umzusehen.
Aber Ludwig antwortete nicht. Er antwortete nie, wenn sie ihm solche Fragen stellte. Und Aletta war froh darüber, dass er nichts sagte, was ihr Angst machte. Hätte sie eine Antwort befürchten müssen, hätte sie nicht gefragt. Krieg! Dieses Wort passte nicht in ihr Leben. Hier auf Sylt noch weniger als in Wien. Dieser Mord in Sarajewo war schrecklich, aber warum sollte daraus ein Krieg entstehen? Aletta schaffte es auch diesmal, diese Frage abzuschütteln wie ein lästiges Insekt.
Ludwig hatte das Abendessen aufs Zimmer bestellt. Auf keinen Fall wollte Aletta sich in den Speisesaal des »Miramar« begeben, wo sie begafft oder womöglich sogar angesprochen wurde. Als der Kellner die Garnelen auf Zitronenrisotto servierte, wurde es bereits dunkel. Ludwig selbst übernahm es, die Kerzen anzuzünden, und bat den Kellner, noch weitere zu holen, weil sie auf elektrisches Licht verzichten wollten.
Sie hatten den Tisch ans Fenster rücken lassen, aßen schweigend, beide mit Blick aufs Meer. Ludwig schien erneut über die politische Lage nachzudenken, Aletta betrachtete das Meer, bis es so schwarz war wie der Himmel. Der Wind war wieder eingeschlafen, es gab nur eine leichte Brandung, die kaum zu hören war. Gelegentlich zeigten sich ein paar Gischtkronen auf der dunklen Wasserfläche. Die Lampen, die die Plattform beleuchteten, auf der tagsüber die Feriengäste flanierten, färbten den Abend direkt vor den Fenstern grau, dahinter gab es nur tiefe Schwärze. In Wien, wo auch die Nacht voller Lichter war, hatte sie vergessen, dass es diese machtvolle Dunkelheit gab, die sie doch eigentlich von klein auf gut kannte. Auch das Haus an der Stephanstraße hatte sich vor dieser Finsternis geduckt, wenn es Nacht wurde.
»Ich würde gerne einen Spaziergang machen«, sagte sie.
Ludwig sah erstaunt auf. »Bist du sicher? Du wolltest dich vor dem Konzert nicht draußen blicken lassen.«
»Es ist dunkel.«
Über sein Gesicht ging ein Lächeln. »Du willst zum Haus deiner Eltern?«
Aletta lächelte ebenfalls. Wie gut er sie kannte! Immer wieder verblüffte er sie damit, dass er ihre Gedanken aussprach.
Die Luft war milde, nur gelegentlich wurde sie von einer Bö aufgefrischt. Ihr Weg führte zunächst auf den Höhepunkt der Düne, wo das Meer zu hören und trotz der Finsternis auch zu sehen war, wo es mit langen dunklen Fingern auf den Strand griff und seine Spuren auf dem hellen Sand hinterließ. Während Aletta einer Brise das Gesicht hinhielt, das Salz zu schmecken glaubte und meinte, das Meer laufe auf sie zu, fragte sie sich, wie sie so lange ohne das ausgekommen war, was Sylt ausmachte. Aber nach einer Antwort wollte sie nicht suchen.
Sie gingen aneinandergeschmiegt die Friedrichstraße entlang. Aletta betrachtete jedes der großen Häuser ausgiebig und kommentierte, was sich in den vergangenen zehn Jahren verändert hatte. »Als ich ging, war die Friedrichstraße noch nicht gepflastert«, erklärte sie Ludwig. »Aber Kanalisation und Wasserleitungen gibt es schon seit 1901. Und Elektrizität sogar seit 1893.«
Sie hatte auf einen Hut verzichtet und sich ein Tuch über den Kopf gelegt, um sich nicht schon in ihrem Umriss von einer Sylterin zu unterscheiden, die niemals einen Hut trug. Beide waren sie dunkel gekleidet, schlicht und unauffällig. Wer ihnen begegnete, würde nicht auf sie aufmerksam werden.
»Bist du enttäuscht?«, fragte Ludwig.
Aletta musste schlucken, ehe sie antworten konnte: »Die Stephanstraße liegt dem Ostbahnhof sehr nahe. Sie müssen den Zug gehört haben.«
»Hast du dir heimlich gewünscht, dass sie am Bahnhof auf dich warten?«
Aletta zögerte noch einmal, dann schüttelte sie den Kopf. »Es ist gut so. Erst das Konzert! Das wird sie überzeugen! Dann müssen sie verstehen, warum ich ihnen das angetan habe. Dann müssen sie begreifen, dass ich nicht anders konnte und dass es ihr Fehler war, mich davon abhalten zu wollen.«
»Du hast recht«, bestätigte Ludwig.
Er hatte es vor der Reise wohl hundertmal bestätigt. Und natürlich hatte er auch gemerkt, dass sie am Bahnhof ihrem Vorsatz untreu geworden war. Sie hatte sich den Wartenden zugewandt, hatte versucht, jeden Einzelnen zur Kenntnis zu nehmen, hatte alten Bekannten zugenickt und anderen ein kurzes Winken geschenkt. Aber das alles erst, nachdem sie erkannt hatte, dass ihre Eltern und auch Insa nicht zum Bahnhof gekommen waren. So hatten sie es in Wien verabredet: Erst das Konzert! Seelische Erschütterungen taten Alettas Stimme nicht gut. Sie musste sich frei fühlen, um frei singen zu können. Und sie wollte diesmal besonders gut sein, so gut, dass sie jeden überzeugte. Jeden!
»Hast du dir überlegt, wie lange du bleiben willst?«, fragte Ludwig, obwohl er sie vor der Reise schon oft gefragt hatte.
Aletta umklammerte seinen Arm noch fester und gab die Antwort, die sie jedes Mal gegeben hatte: »Das kann ich erst entscheiden, wenn ich mit meinen Eltern und mit Insa gesprochen habe. Vielleicht wird alles wieder gut, dann können wir beide hier Urlaub machen. Ich habe ja Zeit. Die Proben für Madame Butterfly beginnen erst im August.«
Als sie am Ende der Friedrichstraße angekommen waren, zögerte Ludwig. »Noch weiter?«
Aletta nickte, und ohne einen Kommentar überquerte Ludwig mit ihr die Maybachstraße. Kurz darauf ging es nach links in die Stephanstraße, die an der linken Seite von einer dichten Baumreihe gesäumt wurde. An der Ecke stand ein weiß getünchtes Haus mit einem kleinen dunklen Pavillon neben dem Eingang.
»Das gehörte dem Kapitän Friedrich Erichsen«, erklärte Aletta. »Nach ihm wurde die Friedrichstraße benannt.«
Das Nebengebäude war ebenso weiß und gut gepflegt wie das Haus des Kapitäns, dann folgte mit nur wenigen Metern Abstand ein dunkles zweigeschossiges Haus, weniger einladend mit seiner düsteren Fassade, aber genauso stattlich und respektabel.
Alettas Schritte wurden langsamer, Ludwig begriff sofort, warum. »Das ist es?«, flüsterte er, als könnte Alettas Familie in ihrem Haus aufgeschreckt werden.
Aletta blieb stehen, tastete nach Ludwigs Hand und drückte sie fest. Er rührte sich nicht, wartete darauf, dass ihr Körper ein Zeichen gab, dass er sich rückwärts oder vorwärts bewegte, zögerte oder sich entschloss.
Die Straße war dunkel, sie war nicht bedeutend genug, um nachts gut beleuchtet zu werden. Lediglich zwei Laternen gab es, die es aber nicht schafften, so viel Licht zu spenden, dass gefahrloses Vorankommen möglich war. Auf dem unbefestigten Weg gab es viele Unebenheiten, Steine, tiefe Spuren von Rädern, achtlos Weggeworfenes, auch Tierexkremente. Zwar war der Fremdenverkehr mittlerweile in alle Straßen Westerlands gedrungen, weil sich viele Hausbesitzer entschlossen hatten, sich mit dem Vermieten von Zimmern etwas dazuzuverdienen, aber ein Entgegenkommen der Stadt Westerland in Form gut gepflasterter Straßen und ausreichender Beleuchtung erhielten nur die Feriengäste, die in den großen Hotels logierten.
Die Häuser in dieser Straße standen dicht nebeneinander, doch hinter ihnen dehnten sich große Grundstücke. Trotz der Dunkelheit war zu erkennen, dass einige Häuser bereits durch Anbauten erweitert worden waren, um mehr Platz für Logiergäste zu haben, und viele Gärten nicht mehr nur zum Anbau von Obst und Gemüse dienten, sondern auch dem Aufenthalt erholungssuchender Sommerfrischler, die in der Sonne sitzen und die gute Seeluft genießen wollten, ohne dafür zum Strand gehen und sich später mit der sandigen Kleidung abplagen zu müssen.
»Vater hat schon vor zwölf Jahren aus dem Hühnerstall zwei Fremdenzimmer gemacht«, sagte Aletta. »Insa hat die Gäste versorgt, wenn welche kamen.«
Nun entschloss sie sich, einen Schritt voranzumachen, ohne jedoch Ludwigs Hand loszulassen. Er folgte ihr, nahm zunächst ihr Zögern auf, trieb sie dann aber mit ein paar Schritten schneller voran.
Doch Aletta löste sich von seiner Hand, als sie den hellen Kreis der nächsten Laterne erreichten. An seinem Rand blieb sie stehen und nickte zu dem dunklen Haus, in dem ein Fenster im Erdgeschoss beleuchtet war. Dahinter war eine Bewegung auszumachen.
»Insa«, flüsterte Aletta. »Wahrscheinlich bereitet sie das Frühstück für die Gäste vor, damit es morgen früh schneller geht.«
»Vielleicht hat sie auf deinen Besuch gewartet«, gab Ludwig zurück. »Wenn sie weiß, dass du heute eingetroffen bist ...«
Aber davon wollte Aletta nichts hören. »Sie muss zu meinem Konzert kommen. Insa und meine Eltern müssen wissen, dass ich morgen nur für sie singe.«
»Du hast recht«, räumte Ludwig ein. »Und du wirst singen wie nie zuvor.«
Aletta machte kehrt. Nun war sie es, die Ludwig mit sich zog. »Wenn sie das Lied hören, das bei uns an jedem Feiertag gesungen wurde, dann müssen sie verstehen, was ich ihnen sagen will.«
Das Auffälligste an Vera Etzold waren neben ihren großen graugrünen Augen ihre Haare gewesen, eine Fülle von schwarzen Locken, die sie zwar bändigte, indem sie sie im Nacken feststeckte, die sich aber immer der Ordnung widersetzten. Stets kringelten sich an ihrer Schläfe, an der Stirn und über den Ohren ein paar fliegende Löckchen, die sich aus der Zucht gelöst hatten. Wie sie sich auch mühte, es gelang ihr nie, so streng und vornehm auszusehen, wie sie es wollte. Ihre schwarzen Locken machten ihr täglich einen Strich durch die Rechnung.
Seit dem Tod ihres Mannes verbrachte sie jeden Sommer auf Sylt. Ende April oder Anfang Mai erschien sie und reiste selten vor dem August wieder ab. Das Vermögen, das sie geerbt hatte, erlaubte ihr einen großzügigen Lebensstil, aber zufrieden war sie mit diesem Müßiggang nicht. Sie vermisste ihren Beruf, bedauerte, dass sie keine Kinder hatte, für die sie sorgen konnte, dass es niemanden gab, der sie brauchte, und ihr Leben ohne ihr geringstes Zutun reibungslos funktionierte. In ihrem Haus in Kassel regierte eine Haushälterin, die Geschäfte ihres Mannes führte ein Neffe weiter, ihre Eltern lebten nicht mehr, und Geschwister hatte sie keine.
In dem Jahr, als Aletta zehn Jahre alt geworden war, kam Vera Etzold schon im Februar nach Sylt. Sie war mit dem Neffen ihres Mannes in Streit geraten, als sie versucht hatte, Einblick in kaufmännische Unterlagen zu bekommen, um etwas von dem Geschäft zu erfahren, das ihr den Lebensunterhalt sicherte. Der Neffe hatte sich kontrolliert gefühlt und nicht verstanden, dass Vera nur eine Beschäftigung suchte, die in ihren monotonen Alltag ein wenig Farbe brachte. Sie hatte es ihm nicht begreiflich machen können. Und aus Enttäuschung und Desillusionierung hatte sie ihre Haushälterin angewiesen, die Koffer zu packen und alles für eine Reise nach Sylt bereitzumachen. Während der Wintermonate war es zwar mühselig, auf die Insel zu kommen, aber sie wagte es trotzdem. Schon am Tag ihrer Ankunft, als sie feststellte, dass das »Miramar« nur wenige Gäste beherbergte und auf der Plattform keine Urlauber flanierten, wurde ihr jedoch klar, dass sie sich auch in Westerland langweilen würde. Nur deshalb entschloss sie sich, einem Gottesdienst beizuwohnen, nachdem sie gehört hatte, dass dort ein junges Mädchen das Ave-Maria singen würde, von dessen schöner Stimme die Sylter mit Hochachtung sprachen. Aletta Lornsen sang angeblich so glockenrein, wie es auf Sylt noch nie gehört worden war. Nachdem Vera Etzold dem Ave-Maria gelauscht hatte, wusste sie plötzlich, womit sie ihrem Leben wieder einen Sinn geben konnte ...
Aletta hatte mit offenem Mund zugehört, als Vera ihr erzählte, wie einsam sie sich in ihrem großen Haus in Kassel fühlte, obwohl es dort viele Dienstboten gab und sie keine einzige Stunde des Tages allein war. Noch nie hatte Aletta jemanden darüber klagen hören, dass er nichts zu tun hatte und sich langweilte, weil es keine Beschäftigung gab, die für eine reiche Witwe angemessen war.
»Ich war Sängerin! Erste Sopranistin am Stadttheater von Göttingen!«
Aber der Neffe ihres Mannes habe ihr sogar offen gedroht, wenn sie es wagen sollte, den Namen ihres verstorbenen Mannes und damit den Namen seiner Firma in den Schmutz zu ziehen, indem sie sich auf einer Bühne einem Publikum präsentiere, das vielleicht zunächst applaudieren, aber schon auf dem Nachhauseweg darüber tuscheln würde, wie schamlos es für eine Witwe sei, sich dermaßen zur Schau zu stellen. Nein, ihr Wunsch, wieder als Sängerin aufzutreten, war ihr so rundweg abgeschlagen worden, dass sie nicht wagte, sich gegen die Familie ihres Mannes zu stellen.
»Wenn du willst, gebe ich dir Gesangsunterricht«, sagte Vera Etzold derart unvermittelt, dass Aletta regelrecht erschrak. »Die Natur hat dir eine wunderschöne Stimme geschenkt, aber wenn du so weitermachst, wird sie bald kaputt sein. Du musst lernen, sie richtig einzusetzen. Ich glaube, ich kann aus dir eine große Sängerin machen.«
Den Moment, in dem Vera Etzold diese unglaublichen Worte aussprach, vergaß Aletta nie. Jede Einzelheit dieses Augenblicks blieb ihr im Gedächtnis. So erinnerte sie sich genau, dass der Raum überheizt war und dass Vera Etzold trotzdem einen warmen Schal trug. Der war so weich, dass er, als er sie im Vorübergehen zufällig streifte, kaum zu spüren war. Und noch Jahre später konnte Aletta sich an Veras dunkelgrünes Seidenkleid erinnern und dass ihr ein Zimmermädchen ein Fußkissen brachte, damit sie es bequemer hatte. Aletta selbst trug damals ihr dunkles Wollkleid, das besonderen Anlässen vorbehalten war, Gottesdiensten, hohen Festtagen und Besuchen bei höhergestellten Verwandten. Es war dunkelblau und besaß einen weißen Kragen, den ihre Mutter gehäkelt hatte. Die ebenfalls dunkelblauen Strümpfe hatte ihre Patentante gestrickt und ihr zu Weihnachten geschenkt. Sie juckten fürchterlich, aber Aletta schaffte es, mit keiner Bewegung zu verraten, wie sehr diese wollenen Strümpfe sie quälten. Auch während des Ave-Maria war sie kein einziges Mal der Versuchung erlegen, sich zu kratzen. Mit rotem Kopf stand sie nun vor Vera Etzold, drehte an ihren dünnen Zöpfen und starrte das Zimmermädchen an, das ihr das wollene Tuch abnehmen wollte, ohne dass Aletta verstand. Schließlich griff das Mädchen einfach zu, zog ihr das Wolltuch von den Schultern und trug es hinaus. Ängstlich blickte Aletta ihr nach, voller Sorge, dass sie das Tuch später vergeblich suchen würde und ohne diesen Schutz nach Hause gehen und erbärmlich frieren müsste.
»Glaubst du«, fragte Vera Etzold am Ende, »dass deine Eltern einverstanden sein werden, wenn ich dich unterrichte? Ohne ihre Erlaubnis kann ich das nicht machen. Natürlich werde ich kein Geld dafür nehmen, mir ist schon klar, dass ihr keinen Unterricht bezahlen könnt. Es wäre mir eine Freude, dich zu unterrichten. Ich möchte aus dir etwas Großes machen. Du hast das Potential dafür.«
Aletta hatte keine Ahnung, was ein Potential war, aber eines wusste sie genau: Ihre Eltern würden niemals zulassen, dass sie Gesangsunterricht erhielt. Auch dann nicht, wenn sie ihn kostenlos bekam. Trotzdem knickste sie tief und antwortete: »Ich werde es meinen Eltern sagen. Ganz sicherlich werden sie einverstanden sein.«
Vera Etzold klingelte nach dem Zimmermädchen und ließ es auf einen Zettel schreiben, dass Aletta demnächst dienstags und freitags gegen drei Uhr nachmittags ins »Miramar« kommen solle. »Zwei Stunden werden wir jeweils brauchen. Sag das deinen Eltern.«
Aletta machte einen noch tieferen Knicks, ließ sich von dem Zimmermädchen auf den Hotelflur geleiten, nahm erleichtert ihr Wolltuch entgegen und stieg vorsichtig die Treppe ins Erdgeschoss hinab. Als der Portier auf sie zukam, wollte sie sich gerade rechtfertigen, dass sie sich nicht ins »Miramar« eingeschlichen habe, sondern von Frau Etzold eingeladen worden war ... da sprang er zur Tür, um sie für Aletta zu öffnen. Später dachte sie manchmal, dass nicht der erste Besuch bei Vera, sondern vor allem dieser Augenblick es gewesen war, der ihr Leben verändert hatte. Als sie das »Miramar« verließ, ohne selbst die Tür geöffnet zu haben, bekam sie eine Ahnung davon, welche Chance sie erhielt. So fest umklammerte sie den Zettel mit der rechten Faust, dass er vollkommen zerknüllt war, als sie zu Hause ankam.
Insa empfing sie misstrauisch. Sie war fünfzehn Jahre älter als Aletta, längst im heiratsfähigen Alter und in der Hausarbeit so geübt, dass sie ohne weiteres von einem Tag auf den anderen einen eigenen Haushalt hätte führen können. Aber Insa hatte beharrlich jeden Verehrer abgelehnt, von denen es mehrere gegeben hatte. Sie war eine hübsche Frau mit einem blassen, ebenmäßigen Gesicht und schönen blonden Haaren, die sie in dichten Flechten an den Kopf steckte. Eine majestätische Frisur! Aletta hatte als kleines Kind von einer Krone gesprochen, wenn sie die Haare ihrer Schwester bewunderte. Und wie hatte sie Insa angehimmelt! Ihre große Schwester, die so stark war, so unverwundbar schien, so beharrlich und unbeirrt ihren Weg ging. Sie schien ihn genau zu kennen, den Weg, den sie gehen wollte. Er führte nicht aus ihrem Elternhaus hinaus. Insa machte bald klar, dass sie in der Stephanstraße bleiben wollte. Die Ehe, Kinder, ein eigener Haushalt, das alles reizte sie nicht. Wenn die Eltern sich um die Zukunft ihrer Ältesten sorgten, sprach sie vom Fremdenverkehr, der ihr ein Auskommen sichern werde. Einen Ehemann brauche sie nicht. Und sie wolle keinen! Solange sie mit Feriengästen ihr Brot verdienen und ihr Auskommen sichern könne, würde sie zufrieden sein. Manchmal hörte Aletta auch die Nachbarn flüstern, dass aus Insa eine verbitterte, freudlose und unzugängliche Frau werden würde, mit der kein Mann sich verbinden wolle, wenn sie so weitermache. Und tatsächlich hatte das Interesse heiratswilliger Männer schnell nachgelassen, als bekannt geworden war, dass Insa zwar eine gute Hausfrau war, wie sie sich jeder Mann wünschte, aber auch streng und ohne jede Heiterkeit. Und dass sie das Zeug zu einer guten Mutter hatte, wurde bald ganz offen bezweifelt. Jeder sah ja, dass Insa sich ungern und nur äußerst selten mit ihrer kleinen Schwester abgab, Aletta sogar oft zurückwies, wenn sie sich an Insa schmiegen wollte, und am liebsten über die Kleine hinwegsah.
Als Aletta aus dem »Miramar« zurückkam, war sie jedoch voller Interesse. »Was wollte die elegante Dame von dir?«
Aletta hielt ohne weiteres ihrem Blick stand. »Sie braucht ein Dienstmädchen.«
Insas Misstrauen vertiefte sich. »Das ›Miramar‹ ist voller Dienstmädchen. Und du bist erst zehn Jahre alt.«
»Sie will aber, dass ich ihr demnächst zweimal in der Woche helfe«, beharrte Aletta und öffnete ihre rechte Faust. »Hier hat sie es aufgeschrieben.«
Nun war auch die Mutter aufmerksam geworden. Mit Insa beugte sie sich über den Zettel, auf den der Name des vornehmsten Hotels Westerlands aufgedruckt war. »Wahrscheinlich sollst du ihr vorlesen«, vermutete die Mutter. »Oder sie möchte, dass du ihr etwas vorsingst. Anscheinend hat ihr dein Gesang gefallen.«
Aletta nickte erleichtert. »Ja, das hat sie gesagt. Vorlesen und vorsingen ...«
Die Mutter nickte zufrieden. »Hat sie gesagt, was du dafür bekommen wirst?«
Aletta starrte sie erschrocken an. »Nein.«
Insa dachte kurz nach. »Fünfzig Pfennige pro Woche sollte sie Aletta schon geben. Was meinst du?«
Die Mutter stand auf, ging zum Herd und nahm den Deckel von einem Topf, um den Zustand des Steckrübeneintopfs zu überprüfen. »Wir sollten langfristiger denken«, entgegnete sie. »Wenn Aletta alles richtig macht, nimmt Frau Etzold sie vielleicht später mit nach Kassel. Womöglich kann sie dort Haushälterin werden.«
Insa sah ihre kleine Schwester streng an. »Also pass auf, dass du alles richtig machst. Aber lass dich trotzdem nicht mit ein paar Pfennigen abspeisen.«
II.
Der Alte Kursaal erstrahlte im schönsten Glanz. Die Kristallleuchter, die über den Sitzreihen hingen, waren auf Hochglanz gebracht worden, die dunklen Holzböden schimmerten, die hölzernen Wandvertäfelungen waren noch am Morgen abgestaubt worden. Der Kurdirektor wollte alles tun, um die berühmte Tochter der Stadt in angemessener Umgebung zu würdigen. Die vierhundert Sitzplätze, die der Saal bot, waren noch erweitert worden durch Klappstühle neben den Sitzreihen und hinter der letzten Reihe. So würden vierhundertfünfzig Personen dem Konzert Aletta Lornsens beiwohnen können, damit würde der Saal zum Bersten gefüllt sein.
Schon eine Stunde vor Konzertbeginn füllten sich die Reihen. In den kleinen Raum hinter der Bühne, in dem Aletta ihre Stimme aufwärmte, sich mit Entspannungsübungen vorbereitete und sich schminken und frisieren ließ, drang schon bald das Stimmengewirr. In den großen Konzerthäusern achtete man darauf, die Künstler vom Publikum akustisch abzuschirmen, damit niemand schon vorher eine Ahnung davon bekam, wie gut oder schlecht die Vorstellung besucht sein würde, aber das Kurhaus von Westerland war eben nicht vergleichbar mit der Mailänder Scala oder der Staatsoper in Wien. Auch die Bühne, die Aletta vorfinden würde, war mit ihren fünfzehn Metern Breite mehr als bescheiden, dennoch war ihr Lampenfieber nie so groß gewesen wie in diesem Augenblick. Ihr war, als hinge ihre Zukunft von dem heutigen Auftritt ab.
Zum Glück ließ Ludwig nicht erkennen, dass dieses Konzert anders war als jedes andere vorher! Er hatte alles so gemacht wie immer, hatte sie an den Ort ihres Auftritts gebracht, sie abgeschirmt, dafür gesorgt, dass sie nicht belästigt wurde, hatte mit ihr zusammen die Bühne besichtigt, Unklarheiten beseitigt, Fragen für sie beantwortet und sie dann in ihre Garderobe gebracht und ihr versprochen, dass niemand sie stören würde, dass nur die Garderobiere und die Friseurin zu ihr vorgelassen würden. Dann war er gegangen, aber Aletta wusste, dass er auch diesmal immer in ihrer Nähe sein würde und sie jederzeit nach ihm rufen konnte.
Sie lehnte sich zurück, atmete den Geruch dieses kleinen Raums ein, den sie nicht kannte und der ihr doch vertraut zu sein schien, weil er zu Sylt gehörte und jeder Raum der Insel einen Geruch trug, den es nirgendwo anders gab. Wo einmal der Wind eingedrungen war, der übers Meer kam, roch es nach Heimat.
Die Stimmen aus dem Zuschauerraum drangen durch die geschlossene Tür, auf dem Gang hörte sie Ludwig etwas sagen, was streng und kategorisch klang. Ja, Ludwig konnte unerbittlich sein, wenn es um ihre Sicherheit und ihren Frieden ging. Aletta lehnte sich zurück und schloss für eine Weile die Augen. Wie sehr sie ihn liebte! Wie dankbar sie ihm war! Er tat alles für sie, nur das eine konnte sie nicht von ihm haben. Seit Frau Wülfke sie mit dieser Frage bedrängt hatte, kreiste sie ständig in ihrem Kopf. Zwar hatte sie viele gute Argumente, die sie hundertmal von Ludwig gehört hatte, aber sie wusste, dass kein einziges ihre Eltern überzeugen würde.
Sie öffnete die Augen und setzte sich aufrecht hin. Dann klingelte sie nach der Friseurin. Warum eigentlich brauchte sie Argumente? Sie war nicht gekommen, um ihre Eltern zu überreden, sie war hier, um sich zu überzeugen, dass sie längst zur Einsicht gekommen waren. Sie wollte sich versichern lassen, dass sie noch immer geliebt wurde! Weil sie das Kind ihrer Eltern war, das ein Recht auf diese Liebe hatte, gleichgültig, was es getan hatte! Und weil sie Insas Schwester war! Wenn diese drei Ludwig Burger ablehnten, weil er sie zwar liebte, aber nicht heiraten würde ... dann wusste sie nicht, was sie tun würde.
Die Friseurin hatte ihr die Haare so straff wie möglich nach hinten gekämmt und mit einem Lack dafür gesorgt, dass sie im Bühnenlicht sanft schimmern würden. Mit einem schlichten Knoten waren sie befestigt worden, über den die Friseurin ein goldenes Netz legte, das mit grünen Federn besetzt war. Ihre Garderobiere war schon vor einer Woche nach Sylt gekommen und würde am nächsten Tag nach Wien zurückkehren. Ludwig hatte Aletta von diesem Plan abbringen wollen, weil sie den Syltern damit vor Augen führte, dass aus ihr ein Luxusgeschöpf geworden war, aber in diesem Fall war sie unerbittlich geblieben. Bei ihrem Make-up wollte sie kein Risiko eingehen. So hatte Ludwig dafür gesorgt, dass niemand erfuhr, wer die Dame aus Wien war, die im Grand-Hotel logierte, und Aletta hatte er verpflichtet, niemandem zu verraten, dass Ella Hofer die Reise nur unternommen hatte, um Aletta Lornsen zu schminken, vorher sämtliche notwendigen Utensilien einzukaufen und sich auf ihre wichtige Aufgabe vorzubereiten.
Niemand verstand die Kunst des Bühnen-Make-ups so wie Ella. Als Aletta in den Spiegel sah, war ihr Teint hauchzart überpudert, mit Rouge war ihm eine gesunde Farbe gegeben worden, ihre Augen waren so geschminkt, dass sie größer und sehr geheimnisvoll wirkten, und ihr Mund war eine einzige leuchtende Verlockung.
»Danke, Ella! Das hätte keiner so hinbekommen wie du!«
Als Aletta hinter die Bühne trat, war aus dem Stimmengewirr im Saal regelrechter Lärm geworden. Laute Rufe ertönten, wenn einer einem anderen über mehrere Köpfe etwas mitteilen wollte, Gelächter erklang, die Stimmung schien ausgelassen zu sein. Aletta wusste nicht genau, ob ihr das gefiel. Sie hätte einer gespannten Erwartung den Vorzug gegeben. Vielleicht, weil sie sich vorstellte, wie ihre Eltern und Insa sich in dieser lauten Vorfreude fühlen mochten. Sie selbst befanden sich vermutlich genau wie Aletta in einem fiebrigen Vorgefühl und litten womöglich unter der Leichtigkeit des übrigen Publikums.
Die Mitglieder des Kurorchesters kamen den Gang entlang, um sich hinter der Bühne aufzustellen. Sie würden als Erste ihren Auftritt haben, aber Ludwig drängte sich prompt hinter Aletta und verhinderte so eine Annäherung, von der er wusste, dass sie sie nicht wünschte. Sie brauchte das Alleinsein kurz vor dem Auftritt, an diesem Tag ganz besonders. Allein sein konnte sie auch, wenn viele Menschen um sie herum waren, vorausgesetzt, sie wurde nicht angesprochen oder über Gebühr beachtet. Auch Ludwig redete in der letzten halben Stunde vor einem Auftritt nur das Nötigste mit ihr, war nur da, immer in ihrer unmittelbaren Nähe, um sie abzuschirmen und zu schützen.
Dann sah Aletta an sich herab. Mit voller Absicht hatte sie ein dunkelgrünes Seidenkleid gewählt, von gleicher Farbe wie das Kleid, das Vera damals trug, als sie Aletta zu sich gerufen hatte, um sie mitzunehmen in ein anderes Leben. Vera sollte auf diese Weise bei ihr sein, sollte ihren Triumph miterleben, diesen Sieg über ihre Vergangenheit.
Aletta machte einen Schritt auf den Vorhang zu, zögerte, als Ludwig »Tu’s nicht, Aletta!« flüsterte, und zerteilte ihn dann doch. Ganz vorsichtig, nur einen winzigen Spalt breit, so winzig, dass er nicht einmal von der ersten Zuschauerreihe zu erkennen sein würde. Mit dem linken Auge spähte sie in den Zuschauerraum, der noch hell erleuchtet war, wanderte von Reihe zu Reihe, von Gesicht zu Gesicht. Da, Pfarrer Frerich! Er saß in einer der ersten Reihen, die Hände über dem Bauch gefaltet, und strahlte höchste Zufriedenheit aus. In der Mitte entdeckte sie Jorit. Ganz still saß er da, beteiligte sich nicht an den Gesprächen, die rechts und links neben ihm geführt wurden. Anscheinend war er allein gekommen. Bewegungslos starrte er den Vorhang an, und Aletta schloss ihn erschrocken. Ihr war, als hätte er ihr linkes Auge entdeckt.
Ludwig strich ihr sanft über den Rücken. »Hast du sie gesehen?«
Aletta schüttelte den Kopf. Dann schloss sie die Augen, wie sie es immer tat, wenn der Auftritt kurz bevorstand, summte leise, machte Kaubewegungen und entspannte ihre Stimme durch Lippenflattern und erzwungenes Gähnen.
Nun wurde es im Zuschauerraum dunkel. Der Vorhang war so dicht, dass das Löschen der Lichter nicht zu sehen war, sondern nur akustisch wahrgenommen wurde, weil die Stimmen leiser wurden und es schließlich still im Saal geworden war. Schritte ertönten, Kurdirektor Wülfke betrat durch einen der beiden Treppenaufgänge an den Seiten die Bühne. Freundlicher Applaus begrüßte ihn, und Aletta hoffte, dass er sein Versprechen halten und ihren Auftritt mit nur wenigen Worten ankündigen werde.