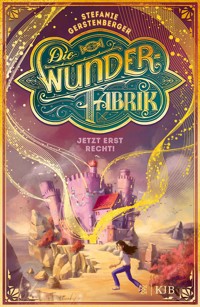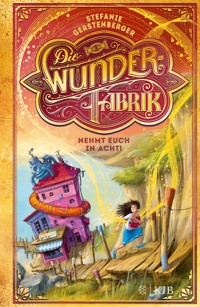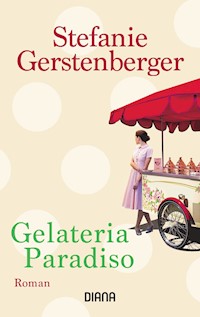11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei der schlanken Felicia und der rastazöpfigen Catta ist es Krieg auf den ersten Blick. Schon am ersten Ferientag am Hotelpool auf Elba geraten die beiden aneinander. Und dann passiert es: Durch einen magischen Switch finden sich die beiden im Körper der anderen wieder!Catta liegt im Bett von Felicia, in einem schmalen Körper und mit einem Kleiderschrank voll biederer Klamotten. Felicia hingegen erwacht mit Rastazöpfen in einem klapprigen VW-Bus. Der Horror! Wenn doch bloß Cattas Bruder Jacques nicht so süß wäre … Felicia und Catta brauchen nun ausgerechnet ihre allerbeste Feindin als Verbündete, um diesen verfluchten Sommer irgendwie zu überstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Stefanie Gerstenberger Marta Martin
SUMMER SWITCH
UND PLÖTZLICHbin ich du!
© Marion Koell
Stefanie Gerstenberger und Marta Martinsind Mutter und Tochter und legen mit Summer Switchihren dritten gemeinsamen Roman vor. Stefanie Gerstenberger wurde 1965 in Osnabrück geboren und studierte Deutsch und Sport. Nach Stationen in der Hotelbranche und beim Film und Fernsehen begann sie selbst zu schreiben. Ihre Italienromane sind hoch erfolgreich. Marta Martin, geboren 1999 in Köln, ist eine junge Nachwuchsschauspielerin und wurde durch ihre Hauptrolle in Die Vampirschwestern bekannt. Die beiden leben in Köln.
Außerdem von Stefanie Gerstenberger und Marta Martin im Arena Verlag erschienen: Zwei wie Zucker und Zimt. Zurück in die süße Zukunft Muffins & Marzipan. Vom großen Glück auf den zweiten Blick
1. Auflage 2017 © 2017 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen Umschlaggestaltung: Maria Seidel, unter Verwendung von Bildern von © gettyimages/Daniel Grill, © istockphoto/ logarymphic/frescomovie/blue67 ISBN 978-3-401-80706-5
Besuche uns unter: www.arena-verlag.dewww.twitter.com/arenaverlagwww.facebook.com/arenaverlagfans
Inhaltsverzeichnis
1 Felicia
2 Catta
3 Felicia
4 Catta
5 Felicia
6 Catta
7 Felicia
8 Catta
9 Felicia
10 Catta
11 Felicia
12 Catta
13 Felicia
14 Catta
15 Felicia
16 Catta
17 Felicia
18 Catta
19 Felicia
20 Catta
21 Felicia
22 Catta
23 Felicia
24 Catta
25 Felicia
26 Catta
27 Felicia
28 Catta
29 Felicia
30 Catta
31 Felicia
Italienisches Glossar
1 Felicia
Es begann alles am dritten Tag der Sommerferien.
An dem Tag, als der Brief ankam.
Und Jacques.
Ich stand hinter dem Tresen der Rezeption und wollte gerade einen langen Seufzer loslassen, als Signora Martini auf mich zulief, um ihren Zimmerschlüssel abzugeben. Also zog ich meine Mundwinkel nach oben und wünschte freundlich »buongiorno!«.
»Was haben Sie ein Glück, Signorina«, sagte sie auf Italienisch. »Sie dürfen auf dieser wunderbaren Insel Ihre Ferien verbringen! Noch dazu im Hotel Ihrer Eltern, in dieser wunderbaren alten Villa, mit diesem wunderbaren Pool und den wunderbaren hohen Pinien drum herum. Ach, diese Pinien. Ich liebe sie!«
Ich starrte sie nur an, lächelte aber weiter. Wenn sie noch einmal meravigliosa sagte, würde ich schreien. Mein Magen knurrte und mir war kalt, obwohl es draußen unter den Bäumen bestimmt schon sechsundzwanzig Grad hatte. Noch keine Kalorie bis heute. Es fühlte sich gut an. »Ja«, beeilte ich mich zu sagen. Aber Signora Martini war schon hinausgegangen und hatte ihre absonderlichen Vorstellungen von meinen Ferien mitgenommen.
Ferien? Ferien bedeuteten Arbeit für mich. Als ich im letzten Jahr aus dem Internat nach Elba zurückkam, hatte ich sechs Wochen lang jeden Morgen ab halb sieben im Frühstücksservice geschuftet: Buffet aufbauen, Käseplatten belegen, Kaffee einschenken, leere Teller abräumen, Buffet abbauen. Das Jahr zuvor auf der Etage, als Zimmermädchen: Betten abziehen, Betten beziehen, Bäder putzen, Klos putzen, staubsaugen. Wenn ich zu Hause war, sprang ich da ein, wo jemand fehlte. Natürlich tat ich das. Ich war schließlich Felicia Rosanna Paradiso, die einzige Erbin der Villa Paradiso. Ich war sechzehn, würde nach dem Abitur auf eine Hotelfachschule gehen und das Hotel eines Tages übernehmen.
Dieses Mal war es die Rezeption. Anna vom letzten Jahr war leider nicht wiedergekommen und die neue Rezeptionistin war gleich am zweiten Tag der Probezeit gegangen. Ich half also aus, bis Mama jemand anderen gefunden hatte.
Die Arbeit am Empfang war eigentlich nicht der schlechteste Job, man schwitzte nicht so wie als Zimmermädchen oder im Service. Aber es war auch sehr anstrengend, wenn fünf Gäste auf einmal vor dem Empfang standen, jeder etwas anderes verlangte, der Drucker die Rechnungen nicht ausspucken wollte und dann auch noch das Telefon klingelte, wie heute schon den ganzen Morgen lang.
Doch in diesem Moment schwieg das Telefon, Signora Martinis Schritte verknirschten im Kies und in mir wurde es plötzlich ganz ruhig. Ich konnte ein paar Vögel zwitschern hören und den Wagen von der Wäscherei, der gerade zum Hintereingang fuhr, um die Laken und Handtücher abzuholen. Es war ein Gefühl, als bliebe die Zeit stehen, als würde die Welt kurz mal tief ein- und wieder ausatmen. Dann hörte ich meine Mutter in dem Zimmerchen hinter der Rezeption erneut auf die Tastatur des Computers einhacken und der Moment war vorbei. Jetzt würde sie gleich loslegen: »Feli-tscha!«
Während die Leute auf Elba mich allesamt nuschelig »Felischa« riefen, sprach meine deutsche Mutter meinen Namen wie einen Peitschenhieb aus: »Feli-tscha! Du stehst schon wieder rum! Feli-tscha! Du träumst!« Sie musste mich gar nicht sehen, sie spürte auch so, wenn ich nichts »Vernünftiges« machte. Wenn ich nicht freundlich guckte. Wenn ich zu viel aß.
Ja. Im Moment träumte ich wirklich vor mich hin. Und zwar nicht vom Strand oder vom Segeln oder irgendwelchen hübschen Schauspielern, sondern von einem Seminarraum. Einem ziemlich stickigen Seminarraum, ohne viele Fenster, in dem ich in diesem Moment liebend gerne gesessen hätte. Technisches Zeichnen an der Uni Bern. Meine Freundin Tamara hatte mir über WhatsApp beschrieben, wie es dort aussah. Tamara machte dort gerade einen Ferienkurs, denn sie wollte unbedingt Architektin werden und ich überlegte, wie ich meinen Eltern erklären könnte, dass auch ich …
»Feli-tscha?! Fé? Tust du was?«
»Ja klar!« Ich holte tief Luft und machte mich daran, die Ankünfte von diesem Morgen in den Computer zu übertragen. Name, Adresse, Land. Anreisedatum, Abreise. Man konnte viel falsch machen an diesem blöden Computer, der nie das tat, was ich von ihm wollte. Auch mit Menschen konnte man viel falsch machen. Meine Mutter belauschte mich seit zwei Tagen und an jedem Satz, den ich an die Gäste richtete, meckerte sie hinterher rum. Leider konnte ich nicht einfach gehen, wie Anna …
Ich legte die Pässe in die Zimmerfächer, um sie später den Gästen zurückzugeben, und guckte heimlich auf mein Handy. Neue Nachrichten von Tamara? Nein. War wohl zu sehr mit ihrem Kurs beschäftigt. Es war erst der dritte Ferientag und schon vermisste ich die Schule. Grazie a Dio, Gott sei Dank, hatten wir in der Schweiz nur sechs Wochen Ferien und nicht drei Monate, wie in Italien.
»Hast du die Anreisen gecheckt?«, kam es aus dem Hinterzimmer. Ich schreckte vom Display hoch. »Bin gerade dabei!« Schnell sah ich in der Liste nach.
Zwei Anreisen waren noch nicht durchgestrichen: eine Familie aus Rom für ein aufgebettetes Dreierzimmer. Ich würde die neue Hausdame anpiepen müssen und fragen, ob das Extrabett schon in Zimmer Concetta stand. Und ein Paar reiste noch an. Krüger-Kingston. Ich zog eine Augenbraue nach oben. Manche deutsche Frauen trugen so unnötig lange Doppelnamen … doch neben diesen hatte Mama etwas mit Bleistift geschrieben und auch noch drei Ausrufezeichen dahintergesetzt, damit ich bloß nicht vergaß, dass die Krüger-Kingstons die Gewinner des Preisausschreibens der Zeitschrift Carina waren. Ihr Preis: ein zweiwöchiger Gratisaufenthalt bei uns.
»Vergiss nicht, der neuen Hausdame zu sagen, dass sie den Gästen des Preisausschreibens in Suite Manuela ein Extra hinstellen soll!«
Ein »Extra« bedeutete eine Flasche Sekt und einen Obstkorb.
»Okay«, rief ich zurück. »Ein Extra für die Krüger-Kingstons!« Ich hätte auch so dran gedacht. Ganz bestimmt. Musste sie immer alles kontrollieren?
»Preissauschreiben? Zwei Wochen, inklusive Frühstück, was uns das wieder kostet!«, hatte mein Vater sich beschwert. »Hätten es drei Tage nicht auch getan?«
»Manchmal muss man eben investieren. Die Fotos und der Bericht sind eine großartige Werbung für uns.« Mamas alte Schulfreundin aus ihrer Hamburger Zeit war zur Chefredakteurin der Carina aufgestiegen und hatte das für uns arrangiert. »Damit wir endlich wieder auf einen grünen Zweig kommen.«
Wir mussten also wieder auf einen grünen Zweig kommen. Warum? Als Nonna noch lebte, war der Zweig doch sehr grün gewesen. Was war passiert?
»Das alles macht mich fertig! Du machst mich fertig!«, hatte Mama meinem Vater vorgeworfen und prompt hatten sie sich wieder gestritten. Sie stritten oft. Dann vermisste ich meine Nonna Rosanna umso mehr, obwohl es schon zwei Jahre her war, dass sie von uns gegangen war. Aber ich vermisste nicht nur sie, sondern auch meinen Opa, den ich Nonno oder manchmal auch Giancarlo nannte. Er hatte sich am Tag nach Nonnas Beerdigung aus dem Hotel und dem Restaurant zurückgezogen und alles meinem Vater und meiner Mutter überlassen. Seitdem lebte er in seinem Gartenhäuschen, einem zusammengezimmerten Ding von einem Haus, das innen aber echt gemütlich war. Es wurde von einem riesigen Pinienbaum überdacht, der von den Elbanern Zio Pino, Onkel Pinie, genannt wurde. Nonna Rosanna hatte mir viele Geschichten über ihn erzählt. Er sei der größte und älteste Pinienbaum in unserem Garten, in dem Waldstück, ja sogar auf ganz Elba.
Nun wohnte Nonno unter dem Zio Pino. Ein paar Stunden am Tag kümmerte er sich noch um den Garten und seine Bienen, er grüßte jeden freundlich, doch er mischte sich nicht mehr ein.
Die Stammgäste hatten natürlich in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass die gut gelaunte Rosanna fehlte und Giancarlo nicht mehr in der Küche sang, und fragten dauernd nach den beiden. Manchmal sah ich einen von ihnen bei ihm stehen und reden. Mein Opa lächelte dann und antwortete mit seinen vielen Gesten, aber er sah einsam aus. Nonna ist tot und hat Nonno Giancarlo, mich und das Hotel allein gelassen, dachte ich.
»Oh! Nein! Nicht das auch noch!«
Ich hielt die Luft an.
»Diese Bewertungen bei You-Travel sind so ungerecht! Man sollte die verklagen!«
Ich antwortete nicht. Meine Mutter erwartete auch meistens keine Antwort. Wenn sie nervös oder gestresst war, redete sie Deutsch. Also fast immer, wenn sie die Buchführung der Villa Paradiso machte, die Reservierungen oder den Einkauf erledigte. Ihre Nervosität versteckte sie dabei hinter langen blonden Haaren, die ich übrigens von ihr geerbt habe.
Die Italiener lieben blonde Menschen. Das passt ganz gut, wenn man wie ich hier auf Elba geboren ist. Auf dieser Insel, die zur Toskana gehört und die wie ein krakelig gemalter Fisch mit zu großem Kopf aussieht.
Auch den Rest meines Aussehens habe ich von meiner Mutter Antje. Lang und dünn. Gerade mal ein A-Körbchen, und das mit sechzehn. Da kommt wohl auch nicht mehr viel … Blaue Augen. Eine normale Nase und einen Mund, der aussieht wie ein lang gezogenes Rechteck, wenn ich lache. Man sieht dann immer meine Zähne bis zum allerhintersten Backenzahn. Keine Ahnung, ob ich das schön finden soll. Aber ich lache ja eh nicht so oft.
Meine Mutter, damals eine junge deutsche Lehrerin aus Hamburg, verliebte sich im Urlaub auf Elba in den coolen Roberto, weil der mit dem Segelboot fast über sie drübergesegelt wäre. Der Klassiker eben. Nach zwei Jahren Versteckspiel und Hin und Her heiratete sie als Deutsche in die alte elbanische Familie Paradiso ein und alle dachten: Oh, oh – das geht bestimmt schief. Aber – oh, oh – es ging gut. Zunächst mal. Antje ließ sich von ihrem Lehrerjob beurlauben und stieg in das Hotel mit ein. Noch heute erwähnte sie das mit dem Beurlauben gerne. »Ich bin Beamtin! Ich kann immer noch in den Schuldienst zurück!«, schrie sie dann.
Na ja. Nach achtzehn Jahren? Egal. Mit meiner Oma war sie immer ganz gut ausgekommen und hatte sich auch einiges von ihr abgeschaut. Seit ihrem Tod versuchte sie, Nonna, so gut es ging, zu ersetzen, doch obwohl sie es vielleicht nicht so meinte, war sie immer eine Spur zu streng mit den Gästen. Und mit den Angestellten sowieso.
Ich war jetzt gerade einmal drei Tage zu Hause, aber sie kam mir echt gestresst vor. Dabei ging die Saison doch erst richtig los. Die Autos wurden jeden Tag zu Hunderten von den Fähren übergesetzt und füllten die Straßen der Insel. Noch waren wir nicht ausgebucht, aber es war ja auch noch keine Hochsaison.
In unserem Hotelrestaurant Adamo war jedenfalls genug zu tun. Gestern hatte ich den ganzen Abend Salat gewaschen, Spinat gewaschen, Tomaten geschnitten und zwischendurch die Soßenkleckse mit einem Tuch vom Tellerrand abgewischt, bevor sie raus in den Service gingen. Es war wie immer sehr hektisch gewesen und zwischendurch hatte mein Vater natürlich wieder rumgebrüllt.
Mein Vater Roberto führte das Restaurant und regte sich den ganzen Tag über alles Mögliche auf, gerne auch über mich. Mama versuchte, alles auszugleichen, und raunzte dabei die an, die in ihrer Nähe standen.
Ich ließ meinen Blick schweifen. In der Lobby standen bequeme Sofas mit weißen Leinenbezügen, kleine Tischchen, orange Stehlampen, auch einen offenen Kamin gab es. Die Halle war hoch, mit einem gemauerten Gewölbe. Falls ich jemals ein Haus entwerfen sollte, müsste es so eine Eingangshalle haben!
Von der Rezeption konnte ich auch auf die Terrasse schauen und in den Garten, der im wild gesprenkelten Licht der hohen Pinienbäume lag. Ich liebte unseren türkis schimmernden kleinen Pool und auch die Kiesauffahrt vor dem Hotel, die großen Hortensienbüsche, die sie säumten, den Parkplatz mit dem rosa blühenden Oleander, den Eingang und die zwei riesigen Tonamphoren … Ich liebte das alles – und wollte doch ganz woanders sein.
Endlich stieß ich den langen Seufzer aus, der in mir steckte, sortierte dann die Anreisezettel neu und trug die Gäste- und Frühstückszahlen in die Statistik von gestern ein. Warum waren die Ferien der letzten beiden Jahre so anstrengend gewesen? Weil ich versucht hatte, für meinen Vater unsichtbar zu sein, und zu oft in Mamas Nähe stand? Könnte sein. Außerdem wusste ich nie, zu wem ich wann halten sollte.
»Ach, du meine Güte! Ach nein! Jetzt hat sie es wirklich getan!«, rief meine Mutter aus, als ob ich sie durch meine Gedanken aufgescheucht hätte. »Dieser Brief ist eine Katastrophe! Sie will uns ruinieren!«
Ich wollte schon verschwinden, bevor sie alles an mir auslassen konnte, aber Mama schoss an mir vorbei, ein paar Papiere flatterten in ihrer Hand. Erst dachte ich nur, Glück gehabt, ihr Ärger wird jemand anderen treffen, doch dann wurde ich neugierig. »Was? Wer? Was ist das für ein Brief?« Ich folgte ihr durch die Lobby und steckte den Pager am Rockbund fest. Einen Moment konnte ich die Rezeption ja wohl mal alleine lassen. Vielleicht geschah ein Wunder und Maurizio, unser fauler Hausdiener, hatte eine wache Minute und würde mich anpiepen, wenn jemand kam. Wo war er eigentlich? Ich hatte ihn seit heute Morgen nicht mehr gesehen.
Oben in unserer Wohnung saß mein Vater im Unterhemd am Küchentisch und rauchte. Er trug echt noch diese weißen, ärmellosen Unterhemden unter seiner Kochjacke. Neben ihm lagen die alten Hanteln auf dem Boden, mit denen er seine Oberarme trainierte. Wenn man ihn glücklich machen wollte, musste man nur was Gutes über seine Arme sagen. Oder seine Ideen loben. Irgendwie machte er immer einen auf Altmodisch, ein Italiener mit gewellten schwarzen Haaren, wie man ihn aus alten Schwarz-Weiß-Filmen kennt.
Früher hatte Babbo (so sagt man auf Italienisch für Papa) irgendwie auch ganz gut ausgesehen und Mama konnte sich damals wohl kaum zwischen ihm und seinem gleichaltrigen Cousin Federico entscheiden. Denn Federico war auch nicht gerade hässlich und würde immerhin einmal das Weingut erben, das neben der Villa Paradiso lag. Zwischen den beiden hatte es angeblich ein paar heftige Eifersuchtsszenen wegen Mama gegeben. Aber das war Jahre her.
Die Fenster standen weit auf, man konnte das Wasser im Pool aufspritzen und anschließend auf die Terrakottafliesen regnen hören. Einer von den kleinen Jungs aus Zimmer Margarete hatte offenbar eine Arschbombe gemacht. Ich mochte die Geräusche des Hotels, am Tag und auch bei Nacht, doch den Rauch von Papas Zigaretten fand ich ätzend.
»Wir müssen mit ihr reden, Roberto«, sagte Mama gerade auf Italienisch und legte die Papiere vor ihm auf den Küchentisch. Er schaute gar nicht darauf.
»Mit der Alten reden? Haben wir doch schon versucht. Seit Jahren«, antwortete er. Natürlich auch auf Italienisch. Mein Vater konnte nur Italienisch, noch nicht mal Englisch. Und Deutsch natürlich auch nicht außer: danke, gute Tag, auf Wiedersähe …
Er warf den Nacken zurück, kippte sich den Rest seines Espressos in den Mund und schnalzte mehrmals mit der Zunge, als ob er den Kaffeegeschmack auskosten wollte. »Das hat Federico eingefädelt, da kannst du Gift drauf nehmen! Bestimmt hat der diesen Franco, diesen kleinkarierten Anwalt, auf uns angesetzt.«
»Ja, natürlich. Der Brief kommt doch von ihm! Von Franco!« Mamas Stimme klang gereizt.
Nun wusste ich auch, worum es ging. Meine Großtante Simonetta hatte ihre Drohung wahr gemacht und uns verklagt. Sie forderte einen Haufen Geld, weil die Villa Paradiso, als meine Oma sie damals 1970 bekam, noch umgebaut und restauriert wurde, das Weingut, das Großtante Simonetta nach ihrer Heirat überschrieben wurde, aber nicht. Dabei war das große Gut mit seinen Weinfeldern und den Kellern, in denen der elbanische Rotwein, der Elba Rosso, in großen Holzfässern lagerte, bestimmt mehr wert als die Villa. Als ich klein war und mein Cousin Raffaele noch nebenan wohnte, sind wir dort unten manchmal Hand in Hand durch die schummrigen Gänge geschlichen. Den köstlichen Geruch nach Holz und vergorenen Trauben werde ich nie vergessen. Und auch nicht das große Zimmer, in dem das Zeichenbrett seines Vaters stand, an das es mich so unwiderruflich zog.
Doch Raffaele war mit seinen Eltern nach Rom gezogen, weil sein Vater Federico es nicht mehr mit der schlecht gelaunten Simonetta ausgehalten hatte und nun dort als Architekt arbeitete. Die Simonetta, die endlich ihr Geld ausbezahlt haben wollte. Nonna Rosanna hatte es zeit ihres Lebens nicht geschafft, sich mit ihrer Schwester zu einigen.
Meine Mutter ließ sich seufzend auf einen der Küchenstühle sinken. Unsere Küche ist eigentlich ganz gemütlich, im Sommer benutzen wir sie allerdings kaum, weil wir alle immer nur unten im Hotel sind.
»Wie sollen wir das denn bloß machen?«, klagte sie. »In zwei Jahren wird Felicia auf die Hotelfachschule gehen. Das kostet ja auch wieder … Rosannas Erbteil für sie reicht dafür nicht.«
Oh ja, ich war die Tochter, deren Ausbildung so viel Geld verschlang. Aber Babbo antwortete nur mit einem Nicken.
»Geht es dir denn besser?«, fragte meine Mutter ihn.
Ich merkte, wie sich meine Augenbrauen vor Verwunderung hoben. Was war los? Das waren ja richtig sanfte Töne, die sie plötzlich anschlug. Es klang besorgt, wenn nicht sogar ängstlich. Mein Vater hatte vor Wochen eine Grippe gehabt und sich nur ganz langsam davon erholt. Am Ende hatte er sogar Antibiotika nehmen müssen, hatte meine Mutter mir am Telefon erzählt. Gott sei Dank war ich zu der Zeit noch in der Schweiz, denn krank war mein Vater noch schwerer zu ertragen als sonst. Ich hatte gedacht, er wäre endlich wieder gesund.
»Nix ist besser geworden! Es ist ein Elend«, lamentierte er. »Wer holt sich denn auch eine verdammte Grippe im Mai?«
Er schaute Mama an, als ob sie schuld an seiner Krankheit wäre.
»Und was willst du jetzt machen? Was sagt Dottore Farinelli? Kommt das denn jemals wieder? Du kannst doch nicht ohne …«
»Ach, was weiß denn ich!«, unterbrach mein Vater sie. Er stützte seine Stirn in beide Hände, seine Haartolle fiel ihm ins Gesicht und er sah mit einem Mal richtig verzweifelt aus.
»Was kommt jemals wieder? Die Grippe?«, fragte ich. Beide schauten erstaunt auf. Offenbar bemerkten sie erst in diesem Moment, dass ich neben dem Kühlschrank stand.
»Nichts.« Mama winkte hastig ab. »Was machst du denn überhaupt hier oben? Ist der Empfang jetzt etwa unbesetzt, oder was?«
Noch über fünf Wochen, dachte ich, dann erst darf ich wieder nach Bern. Prompt hatte ich ein schlechtes Gewissen.
»Scusate«, entschuldigte ich mich, drehte mich um und wollte schon gehen, da tobte mein Vater gegen meine Mutter los: »Aha! Das bezeichnest du also als nichts?«
»Ich dachte, sie müsste es ja nicht unbedingt wissen«, protestierte Mama. »Vielleicht kommt es ja auch von alleine zurück …« Ich wandte mich ihnen wieder zu. Meine Mutter verdrehte die Augen, aber das konnte mein Vater nicht sehen.
»Ma sì!«, tobte er auf Italienisch los. »Oh doch! Irgendwann muss sie ja erfahren, dass ihr Vater es nicht schafft, einen starken Espresso von einer dünnen deutschen Kaffeebrühe zu unterscheiden! Nichts mehr da, meine Nase tut’s nicht mehr!« Er setzte die kleine Tasse hart auf dem Unterteller ab und starrte uns wütend an. Ich stand ganz still.
Er konnte nichts mehr riechen? Wie wollte er dann noch kochen? Aber da beantwortete er die Frage schon selbst: »Ich kann schließen! Kann sofort zumachen! Ich war mal in der Lage, ein fruchtiges Olivenöl aus Apulien von einem aus Ligurien zu unterscheiden … Und jetzt? Schmeckt alles gleich! Spinatravioli oder Mangoldfüllung? Keine Ahnung.« Seine Stimme war immer lauter geworden. Nun brüllte er: »Ich kann weder riechen noch schmecken! Ich bin erledigt!«
»Manchmal kommt der Geruchssinn auch wieder«, sagte meine Mutter. »Im Internet habe ich gelesen, dass …«
Oh! Es war ein Fehler, das Internet zu erwähnen. Mein Vater hasste das Internet, er misstraute ihm und allem, was man darin finden konnte. Sofort legte er wieder los: »Das glaube ich, dass man da solchen Mist lesen kann …«
Schnell drehte ich mich um, schloss leise die Wohnungstür hinter mir und rannte die Treppe hinunter. Kein Wunder, dass die beiden so gestresst waren. Erst verlor mein Vater seinen Geruchssinn und nun kam Großtante Simonetta auch noch mit diesem Anwalt und wollte so viel Geld!
Besser, besser, besser!, sagte ich mir bei jeder Stufe. Felicia, du musst besser werden, viel besser!, murmelte ich in Gedanken bei jedem Schritt und flüchtete hinter die Rezeption. Ich würde ab jetzt noch besser mitarbeiten, weniger egoistisch sein und mich verantwortungsvoller benehmen, um meine Eltern zu entlasten. Die Villa Paradiso war ihnen doch so wichtig! Und außerdem war sie mein Zuhause.
»Ich schwöre«, sagte ich leise vor mich, »ich schwöre bei …« Auf was sollte ich schwören? »Bei meinem Leben!« Auf was sonst?
Also los! Anstatt die Wochen zu zählen, würde ich eine Lösung finden, wie man die Villa Paradiso vor den Klauen der Tante bewahren konnte, um uns alle irgendwie zu retten. Wie ich das anstellen sollte, wusste ich allerdings noch nicht und in diesem Moment konnte ich mich auch nicht darauf konzentrieren, denn unsere neue Hausdame Lucia kam an die Rezeption. Sie war mittelalt, hatte rot gefärbte dünne Haare und immer zwei steile Falten zwischen den Augen.
»In Zimmer Marianna ist der Putz von der Decke gefallen«, nuschelte sie mit toskanischem Akzent. »Was für einen Dreck das immer macht!« Sie knallte das Klemmbrett mit der Zimmerliste auf den Tresen. »In Concetta gehen beide Nachttischlampen nicht, der Gast hat mir einen Zettel geschrieben, und in Livia ist der Vorhang an der Seite aus der Schiene gerissen. Da komme ich ohne Leiter nicht dran.« Sie klang müde, dabei war sie erst seit zwei Wochen bei uns. Irgendwie hatten wir in letzter Zeit auch mit den Hausdamen Pech, sie blieben nie lange.
»Ich gehe in die Wäschekammer. Zählen, was die Wäscherei gebracht hat.« Lucias Gesicht nach zu urteilen, hatte sie keine Lust dazu.
Ich lächelte sie trotzdem an. Mein Schwur war erhört worden: Hier war meine erste Chance, meinen Eltern zu beweisen, dass sie sich auf mich verlassen konnten: »Ich sage Maurizio wegen des Vorhangs und der anderen Sachen Bescheid.« Ich sah mich um. Der Hausdiener war immer noch nicht zu sehen. Wahrscheinlich saß er irgendwo und spielte auf seinem Handy. »Ach so, und für Suite Manuela brauchen wir ein Extra. Können Sie das aus der Küche holen?« Ich siezte die Hausdame, ich kannte sie ja nicht und würde sie in den nächsten sechs Wochen auch kaum kennenlernen.
»Weiß nicht, wo der Sekt für die Extras steht«, knurrte sie. »Dein Vater hat mich äußerst unfreundlich angefahren, als ich neulich in der Küche danach suchte.«
»Ich mache es selber. Kein Problem.« Sie hatte recht, Babbo war seine Küche heilig. Er mochte es nicht, wenn fremde Menschen, und sei es auch nur unsere Hausdame, darin herumliefen. Aber das ist doch schon die nächste Chance für mich, alles besonders gut zu machen, dachte ich, während ich die Handynummer des Hausdieners suchte.
In der nächsten Sekunde hörte ich draußen auf dem Parkplatz den Kies unter Rädern knirschen, kurz darauf das dumpfe Knallen von Türen und einer Kofferraumklappe. Neue Gäste? Alte Gäste? Auf jeden Fall Gäste, um die ich mich richtig gut kümmern würde! Mama sollte endlich mal zufrieden mit mir sein. Ich straffte die Schultern, setzte mein Empfangslächeln auf und strich noch einmal die Bluse glatt, die beim Laufen etwas aus dem Rock gerutscht war … da kam er auch schon hinein …!
Der wahrscheinlich schönste Mann, den ich je in meinem Leben gesehen hatte. Er schleppte zwei Reisetaschen und hatte einen Rucksack auf den Schultern. Kein Problem für ihn – bei diesen Armen, die in dem ärmellosen T-Shirt sichtbar waren. Mein Blick glitt an ihnen auf und ab. Und was für schöne Haut er hatte. Leicht gebräunt, wie Kaffee mit einem Schuss Milch.
Ähm. War das rassistisch, so was zu denken? O Dio … Um ihn nicht weiter anzustarren, schaute ich seiner Frau ins Gesicht und lächelte. Sie war nicht besonders groß, trug einen auffällig bunten Turban auf dem Kopf und ihre helle Haut war extrem blass. Sie sah richtig erschöpft aus und hatte nichts in der Hand, nicht einmal eine Handtasche. Sie ist die Krüger, er der Kingston von Krüger-Kingston, ganz bestimmt, dachte ich. Und auch: Mist! Die Hausdame hat Suite Manuela noch nicht freigegeben und das Extra fehlt. Das alles sagte ich natürlich nicht, sondern: »Benvenuti!« Deutsche mögen es, wenn sie auf Italienisch begrüßt werden.
Der Typ lachte mich von der Seite an. Er war verdammt jung, mein Gott, war ich blöd, der konnte gar nicht ihr Mann sein. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und warf erneut einen kurzen Blick auf ihn. Madonna mia! Ich landete voll in seinen Augen, aber was für Augen! Sie schauten mich direkt an und sahen doch gleichzeitig so entrückt aus, als ob sie tief in mir gerade etwas Nie-Gesehenes, Wunderschönes entdeckten.
»Hi! Für uns müsste ein Zimmer reserviert sein. Auf Marlene Krüger-Kingston. Sie hat das Preisausschreiben bei euch gewonnen. Also gebt ihr bitte was Gutes, okay? Ach so, sorry, sprichst du überhaupt Deutsch?«
»Ja.« Ich lächelte einen Tick zu lange und brachte vor lauter Verlegenheit kein weiteres Wort mehr hervor, sondern kramte schnell nach dem Block mit den Anmeldezetteln und machte zwei Kreuzchen darauf, so wie meine Mutter es mir gezeigt hatte: »Dann bräuchte ich erst einmal einen Pass oder einen Personalausweis und hier tragen Sie bitte Ihre Anschrift und die Stadt ein und da, bei dem zweiten Kreuz, brauche ich noch eine Unterschrift. Haben Sie eine Kreditkarte? Von der würden dann die Minibar und alle weiteren Serviceleistungen abgebucht werden. Übernachtung und Frühstück wird bei Ihnen ja übernommen.« Ich spulte nervös meine Sprüche herunter, erklärte, wann es Frühstück gab, redete über die Öffnungszeiten des Restaurants und der kleinen Bar, die abends ab sechs Uhr einen aperitivo und Getränke für unsere Gäste bereithielt. Ich lachte nervös und beschimpfte mich im Stillen, weil ich mich so künstlich anhörte und ihn einfach nicht anschauen konnte. Stattdessen heftete ich meinen Blick auf das durchscheinende herzförmige Gesicht von Marlene Krüger unter ihrem afrikanisch anmutenden Turban. Endlich war ich fertig mit der Begrüßungsrede, die ich schon so oft von Mama, aber viel schöner von Nonna gehört hatte. »Und herzlichen Glückwunsch noch mal! Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt bei uns im Paradiso!« Ich legte die Hände auf den Rücken, weil ich nicht wusste, wohin sonst mit ihnen.
»Stehst du abends auch manchmal hinter der Bar?«
Er duzte mich schon wieder. Für dich schon!, wollte ich am liebsten antworten, sagte aber: »Eher nicht. Nur, wenn unser Barkeeper mal ausfällt …« Oder er seinen Dienst verschläft. Oder zu betrunken ist, um zur Arbeit zu erscheinen. Ich versuchte, geheimnisvoll zu lächeln. Wahrscheinlich sah es eher verzweifelt aus.
»Jacques!« Die Turbanfrau klang wehleidig.
»Komme ja schon, Mama! Entspann dich, ab jetzt kannst du chillen.« Er schnappte sich wieder die beiden Taschen.
Mama! Natürlich, er war der Sohn! Der hübscheste, lässigste Sohn, der je das Paradiso betreten hatte. Ich sah auf den ausgefüllten Anmeldezettel. Sie lebten in Hamburg! Die Stadt, aus der meine Mutter kam. Ich war früher oft mit ihr dort gewesen – meistens im Winter, wenn unsere Villa für Gäste geschlossen war –, um ihre Familie zu besuchen. In Hamburg war es kalt, die Leute schauten einander nicht an und es regnete immer. Aber der Hafen war riesig und schön! Was wollte mir dieser Zufall sagen? Schicksal?
Nun reiß dich mal zusammen! Hast du nicht etwas vergessen? Auch wenn Mama nicht in ihrem Kämmerchen saß, hörte ich ihre Kommentare.
»Ach, Entschuldigung, hier!« Ich nahm den Schlüssel mit dem massiven Metallanhänger aus dem Fach. »Sie wohnen bei uns in der Suite Manuela. Die liegt im Nebengebäude. Durch die Tür da vorne in den Garten und dann den kleinen Weg mit den Steinplatten entlang. Soll ich unseren Hausdiener Maurizio für das Gepäck holen?«
»Nö, danke. Nicht nötig.« Er nahm den Schlüssel und grinste mich an. Schnell schaute ich weg, auf seine Hände. Sie waren groß, natürlich auch so braun wie der Rest von ihm und hatten gepflegte helle Nägel.
Jetzt warf er den Schlüssel hoch: »Manuela. Gott, was für ein Name für ein Zimmer!«
»Jacques!« Diesmal ermahnend.
»Meine Oma hat sie so benannt«, beeilte ich mich zu sagen. »Das ist unsere schönste Suite, sie hat sogar eine kleine Terrasse.« Ich wollte, dass er blieb, ich wollte, dass er die Villa Paradiso toll fand – und, ja, mich sollte er auch toll finden.
Ich sah den beiden hinterher, bis mir das fehlende Extra einfiel. O Dio. Und was, wenn Manuela noch gar nicht fertig war? Warum hatte ich die Krüger-Kingstons nicht aufgefordert, noch zehn Minuten in den gemütlichen Sofas der Lobby zu warten, und in der Zeit die Suite gecheckt? Ich würde das sofort in Ordnung bringen, bevor Mama etwas merkte. Und sie würde es merken, so viel war sicher.
Ich rannte durch die Lobby und die Stufen hinab in die Restaurantküche, die bei uns halb im Keller lag. Die Sonne fiel durch eine Reihe schmaler Oberlichter und es roch lecker nach Zitronen, einem Hauch Knoblauch und Essigreiniger. Niemand war zu sehen. Der Frühstücksservice war für heute fertig, die Abendschicht hatte noch nicht angefangen. Ich holte eine kleine Honigmelone, Bananen, Erdbeeren und ein paar reife Aprikosen aus dem Kühlhaus und arrangierte alles in einem weißen Porzellankorb. Für Jacques! Zwei Teller, Obstmesser, kleine Gabeln und zwei Stoffservietten dazu. Früher hatte ich Nonna immer gerne begleitet, wenn sie durch die Zimmer ging, sie auf Sauberkeit prüfte und manchmal für besonders wichtige Gäste eben auch Obstkörbe verteilte. Jetzt noch den Sekt, zwei Gläser und einen silbernen Kühler auf das Tablett. Ich stellte mir vor, wie ich mit Jacques die Gläser aneinanderklingen ließ, während er mir noch mal so tief in die Augen schaute wie eben … und trug alles nach oben.
Im Garten schlug ich den Weg zu dem Gebäude ein, das wir Casa nannten, um es von der Villa zu unterscheiden. Es war warm. Am Pool waren fast alle Liegen besetzt. Die Gäste lasen oder schliefen unter eckigen Schirmen und ihren Sonnenhüten. Die Arschbomben-Jungs waren verschwunden, vermutlich standen sie bei der Tischtennisplatte, denn von dort hörte man Kinderstimmen und das Klacken eines Balles. Sonst war es still, nur Nonnos Bienen summten im Lavendel und das Wasser schwappte leicht in die Überlaufrinne. Ich wusste genau, wann ich das letzte Mal Zeit gehabt hatte, in diesem Pool zu schwimmen: vor drei Jahren, als ich noch auf Elba zur Schule ging und zwei Mädchen aus meiner Klasse eingeladen hatte. Eine von beiden hatte ihre kleinen Geschwister mitgebracht und Babbo kam raus und schimpfte, wir wären zu laut und würden die Gäste stören. Er hatte uns weggeschickt.
Keine fremden Personen, wenn Gäste da waren! Kein Lärm. Nicht einmal in meinem Zimmer durfte ich laut Musik hören. Aber er hatte ja recht, wir waren ein Hotel. Ein Hotel war ein Ort, wo andere Leute sich erholen sollten. Ich hatte nie wieder jemanden mitgebracht.
Ich war beim Casa angekommen, einem lang gezogenen einstöckigem Gebäude aus Naturstein, das drei Suiten und sechs normale Zimmer beherbergte und sich zwischen Pinien, Oleanderbüschen und Blumenbeeten perfekt in den Garten einfügte. Onkel Federico hatte es entworfen, damals, als er noch auf dem Weingut wohnte. Ich zeichnete die Linien im Geiste nach, als ob ich das Gebäude später aus dem Gedächtnis auf Papier bringen müsste. Ein kleiner Tick von mir.
Jede Suite hatte eine Veranda vor der Eingangstür und nach hinten gab es eine Terrasse. Die Zimmer im ersten Stock waren kleiner, hatten aber alle einen Balkon, auf den am Nachmittag die Sonne schien. Mein Herz fing ganz albern an zu klopfen. Gleich würde ich ihn wiedersehen. Jacques. Was für ein schöner Name … Jacques.
Ich hielt die Luft an und klopfte. Da war er auch schon an der Tür. »Hey. Cool! Mum? Wir bekommen Sekt!«
Seine dunklen Augen machten mich noch nervöser, als ich schon war, also spähte ich an ihm vorbei in die Suite hinein. Alle Zimmer waren bei uns unterschiedlich eingerichtet, doch in Manuela waren die Möbel besonders schön. Die Vorhänge vor dem Fenster und der Terrassentür leuchteten in hellem Blau. Das Doppelbett war schmiedeeisern und mit weißer Wäsche frisch bezogen, die Nachttischchen waren antik, mit grauen Marmorplatten darauf. Seine Mutter war nicht zu sehen.
»Darf ich?« Er griff nach dem Tablett.
»Nein, ich würde gerne …« Beide zogen wir daran und lachten.
»Ich hab’s schon vermasselt, das alles sollte längst auf dem Tisch stehen …!«
»Kein Ding. Komm rein! Mum ist im Bad.«
»Grazie!« Ich huschte in den Nebenraum, stellte das Tablett auf dem Tischchen vor dem Sofa ab und dekorierte Kühler, Korb und Teller so, wie Nonna Rosanna es mir gezeigt hatte. Um mich herum lag das Gepäck verstreut. Da Jacques gerade nicht schaute, richtete ich die Vorhänge noch ein wenig und fuhr mit der Spitze meines Zeigefingers heimlich über den goldenen Rahmen des Wandspiegels. Auch das hatte Nonna Rosanna immer gemacht. Nichts. Kein Staub. Ich nickte zufrieden, schnappte das Tablett und ging schnell zur Tür.
»Danke! Muss ich dir jetzt Trinkgeld geben, oder was?« Er stand neben dem Bett, die Hände in den hinteren Hosentaschen, und grinste sehr süß.
Ich schüttelte den Kopf, zu blöd und zu schüchtern, um noch was zu sagen. Keine fünf Sekunden und schon hatte ich mich in diesen Jacques mit der Kaffee-und-Sahne-Haut und den dunklen Dreadlocks verliebt! Vielleicht bedeutete das ja was, dachte ich. Weswegen war er sonst gerade jetzt in der Villa Paradiso und in meinem Leben gelandet?
2 Catta
Ich atmete die salzige Luft ein und legte Arme und Kinn auf die Reling, tief unter uns strudelte das Wasser an der Schiffswand der Fähre. Wahnsinn, wie schön, wie megaschön dieses Elba da vor uns in der Ferne lag! Es schien nur aus Bergen und hügeligen Wäldern zu bestehen. Die Sonne knallte vom Himmel und das endlose Wasser um uns war sattblau. Erst jetzt merkte ich, dass die monatelange Traurigkeit mein Herz mehrfach und immer wieder umwickelt und verschnürt gehalten hatte wie ein borstiger Strick. Mum war zweimal fast gestorben und konnte immer noch sterben und deswegen hatte ich auf meiner E-Geige in letzter Zeit gar nichts anderes spielen können als melancholische Stücke. Aber nun, bei diesem Ausblick auf die Insel und das Meer, kam plötzlich Elements in mir hoch. In der Version von Lindsey Stirling. Es war so kraftvoll und dramatisch und voller Leben und mit einem Mal war ich so glücklich, dass mir die Tränen kamen … Ich wusste, dass diese Insel dort vor mir der Platz sein würde, an dem ich endlich nicht mehr nur für mich und meinen Geigenlehrer spielen würde, sondern vor Publikum! Auf einer Piazza, an jeder Straßenecke. Und Mum würde es besser gehen und sie würde es sehen und stolz auf mich sein …
In diesem Moment zog Émile an meinem kurzen Rock und wollte hochgehoben werden. Er war zu klein, er sah nichts. Eliese machte es ihm auf der anderen Seite sofort nach und nun waren es vier Kinderfäuste, die sich an mich klammerten. Ich wischte mir über die Augen und schaute mich um, wo war Otto? Da kam er schon mit einem Tablett voller Sandwiches und Limonadendosen.
»Guck mal, was Otto da hat!«, sagte ich zu Eliese, während ich Émile hochhob und ihm die weißen Schaumkronen auf dem Wasser zeigte. »Limonade!« Eliese ließ meinen Rock los und rannte auf Otto zu.
Otto war cool. Er war seit sechs Jahren mit meiner Mum zusammen und für mich der beste Ersatzvater, den ich mir vorstellen konnte.
»… und weißes Brot und gar nichts Gesundes!«, hörten wir von Eliese.
»Catta, Catta, ich will auch Limo und nichts Gesundes!« Émile strampelte mit den Beinen, ich ließ ihn herunter. Gut, dass wir beim Hip-Hop auch immer Liegestütze machen, mit seinen fünf Jahren war er echt schon ziemlich schwer. Immer wenn Mama sich ein bisschen besser fühlte, war ich wieder zum Training gegangen. Aber nur dann. Es ist dir einfach nicht nach gut gelauntem Herumspringen, wenn deine Mutter schlechte Nachrichten bekommen hat und zitternd auf die Ergebnisse der nächsten Untersuchung wartet. Du willst dann einfach nur noch bei ihr sein. Du hast keine Zeit mehr für deine Freundinnen, deinen Sport, für Sachen wie den Führerschein oder Jungs. Und es ist dir auch egal.
Langsam drehte ich mich um und schlenderte auf die Bank zu, auf der Otto unsere kleine Vor-Elba-Mahlzeit aufgebaut hatte. Seit drei Tagen waren wir mit dem alten VW Bulli, der unter uns im Bauch der Fähre mitfuhr, unterwegs. Als Mama noch gesund war und die Zwillinge noch echt klein, waren wir damit nach Südfrankreich gefahren. Jacques und ich hatten oben im Dach geschlafen, das man hochklappen konnte. Es war dort drin so gemütlich, ich liebte unseren Bulli.
»Ich bin so gespannt auf das Hotel«, sagte ich. »Jacques meinte ja, es sei toll und Mama sei es in den vergangenen zwei Tagen schon viel besser gegangen!«
»Obwohl sie bis jetzt nur geschlafen hat! Und noch nicht mal im Pool gewesen ist.« Émile biss herzhaft in eine der dreieckigen Toastbrotscheiben, eine dünne Scheibe Ei fiel dabei auf die Bank. »Darf ich das noch essen oder sind da jetzt Baktaterien dran?«
»Nein, da sind keine Bakterien dran«, sagte Otto. »Und Mum schläft sich einfach gesund!«
Émile klatschte das Ei glücklich wieder auf seinen Toast. Ich versuchte immer, Mamas Krankheit so wenig schlimm wie möglich erscheinen zu lassen. Otto half mir dabei.
»Wie heißt das ungesunde Brot? Das schmeckt lecker.« Fünfjährige fragen den ganzen Tag. Auch wenn sie den Mund total voll haben.
»Das nennt man tramezzini.«
»Gut, dass wenigstens du Italienisch kannst, Catta«, sagte Otto und klopfte mir leicht auf die Schulter. »Dadurch ist alles einfacher.«
Otto war der leibliche Vater von Émile und Eliese und er sah einfach nur … nett aus, ich wüsste nicht, wie ich ihn sonst beschreiben sollte. Er war nicht besonders groß, aber auch nicht klein, eher so mittel, er hatte dunkelbraune Haare, aber davon auch nicht besonders viele. Es war nichts Auffälliges an ihm, nur ein kleiner tätowierter Drache unter dem rechten Arm, den man bei ihm echt nicht erwartete, den man normalerweise aber auch nicht sah. Er sagte nicht viel, schrieb dafür viele Bücher über Politik und die allgemeinen Zustände, manchmal sogar über vergiftetes Essen oder ob Schule dumm macht, und hielt Vorträge darüber. Auch in Amerika. Trotzdem sah er immer, was jeder von uns brauchte. Vor allen Dingen Mum. Wo sie doch so lange so krank war.
»Ich will später auch auf die Italienische Schule gehen. Wie Catta«, sagte Eliese.
»Da musst du aber auch auf Italienisch rechnen lernen«, erinnerte ich sie. »Da musst du alles auf Italienisch machen.« In der Grundschule war ich unzertrennlich gewesen mit meiner Freundin Viviana, die aus den Dolomiten kam und natürlich nach der Vierten auf die Italienische Schule geschickt wurde. Ich wollte unbedingt mit, aber ich wollte auch auf den Musikzweig von Jacques’ Gymnasium. Mein richtiger Vater war Musiker gewesen und Mum hatte ihn sehr geliebt. Klar, dass auch ihre Kinder Musik machen sollten! Sie meldete mich für die Aufnahmeprüfung an, aber ich war zu nervös und schaffte es nicht. Ich war schon damals nicht in der Lage, vor fremden Leuten zu spielen. Also ging ich mit Viviana auf die Italienische Gesamtschule Francesco Petrarca. Was okay war. Viviana war noch heute meine beste Freundin.
»Egal.« Eliese hielt mir ihre Tomatenscheibe hin, obwohl sie wusste, dass ich rohe Tomaten hasste. »Dann kaufe ich uns ganz alleine die Tickets für die Fähre und dann sage ich dem Mann auf dem Campingplatz, dass wir nicht kalt duschen wollen!«
»Dürfen wir im Hotel auch in den Pool, Dad?« Auch Émile hielt mir seine Tomatenscheibe hin. Manchmal fühlte man sich mit den beiden echt wie der letzte Müllschlucker.
»Nein. Na ja, vielleicht. Ich weiß nicht, wie die das da handhaben. Marlene muss sich immer noch ausruhen, aber wir gehen zum Baden ans Meer und machen ganz viele schöne Sachen!«
»Wir sind ja nicht im Hotel wie Mum und Otto«, sagte ich und bedeckte die Tomatenscheibe mit meiner Serviette, um sie nicht sehen zu müssen. »Wir sind auf dem Campingplatz.«
»Mit Jacques!«, riefen die Zwillinge im Chor. Jacques war ihr absoluter Liebling, vor allen Dingen weil er jetzt nicht mehr so oft zu Hause war, seitdem er in Amsterdam Musik studierte. Ich kümmerte mich jeden Tag um die beiden, brachte sie noch vor der Schule in den Kindergarten oder abends ins Bett, wenn Otto unterwegs war und es Mum wieder schlechter ging. Mich nahmen sie als ganz normal hin und waren manchmal echt zickig oder schlecht gelaunt. Aber wenn Jacques da war, war alles toll, was er machte, und sie hörten viel besser auf ihn als auf mich. Falls er ihnen mal was verbot …
Otto öffnete die Getränkedosen und goss vier Becher voll, auf denen ein blauer Wal abgebildet war.
»So viele Dosen und so viel Plastik!«, sagte Eliese kopfschüttelnd.
»Plastik ist scheiße, Otto!«, sagte jetzt auch Émile.
Ich grinste. Die Erziehung meiner Mutter war nicht spurlos an den Zwillingen vorbeigegangen.
»Ich weiß, aber Strohhalme hatten sie nicht. Besser gesagt, ich wusste nicht, was Strohhalm auf Italienisch heißt.« Otto war immer ehrlich. Er konnte gar nicht anders.
»Du hättest Catta schicken sollen. Sie weiß alles«, sagte Eliese so vorwurfsvoll, dass Otto und ich lachen mussten. Es ist echt schön, so zu lachen, dachte ich und merkte, wie der Strick um mein Herz sich noch ein bisschen mehr lockerte.
Die Fähre stampfte vor sich hin. Elba kam näher, es roch nach Meer und nach Ruß und auf einem der oberen Decks fütterte jemand die Möwen, indem er seine Hand mit einem Keks darin nach oben hielt. Fasziniert sahen wir dabei zu, wie einer der Vögel immer wieder gegen den Wind versuchte, den Keks aus seiner Hand zu nehmen, während die anderen ziellos um ihn herumflatterten. Irgendwann gelang es dem Tier und es ließ sich zur Seite fallen und vom Wind hinwegtragen. Die Zwillinge klatschten in die Hände und wieder war da die Geigenmusik und ich fühlte, wie eine weitere Welle des Glücks sich in mir ausbreitete. Ich küsste die beiden kurz auf den Kopf und sandte zwei Wunsch-Sätze in den blauen Himmel und an das Universum: Lass Mama wieder richtig gesund werden und so glücklich sein, wie ich es gerade bin, bitte! Und lass mich die Aufnahmeprüfung in Amsterdam schaffen, damit sie stolz auf mich ist!
Eine Frauenzeitschrift war schuld, dass wir von diesem Fährschiff mit dem süßen Namen Moby Baby hinüber nach Elba getragen wurden. Ein fettes Preisausschreiben in der Carina, in der ich im Wartezimmer bei Mamas Ärztin gelesen hatte. Die Seite heimlich herauszureißen, war einfach gewesen, eine Postkarte los- und einen Wunsch hinterherzuschicken auch. Ich hatte die ganze Sache sofort wieder vergessen, und als Monate später der Anruf kam, dachte ich zunächst, die wollten mich verarschen. Aber es stimmte: Ich hatte zwei Wochen in einem tollen Hotel auf Elba gewonnen. Natürlich für Mum. Niemals für mich.
Höchstens noch für Otto, damit er sich mit ihr zusammen erholen konnte, von diesem Scheiß-Krebs, mit dem sie jetzt schon zwei Jahre zu tun hatte. Dieser unnötige Krebs, der ihr erst die schönen kastanienbraunen Haare, dann ihre Kraft, morgens überhaupt aufzustehen, und zu allerletzt die Lust am Malen genommen hatte. Auch wenn sie nach der Chemo total schlapp war und richtig elend aussah – in ihrem Atelier ging es ihr bis vor einem halben Jahr immer noch gut. Sie saß dann in Decken gewickelt in einem Sessel zwischen dem Chaos aus Werkzeug, Farbtuben und Spraydosen auf den Arbeitstischen, starrte die fertigen und unfertigen Bilder an der Wand an und war einigermaßen glücklich. »Ich werde wieder malen!«, sagte sie immer wieder. Sie malte große Bilder mit Tellern und Kopfkissen darauf und mit Graffiti und Sprüchen. Mir gefielen sie. Und den Leuten auch. Sie verkaufte ziemlich gut. Hatte verkauft. Denn nun arbeitete sie ja nicht mehr.
Irgendwann nach der zweiten OP und der Bestrahlung wollte sie dann nicht einmal mehr von Otto ins Atelier getragen werden. Das war am schlimmsten. Verdammt, jetzt hat sie wirklich aufgegeben, meinte damals auch Jacques. Als ich in diesem Moment auf der Fähre daran dachte, fing ich schon wieder an zu weinen und ich musste mir heimlich das Gesicht abwischen, ohne dass die Zwillinge etwas davon merkten. Ich war eine Meisterin im Tränen-Verbergen.
Mum war lange in der Reha gewesen. Und dann wieder zu Hause bei uns. Aber so leer im Gesicht. Und das bei meiner Mutter, die immer eine Idee hatte, der immer etwas Verrücktes einfiel …
»Gehen wir gleich ins Bällebad?«, fragte Émile.
»Oh ja, wir gehen in den Käfig!« Eliese stand auf, um auf Ottos Knien herumzutrommeln, und ich tauchte aus meinen Krebs-Gedanken auf.
Es ist toll, wie leicht Fünfjährige glücklich zu machen sind.
Fünfjährigen wird aber auch leicht mal schlecht. Nachdem Otto mit dem Bulli von der Fähre gerollt und wir eingestiegen waren, ging es weg vom Hafen, raus aus der Hauptstadt Portoferraio und schon bald auf kurvigen Straßen hoch in die Berge, die ich vom Meer aus gesehen hatte. Eine Kurve folgte der anderen, bis wir oben waren und dann, genauso kurvig, hinunterfuhren. Ich kletterte vom Vordersitz nach hinten, holte zwei Plastikschüsseln aus dem Schrank und verteilte sie an die Zwillinge. Otto fuhr langsamer, damit es nicht so sehr schaukelte, aber hinter uns sammelte sich eine lange Autoschlange und irgendwie mussten wir ja weiterkommen. Selbst der wahnsinnig tolle Blick auf das Meer und eine Bucht mit weißem Strand und vielen kleinen Sonnenschirmen, den wir zwischendurch hatten, konnte sie nicht aufmuntern. Als wir an dem Ortsschild von Procchio vorbeigekommen waren, reiherte Eliese los. Reihern. So nannte Jacques das immer. Émile schloss sich an. Bei den beiden bekam man immer alles im Doppelpack. Es stank, wie Erbrochenes nun mal stinkt, und ich atmete durch den Mund, während ich meinen kleinen Geschwistern die Münder mit den Tüchern einer Küchenrolle abputzte, sie beruhigte und selber an eine schöne gerade Straße dachte.
Wir hielten auf einem Parkplatz im Ort. Otto schüttete den Inhalt der Schüsseln ins angrenzende Gebüsch, wofür ich ihm dankbar war, denn sonst hätte ich mich auch übergeben müssen, und als wir die beiden Kleinen endlich wieder im Auto hatten und weiterfahren konnten, merkte ich, dass ich nach Schweiß und Kotze roch, eine Dusche brauchte und überhaupt von der Fahrt ziemlich fertig war.
Weil an jeder Ecke blaue Pfeile mit den Ortsnamen hingen, wusste ich, dass wir Richtung Marina di Campo fuhren. Otto hatte voll den Plan von der Insel, auch ohne Navi. Beinahe wären wir trotzdem an dem Wegweiser Villa Paradiso vorbeigefahren. Otto bremste und wir bogen nach rechts in einen Weg. Al Paradiso stand auf dem Straßenschild. Zum Paradies.
»Schon wieder Kurven«, stöhnte Émile, als es leicht bergauf in die erste Rechtskurve ging.
»Wir sind gleich da, dann seht ihr Mum wieder«, sagte Otto.
»Und Jacques!«, erinnerte ich noch einmal, doch auch diese Aussicht konnte Émiles Magen nicht besänftigen … diesmal war ich nicht schnell genug, er traf die Schüssel nur halb und fing an zu weinen, als er sein vollgespucktes nacktes Bein betrachtete. Ich griff wieder zur Küchenrolle und wischte an ihm herum.
»Here we are!«, rief Otto Sekunden später. »Alle raus! Jetzt at men wir erst mal tief ein und dann suchen wir Mum!« Er sprang aus dem Wagen und öffnete uns die Schiebetür. Ich schnallte die Zwillinge ab, die wie kleine Gummibälle aus der Tür fielen, und taumelte hinter ihnen hinaus. Sofort vergaß ich allen Stress, sogar meine Dauertraurigkeit. Wenigstens für die nächsten Sekunden. Es war bellissima! Ich drehte mich einmal um mich selbst. Meravigliosa! Wenn man wie ich in der Schule jeden Tag Italienisch spricht, ist man auch nach einer Woche Ferien schnell wieder drin und es fallen einem ganz viele Wörter für »wunderschön«, »einfach zauberhaft« und »wunderbar« ein. Die Grillen zirpten, der warme Wind bewegte die Zweige der hohen Pinien und die Hortensien, die die Einfahrt und den schattigen Parkplatz einfassten, wetteiferten mit dem Oleander, wer die meisten rosa Blüten hatte.
Wir gingen auf den Eingang zu. Die Villa Paradiso war in einem leuchtend warmen Ockergelb gestrichen, wie viele Häuser in der Toskana, sie war zwei Stockwerke hoch und vor den Fenstern sah man grüne Gitterbalkone, an denen Geranien hingen. »Un paradiso davvero«, murmelte ich. Ein wahres Paradies … und das alles für …
»Wo ist Mum denn?«, rief Eliese weinerlich. … für Mum.
»Wir gehen rein und überraschen sie!«, sagte Otto, und nachdem Eliese versichert hatte, dass ihr nicht mehr schlecht sei, nahm er sie auf die Schulter. »Überraschen« stimmte nicht ganz. Sobald wir von der Fähre runter waren, hatte Otto Jacques angerufen und Bescheid gesagt.
»Sie wohnen im Garten. Wir sollen einfach in den Garten gehen und Suite Manuela suchen.«
Die schwere grüne Tür stand offen, wir marschierten hinein. Die Rezeption bestand aus einem alten, ehemals weißen Tresen. In einer silbernen Schale lagen zwei Zimmerschlüssel, daneben eine Klingel zum Draufhauen. Niemand war zu sehen, als ob das ganze Hotel ein spätes Nachmittagsschläfchen hielte.
»Vertrauen haben sie ja hier … keine Frage.« Otto schaute sich um.
»Guckt mal«, rief Eliese oben auf seinen Schultern, »das ist alles so groß und hoch hier, ich habe noch ganz viel Platz!«
Wir schauten zu ihr und an das Deckengewölbe, gingen an einigen leeren Sofas vorbei, einen Kamin und eine Bar gab es auch, und schon standen wir auf der Terrasse im Garten.
»Schau, Émile, hier gibt es kein Plastik!« Otto zeigte auf die schnörkeligen Eisenstühle und Tische, an denen ein paar Hotelgäste saßen. Alle lächelten, als wir an ihnen vorbeigingen. Das kannte ich schon. Émile und Eliese waren echte Knaller, schon als Babys hatten sie jede Menge dieser Oh-wie-süß-sind-die-denn!-Blicke abbekommen. Mit ihren hübschen Gesichtern und den langen braunen Haaren dachten viele Leute zunächst, sie wären zwei Mädchen. Émile störte das nicht.
Blicke bekam ich auch, aber aus anderen Gründen. Denn ich sah auch nicht schlecht aus, mit meiner etwas dunkleren Haut und den kurzen schwarzen Zöpfchen. Etwas klein vielleicht, aber ’ne Menge dran, sagte Jacques immer. Ich nahm die Blicke als Kompliment. Als was denn sonst? Aber da ich äußerlich so überhaupt nicht zu Émile und Eliese passte, hielt man mich oft nicht für ihre Halbschwester, sondern für das Au-pair-Mädchen oder so was in der Art, wenn ich alleine mit ihnen unterwegs war.
»Ich sehe schon den Pool, ich will in den Pool!«, rief Eliese von oben.
»Ich auch, weil: Ich rieche immer noch nach Kotze«, kam es von Émile.
»Du sollst nicht Ko…, du sollst Erbrochenes sagen!«, korrigierte Otto.
»Wir suchen Mums Zimmer und duschen dich vorher ab«, sagte ich und tauschte mit meinem Stiefvater einen Blick.
Er nickte. »Ich hole gleich deine Badehose aus dem Auto.«
Wir lotsten Émile am Pool vorbei und fanden Suite Manuela in dem Gebäude am Ende des Weges. Noch bevor wir anklopfen konnten, öffnete Jacques uns die Tür und legte den Finger auf die Lippen. »Sie schläft!« Die Zwillinge kreischten dennoch los und schmissen sich in seine Arme.
»Sind sie da? Wo sind meine Kinder?«, hörten wir hinter ihm und nun gab es kein Halten mehr und wir liefen hinein, warfen uns alle auf Mums Bett und drückten und knuddelten sie und mir kamen schon wieder die Tränen, aber das waren welche vor Glück.
Wie Jacques schon am Telefon gesagt hatte, war es kein Zimmer, sondern eher eine Suite. Mit einem extra Raum für ein Sofa, auf dem er, wie es aussah, seit zwei Tagen schlief, einem Fernseher und einer superschönen Terrasse, von der man weit in den Garten schauen konnte.
Während Otto die Badesachen der Kleinen aus dem Bulli holte und Eliese Mum alles über unsere Fahrt erzählte, zog ich Émile aus und steckte ihn unter die Dusche. In ein Handtuch gewickelt und nach Hotel-Duschgel duftend, setzte ich ihn dann zu Mum aufs Bett. Sie sah gut aus. Sie hatte zwei scharfe rote Flecken auf den Wangen, vermutlich nur, weil sie geschlafen hatte, aber ihre Augen lachten seit Langem wieder und auf ihrem kahlen Kopf begann sich tatsächlich ein erster rotbrauner Haarflaum zu bilden.
»Schafft ihr das denn auch?«, fragte sie immer wieder. Und jedes Mal versicherten Jacques und ich ihr, dass wir es schaffen würden.
»Ich bin immerhin fast zwanzig und Catta ist sechzehn, Mum«, sagte er. »Ich fahre absolut vorsichtig, wenn die beiden im Auto sind, und auf dem Campingplatz lassen wir sie nicht aus den Augen.«
»Na klar. Das wird ein cooles Abenteuer«, beteuerte ich. Hauptsache, sie machte sich keine Sorgen um uns. Sorgen konnte sie nicht gebrauchen! Wir hatten schließlich den Bulli und das große Zelt, den Gaskocher und das Kochgeschirr. Und ich hatte mit Otto richtig viel Proviant gekauft. Wie auf das Stichwort kam Otto wieder herein: »Ich nehme euch die Zwillinge auch so oft es geht ab. Dann könnt ihr in der Zeit machen, was ihr wollt! Ihr sollt ja auch ein bisschen Urlaub haben.«
Nun war es an Jacques und mir, uns anzuschauen. Er zwinkerte mir heimlich zu, und obwohl ein Schreck durch meinen Magen zuckte, liebte ich ihn dafür. Nicht nur die Zwillinge hatten ihn vermisst!
Jacques wollte keinen Strandurlaub. Er wollte etwas anderes: Straßenmusik mit mir machen. Du gehörst auf die Bühne, Catti, sagte er immer. Du bist eine Kingston! Klar, ich war eine Kingston, wie mein Vater, aber alle Gene hatte ich dann offenbar doch nicht von ihm bekommen, denn ich konnte zwar spielen, ja, ich liebte es, zu spielen und auch zu singen, hatte aber Schiss auf der Bühne. Auch wenn es nur ein Bürgersteig oder ein grüner Rasenhügel im Park war. Ich hatte so großes Lampenfieber, dass ich alles vergaß, vor Angst nicht mehr die Töne traf und meine tiefe volle Stimme schwach wurde und zitterte.
Aber Jacques glaubte an mich. Seine Gitarre, meine Elektro-Geige und die beiden kleinen Verstärker lagen im VW-Bus. Er wollte mit mir in den verschiedenen Orten der Insel auftreten und mir meine Angst nehmen. Du wirst dein Coming-out haben, hatte er mir vorgeschwärmt. Du wirst endlich kapieren, dass du das Zeug hast, in Amsterdam zu studieren. Und ordentlich Geld von den Touristen werden wir außerdem sammeln.