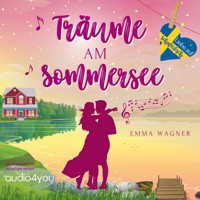3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Valentina hat einen tollen Job, eine Luxuswohnung und die begehrte Vintagetasche ihres Lieblingsdesigners. Einen Mann braucht sie so dringend wie ein Loch in ihren Louboutins - Karriere geht vor. Der plötzliche Tod ihrer ehemals besten Freundin katapultiert sie zurück nach Himmelreich und damit direkt in ihre Vergangenheit. Dort stößt sie nicht nur auf äußerst eigenwillige Dorfbewohner, sondern auch auf das Rätsel um den Tod ihrer ehemals besten Freundin Nattie. Dieses aufzuklären setzen sich Valentina und ihre verbliebenen vier Freundinnen zum Ziel. Es wäre allerdings viel einfacher, sich darauf zu konzentrieren, wenn es da nicht diesen unfreundlichen Bauern Jan gäbe, der ihr das Leben schwermacht. Oder ihren alten Schwarm Tom, der nach all den Jahren plötzlich sein Herz für Valentina entdeckt ... ***Romantisch und spannend, witzig und sexy, mit sinnlich gefühlvollen Liebesszenen*** "Summertime Kisses" ist der Auftakt zu einer fünfteiligen Romanreihe der Bestsellerautorinnen Emma Wagner, Lana N. May, Jo Berger, Stine Mertens und Mia Leoni.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Weitere Werke von Emma Wagner: https://autorin-emma-wagner.de
Emma Wagner
__________________
Summertime Kisses
Summertime Romance 1
__________________
Roman
Copyright © 2015 by Emma Wagner
Lektorat: Susanne Pavlovic (www.textehexe.com)
Cover by Truelove Coverdesign
Bildnachweis: Shutterstock / G-Stock StudioShutterstock / ju_seeShutterstock / lemonkate Taydoo
Buchsatz: Jürgen Eglseer (www.eglseer.de)
Zeichnungen: Katharina Reitz
Emma Wagner
Bohnenbrunnenweg 8
34346 Hann. Münden
www.autorin-emma-wagner.de
Besucht mich auf Facebook:
www.facebook.com/AutorinEmmaWagner
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin.Hinweis: Dies ist eine Neuauflage von „Himmelreich mit kleinen Fehlern“
Heimkehr
Also, gleich flippe ich aus! Ist der zu blöd, um zu kapieren, was ne Lichthupe ist? Wie lange will der mit seinem ollen Traktor denn noch vor mir her tuckern?
Ich lasse den Motor des feuerroten Mercedes SL 107 aufheulen – einmal, zweimal. Keine Reaktion.
Mein Gott, ist der schwerhörig? Oder senil? Vermutlich beides. Bitte schön! Ich kann auch anders!
Wütend presse ich meinen Handballen gegen die Hupe. Das Geräusch hätte wahrscheinlich ausgereicht, Jericho zum Einsturz zu bringen, doch der Typ auf dem Traktor vor mir nimmt lediglich etwas aus seinen Ohren – der Idiot hat die ganze Zeit Musik gehört?! – dreht sich in aller Ruhe zu mir um und zuckt mit den Schultern.
Zu meiner Überraschung ist es kein Opi, der da auf dem grünen Deutz vor sich hin träumt, sondern ein relativ junger Mann. Jedenfalls soweit man das unter der Kapuze seines überdimensionalen Regencapes erkennen kann. Umso schlimmer – also einer von der dämlichen Sorte!
Wie zur Bestätigung hebt der Typ jetzt die Hand und deutet auf die Straße.
Ja, das weiß ich selbst, dass die nicht breit genug ist! Kannst du nicht einfach zur Seite fahren?! Als ob das die blöden Rüben auf den dämlichen Feldern hier groß stören würde!
Doch offenbar kann der Typ keine Gedanken lesen und kommt leider auch nicht von selbst auf die Idee, Platz zu machen. Vielmehr dreht er sich wieder nach vorn und sitzt weiter regungslos auf seinem Schlepper. Als ob das Regencape nicht groß genug wäre, trägt er auch noch einen breitkrempigen Regenhut, den er sich allerdings in den Nacken geschoben hat. Dass sich inzwischen die Sonne an die Wettervorhersage erinnert und endlich zum Vorschein kommt, bemerkt der Kerl offenbar nicht.
Entnervt sehe ich auf die Zeitanzeige am Armaturenbrett. Na super: Ich werde zu spät kommen. Ich fasse es nicht! Und das, nachdem ich extra um halb fünf aufgestanden bin! Nicht einmal die Zeit, meine Haare zu waschen, habe ich mir genommen! Bei dem sintflutartigen Regen heute Morgen hätte es allerdings auch gereicht, meinen Kopf mal kurz aus dem Fenster zu halten. Tatsächlich hatte ich das sogar kurz in Erwägung gezogen. Koffeinmangel tut mir definitiv nicht gut!
Und trotz all dieser Hektik gurke ich jetzt schon seit was-weiß-ich-wie-vielen Kilometern diesem Hornochsen hinterher! Über so einen beschissenen Feldweg.
Ich hätte diesem Umleitungsschild nicht vertrauen sollen. Die Straße sah doch gut aus. Es wäre ja mal wieder so was von typisch für dieses Kaff, wenn die einfach vergessen hätten, nach Beendigung der Bauarbeiten das Schild wieder zu entfernen.
Erschreckend, wie schwer mir die Orientierung gerade fällt, schließlich habe ich meine ganze Jugend hier verbracht. Daher habe ich auch auf ein Navi verzichtet.
Na gut – zugegeben: Der Verzicht ist nicht ganz freiwillig. Dass mein neues Navi etwas anders funktioniert als mein altes, stellte sich heraus, als ich – bereits etliche Kilometer hinter Heidelberg – versuchte, mein Ziel einzugeben. Prompt hat mich das Navi erst auf Spanisch vollgequatscht, mich dann mit der Stimme von Bruce Willis angeschnauzt und schließlich auf meine Ortseingabe hin beleidigt die Klappe gehalten.
Gefrustet habe ich es auf den Beifahrersitz gepfeffert und meinem Orientierungssinn und Erinnerungsvermögen vertraut.
Tja, und beide haben mich offensichtlich gerade im Stich gelassen. Die Vermutung, nach diesem Umleitungsschild irgendwo die falsche Abzweigung genommen zu haben, wird langsam zur Gewissheit, denn das, worauf ich inzwischen unterwegs bin, ist kaum mehr als eine Schotterpiste, die stellenweise sogar völlig ohne Schotter auskommt.
Ah, da vorn: Die Stelle sieht eigentlich ganz gut aus. Da wird dieser Trampelpfad etwas breiter.
Ich verrenke mir den Kopf und schiele am Traktor vorbei. Prima: kein Gegenverkehr. Ist eben sonst keiner so doof, diese Rüttelpiste zu benutzen. Außer mir und diesem dämlichen Traktorfahrer natürlich.
Kurzentschlossen lasse ich den Motor aufheulen, gebe Gas und reiße das Lenkrad herum.
Nur Sekundenbruchteile später braust mein Wagen an dem Traktor vorbei und ich sehe im Rückspiegel, wie der Typ überrascht hochsieht und mir dann wütend einen Vogel zeigt. Mein Mittelfinger antwortet ihm. Hah! Auf Nimmerwiedersehen, du Trottel!
Zufrieden richte ich meinen Blick wieder nach vorne. Doch der Anblick, der sich mir bietet, beendet meinen Höhenflug ziemlich schnell: die Pampa. Unendliche Weiten. Viele Lichtjahre von der Zivilisation entfernt dringt Valentina in Ecken vor, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Kühe sind hier definitiv die intelligenteste Lebensform.
Und wenn es nicht diesen schrecklichen Anlass gäbe, hätten mich auch keine zehn Kühe in diese öde Gegend zurückgebracht!
Beklommen taste ich mit der rechten Hand auf dem Beifahrersitz nach meiner Hermès-Tasche, während ich weiter nach vorne schaue und mit der linken Hand am Steuer versuche, zumindest die größten Schlaglöcher zu umfahren.
Endlich werde ich fündig, fühle etwas Hartes, Kantiges zwischen meinen Fingern und atme erleichtert aus. Gott sei Dank, es ist noch da!
Einen kurzen Augenblick lang hatte ich befürchtet, das kleine gerahmte Bild an der letzten Raststätte vergessen zu haben, wo ich mir meinen dritten Kaffee reingezogen habe. Und wo ich, wie so oft in den letzten Tagen, wieder und immer wieder auf das Bild gestarrt habe, das meine ehemals beste Freundin und mich zeigt. Ich halte sie umschlungen, und mit aneinander gelehnten Gesichtern lachen wir in die Kamera. Zwei junge Mädchen, eines blond, das andere schwarzhaarig, die in eine strahlende Zukunft blicken, randvoll mit Träumen, Hoffnungen und Wünschen.
Seufzend streiche ich ein letztes Mal über den Bilderrahmen und ziehe meine Hand dann zurück. Das alles hier kommt mir immer noch irreal vor. Wie ein böser Traum. Und dennoch bin ich unterwegs nach – was für ein makabrer Scherz des Schicksals – Himmelreich. Leider. Denn es ist eine Beerdigung, zu der ich fahre. Nathalies Beerdigung.
Sofort kriecht dieses dumpfe, drückende Gefühl in meinem Magen wieder meine Speiseröhre hinauf. Wie immer, wenn ich an Nathalie denke. Was ich zugegebenermaßen lange nicht getan habe – bis mich die Nachricht von ihrem Tod erreicht hat. Und diese beschämende Tatsache wiederum hat nicht unwesentlich damit zu tun, dass meine Kollegen sich seitdem über meine ständigen Anfälle von Sodbrennen wundern.
Wobei das theoretisch auch davon stammen könnte, dass meine Eltern gerade mal wieder geschäftlich in Heidelberg zu tun haben und deshalb bei mir zu Besuch sind.
Ich seufze und versuche, meine Gedanken wieder auf das Vordringlichste zu fokussieren. Um die Sache mit dem Gut und dem Auftrag meines Vaters muss ich mich später kümmern. Vorerst habe ich wirklich genug andere Probleme! Denn mit welchen Hintergedanken auch immer mir mein Vater den Oldtimer, seinen absoluten Lieblingswagen, überlassen hat – jetzt kann ich seine Großzügigkeit nicht einmal richtig ausnutzen, weil ich zwischen Wäldern und Feldern über diese bescheuerte Piste holpere.
Oder auch nicht. In diesem Moment verschluckt sich nämlich mein Auto. Zumindest hört es sich so an. Ich runzle die Stirn, nehme den Fuß vom Gas. Erneut eine Art würgendes Geräusch, dann ein Husten. Jetzt sitze ich kerzengerade und umklammere angespannt das Lenkrad. Wieder ein Husten, dann ein Hopsen.
Erschrocken trete ich auf die Bremse und würge den Motor ab. Mit klopfendem Herzen sitze ich einen Augenblick lang da und lausche, doch alles ist still. Ich versuche, den Motor zu starten. Einmal. Zweimal. Ein drittes Mal. Der Wagen springt nicht an.
Scheiße!
Wütend stoße ich die Autotür auf, schwinge mein Bein hinaus und kann gerade noch in letzter Minute innehalten, bevor meine sauteuren Louboutins im Matsch versunken wären. Direkt neben mir breitet sich eine riesige Dreckpfütze aus, eindeutig zu groß, um darüber hinwegzuspringen. Auf der Beifahrerseite dasselbe. Na toll! Womit habe ich mir mein Karma so versaut, dass mein Auto ausgerechnet im einzigen Matschloch weit und breit liegenbleibt?
Ich ziehe meinen Fuß wieder in den Innenraum des Autos zurück, sinke nach vorne, bis meine Stirn auf dem Lenkrad aufliegt, und gehe meine Optionen durch: a) barfuß durch den Matsch zur Motorhaube latschen und dreckverschmiert zu spät zur Beerdigung erscheinen oder b) gleich den ADAC rufen und zu spät – aber dafür sauber – zur Beerdigung erscheinen.
Eindeutig Letzteres. Und vielleicht sollte ich die vom ADAC auch gleich fragen, ob sie irgendwo ein paar Gummistiefel herumliegen haben, die sie mir mitbringen können. Ich habe nämlich den Verdacht, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass ich darauf werde zurückgreifen müssen.
Frustriert krame ich mein Handy heraus, hätte es aber im nächsten Moment um ein Haar nach draußen in die Pfütze gepfeffert. Kein Empfang. Nur Notrufe möglich.
War ja klar! Kaum nähere ich mich diesem blöden Kaff, streikt alles, was mit Zivilisation zu tun hat! Also doch Option A.
Ich öffne das Handschuhfach in der vagen Hoffnung, hier auf Plastiktüten oder irgendetwas anderes zu stoßen, das ich mir über die Füße ziehen könnte, finde jedoch nur die Gucci-Sonnenbrille meiner Mutter. Nur unwesentlich mehr Geeignetes gibt meine Tasche her: Eine Packung Taschentücher muss reichen!
Zum Glück habe ich keinen langen Rock angezogen, sondern ein kurzes schwarzes Chanel-Kostüm. Ich schlüpfe aus meinen Pumps, strecke vorsichtig meinen Fuß aus und verziehe das Gesicht, als meine Zehen in die dunkle, kalte Brühe eintauchen. Dann folgt der zweite Fuß, und schon stakse ich, mich am Auto entlanghangelnd, zur Motorhaube vor. Dabei wird mir bewusst, dass das leise Röhren, das ich unbewusst schon seit einer Weile wahrgenommen habe, jetzt lauter geworden ist. Ich schaue zurück und sehe den grünen Trecker von vorhin hinter dem kleinen Wäldchen um die Ecke biegen.
Na super! Hätte der nicht aufkreuzen können, bevor ich meinen sorgfältig pedikürten Füßen eine Schlammpackung erster Güte verpasse?
Das Röhren wird lauter, der Traktor nähert sich gemächlich. Ich kümmere mich nicht drum und klappe die Motorhaube auf.
Doch trotz gründlicher Inspektion kann ich nichts Auffälliges entdecken, weder angefressene Leitungen oder lose Kabelenden noch ausgetretene Feuchtigkeit.
Der Traktor kommt hinter meinem Wagen zum Stehen und der Scheintote von vorhin schaltet den Motor ab. »Na, sieh mal einer an, wen wir da haben!«, ruft er schadenfroh zu mir hinüber.
Ich ignoriere ihn, ziehe für den Fall, dass da ein Wackelkontakt vorhanden ist, die Kabelstecker von den Zündkerzen ab und stecke sie wieder auf. Dann gehe ich wieder zur Fahrerseite, wo ich mir mit den Taschentüchern meine Füße notdürftig säubere, einsteige und anschließend bei geöffneter Fahrertür das Auto probeweise starte.
Das Ergebnis ist ernüchternd.
Mist.
Ich steige wieder aus und latsche durch den Schlamm zurück zur Motorhaube. Inzwischen ist es mir egal, wie tief meine Füße im Matsch versinken.
Der Typ klettert von seinem Sitz herunter, springt zu Boden und kommt dann mit großen Schritten auf mich zu. Einen Moment lang kriege ich Panik. Er sieht nämlich nicht nur schmutzig und schmuddelig, sondern davon abgesehen auch alles andere als vertrauenerweckend aus. Und ich habe gerade weder ein Handy noch ein Pfefferspray zur Hand!
»Meinen Sie etwa, die Straße würde Ihnen gehören, nur weil Sie in so einer beschissenen Geldkarre fahren?« Er schiebt sich seinen Regenhut aus der Stirn.
Na toll: einer von der Sorte Neidhammel! Jetzt wird mir auch klar, warum er mich ums Verrecken nicht passieren lassen wollte. Aber nicht mit mir! Und nicht an diesem wirklich verdammt beschissenen Morgen! »Die Straße gehört dem, der fahren kann, und das sind offensichtlich nicht Sie. Denn Ihr Traktor verfügt rein zufälligerweise über so ein seltsames Ding, das sich Lenkrad nennt. Damit kann man ihn zur Seite fahren. Um Menschen durchzulassen, die Wichtigeres zu tun haben, als Musik zu hören und den Kaninchen beim Vögeln zuzugucken!«
Im nächsten Moment bereue ich mein vorlautes Mundwerk, denn wir sind hier ja – leider – nicht in der Stadt unter Tausenden von Menschen, sondern allein am Rande des Nirgendwo mit lediglich ein paar Runkelrüben als Zeugen, falls er gewalttätig werden sollte. Und danach sieht es leider aus, denn sein Gesicht verfärbt sich deutlich in Richtung Rot, und er ballt die Fäuste.
Unauffällig bewege ich mich von ihm weg, um zumindest die Motorhaube als Barriere zwischen uns zu haben.
»Wissen Sie was, Sie arrogante Ziege? Ich war ja bereit, Ihnen trotz Ihres unmöglichen Benehmens zu helfen. Aber das können Sie jetzt vergessen! Viel Spaß noch. Der nächste Traktor dürfte morgen Nachmittag hier vorbeikommen.« Damit dreht er sich um und stiefelt zu seinem Gefährt zurück.
»Gut! Hauptsache, ich muss mir Ihre Unfähigkeit nicht länger ansehen!«, rufe ich ihm hinterher, als er bereits die Leiter zu seinem Sitz erklimmt.
Dann startet er den Motor und – ich fasse es nicht! – fährt tatsächlich zur Seite aufs Feld und in einem Bogen um mein Auto und mich herum.
Als er vor mir wieder auf den Feldweg einschert, wird mir klar, dass sich gerade meine einzige Möglichkeit, doch noch rechtzeitig – oder überhaupt! – zu Natties Beerdigung zu erscheinen, aus dem Staub macht. Mist! Ich beiße mir auf die Lippe.
Ich will das nicht tun! Ich kann das nicht tun!
Aber ich muss das tun! Nathalie zuliebe. Nachdem ich schon sonst nichts für sie getan habe ... Aua, Sodbrennen! Ich muss dringend meinen Pillenvorrat aufstocken!
Ich schließe kurz die Augen, atme dann tief durch und schreie: »Halt, stopp. Warten Sie!«
Der Traktor zuckelt weiter.
Ach, verdammt! Ich hebe die Arme, winke wild und renne ihm hinterher. »Haaaalt. Warten Sie! Bitteee!«
Endlich dreht sich der Neidhammel um und scheint zu überlegen, hält dann immerhin an und setzt zurück.
Als er vor mir wieder zum Halten gekommen ist, schaltet er den Motor aus. Ein triumphierendes Grinsen zeichnet sich zwischen den weizenblonden Bartstoppeln ab. »Hat es sich da jemand anders überlegt und möchte nun doch Manieren zeigen?«
»Das will ich doch hoffen, das wäre bei Ihnen wirklich dringend notwendig!«
Der Typ glotzt mich an. Dann dreht er sich um und startet den Motor.
Ich könnte mir in den Hintern beißen! »Nein. Halt. Bitte. Entschuldigung. Das war nicht so gemeint. Das ist mir nur so rausgerutscht. Hören Sie, ich brauche wirklich Ihre Hilfe!«
Das Motorengeräusch erstirbt. Der Traktorist wendet sich erneut zu mir. »Wieso sollte ich ausgerechnet Ihnen jetzt noch helfen wollen?«
»Es tut mir leid. Ich bin ein wenig durcheinander. Aber ich muss nach Himmelreich!«
»Himmelreich?« Er runzelt die Stirn. »Was wollen Sie da?«
»Zu einer Beerdigung«, erkläre ich knapp.
Im nächsten Moment legt sich ein Ausdruck tiefer Betroffenheit auf sein sonnengebräuntes und unrasiertes Gesicht. Einen Atemzug lang mustert er mich so eindringlich aus graublauen Augen, dass ich unbehaglich von einem Fuß auf den anderen trete, dann nickt er zögernd. »Das tut mir sehr leid. Ähm. Vor diesem Hintergrund verstehe ich natürlich Ihre Eile.«
Ich sage nichts. Seine offensichtliche Bestürzung ist mir unangenehm, schließlich habe ich in den letzten Jahren viel zu wenig Kontakt zu Nathalie gehabt.
»Soll ich mir Ihren Wagen mal ansehen?«, reißt mich die Stimme des Bauern aus meinen Gedanken.
»Nicht nötig«, winke ich ab. »Da ist nichts mehr zu machen. Jedenfalls nicht rechtzeitig.«
»Woher wollen Sie das wissen?« Er zieht bereits sein Regencape aus. Darunter kommen ein verwaschenes grünkariertes Hemd und eine Cargohose zum Vorschein, deren Farbe ich unter all dem Dreck kaum erahnen kann.
Der Anblick lässt mich vorsichtshalber einen Schritt zurücktreten, immerhin war mein Kostüm nicht gerade billig. »Ich hab’s mir angeschaut.«
»So? Und was haben Sie gesehen? Etwa ein Problem mit dem Öl oder den Zylindern?« Herablassend lächelt er mich an. »Sind Sie sicher, dass Sie nicht einfach nur vergessen haben, zu tanken?«
Ich mustere ihn. Dann besehe ich mir meine Fingernägel und sage leichthin: »Wäre Motoröl aus dem Ventilgehäuse in den Motorraum und auf den Auspuffkrümmer gespritzt, hätte sich dunkler Qualm entwickelt. Das ist jedoch nicht passiert. Und bei einem undichten Schlauch im Kühlsystem hätte es gedampft. Auch das war nicht der Fall. Also ist auch kein Wechsel der Zylinderkopfdichtung nötig.«
Ich poliere meine Fingernägel an meinem Rock und wende mich wieder dem Typen zu. Er starrt mich mit offenem Mund an.
»Ich würde ja den ADAC rufen«, fahre ich fort, »aber in dieser, Tschuldigung, beschissenen Einöde gibt es ja keinen Handyempfang. Wenn Sie mich also vielleicht zum nächsten Ort mitnehmen könnten, von wo aus ich den Abschleppdienst rufen könnte, wäre das wirklich sehr nett von Ihnen. Welcher Ort wäre das überhaupt?«
Meinem Gegenüber steht immer noch der Mund offen. Endlich fällt es auch ihm auf. Er schließt ihn und räuspert sich. »Ja. Klar. Mach ich. Äh, Himmelreich.«
»Was? Echt? Perfekt. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch rechtzeitig.« Also stakse ich durch den Matsch wieder zurück in Richtung Auto, um meine Sachen zu holen.
Als der Traktorfahrer sieht, wie ich meine Schuhe aus dem Fußraum ziehe und dann nach meiner Tasche auf dem Beifahrersitz angle, kommt endlich wieder Leben in ihn. »Ich mach das schon. Geben Sie ruhig her.«
»Vielen Dank. Meine Sachen sind im Kofferraum.«
»Wie? Sie haben noch mehr Sachen als das?«
Ich drehe mich um. Er deutet auf meine Handtasche.
»Ja, klar, ich habe leider einiges zu erledigen und werde eine Woche bleiben müssen.«
Der Typ presst unwillig die Lippen zusammen, geht aber folgsam zum Kofferraum hinüber.
Nach einer kurzen Pause tönt es trocken: »Das ist jetzt aber nicht Ihr Ernst!«
»Was meinen Sie?«
»Ich schleppe doch jetzt nicht Ihre beiden Koffer durch die Gegend. Wieso lassen Sie die nicht einfach im Auto?«
»Und wenn sie geklaut werden?«
»Sie machen sich Sorgen darum, dass Ihre Koffer geklaut werden? Und was ist mit dem Wagen?«
»Der ist versichert. Meine Koffer nicht. Und selbst wenn: Ich würde ein halbes Jahr benötigen, um Dinge aufzutreiben, die auch nur annähernd so schön sind wie die Sachen, die ich schon habe.«
»Dann viel Spaß beim Suchen.« Er drückt die Kofferraumklappe wieder runter. »Wie soll ich die Koffer denn bitte transportieren? Etwa in der Traktorschaufel?«
Ich behalte für mich, dass ich mir das in der Tat ungefähr so vorgestellt hatte. Warum denn auch nicht? Es handelt sich ja zum Glück um Hartschalenkoffer, von denen ich den Dreck leicht wieder abwischen kann. Doch aus der Befürchtung heraus, er könnte sein Angebot zurücknehmen, beharre ich nicht weiter darauf.
Ich schließe das Auto ab und stelze mit meinen Schuhen in der linken und meiner Handtasche in der rechten Hand erneut durch den Dreck hinüber zum Traktor.
»Es sind noch ein paar Kilometer bis Himmelreich«, informiert mich der Bauer. »Halten Sie sich gut fest.« Er deutet auf die Haltegriffe neben der Leiter.
Ich runzle einen Moment die Stirn, bis mir aufgeht, dass er damit sagen will, ich solle die Fahrt über auf dieser Leiter stehen. Kurz bin ich davor, aufzubegehren, doch dann wird mir klar, dass es jetzt taktisch etwas ungünstig wäre, zu verlangen, den Traktor selbst lenken zu dürfen. Leider hat ausgerechnet dieses Modell keinen Beifahrersitz.
Also beiße ich die Zähne zusammen, verstaue meine Louboutins in meiner Tasche und erklimme die Leiter.
»Ihre Tasche können Sie mir geben. Die passt hier noch rein.«
Entgeistert starre ich ihn an. »Das ist die neue Vintagebag von Hermès! Eine limitierte Auflage! Wildleder! Die kann man nicht auf einem Haufen Dreck abstellen!«
Der Typ mustert mich einen Augenblick, dann zuckt er wortlos mit den Achseln und richtet den Blick nach vorn.
Als er den Deutz mit einem kräftigen Ruck anfährt, bin ich mir ziemlich sicher, dass er das mit Absicht macht, und als er im nächsten Moment den Motor wieder abwürgt, verliere ich beinahe das Gleichgewicht. Dennoch verkneife ich mir mühsam jeglichen Kommentar.
Doch nachdem wir etliche Kilometer in einem Tempo dahingeschlichen sind, das mich befürchten lässt, erst als alte Frau in Himmelreich anzukommen, reißt mir der Geduldsfaden. »Hallo? Das Ding hat auch mehr als einen Gang!«
Ein verärgerter Blick ist die Antwort. Der Traktor kommt zum Stehen. »Dann fahren Sie doch selbst, wenn Sie alles besser wissen.«
Darauf habe ich nur gewartet. »Aber mit dem größten Vergnügen!«
Ich klettere die Leiter hoch und der völlig perplexe Möchtegern-Traktorist macht mir tatsächlich Platz, indem er sich in gebeugter Haltung an das Seitenfenster drückt. Doch erst als er mit Erstaunen registriert, wie ich selbstbewusst den Motor starte, die Baggerschaufel noch ein Stück weiter hochfahre und dann den ersten Gang einlege, überlässt er mir ohne einen weiteren Kommentar die Fahrerkabine und nimmt meinen Platz auf der Trittleiter ein. Dennoch werde ich mehr als glücklich sein, wenn wir endlich in Himmelreich ankommen und ich diesen Typen nie mehr wiedersehen muss!
Eine Dreiviertelstunde später haste ich über den Friedhof und öffne vorsichtig die Tür zur Trauerhalle.
Obwohl ich mich zuvor bestmöglich gesäubert habe und mich bemühe, kein Aufsehen zu erregen, wenden sich dennoch etliche Gesichter zu mir um und bedenken mich mit strafenden Blicken. Ich sehe mich nach einem freien Stuhl um, doch die Trauerhalle ist bis in den letzten Winkel besetzt.
Plötzlich steht vor mir ein Mann auf und bedeutet mir, seinen Sitzplatz zu nehmen. Im ersten Moment will ich ablehnen, doch da ich immer noch aus unterschiedlichen Richtungen angestarrt werde, setze ich mich eilig. Dann erst nehme ich den Gentleman in Augenschein, der mir seinen Platz angeboten hat, und bin nur milde erstaunt, als ich auf warme braune Augen in einem markanten Gesicht treffe: Thomas Linder, der einzige Lichtblick so manchen trostlosen Schultages. Und Exfreund von Nattie.
Wir waren siebzehn, und er kam als junger Referendar an unsere Schule. Ein witziger, charmanter, höflicher und unglaublich gut aussehender Sport- und Politiklehrer, der jede Menge frischen Wind in unser verstaubtes Gymnasium brachte. Kein Wunder, dass ihm die Herzen sämtlicher Mädchen zuflogen. Die Sache mit Nattie allerdings ergab sich erst Jahre später und war auch nicht von langer Dauer.
Verstohlen mustere ich ihn. Offenbar hat er sich nicht nur sein gutes Benehmen, sondern auch sein gutes Aussehen erhalten.
»Danke«, flüstere ich ihm zu.
»Keine Ursache«, gibt er mit gefasstem Gesichtsausdruck zurück und richtet seine Aufmerksamkeit sogleich wieder nach vorne und der Predigt zu. Auch wenn seine Beziehung zu Nattie schon lange zurückliegt, nimmt ihn ihr Tod offensichtlich sehr mit.
Natties Tod ...
Urplötzlich wird mir wieder bewusst, was ich während der ärgerlichen Traktorepisode völlig verdrängt habe: Hier ist nicht irgendjemand gestorben, sondern eine junge Frau, die einmal zu meinen besten Freundinnen gehört hat. Jetzt gebe ich mir keine Mühe mehr, dieses stechende Gefühl niederzukämpfen, das plötzlich wieder in mir hochsteigt.
Auf einmal ist das alles so schrecklich real! Sich vorzustellen, dass dort in dem Sarg Nathalie liegt. Die wunderschöne Nathalie, auf die ich als Jugendliche immer ein wenig neidisch war, weil sie weder mit Pickeln noch mit Spliss je zu kämpfen hatte. Ich komme mir jetzt furchtbar schäbig vor und bade in diesem Gefühl. Eine Art Selbstbestrafung. Doch nicht für meinen damaligen Anflug von Neid, sondern dafür, dass ich sie habe hängen lassen, letzte Woche ...
Mein Blick klebt an dem großformatigen Porträt von ihr, das vor dem Sarg aus Holz aufgestellt ist. Der Sarg ist mit weißen Callas und roten Rosen geschmückt, und vom Porträt lachen mich strahlendblaue Augen an. Die Nathalie auf dem Bild streicht sich gerade eine Strähne ihres lockigen Haares zurück. Meine Idee, unser Jugendbild vor dem Sarg aufzustellen, kommt mir plötzlich furchtbar kindisch und dumm vor und ich schiebe es schnell noch tiefer in meine Handtasche.
»... denn der Sand in der Wüste ist zahlreich und ebenso das Wasser im Meer. So wollen wir inmitten aller Trauer die Hoffnung unseren Glaubens sprechen lassen, indem wir auf den Jesus Christus blicken, der uns Leben und Heil verheißt ...« Die Stimme des Redners klingt volltönend durch die Halle.
Als ich meinen Blick von Nathalies Porträt löse und zu ihm sehe, erkenne ich Pfarrer Wohlfahrt, bei dem wir damals unsere Konfirmation hatten. Jetzt reicht ihm sein weißer Rauschbart bis auf die Brust und sein Kopf ist kahl. Er muss schon weit über sechzig sein. Nur seine dicke, rote Knollennase verrät, dass er vermutlich nach wie vor gerne ein Gläschen Wein trinkt. Oder auch zwei oder drei.
»... Möge Nathalie Sonnwickler Gott nun von Angesicht zu Angesicht schauen durch den, der ihr und uns allen in der Taufe Zugang zum Leben geöffnet hat: Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.«
»Amen«, schallt es von allen Seiten, und auch ich beeile mich einzustimmen, während über uns die Orgel einsetzt und sich vier Männer um den Sarg herum aufstellen.
»Manche von uns gingen mit ihr nur ein kurzes Stück, andere waren weite Strecken an ihrer Seite. Wieder andere gingen immer wieder mal ein Weilchen mit ihr ...«
Aua!
»... doch auf ihrem letzten Weg wollen wir sie nun alle begleiten.«
Kaum ist mein plötzlicher Anfall von Sodbrennen wieder verklungen, als Pfarrer Wohlfahrt auch schon gemessen den Gang entlang schreitet. Die vier Männer heben den Sarg auf ihre Schultern und folgen dem Pfarrer Richtung Tür. Zu den melancholischen Klängen von Beethovens Mondscheinsonate formiert sich hinter dem Sarg der Trauerzug.
Allen voran gehen Natties Eltern, wobei Herr Sonnwickler seine von Schluchzern geschüttelte Frau stützen muss. Der Anblick ist schrecklich. Niemand sollte den Tod des eigenen Kindes miterleben müssen! Ich hoffe aus ganzem Herzen, dass mir solch ein Grauen erspart bleiben wird.
Mein Sitznachbar, ein rothaariger und ziemlich bleicher junger Mann mit einer etwas schiefen Nase und beinahe wimpernlosen braunen Augen starrt zu Boden. Jetzt erst fällt mir auf, dass um ihn her alle Stühle ein wenig von ihm abgerückt sind.
Der junge Mann rührt sich nicht.
Erst will ich es ihm gleich tun und warten, bis die Masse der Menschen sich dem Trauerzug angeschlossen hat, doch dann entdecke ich in der Menge plötzlich ein sehr bekanntes Gesicht. Lisa? Sie hat längere Haare als früher, mit hellen Strähnen in dem dunklen Braun, und sie trägt eine riesige, dunkel getönte Sonnenbrille, doch sie ist es definitiv!
Sofort fühle ich mich noch schlechter. Schließlich hätte ich mir denken können, dass die Mädels auch zur Beerdigung kommen würden. Wieso habe ich nicht bei ihnen angerufen?
Die Antwort gebe ich mir postwendend selbst: Weil ich mich davor gedrückt habe. Weil mir die lange, lange Sendepause so unglaublich peinlich war. Außer zum Arbeiten und Schlafen bin ich in den letzten Monaten wirklich zu nichts gekommen. Ab und an eine kurze SMS musste reichen. Und so habe ich die Telefonate mit meinen ehemals besten Freundinnen auf die lange Bank geschoben. Und weiter geschoben. Und noch ein bisschen weiter. Bis irgendwann schon der Gedanke daran, sich nach so langer Zeit plötzlich wieder zu melden, so unangenehm war, dass ich ihn irgendwo ganz weit hinter den Überlegungen zu Nachtschichten, Patientenakten, Karriereplänen und den fiesen Kommentaren dieses besserwisserischen Doktor Sämlein mit seinem aufgeblasenen Ego versteckt habe.
Einen Augenblick zögere ich noch, dann gebe ich mir einen Ruck und stehe auf. Der Rothaarige sieht mich an. Er hat Tränen in den Augen. Ich will ihn in seiner Trauer nicht stören, gehe schnell an ihm vorbei und auf Lisa zu.
Als sie mich erblickt, nimmt sie die Sonnenbrille ab. Auch ihre Augen sind feucht. Wortlos fallen wir uns in die Arme. Erinnerungen steigen wie schillernde Seifenblasen in mir auf: Wir sechs auf dem Schulhof, unzertrennlich und unendlich albern. Die geteilte Freude über die erste Eins einer von uns in der Schule. Der ebenso geteilte Frust über unsere uncoolen Eltern. Später dann unser erster Liebeskummer und auch alle folgenden. Der Tag, an dem wir der intriganten Anna einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Die Nacht, in der wir Nattie heimlich zu ihrer ersten Party mitnahmen. Unsere Küchenpartys während des Studiums, die manchmal erst endeten, wenn die Uni wieder anfing. Das –
»Ich kann es einfach nicht fassen«, unterbricht Lisa meine Gedanken.
Ich nicke bedrückt. »Noch vor ein paar Tagen war sie am Leben. Und jetzt ...«
»Es ist so unfassbar schrecklich. Ich habe das Gefühl, dass genauso gut ich dort in dem Sarg liegen könnte.«
Ich umarme Lisa ein weiteres Mal und kämpfe gegen die Tränen an. Natties Leben lag doch noch vor ihr. Wie konnte das Schicksal nur so ungerecht sein ...
Lisa holt tief Luft. »Wir müssen.«
Ich nicke und löse mich langsam von ihr. Tatsächlich verlassen soeben die letzten Personen die Halle. Auch mein rothaariger Sitznachbar ist fort.
Ich atme tief durch, hake mich bei Lisa ein, und wir schließen uns dem Trauerzug an.
Langsam schlängelt sich der Zug um die Trauerhalle herum, einen schmalen Kiesweg entlang und zwischen den Gräbern hindurch. Mein Blick schweift über die Grabsteine und Bäume hinweg zu den Hügeln der umliegenden Landschaft. Wälder und Felder, so weit das Auge reicht.
Ab sofort und für die nächsten Tage keinerlei Möglichkeit, einmal ein anständiges Einkaufszentrum zu besuchen. Dabei ist mein Bedürfnis nach einer neuen Tasche in diesem traurigen Moment nahezu überwältigend.
Vielleicht eine mit buntem Aufdruck? Oder doch lieber ein klassisches Modell?
Ich schüttle den Kopf. Was soll das? Wieso denke ich jetzt über eine neue Tasche nach? Ich bin bei einer Beerdigung!
Im nächsten Moment beantworte ich mir meine Frage selbst: genau deshalb! Und im Grunde ist es mir sogar egal, wie sie aussieht. Hauptsache, sie ist teuer. Nichts tröstet so gut wie eine neue Tasche!
Kurz drauf erreicht der Zug sein Ziel, und wir rücken langsam vor in der Schlange der Trauergäste, die unter den Weiden am offenen Grab noch einen letzten Gruß an Nathalie richten wollen.
»Voll Trauer stehen wir an diesem Grab«, empfängt uns Pfarrer Wohlfahrts Stimme. »Das Grab ist für uns Ausdruck der Vergänglichkeit irdischen Lebens. Doch durch Jesus Christus ist es auch zum Zeichen der Hoffnung geworden ...«
Lisa stößt mich an und deutet mit dem Kinn nach vorn.
Erst auf den zweiten Blick wird mir klar, was sie mir sagen will: Die Frau, die gerade eine Blume in das offene Grab wirft, ist Cleo. Unsere Cleo. Und die anderen?
Ich blicke mich suchend um und tatsächlich: Hinter Natties Verwandtschaft, auf der anderen Seite des offenen Grabes, entdecke ich die weinende Maike. Ich hatte sie nicht gleich erkannt, da sie ihre kupferroten Haare unter einem schwarzen Hut verborgen hat. Schoscho hat ihren Arm um Maike gelegt. Der Anblick löst ein Déjà-vu in mir aus. Vor sechs Jahren war es Maike, die wir auf dem schwersten Gang ihres Lebens begleitet haben.
»Ist der Kleine auch dabei?«, frage ich Lisa.
»Nein. Seine Großeltern passen auf ihn auf.«
»... So verbindet sich nun der Schmerz des Abschieds mit der Hoffnung auf eine ewige Heimat, die Gott unserer lieben Nathalie schenkt«, beendet Pfarrer Wohlfahrt seine Ansprache.
Ich schlucke und sehe wieder zu Natties Grab.
Also sind wir alle da.
Wir verbliebenen Fünf.
Die Schlange rückt weiter und ich nehme eine der Rosen, die für die Trauergäste bereitliegen. Noch ein paar Schritte, dann stehe ich zum letzten Mal vor meiner ehemals besten Freundin. Plötzlich fällt mir das Luftholen schwer. Mein Brustkorb scheint zu eng geworden.
Ich will etwas sagen, einen letzten Gruß, doch mein Kopf ist leer.
Stumm werfe ich die Rose hinab und folge ihr mit den Augen, bis sie auf dem matt schimmernden Holz zum Liegen kommt. Ich schicke ein geflüstertes Bitte verzeih mir hinterher, dann trete ich zu Natties Eltern, um ihnen mein Beileid auszusprechen.
Vor mir steht Natties betagter Onkel, hat die Hände von Nathalies Mutter in die seinen genommen und seine Stirn an ihre gelegt. »Es gibt keine Worte für diesen Verlust, Ingrid. Wenn ihr etwas braucht, ich bin für euch da.«
»Danke, Anton.«
Der Mann lässt ihre Hände los und geht weiter.
Ich hole tief Luft und trete einen Schritt vor.
Natties Mutter sieht noch ihrem Bruder nach. Erst als ich mich räuspere, wendet sie sich mir zu. Im nächsten Moment reißt sie die Augen auf, wird kreidebleich und fällt in Ohnmacht.
»Erst in einer Dreiviertelstunde? Na großartig. Und schneller geht es wirklich nicht? Ich meine, in dieser Einöde kann doch wirklich nicht so viel los sein, dass Sie ... ja, ist ja gut. Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Ja, ich warte dann vor Ort.« Ich beende das Telefonat mit dem ADAC einigermaßen verärgert, denn so ganz wohl ist mir nicht bei dem Gedanken, dass der Wagen meines Vaters irgendwo im Nirgendwo herumsteht.
Kaum habe ich aufgelegt, klingelt es erneut. Es ist meine Mutter: »Kind, sag mal, wo ist der Schlüssel für den Keller?«
»Hallo Mama. Ich bin gut angekommen.«
»Was?«
»Na, in Himmelreich. Ich bin doch heute zur Beerdigung von Nathalie gefahren.«
»Ach so, ja. Natürlich. Ich wünsche dir viel Spaß. Aber dann macht es dir doch sicher nichts aus, wenn wir hier morgen Abend einen kleinen Cocktailempfang für Kunden und Geschäftspartner geben, oder?«
»Mama, hast du mir gerade zugehört?«
»Ja natürlich. Du bist in Himmelreich. Valentina, ich hab nicht viel Zeit! Der Caterer wartet auf mein Go und die Floristen stehen vor der Tür. Also?«
»Warum fragst du mich überhaupt, wenn ohnehin schon alles geplant ist?«
»Also wirklich, wo ist das Problem? Du bist doch gar nicht da!«
Ich seufze. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es reine Zeitverschwendung wäre, diese Diskussion weiterzuführen. »Alle Ersatzschlüssel liegen in der Küche in der Teedose.«
»Gut, danke. Und wenn Papa und ich nächstes Mal kommen, gehen wir mal schön essen, ja?«
»Du meinst, ohne dass ihr beiden währenddessen pausenlos an euren Handys hängt und mit irgendwelchen Kunden telefoniert?«
»Komm jetzt nicht mit so was! Du weißt, wie es ums Geschäft steht: Wenn wir jetzt nicht die Kurve kriegen, war alles umsonst!«
»Als hättet ihr Zeit für mich gehabt, solange es noch gut lief!«
»Wir reden weiter, wenn du dich wieder wie ein erwachsener Mensch benimmst.«
Im nächsten Moment ertönt das Freizeichen.
Ich atme tief durch, dennoch fällt es mir schwer, mich zu beruhigen.
Als meine Eltern vor ein paar Tagen überraschend zu Besuch kamen, fragte ich gar nicht erst nach dem Grund, denn der war mir ohnehin klar. Natürlich ist es an und für sich kein Problem für mich, meine Eltern bei mir zu beherbergen, denn die Penthouse-Wohnung, die mein Vater mir letztes Jahr gekauft hat, ist groß genug. Doch die Tatsache, dass sie dann immer nur mit ihren Geschäftspartnern unterwegs sind, ärgert mich jedes Mal aufs Neue. Ich habe meine Eltern in den letzten drei Tagen genau zwei Mal gesehen. Beide Male haben sie geschlafen.
Wahrscheinlich hat mein Vater deshalb für die Dauer seines Besuches mit meinem Golf vorliebgenommen und mir seinen heißgeliebten Oldtimer überlassen. Sozusagen, um sein Gewissen zu beruhigen. Vielleicht auch als Entschuldigung dafür, dass er mir im selben Atemzug, in dem er mir die traurige Nachricht von Nathalies Tod überbrachte, den Auftrag mit dem Gutshof erteilt hat. Weshalb ich jetzt auch noch meine erste freie Woche seit Langem damit zubringen darf, meine Nase zwischen Misthaufen und Kohlfelder und in die Angelegenheiten der Pächter zu stecken. Und das an dem Ort, den erneut zu betreten ich mich seit Jahren erfolgreich gedrückt habe!
Noch vor einem Jahr allerdings hätte mein Vater mir vermutlich gleich einen neuen Wagen gekauft. Doch seit seine Firma rote Zahlen schreibt ...
Ich verstaue das Handy wieder in meiner Handtasche und gehe auf die Tür des Lokals zu, das Nathalies Eltern für das Beerdigungsessen ausgewählt haben. Es ist ziemlich rustikal, wie könnte es hier auch anders sein, und liegt nur fünfhundert Meter vom Friedhof entfernt.
»Bitte schön«, ertönt eine angenehm warme Stimme, als die braungetäfelte Tür sich wie von Zauberhand vor meiner Nase öffnet. Ich muss eigentlich gar nicht hinsehen, um zu wissen, wem die Stimme gehört. Doch ich schaue gerne hin. Sehr gerne sogar. »Vielen Dank.«
»Nicht doch.« Thomas Linder lächelt mich an, aber ein trauriger Zug liegt um seinen Mund. »Ich muss mich bedanken. Dafür, dass ich einer so schönen Frau die Tür öffnen darf.«
Mir fällt die Kinnlade runter angesichts dieses übertriebenen Kompliments, doch schon im nächsten Moment zwinkert dessen Urheber. »Ich freue mich, dich wiederzusehen, Valentina.«
»Du weißt noch, wer ich bin?«, frage ich erstaunt.
Seine wunderschönen schokobraunen Augen mit den langen schwarzen Wimpern funkeln verschmitzt. »Na hör mal, sehe ich etwa so alt aus, dass du mir Demenz unterstellst?«
»Ganz im Gegenteil!«, gebe ich aus tiefstem Herzen zurück, denn in der Tat merkt man ihm die zehn Jahre Altersunterschied nicht an.
Erst als er mich belustigt mustert, wird mir bewusst, dass diese Antwort vielleicht ein klein wenig unpassend war.
Zum Glück deutet er ins Innere des Lokals. »Bitte schön. Ich hol nur rasch noch ein paar Stühle von draußen.«
Ich nicke dankend und betrete das Lokal.
Es ist ziemlich stickig und warm, denn die kleinen Fenster machen das Lüften schwierig. Auch lassen sie nur wenig Sonnenlicht herein, sodass bereits die altmodischen Schirm-Wandlampen eingeschaltet sind.
An den nackten, aus groben Steinen gemauerten Wänden hängen verblichene Landschaftsdrucke – die gleichen wie vor über zehn Jahren, da bin ich mir sicher – und auf den dunklen Eichentischen liegen weinrote Läufer.
Wer dieses Lokal betritt, dem drängt sich unweigerlich der Gedanke an Spanferkel oder Knödel mit Sauerkraut auf. Meine Hoffnung auf einen leichten Salat oder eine milde Brühe für meinen momentan arg überreizten Magen verflüchtigt sich.
Etliche Gäste sind, wie ich, noch dabei, nach einem Platz zu suchen, andere schieben sich neben mir durch die Tür herein.
Natties Mutter sitzt neben ihrem Mann an einem Tisch in der Mitte des Raumes. Bei meinem Eintreten hat sie mit unruhigem Blick zu mir geschaut. Sie sieht immer noch sehr blass aus, scheint sich jedoch von ihrem Zusammenbruch vorhin einigermaßen erholt zu haben.
Gerade gesellt sich ein weiterer Mann zu ihnen an den Tisch. Seine Haare sind glatt gescheitelt und zur Seite gekämmt und mit den Jahren grau geworden, sein kurzer Bart ist sogar fast ganz weiß, aber immer noch genauso ordentlich gestutzt wie damals. Seine relativ geringe Körpergröße macht er wie früher durch umso mehr Körperfülle wett, sowie durch einen Gesichtsausdruck, der von der ungeheuren Wichtigkeit seiner Person zeugt. Es ist Karl König. Und seinem Gebaren nach zu urteilen, ist er nach wie vor, Nomen est omen, der Bürgermeister von Himmelreich, wenn auch vermutlich nur deshalb, weil niemand sonst den Job will. Mein Blick fliegt durchs Lokal auf der Suche nach Josh, seinem älteren Sohn, doch ich kann ihn nirgendwo ausmachen und bin im Namen von Schoscho äußerst erleichtert darüber.
Die Stimmung ist gelöst, wie häufig nach einer Beerdigung, wenn die Trauer langsam dem Alltäglichen Platz macht und Menschen beieinandersitzen, die sich lange nicht gesehen haben. Aus dem Stimmengewirr ertönt vereinzelt sogar Gelächter. Unmittelbar neben mir jedoch schüttelt eine ältere Frau den Kopf und fragt ihre Sitznachbarin empört, wie er es denn nur wagen konnte, bei der Beerdigung zu erscheinen.
»Solche Leute haben überhaupt keinen Anstand«, lautet die entrüstete Antwort.
»Und gerade bei ihm war es doch von Anfang an abzusehen. Der war und bleibt ein Taugenichts!«, mischt sich ein ihnen gegenübersitzender Mann ein.
Kurz frage ich mich, wer er sein mag und was er getan hat, um ein so hartes Urteil zu verdienen, doch dann erspähe ich meine Freundinnen. Sie waren während meines Telefonates vorausgegangen und haben sich zu viert an ein Tischende in Fensternähe gequetscht. Maike winkt mich rüber. Ihr kupferrotes Haar trägt sie jetzt wieder offen und es schimmert leicht im Schein der Lampen, doch sie selbst sieht noch blasser aus als vorhin auf dem Friedhof. Dadurch stechen ihre zahllosen Sommersprossen deutlich heraus. Vor ihr liegen Fotos von Leon, ihrem sechsjährigen Sohn. »Und?«, fragt sie mich. »Schleppen sie dich ab?«
»Ja, aber blöderweise muss ich dabei sein. Aus versicherungstechnischen Gründen. In knapp vierzig Minuten kommt der Abschleppwagen, aber ich kann doch hier nicht einfach so gehen, oder?«
»Es wird schon niemand merken«, beruhigt mich Maike. »Außerdem kannst du doch nichts dafür, dass du eine Autopanne hast.«
»Sehe ich auch so, und bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, also setz dich endlich!«, mault Schoscho, die eigentlich Charlotte heißt. Wie wir auf Schoscho kamen, weiß ich inzwischen gar nicht mehr. Sie ohne eine ihrer Mützen oder Kappen zu sehen, die sonst wie festgewachsen auf ihrem Kopf sitzen, ist ungewohnt. »Ich krieg ja Nackenschmerzen, wenn ich dauernd zu dir hochsehen muss.«
»Leichter gesagt als getan«, gebe ich zurück und blicke mich nach einem freien Stuhl um, doch ich muss nicht lange suchen, denn erneut wird mir Hilfe zuteil.
»Nehmen Sie meinen. Ich hole mir von draußen einen anderen.«
Überrascht drehe ich mich und sehe mich wieder einmal Thomas gegenüber. Doch bevor ich widersprechen kann, hat er den Stuhl, den er getragen hat, vor mir abgestellt und wendet sich wieder zum Gehen.
»Äh, danke«, murmle ich perplex.
»Hab ich nen Knick in der Optik oder war das gerade tatsächlich der Traum unserer jugendlichen Nächte?«, fragt Schoscho verblüfft, während ich ebendiesem Traum immer noch hinterherstarre.
»Wenn nicht, dann müssen wir wohl beide zum Augenarzt.« Cleos Finger spielen mit den Spitzen ihrer schwarzen Haare. Ihr Bob mit dem gerade geschnittenen Pony ist offenbar nach wie vor ihr Markenzeichen. Er ist es auch, der ihr schon früh zu ihrem Spitznamen verholfen hat, denn eigentlich heißt sie Lena. Doch ihres blutroten Lippenstifts wegen wirkt sie heute weniger wie Cleopatra als vielmehr wie Schneewittchen.
Ich blicke erneut zur Tür, von Thomas ist jedoch nichts mehr zu sehen. Leider. Als ich mich wieder umdrehe, treffe ich auf Lisas durchdringenden Blick. Hastig bemühe ich mich um einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck und quetsche mich samt meinem Stuhl zwischen Maike und Cleo.
Lisa hat derweil nach jedem Blick in die Speisekarte wild in ihr Handy getippt. Nun ruht es endlich. »Was ist daran so verwunderlich, dass Thomas da ist? Das ganze Dorf scheint doch hier zu sein.« Sie sieht sich aufmerksam um.
»Suchst du nach Marcel?«, fragt Cleo.
»Nein!«, schnappt Lisa, doch die leichte Röte in ihrem Gesicht beweist das Gegenteil.
»War er denn bei der Beerdigung?«, frage ich und Cleo nickt: »Er ...«
»Könnten wir bitte aufhören, über ihn zu sprechen?«, fällt Lisa ihr ins Wort. Ich kann sie verstehen. Es muss schwer sein, nach so vielen Jahren auf die erste große Liebe zu treffen, mit der man mit achtzehn sogar verlobt war. Vor allem, da diese große Liebe die Verlobung aus heiterem Himmel gelöst hat.
Offenbar darum bemüht, vom Thema abzulenken, nickt Lisa in Richtung des Tisches von Natties Eltern. »Guck mal, Schoscho!«
Auch ich sehe hinüber und mein Blick fällt auf einen großen Mann mit angegrautem Haar, der genauso hager aussieht wie vor über zehn Jahren. Es ist Alexander von Hilsenhain, genannt Alex, Besitzer des örtlichen Pubs. Vermutlich hat er gut daran getan, ihm nicht seinen Nachnamen zu geben, sondern es einfach ›Mc Leod’s‹ zu nennen.
Vor allem aber ist er Schoschos Vater.
Schoscho schrumpft in sich zusammen und hebt die Speisekarte vor ihr Gesicht.
»Sprecht ihr immer noch nicht miteinander?«, frage ich. Schoscho scheint förmlich in die Karte hineinkriechen zu wollen und schüttelt wortlos den Kopf.
Ich seufze. »Willst du dich nicht endlich einmal mit ihm versöhnen?«
»Nein.« Sie starrt weiter stur auf die sehr überschaubare Vorspeisenauswahl. »Das, was er getan hat, ist unverzeihlich!«
Unschlüssig, wie wir uns verhalten sollen, blicken wir anderen uns an, und vor allem Cleo wirkt sehr betrübt. Uns allen war das Mc Leod’s neben dem Scardellis eine zweite Heimat, doch Cleo, die seit jeher mit besonderer Intensität an Kneipen aller Art hing, war besonders untröstlich, als Schoscho und ihr Vater sich verkrachten.
Ich wende mich wieder Alex zu. Mir scheint, dass auch er krampfhaft darum bemüht ist, nicht in unsere Richtung – oder vielmehr: nicht in die Richtung seiner Tochter – zu sehen. Schade. Ich mochte seinen trockenen Humor immer sehr gerne.
Eine braunhaarige Kellnerin hat gerade seine Bestellung aufgenommen, eilt nun weiter zwischen den Reihen hindurch und bleibt vor ... oh ... Thomas stehen.
Er hat offenbar wieder Platz genommen, und zwar neben einer Mittfünfzigerin mit eindeutig zu viel Make-up, die für ihre aufgetürmte Frisur sicher eine ganze Flasche Haarspray verbraucht hat. Jede Strähne des zu stark blondierten Haares ist erdbebensicher einbetoniert.
Echt blöd, dass Thomas jetzt so weit von unserem Tisch entfernt sitzt.
»Wenn mein Vater nicht in der Pizzeria so unentbehrlich wäre«, höre ich mit halbem Ohr Lisa weiter reden, »wäre er auch gekommen.«
»Dass der immer noch so knackig aussieht, ist echt unglaublich«, murmele ich.
Lisa sieht mich schockiert an.
»Nicht dein Vater!«, beeile ich mich zu erklären. »Ich meinte doch Thomas ... Nicht hingucken!« Doch es ist bereits zu spät: Sämtliche Köpfe haben sich erneut in die entsprechende Richtung gewandt. »Also, nur rein objektiv betrachtet«, füge ich hastig hinzu.
»Von der Bettkante stoßen würde ich jemanden wie ihn unter normalen Umständen auch nicht«, pflichtet Cleo mir bei.
»Aber die Umstände sind nicht normal«, erinnert uns Maike mit leiser Stimme.
Betretenes Schweigen ist die Folge.
Schoscho zuckt die Achseln und wirft ihr Haar nach hinten. »Das liegt doch aber schon zig Jahre zurück. Und es war doch ohnehin nur ne kurze Sache von zwei Monaten oder so. Wenn es diese Beziehung zwischen Nattie und ihm überhaupt gegeben hat. Ich habe sie jedenfalls nie zusammen als Paar gesehen.«
»Wie willst du denn auch irgendetwas mitbekommen, wenn du die ganze Zeit in der Weltgeschichte herumgurkst oder von irgendwelchen Brücken springst?«, entgegne ich ungerührt.
»Das nennt sich Bungee Jumping. Und trotzdem: Wie man ein solches Sahneschnittchen wie unseren knackigen Sportlehrer wieder ziehen lassen kann, ist mir ein Rätsel. Ich hätte ihn ja an mein Bett gefesselt.« Doch Schoschos Versuch, die Stimmung wieder zu heben, läuft ins Leere, denn jetzt ist kein Herumreden um den heißen Brei mehr möglich. Wir müssen uns dem Thema stellen.
Lisa fasst sich als Erste wieder. »Ich habe es von meinen Eltern erfahren. Die haben mich in meiner Praxis angerufen.«
»Mir haben es auch meine Eltern gesagt«, führe ich den Faden fort. »Unsere Pächter hatten sie informiert.«
Cleo fährt sich mit der Hand über die Augen. »Mir hat es meine Mutter erzählt. Es war schon Nacht. Ich hatte Nattie eigentlich an dem Tag noch anrufen wollen.«
Bamm.
»Was ist?«, fragt Lisa angesichts meines schmerzerfüllten Gesichts.
»Sodbrennen«, erkläre ich kläglich. Nattie ... Anruf ... Ich atme tief durch, doch das schlechte Gewissen hält mich weiterhin mit seinen spitzen Krallen gepackt.
»Es ging angeblich ganz schnell«, sagt Maike zögerlich und starrt die speckige Tischplatte an.
»Ja.« Schoscho nickt. »Ein schwacher Trost, aber immerhin. Oben, bei den Serpentinen im Wald soll es ja passiert sein. Ist aber auch eine verdammt gefährliche Stelle. Eigentlich ein Wunder, dass es da nicht schon viel früher zu einem Unfall gekommen ist. Ich hatte schon überlegt, ob wir vielleicht an dem Baum einen Kranz anbringen und Blumen ablegen sollten.«
»Ja, eine gute Idee«, stimme ich zu.
»Lasst uns aber erst einmal abwarten, was ihre Eltern an der Unfallstelle machen«, wendet Lisa ein und wiegt bedächtig ihren Kopf. »Ich will ihnen da nicht vorgreifen.«
Ich sehe zu Natties Eltern rüber. Mein Blick trifft auf den der Mutter. Ihre Stirn ist gerunzelt. Hastig sehe ich wieder weg.
»Auch wieder wahr.« Schoscho nickt, und einige Minuten lang hängen wir alle unseren Gedanken nach. Meine sind nicht dazu geeignet, mein Sodbrennen zu mildern. Ich unterdrücke meinen Drang, wieder zu Frau Sonnwickler zu sehen, und rutsche unruhig auf meinem Stuhl hin und her.
Die Gespräche um uns herum werden allmählich lauter.
»Es war eine schöne Predigt«, stellt Maike schließlich mit leiser Stimme fest.
»Ja«, nickt Cleo, »auch wenn ich die Sache mit dem Sand in der Wüste und dem Wasser im Meer nicht ganz verstanden habe.«
»Es ist schon komisch«, fährt Maike, Cleos Einwand ignorierend, fort. »Hier so ohne sie zu sitzen. Ich ... ich wünschte, wir hätten es vor ihrem Tod geschafft, uns alle noch einmal zu treffen. Ich meine, früher haben wir doch jede freie Minute miteinander verbracht. Wir hätten nicht zulassen dürfen, dass das so vollkommen abreißt.«
Mit betretenen Mienen sehen wir uns an.
»Ich finde, wir sollten – um Nattie zu ehren – gleich heute damit anfangen, das zu ändern«, sage ich. Ich muss sofort die nächste Apotheke suchen! Ich brauch was hardcore-mäßiges gegen Sodbrennen! »Ich muss ja leider gleich zu meinem Wagen, aber wie wäre es, wenn wir uns nachher noch mal treffen? Vielleicht im ...«
»Scardelli’s«, beenden die anderen im Chor meinen Satz und wir müssen lachen. Dann wird uns wieder bewusst, wo wir sind, und wir senken hastig unsere Stimmen.
»Wie in alten Zeiten, was?«, flüstert Lisa.
»Genau«, stimmt Cleo zu, während Schoscho plötzlich ungläubig auf meine schwarzen Louboutins mit dem 12-cm-Absatz deutet. »Bist du etwa zu Fuß hierher gelaufen? In den Dingern?«
»Nein. So ein Typ hat mich auf seinem Traktor mitgenommen.«
»Dann frag den doch, ob er dich jetzt zu deinem Wagen fährt.« Schoscho grinst.
»Um Gottes willen. Niemals würde ich freiwillig noch einmal mit dem mitfahren. So ein Bauer! Im wahrsten Sinne des Wortes!«
»War er denn aus Himmelreich?«, fragt Maike.
»Keine Ahnung. Ich hab ihn nicht gefragt.«
»Vielleicht war es ja der alte Krausberger. Du müsstest an seinem Hof vorbeigekommen sein. Hatte er einen Bart, abstehende Ohren und dicke Tränensäcke?«
»Nein. Eine Rasur hatte der zwar dringend nötig, aber alt war er nicht. Und er hatte auch weder Tränensäcke noch abstehende Ohren. Aber das ist ja auch egal. Bauer ist Bauer.«
»War das nicht immer der Lieblingsspruch deines Vaters?«, hakt Lisa zu meinem Leidwesen nach, während Maike verwundert von der Karte aufsieht. »Dein Opa war doch auch Bauer.«
»Nein«, stelle ich würdevoll klar. »Er war Gutsbesitzer.« Die amüsierten Blicke der Mädels ignoriere ich, schließlich legen meine Eltern immer sehr viel Wert auf diese Unterscheidung. »Aber wie auch immer: Kann mich eine von euch zu meinem Wagen fahren? Oh, und ich darf nicht vergessen, meine Koffer rauszuholen. Die wollte dieser trottelige Traktorist nämlich nicht mitnehmen.«
»Mehrere Koffer?«, hakt Schoscho nach.
»Ja, ich muss ein paar Tage bleiben«, erkläre ich. »Ein paar Sachen regeln, die mit dem Gut zusammenhängen.« Ich will nicht dorthin! Ich will einfach nicht! Erneut reibe ich mir über mein Brustbein, dort, wo dieser brennende Schmerz sich eingenistet hat. »Ich hoffe, ich finde hier irgendwas gegen Sodbrennen.«
»Sex«, sagt Lisa.
»Was?« Wir gucken sie verdutzt an.
»Sodbrennen kommt auch von zu viel Stress. Und gegen Stress hilft Entspannung. Und was entspannt am besten? Richtig: Sex.«
»Also den Doktor möchte ich sehen, der Sex als Therapiemaßnahme verordnet!«, sagt Cleo mit einem schiefen Lächeln. »Ich wäre seine Stammpatientin!«
»Und wo willst du wohnen?«, nimmt Schoscho den Faden wieder auf, während sie mit ihren Ringen spielt.
»Auf dem Gut. Ist so mit den Pächtern abgeklärt.« Während ich spreche, schweift mein Blick erneut zu Natties Mutter. Sie scheint uns nicht aus den Augen zu lassen, während ihre Finger dazu übergegangen sind, die Serviette zu zerfetzen. Oder starrt sie etwa konkret mich an? So langsam wird mir das ein bisschen unheimlich. »Sagt mal ... dass Natties Mutter vorhin ohnmächtig geworden ist ... Der Grund war doch nur die nervliche Anspannung, nicht wahr? Und nicht ...« Ich schüttle den Kopf, der Gedanke, dass sie zusammengebrochen sein könnte, weil sie mich gesehen hat, ist zu absurd, um ihn auszusprechen.
»Und die Erschöpfung. Sie hat sicher seit Tagen nicht geschlafen«, ergänzt Maike leise. »Noch dazu, wo Nattie ja bei ihnen gelebt hat. Jeden Tag am Zimmer der toten Tochter vorbeigehen zu müssen ... ihre Sachen zu sehen ... daran zu riechen ...«
Mitfühlend lege ich ihr meine Hand auf den Arm und ernte einen dankbaren Blick, denn sie spricht leider nicht nur aus ihrem Berufsleben als Krankenschwester heraus, sondern auch aus eigener Erfahrung.
»Wieso fragst du?« Lisa sieht mich aufmerksam an.
»Es ist bestimmt nur Einbildung, aber ...«, ich winde mich, »ich habe schon die ganze Zeit den Eindruck, als würde sie uns anstarren.«
Eine Weile herrscht Stille, in der immer wieder eine von uns zum Tisch von Natties Eltern schielt. Schließlich meldet sich Cleo als Erste zu Wort: »Du hast recht. Sie starrt uns wirklich an.«
»Ununterbrochen«, ergänzt Schoscho.
»Und als sie vorhin ohnmächtig wurde, war das doch in dem Moment, als sie dich sah, oder?« Lisa blickt zu mir. Unbehaglich schlinge ich die Arme um meinen Oberkörper. »Als sie uns beide gesehen hat«, korrigiere ich. »Du bist doch direkt hinter mir gestanden.«
»Hm.« Lisa linst noch einmal zu Natties Mutter und runzelt dann nachdenklich die Stirn.
Ich fühle mich deutlich unwohl und sehe demonstrativ auf meine Armbanduhr. »Ich muss jetzt wirklich los. Könnte mich eine von euch kurz hinfahren?«
Lisa steht auf. »Ich mach das.«
Ich erhebe mich ebenfalls. »Wir sehen uns nachher, Mädels.«
Kaum haben wir den Ausgang erreicht, warne ich Lisa: »Wehe, du versuchst, mich zu analysieren!«
»Dich muss ich nicht analysieren. Bei dir reicht ein Blick, um zu wissen, was Sache ist.«
»Ach ja?«, gebe ich missmutig zurück, öffne die Tür und wäre beinahe in jemanden hineingelaufen.
»Ich hab’s ja schon gesagt: zu viel Stress. Du hattest wahrscheinlich seit Monaten keinen Sex«, erklärt Lisa lautstark hinter mir, während mir bewusst wird, dass mir derjenige, dem da gerade die Kinnlade runterfällt, sehr bekannt vorkommt.
Ich bin wie angewurzelt stehen geblieben. Lisa hinter mir leider nicht und daher finde ich mich im nächsten Moment in den nach Erde und ... Kuhmist?! ... riechenden Armen meines Traktoristen wieder. Hastig reiße ich mich los und registriere mit Entsetzen, dass er zwar nicht mehr im dreckigen Regencape, aber dafür in einem sogar noch schmuddeligeren, schreiend-scheußlichen karierten Hemd und Hochwasser-Cargohosen vor mir steht.
Ich hoffe brennend, dass er Lisas Spruch gar nicht gehört hat. Seine hochgezogene Augenbraue deutet leider auf das Gegenteil hin.
»Das erklärt einiges«, murmelt er.
Ich laufe rot an. »Ich bin gestolpert.«
»Was für ein Zufall.«
War da etwa Ironie in seiner Stimme?
Ich strecke das Kreuz durch und richte mich zu meiner – den Absätzen meiner Schuhe sei Dank – beeindruckenden Größe auf. »Also, um hier mal etwas klarzustellen: Falls Sie gerade eben andeuten wollten, dass ich mit Absicht gestolpert bin, dann ...«
»Sie haben sich mir an den Hals geworfen.«
»... können Sie – was?»
Ich schnappe empört nach Luft. »Glauben Sie mir: Wenn ich mich jemandem an den Hals werfe, sieht das definitiv anders aus. Also, ich meine, wenn ich das tun würde, denn selbstverständlich tue ich das nicht und …« Ich räuspere mich und setze noch einmal neu an. »Darum geht es hier auch gar nicht! Fakt ist: Ich bin gestolpert! Und jetzt gehen Sie bitte aus dem Weg. Ich habe es wirklich eilig. Ein dringender Termin!«
»Wollen Sie zur Maniküre oder was?«
»Und wenn? Ein bisschen mehr Körperpflege würde Ihnen auch nicht schaden! Wie können Sie nur in solch einem Aufzug zu einem Beerdigungsessen erscheinen?«
»Gar nicht.«
»Was?«
»Ich suche nur meinen Bruder.«
Oh. »Egal. Das ändert nichts.«
»Woran?«
»Daran, dass Sie kein Benehmen haben. So betritt man kein Lokal.«
Jetzt ist er derjenige, der tief Luft holt. »Ich fahre Sie trotz Ihrer Zickerei bis nach Himmelreich, und jetzt muss ich mir von Ihnen so einen Unsinn anhören?