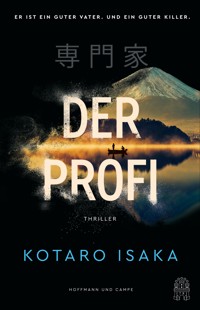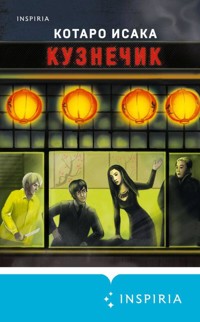Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In der Unterwelt von Tokio begegnen drei kaltblütige Auftragskiller ihrem Meister: einem von Rache getriebenen Mathematik professo r. Drei Auftragskiller mit eigenen Methoden: Die Zikade tötet mit dem Messer. Der Pusher stößt Menschen vor Autos. Und d er Wal treibt seine Opfer dazu, sich selbst das Leben zu nehmen. Die Drei gelten in Tokios Unterwelt als unerreichte Meister ihres Fachs. Das ändert sich schlagartig, als sie auf Suzuki treffen, einen einfachen Mann und ehemaligen Mathematikprofessor, der ein glückliches Leben führte, bis seine Frau ermordet wurde. Suzuki bringt in Erfahrung, dass der Sohn des Mafiabosses der Großstadt für den Tod seiner geliebten Frau verantwortlich ist. Getrieben von Rache begibt sich Suzuki in die Unterwelt der Metropole, die damit für die Zikade, den Pusher und den Wal zur tödlichen Arena wird.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kotaro Isaka
Suzukis Rache
Thriller
Aus dem Japanischen von Sabine Mangold
Hoffmann und Campe
Suzuki
Suzuki blickt auf das Häusermeer und denkt über Insekten nach. Es ist Nacht, aber grelles Neonlicht und die Straßenbeleuchtung lässt die Szenerie taghell erscheinen. Ein Gewimmel von Menschen, wohin man auch blickt. Sie sehen aus wie schrill bunte, krabbelnde Insekten.
Suzuki, unangenehm berührt, fällt eine Bemerkung ein, die sein ehemaliger College-Professor zehn Jahre zuvor geäußert hatte.
»Im Tierreich findet man das höchst selten, dass Einzelwesen freiwillig so dicht zusammengepfercht leben. Der Mensch ist offenbar gar kein Säugetier, sondern ähnelt eher Insekten«, behauptete er mit einem gewissen Stolz. »Wie Ameisen oder Heuschrecken.«
»Ich habe Aufnahmen von Pinguinen gesehen, die eng zusammen in Kolonien leben. Sind Pinguine auch Insekten?«
Es war Suzuki, der die Gegenfrage stellte. Gar nicht mal in böser Absicht.
Der Professor lief rot an.
»Pinguine spielen keine Rolle«, gab er unwirsch zurück.
Es klang so herrlich naiv, und Suzuki erinnert sich, dass er damals dachte: so möchte ich auch mal sein.
Dabei kommt ihm seine Frau in den Sinn, die vor zwei Jahren gestorben ist. Sie fand die Geschichte nämlich total witzig.
»In einer solchen Situation musst du einfach antworten: ›Sie haben völlig recht, Herr Lehrer!‹ – und schon ist alles in Butter.« So lautete ihr Ratschlag.
Zumindest schien das für sie zu gelten, denn sie war immer bester Laune, wenn er ihr zustimmte: »Du hast recht, meine Liebe.«
»Worauf wartest du noch? Schmeiß ihn da rein.«
Suzuki erschrickt, als er hinter sich Hiyokos drängende Stimme vernimmt.
Kopfschüttelnd versucht er die Gedanken an seine verstorbene Frau zu verscheuchen und bugsiert den Körper des jungen Manns in den Wagen. Ein langer Lulatsch mit blonder Mähne plumpst auf den Rücksitz der Limousine. Bewusstlos. Er trägt einen schwarzen Lederblouson, unter dem ein dunkles Hemd hervorlugt. Auf schwarzem Untergrund breitet sich ein Muster mit wimmelnden Insekten aus. Grässlich! Das Muster passt zu dem Typen, ebenfalls grässlich!
Auf dem Platz daneben befindet sich bereits eine andere Person. Suzuki hatte sie ebenfalls mit Ach und Krach nach hinten ins Auto verfrachtet. Eine junge Frau Anfang zwanzig. Lange schwarze Haare, gelber Mantel. Mit geschlossenen Augen, den Mund halb geöffnet, lehnt sie an der Rückbank. Dem Atemgeräusch nach scheint sie tatsächlich zu schlafen.
Suzuki schiebt die Beine des Mannes in den Wagen und wirft die Tür zu.
»Steig ein!«, befiehlt Hiyoko.
Suzuki öffnet die Beifahrertür und setzt sich nach vorn.
Die Limousine parkt direkt am nördlichen Ausgang der U-Bahn-Station Fujisawa-Kongocho. Vor ihnen liegt eine belebte Kreuzung mit Zebrastreifen.
Obwohl es bereits halb elf abends ist, herrscht in Shinjuku sogar in der Woche mehr Betrieb als tagsüber. Besoffene wie Nüchterne und Hunderte Katzen treiben sich hier zu etwa gleichen Teilen herum.
»Und, war doch ganz einfach, oder?« Hiyoko klingt völlig gelassen. Ihr blasses Gesicht, schimmernd wie Porzellan, tritt im dunklen Wageninneren besonders deutlich zum Vorschein. Das kurz geschnittene, kastanienbraune Haar bedeckt knapp die Ohren. Ihre Miene hat etwas Kaltes an sich, was vielleicht an den Schlupflidern liegt. Sie hat knallroten Lippenstift aufgelegt und trägt eine weiße Bluse, tief ausgeschnitten. Der kurze Rock reicht ihr kaum bis zum Knie. Angeblich ist sie Ende zwanzig, also etwa genauso alt wie Suzuki, wirkt jedoch älter oder aber einfach nur abgeklärt. Man könnte meinen, sie sei ein vergnügungssüchtiges Partygirl, aber Suzuki weiß, dass sie klug und gebildet ist. Ihre Füße stecken in Stöckelschuhen, er wundert sich, wie man damit Auto fahren kann.
»Einfach oder schwierig, ich habe sie lediglich in den Wagen gehievt.« Suzuki schneidet eine Grimasse. »Ich habe das bewusstlose Pärchen nur zum Wagen geschleppt und nach hinten verfrachtet.«
Für alles Weitere bin ich nicht verantwortlich, will er damit sagen.
»Wenn du Schiss hast, wirst du es nicht weit bringen. Deine Probezeit ist bald vorbei, mit Manschetten wirst du es zu nichts bringen. Ich wette, du hast nie daran gedacht, dass du mal Leute wie die beiden Kids hier entführen wirst.«
»Natürlich nicht!«
In Wahrheit ist Suzuki keineswegs überrascht. Er hat die Agentur von vornherein nicht für seriös gehalten. »Furoirain ist doch ein deutsches Wort und bedeutet ›junge Frau‹, richtig?«
»Du kennst dich aus. Wahrscheinlich hat Terahara selbst die Firma so getauft.«
Suzuki verkrampft sich sofort, als er den Namen aus Hiyokos Mund vernimmt. »Der Alte?« Er meint den Chef.
»Wer sonst? Sein Söhnchen, die Flasche, wäre doch sogar dafür zu blöd.«
Suzuki muss abermals an seine tote Frau denken, und die Emotionen kochen in ihm hoch.
Er spannt die Bauchmuskeln an und reißt sich am Riemen. Jedes Mal, wenn von Terahara junior die Rede ist, ist er kurz davor, die Beherrschung zu verlieren.
»Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich eine Agentur namens Furoirain an junge Mädels ranmacht«, schafft er gerade noch, sich herauszureden.
»Absurd, oder?«
Hiyoko ist schon länger in der Firma, was ihr trotz des gleichen Alters eine ganz andere Position als Suzuki verschafft. Seit einem Monat gehört er zur Truppe, und sie bringt ihm bei, was er zu tun hat. Seine Aufgabe bestand bisher lediglich darin, in einer Einkaufspassage herumzulungern und Passantinnen zu akquirieren.
Er hält sich an belebten Spots auf und quatscht sie unverfroren an. Sie lehnen ab, ignorieren oder beschimpfen ihn sogar, was ihn jedoch nicht davon abhält, unverdrossen weiterzumachen. Die meisten Frauen gehen einfach weiter. Es hat nichts mit besonderem Einsatz, Raffinesse oder Taktik zu tun. Sie mögen angewidert das Gesicht verziehen, ihn misstrauisch beäugen oder einen großen Bogen um ihn machen, ihm bleibt keine Wahl, als stur auf sie einzureden.
Trotzdem findet sich pro Tag mindestens eine Frau, eine unter tausend, die sich interessiert zeigt. Mit der geht er dann in ein Café, wo er sie mit Angeboten von Kosmetikprodukten und Fitnessdrinks volllabert. »Die Wirkung tritt nicht sofort ein, aber schon nach einem Monat werden Sie dramatische Veränderungen bemerken«, verspricht er ihr das Blaue vom Himmel, belegt es mit überzeugenden Argumenten und präsentiert entsprechende Broschüren. Farbenfroh gestaltet, mit imposanten Graphiken und Zahlen, aber im Grunde alles Lug und Trug.
Leichtgläubige Frauen gehen den Vertrag auf der Stelle ein, die anderen zögern, sie würden ›es sich überlegen‹, und ziehen ab. Falls er doch noch eine Chance wittert, läuft er ihnen nach. Dann übernimmt ein Sondertrupp, der den Frauen bis zu ihren Wohnungen auf die Pelle rückt und sie auf nicht immer legale Weise zur Unterschrift nötigt. Angeblich. Er hat bisher nur davon gehört.
»So, du bist nun einen Monat bei uns. Können wir zum nächsten Level übergehen?«
Das hat sie vor einer Stunde zu ihm gesagt.
»Das nächste Level?«
»Du willst ja wohl nicht bis in alle Ewigkeit fremde Frauen auf der Straße anbaggern, oder?«
»Na ja«, war er ausgewichen. »Eine Ewigkeit wäre vielleicht ein bisschen lange.«
»Heute erwartet dich ein neuer Job. Wenn du das nächste Mal jemanden ins Café abschleppst, begleite ich dich.«
»Jemanden zu ködern, ist nicht gerade Pillepalle«, hatte er aus einmonatiger Erfahrung mit einem schiefen Grinsen geantwortet.
Doch glücklicherweise – oder auch nicht – hatte er binnen einer Stunde zwei Jugendliche festgenagelt, die ihm auf den Leim gegangen waren. Das Pärchen, das jetzt hinter ihm auf der Bank schlummert.
Die junge Frau hatte zuerst angebissen.
»Hey, findest du nicht, dass ich Model werden könnte, wenn ich abnehme?«, sagte sie leichthin zu ihrem Freund, der ihr sofort schmeichelte: »Aber klar. Du hast echt das Zeug dazu. Du hättest alle Chancen.«
Suzuki rief Hiyoko an, ging mit dem Pärchen ins Café und pries wie üblich seine Produktpalette an.
Mangelte es ihnen nun an Wachsamkeit oder waren sie einfach nicht clever genug und zu unerfahren? Jedenfalls waren sie voll darauf eingestiegen und ließen sich um den Finger wickeln. Beim geringsten Kompliment leuchteten die Augen des ›Models‹, und beide nickten begeistert zu den Angaben in den Broschüren, die vorn und hinten nicht stimmten.
Angesichts ihrer gnadenlosen Naivität machte Suzuki sich fast Sorgen um die beiden. Er wurde plötzlich eingeholt von Erinnerungen an seine Schüler vor zwei Jahren, als er noch Lehrer war. Besonders lebhaft kam ihm einer von den Kids in den Sinn. ›Was sein muss, erledige ich schon‹, hatte der Jugendliche zu Suzuki gesagt. Er stammte aus der letzten Schulklasse, die Suzuki betreut hatte. Sonst wurde er wegen seines rüpelhaften Betragens von den Mitschülern gemobbt, aber einmal hatte er großes Lob erhalten, weil er im Einkaufszentrum einen Handtaschendieb überwältigen konnte. »Was sein muss, erledige ich schon.« Bei dem Satz lächelte er Suzuki an, verschämt, aber auch ein wenig stolz. »Geben Sie mich nicht so schnell auf, Herr Lehrer!«, hatte er hinzugefügt und auf einmal wie ein kleiner Schuljunge gewirkt. Der picklige Typ vor ihm, der gerade in der Broschüre blätterte, erinnerte Suzuki an seinen damaligen Schützling. Er wusste, dass er diesem Wildfremden noch nie begegnet war, aber die Ähnlichkeit war verblüffend.
Dann bemerkte er, wie Hiyoko aufstand und zum Tresen ging, um Kaffee nachzuschenken. Ihm fiel auf, dass sie dort an den Tassen herumhantierte. Aha, sie schüttete Drogen hinein. Kurz darauf bekamen die beiden einen glasigen Blick und waren kurz davor einzunicken. Das Mädchen lallte: »Ich bin die ›Gelbe‹ und er ist der ›Schwarze‹. Das sind nur Spitznamen, nur Spitznamen. Deshalb trage ich einen gelben Mantel und er schwarze Klamotten. … Mann, ich bin so müde …« Der Rest war nur noch Gemurmel. Sie sackte weg. Ihr Begleiter quasselte ebenfalls wirres Zeug: »Aber ich habe dafür blondes Haar und du schwarzes … Was ist denn los?«, kam ihm gerade noch über die Lippen, bevor auch er wegkippte.
»Los, schaffen wir sie ins Auto«, hatte Hiyoko befohlen.
»Diese beiden Hohlköpfe sind lukrative Ware, je nachdem, wofür man sie verwendet«, erklärt sie, hörbar gelangweilt.
Würde das auch für meine Schützlinge gelten? will Suzuki zurückfragen, verkneift es sich aber noch rechtzeitig.
»Sag, sollten wir nicht los?«
»Normalerweise schon …«
Hiyokos Tonfall wurde schärfer.
»Aber heute läuft es anders.«
Eine böse Vorahnung ergreift ihn.
»Was meinst du damit?«
»Ich muss dich erst testen.«
»Wozu denn testen?«
Seine Stimme bebt leicht.
»Ob man dir trauen kann.«
»Mir?« Er schluckt.
»Wieso das denn?«
»Na ja, da ist so einiges … Die von der Agentur sind schon fast krankhaft misstrauisch. Du wirkst so seriös. Was hast du gemacht, bevor du zu uns kamst?«
»Lehrer.« Er sieht keinen Grund, es zu verheimlichen. »An einer Mittelschule. Mathe.«
»Na bitte, da haben wir’s. Stimmt doch, unser Riecher. Deine ganze Ausstrahlung! Ein Mathelehrer an der Mittelschule – wieso sollte der sich auf ein derartiges Unternehmen einlassen, besonders eins, das sogar so weit geht, junge Menschen reinzulegen? Passt nicht so ganz, oder?«
»Ooch, was mich betrifft, passt das ganz gut.«
»Tut es nicht.«
Stimmt. Es haute nicht hin.
»Wie du weißt, befinden wir uns gegenwärtig in einer Rezession. Heutzutage ist es schwer, einen Job zu kriegen. Als ich davon erfuhr, dass eure Agentur Furoirain Leute sucht, habe ich mich einfach darum beworben.«
»Hör auf zu spinnen!«
»Wirklich!« Es war gelogen. Suzuki hatte durch eigene Nachforschungen die Firma ›Furoirain‹ entdeckt. Er merkt, dass ihm der Atem stockt. Sein Brustkorb hebt und senkt sich. Das ist kein Geplänkel. Es ist ein Verhör.
Er schaut aus dem Fenster. Junge Leute scharen sich um den Springbrunnen links vor dem Hotel. Obwohl es erst Anfang November ist, leuchten von den riesigen Werbeflächen an den Gebäuden Weihnachtsthemen, und auch die Bäume sind schon festlich geschmückt. Verkehrslärm und die johlenden Stimmen junger Leute erfüllen die Luft, vermischen sich wie Öl und Wasser mit dem Qualm rauchender Passanten.
»Du wusstest ganz genau, dass wir kein seriöser Laden sind. Aber hast du ’ne Ahnung, wie die Geschäfte wirklich laufen?«
»Was soll ich dazu sagen? »Mit einem gequälten Lächeln schüttelt er den Kopf. »Ich kann es mir nur vorstellen.«
»Na, dann leg mal los!«
»Mir ist inzwischen klar, dass das Zeug, was ich als Fitnessprodukt verkaufe, nicht sauber ist. Die bleiben doch irgendwie daran hängen, werden süchtig.«
»Du meinst, wir fixen die an?«
»Ja, so in etwa.«
In den letzten vier Wochen waren ihm immer wieder Frauen begegnet, die Produkte von Furoirain konsumierten. Sie waren alle hochgradig nervös und hatten stark gerötete Augen. Die meisten von denen hatten ihn verzweifelt angefleht, er möge »schnellstens mehr schicken«. Ihre Haut war spröde und rissig, ihre Stimmen klangen heiser. Das waren keine Frauen auf Diät – sie wirkten eher wie Junkies.
»Stimmt.«
Hiyokos Miene bleibt ausdruckslos.
Das ist kein Quiz. Suzuki verzieht das Gesicht. »Ist doch aber eigentlich wenig effizient, Leute auf der Straße anzuquatschen. Das ist wie Angeln mit einer Rute statt Fischen mit dem Netz. Der Aufwand steht doch in keinem Verhältnis zum Ertrag, oder?«
»Keine Sorge! Wir haben da noch ein paar andere Tricks auf Lager.«
»Und die wären?«
»Wir veranstalten hin und wieder Beauty-Seminare in großen Hallen, wozu wir scharenweise Mädchen einladen. Wie im Sommerschlussverkauf verhökern wir dort Unmengen an Produkten.
»Und die gehen euch auf den Leim?«
»Weil wir mit etlichen Lockvögeln arbeiten. Vier von fünf der Besucher arbeiten für uns und kurbeln den Kaufrausch an.«
»Heißt das, die übrigen lassen sich mitreißen?«
Er weiß von solchen Machenschaften mit Senioren.
»Schon mal von der ›Truppe‹ gehört?«
»Truppe? So wie Schauspieler im Theater?«
»Nee! So nennt man die in unserer Branche.«
Mittlerweile weiß er, was sie unter »Branche« verstehen. Einen Haufen dubioser, illegaler Händler. Je mehr er darüber erfährt, umso lächerlicher findet er den ganzen Rummel, wozu auch die absurden Spitznamen gehören, die die Kriminellen sich selbst und ihresgleichen verpassen.
»Es gibt also diese ›Truppe‹, keine Ahnung, wie viele dazu gehören. Aber jeder von denen übernimmt eine bestimmte Rolle. Man kann sie praktisch für jegliche Aufgabe engagieren. Weißt du noch, damals das Attentat auf den Außenminister auf einer Bowlingbahn in Yokohama?«
»Darüber stand nichts in meinen Lehrbüchern.«
»Alle Gäste im Bowling-Center waren Mitglieder der ›Truppe‹. Durchweg Komplizen. Absolut undurchschaubar.«
»Ja, und?«
»Wir heuern die auch an. Wir engagieren sie für Veranstaltungen. Auch die Lockvögel holen wir uns von denen.«
»Innerhalb der ›Branche‹ arbeitet man also Hand in Hand.«
»Na ja, derzeit gibt’s da einige Reibereien.«
»Reibereien?«
»Ja, was bezahlt wird und was nicht bezahlt wird, darüber ist man sich uneins.«
»Aha …«, erwidert Suzuki scheinbar desinteressiert.
»Und da ist die Sache mit den Organen.«
»Organe?«
»Herzen …«
Hiyoko zählt Organe wie Waren auf.
»Nieren.«
Sie schaltet die Klimaanlage ein und schiebt den Temperaturregler nach rechts.
»Ah, die Organe.«
Suzuki gibt sich völlig unbeeindruckt.
»Weißt du, wie viele Menschen in Japan auf eine Organtransplantation warten? Unmengen, sag ich dir. Damit wird reichlich gehandelt. Ein Bombengeschäft, sozusagen.«
»Vielleicht bin ich ja zu leichtgläubig, aber ich dachte immer, hierzulande wäre es strafbar, Organe zu kaufen und zu verkaufen.«
»Meines Wissens ist das auch so.«
»So eine Firma darf man also nicht gründen, würde ich sagen.«
»Das wäre nicht das Problem.«
»Wieso nicht?«
Hiyokos Tonfall wird milder, als würde sie einem unwissenden Lehrling beibringen, wie die Gesellschaft funktioniert.
»Nehmen wir an, eine x-beliebige Bank wäre vor längerer Zeit pleitegegangen.«
»Eine x-beliebige …«
»Aber am Ende wurde sie mittels zig Billionen aus Steuergeldern gerettet.«
»Und?«
»Oder ein anderes Beispiel – die Arbeitslosenversicherung. In die alle Angestellten einzahlen. Wusstest du, dass mehrere Hundert Milliarden Yen davon in unnütze Bauprojekte fließen?«
»Davon habe ich mal in den Nachrichten gehört.«
»Es wurden zig Milliarden Yen für nutzlose Gebäude verschwendet, die nur Verluste einbrachten. Ist doch seltsam, oder? Und dann heißt es, dass die Mittel der Arbeitslosenversicherung nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken. Macht dich das nicht auch wütend?«
»Ja, schon. Sehr ärgerlich!«
»Und trotzdem kommt dieses Pack, das unsere Gelder verschwendet, ungestraft davon. Sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen, obwohl sie Milliarden, Billionen Steuergelder veruntreuen. Und obendrein kassieren sie noch eine fette Pension und können sich geruhsam aufs Altenteil setzen. Völlig verrückt. Und weißt du warum?«
»Weil die Bevölkerung so nachsichtig ist?«
»Weil die Leute, die das sagen, es stillschweigend dulden.« Hiyoko hebt den Zeigefinger. »In der Welt geht es nicht um Gut oder Böse. Die Mächtigen bestimmen die Regeln. Wer von denen protegiert wird, ist fein raus. Terahara gehört auch zu denen. Er ist mit der Politik fest verbandelt, eine Hand wäscht die andere, die reinste Vetternwirtschaft. Wenn einer von denen sagt: ›Der steht uns im Weg‹, erledigt Terahara das und geht dabei im Gegenzug immer straffrei aus.«
»Ich bin dem Boss noch nie begegnet.«
Hiyoko dreht den Rückspiegel zu sich und streicht sich über die Wimpern. Dabei wirft sie Suzuki einen Seitenblick zu.
»Du hast doch etwas mit dem Junior, diesem Volltrottel, laufen, oder?«
Suzuki zuckt zusammen, als hätte ein Pfeil ihn mitten ins Mark getroffen.
»Ich … und Teraharas Sohn … wir haben was laufen?«, echot er monoton.
»Und damit wären wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs.« Hiyoko malt einen Kreis in die Luft. »Du bist uns suspekt«, sagt sie in scherzhaftem Tonfall, als würde sie flachsen. »Was ich noch fragen wollte und beinahe vergessen hätte, bist du verheiratet?«
Sie spielt offensichtlich auf den Ring an seinem linken Ringfinger an.
»Nein«, gibt er zurück. »Bin ich nicht. Ich war’s.«
»Und trotzdem trägst du immer noch den Ehering?«
»Ich habe zugenommen und krieg ihn nicht mehr ab.«
Auch das ist gelogen. Der Ring sitzt eher locker. In der Zeit nach seiner Hochzeit hatte er abgenommen. Inzwischen muss er sogar aufpassen, dass ihm der Ring beim Laufen nicht vom Finger rutscht.
»Verlier ihn bloß nicht!«, hatte seine Frau mit ernster Miene noch kurz vor ihrem Tod gesagt. »Er ist das Symbol für unsere Verbindung. Wenn du ihn anschaust, denkst du an mich.«
Wenn er ihn verlieren würde, wäre sie bestimmt böse auf ihn, sogar jetzt noch nach ihrem Tod.
»Lass mich raten.«
Hiyokos Augen blitzen.
»Das ist kein Quiz!«
»Wahrscheinlich hat diese Flitzpiepe deine Frau auf dem Gewissen.«
Wie kann sie nur! Er ist kurz davor, die Beherrschung zu verlieren, kann sich gerade noch zurückhalten. Alles in ihm bäumt sich auf: der Blick fängt an zu flimmern, die Kehle ist wie zugeschnürt, die Brauen beben, die Ohren werden heiß. Seine Erregung steht kurz davor, aus allen Poren seines Körpers auszubrechen. Indessen spukt ihm das Bild seiner Frau – eingeklemmt zwischen Geländewagen und Telefonmast – im Kopf herum. Er will die Erinnerung verscheuchen. Spannt die Bauchmuskeln an.
»Weshalb soll Teraharas Sohn meine Frau umbringen wollen?«
»Grundlos zu töten wäre einfach typisch für diesen Psychopathen.« Hiyoko blickt zu Suzuki, als sei er voll im Bilde. »Der Idiot baut doch ständig Mist. Knackt nachts Autos, um Spritztouren zu machen. Besäuft sich und fährt dann Leute über den Haufen. So geht das tagein, tagaus.«
»Das ist ja furchtbar.« Suzuki versucht sich zu beherrschen. »Einfach nur schrecklich.«
»Mein ich doch! So etwas kann man doch nicht durchgehen lassen. Woran ist deine Frau denn gestorben?«
»Wie kommst du darauf, dass sie tot ist?«
Er stellt sich den zerschundenen Leichnam seiner Frau vor. Das Bild, das er komplett gelöscht zu haben glaubt, steigt in aller Deutlichkeit in ihm hoch. Wie sie dalag, blutüberströmt, das entstellte Gesicht mit der eingedrückten Nase, die Schultern zerschmettert …
Suzuki hatte wie betäubt danebengestanden, bis sich ein Beamter von der Spurensicherung erhob, der die ganze Zeit auf dem Boden herumgekrochen war. »Es sieht ganz danach aus, dass der Wagen nicht gebremst hat, ganz im Gegenteil, er scheint sogar beschleunigt zu haben«, hörte er ihn mehr zu sich selbst murmeln.
»Wurde sie nicht von einem Auto angefahren?«
Volltreffer! Sie hat recht.
»Wie kommst du denn darauf?«
»Soweit ich mich erinnern kann, hat der Arsch vor zwei Jahren eine Frau angefahren, die Suzuki hieß.«
Leider liegt sie richtig. »Quatsch.«
»Doch, so war es. Mir sind ständig seine Angeberstorys zu Ohren gekommen. Er kann anstellen, was er will, ohne je mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Und weißt du auch, warum?«
»Na?«
»Weil er ständig geschont und gepampert wird.« Hiyoko hebt vielsagend die Augenbrauen. »Von seinem Vater, aber auch von Politikern.«
»So in der Art, wie du das vorhin mit den Steuern und der Arbeitslosenversicherung gemeint hast?«
»Genau. Ich wette, du hast herausgefunden, wer es war und dass er nie dafür zur Rechenschaft gezogen wurde. Und dann hast du weiter nachgeforscht. Um besser an ihn heranzukommen, hast du dir einen Job in seiner Nähe gesucht, nämlich in der Firma der Teraharas.«
Hiyoko klingt, als spule sie einen auswendig gelernten Text ab. »Habe ich recht?«
»Wozu hätte ich das machen sollen?«
»Weil du dich rächen willst.«
Sie scheint überzeugt davon.
»Du suchst nach einer Gelegenheit, um es dem Hurensohn heimzuzahlen. Deshalb hast du schon einen Monat bei uns durchgehalten. Liege ich da falsch?«
Ganz und gar nicht.
»Das ist eine Unterstellung.«
»Nun …« Ihre rot geschminkten Mundwinkel heben sich. »Du bist uns schon die ganze Zeit suspekt.« Im Fenster hinter ihr zucken grell leuchtende Bilder auf dem Display einer Werbetafel.
Suzuki schluckt sichtbar.
»Deshalb meine Extraanweisungen gestern.«
»Extraanweisung?«
»Ich will einfach nur rauskriegen, ob du an das Arschloch rankommen oder echt für uns arbeiten willst. Trottel können wir hier gut gebrauchen, aber keine oberschlauen Rächer.«
Suzuki schweigt zunächst, zwingt sich jedoch kurz darauf zu einem netten Lächeln.
»Übrigens, du bist nicht der Erste.«
»Hä?«
»Es gab schon vor dir einige Kandidaten, die eine Stinkwut auf Terahara und seinen Balg hatten und sich deshalb in die Firma eingeschlichen haben, um sich an den beiden zu rächen. Wir haben schon Übung darin, wie wir das händeln. Im ersten Probemonat behalten wir sie im Auge. Und wenn sie uns dann immer noch nicht koscher erscheinen, werden sie getestet.« Hiyoko zuckt mit den Schultern. »So wie du heute.«
»Was sollen diese Anschuldigungen?« Mittlerweile spürt Suzuki Hoffnungslosigkeit in sich aufsteigen.
Die Chancen stehen schlecht, wenn andere das auch schon vergeblich versucht haben. Für eine anrüchige Firma wie Furoirain zu arbeiten und einen ganzen Monat jungen Frauen angebliche »Diätprodukte« anzudrehen, die er in Wahrheit für Drogen hielt – all das tat er doch nur, um an Terahara junior heranzukommen und den Tod seiner Frau zu rächen.
Die betrogenen Frauen hätten es besser wissen müssen, versucht er sein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Er sollte sich einfach auf sein Vorhaben konzentrieren, indem er seine Ängste und Gefühle des Anstands beiseiteschob. Aber zu erfahren, dass sein Plan ganz und gar nicht originell sei, ist schlichtweg niederschmetternd. Er fühlt sich zerstreut, machtlos, verloren.
»So, kommen wir nun zur Prüfung. Ich will sehen, ob du dich wirklich für uns eignest.«
»Ich denke, dass ich eure Erwartungen erfüllen kann.« Noch während er es ausspricht, merkt er, dass ihm seine Stimme fast versagt.
»Na, wenn das so ist …« Hiyoko weist mit dem linken Daumen auf das Pärchen auf dem Rücksitz. »Warum bringst du die beiden nicht einfach um? Zwei Fremde, mit denen du nichts zu tun hast.«
Beunruhigt dreht er den Kopf und späht auf die Rückbank.
»Wieso denn? Und warum ich?«
»Um dich von jeglichem Verdacht reinzuwaschen.«
»Aber das beweist doch gar nichts.«
»Wieso beweisen? Wir sind ein unkompliziertes Unternehmen. Spekulationen oder Unterstellungen haben wir nicht nötig. Wir halten uns an simple Regeln und Rituale. So simpel ist das: Wenn du die beiden hier ausknipst, bist du ein echtes Mitglied.«
»Echtes Mitglied?«
»Klar, die Probezeit ist vorbei, du wirst damit ein vollwertiger Kollege.«
»Aber wieso wird das von mir verlangt?«
Ohne laufenden Motor herrscht Totenstille im Wagen. Suzuki verspürt noch die Vibrationen, merkt aber bald, dass es das Pochen seines eigenen Herzschlags ist. Mit jedem Atemzug wogt sein Körper, und die Wellen übertragen sich auf den Autositz, lassen ihn erbeben. Er stößt den Atem aus und holt tief Luft, wobei ihm der Geruch der Lederpolster in die Nase steigt.
Verstört schaut er durch die Windschutzscheibe. Die auf Grün geschaltete Fußgängerampel beginnt zu blinken. Es verlangsamt sich wie in Zeitlupe. Als würde sie nie mehr auf Rot umspringen. Es blinkt und blinkt …
»Du nimmst die Pistole und knallst die beiden ab. Das wär’s schon«, holt ihn ihre Stimme in die Realität zurück.
»Und was bringt das, sie zu töten?«
»Tja, was wohl? Wenn ihre Organe taugen, könnte man sie sofort entnehmen und verhökern. Das Mädchen wäre außerdem noch als Schaustück zu gebrauchen.«
»Schaustück?«
»Klar, man könnte ihr doch Hände und Füße abtrennen.«
Er weiß nicht, inwieweit sie sich einen Scherz erlaubt hat.
»Und? Bist du bereit? Die Waffe steht zu deiner Verfügung.«
Hiyokos gestelzte Wortwahl klingt spöttisch, als sie einen unscheinbaren Gegenstand unter dem Sitz hervorholt.
Sie hält ihm die Mündung vor die Brust.
»Hör zu, falls du abhaust, erschieße ich dich!«
Was?! Suzuki erstarrt. Eine auf ihn gerichtete Waffe raubt ihm die Fähigkeit, sich zu regen. Er hat das Gefühl, jemand würde ihn aus dem schwarzen Loch des Laufs fixieren. Hiyokos Zeigefinger legt sich auf den Abzug. Es reichte, die Fingergelenke zu krümmen, und mit geringstem Kraftaufwand würde ihn blitzschnell eine Kugel durchbohren. Der Gedanke, wie leicht und fix das ginge, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren.
»Das ist die Waffe, mit der du unserem Pärchen in den Rücken schießen wirst.«
»Und was wäre«, hebt er an und wagt kaum, die Lippen zu bewegen, »wenn du mir die Waffe in die Hand drückst und ich sie stattdessen auf dich richte? Das ist selbstverständlich nur eine rein hypothetische Frage.«
Hiyoko bleibt cool. Allenfalls zeigt sich eine Spur Mitleid in ihrem Gesicht. »Noch habe ich sie dir nicht ausgehändigt. Ein Kollege ist gerade auf dem Weg zu uns. Du kriegst sie erst, wenn er da ist. Nur, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst.«
»Wer kommt denn?«
»Na, der Hurensohn«, erwidert sie wie beiläufig. »Er wird gleich hier sein.«
Suzuki verkrampft sich. Sein Kopf ist leer.
Hiyoko nimmt die Pistole in die linke Hand, um mit dem rechten Zeigefinger an die Windschutzscheibe zu tippen. Sie hält dort inne. »Er kommt von dieser Seite der Kreuzung.«
»Terahara?« In seinem Kopf scheppert es, als würde etwas darin zertrümmert. »Terahara … hierher?«
»Nicht der Alte. Der Hurensohn. Du bist ihm noch nicht persönlich begegnet, oder? Das ist doch die Gelegenheit. Er wird gleich da sein. Dann kannst du den Mistkerl kennenlernen, der deine Frau umgebracht hat.«
Hiyoko nennt seinen Vornamen, aber Suzukis Ohren sind wie taub. Wahrscheinlich, weil er es nicht wahrhaben will, dass der ein menschliches Wesen aus Fleisch und Blut ist.
»Was will der hier?«
»Er will sich selbst davon überzeugen, wie du dich verhältst. Er ist immer höchstpersönlich bei den Prüfungen zugegen.«
»Nette Angewohnheit.«
»Wusstest du das nicht?«
Er sagt nichts darauf, sondern stiert geradeaus.
Die Diagonalkreuzung rückt erschreckend nah. Horden von Fußgängern warten darauf, dass die Ampel umspringt. Als stünden sie am Gestade und schauten über das weite Meer.
Bei der Masse von Menschen fallen ihm abermals die Worte des Professors ein. Er hatte recht: das Gewimmel von Insekten.
»Ah, da ist er ja, der Hurensohn. Schau, dort!«, quietscht Hiyoko vergnügt und weist mit dem Zeigefinger in die Richtung.
Suzuki richtet sich ruckartig auf und reckt den Hals.
Schräg rechts auf dem Bürgersteig steht ein Mann in Anzug und schwarzem Mantel. Er mag wohl Mitte zwanzig sein, aber in seiner eleganten Aufmachung wirkt er irgendwie gesetzter. Sein Gesicht verzerrt sich zu einer Grimasse, als er an seiner Zigarette saugt.
Hiyoko packt den Türgriff.
»Hat der Idiot uns etwa nicht gesehen?«
Kaum hat sie es ausgesprochen, springt auch schon die Tür auf. Die Pistole noch in der Hand, winkt sie ihn mit der anderen zu sich.
Suzuki steigt auf der Beifahrerseite ebenfalls aus dem Wagen. Da ist er, das Schwein. Leibhaftig, nur zehn Meter entfernt.
Ein Ausspruch seiner verstorbenen Frau kommt ihm in den Sinn.
»Einfach machen«, hatte sie oft zu ihm gesagt und ihm bei solchen Gelegenheiten auf die Schulter geklopft. Gibt es eine Tür, muss man sie aufstoßen. Wenn sie dann offen ist, hindurchgehen. Wenn jemand da ist, sollte man mit ihm reden. Wenn einem eine Mahlzeit angeboten wird, sollte man sie essen. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, sollte man sie ergreifen. Ihr Tonfall hatte dabei so unbeschwert geklungen. Wenn sie dann online im Internet war, hieß es auch immer, man müsse es doch nur anklicken, und sie klickte alles Mögliche an, sodass ihr Computer ständig virenverseucht war.
Terahara junior steht nun zum Greifen nah vor ihm. Eine imposante Erscheinung, die alles Störende um sich herum plattmachen würde. Breitschultrig, aufrechte Statur. Er ist groß und durchaus nicht unattraktiv. Mit zusammengekniffenen Augen nimmt Suzuki ihn ins Visier. Je näher er ihn heranzoomt, umso deutlicher registriert er dessen Züge.
Ausdrucksstarke buschige Augenbrauen und eine platte Nase mit deutlichen Löchern. Ihm fallen die Lippen auf, zwischen denen die Zigarette klebt. Terahara wirft den Stummel auf den Boden, wo er nach einem Hüpfer liegenbleibt. Mit dem rechten Absatz drückt er ihn mit einer knetenden Bewegung sorgfältig aus. Der Stummel nimmt die Gestalt von Suzukis toter Frau an. Unter dem teuren, aber geschmacklosen schwarzen Ledermantel lugt eine rote Krawatte hervor.
Suzuki malt sich aus, was als Nächstes passieren wird. Wenn die Ampel auf Grün springt, wird Terahara die Straße überqueren. Er wird direkt auf Suzuki zusteuern. Sobald Hiyoko ihm die Waffe aushändigt, könnte er sie prompt auf Terahara richten. Es ist die einzige Chance, er hat nichts zu verlieren. Er muss die Gelegenheit nutzen. Einfach machen. Wie du immer gesagt hast.
»Hey!«
Es ist Hiyoko. In dem Moment, als das Signal auf Gelb springt. Terahara junior tritt auf die Fahrbahn. Die Fußgängerampel zeigt immer noch Rot. Aber er betritt bereits die Straße. Ein Schritt, noch ein Schritt …
Ein schwarzer Minivan erfasst ihn.
Suzuki reißt die Augen auf, um den Moment des Aufpralls haargenau zu erfassen. Um ihn herum wird es still. Als würde sein Gehör aussetzen, um stattdessen seine Sehkraft zu schärfen.
Er kann sehen, wie Terahara juniors rechter Oberschenkel gegen die Stoßstange prallt. Die Beine verdrehen sich, heben vom Boden ab, und der Oberkörper wird auf die Kühlerhaube hochgerissen. Terahara junior knallt mit der rechten Flanke gegen die Windschutzscheibe. Sein Gesicht schrammt über die Scheibenwischer. Der Aufprall schleudert seinen Körper zurück auf die Fahrbahn, wo er sich überschlägt und mit verrenktem Arm liegenbleibt.
Etwas kullert über den Asphalt. Es hat sich von seinem Anzug gelöst. Knöpfe, erkennt Suzuki. Verstreute runde Knöpfe kreiseln am Boden. Ein Knopf rollt immer weiter.
Der sich überschlagende Körper landet bäuchlings in einer Asphaltdelle, wobei der Kopf sich quasi um die eigene Achse dreht und in einer unnatürlichen Position verharrt.
Statt anzuhalten, gibt der Minivan, der soeben Terahara in die Luft geschleudert hat, erneut Gas und rammt den Körper abermals.
Zuerst zerquetscht ein Vorderreifen den Oberschenkel in der gebügelten Hose. Dann rumpelt das Fahrzeug über den gesamten Torso. Rippen brechen, innere Organe werden förmlich planiert. Danach rollt der Minivan noch ein paar Meter weiter, bevor er endlich zum Stehen kommt.
Es war wie beim Schlusston einer Sinfonie, wo das Publikum für einen kurzen Moment lang den Atem anhält und absolute Stille im Saal herrscht, bis gleich darauf tosender Applaus einsetzt. Genauso erstarben plötzlich alle Geräusche in der Umgebung, und dann brach ein Höllenlärm aus.
Suzukis Hörvermögen kehrt zurück. Hupen, Aufschreie, lautes Stimmengewirr, wie ein tosendes Gewässer, das einen Damm durchbricht. Innerlich noch aufgewühlt, stiert Suzuki bloß geradeaus. Plötzlich fällt ihm jemand auf. Inmitten des Tumults, auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung, steht ein Mann, der sich in dem Moment umdreht und fortgeht.
»Was … ist da …?«, stammelt Hiyoko mit offenem Mund. »Man hat ihn …«
»Er wurde überfahren.«
Suzuki spürt sein Herz laut pochen wie eine Alarmglocke.
»Hey, hast du das auch gesehen?«, fragt ihn Hiyoko mit verstörter Miene.
»Hä?«
»Du hast es doch gesehen, oder nicht? Drüben stand so ein zwielichtiger Typ, der sich gleich aus dem Staub gemacht hat.«
Sie spricht aufgeregt und gehetzt, fast atemlos.
»Du hast den doch auch bemerkt. Da stand doch jemand. Es sah doch ganz danach aus, dass der Junior von jemandem gestoßen wurde.«
»Ich …«
Suzuki überlegte kurz, was er darauf antworten soll.
»Ja …«, platzt es dann doch aus ihm heraus: »Ich hab’s gesehen.«
Hiyoko verstummt. Sie mustert zuerst Suzuki und schaut dann auf ihre Füße. Mit einem Zungenschnalzen richtet sie ihren Blick erneut auf die gegenüberliegende Straßenseite. Ihre Augen verraten, dass sie einen Entschluss gefasst hat.
»Los, lauf ihm nach.«
»Ihm hinterher?«
»Klar, du hast ihn doch gesehen.«
»Hm.«
Jetzt ist Suzuki irritiert.
»Mach dir keine falschen Hoffnungen. Der Job ist noch nicht erledigt, aber wir dürfen die Ratte, die den Junior vors Auto gestoßen hat, keinesfalls entkommen lassen.« Sie wirkt gequält. Offenbar musste sie sich zu diesem Entschluss durchringen. »Und komm bloß nicht auf die Idee, einfach abzuhauen.« Dann hellt sich ihre Miene auf, als wäre ihr ein toller Einfall gekommen. »Genau. Wenn du abhaust, werde ich deine beiden Süßen im Wagen selbst kaltmachen«, fügt sie hinzu.
»Was fällt dir ein!«
»Mach endlich! Lauf ihm hinterher!«
Suzuki ist durch den Aufruhr und die unvorhergesehene Entwicklung ganz konfus, schon fast dem Irrsinn nahe, aber bevor er weiß, wie ihm geschieht, hat er sich schon in Bewegung gesetzt.
»Los, hol ihn ein!«, schreit Hiyoko hysterisch. »Schnapp dir die Ratte!«
Suzuki sprintet los wie ein Galopper, der die Peitsche spürt. Im Laufen schaut er über die Schulter zurück.
Hiyokos schwarze Stöckelschuhe springen ihm ins Auge. In den Dingern wird sie ihn kaum einholen können. Das hat sie offenbar nicht einkalkuliert.
Der Wal
Ein Mann sitzt auf einem Stuhl, hinter ihm steht der Wal. Er hat den Vorhang vors Fenster gezogen, aber einen Spalt offen gelassen. Durch diesen Spalt blickt er auf die Stadt unter ihm. Es gibt nichts Besonderes zu sehen. Der fünfundzwanzigste Stock ist nicht hoch genug, um das gesamte Häusermeer überschauen zu können, und das nächtliche Vergnügungsviertel bietet keinen aufregenden Anblick. Bloß Scheinwerfer von Autos, die eine große Kreuzung passieren, und blinkende Leuchtreklamen an den Hauswänden. Wegen der angrenzenden Gebäude ist der Ausschnitt des Himmels, den er sehen kann, nicht größer als eine Zimmerdecke.
Der Wal zieht den Vorhang ganz zu und geht in den Raum. Für ein Einzelzimmer ist es größer als erwartet. Das Bett und die Frisierkommode wirken gediegen und sehr sauber. Es ist eines der besseren Hotels in der Innenstadt.
»Oder willst du lieber nach draußen schauen?«, spricht er den Mann von hinten an.
Der Mann in den Fünfzigern sitzt am Tisch und starrt an die Wand. Er hält sich kerzengerade wie ein Musterknabe an seinem ersten Schultag. Abrupt wendet er nur den Kopf, als hätte die Stimme des Wals ihn aus seinen Gedanken gerissen.
»Nein, nicht nötig.«
Von all den politischen Funktionären, denen der Wal bisher begegnet ist, gehört dieser Mann zur sympathischeren Sorte. Er trägt sein Haar exakt gescheitelt und macht insgesamt einen seriösen Eindruck. Sein maßgeschneiderter Anzug ist von bester ausländischer Qualität, jedoch unauffällig, ohne protzigen Schnickschnack, was man höchst selten sieht. Im Gespräch mit dem Wal drückt er sich ausgesucht höflich aus, obwohl er diesem altersmäßig um gut zehn Jahre überlegen sein müsste.
»Es wäre deine letzte Gelegenheit.«
Der Hinweis ist überflüssig, aber der Wal äußert ihn trotzdem.
Die Augen des Mannes wirken matt.
Gleich bist du tot, es wird also dein letztes Panorama sein. Der Wal verkneift sich die Bemerkung, die ihm auf den Lippen liegt. Sie kapieren ihre Situation ohnehin nie so recht, also braucht man auch keine unnötigen Worte zu verschwenden. Meistens ist die Aussicht sowieso nicht berauschend.
Der Mann dreht sich wieder zum Tisch zurück. Er starrt auf den Block Briefpapier mit den Umschlägen.
»Die … Diese Sache …«, stammelt er abgewandt. »Passiert das öfter?«
»Öfter? Was denn?«
»Na, so wie jetzt mit mir«, sagt der Mann. Er ringt nach Worten. In seiner Verwirrung versucht er sich an dem englischen Begriff: »Suside … Ich meine, Leute zum Selbstmord zu zwingen. Machen Sie das öfter?«
Seine Schultern beben.
Typisch. Es ist doch immer das Gleiche mit denen. Zuerst machen sie einen auf cool, versuchen ganz gelassen zu wirken und zeigen sich einsichtig. »Dann muss es eben sein«, sagen sie dann und fügen sich in ihr Schicksal. Aber schon bald werden sie redselig. Wahrscheinlich bilden sie sich ein, sie könnten ihren Tod aufschieben, indem sie schwatzen. Aber der Tod blüht ihnen so oder so, auch wenn sie quasselnd Zeit schinden.
Der Wal gibt keine Antwort. Er schaut lediglich zur Decke, wo ein Plastikseil an der Abluftöffnung befestigt ist. Zu einer Schlinge geknotet. Der Auftraggeber hatte keine direkte Anweisung für ein Erhängen erteilt, aber wenn die Todesart nicht eigens erwähnt wird, entscheidet sich der Wal meistens dafür.
»Finden Sie es nicht seltsam, dass mein Tod etwas wiedergutmachen soll?«, wendet sich der Mann auf dem Stuhl nun mit einem Seitenblick an den Wal. »Ich bin nur ein Sekretär. Mein Selbstmord würde nichts an der Situation ändern. Das sollte eigentlich aller Welt klar sein. Es liegt doch auf der Hand, dass der wahre Schuldige ein anderer ist. Und trotzdem soll mein Selbstmord die Angelegenheit aus der Welt schaffen? Kommt Ihnen das nicht merkwürdig vor?«
Es hat keinen Sinn, sich auf Diskussionen einzulassen. Das weiß der Wal aus Erfahrung nur zu gut.
»Es geht ja schließlich nicht auf meine Kappe. So einen ausgeklügelten Plan hätte ich niemals allein ersinnen können. Habe ich nicht recht?«
Der Mann ist der Sekretär eines Abgeordneten namens Kaji. Die Medien fanden vor Kurzem heraus, dass Kaji Bestechungsgelder von einem Kommunikationsunternehmen angenommen hatte. Die letzten Wochen waren für den Politiker ein Spießrutenlauf. Der Skandal hatte ihn in eine äußerst heikle Lage gebracht. Angesichts der bevorstehenden Wahlen zum Repräsentantenhaus läuft er überdies Gefahr, aus der Regierungspartei ausgeschlossen zu werden.
»Mein Selbstmord wird doch wohl kaum dazu führen, dass der Verantwortliche verschont bleibt.«
»Kaji ist eben ein Feigling. Bei der kleinsten Sache fängt er an zu krakeelen. Wenn er in die Bredouille gerät, schlägt er um sich. Stimmt doch, oder?«
Der Wal ruft sich den Politiker in Erinnerung. Kleinwüchsig und kindlicher Ausdruck, das Gesicht eines Parlamentariers. Er hat sich einen Bart stehen lassen und reißt ständig die buschigen Augenbrauen hoch, um eine nicht vorhandene Würde auszustrahlen, aber es fehlt ihm an Charisma.
»Erledigen Sie öfter solche Aufträge für Kaji?«
»Das ist das erste Mal.«
Das ist nicht gelogen. Kaji hatte sich auf Empfehlung eines anderen Abgeordneten, den der Wal kannte, vor drei Tagen bei ihm gemeldet.
»Ziemlich unsympathischer Zeitgenosse, aber das ist nun mal mein Job. Ich habe den Auftrag angenommen.«
»Wären wir das Problem mit Ruhe und Gelassenheit angegangen, hätten wir es garantiert in den Griff bekommen.« Der Mann klingt panisch, er redet wie ein Maschinengewehr, die Augen blutunterlaufen. »Stattdessen hat Kaji ein Riesentamtam veranstaltet und damit alles nur noch schlimmer gemacht.«
»Sie selbst haben zugestimmt, als sein Sekretär zu arbeiten.«
Der Mann fängt an zu keuchen und zu schluchzen.
»Das ist doch kompletter Schwachsinn!«, brüllt er und reißt, erschrocken über sich selbst, die Augen auf.
»Sie werden die Ermittlungen einstellen«, antwortet der Wal ungerührt.
»Wie?«
»So ist das nun mal, wenn jemand die Schuld auf sich nimmt und Selbstmord begeht.«
»Auch wenn das niemanden überzeugen wird?« Der Mann blickt ungläubig und ernüchtert.
»Ich mache den Job seit fünfzehn Jahren.«
»Leute in den Selbstmord treiben?«
»Wenn das nicht funktionieren würde, wäre ich schon längst arbeitslos.«
Der Wal setzt sich aufs Bett. Es knarrt laut unter seinem Gewicht. Er wiegt neunzig Kilo bei einer Körpergröße von einem Meter neunzig. Dann greift er in die Jackentasche und zieht ein Taschenbuch heraus. Den flehenden Blick des Mannes ignorierend, beginnt er darin zu lesen.
»Was ist das für ein Buch?«, fragt der Mann.
Vermutlich erkundigt er sich weder aus Neugier noch Interesse, sondern um die Angst vor seinem Schicksal zu überspielen. Wortlos hält ihm der Wal den Buchrücken entgegen. Es ist ein abgegriffenes Paperback-Exemplar.
»Ach, das habe ich als Teenager gelesen.«
Die Augen des Mannes beginnen zu leuchten. Als wolle er sich anbiedern, sie seien doch aus dem gleichen Holz geschnitzt. »Ein Klassiker? Klassiker taugen immer.«
»Von sämtlichen Romanen der Weltliteratur ist das der Einzige, den ich jemals gelesen habe.«
Der Sekretär starrt ihn verdutzt an, den Mund leicht geöffnet.
»Das ist keine Koketterie, ich will mich weder damit brüsten, noch schäme ich mich dafür.«
Erklärungen sind ihm lästig, aber er antwortet trotzdem. »Es ist halt bloß das einzige Buch.«
»Sie scheinen das Buch öfter gelesen zu haben?«
»Wenn es zu zerfleddert ist, kaufe ich mir ein neues. Das hier das fünfte Exemplar.«
»Dann müssten Sie es ja schon auswendig kennen.« Der Mann gibt sich betont fröhlich. »Ha, wenn man die Silben vertauscht, lautet der Titel Verfe und Strabrechen.« Seine schrille Stimme hat einen missionarischen Tonfall, als würde er eine bedeutende Botschaft überbringen.
Der Wal löst langsam den Blick von seiner Lektüre und mustert den Titel. »Ist mir nie aufgefallen.«
Plötzlich besinnt er sich auf ein früheres Missverständnis. Vor etwa zehn Jahren hatte er fälschlicherweise angenommen, er könne sich gut mit jemandem anfreunden, der ebenfalls Gefallen an diesem Roman findet. Sein Irrglaube erwies sich jedoch als ziemliche Pleite. Es gab unzählige Menschen, die dieses Werk gelesen hatten. Das machte jedoch keinen Einzigen von denen zu seinem Verbündeten. Nur, dass er es damals noch nicht erkannt hatte.
Die Schläfen des Mannes pochen.
»Muss ich wirklich Selbstmord begehen? Sieht das nicht nach schlechtem Verlierer aus?«
»Nein, aber so denken alle.«
»Aber ich verstehe immer noch nicht, was der Selbstmord eines unbedeutenden Sekretärs bewirken soll.«
»Wenn ein Selbstmord hinzukommt, dann ist das Sand im Getriebe der Ermittlungen. Das ist der ganze Sinn und Zweck der Angelegenheit.«
Wenn ein Sekretär erklärt, er trage die alleinige Verantwortung, was ihm nicht einmal ein Schuljunge abnehmen würde, und er sich danach erhängt, dann reicht das aus, um die Vorwürfe gegen den Politiker abzuschwächen. Genauso funktionierte es neulich, als sich der Geschäftsführer eines in einen Umweltskandal verwickelten Konzerns vom Wolkenkratzer stürzte. Natürlich argwöhnten manche, es sei nur ein Ablenkungsmanöver, andere urteilten, er habe sich feige aus dem Staub gemacht – aber dennoch herrschte stilles Einvernehmen, dass man die Sache jetzt auf sich beruhen lassen könne.
»Ist erst mal ein Sündenbock gefunden, dann werden die ursprünglichen Beschuldigungen entkräftet, auch wenn die Fakten auf etwas anderes hindeuten«, leiert der Wal herunter.
Stöhnend schlägt der Mann die Hände vors Gesicht. Er lässt sich vornüber auf den Schreibtisch fallen. Auch das ist nichts Neues.
Der Wal bleibt sitzen und liest in seinem Buch, darauf wartend, dass der Mann aufhört zu weinen. Er weiß im Voraus, was der andere sagen wird, sobald sein Schluchzen und Zittern verebbt.
Und genauso ist es, der Mann reagiert erwartungsgemäß: »Wenn ich schon sterben muss, dann soll wenigstens meiner Familie nichts geschehen, ja?«
Damit ist die Vorbereitungsphase der Aktion quasi abgeschlossen. Jetzt würde der Ablauf an Fahrt aufnehmen wie eine Lore, die den Abhang runtersaust. Die roten Blinklichter der Leuchtreklamen draußen vor dem Fenster scheinen die Arbeit des Wals förmlich anzuspornen.
»Du brauchst dir keine Sorgen zu machen!«
Der Wal schiebt ein Lesezeichen zwischen die Seiten und erhebt sich vom Bett. Er tritt zu dem Mann. Er tippt aufs Papier, das vor ihnen liegt.
»Schreib zum Abschied, was du willst.«
Das Gesicht des Mannes nimmt den Ausdruck eines kleinen Jungen an, der die Miene seines Erziehungsberechtigten studiert. Bring dich um! Dann ist deine Familie in Sicherheit. Dies impliziert jedoch auch die Drohung: Wenn du es nicht tust, ist deine Familie in Gefahr.
»Gibt es auch Kandidaten, die sich weigern?«
»Schon.«
»Und was geschieht mit ihnen?«
»Versuch’s doch. Und später wird deine ganze Familie bei einem Brand unbekannter Ursache umkommen.«
Der Hoffnungsschimmer auf dem Gesicht des Mannes verflüchtigt sich sofort.
»Oder ein besoffener Lkw-Fahrer rammt deinen Pkw, und alle Insassen sind sofort tot. Es mag auch vorgekommen sein, dass die einzige Tochter vergewaltigt wird. Damals hatte eine ganze Rockergang ihren Spaß.«
Der Wal rattert die Beispiele herunter, als würde er ein buddhistisches Sutra rezitieren. Er hat lediglich davon gehört, weiß aber nicht, ob es den Tatsachen entspricht. Entscheidend ist ja nur, dass es »wahr« klingt.
Die Lippen des Mannes zittern: »Aber wenn ich mich füge, dann passiert meiner Familie nichts?«, stammelt er.
Der Wal nickt, obwohl er sich tatsächlich nie vergewissert hatte, ob die Familien unbehelligt geblieben waren. Es interessiert ihn auch nicht. Es ist nicht sein Metier. Er kann sich jedoch vorstellen, dass es generell so funktioniert. Denn ein Toter reicht – Politiker und Reiche vermeiden überflüssige Ausgaben, besonders bei Auftragsmorden.
Die Schultern des Mannes sacken nach unten und bilden einen Abhang, auf dem alle Hoffnungen weggleiten.
Er greift zum Stift und blättert durch den Block Briefpapier.
Sie Abschiedsbriefe verfassen zu lassen, gehört zum Auftrag des Wals. Manche schreiben nur an ihre Angehörigen, andere auch an Politiker oder Vorgesetzte. Der Wal lässt ihnen dabei freie Hand und überprüft den Inhalt erst hinterher. Sollte er verdächtige Andeutungen finden, wirft er den entsprechenden Brief einfach weg.
Der Wal setzt sich wieder aufs Bett und widmet sich seiner Lektüre. Sobald er das Buch aufgeschlagen und ein paar Sätze gelesen hat, taucht er komplett ab in die Welt des Romans. Sie ist ihm viel vertrauter als das reale Geschehen.
Der Mann schreibt schon fast eine halbe Stunde. Ab und zu zerreißt er ein Blatt und knüllt es zusammen. Aber er wird nicht wütend und hämmert nicht auf den Tisch. Als er mit dem Schreiben fertig ist, dreht er sich auf dem Stuhl um und blickt zum Wal.
Der Wal atmet ganz leise und blättert die Buchseiten geräuschlos um, sodass der trügerische Eindruck entsteht, er hätte das Zimmer verlassen.
»Zittern manchen Leuten nicht dermaßen die Hände, dass sie gar kein Testament schreiben können?«
»Ich denke einem Drittel.«