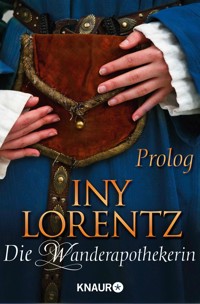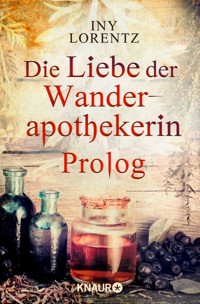9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Berlin-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Sie wurde verraten und verkauft. Nun holt sie sich ihr Leben zurück! Der Auftakt der historischen Roman-Reihe des Bestsellerduos Iny Lorentz um eine junge, mutige Heldin im Berlin Ende des 19. Jahrhunderts Als uneheliche Tochter des Schlossherrn hat die junge Magd Resa von ihrer Herrin Rodegard nicht viel Gutes zu erwarten. Unbeabsichtigt kommt sie auch noch den Heiratsplänen in die Quere, die Rodegard für ihre eigene Tochter schmiedet. Kurzerhand lässt Rodegard das Mädchen in ein Berliner Bordell verschleppen. Als Prostituierte gebrandmarkt, gehört Resa zum Abschaum der Gesellschaft. Eine Zeit im Aufruhr, eine verstoßene junge Frau, ein Kampf um wahre Liebe Doch während der blutigen Barrikadenkämpfe der Märzrevolution steht plötzlich ein verletzter junger Mann vor den verriegelten Toren des Bordells und bittet Resa um Hilfe. Ist Friedrich für Resa die Chance, sich ihr Leben zurückzuholen und Rache an Rodegard zu nehmen? Dramatische Wendungen, schicksalhafte Liebe und historische Spannung - Iny Lorentz ist das »Königspaar der deutschen Bestsellerliste« (DIE ZEIT) Mit ihrer Berlin-Trilogie um die Fabrikanten-Familie von Hartung lässt die Spiegel-Bestseller-Autorin Iny Lorentz das 19. Jahrhundert in Deutschland lebendig werden und verknüpft geschickt politische Wirrnisse mit persönlichen Schicksalen. Die historische Familien-Saga besteht aus den Romanen - Band 1: »Tage des Sturms« (1846–1849) - Band 2: »Licht in den Wolken« (1864–1870) - Band 3: »Glanz der Ferne« (1897–1900)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 668
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Iny Lorentz
Tage des Sturms
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als uneheliche Tochter des Schlossherrn hat die junge Magd Resa von ihrer Herrin Rodegard nicht viel Gutes zu erwarten. Unbeabsichtigt kommt sie auch noch den Heiratsplänen in die Quere, die Rodegard für ihre eigene Tochter schmiedet. Kurzerhand lässt Rodegard das Mädchen in ein Berliner Bordell verschleppen. Als Prostituierte gebrandmarkt, gehört Resa zum Abschaum der Gesellschaft. Doch während der blutigen Barrikadenkämpfe der Märzrevolution steht plötzlich ein verletzter junger Mann vor den verriegelten Toren des Bordells und bittet Resa um Hilfe. Ist Friedrich für Resa die Chance, sich ihr Leben zurückzuholen und Rache an Rodegard zu nehmen?
Inhaltsübersicht
Erster Teil: Die Tochter der Magd
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Zweiter Teil: Ein Hauch von Glück
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Dritter Teil: Schwarze Wolken
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Vierter Teil: In die Hölle verschleppt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Fünfter Teil: Der Wert einer Frau
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Sechster Teil: Vorboten des Sturms
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Siebter Teil: Die Macht der Bajonette
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Achter Teil: Stürme des Lebens
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Neunter Teil: Schicksalswende
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Zehnter Teil: Tage des Glücks
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Elfter Teil: Die Frau mit dem Schleier
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Personen
Erster TeilDie Tochter der Magd
1.
Resa biss die Zähne zusammen, um nicht vor Schmerz aufzuschreien, als Rodegard von Stebens Reitgerte ihren Rücken traf.
»Du dummes, unfähiges Ding!«, schrie ihre Herrin sie an und wies mit der Gerte in Richtung Wald. »Mach, dass du den Holzarbeitern das Essen hinausträgst. Zu etwas anderem bist du nicht zu gebrauchen.«
»Verzeihen Sie, gnädige Frau, aber die Köchin hat mir angeschafft, den Männern das Essen zu bringen«, wandte Bertha ein. Sie war in Resas Alter, im Gegensatz zu dieser etwas pummlig und nicht besonders fleißig.
Das wusste auch Rodegard von Steben, und ihr war klar, dass es klüger wäre, den Trampel Bertha in den Forst zu schicken und die geschickte Resa im Schloss zu behalten. Das ließ jedoch ihr Stolz nicht zu. Ihre Abscheu gegen das Mädchen hatte bereits vor Resas Geburt begonnen und sich in den sechzehn Jahren, die seither vergangen waren, noch gesteigert. Wagte diese schmutzige, kleine Magd es doch, ihre eigene Tochter weit in den Schatten zu stellen. Resa war nur wenig kleiner als sie selbst, feingliedrig und eindeutig zu hübsch. Trotz der ländlichen Tracht und dem hellblonden, zu einem einfachen Zopf geflochtenen Haar war die Ähnlichkeit mit dem Bild unübersehbar, das Freifrau Rodegard vor zwei Jahren auf den Speicher hatte räumen lassen. Das verbannte Porträt zeigte die Mutter ihres Gemahls, eine überstolze Frau, der sie trotz einer großen Mitgift als Braut ihres Sohnes nie gut genug gewesen war. Nun fragte die Freifrau sich, was ihre Schwiegermutter zu ihrem jüngeren Ebenbild sagen würde. Für einen Augenblick verzog sie höhnisch die Lippen, funkelte Resa dann aber zornig an. »Auch wenn die Köchin etwas anderes sagt, so wirst du gehen. Was stehst du hier noch herum? Mach, dass du in den Wald kommst. Die Knechte warten auf ihr Essen!«
Resa knickste und verließ rückwärtsgehend den Raum. Sich umzudrehen wagte sie nicht, weil die Freifrau es als unverschämt empfunden hätte.
Bertha folgte ihr rasch. »Puh, war die heute wieder geladen!«, stöhnte sie, als sie außer Hörweite waren. Dann musterte sie Resa. »Tut es sehr weh?«
Resa zuckte mit den Schultern. »Die gnädige Frau hat schon härter zugeschlagen.«
»Ich frage mich, warum sie ihre Wut immer an dir auslässt. Dabei hast du doch gar nichts ausgefressen. Lina hat gestern vergessen, das Laken zu wechseln. Daher hätte die gnädige Frau sie schlagen müssen und nicht dich.«
Resa hatte sich diese Frage schon oft gestellt, aber nie eine Antwort darauf gefunden. Zwar gab es Gerüchte, doch um zu erfahren, ob etwas Wahres an ihnen war, hätte sie ihre Mutter fragen müssen. Einmal hatte sie es gewagt, doch statt einer Antwort hatte sie eine Ohrfeige erhalten, die ihr noch in der Erinnerung weh tat.
»Dafür ist der gnädige Herr recht freundlich zu dir«, fuhr Bertha munter fort.
»Er beachtet mich doch kaum«, wehrte Resa ab.
»Zwar redet er nicht viel mit dir, aber er hat dem Herrn Pastor befohlen, dir noch Schulstunden zu geben, als ich und die anderen Mädchen bereits unter der Knute der Mamsell zu schuften hatten.«
Bertha klang neidisch. Während sie und die anderen Kinder im Dorf schon während der Schulzeit im Schloss und auf dem Gut hatten mithelfen müssen, war Resa dies bis vor wenigen Wochen erspart geblieben. Das Mädchen hatte sogar Französisch lernen dürfen, genauso wie das gnädige Fräulein Liebgard.
In den Hütten der armen Leute wurde seltener ein Blatt vor den Mund genommen als im Schloss, und so kannte Bertha die Gerüchte, die sich um ihre Freundin rankten. Es hatte etwas mit dem Freiherrn zu tun und mit Resas Mutter. Offen sagen durfte man das jedoch nicht, denn die Gemahlin hatte schon zweimal Leute aus dem Dorf jagen lassen, nur weil diese mit Bediensteten von Gästen oder in der Schenke darüber getratscht hatten.
»Ist es nicht ein Jammer, dass der gnädige Herr der gnädigen Frau in allem nachgibt?«, fuhr Bertha fort.
»Mama sagt, Freifrau Rodegards Mitgift hätte den Vater des gnädigen Herrn im letzten Augenblick vor seinen Gläubigern gerettet«, antwortete Resa.
Das war allgemein bekannt, durfte aber ebenfalls nicht offen ausgesprochen werden. Noch während Bertha überlegte, wie sie Resa mehr entlocken konnte, tauchte wie aus dem Nichts die Mamsell vor ihnen auf. Bertha duckte sich in Erwartung einer Ohrfeige, doch Ida starrte nur Resa an.
»Hast du deine Strafe erhalten?«, fragte sie lauernd.
Resa kniff kurz die Lippen zusammen, sagte sich dann aber, dass Trotz ihr nichts brachte, und nickte.
»Dann ist es gut«, antwortete Ida mit aufblitzenden Augen und schlug so schnell zu, dass Resa nicht mehr ausweichen konnte. Obwohl Ida für eine Frau nur mittelgroß und mager war, besaß sie viel Kraft, und so zeichneten sich ihre fünf Finger deutlich auf Resas Wange ab.
»Und nun geh an deine Arbeit!« Sichtlich beschwingt ging die Mamsell Resa davon.
»So ein Biest!«, zischte Bertha. »Ich bin mir sicher, dass sie der gnädigen Frau gesteckt hat, du wärest schuld, dass Lina das Laken nicht gewechselt hat!«
Resa war zwar der gleichen Ansicht, sagte aber nichts, sondern strebte mit schnellen Schritten der Küche zu. Als sie und Bertha eintraten, drehte sich die Köchin Agnes zu ihnen um.
»Wo seid ihr so lange gewesen?«, fragte sie streng.
»Wir sind der gnädigen Frau über den Weg gelaufen«, verteidigte Bertha sich.
»Hat sie dich wieder geschlagen?«, fragte Agnes Resa.
Diese nickte mit einer knappen Bewegung. »Es war aber nicht schlimm.«
»Es ist zum Gotterbarmen«, murmelte die Köchin und wies auf einen vollen Korb, der mit einem gemusterten Tuch abgedeckt war. »Dort ist das Essen für die Waldarbeiter. Sieh zu, dass du rasch zu ihnen kommst!«, wies sie Bertha an.
Diese schüttelte den Kopf. »Die gnädige Frau will, dass Resa geht. Das hat sie eben gesagt!«
»Stimmt das?« Da Bertha sich gerne vor unangenehmen Arbeiten drückte, war Agnes misstrauisch.
Resa nickte erneut. »So hat die gnädige Frau es bestimmt!«
»Dann musst du gehen. Also hurtig! Du hast einen langen Weg vor dir. Und gib auf dich acht! Die Kerle lieben derbe Späße.«
Agnes hätte lieber die flinke, geschickte Resa in der Küche behalten. Nun musste sie sich mit Bertha behelfen, die, wie sie einmal in ihrem Ärger erklärt hatte, sogar Wasser anbrennen lassen konnte.
Während die Köchin Bertha einige Anweisungen gab, hob Resa den schweren Korb auf und verließ die Küche. Vor ihr lag zwar ein weiter Weg, aber sie musste zumindest nicht in ständiger Hut davor sein, von Freifrau Rodegard oder der Mamsell Ida abgepasst und geschlagen zu werden.
2.
Resa ahnte nicht, dass Freifrau Rodegard von Steben ihr von einem Fenster im ersten Stock aus nachschaute. Die Lippen der Dame waren zu schmalen Schlitzen zusammengepresst, und sie umkrampfte den Griff ihrer Reitpeitsche so fest, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten. Die Tatsache, dass dieses Ding nur drei Monate nach ihrer eigenen Tochter Liebgard geboren worden war, verzieh sie weder dem Bastard noch dessen Hure von Mutter – und am wenigsten ihrem Gemahl.
Es ärgerte die Freifrau immer mehr, dass Liebgard im Vergleich mit der anderen Tochter ihres Vaters so sehr verblasste. Wenn Gott gerecht wäre, müsste es anders herum sein, dachte sie. Immerhin war Resa ein Kind der Sünde, ihre Tochter aber im Ehebett gezeugt worden.
»Ich werde das Miststück brechen!«, flüsterte sie voller Wut. »Sie wird noch zu meinen Füßen liegen und mich anflehen, meine Zehen lecken zu dürfen.«
Zu ihrem Ärger war der Freifrau allerdings klar, dass sie es nicht zu toll treiben durfte. Wenn sie das Mädchen so schlug, dass Narben zurückblieben, würde ihr Gemahl eingreifen. Sie kannte dessen törichte Überlegungen, seinen Bastard über kurz oder lang mit einem wohlhabenden Bürger zu verheiraten. Doch durch diese Rechnung würde sie ihm einen Strich machen. Resa war eine Dienstbotin und sollte es für immer bleiben.
Ein Klopfen an der Tür beendete Freifrau Rodegards Gedankengänge. »Was gibt es?«, fragte sie streng.
Ihre Zofe trat ein. »Eben ist die Post gebracht worden. Es ist ein Brief des jungen Herrn darunter.«
»Wilhelm hat geschrieben!«
In dem Augenblick hatte die Freifrau den Ärger über Resas Existenz vergessen. Eilig verließ sie die Kammer und betrat kurz darauf ihren Salon. Ihre Zofe hatte die Briefe bereits sortiert.
Den größeren Packen reichte Frau Rodegard ihr und befahl: »Bring das in die Gemächer meines Gemahls und übergib es seinem Kammerdiener!«
Dann nahm sie den Brief ihres Sohnes zur Hand und erbrach das Siegel. Er enthielt einen kurzen Bericht über seine vergangenen Wochen als Sekondeleutnant im Kürassierregiment des Oberst Hegenberg, und am Schluss stand die übliche Bitte um Geld.
Mit einem nachsichtigen Lächeln legte Freifrau Rodegard das Schreiben zurück und zog ein Fach ihres Sekretärs auf. Doch als sie ihre Privatschatulle öffnete, fand sie diese leer. Bestürzt, da für sie in diesem Monat selbst noch Ausgaben anstanden, stellte sie die Kassette wieder zurück und stand auf. Rasch eilte sie zu den Gemächern ihres Gemahls und öffnete die Tür zu seiner Bibliothek, ohne anzuklopfen. »Wilhelm hat geschrieben! Wir müssen ihm Geld schicken!«, sagte sie.
Gundolf von Steben sah verärgert von einem Stapel Briefe auf. »Dann tun Sie das!«
»Das würde ich nur zu gerne tun, doch meine Schatulle ist leer. Daher werden Sie Wilhelm das Geld senden.«
»Wovon soll ich es nehmen? Es sind allein heute mehr Rechnungen eingetroffen, als ich bedienen kann«, antwortete der Freiherr leise.
»Wollen Sie etwa einem Schneider oder Bäcker das Geld zukommen lassen, das unser Sohn dringend braucht?«, fragte Frau Rodegard schneidend.
»Mit etwas weniger kostspieligen Vorlieben könnte Wilhelm bestens mit seiner Apanage auskommen! Die Zahlungsaufforderungen kommen beileibe nicht nur von meinem Schneider oder dem Zuckerbäcker, der das Schloss beliefert, und sie sind dringend. Daher kann ich Wilhelm kein Geld schicken.« Verzweiflung schwang in Gundolf von Stebens Worten mit, doch seine Frau hatte kein Ohr dafür.
»Sie können es und Sie werden es!«, fuhr sie ihn an. »Wenn Sie Geld brauchen, dann leihen Sie es sich.«
Gundolf von Steben lachte bitter. »Leihen? So wie unser nächster Nachbar? Der hat sich so lange Geld geliehen, bis er sein Gut verkaufen musste. Man stelle sich das vor! Statt eines Grafen Trellnick werden wir in Zukunft einen Emporkömmling neben uns haben, einen Schmied, der Eisen bearbeitet!«
»Entsetzlich!«, stöhnte seine Gemahlin, kniff dann aber die Augen zusammen. »Wenn dieser Emporkömmling genug Geld hat, Graf Trellnicks Besitz zu kaufen, so wird es ihm auch eine gewisse Summe wert sein, in unsere Kreise aufgenommen zu werden.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Gundolf von Steben verständnislos.
»Dieser Mann hat Gut Trellnick gewiss nicht gekauft, nur um dort Kohl zu ernten, sondern will von den Gutsherren der Nachbarschaft eingeladen werden. Ich bin dazu bereit, wenn er entsprechend zahlt.«
»Ich soll mich mit diesem Menschen gemeinmachen, nur damit Sie weiterhin unserem Sohn Geld schicken können?« Gundolf von Steben schüttelte es.
Die Miene seiner Gemahlin verriet jedoch, dass es ihr vollkommen ernst mit dieser Forderung war. Wilhelm war ihr Liebling, und für ihn war sie bereit, selbst einen zu Geld gekommenen Schmied zu empfangen, wenn es ihr nur genug harte Taler in die Geldkassette spülte.
»Also gut! Ich werde die Bekanntschaft dieses Menschen suchen. Aber Sie müssen mir dafür eines versprechen«, erklärte er mit mühsam beherrschter Stimme.
»Und was soll das sein?«, fragte seine Frau hochmütig.
»Sie werden Resa besser behandeln! Ich weiß, dass Sie sie schlagen. Leugnen Sie es nicht! Warum sonst tragen Sie Ihre Reitgerte immer bei sich?«
Freifrau Rodegard wollte es abstreiten, doch da bemerkte sie, dass sie ihre Reitpeitsche immer noch in der Hand hielt. Alles in ihr sträubte sich gegen diese Forderung, doch als sie in das blasse, aber beherrschte Gesicht ihres Ehemannes sah, begriff sie, dass er nicht nachgeben würde. Entweder sie versprach es, oder Wilhelm würde die nächsten Monate ohne jeden Zuschuss auskommen müssen.
»Also gut«, lenkte sie ein. »Ich werde mich bemühen, die trampelhafte Art Ihres Bastards und seine Fehler fürderhin mit Nachsicht zu betrachten.«
»Sie hätten Resa niemals schlagen dürfen!«, antwortete der Freiherr und stöhnte wie unter einem inneren Schmerz auf.
Seine Gemahlin hatte stets darauf gepocht, dass ihre Mitgift einst Schloss und Gut gerettet hatten. Es war so schlimm geworden, dass er während ihrer zweiten Schwangerschaft mit Liebgard vor Rodegards Launen und ihrer Herrschaft geflohen war und Trost bei einer jungen Magd gesucht hatte, die der alte Graf Trellnick auf sein Gut geschickt hatte.
Doch damit hatte sein Unglück erst richtig begonnen. Um zu verhindern, dass seine Gemahlin sich nach Resas Geburt von ihm scheiden ließ, hatte er ihr die Herrschaft über Steben fast vollständig überlassen müssen. Nun bereute er dies zutiefst, denn sein Besitz stand nach ihrer Misswirtschaft noch weitaus schlechter da als vor seiner Heirat.
»Das Mädchen hat die Schläge erhalten, die ich ihrer Mutter, Ihrer Hure, nicht geben kann!«, fauchte seine Frau ihn an. »Geben Sie sich damit zufrieden, dass ich sie in Zukunft nicht mehr schlagen werde. Sie soll mir aber so wenig wie möglich unter die Augen kommen. Haben Sie verstanden?«
Gundolf von Steben nickte. »Ich werde der Mamsell sagen, dass sie Resa anderweitig beschäftigt.«
»Ich werde es der Mamsell sagen!«, widersprach seine Frau, denn sie traute ihrem Mann zu, das Mädchen irgendwohin zu schicken, wo es fast wie ein Edelfräulein behandelt wurde. »Sehen Sie zu, dass Sie die Bekanntschaft dieses Schmieds machen, der Trellnick gekauft hat. Wenn wir ihn zu uns einladen und auch noch ein Fest geben, muss es sich für uns lohnen. Wilhelm braucht dringend Geld! Schicken Sie ihm etwas und bezahlen Sie die Bäcker und Schneider mit dem, was Sie diesem Emporkömmling aus der Tasche ziehen können.«
Es schwang so viel Hohn in ihrer Stimme, dass Gundolf von Steben verärgert auf den Tisch schlug. »Bei Gott! Einen meiner Ahnen hat man als Raubritter gefangen und aufgehängt, doch erscheint mir sein Tun ehrenhafter als das, was Sie von mir fordern.«
Er erhielt jedoch keine Antwort mehr, denn seine Gemahlin war bereits zur Tür hinaus.
3.
Unterdessen schritt Resa durch den Wald. Auch wenn sie kaum etwas von Forstwirtschaft verstand, so war auch ihr bewusst, dass hier in den letzten Jahren viel Raubbau betrieben worden war. Eine halbe Meile weiter ragte ein Stück des Trellnicker Forstes in den Stebener Besitz hinein, und dort sah es noch schlimmer aus. Dornengestrüpp und Unkraut hatten sich ausgebreitet, und es würde viel Arbeit und noch mehr Geld kosten, es zu beseitigen. Doch um hier wieder aufzuforsten, gab es auf Trellnick zu wenig Knechte, und an Geld mangelte es ohnehin seit vielen Jahren.
Resa wunderte sich daher, als sie einen Reiter auf dem Grund des Nachbarn entdeckte. Er trug einen braunen Rock und lederne Reithosen sowie kniehohe Stiefel. Sein Hut hing gut drei Schritte weit in den Dornen, und er schien unsicher zu sein, ob er ihn zurückholen und Kratzer riskieren oder ihn aufgeben sollte. Resa schätzte sein Alter auf zwischen dreißig und vierzig. Er war mittelgroß, stämmig gebaut und hatte ein kantiges Gesicht, das sympathisch wirkte. Das war niemand, der zu Hause im Salon saß und andere für sich arbeiten ließ, dachte sie.
In diesem Moment drehte sich der Mann zu ihr um. »Guten Tag«, grüßte er freundlich.
Resa blieb stehen und beantwortete den Gruß. »Guten Tag! Sie sind wohl neu hier?«
»So kann man es sagen!« Der Mann lächelte auf eine so herzliche Weise, dass Resa unwillkürlich mit einem Lächeln antwortete.
Er wies auf das Dornenfeld. »Ich wollte mir dieses Waldstück ansehen. Laut Beschreibung hieß es, es wäre ein Leichtes, es wieder zu bepflanzen. Die Wahrheit sieht jedoch anders aus.«
Jetzt erinnerte Resa sich, dass es geheißen hatte, Graf Trellnick wolle seinen Besitz verkaufen. »Sie sind wohl der Agent des Herrn, der Schloss und Gut Trellnick erwerben will?«
Der Mann dachte einen Moment nach und nickte. »So kann man es ausdrücken. Doch wer bist du? Gehörst du auch zu Trellnick?«
»Nein, ich bin Bedienstete auf Gut Steben und muss mich beeilen, um den Waldarbeitern das Essen zu bringen«, sagte Resa und wollte weitergehen.
»Bleib noch einen Augenblick!«, bat der Mann. »Ich bin hier fremd und um jede Auskunft froh. Gut Steben liegt hier?«
Er zeigte in die Richtung, aus der Resa gekommen war.
»Direkt in dieser Richtung liegt Schloss Schleinitz, und bis dorthin ist es fast eine Meile. Um Steben zu erreichen, muss man am ersten Kreuzweg nach dem Wald rechts abbiegen.«
»Ich danke dir.«
Der Fremde lächelte erneut und ließ Resa nicht aus den Augen. Vermutlich wunderte ihn, dass sie nur eine schlichte Magd sein sollte, denn sie sprach anders als das einfache Volk dieser Gegend. Auch ihre ganze Haltung passte nicht zu ihrem Stand. Anmutig und hübsch konnte auch ein Dorfmädel sein, doch dieses Mädchen hätte in entsprechender Kleidung in Berlin und jeder anderen Residenzstadt Furore gemacht.
»Darf ich noch wissen, wie du heißt?«, fragte er.
»Resa.«
»Und wie noch?«
Für einen Augenblick huschte ein Schatten über ihr Gesicht, dann musterte sie den Mann mit einem herausfordernden Blick. »Der Großvater meiner Mutter hieß Frohnert. Dies ist auch mein Name. Doch nun muss ich weiter. Lebt wohl!«
Resa wusste selbst nicht, weshalb sie so stachlig reagiert hatte. Es war allgemein bekannt, dass sowohl ihre Mutter wie auch sie als ledige Kinder geboren waren und es keinen Mann gab, der sich zu seiner Vaterschaft bekannt hätte. Bislang hatte sie dies kaum gestört, doch nun tat es ihr zum ersten Mal weh, ein Bankert zu sein.
In Gedanken versunken, bemerkte sie nicht, dass der Fremde ihr nachblickte, bis sie im Dunkel des Waldes untergetaucht war. Erst dann rührte er sich wieder, stieg von seinem Pferd und drang in das Dornengestrüpp ein, um sich seinen Hut zurückzuholen. Seine Gedanken galten jedoch dem schönen Mädchen. Bislang hatte er über Männer gespottet, die behauptet hatten, die Liebe habe sie wie ein Blitz getroffen. Nun aber spürte er, dass auch er nicht gegen Amors Pfeile gefeit war.
»Sie ist eine Magd und zudem unehelich geboren! Schließlich habe ich Schloss und Gut Trellnick gekauft, damit eines der hochgeborenen Fräuleins sich herablässt, mir die Hand zum Bunde zu reichen«, sagte er zu sich selbst.
Er wollte den Gedanken an die Magd beiseiteschieben, aber ihr Bild blieb hartnäckig vor seinem inneren Auge stehen. Allerdings gab es bereits eine geeignete Kandidatin für seine Pläne. Von einem befreundeten Bankdirektor hatte er erfahren, dass Freiherr Gundolf von Stebens Situation fast ebenso katastrophal sei wie die von Graf Trellnick. Steben würde seine Tochter deswegen jedem Mann zur Frau geben, dessen Taler ihm wieder zu Kredit und Wohlstand verhelfen konnten.
Frühere Zweifel, die er lange beiseitegeschoben hatte, gewannen nun die Oberhand. Sollte er wirklich neben einer Frau herleben, die für ihn nicht mehr als ein adeliges Aushängeschild war?
»Bei Gott, ich wollte mir eine Frau kaufen, als wäre sie eine Ware! Dabei sind eine sanfte Hand und ein liebendes Gemüt weitaus mehr wert als ein ›von‹ im Namen«, sagte er tadelnd zu sich selbst und stieg wieder auf seinen Hengst.
Sein Entschluss stand fest. Er würde Gundolf von Stebens Bekanntschaft suchen, jedoch nicht, weil er um dessen Tochter freien wollte, sondern wegen einer kleinen, schimpflich geborenen Magd.
4.
Nach einer guten halben Meile strammen Marsches erreichte Resa die ersten Waldarbeiter. Die Aufgabe der beiden Männer war es, Brennholz für den Winter zu schlagen. Früher hatte man dies näher am Gutshof tun können, aber mittlerweile war dort nichts mehr zu holen. Als sie Resa erkannten, hielten sie inne und legten ihre Äxte nieder.
»Bringst du das Essen?«, fragte Martin, der Vorarbeiter.
»Was gibt es? Hoffentlich einen besseren Fraß als gestern! Da hat Bertha, dieser Trampel, auch noch die halbe Suppe verschüttet«, setzte der zweite Waldarbeiter hinzu.
»Ich habe nichts verschüttet!«, erwiderte Resa. »Allerdings weiß ich nicht, was Agnes alles eingepackt hat.«
»Das Essen kommt vom Schloss? Dann ist es besser als das Zeug, das die Gutsköchin schickt.« Martin zwinkerte Resa zu und half ihr, die Sachen auszupacken.
»Suppe mit viel Kohl und wenig Fleisch, Brot und ein Hering für jeden. Wie soll man da Kraft für die Arbeit bekommen? Da ist mir das Zeug aus der Gutsküche doch noch lieber«, rief er enttäuscht.
»Die Mamsell hat beschlossen, dass für alle Waldarbeiter in der Schlossküche gekocht wird, da ab jetzt nur noch Mägde von dort euch das Essen bringen sollen. Wir müssten es sonst aus der Gutsküche holen«, erklärte Resa.
Es stimmte nicht ganz, denn hinter diesem Beschluss steckte die Freifrau, die nach Möglichkeit immer nur sie losschicken wollte – und das bei jedem Wetter. Würde sie das Essen aus der Gutsküche holen, wäre die dortige Köchin zu gerne bereit, sie ein paar Stunden als Arbeitskraft zu behalten und die Waldarbeiter von Berthas Schwester Martha versorgen zu lassen.
Für das, was im Schloss vorging, interessierten sich die Männer kaum. Sie wollten ausreichend zu essen haben, um arbeiten zu können, dazu ihren Lohn und zu Weihnachten ein kleines Geschenk von der Herrschaft. Trotz der ersten Enttäuschung waren sie an diesem Tag zufriedener als sonst, da Agnes um einiges besser kochte als die Köchin vom Gutshof. Anders als diese sparte sie auch nicht mit Butter und Schmalz.
»Wegen mir kann es so bleiben«, meinte Martin nach einer Weile.
»Wo ist Gerd?«, fragte Resa, ohne auf die Bemerkung einzugehen.
»Der ist im alten Wald Pech scheiden«, erklärte Martin ihr.
Dieses Stück des Forstes lag am weitesten vom Gut entfernt und war nur deshalb nicht der Axt zum Opfer gefallen, weil es fast unmöglich war, die mächtigen Stämme von dort fortzuschaffen. Für Resa hieß dies, noch einmal fast eine Stunde gehen zu müssen. Rasch stellte sie Topf und Kanne wieder in ihren Korb.
»Bis morgen!«, sagte sie, da sie annahm, dass die Freifrau sie auch weiterhin in den Wald schicken würde.
Für einen Augenblick dachte sie an ein Märchen, das Berthas und Marthas Großmutter erzählt hatte. Es handelte von einem Mädchen, das in den Wald ging und dort Gefahr lief, von einem Wolf gefressen zu werden. Dieses Mädchen war von einem Jäger gerettet worden. Auf die Hilfe des Stebener Jägers würde sie allerdings wohl verzichten müssen, denn der Mann saß lieber im Gasthaus und ließ sich das Bier schmecken.
Bei dem Gedanken lachte sie über sich selbst. Wölfe waren hier zum letzten Mal vor etlichen Jahren gesehen worden, und das auch nur in einem strengen Winter.
Um den letzten Knecht rasch zu erreichen, kürzte Resa den Weg quer durch den Forst ab. Dabei übersah sie eine hochstehende Baumwurzel und wäre beinahe gestolpert. »Gib acht!«, rief sie sich zur Ordnung. »Wenn du das bisschen Suppe, das übrig geblieben ist, auch noch verschüttest, kannst du dir von Gerd einiges anhören.«
Unterwegs kam ihr der Fremde wieder in den Sinn. Wie es aussah, hatte der neue Besitzer von Trellnick ihn geschickt, um sich den Gutshof anzusehen. Viel Gutes würde er seinem Herrn nicht sagen können, denn Trellnick war so herabgewirtschaftet, dass selbst ein Eingreifen des Königs es nicht hätte retten können.
Der Mann war mit Sicherheit kein Knecht, aber auch kein Edelmann, den man auf Schloss Steben empfangen würde. Von den fein gekleideten Herren, die dort erschienen, hielt sie sich nach Möglichkeit fern, seit einer der Nachbarn Bertha eines Nachts in betrunkenem Zustand in die Orangerie gezerrt hatte. Was dort geschehen war, wusste sie nicht genau. Bertha behauptete jedenfalls, das Dinglein des Herrn hätte sehr traurig gehangen und wäre zu nichts nütze gewesen. Zu Resas Verwunderung hatte die Freundin sogar ein wenig enttäuscht geklungen.
»Der Fremde ist bestimmt keiner, der sich an einer Magd vergreift«, sagte sie sich und setzte ihren Weg fort.
5.
Den Knecht im Wald zu finden war schwieriger, als sie angenommen hatte. Resa blieb schließlich stehen und begann zu rufen.
»Gerd, wo bist du? Ich bringe dein Mittagessen!« Sie erhielt keine Antwort. »Gerd, ich bin es, Resa! Melde dich doch!«
Sie begann sich zu ärgern. Der Knecht musste sie gehört haben, denn sein Auftrag war, hier Harz zu sammeln, das später mit ein paar anderen Ingredienzien zu Pech gemischt wurde.
»Gerd, wo bist du? Hier ist dein Essen!« Resa schritt tiefer in den Wald hinein.
Mit einem Mal vernahm sie ein halb ersticktes Ächzen und horchte auf.
»Bist du das, Gerd?«, fragte sie in den Wald hinein.
»Verfluchte Scheiße!«, klang es gepresst zurück.
»Was ist?« Noch während sie es sagte, lief Resa in die Richtung. Gut fünfzig Schritt weiter hörte sie ihn wieder fluchen und wurde schneller.
Ein Stück weiter hockte der Knecht stöhnend am Boden und presste sich beide Hände gegen den linken Oberschenkel. Zwischen den Fingern rann es rot heraus.
»Was ist geschehen?«, rief Resa erschrocken.
Der Knecht wandte sich mit schmerzverzerrter Miene zu ihr um. »Als du zu plärren begonnen hast, bin ich mit dem Messer abgerutscht und habe es mir ins Bein gerammt. Bei Gott, tut das weh! Und wie es blutet! Ich werde hier noch krepieren – und das nur wegen deiner Dummheit!«
»Ich musste doch nach dir rufen, nachdem ich dich nirgends gefunden habe«, antwortete Resa empört.
Sie überlegte, ob sie Martin und Hans zu Hilfe holen sollte. Die Wunde blutete jedoch stark, und wenn Gerd nicht mehr in der Lage war, sie zuzudrücken, würde er tot sein, bevor sie zurückkam. Da fiel ihr Blick auf das Tuch, mit dem ihr Korb zugedeckt war. Von dem alten Rossknecht Heinz, der mit dem Freiherrn zusammen in Waterloo gegen Napoleon gekämpft hatte, wusste sie, dass die Chirurgen Verletzten mit schweren Arm- oder Beinwunden die Glieder fest abgeschnürt hatten, bis kein Blut mehr ausgetreten war. Rasch nahm Resa das Tuch, beugte sich über den Verletzten und wickelte es ein Stück über der Verletzung um den Oberschenkel.
»Wenn du mich mit dem Fetzen verbinden willst, das hält das Blut nicht auf. Mir werden bereits die Hände klamm«, stöhnte der Knecht.
Resa zog ihr Tuch zusammen, so fest sie konnte, merkte aber, dass ihre Kräfte nicht ausreichten, um das Bein abzubinden. Kurz entschlossen ergriff sie einen herumliegenden Zweig, kürzte ihn mit Gerds Messer auf eine brauchbare Länge und benützte ihn als Hebel, um das Tuch zu spannen. Zu ihrer Erleichterung wurde der Blutstrom, der aus der Wunde trat, schwächer und hörte zuletzt ganz auf.
»Wie hast du das gemacht?«, fragte Gerd verblüfft.
»Wir haben keine Zeit zum Reden!«, antwortete Resa, während sie den Stock mit ihrem Kopftuch festband, damit er nicht locker werden konnte.
»Ich hoffe, es geht eine Weile so. Ich laufe jetzt zu Martin und Hans, damit sie dir helfen«, sagte sie und rannte los.
Schon bald stach ihre ganze Seite, und sie bekam kaum mehr Luft. Der Gedanke an den Verletzten trieb sie jedoch weiter. Zuletzt taumelte Resa nur noch. Sie wollte nach Martin und Hans rufen, doch es kam nur ein Krächzen aus ihrer Kehle. Nach einer Zeit, die ihr schier endlos vorkam, sah sie die beiden vor sich.
»Kommt rasch!«, rief sie keuchend. »Gerd hat sich schwer verletzt! Er wird vielleicht verbluten.«
»Was ist los, Mädel?«, fragte Martin, während Hans den Kopf schüttelte.
»Wenn wir bis zum Abend nicht genug Holz geschlagen haben, wird uns der Inspektor schelten!«
»Gerd ist in Lebensgefahr«, fuhr Resa ihn an, »und du denkst an das Brennholz!«
»Wir sollten tun, was sie sagt«, entschied Martin und ging los.
Resa blieb an seiner Seite. »Gerd hat sich eine Handbreit über dem Knie verletzt. Die Wunde hat sehr stark geblutet. Ich bin daher in großer Sorge um ihn.«
»Das kann ich mir denken. Hoffentlich hat er nicht die Schlagader getroffen, dann wäre es nämlich aus mit ihm.«
»Ich würde es nicht bedauern«, brummte Hans, der in der Vergangenheit so manchen harten Strauß mit Gerd ausgefochten hatte.
»So etwas sagt man nicht!«, wies Martin ihn zurecht. Auch er mochte Gerd nicht besonders, aber es ging jetzt um einen Menschen, der Hilfe brauchte.
6.
Zu Resas Erleichterung lebte Gerd noch, als sie bei ihm eintrafen, litt jedoch heftige Schmerzen. Die Verletzung blutete nur schwach.
»Das sieht nicht gut aus«, meinte Martin kopfschüttelnd. »Er wird den Wundarzt brauchen, aber der kommt nicht hierher in den Wald. Weißt du was, Mädel? Du läufst jetzt ins Dorf und sagst, sie sollen den Doktor holen. Hans und ich schaffen Gerd in seine Hütte.«
»Bringt ihn doch ins Schloss! Dorthin kommt der Arzt gewiss schneller als in eine Kate«, schlug Resa vor.
Martin hob mit einer hilflosen Geste die Arme. »Würde ich ja gerne, aber du kennst die gnädige Frau und deren Drachen Ida. Die würden uns heimleuchten, wenn wir mit einem Verletzten dort erscheinen und der vielleicht auch noch den frisch gewienerten Parkettboden mit seinem Blut volltropft.«
»Um den Kerl bis ins Dorf zu bringen, werden wir ganz schön schleppen müssen«, maulte Hans und sah dann den Verletzten an. »Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dir das Messer ins Bein zu rammen?«
»Ich wollte Rinde von einem Baum schälen, und da hat diese dumme Kuh plötzlich herumgebrüllt, und ich bin erschrocken«, antwortete Gerd mit einem finsteren Blick auf Resa.
Bei diesem Vorwurf kamen dem Mädchen die Tränen.
Martin wies auf das abgebundene Bein. »Das hast du wohl kaum selbst gemacht. Sei froh, dass Resa kühles Blut bewahrt hat! Sonst müssten wir jetzt einen Leichnam nach Hause schaffen.«
Was Gerd darauf antwortete, vernahm Resa nicht mehr, denn sie rannte los, um die Nachricht von seiner Verletzung ins Dorf zu bringen. Ihren Korb ließ sie unbeachtet neben einem Baum stehen.
Resa war an diesem Tag schon weit gelaufen, biss aber die Zähne zusammen. Als sie endlich im Dorf ankam, hatte sie erneut quälendes Seitenstechen und brachte zunächst keine zwei Worte heraus.
Ihre Mutter kam verwundert aus dem kleinen Haus, in dem sie lebten. »Was ist denn los, Resa?«
»Gerd hat sich verletzt! Wir brauchen dringend den Wundarzt«, rief Resa, als sie halbwegs wieder zu Atem gekommen war.
»Der Herr Doktor wird uns etwas husten, nachdem die Freifrau sich geweigert hat, ihn für das Einrichten von Friedels Bein zu bezahlen«, antwortete die Mutter herb.
»Aber wir können Gerd doch nicht einfach sterben lassen«, brach es aus Resa heraus.
»Er ist ein unguter Kerl!« Die Mutter erinnerte sich an einige Zusammenstöße mit dem Knecht, senkte dann aber den Kopf. »Trotzdem ist er ein Mensch und hat ein Recht darauf, nicht wie ein Tier zu verrecken. Den Wundarzt kriegen wir nicht, also wird die alte Käthe sich um ihn kümmern müssen. Warte, ich hole sie!«, setzte sie rasch hinzu, da Resa Anstalten machte, loszulaufen.
»Danke, Mama.« Resa blieb stehen und kämpfte gegen die Erschöpfung an. Zudem hatte sie seit dem Frühstück nichts mehr gegessen, und ihr wurde flau vor Hunger.
»Ruh dich ein bisschen aus!«, forderte ihre Mutter sie mit einem sanften Lächeln auf.
Resa schüttelte bedauernd den Kopf. »Ich würde es gerne, aber wenn der Mamsell zugetragen wird, dass ich am helllichten Tag gefaulenzt habe, wird sie es mir eintränken. Außerdem muss ich Gerds Verletzung im Schloss melden.«
»Tu das! Auf dem Weg musst du aber nicht mehr rennen.« Sie zog Resa kurz an sich und strich ihr über den Kopf. »Ich weiß, dass sie dir im Schloss das Leben zur Hölle machen. Doch ich kann dir nicht helfen.«
Es klang so traurig, dass Resa ihre Mutter fest an sich drückte. »Ganz so schlimm ist es nicht!«, sagte sie nicht ganz wahrheitsgemäß. »Ich halte es schon aus.«
Dann ließ sie die Mutter los und ging in Richtung Schloss.
Gunda sah ihrer Tochter nach und seufzte. Auch wenn Resa nicht erzählte, was dort oben geschah, gab es genug Münder, die es ihr zutrugen – und das nicht immer aus Freundlichkeit. Bitterkeit stieg in ihr auf, doch sie wusste, dass sie diesem Gefühl nicht nachgeben durfte. Daher ging sie hinüber zur Hütte der alten Hebamme, um ihr Bescheid zu sagen. Ob Käthe Gerd würde helfen können, wusste sie nicht. Doch seit Freifrau Rodegard den Arzt nur noch für sich, ihre Familie und einige wenige Schlossbedienstete holen ließ, blieb dem restlichen Gesinde nichts anderes übrig, als auf die Fähigkeiten der alten Frau zu vertrauen.
7.
Da Resa den Haupteingang des Schlosses nicht benutzen durfte, ging sie um das Gebäude herum und wollte durch die Gartenpforte eintreten. Auf ihrem Weg kam sie am Rosengarten vorbei. Dort saß die Freifrau auf der steinernen Bank bei der Nymphenstatue, die der Großvater ihres Gemahls hier hatte aufstellen lassen. Als sie Resa sah, schoss sie hoch und vertrat ihr den Weg. Ihre Hand hob bereits die Reitgerte, als sie sich daran erinnerte, dass sie ihrem Ehemann hatte versprechen müssen, das Mädchen nicht mehr zu schlagen.
»Warum kommst du so spät?«, herrschte sie das Mädchen an.
Resa knickste, sah ihr dann aber offen ins Gesicht. »Gerd hat sich im Forst schwer verletzt. Sie sollten den Wundarzt holen lassen, denn ich weiß nicht, ob die alte Käthe ihm helfen kann.«
»Wenn die alte Hexe ihm nicht helfen kann, kann es niemand«, antwortete Frau Rodegard mit einem Achselzucken.
Resa begriff nicht, warum die Freifrau sich so wenig für ihre Leute interessierte. Auch wenn Gerd ein Knecht war und nicht sonderlich beliebt, so leistete er doch gute Arbeit. Ihrer Herrin dies zu sagen, wagte sie jedoch nicht.
Als sie gehen wollte, hielt die Freifrau sie auf. »Du hast doch den Knechten das Essen gebracht! Wo ist dein Korb?«
Jetzt erst erinnerte Resa sich daran, dass sie diesen im Wald hatte stehen lassen. »Ich konnte ihn nicht mitnehmen, da ich ins Dorf eilen musste, um Hilfe zu holen.«
»Du warst gewiss bei deiner Mutter!« Frau Rodegards Miene verfinsterte sich, als sie an Gunda Frohnert dachte. Wäre es nach ihr gegangen, hätte sie die Frau längst aus dem Dorf gejagt – und ihren Bastard dazu. Doch in dieser Beziehung war ihr Ehemann stur geblieben und hatte sogar dafür gesorgt, dass Gunda nicht als Magd arbeiten musste, sondern sich ihren Lebensunterhalt mit Näharbeiten verdienen konnte.
»Ich habe Mutter nur gesagt, dass Gerd verunglückt ist. Sie wollte Käthe holen und hat mich hierhergeschickt, damit ich Bescheid geben kann«, erklärte Resa.
Ihre Herrin musterte sie mit einem höhnischen Blick. »Wer es glaubt! Da du deinen Korb pflichtvergessen im Wald gelassen hast, wirst du ihn jetzt holen.«
Resa wusste, dass Widerspruch sinnlos war, doch sie wollte vorher noch in die Schlossküche gehen, um sich ein Stück Brot gegen den schlimmsten Hunger zu holen.
»Zum Wald geht es hier!«, sagte Frau Rodegard und lächelte boshaft. Auch wenn sie dem Mädchen in Zukunft weniger Schläge geben durfte, gab es genug andere Möglichkeiten, ihm das Leben zur Hölle zu machen.
Resa hätte sich im Dorf etwas zu essen besorgen können, aber sie traute es der Freifrau und deren Schatten Ida zu, sie zu beobachten und wegen angeblicher Pflichtvergessenheit zu bestrafen. Das war ihr das bisschen Hunger nicht wert. Während sie auf den Wald zuging, fragte sie sich, wie Menschen so kleinlich und gemein sein konnten.
Einen Augenblick überlegte sie, ob sie auf Trellnick anfragen sollte, ob dort eine Magd gebraucht wurde. Sie schob den Gedanken jedoch rasch wieder von sich, denn ihre Mutter würde gewiss nicht mitkommen können, und sie wollte sie nicht verlassen.
Als Resa in das Dunkel des Waldes eintauchte, stand die Sonne weit im Westen. Bis sie zurück im Schloss war, würde es bereits dunkel sein. Zu ihrer Erleichterung fand sie die Stelle, an der Gerd sich verletzt hatte, auf Anhieb und auch ihren Korb. Bis dahin hatte sie gehofft, es wäre etwas von dem Essen übrig geblieben, das sie dem Knecht hatte bringen wollen. Wildschweine hatten jedoch den Korb entdeckt und waren darüber hergefallen. Der Suppentopf lag etliche Schritte entfernt und war sauber ausgeleckt. Auch vom Brot und dem bisschen Speck war nichts mehr übrig.
Besorgt, die Schweine könnten den Korb mit ihren kräftigen Zähnen kaputt gemacht haben, hob sie ihn auf und sah, dass der Topf zwar eine leichte Delle aufwies, doch die würde sie mit Hilfe eines Steines glatthämmern können. Um die letzten Spuren der Wildschweine zu beseitigen, trug Resa Korb, Topf und die ebenfalls leere Bierkanne zum nächsten Bach und wusch das Geschirr sorgfältig.
Als sie Schritte vernahm, blickte sie auf und erkannte Frau Rodegards Gemahl.
»Was machst du da?«, fragte Gundolf von Steben und betrachtete das Mädchen mit trauriger Miene. Resa ähnelte dem Jugendbild seiner Mutter so sehr, als sei diese aus dem Rahmen gestiegen. Seine legitime Tochter Liebgard kam nach ihrer Mutter und hatte so gar nichts von seiner Familie an sich.
»Ich wasche nur die Sachen hier aus«, antwortete Resa.
»Das kann doch im Schloss geschehen«, meinte der Freiherr.
Auf Resas Gesicht trat ein scheues Lächeln. »Während ich weg war, sind Schweine über das Essen hergefallen, das ich Gerd bringen sollte. So schmutzig, wie der Korb ist, kann ich ihn nicht zurückbringen.«
»Weshalb hast du ihn zurückgelassen?«
Resas Miene wurde ernst. »Gerd hat sich verletzt, und ich musste erst Martin und Hans holen und dann ins Dorf laufen, um Bescheid zu geben.«
»Gerd ist verletzt? Wie schwer?«
»Ich weiß es nicht. Er hat stark geblutet. Jetzt kümmert sich die alte Käthe um ihn. Eigentlich hätte der Wundarzt geholt werden müssen, aber der kommt nicht mehr ins Dorf.«
Gundolf von Steben kniff verwundert die Augen zusammen. »Weshalb kommt der Wundarzt nicht ins Dorf, wenn jemand ihn braucht?«
Nun hätte Resa antworten müssen, dass Frau Rodegard dies so angeordnet hatte, wagte es aber nicht, sondern wandte sich wieder dem Korb zu, der im Gegensatz zu Topf und Kanne ziemlich dreckig geworden war.
Der Freiherr sah ihr zu und verachtete sich selbst, weil er dem Mädchen diese niedere Arbeit nicht ersparen konnte. Dabei hatte er ganz andere Pläne mit Resa gehabt. Doch die Abhängigkeit vom Geld seiner Frau und seine erneut leeren Kassen hatten dies verhindert. Er wollte bereits zu seinem Pferd zurückgehen, als ihm einfiel, dass Resa mehr als eine Meile bis zum Schloss würde laufen müssen.
Kurz entschlossen wartete er, bis Resa fertig war und den Topf wieder in den sauberen Korb stellte. »Komm mit!«, forderte er sie auf und ging zu seinem Hengst. Resa folgte ihm verwundert und sah zu, wie er mit einer geschmeidigen Bewegung in den Sattel stieg. Dann streckte er ihr die Hand entgegen.
»Komm, setz dich hinter mich! So kommst du schneller nach Hause.«
Resa wich einen Schritt zurück und schüttelte den Kopf. »Wenn das jemand sieht, werde ich arg gescholten.«
»Wenn du vor dem Waldrand absteigst, wird es keiner sehen.«
Gundolf von Stebens Tonfall ließ keinen Widerspruch zu. Daher ergriff Resa seine Hand und ließ sich von ihm aufs Pferd ziehen.
»Halte dich an mir fest, damit du nicht herabrutschst«, wies er sie freundlich lächelnd an.
Mit einer Hand hielt Resa krampfhaft den Korb fest und krallte die Finger der anderen Hand in das Sattelleder. Den Freiherrn zu berühren, wagte sie nicht.
Dieser nahm es mit einem gewissen Bedauern zur Kenntnis. Ich hätte mich Rodegard gegenüber durchsetzen sollen, dachte er, wusste jedoch selbst, dass dies nicht möglich gewesen war. Nur ihre Mitgift hatte das verschuldete Gut retten können. Nun würde sein Sohn bald in einen ähnlich sauren Apfel beißen und eine reiche Erbin heiraten müssen. Hoffentlich wird das Schicksal es besser mit Wilhelm meinen als mit mir, dachte er, während er den großrahmigen Hengst zum Waldweg lenkte und dort antraben ließ.
8.
Nachdem Gundolf von Steben Resa am Waldrand abgesetzt und ihr damit drei Viertel des Weges erspart hatte, ritt er ins Dorf. Angesichts der vernachlässigten Katen und Häuser kniff er die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Auch wenn die Bewohner die Reparaturarbeiten selbst durchführen mussten, so wäre es seine Aufgabe gewesen, ihnen Baumaterialien zur Verfügung zu stellen. Nur ein Viertel der Summe, die sein Sohn in einem Jahr als Sekondeleutnant in Berlin verbrauchte, hätte ausgereicht, um die meisten Schäden zu beseitigen. Doch auch in diesem Fall waren ihm die Hände gebunden, denn für seine Frau galt der Sohn alles, und die Leute, die mit ihrer Hände Arbeit dafür sorgten, dass sie gut leben konnten, weniger als nichts.
Mit diesem Gedanken erreichte Freiherr Gundolf die Kate der Hebamme und stieg schwerfällig aus dem Sattel. Ist Gerd etwas Schlimmes zugestoßen, so ist es meine Schuld, fuhr es ihm durch den Kopf. Er musterte die niedrige Hütte mit dem schütteren Strohdach, das mit Sicherheit keinem starken Regen mehr standhielt, und band die Zügel an den Kirschbaum, der in der Nähe der Kate stand. Als er auf die Tür zuging, wurde diese geöffnet, und er sah Käthe vor sich. Er konnte nicht sagen, wie alt die Hebamme war. Schon in seiner Kindheit war sie nicht mehr jung gewesen, und seitdem waren gut vierzig Jahre vergangen. In der Zeit hatte die Frau geholfen, alle Kinder auf dem Gut und im Schloss zur Welt zu bringen, bis auf die beiden, die Rodegard ihm geboren hatte. Für diese war ein Arzt aus der Stadt gekommen und hatte beide Male das ganze Schloss tyrannisiert.
»So in Gedanken, gnädiger Herr?«, fragte Käthe mit einem gewissen Spott.
Gundolf von Steben schüttelte sich. »Ich wollte fragen, wie es Gerd geht.«
»Der ist noch nicht reif fürs Himmelreich oder die Hölle. Auch wenn er die ganze Zeit schimpft, er hätte sich nur deshalb verletzt, weil Resas Rufen ihn erschreckt hat, so sollte er dem Mädchen besser dankbar sein, dass er noch lebt. Hätte sie ihm nicht das Bein abgebunden, wäre er verblutet. Aber es ist wie immer: Undank ist der Welt Lohn.«
»Kann ich mit ihm sprechen?«
Die Hebamme sah Gundolf von Steben kopfschüttelnd an. »Sie sind der Herr hier! Wenn Sie sagen, Sie wollen mit Gerd reden, dann geschieht dies auch.«
»Ich wollte nur wissen, ob er schläft oder bewusstlos ist«, sagte der Freiherr verärgert und trat an Käthe vorbei in das Häuschen, das aus einem einzigen Raum bestand. Der Verletzte lag auf dem Bett der Hebamme, das Gesicht schmerzverzerrt, und murmelte leise vor sich hin. Als Gundolf von Steben neben dem Bett stehen blieb, verstand er Flüche und Verwünschungen.
»Du solltest Gott nicht verfluchen, Gerd, sondern ihm danken, dass Resa nicht den Kopf verloren hat, als du dich verletzt hast«, wies er den Knecht zurecht.
Gerd drehte den Kopf und sah ihn mit verkniffener Miene an. »Dass Sie dieses Biest noch verteidigen, ist ja klar!«
Da fuhr Käthe auf. »Wenn du weiterhin so dummes Zeug redest, werde ich ernsthaft böse. Hätte Resa dir nicht das Bein abgebunden, lägest du jetzt in deiner eigenen Hütte aufgebahrt und würdest darauf warten, dass der Teufel dich holt. Ins Himmelreich kommt so einer wie du nicht.«
Die Hebamme wies durch die offene Tür auf die Hütte, in der der Knecht hauste. »Noch ein Wort gegen Resa, und ich rufe ein paar Männer, damit sie dich nach Hause tragen. Dann kannst du zusehen, wer dich pflegt und dir das Essen kocht!«
Bei diesen harschen Worten zog Gerd den Kopf ein. »Bei Gott, man wird sich doch noch ärgern dürfen.«
»Es ist etwas anderes, sich über die eigene Dummheit zu ärgern, als über das Mädchen herzuziehen, dem du dein Leben verdankst. Geht das nicht in deinen Dickschädel?«
»Du wirst ihn aber doch pflegen?«, fragte Gundolf von Steben besorgt. Seit dem Tod seiner Mutter lebte Gerd allein, und es gab im Dorf niemanden, der sich freiwillig seiner annehmen würde.
»Natürlich pflege ich ihn«, antwortete die Alte brummelnd. »Aber er soll mit dem Gerede aufhören! Ich mag es nicht, wenn man einen Fehler macht und diesen auf andere schiebt oder sie gar dafür bezahlen lässt.«
Käthe sah den Freiherrn so mahnend an, dass dieser sich ohne Abschied umdrehte und die Kate verließ. Als er sich draußen aufs Pferd schwang, wirkte sein Gesicht wie aus Stein gemeißelt. Er hatte begriffen, dass die letzte Bemerkung weniger auf Gerd als auf ihn bezogen war. Immerhin hatte er Gunda Frohnert geschwängert und war zu schwach, die gemeinsame Tochter vor seiner Gemahlin zu schützen.
»Ich hätte damals nicht nachgeben dürfen«, klagte er sich selbst an, während er den Weg zum Schloss entlangtrabte. Die Angst, Rodegard könnte ihre Drohung wahr machen und sich scheiden lassen, hatte ihn dazu gebracht, vor ihr einzuknicken. Bei einer Scheidung hätte sein Schwiegervater ihm jegliche Unterstützung entzogen, und dies wäre gleichbedeutend mit seinem Ruin und dem Verlust seines Besitzes gewesen. Mit einem bitteren Lachen dachte er daran, dass sich die Geschichte zu wiederholen schien. Nun würde sein einziger Sohn den Verlust des Gutes durch eine reiche Heirat verhindern müssen.
Vor den Ställen stieg er aus dem Sattel und reichte einem herbeieilenden Pferdeknecht die Zügel. Ohne auch nur ein Wort mit dem Mann zu wechseln, ging er durch den Garten zum Schloss und wollte es durch die Hintertür betreten. Da sah er seine Gemahlin auf der Terrasse sitzen und gesellte sich zu ihr.
»Sie sind ausgeritten?«, fragte sie.
Gundolf von Steben nickte. »Romulus musste bewegt werden.«
»Ich frage mich, weshalb Sie dieses Pferd nicht Wilhelm überlassen haben. Er hätte es in Berlin brauchen können!« Die Stimme der Freifrau klang giftig. »Der Inspektor war eben hier und hat Sie gesucht!«, fuhr sie fort, ohne auf eine Antwort zu warten. »Einer der Waldarbeiter wurde durch Resas Schuld schwer verletzt. Es ist ungewiss, ob er überleben wird.«
»Käthe meint, er würde es. Was Resa betrifft, so sagt die Hebamme, deren beherztes Zugreifen habe Gerd das Leben gerettet. Dies bringt mich darauf, Sie zu fragen, weshalb der Wundarzt angeblich nicht mehr zu den Leuten im Dorf gehen darf.«
»Weiß ich es? Vielleicht ist er es leid, auf sein Geld warten zu müssen. Nicht jeder ist so geduldig wie Ihr Schneider!« Frau Rodegard lächelte so spöttisch, dass es ihren Ehemann in den Fingern juckte, handgreiflich zu werden.
Resignierend wandte er sich jedoch ab und betrat das Schloss. In seinen Gemächern rief er nach seinem Kammerdiener. »Bring mir einen Cognac, Pierre!«
Pierre, der in Wirklichkeit Peter hieß und keine halbe Meile vom Schloss entfernt geboren worden war, verbeugte sich und ging. Nach einiger Zeit kehrte er mit einem Cognacglas auf einem silbernen Tablett zurück und verbeugte sich erneut.
»Ich bedaure, dem gnädigen Herrn mitteilen zu müssen, dass nur noch drei Flaschen der geschätzten Sorte des gnädigen Herrn vorrätig sind. Daher rate ich dem gnädigen Herrn, eine Bestellung aufgeben zu lassen.«
»Ich werde daran denken«, erklärte der Freiherr, sagte sich aber, dass er es in der nächsten Zeit nicht tun würde. Im Gegensatz zu seinem Schneider und einigen anderen Geschäftsleuten verlangte sein Wein- und Cognaclieferant prompte Bezahlung.
»Danke, Pierre, ich brauche dich jetzt nicht mehr«, sagte er, während er das Glas in die Hand nahm und sich ans Fenster setzte.
Als er in den Park hinausschaute, fiel ihm ein, dass seine Frau ihn aufgefordert hatte, die Bekanntschaft des neuen Besitzers von Trellnick zu suchen. Der Gedanke, einen Emporkömmling für Geld in die gute Gesellschaft dieses Landkreises einzuführen, widerstrebte ihm zutiefst. Daher beschloss er, am nächsten Tag in die Kreisstadt zu fahren und den Direktor seiner Bank aufzusuchen. Vielleicht erhielt er doch noch ein paar tausend Taler Kredit. Sie würden ihm so lange helfen, bis Wilhelm eine passende Braut gefunden hatte.
9.
Am nächsten Tag ließ Gundolf von Steben nach dem Mittagessen anspannen, die fragenden Blicke seiner Frau ignorierte er, bis sie ihn direkt fragte, was er vorhabe.
»Ich fahre in die Stadt«, antwortete er mit einem gezwungenen Lächeln. »Ich soll doch Wilhelm Geld schicken. Dazu muss ich meinen Bankier aufsuchen.«
»Das ist gut«, sagte sie und lächelte ebenfalls. In seinem letzten Brief hatte Wilhelm geschrieben, dass er bald Urlaub beantragen und nach Hause kommen werde. Sie hatte schon überlegt, welche Nachbarn und Freunde sie dazu einladen sollte. Leider war unter den Töchtern dieser Familien keine zu finden, die eine Mitgift erhielt, mit der sie Steben wieder auf die Höhe bringen konnte.
»Ich werde wohl ebenfalls ausfahren und Besuche machen«, erklärte sie und hoffte, von einer ihrer Bekannten eine Erbin genannt zu bekommen, die es wert war, von Wilhelm vor den Traualtar geführt zu werden.
»Tun Sie das!« Die Gleichgültigkeit, mit der Gundolf von Steben antwortete, erboste Rodegard. Mit einem leisen Schnauben rauschte sie ab.
Ohne etwas auf ihren Unmut zu geben, nahm der Freiherr von seinem Kammerdiener Zylinderhut und Stock entgegen und verließ das Gebäude. Wenig später bestieg er seinen Wagen, nannte dem Kutscher das Ziel und lehnte sich in das Sitzpolster zurück.
Auf der Fahrt sah er Resa mit dem Korb zwischen den Bäumen hervortreten. Wie es aussah, hatte sie auch an diesem Tag den Waldarbeitern das Essen bringen müssen. Er ärgerte sich darüber, denn er hätte sich eine leichtere, aber auch sinnvollere Arbeit für das Mädchen gewünscht. Verbittert über die Hilflosigkeit, die er seiner Frau gegenüber empfand, sah er starr an Resa vorbei, als der Wagen sie passierte.
Das Mädchen blickte ihm verwundert nach. Am Tag vorher war der Freiherr freundlich zu ihr gewesen, doch nun schien es, als würde er es bereits bereuen. Mit einem Achselzucken ging Resa weiter und war froh, dass es an diesem Tag keine Probleme gegeben hatte. Aufgrund der Ereignisse am Vortag hatte die Köchin ihr sogar ein wenig Suppe und ein Stück Brot mehr mitgegeben, damit sie im Wald etwas essen konnte. Sie war daher halbwegs satt, und da es ein schöner Tag war, auch recht guter Laune. Diese wollte sie sich auch von Frau Rodegard und deren Hilfsdrachen Ida nicht verderben lassen.
Während Resa auf das Dorf zuging, erreichte Gundolf von Steben die Stadt und ließ seinen Kutscher vor dem stattlichen Gebäude der Bank anhalten. Da er nicht nur ein Herr von Adel, sondern auch ein treuer Kunde war, eilte ihm sofort einer der Angestellten entgegen und machte einen Bückling.
»Der gnädige Herr wollen wohl zum Herrn Direktor?«
»Das will ich«, antwortete der Freiherr und sah sich in der Bank um.
Ein paar Kunden standen an den Schaltern und zahlten Geld ein oder ließen sich welches geben. Hier ging es nur um ein paar Taler. Die besseren Herrschaften empfing der Bankdirektor persönlich in seinem Kontor.
Neben Gundolf von Steben wartete noch jemand darauf, zu diesem vorgelassen zu werden. Es handelte sich um einen mittelgroßen, breit gebauten Mann mit einem energischen Gesichtsausdruck. Obwohl er Handschuhe trug, bemerkte der Freiherr kräftige Hände, wie sie kein Herr von Stand aufwies. Auch der braune Rock, die enge Hose aus gestreiftem Stoff und der Zylinder deuteten auf einen Bürgerlichen hin.
Der Freiherr hatte nicht die Zeit, den Fremden lange zu betrachten, denn der Bankangestellte erschien wieder und bat ihn, ihm zu folgen. Der Mann im braunen Gehrock machte eine unwillige Geste, beherrschte sich jedoch und betrachtete scheinbar interessiert die Statuen, die in den Nischen der Halle standen.
Bei dem Mann handelt es sich um niemanden, den der Direktor der Bank ihm vorziehen würde, dachte Gundolf von Steben zufrieden, als er den Korridor entlangschritt und kurz darauf in das bequem ausgestattete Kontor geführt wurde.
Der Bankdirektor stand auf und begrüßte ihn freudestrahlend. Erst vor kurzem war er aufgrund der Bemühungen einiger Herren, die ihn sich verpflichten wollten, in den Adelsstand erhoben worden. Gundolf von Steben hatte sich ebenfalls für ihn verwendet und hoffte daher, ein geneigtes Ohr für seine Kreditwünsche zu finden. Doch kaum hatte er sich diesbezüglich geäußert, nahm die Miene des Bankdirektors einen ablehnenden Ausdruck an.
»Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze, Herr von Steben. Allerdings bin ich zuvorderst meinen Anteilseignern in der Bank verpflichtet. Sosehr ich es bedauere, muss ich im Interesse der Bank auf Sicherheiten bestehen, und die können Sie mir leider nicht leisten.«
Ich bin umsonst gekommen, durchfuhr es von Steben, und er ärgerte sich, seine Unterschrift unter die Empfehlung, den Mann zu adeln, gesetzt zu haben. »Nun, dann werde ich mich wohl verabschieden, Herr von Hussmann!«
Mit kaum verhohlener Empörung stand er auf, um zu gehen.
Das war dem Bankdirektor auch nicht recht. Gundolf von Steben gehörte zu den tonangebenden Männern in diesem Landkreis, und wenn es hieß, dieser lade ihn nicht ein, blieben ihm auch andere Türen verschlossen.
»Jetzt lassen Sie doch die Kirche im Dorf, Herr von Steben. Auch wenn ich Ihnen durch meine Verpflichtung meinen Anteilseignern gegenüber keinen neuen Kredit mehr einräumen darf, so findet sich für Sie gewiss eine andere Möglichkeit, an Geld zu gelangen.«
Um zu verhindern, dass von Steben trotzdem sein Kontor verließ, fasste er diesen am Arm und führte ihn zu einem Sessel. »Setzen Sie sich, und du, Norbert, besorgst Wein für den Herrn Baron!«
Das Letzte galt dem Angestellten. Dieser verließ den Raum jedoch nicht gleich, sondern wandte sich noch einmal an seinen Herrn. »In der Halle wartet Herr Gerbrandt darauf, dass Sie ihn empfangen, Herr Direktor.«
Der Bankdirektor nickte erst unwillig, lächelte aber dann zufrieden. »Der kommt goldrichtig! Lass auch ihm ein Glas Wein reichen und teile ihm mit, dass ich ihn gleich Baron von Steben vorstellen werde.«
Als der Angestellte verschwand, sah Gundolf von Steben seinen Gastgeber verwundert an. »Wer ist dieser Gerbrandt? Muss man ihn kennen?«
»Unbedingt!«, antwortete der Bankdirektor. »Herr Gerbrandt ist der neue Herr auf Trellnick und, wie ich Ihnen im Vertrauen mitteile, der Besitzer einer Fabrik und mehrfacher Millionär.«
»Ein Adelsgut zu kaufen sollte nur Herren von Stand erlaubt sein und keinem Schmied!«
Steben klang abwehrend, doch sein Gastgeber hob beschwichtigend die rechte Hand. »Es gibt überall Ausnahmen, vor allem, wenn die Unterschrift Seiner Majestät, des Königs, unter der Empfehlung steht. Gerbrandt ist ein sehr wichtiger Mann und wird gewiss auch bald ein ›von‹ vor seinen Namen setzen können. Deshalb hat er auch Schloss und Gut Trellnick gekauft. Er will gesellschaftlich aufsteigen. Ein Geschäftspartner aus Duisburg, der Gerbrandt schon länger kennt, teilte mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit mit, dass der Mann sich hier in unserem Landkreis auf Brautschau begeben will.«
»Da wird er kein Glück haben. In unserer Gegend gibt kein Herr von Stand seine Tochter einem Emporkömmling«, erwiderte Steben mit einer gewissen Verachtung.
Der Bankdirektor wiegte den Kopf. »Wie ich schon sagte, ist Herr Gerbrandt mehrfacher Millionär. Wären meine Töchter nur fünf oder sechs Jahre älter, würde ich ihn mit Freuden als Schwiegersohn willkommen heißen. Er wäre jedoch auch für die Tochter aus altfeudalem Hause eine erstrebenswerte Partie. Mein Geschäftsfreund sagte mir, dass Gerbrandt bereit wäre, einer in Schwierigkeiten geratenen Familie mit hunderttausend Talern und mehr unter die Arme zu greifen. Deshalb habe ich auch an Sie gedacht. Ihre Tochter Liebgard wird bald siebzehn, und Sie könnten allmählich daran denken, einen Ehemann für sie zu finden. Ohne standesgemäße Mitgift wird Ihnen dies jedoch schwerfallen.«
Hussmann verbarg sorgsam, wie sehr er es genoss, den überstolzen Freiherrn auf dessen verzweifelte Situation hinweisen zu können.
Unterdessen kam der Bankangestellte zurück und reichte dem Freiherrn ein Glas Wein. Dieser trank einen Schluck und stellte das Glas ab. Alles in ihm schrie danach, dieses Zimmer umgehend zu verlassen und seine Geldgeschäfte einem anderen Bankhaus anzuvertrauen. Aber für einen solchen Schritt hatte er dieser Bank gegenüber zu viele Verbindlichkeiten. Mit diesem bitteren Gefühl blieb er sitzen und starrte auf die Tür, durch die Gerbrandt gleich eintreten würde.
»Gerbrandt ist ein beachtenswerter Mann«, fuhr der Bankdirektor fort. »Sein Vater war ein kleiner Schmied in einem der bergischen Dörfer. Er selbst hat mit zwanzig sein erstes Patent angemeldet und besaß fünf Jahre später bereits seine erste Fabrik. Nun sind noch einmal zehn Jahre vergangen, und er ist in dieser Zeit wohlhabend geworden. Es dürfte in unserer Provinz nur zwei oder drei Männer geben, die es mit ihm aufnehmen können, und in unserem Landkreis niemanden.«
Insgeheim sehnte Steben sich in die Zeit zurück, in der Stand und Landbesitz mehr gegolten hatten als Geld, und verspottete sich im nächsten Augenblick selbst. Schon Kaiser Maximilian hatte das Geld der Fugger und anderer Bankiers gebraucht, um seinem Enkel Karl die Krone zu sichern. Heutzutage zählten die Nachkommen dieser Geldverleiher zum hohen Adel und sahen auf Männer wie Gerbrandt ähnlich hochmütig herab wie er selbst.
Die Tür wurde geöffnet, und Gerbrandt trat ein. Steben hatte ihn bereits in der Halle gesehen, konnte ihn nun aber genauer mustern. Zu seiner Überraschung wirkte der Mann nicht unsympathisch. Sein Blick drückte das Selbstbewusstsein eines Mannes aus, der seinen Wert kannte, auch wenn dieser sich auf sein Bankkonto stützte und nicht auf eine jahrhundertelange Reihe adeliger Ahnen.
»Darf ich vorstellen? Herr Gerbrandt, der neue Besitzer von Trellnick, und Baron Steben, Herr auf Steben«, sagte der Bankbesitzer.
»Freiherr!«, korrigierte Gundolf von Steben ihn nun.
»Das ist doch dasselbe wie ein Baron«, warf Gerbrandt ein.
Steben schüttelte mit einem nachsichtigen Lächeln den Kopf. »Im Ranggefüge des Adels nehmen beide den gleichen Platz ein. Doch hier in Deutschland heißt es bei den alten Familien Freiherr. Als Barone bezeichnen sich nur jene, die in napoleonischer Zeit von dem Korsen dazu ernannt worden sind.«
»Verzeihen Sie meinen Fauxpas, so genau kenne ich mich nicht aus!«
Gerbrandt lächelte ohne jede Verlegenheit und musterte seinerseits den Freiherrn. Dieser war groß, schlank und mit einer Eleganz gekleidet, die einen ausgezeichneten Geschmack verriet. Sein Gesicht wirkte ebenmäßig und erinnerte ihn an jemanden, ohne dass er hätte sagen können, an wen. Eine gewisse Traurigkeit in Stebens Augen deutete darauf hin, dass bei ihm nicht alles zum Besten stand.
Von seinem Bankier in Duisburg wusste Gerbrandt, dass Steben sich am Rande des Ruins befand. Nicht zuletzt deshalb hatte er sich entschlossen, zuzugreifen, als Trellnick ihm angeboten worden war. Bis zum Vortag hatte er die Verbindung mit einer Familie aus uraltem Adel als höchstes Ziel angesehen. Doch nun drängte sich das Bild eines hübschen, etwa sechzehn Jahre alten Mädchens in seine Gedanken, das nicht nur eine schlichte Magd, sondern auch noch ein unehelicher Bastard war, dem alle Türen verschlossen bleiben würden.