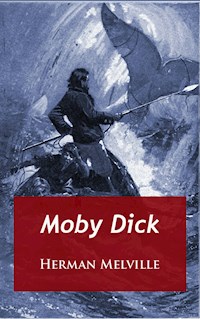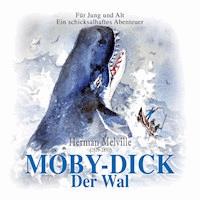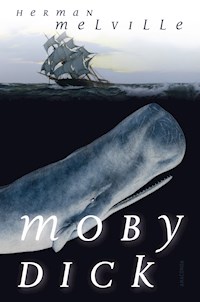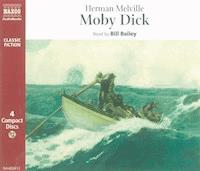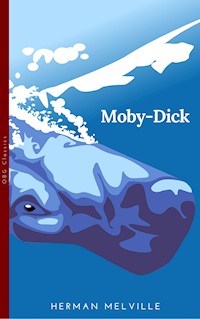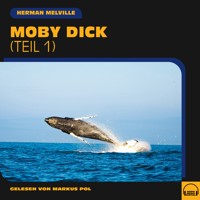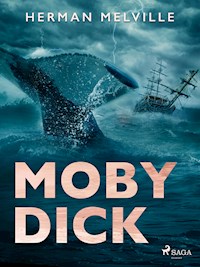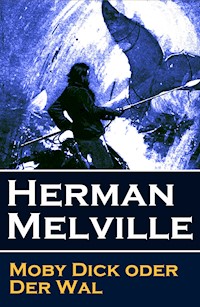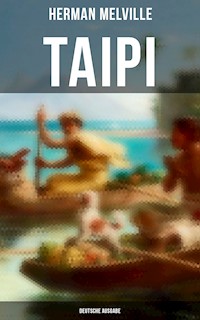
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Taipi, das bekannteste Buch des renommierten Autors Herman Melville, entführt den Leser in die exotische Welt der Südsee. In diesem Buch erforscht Melville die Beziehungen zwischen den einheimischen Taipi-Stämmen und den europäischen Entdeckern des 19. Jahrhunderts. Der Roman besticht durch seinen detailreichen Schreibstil und die fesselnde Erzählung, die den Leser in die unergründlichen Geheimnisse der Inseln eintauchen lässt. Melville gelingt es, eine Brücke zwischen Abenteuerroman und kultureller Analyse zu schlagen, was Taipi zu einem einzigartigen Werk in der Literaturgeschichte macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Taipi
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der ewige Entdeckungsdrang der Menschen verlangt stets nach neuen Menschen und Ländern. Ein Kolumbus stieß auf seinem Schiffchen nach Westen vor, und die flache Welt wurde zur göttlichen vollendeten Kugel, einer Schwester der Sonne und der Sterne. Wer entdeckt die Literaturen? Wer erforscht, wer eröffnet neue Gebiete der Phantasie, durchschlägt die dünne, unsichtbare Wand, die Sprache von Sprache trennt, läßt neues Licht, neue Farbe, neue Stimmen und Menschen in einer alten Welt wie in einem feierlichen Zuge wandeln? Oft vergessen die Völker einen großen oder eigenartigen Geist, besonders einen, der unzeitgemäß in der Zeit wirkte. Dann kommt endlich die Generation, die ihn versteht und zu der er sprechen kann, und der Mann erwacht wieder zum Leben und nimmt Unsterblichkeit an. So war es mit Herman Melville, einem der originellsten Dichter, die Amerika jemals gebar. Man hat ihn wieder entdeckt, und das Wunder, das sich in ihm offenbarte, wirkt heute mächtiger als je. Seine Stunde ist gekommen, wie auch die Edgar Allan Poes und Walt Whitmans kam.
Unsere Zeit hat eine neue Magie gebracht. Diese Zeit, in der grellste und wildeste Abenteuer allabendlich im weichen Plüschsessel vor leuchtender Leinwand aus zweiter Hand erlebt werden können – die Abenteuer der anderen, die gedichteten und konstruierten. Die Technik des modernen Verkehrs hat ein neues Pathos geschaffen – das Pathos der Nähe, die Tragik der zusammengeschrumpften Welt. Einige Stunden – und der Luxusmensch, noch vom Duft seiner Salons umgeben, vermag im Urwald spazierenzugehen. Die Abenteuer des deutschen Sports, der von der Nachahmung des Fremden ausgehend, zu eigener Form gelangt, ist ein gesunder Ersatz für den Ruhm der Schlachtfeldromantik geworden. Die äußere Welt verengt sich, aber das Reich der echten Erlebnisse dehnt sich ins Unendliche. Da ist das Meer noch offen und uferlos, der Wald steht jungfräulich und voller Geheimnisse da, der Berg hebt sich strahlend in frischem Sonnenglanz wie am ersten Tag.
Dieser unsterblichen Frische und Jugend begegnen wir in der Welt Herman Melvilles. Er ist der Vorgänger der modernen Dichter der unbekannten Weltteile, Meere und Weiten. Er war vor Stevenson, vor Kipling, Conrad und Jack London. Er war der Gefangene dieser Welten, betrat sie aber als Dichter und Entdecker.
Herman Melville war ein Gentleman-Abenteurer aus alter amerikanischer Familie, der das Los eines einfachen Matrosen auf sich nahm. Er war Feuergeist, Dichter und Denker und wurde schließlich nach seinen langen Fahrten Mystiker, denn es floß in ihm von mütterlicher Seite das schwere Blut der Holländer aus dem Stamme Gansevoort. Die bunte Welt, die er auf den farbenprächtigen Inseln der Südsee oder im stahlblauen Reich der Rieseneisberge kennenlernte, hüllte sich kristallhaft in eine leuchtende Metaphysik ein, und der frühere Seemann wurde später zum Faust. Eine solche abenteuerliche, freisinnige und problematische Natur wurde von dem damaligen Amerika nicht verstanden – man sah seine Haltung als eine geistige Verwirrung an. Seine Mitbürger verdammten ihn dazu, als kleiner Zollbeamter seinen Lebensunterhalt im Hafen von New York zu verdienen, wie sie Poe durch die Redaktionsstuben und dann zur Verzweiflung trieben, und den elementaren Whitman in ein Amtszimmer in Washington bureaukratisch einsperrten. Er war in seiner Zeit nicht unbekannt und nicht ungeehrt, aber er war vor seiner Zeit, und die englisch sprechende Welt mußte ihm erst entgegenreifen.
Jetzt sind die Jahre von ihm abgefallen, und er steht als ein ganz Großer und Eigenartiger da. Durch den tiefen Zug im Wesen dieses Mannes der Tat und durch den Untertan des Übersinnlichen, der in seinen Worten liegt, wird er vielleicht lauter und eindringlicher zum deutschen Geiste reden, als er selbst durch seinen spielerischen Humor, seine phantastische Ironie zum Angelsachsen sprach. Die Magie, die uns in unserer Kindheit aus dem Robinson Crusoe entgegenströmt, ist wieder erwacht.
Herman Melville wurde in New York im Jahre 1819 geboren. Nach dem Tode seines Vaters schiffte er sich mit siebzehn Jahren als Schiffsjunge nach Liverpool ein, mit achtzehn war er Matrose auf dem Walfischfahrer »Acuschnet« aus New Bedford. Nach zwölf Jahren Wanderfahrten, darunter einer Reise auf einem Kriegsschiff »The United States«, ließ er sich als Schriftsteller in New York nieder, siedelte später nach Pittsfield (Massachusetts) über, pflegte eine Freundschaft mit dem Dichter Nathaniel Hawthorne und erlebte seinen literarischen Ruhm, den er dann wieder selbst durch seinen intensiven Individualismus, seinen satirischen Ausfällen gegen die Missionare und seinen zunehmenden Mystizismus vernichtete. So starb er halb vergessen in New York im Jahre 1891.
In diesem Band »Taïpi«, der im Original »Typee« heißt, führt uns Melville in das Paradies der königlichen Kannibalen ein, unter denen er gelebt und deren Leben und Wesen er studiert hat. Hier weht uns der Atem einer jungen Urwelt entgegen – in dieser Odyssee lebt wieder der ursprüngliche Zauber der Marquesas-Inseln auf mit seinen herrlichen, braunen Naturkindern und dem goldenen Zeitalter, das jetzt schon längst dem Untergang durch die Seuche der weißen Zivilisation geweiht ist.
Welch eine Kraft durchströmt, welch ein Feuer durchglüht dieses Werk, das unter seiner eigenen Asche lebendig begraben war! Magisch rollt diese polynesische Welt weiter im Buch »Omu« (»Omoo«), das bald diesem ersten Band in den »Romanen der Welt« folgen wird, um bald darauf von Melvilles Meisterwerk, »Moby Dick« – einem der genialsten und ungeheuerlichsten Werke der modernen Literatur, dem Epos des Kampfes mit dem uralten unheimlichen weißen Walfisch, der in grandioser Dichtung das ganze Leben, die ganze Natur und ihre Kräfte verkörpert, gekrönt zu werden. Manches andere Werk Melvilles ist schon in Vorbereitung. Mit »Taïpi« sei Herman Melville einem großen deutschen Leserkreis zum ersten Male vorgestellt. Das Schiff dieses Dichters ist nach langer Fahrt endlich in einem neuen Heimathafen eingelaufen. Es bringt eine kostbare Fracht. Und von irgendwoher ertönt eine seltsame Musik, die sich in deutschen Herzen einschleichen wird. Und alle diese Herzen werden fühlen, daß das Schiff ihnen etwas von der Jugend bringt, die das Alter überdauert hat und die dem Frühling einer neuen Welt entstammt.
Herman George Scheffauer
Erstes Kapitel
Sechs Monate auf dem Meer! Ja, Leser, so wahr ich lebe, sechs Monate hatten wir kein Land gesehen, sechs Monate kreuzten wir nach Pottwalen unter der glühenden Sonne des Äquators, auf den Wogen des weithin rollenden Stillen Ozeans hin und her geworfen, den Himmel über uns, das Meer um uns und nichts sonst! Seit Wochen hatten wir keine frische Nahrung mehr, keine süße Kartoffel, nicht eine einzige Yamswurzel. Die herrlichen Bananenbündel, die einst unser Heck und Achterdeck schmückten, waren leider verzehrt! Die wonnigen Orangen, die von den Körben und Stagen hingen, gleichfalls längst dahin! Alles weg und nichts übrig als gesalzenes Pferdefleisch und Schiffszwieback.
Oh, was würden wir für einen erfrischenden Blick auf ein bißchen Gras, für eine Spur, ein Riechen von ein wenig Lehm und Erde gegeben haben! Aber das einzige Grüne, das wir sehen konnten, war die grüngestrichene Innenseite unserer Reling, eine jammervolle, widerliche Farbe, als ob nichts, was an wirkliches frisches Grün erinnerte, so weit vom Lande gedeihen könnte. Selbst die Rinde, die einst an unserem Feuerholz war, hatte das Schwein, das der Kapitän hielt, abgenagt und aufgefressen, und das Schwein selbst war leider seit langem verzehrt.
Der Hühnerstall hatte nur noch einen einzigen einsamen Bewohner, der einst ein kecker und munterer junger Hahn war und sich tapfer unter den scheueren Hennen hielt. Jetzt steht er den ganzen Tag traurig auf einem Bein und wendet sich mit Ekel von dem muffigen Korn ab, das wir ihm vorsetzen können, und dem fauligen Wasser in seinem kleinen Trog. Vielleicht trauert er auch um seine verlorenen Gefährtinnen, die ihm eine nach der anderen entrissen wurden. Aber er wird nicht mehr lange trauern; Mungo, unser schwarzer Koch, sagte mir gestern, daß das Schicksal des armen Pedro besiegelt sei. Sein abgemagerter zäher Körper wird nächsten Sonntag auf dem Tisch des Kapitäns liegen, und vor dem Abend wird er in dem Leibe des Würdigen begraben sein. Niemand hätte es für möglich gehalten, aber die Schiffsmannschaft betet um sein Ende, denn sie sagen, der Kapitän wird den Bug nie nach dem Lande richten, so lange er noch frisches Fleisch an Bord hat. Der unglückliche Hahn ist das letzte Stück, und darum ist nicht einer unter uns, der ihm nicht gerne den Hals umdrehen würde, denn alle haben nur den einen Wunsch, das lebendige Land wiederzusehen. Selbst das alte Schiff sehnt sich danach, noch einmal aus seinen Klüsgatten aufs Land schauen zu können, und mit Recht sagte Jack Lewis neulich zum Kapitän, der seine Steuerführung bemängelte:
»Ja, sehen Sie, Kapitän Vangs,« sagte er keck, »ich bin ein so guter Steuermann, als je einer Hand an die Spaken gelegt; aber niemand kann die Alte mehr steuern. Wir können sie nicht mehr im Kurs halten, Herr; man kann tun was man will, sie fällt ab. Ich kann das Ruder noch so sanft umlegen und ihr zureden und schmeicheln, sie tut's nicht, sie wird bös, sie fällt wieder ab; sie weiß, das Land liegt in Lee und sie will nun mal nicht mehr gegen den Wind angehen.«
Und Jack hat recht, und »Dolly«, das Schiff, hat recht, denn ihre Planken sind auf dem Land gewachsen, und sie fühlt so gut wie wir.
Man sieht es dem armen alten Schiff an, wie es sich nach dem Land sehnt. Es sieht wirklich kläglich aus; der Anstrich, von der glühenden Sonne ausgedörrt, ist überall gesprungen und abgefallen. Es schleppt Tang und Unkraut mit, am Heck kleben die Entenmuscheln wie häßliche Geschwüre; und sooft eine See es in die Höhe hebt, sieht man den Kupferbeschlag abgerissen und in verbeulten und ausgebrochenen Streifen hängen.
Seit einem halben Jahr wird es jetzt ohne einen Augenblick Ruhe auf den Wassern umhergeworfen. Aber nur Mut; es kommt noch anders! Bald liegst du gemütlich in irgendeiner grünen Bucht vor Anker, vor allen Winden geschützt, und nicht weiter vom vergnüglichen Ufer, als einer ein Stück Zwieback werfen kann.
»Hurra, Jungens! Es ist abgemacht, nächste Woche halten wir Kurs auf die Marquesas!«
Die Marquesas! Welche seltsamen Gesichte zaubert der Name herauf! Kokosnußhaine, Korallenriffe, sonnige Täler, mit Brotfruchtbäumen bepflanzt, Bambustempel, geschnitzte Kanus, die auf blitzenden, blauen Wassern dahinschießen, liebliche Mädchen, tätowierte Häuptlinge, wilde Wälder, die von schrecklichen Götzenbildern bewacht sind, heidnische Gebräuche, Menschenopfer und die Feste von Kannibalen. Diese Bilder verfolgten mich, seltsam durcheinandergewirbelt, während unserer Fahrt aus dem Jagdgebiet. Unwiderstehliche Neugier ergriff mich, die Inseln zu sehen, die die alten Reisenden in so glühenden Farben geschildert hatten.
Eine der frühesten europäischen Entdeckungen in der Südsee – im Jahre 1595 zum erstenmal besucht –, sind sie noch immer von wilden und seltsamen Geschöpfen bewohnt. Als Mendaña nach irgendeinem Goldland kreuzte, waren diese Inseln plötzlich wie ein Zauberbild auf seinem Wasserwege aufgetaucht, und für einen Augenblick glaubte der Spanier, sein schöner Traum sei erfüllt. Zu Ehren des Marques de Mendoza, des damaligen Vizekönigs von Peru, hatte er sie die Marquesas genannt und der Welt bei seiner Rückkehr einen ungewissen Bericht von ihrer Pracht und Schönheit gegeben. Aber Jahre blieben die Inseln ungestört und versanken wieder ins Dunkel der Vergessenheit. Die Missionare segelten an ihrem lieblichen Ufer vorbei und überließen sie ihren Götzen aus Holz und Stein. Hier und da einmal im Laufe eines halben Jahrhunderts störte irgendein abenteuernder Seefahrer ihren Frieden, und so unbekannt waren sie geblieben, daß er, erstaunt über das ungewöhnliche Bild, sich beinahe das Verdienst der Entdeckung zuschrieb.
So weiß man wenig von ihnen; Cook hat sie kaum berührt, und erst in den letzten Jahren sind amerikanische und englische Walfischfänger gelegentlich, wenn ihnen der Vorrat ausging, in den bequemen Hafen eingefahren, der sich in einer der Inseln findet; aber die Furcht vor den Eingeborenen, die Erinnerung an das schreckliche Schicksal, das schon viele weiße Männer dort ereilt hat, schreckte die Mannschaften ab, und sie verkehrten nur so wenig als möglich mit der Bevölkerung, nicht genug, um irgendwelche Kenntnis von ihren Lebensgebräuchen und Sitten zu bekommen. So gibt es keine Inselgruppe im Stillen Ozean, von der trotz der langen Zeit seit ihrer ersten Entdeckung so wenig bekannt ist, wie die Marquesas, und ich freue mich, daß diese meine Erzählung den Schleier ein wenig lüften wird, der auf einem so romantischen und herrlichen Gebiet bisher lag.
Zweites Kapitel
Nie werde ich die achtzehn oder zwanzig Tage vergessen, in denen die leichten Passatwinde uns still auf die Insel zutrieben. Auf der Jagd nach dem Pottwal hatten wir, etwa 20 Grad westlich von den Galapagos, an der Linie gekreuzt; sobald der Kurs nach den Inseln beschlossen war, brauchten wir nichts weiter zu tun, als die Rahen vierkant zu brassen und das Schiff vor dem Winde zu halten, alles andere taten das gute Schiff und die stetige Brise von allein. Der Mann am Ruder brauchte die alte Dame nicht durch überflüssiges Steuern zu belästigen; er machte es sich an der Pinne bequem und schlummerte stundenlang. Die Dolly lief getreulich ihren Kurs, und wie jene braven Leute, die am besten arbeiten, wenn man sie ganz sich selbst überläßt, so schaukelte und schob sich die alte Seeveteranin auf ihrer Fahrt hin.
Wir aber hatten eine wonnige, lässige Zeit der Faulheit und Ruhe. Das Schiff glitt dahin, wir hatten nichts zu tun, was auch durchaus unseren Neigungen entsprach. An der Gaffel war niemand mehr zu sehen. Wir spannten eine Decke über das Vorderkastell und darunter aßen, schliefen und lungerten wir den ganzen langen Tag. Es war, als ob wir Schlafmittel genommen hätten. Selbst die Offiziere achtern, deren Pflicht ihnen gebot, sich nicht zu setzen, solange sie Deckwache hatten, versuchten vergeblich, sich auf ihren Stelzen zu halten. Sie schlossen schließlich ein Kompromiß zwischen Pflicht und Mattigkeit, sie lehnten sich an die Reling und schauten mit leerem Blick in die Weite. Lesen kam gar nicht in Frage; wenn man ein Buch in die Hand nahm, schlief man in der nächsten Minute ein.
Wenn ich auch meistens der allgemeinen Trägheit erlag, gelang es mir doch hier und da, mich aufzuraffen und die Schönheit des Anblicks ringsumher zu genießen. Der Himmel dehnte sich weithin im zartesten Blau; nur fern am Horizont hing eine dünne Draperie bleicher Wolken, die niemals Farbe oder Form änderten. In langen feierlichen Rhythmen, wie mit einem Trauergesang, wogte das Meer um uns, mit unzähligen winzig kleinen Wellen auf der Oberfläche, die im Sonnenschein funkelten. Hier und da sprang eine Schar fliegender Fische, aus dem Wasser unter dem Bug aufgescheucht, in die Luft, um im nächsten Augenblick wie ein silberner Regenschauer ins Meer zu fallen. Man sah den herrlichen weißen Thunfisch mit seinen leuchtenden Flossen durch die Luft schießen und in einem mächtigen Bogen niedersteigend an der Wasserfläche verschwinden. In der Ferne war der Speistrahl eines Walfisches sichtbar, und in der Nähe des Schiffes ein beutegieriger lauernder Hai, dieser gemeine Straßenräuber des Meeres, der aus vorsichtiger Entfernung mit bösen Augen nach uns sah. Bisweilen stießen wir auf irgendein ungestaltes Seeungetüm, das, wenn wir näher kamen, langsam in den blauen Wassern versank und aus dem Gesicht schwand. Aber das merkwürdigste war die fast ungebrochene Stille über Himmel und Meer. Kaum ein Ton war hörbar, außer dem gelegentlichen Schnaufen eines Schwertwals und dem leichten Schlagen des Kielwassers.
Als wir dem Lande näher kamen, zeigten sich unzählige Seevögel, die ich mit Entzücken begrüßte. Laut schreiend und in Spiralen um uns fliegend begleiteten sie das Schiff und ließen sich manchmal auf unseren Rahen und Stagen nieder. Der Vogel, der so räuberisch aussieht und den passenden Namen »Kriegsschiffhabicht« führt, mit seinem blutroten Schnabel und rabenschwarzem Gefieder, umschwebte uns in immer engeren Kreisen, bis wir das seltsame Funkeln seines Auges ganz deutlich sehen konnten; dann, wie befriedigt von dem, was er gesehen, stieg er hoch in die Lüfte und verschwand. Immer deutlicher wurden die Zeichen der Landnähe; und es dauerte nicht mehr lange und wir hörten die frohe Ankündigung von oben mit jenem besonderen langgedehnten Ton, den die Seeleute lieben: »Land ahoi!«
Der Kapitän stürzte aus seiner Kabine an Deck und schrie nach seinem Fernglas; noch lauter brüllte der Maat dem Mann in den Toppen zu: »Wo?« Der schwarze Koch schob seinen wolligen Kopf aus der Kambüse und »Bootsmaat«, der Hund, sprang zwischen den Ohrhölzern in die Höhe und bellte wie verrückt. Land ahoi! Ja, da war es, eine kaum sichtbare unregelmäßige blaue Linie, die den fernen Umriß der gewaltigen Höhen von Nukuhiva andeutete.
Diese Insel wird zu den Marquesas gerechnet, bildet aber mit Ruka und Ropo eine besondere Gruppe, die man auch die Washington-Gruppe nennt. Sie bilden ein Dreieck und liegen zwischen 8+° 38+'' und 9+° 32+" südlicher Breite und 139+° 20+'' und 140+° 10+'' westlicher Länge von Greenwich. Aber ihre Einwohner sprechen den gleichen Dialekt wie auf den eigentlichen Marquesas, und ihre Gesetze, ihre Religion und Sitten sind die gleichen. Vielleicht hat man ihnen nur deshalb einen besonderen Namen gegeben, weil man von ihrem Dasein nichts ahnte bis zum Jahre 1791, in dem sie von Kapitän Ingraham aus Boston in Massachusetts entdeckt wurden, beinahe zwei Jahrhunderte nach der Entdeckung der Nachbarinseln durch den Agenten des spanischen Vizekönigs.
Nukuhiva ist die größte dieser Inseln, und die einzige, die oft von Schiffen berührt wird, bekannt und berühmt als der Platz, an dem der abenteuerliche Kapitän Porter während des Krieges von 1812 zwischen England und den Vereinigten Staaten seine Schiffe wieder seetüchtig machte, um von dort aus die gewaltige Flotte von Walfischfängern zu überfallen, die damals in den benachbarten Meeren unter der feindlichen Flagge segelte. Die Insel ist etwa 20 Meilen lang und ungefähr ebenso breit. An der Küste finden sich drei gute Häfen; der größte und beste wird von den Leuten, die dort leben, »Taiohi« genannt; Kapitän Porter taufte ihn »Bai von Massaschusetts«. Aber bei den Reisenden und unter den feindlichen Stämmen, die am Ufer der anderen Buchten leben, ist er zumeist unter dem Namen der Insel selbst, »Nukuhiva« bekannt. Die Einwohner sind durch den Verkehr mit Europäern in letzter Zeit ein wenig verdorben worden, aber was ihre besonderen Sitten und ihre Lebensweise betrifft, sind sie so primitiv und beinahe in dem gleichen Naturzustand geblieben, wie zur Zeit, da die weißen Männer sie zum erstenmal erblickten. Die feindlichen Stämme, die in den entferntesten Teilen der Insel leben, und nur äußerst selten mit Fremden in Berührung kommen, sind noch völlig unverändert und genau so, wie man sie zuerst kennenlernte.
In der Bucht von Nukuhiva lag der Ankergrund, nach dem unsere Fahrt ging. Gegen Sonnenuntergang hatten wir den ersten Schimmer der fernen Berge erblickt; die ganze Nacht lief das Schiff vor einer ganz leichten Brise, und am nächsten Morgen sahen wir die Insel dicht vor uns; da aber die Bucht, die wir suchten, an der anderen Seite lag, mußten wir eine Strecke am Ufer entlang segeln; und wir kamen auf dieser Fahrt an blühenden Tälern, tiefen Schluchten, Wasserfällen und wogenden grünen Hainen vorüber, die auftauchten und wieder verschwanden, die zwischen felsigen Vorgebirgen verborgen lagen und jeden Augenblick uns mit neuer Schönheit überraschten.
Wer die Südsee zum erstenmal besucht, wird von dem Anblick, den die Inseln, vom Meer gesehen, bieten, zumeist überrascht. Aus den ungewissen Berichten, die man von ihrer Schönheit hört, stellen die Menschen sie sich als sanft ansteigende smaragdgrüne Ebenen vor, mit entzückenden schattigen Hainen, durch die murmelnde Bäche laufen und die sich nur wenig über die Fläche des Ozeans erheben.
Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus: wilde Felsenküsten, an denen die Brandung mächtig gegen steile Klippen schlägt, und die sich hier und da in tiefen Schluchten öffnen und den Blick auf dichtbewaldete Täler bieten, die durch mit Grasbüscheln bewachsene Gebirgsrücken getrennt sind und von den steilen zerklüfteten Höhen im Inneren sich zur See hin senken, geben den Inseln ihren Charakter.
Gegen Mittag waren wir auf der Höhe des Hafeneingangs angelangt, und endlich glitten wir langsam um das Vorgebirge und fuhren in die Bucht von Nukuhiva ein. Niemand vermöchte ihre Schönheit zu schildern; aber ich sah ihre Schönheit nicht; ich sah nur die dreifarbige französische Flagge, die am Heck von sechs Fahrzeugen wehte, deren schwere Schiffskörper und bestückte Breitseiten ihren kriegerischen Charakter verkündeten. Da lagen sie in der lieblichen Bucht, und die grünen Höhen am Strand sahen so ruhig auf sie nieder, als mißbilligten sie den drohenden Anblick. Nichts schien mir weniger zur Landschaft zu passen als die Gegenwart dieses Geschwaders; aber wir erfuhren bald, was sie hergeführt hatte: Der Konteradmiral Du Petit-Thouars hatte soeben im Namen der unbesiegbaren französischen Nation von der ganzen Inselgruppe Besitz ergriffen!
Wir erfuhren dies von einem höchst merkwürdigen Kerl, einem echten Südseevagabunden, der in einem Walfischboot längseits kam, sowie wir in die Bai einfuhren, und mit Hilfe einiger Menschenfreunde am Fallreep an Bord gelangte, denn er befand sich in jenem interessanten Stadium der Besoffenheit, in dem der Mensch friedfertig und hilflos ist. Obwohl er völlig außerstande war, sich aufrecht zu halten oder seinen Körper über das Deck zu steuern, erbot er sich doch großherzig, das Schiff nach einem guten und sicheren Ankergrund zu lotsen. Unser Kapitän, der kein großes Vertrauen in seine Fähigkeiten setzte, weigerte sich, ihn als Lotsen anzuerkennen; aber der freundliche Herr war entschlossen, seine Rolle durchzuführen; es gelang ihm mit mühevollem Klettern in das Boot an der Luvseite zu gelangen, dort hielt er sich an einem Segeltuch fest und begann sogleich mit erstaunlichem Wortreichtum und seltsamen Gebärden seine Befehle zu erteilen. Natürlich wurden sie von niemandem befolgt, da es aber ebenso unmöglich war, ihn ruhig zu kriegen, so fuhren wir an den Schiffen des Geschwaders entlang, während der sonderbare Kerl die ganze Zeit angesichts aller französischen Offiziere seine Mätzchen machte.
Später erfuhren wir, daß unser spaßhafter Gast einst Schiffsleutnant in der englischen Marine gewesen war, und in irgendeiner großen Hafenstadt sich irgend etwas hatte zu schulden kommen lassen und darauf desertiert war; dann hatte er sich manches Jahr auf den Südseeinseln umhergetrieben, und da er zufällig gerade in Nukuhiva war, als die Franzosen von der Insel Besitz ergriffen, war er von der neuen Obrigkeit zum Hafenpiloten ernannt worden.
Während wir langsam tiefer in die Bucht einfuhren, stießen zahlreiche Kanus von den umliegenden Ufern ab, und wir waren bald von einer ganzen Flottille umgeben. Die Wilden darin mühten sich heftig, an Bord unseres Schiffes zu gelangen und stießen einer den anderen bei ihren vergeblichen Versuchen zur Seite. Gelegentlich verfingen sich die vorspringenden Ausleger ihrer leichten Flachboote, wenn sie aneinander fuhren, unter dem Wasser, und die Kanus drohten zu kentern. Dann gab es eine unbeschreibliche Verwirrung. So seltsame Laute und so leidenschaftliche Gebärden hatte ich noch nie im Leben gehört oder gesehen. Es sah ganz so aus, als wenn die Insulaner einander ans Leben wollten. Während sie in der Tat nur in freundlichster Weise ihre Boote frei zu machen suchten.
Zwischen den Kanus, über die Bucht verstreut, sah man überall Kokosnüsse schwimmen, die kreisförmige Gruppen auf dem Wasser bildeten und mit jeder Welle auf- und niederschaukelten. Unerklärlich war, daß diese Kokosnüsse sich alle stetig dem Schiff näherten. Als ich mich neugierig über den Schiffsrand beugte, um das Rätsel zu lösen, und den Kranz von Nüssen, der den anderen am weitesten vorausschwamm, näher ins Auge faßte, da bemerkte ich, daß die Nuß in der Mitte von einer ganz merkwürdigen Art war. Sie wirbelte, bewegte sich und tanzte in der seltsamsten Weise zwischen den anderen, und als sie noch näher kam, zeigte sie ein paar Augen, einen kahlgeschorenen. Schädel: was ich für eine Frucht gehalten, war der Kopf eines Insulaners, der seine Ware in dieser seltsamen Weise auf den Markt brachte. Die Kokosnüsse waren alle durch teilweise von der Schale losgerissene Streifen ihrer zottigen äußeren Hülle aneinander befestigt und zusammengebunden. In die Mitte des Kranzes steckte der Eigentümer seinen Kopf und trieb sein Kokosnußhalsband durch das Wasser, indem er sich unter der Oberfläche mit den Füßen fortbewegte.
Ich war einigermaßen erstaunt, unter den vielen Eingeborenen, die uns umgaben, nicht ein einziges Frauenzimmer zu sehen. Ich wußte damals noch nicht, daß der Gebrauch von Kanus dem weiblichen Geschlecht auf der ganzen Insel durch ein »Tabu« aufs strengste untersagt ist. Kein Weib darf bei Todesstrafe auch nur ein auf dem Lande befindliches Kanu betreten; die Folge ist, daß eine Marquesas-Dame, die zur See zu reisen wünscht, sich der natürlichen Ruder bedienen muß, die ihrem schönen Leibe angewachsen sind.
Wir waren vom innersten Rande der Bucht nur noch anderthalb Meilen entfernt, als einige Eingeborene, die inzwischen auf die Gefahr, ihre Kanus unter Wasser zu setzen, an Bord geklettert waren, unsere Aufmerksamkeit auf eine seltsame Bewegung im Wasser in unserer Fahrtrichtung lenkten. Zuerst dachte ich, es müßte ein Zug von Fischen sein, die an der Oberfläche spielten, aber unsere wilden Freunde versicherten uns, daß es ein Zug von »Winhinis« (jungen Mädchen) sei, die vom Strande kämen, um uns zu bewillkommnen. Als sie näher kamen und ich sie beobachtete, wie sie sich in der Flut hoben und senkten, mit der rechten Hand ihren Lendenschurz aus Tappa übers Wasser hielten und ihr dunkles langes Haar seitlich im Wasser nachzogen, schienen sie lauter Seejungfern zu sein; und wie Seejungfern benahmen sie sich auch.
Wir waren noch in einiger Entfernung vom Strande, in langsamer Fahrt, als wir mitten unter diese schwimmenden Nymphen gerieten, die sogleich von allen Seiten an Bord zu gelangen suchten; die einen hielten sich an die Püttings und sprangen in die Ketten; andere erfaßten auf die Gefahr, vom Schiff überrannt zu werden, die Wasserstage und hingen, ihre schlanken Körper um die Taue windend, in der Luft.
Alle aber kamen zuletzt an der Schiffswand hoch, an die sie sich klammerten, vom Wasser triefend, vom Bade glühend, während ihr kohlschwarzes Haar ihnen über die Schultern fiel und ihre sonst völlig nackten Körper halb umhüllte. Da hingen sie, funkelnd von wilder Lebenslust, und lachten einander zu und schwatzten in größter Fröhlichkeit. Dabei waren sie nicht müßig, sondern alle halfen einander augenblicklich bei ihrer allerdings höchst einfachen Toilette. Die üppigen Locken wurden von Schlamm und Tang gesäubert, aufgewunden und in den kleinsten Raum zusammengepreßt, der ganze Körper sorgfältig getrocknet und mit einem duftenden Öl gesalbt, das in einer kleinen runden Muschelschale von Hand zu Hand ging; dann gürteten sie ein paar lose Falten von weißem Tappa um die Mitte und waren fertig. Nun zögerten sie auch nicht länger, sondern schwangen sich leicht über die Reling und im nächsten Augenblick tummelten sie sich lustig über das Verdeck. Viele eilten nach dem Vorderschiff und hockten alsbald wie Vögel auf den Gallionsrelingen oder liefen aufs Bugspriet hinaus, andere fanden auf der Heckreling Platz oder legten sich der Länge nach auf die Boote.
Sie waren ein völliges Wunder für mich, alle ganz jung, die Farbe ein helles Braun, mit zartesten Zügen und unsagbar anmutigen Gestalten; die sanft gerundeten Glieder und die freie unbefangene Bewegung, alles ließ sie ebenso seltsam als schön erscheinen.
Die »Dolly« war erobert; und ich muß sagen, daß nie ein Schiff von einer keckeren und unwiderstehlicheren Schar geentert wurde. Das Schiff war genommen, uns blieb nichts übrig, als uns zu ergeben, und während der ganzen Zeit, die sie in der Bucht blieb, war die »Dolly« und ihre Mannschaft vollkommen in der Hand der Seejungfrauen. Am Abend, nachdem wir vor Anker gegangen waren, war das Deck von Laternen beleuchtet und die ganze malerische Schar von Sylphen veranstaltete, blumengeschmückt und in Kleider von buntem Tappa gehüllt, einen Ball in großem Stil. All diese Insulanerinnen tanzen leidenschaftlich, und in ihrer wilden Anmut und dem Geist, möchte ich sagen, der ihren Tanz beseelt, übertreffen sie alles, was ich je gesehen. Die mannigfachen Tänze der Marquesas-Mädchen sind wunderbar schön, aber es liegt eine wollüstige Hingabe darin, die ich nicht beschreiben werde.
Jede Art von Lust und Ausschweifung herrschte auf dem Schiff. Während der ganzen Zeit, die es dort vor Anker blieb, und mit nur sehr kurzen Unterbrechungen überließen sich die Leute, zumeist schändlich besoffen, dem gröbsten Genuß. Ach, um die armen wilden Geschöpfe, die so vollkommen verdorben werden! Sie geben sich natürlich und vertrauend hin und werden von den Europäern, die sie angeblich »zivilisieren«, zu jedem Laster verleitet und reuelos zugrunde gerichtet. Dreimal glücklich jene, die auf irgendeiner noch unentdeckten Insel mitten im Ozean leben und nie in die befleckende Berührung mit dem weißen Mann gekommen sind!
Drittes Kapitel
Unsere Ankunft auf der Insel fand im Sommer 1842 statt, und unser Schiff war noch nicht viele Tage in der Bucht von Nukuhiva, als ich den Entschluß faßte, es zu verlassen.
Man wird mir glauben, daß meine Gründe zahlreich und gewichtig waren, wenn ich mich lieber unter die wilden Bewohner der Insel wagen als noch eine Fahrt an Bord der »Dolly« mitmachen wollte. Um es in der geraden Seemannssprache zu sagen, ich war entschlossen »auszureißen«. Und da dieses Wort im allgemeinen eine wenig schmeichelhafte Bedeutung hat, so bin ich es mir wohl selber schuldig, mein Verhalten zu erklären.
Als ich mich für die »Dolly« heuern ließ, unterschrieb ich natürlich die Schiffsartikel und verpflichtete mich dadurch freiwillig und band mich gesetzlich für die volle Dauer der Fahrt; und unter gewöhnlichen Umständen hätte ich meine Pflicht auch erfüllen müssen. Wenn aber ein Teil seine Vertragspflichten nicht erfüllt, wird wohl auch der andere frei. Selbst die in den Schiffsartikeln besonders genannten Bedingungen waren unzählige Male verletzt worden. Die Behandlung an Bord war eine tyrannische; die Kranken wurden in unmenschlicher Weise vernachlässigt; die Nahrung wurde aufs spärlichste zugeteilt, die Kreuzerfahrten sinnlos ausgedehnt und verlängert. Schuld an alledem war der Kapitän, und es wäre töricht gewesen, zu erwarten, daß er sein Verfahren ändern würde. Man konnte nicht gewalttätiger und wilder vorgehen als er. Auf alle Klagen und Vorstellungen hatte er nur eine einzige rasche Antwort, die er mit dem dicken Ende einer Handspake gab, und die den Beschwerdeführer aufs überzeugendste und wirksamste zum Schweigen brachte.
Und wir konnten uns an niemanden um Abhilfe wenden. Gesetz und Recht hatten wir hinter uns gelassen, sobald wir Kap Horn umschifft hatten; die Mannschaft war, mit wenigen Ausnahmen, aus dem gemeinsten und völlig herabgekommenen Gesindel zusammengesetzt, überdies waren sie unter sich in Streit und nur darin einig, daß alle die Tyrannei des Schiffers widerstandslos ertrugen. Es wäre Wahnsinn gewesen, wenn zwei oder drei von uns allein den Versuch gemacht hätten, uns gegen die Mißbräuche und Mißhandlungen aufzulehnen. Wir würden nur die besondere Rache dessen heraufbeschworen haben, der für uns Herr über Leben und Tod war, und die übrige Mannschaft wäre noch schlimmer behandelt worden.
Schließlich hätten wir das alles eine Weile ausgehalten, wenn wir nur die Hoffnung gehabt hätten, die Reise in vernünftiger Zeit zu vollenden und unserer Sklaverei ledig zu werden. Aber gerade darin waren die Aussichten fürchterlich. Die lange Dauer der Walfischfahrten um Kap Horn ist sprichwörtlich. Häufig dauert so eine Fahrt vier oder fünf Jahre. So mancher junge Kerl mit langem Haar und bloßem Halse, der von Not und Abenteuerlust getrieben, sich in Nantucket einschifft, um, wie er meint, einen vergnüglichen Ausflug nach dem Stillen Ozean zu unternehmen, und dem die besorgte Mutter noch ein paar gut verkorkte Milchflaschen mitgibt, kommt als ein Mann von mittleren Jahren zurück.
Schon die Vorbereitungen für solch eine Expedition können einen erschrecken. Da das Schiff keine Ladung führt, wird der Schiffsraum lediglich mit Vorräten gefüllt. Die Lieferanten sind die Schiffseigentümer, und sie füllen die Speisekammer mit Leckerbissen besonderer Art: hauptsächlich Schnitten von Rind- und Schweinefleisch, die den merkwürdigsten Teilen des Tieres entnommen, sorgfältig eingesalzen und in Fässer verpackt, im Grad der Zähigkeit und des Salzgehaltes wirklich eine unendliche Abwechslung bieten. Sonst allerdings keine. Dazu das feinste alte Wasser in mächtigen Tonnen, das viele Monate lang aufbewahrt wird und von dem jeder an Bord täglich zwei Pinten voll erhält. Ein reicher Vorrat an Schiffszwieback, der vorher schon sorgfältig zu Stein gehärtet wird, offenbar um ihn vor Verfall oder Verderb zu schützen, bietet der Mannschaft einen weiteren Genuß. Die Menge, in der diese herrlichen Nahrungsmittel an Bord gebracht werden, ist unglaublich. Manchmal, wenn ich im Schiffsraum die unendlichen Reihen von Fässern und Tonnen aufgeschichtet sah, die wir im Verlauf der Reise leer essen sollten, verlor ich allen Mut.
Im allgemeinen hört ein Schiff, das kein Glück gehabt und nicht viel Wale getroffen hat, nicht auf, nach ihnen zu kreuzen, bis ihm kaum genug Mundvorrat bleibt, um nach Hause zu gelangen, dann wendet es und macht sich auf die Heimfahrt, wie es eben geht. Es gibt aber Beispiele, in denen besonders hartköpfige Schiffer sich auch davon nicht bewegen ließen, sondern die Frucht ihrer schweren Arbeit in den Häfen von Chile oder Peru gegen neuen Mundvorrat eintauschten und die Reise munter von neuem begannen. Vergeblich schreiben die Reeder ihm dringende Briefe und fordern ihn auf, um ihretwillen das Schiff heimzusteuern, da er offensichtlich keine Ladung schaffen kann. Das kümmert ihn nicht. Er hat ein Gelübde getan: er wird sein Schiff mit gutem Walrat füllen, und wenn es ihm nicht gelingt, niemals mehr Yankeeland ansteuern.
Der Seemannswitz erzählt von einem Walfischfänger, der nach langen Jahren verlorengegeben wurde; das letzte, was man von ihm gehört, war ein unsicherer Bericht, daß er eine jener schwimmenden Inseln in der fernsten Südsee berührte, deren seltsame Wanderungen in jeder neuen Ausgabe der Seekarten sorgfältig verzeichnet werden. Nach langer Zeit hörte man plötzlich wieder, die »Perseverance« – so hieß das Schiff – sei irgendwo am Ende der Welt gesehen worden, wo sie so munter kreuzte wie je, die Segel alle geflickt und mit Kabelgarn gestopft, die Spieren mit alten Röhren verschalt, das Tauwerk ganz verknotet und versplißt. Die Mannschaft bestand aus etwa zwanzig ehrwürdigen alten Teerjacken, die wie Pensionäre aus einem Seemannsheim aussahen und gerade noch über Deck humpeln konnten. Die Enden alles laufenden Guts, mit Ausnahme der Signalfallen und der Treiberschot am Schanzdeck, waren über Blöcke geschoren und führten zu Gang- und Ankerspillen; keine Rahe wurde gebraßt, kein Segel gesetzt, ohne diese Maschinerie zu verwenden. Der Rumpf war mit Muscheln so besetzt, daß er wie in einem Futteral stak. Drei zahme Haie folgten ihr im Kielwasser und wurden aus dem Mülleimer des Schiffkochs gefüttert, dessen Inhalt täglich über den Schiffsrand geleert wurde. Ein mächtiger Zug von weißen und gestreiften Thunfischen folgten ihr auf ihren Fahrten.
Was aus dem Schiff geworden, habe ich nie erfahren; es ist jedenfalls nie heimgekommen; vielleicht wendet es heute noch regelmäßig zweimal in vierundzwanzig Stunden irgendwo auf der Höhe der Buggerryinsel oder der Teufelschwanzspitze.
Angesichts der Dauer dieser Fahrten hatte die unsere erst begonnen, denn wir waren kaum fünfzehn Monate unterwegs; ich sah daher trübe in die Zukunft, um so mehr, als ich immer eine Vorahnung hatte, daß wir Unglück haben würden, und meine Erwartung bisher nur bestätigt worden war. Ich habe auch nachher gehört, als ich nach manchen Abenteuern heimkam, daß das Schiff sich noch auf dem Stillen Ozean befand und wenig Jagderfolg gehabt hatte. Der größte Teil der Mannschaft hatte es verlassen; die ganze Reise dauerte über fünf Jahre.
Ich hatte also beschlossen auszureißen; ein ruhmreiches Unternehmen war dies nicht; ich konnte mich nicht einmal für all das Unrecht rächen, das ich an Bord erfahren hatte, aber was blieb mir übrig?
Ich versuchte zunächst, soviel wie irgend möglich über die Insel und ihre Bewohner zu erfahren, um meinen Plan danach einzurichten. Und ich erfuhr folgendes: die Bucht von Nukuhiva, in der wir lagen, hat die Form eines Hufeisens; der Umfang beträgt etwa neun Seemeilen. Man fährt durch eine schmale Öffnung ein, zu beiden Seiten der Einfahrt liegen zwei kleine Zwillingsinseln, die kegelförmig aus dem Wasser bis zu einer Höhe von etwa fünfhundert Fuß ansteigen. Dann weicht der Strand beiderseits zurück und beschreibt einen tiefen Halbkreis. Vom Ufer der Bucht steigt das Land nach allen Seiten gleichförmig an, bis es von sanften grünen Hügelabhängen und mäßigen Erhebungen unmerklich sich zu majestätischen Höhen erhebt, deren blaue Umrisse den Blick von allen Seiten schließen. Tiefe Schluchten, die sich in fast gleichmäßigen Entfernungen zum Ufer senken und offenbar alle von einem gemeinsamen Mittelpunkt ausstrahlen, erhöhen die romantische Schönheit der Landschaft. Ihr oberes Ende verliert sich im Schatten der hohen Berge. Durch jedes dieser engen Täler fließt ein klarer Bach, der hier und da über einen Felsen fällt, dann unsichtbar weiterschleicht, bis er in größeren brausenden Wasserfällen wieder sichtbar wird und zuletzt still zum Meere hinab sich schlängelt.
Unregelmäßig in diesen Tälern verstreut, unter schattigen Zweigen der Kokosnußbäume, liegen die Häuser der Eingeborenen, aus gelbem Bambus erbaut, dessen Stäbe mit einer Art von Weidengeflecht geschickt und geschmackvoll verbunden sind. Das Dach besteht aus den langen spitzen Blättern der Zwergpalme.
Von unserem Schiff aus gesehen, das etwa in der Mitte der Reede vor Anker lag, glich die Landschaft um die Bucht einem weiten natürlichen Amphitheater, das in Verfall geraten und mit wildem Wein überwachsen schien, während die tiefen Schluchten ungeheuren Rissen glichen, die durch die zerstörende Wirkung der Zeit entstanden waren. Oft, wenn ich bewundernd vor soviel Schönheit stand, tat es mir leid, daß ein so bezauberndes Bild so vor aller Welt verborgen in jenen fernen Meeren lag.
Außerhalb der Bai ist das Ufer der Insel von vielen Buchten gezahnt, zu denen breite grüne Täler niedersteigen. Sie sind von ebenso vielen verschiedenen wilden Stämmen bewohnt, die zwar verwandte Dialekte der gleichen Sprache sprechen, dieselbe Religion und dieselben. Gebräuche haben, aber dennoch seit undenklichen Zeiten in Erbfeindschaft und ewigem Kampfe leben. Die Berge, die sie trennen, und die sich zumeist zwei- bis dreitausend Fuß über dem Meeresspiegel erheben, bilden auch die Grenzen dieser feindlichen Stämme, die sie nie überschreiten, außer um einen Kriegs- oder Beutezug zu unternehmen. Dicht bei Nukuhiva, nur durch die Berge, die man von der Bucht aus sieht, getrennt, liegt das liebliche Tal von Happar, dessen Bewohner mit denen von Nukuhiva den freundlichsten Verkehr pflegen. Jenseits von Happar liegt, dicht daran grenzend, ein herrliches Tal, in dem die gefürchteten Taïpis wohnen, die mit beiden Stämmen in unversöhnlicher Feindschaft leben.
Diese berühmten Krieger flößten den übrigen Inselbewohnern unsagbaren Schrecken ein. Schon ihr Name ist entsetzlich, denn das Wort »Taïpi« bedeutet in der Marquesas-Sprache »Menschenfresser«. Es ist allerdings sonderbar, daß gerade sie allein diesen Namen erhielten, da die Eingeborenen der ganzen Gruppe unverbesserliche Kannibalen sind. Vielleicht wurde ihnen der Name gegeben, um die besondere Wildheit des Stammes zu kennzeichnen und sie zu brandmarken. Denn die Taïpis sind auf der ganzen Inselgruppe berüchtigt. Die Eingeborenen von Nukuhiva schilderten unserer Schiffsmannschaft oft mit lebhaften Gebärden ihre schrecklichen Taten und zeigten uns die Wundnarben, die sie in wilden Kämpfen mit ihnen davongetragen hatten. Wenn wir auf dem Lande waren, versuchten sie uns manchmal zu erschrecken, indem sie auf einen ihrer eigenen Leute zeigten und ihn einen Taïpi nannten, und wunderten sich, daß wir dann nicht augenblicklich die Flucht ergriffen. Ganz amüsant war zu beobachten, mit welchem Ernst sie alle Neigung zum Kannibalismus ihrerseits leugneten, während sie ihre Feinde, die Taïpis, einer eingewurzelten Vorliebe für Menschenfleisch bezichtigten; aber darüber werde ich noch öfters zu sprechen Gelegenheit haben. Jedenfalls, obwohl ich überzeugt war, daß die Bewohner der Bucht genau so eingefleischte Kannibalen waren wie die anderen Stämme der Insel, fühlte ich doch einen besonderen und unbeschreiblichen Widerwillen gegen die Taïpis. Noch ehe ich selbst nach den Marquesas gekommen war, hatte ich von Leuten, die die Gruppe auf früheren Reisen berührt hatten, schauderhafte Geschichten über diese Wilden gehört; noch ganz frisch in meiner Erinnerung stand das Abenteuer des Schiffers der »Katharine«, der erst vor wenigen Monaten, als er sich in einem bewaffneten Boot unvorsichtig in jene Bucht gewagt hatte, um Tauschhandel zu treiben, von den Eingeborenen ergriffen, in ihr Tal geschleppt und vor einem grausamen Tode nur durch ein Mädchen gerettet wurde, das ihm des Nachts zur Flucht den Strand entlang nach Nukuhiva verhalf.
Ich hatte auch von einem englischen Schiff gehört, das vor vielen Jahren nach einer langen ermüdenden Fahrt den Eingang der Bucht von Nukuhiva gesucht hatte, und etwa zwei oder drei Meilen von der Küste einem großen Kanu voll von Eingeborenen begegnete, die sich erboten, ihnen den Weg zu zeigen. Der Kapitän, der die Insel nicht kannte, nahm den Vorschlag freudig an; das Kanu paddelte weiter und das Schiff folgte; es wurde nach einer herrlichen Bucht geführt und warf im Schatten des hohen Ufers den Anker aus. Noch in derselben Nacht kamen die treulosen Taïpis, die sie so in ihre Todesbucht gelockt hatten, zu Hunderten an Bord des verlorenen Schiffs, und auf ein gegebenes Zeichen ermordeten sie die gesamte Besatzung bis auf den letzten Mann.
Viertes Kapitel
Nachdem ich einmal entschlossen war, das Schiff heimlich zu verlassen und alles über die Bucht in Erfahrung gebracht hatte, was ich konnte, überlegte ich meinen Plan. Der unerträglichste Gedanke war mir der, eingefangen und schimpflich wieder aufs Schiff gebracht zu werden; ich wollte daher keinen unüberlegten Schritt tun, der zu solchem Mißgeschick hätte führen können.
Ich wußte, daß unser würdiger Kapitän, der um die Wohlfahrt seiner Mannschaft so väterlich besorgt war, es nicht leicht zugegeben hätte, daß einer seiner besten Leute sich den Gefahren eines Aufenthalts unter den barbarischen Eingeborenen der Insel aussetzte. Und ich war völlig sicher, daß er, wenn ich verschwand, viele Ellen herrlich bedruckten Kalikos als Lohn für meine Ergreifung bieten würde. Vielleicht schätzte er meine Dienste sogar bis zur Höhe einer Muskete ein, und dann, das wußte ich, machte sich die ganze Bevölkerung, von einem so herrlichen Preise gelockt, sofort zur Verfolgung auf.
Da mir bekannt war, daß die Insulaner aus Gründen der Vorsicht in den Tiefen der Täler zusammen wohnten und Wanderungen in den Bergen und selbst über die Uferhöhen vermieden, es wäre denn auf gemeinsamen Kriegs- und Beutezügen, so nahm ich an, daß ich unbemerkt in die Berge gelangen und leicht dort bleiben und mich von Früchten nähren könnte, bis das Schiff wieder unter Segel ging. Das aber mußte ich sofort wahrnehmen, da ich von oben den ganzen Hafen bequem überschauen konnte.
Dieser Gedanke schien mir praktisch und versprach überdies genußreich zu werden. Wenn ich mir die Freude vorstellte, mit der ich aus einer Höhe von einigen tausend Fuß auf das verhaßte alte Schiff heruntersehen und die grüne Landschaft um mich mit ihrem engen Deck und dem düsteren Vorderkastell vergleichen würde – der bloße Gedanke war erfrischend. Ich sah mich bereits unter einem Kokosnußbaum hoch oben in den Bergen sitzen, einen Pisanghain in erreichbarer Nähe, und die Bewegungen des ausfahrenden Schiffes mit kritischen Blicken verfolgen. Allerdings gab es auch Schattenseiten in dem erfreulichen Bild: die Möglichkeit, einer fouragierenden Truppe blutgieriger Taïpis zu begegnen, deren Appetit, von der Höhenluft geschärft, sie zu für mich unangenehmen Maßnahmen veranlassen konnte. Aber dagegen war nichts zu machen. Wenn ich mein Ziel erreichen wollte, mußte ich die Gefahr auf mich nehmen; ich rechnete auf meine Geschicklichkeit, in den Bergen hinreichende Verstecke zu finden, um den beutegierigen Kannibalen zu entgehen. Außerdem konnte ich mit einer Wahrscheinlichkeit von zehn zu eins annehmen, daß sie ihre Täler nicht verlassen würden.
Ich hatte beschlossen, meine Absichten keinem meiner Schiffsgenossen mitzuteilen und noch weniger einem zuzureden, daß er mich etwa auf der Flucht begleiten sollte. Dennoch geschah es in einer Nacht auf Deck, da ich meine Pläne überdachte, daß ich einen von der Schiffsmannschaft, offenbar in tiefe Gedanken versunken, sich über die Reling lehnen sah. Es war ein junger Bursche, etwa im gleichen Alter wie ich, der mir immer gut gefallen hatte; und Toby, so nannte er sich unter uns – seinen wirklichen Namen wollte er nie sagen –, verdiente das auch. Er war energisch, entschlossen, gefällig, von unbezwinglichem Mut und ungewöhnlich offen und furchtlos im Reden. Ich hatte ihm mehr als einmal geholfen, wenn er dadurch in Schwierigkeiten gekommen war, und er hatte vielleicht deshalb, oder weil eine gewisse Seelenverwandtschaft zwischen uns bestand, meine Gesellschaft stets bevorzugt. Wir hatten manche lange Wache zusammengesessen und uns die trägen Stunden mit Geplauder, Liedern und Geschichten vertrieben, unterbrochen von manchem kräftigen Fluch auf das üble Geschick, das uns beide betroffen hatte.
Toby hatte offenbar wie ich sich vorher in anderen Kreisen bewegt; sein Gespräch verriet es bisweilen, obschon er es zu verbergen versuchte. Er war einer jener Abenteurer, die man manchmal auf dem Meere trifft, die nie ihre Herkunft verraten, nie eine Anspielung auf ihr Zuhause machen und sich, wie von einem geheimnisvollen Schicksal verfolgt, in der Welt umhertreiben.
Vieles an Toby zog mich an; während das Äußere des größten Teiles der Mannschaft ebenso brutal war wie ihr Wesen, sah er ungewöhnlich gut aus. In seiner blauen Jacke und seinen Hosen aus weißem Segeltuch war er ein so schmucker Seemann, als je einer die Planken eines Verdecks betrat; er war auffällig klein und zierlich, aber außerordentlich kräftig und gelenkig. Seine von Natur aus dunkle Hautfarbe war von der Tropensonne noch mehr gebräunt, sein Haar hing in rabenschwarzen, dichten Locken um die Schläfen und ließ seine großen schwarzen Augen noch dunkler erscheinen. Er war ein seltsamer Mensch und wechselnden Stimmungen unterworfen, launisch, heftig, eigensinnig, melancholisch, zuzeiten fast finster und trübselig. Dabei war er von rasch aufloderndem, feurigen Temperament, und wenn er gründlich gereizt war, ging sein Zorn bis zum Wahnsinn. Ich habe kräftige Burschen, denen es sonst an Mut nicht fehlte, vor diesem zarten Jungen zittern sehen, wenn er einen seiner Wutanfälle hatte. Sie waren indessen nicht häufig und er wurde dabei die Galle los, die ruhigere Leute in beständigen kleinen Ärgernissen ausgeben.
Niemand hat Toby je lachen sehen, wenigstens nicht in herzlicher, freier Lustigkeit. Er lächelte mitunter und besaß einen trockenen, spöttischen Humor, der bei seinem unerschütterlichen Ernst um so wirkungsvoller war.
In der letzten Zeit hatte ich beobachtet, daß seine Traurigkeit zunahm; seit unserer Ankunft in der Bucht hatte ich ihn oft sehnsüchtig nach dem Ufer schauen sehen, wenn die übrige Mannschaft sich unten im Schiffsraum ihren wilden Vergnügungen hingab. Es war mir klar, daß auch er das Schiff verabscheute, und ich nahm an, daß er eine gute Gelegenheit zur Flucht gerne benützen würde. Aber der Versuch war an der Stelle, an der wir uns befanden, so gefährlich, daß ich mich für den einzigen Mann an Bord hielt, der tollkühn genug war, es zu wagen. Ich war jedoch im Irrtum. Als ich Toby so in Gedanken versunken über die Reling lehnen sah, kam mir sogleich der Gedanke, daß er Ähnliches im Sinne haben mochte wie ich. Und wenn ich einen meiner Schiffsgenossen zum Gefährten der Flucht wünschte, so war er es. Wer weiß, ob es mir nicht bevorstand, mich in den Bergen wochenlang versteckt halten zu müssen. Wie angenehm mußte dann ein Gefährte sein! Diese Gedanken schossen rasch durch mein Hirn, und ich wunderte mich, daß sie mir nicht früher gekommen waren. Es war noch nicht zu spät. Ein freundlicher Schlag auf die Schulter weckte Toby aus seiner Träumerei; er war bereit, und wenige Worte genügten uns zur Verständigung. In kaum einer Stunde hatten wir unseren Plan fertig. Dann verpflichteten wir uns gegenseitig mit einem freundschaftlichen Handschlag und begaben uns, um keinen Verdacht zu erwecken, jeder zu seiner Hängematte, um die letzte Nacht an Bord der »Dolly« zu verbringen.
Am nächsten Tage hatte die Steuerbordwache, zu der wir beide gehörten, Landurlaub: das war unsere Gelegenheit. Sobald als möglich nach der Landung wollten wir uns unauffällig von den anderen trennen und sogleich in die Berge fliehen. Vom Schiff aus gesehen, schienen ihre Gipfel unersteiglich; aber da und dort zogen sich sanfter geneigte Ausläufer fast bis ans Meer; sie glichen Strebepfeilern, die den Mittelstock des Gebirges stützten und jene ausstrahlenden Täler bildeten, von denen ich sprach. Einen dieser Kämme, der leichter zugänglich schien als die anderen, beschlossen wir hinanzuklettern, und wir suchten uns schon vom Schiff aus mit seiner Lage und den Örtlichkeiten möglichst vertraut zu machen, um dann am Ufer den Aufstieg nicht zu verfehlen. Dann wollten wir uns solange verborgen halten, bis das Schiff die Bucht verließ, hierauf versuchen, welche Aufnahme wir bei den Eingeborenen von Nukuhiva finden würden, und solange auf der Insel bleiben, wie wir den Aufenthalt angenehm fanden, um sie später bei der ersten günstigen Gelegenheit zu verlassen.
Fünftes Kapitel
Früh am nächsten Morgen stand die Steuerbordwache auf dem Achterdeck gereiht und der Kapitän hielt vom Kajütengang aus folgende Ansprache: