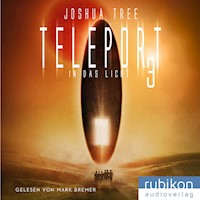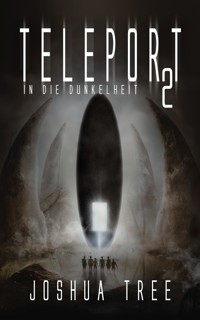
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
James und sein Team sind auf Prime gestrandet. Der Rückweg ist versperrt und sie sehen sich einer Welt gegenüber, die in ihren letzten Atemzügen liegt. Lediglich ein kleines Waldgebiet scheint Strahlung und Stürmen noch zu trotzen und seine Beschaffenheit gibt den Forschern Rätsel auf. Doch am Horizont sehen sie die Überreste einer Stadt und schöpfen neue Hoffnung - bis sie herausfinden, was auf diesem dunklen Planeten wirklich geschehen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
TELEPORT 2
IN DIE DUNKELHEIT
JOSHUA TREE
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Nachwort
1
Dr. Adrian Smailow ließ das Wasser des Flusses zwischen seinen Fingern hindurchrinnen und genoss das Gefühl der Kälte, das es durch seinen gesamten Körper sandte. Es vertrieb die Hitze nicht gänzlich von seiner Haut oder aus seinen Knochen, die von innen heraus zu glühen schienen. Doch es sandte Wellen kühlen Schauderns über ihn hinweg, das prickelte wie eine Gänsehaut. Der Weg von der Mauer hinunter in die grüne Waldlandschaft, die sich bis zum Horizont mit seinen merkwürdigen Gebäuden erstreckt hatte, war beschwerlich gewesen, zumal sie Mette die meiste Zeit über tragen oder so hatten stützen müssen, dass es einem Tragen gleichkam. Doch jetzt hatten sie wenigstens Wasser und getrunken, was zumindest ein paar Lebensgeister zurückgebracht hatte. Seine Lippen waren noch immer aufgesprungen und rissig, aber er wurde nicht mehr von diesem heftigen Schwindel geplagt, und auch sein Körpergefühl entsprach nicht mehr dem eines ausgewrungenen Lappens.
Während er sein Gesicht in der gekräuselten Wasseroberfläche betrachtete, die noch immer ein verzerrtes Spiegelbild abgab, obwohl der Morgen heranbrach, erinnerte er sich an seine letzte Mission auf der internationalen Raumstation ISS. Damals war Felicity Barnes Kommandantin gewesen, eine drahtige NASA-Astronautin mit einem Falkengesicht, das ihn an seine ehemalige Grundschullehrerin erinnert hatte, an deren Namen er sich im Gegensatz zu ihrem strengen Blick nicht mehr erinnern konnte. Er war gerade in seinem Schlafsack im Swesda-Modul dabei gewesen, den Reißverschluss zuzuziehen, was ihm auch nach zwei Wochen auf der Station noch nicht leichtgefallen war, als der Alarm losgejault hatte. Durch sein rigoroses Training im Sternenstädtchen vor den Toren Moskaus hatte er sofort gewusst, dass es der Feueralarm war, und sich befreit. Da der russische Teil des internationalen Gemeinschaftsprojekts etwas abseits lag und er und sein Kollege Dima im Grunde im Alltag immer ihr eigenes Süppchen kochten, dauerte es einen Augenblick, bis er nachgeprüft hatte, ob es sich um ein Feuer in ihren Modulen handelte, oder in den westlichen auf der anderen Seite.
Wieder spielten sich die einschneidendsten zwölf Minuten und dreizehn Sekunden seines Lebens vor seinem inneren Auge ab, als wäre er selbst dort und würde sie zum ersten Mal durchleben.
Adrian starrte auf den Laptop-Bildschirm im Swesda, nachdem er sich aus der Kammer mit den Schlafbuchten, die wie aufrechte Särge nebeneinander in die Wand eingelassen waren, abgestoßen hatte und zwischen den cremefarbenen Compartments mit Holzoptik schwebte. Mit den Händen hielt er sich an den grauen Haltestangen fest und sah, wie es im europäischen Columbus-Modul rot blinkte.
»Felicity, was ist da los?«, rief er über Funk. »Ist der Durchgang zu euch frei?«
»Feuer im PMA 3!«, kam die atemlose Antwort der Kommandantin. »Alle ins Destiny!«
Adrian nickte stumm und winkte in Richtung des Zarya-Verbindungsmoduls, als Dima aus dem Schlafbereich kam. Mit einem stummen Nicken machte sich der andere Kosmonaut auf den Weg, schwamm wie ein Fisch im Wasser mit behänden Handgriffen und gestreckten Beinen durch die Konservenbüchse, die sie hier oben in über vierhundert Kilometern Höhe ihr vorübergehendes Zuhause nannten.
Ein Feuer im All war neben dem Einschlag eines Mikrometeoriten mit Druckverlust das Schlimmste, was sie an Ernstfällen geprobt hatten, und er konnte am Gestank verbrannter Kabel bereits erkennen, dass es sich weder um eine Übung, noch um eine Kleinigkeit handelte.
»Blyat!«, fluchte Dima vor ihm auf Russisch, während sie, so schnell es ging und ohne sich zu verletzen, durch die Module glitten. »Warum wurden wir erst vom Alarm geweckt?«
»Der ist äußerst sensitiv.«
»Hat gerade noch gefehlt.«
Im Destiny-Modul warteten bereits Felicity und Roy von der NASA und Max Erichsen von der ESA, die sich offenbar gerade die Gasmasken übergezogen hatten und jetzt auch ihm und Dima welche hinhielten. Zwischen all den verriegelten Schubladen und Computern, die an schwenkbaren Armen in der Wand befestigt waren – ganz abgesehen von den tausenden Kabeln – war es jetzt so eng, dass nicht einmal mehr eine Colabüchse Platz gefunden hätte.
Adrian wusste, dass es vermutlich Blödsinn war, aber er konnte nicht umhin, sich wieder wie ein Kosmonaut zweiter Klasse zu fühlen, jetzt, wo er mit den Westlern hier zusammenkam und ihm das Adrenalin wie ein Dampfhammer in den Ohren sauste. Sie kamen später und hatten als Letzte die Masken auf. Obwohl unter Astronauten ein ausgesprochener Corpsgeist herrschte, war es leicht, sich als Russe wie ein Außenseiter zu fühlen. Ihre Module waren veralteter, sie hatten im Prinzip kaum etwas zu tun, weil ihre Regierung kaum Forschungsprojekte im All finanzieren konnte, und jeder Kosmonaut war bloß hier, um der Nation zu zeigen, dass man noch mit den Amerikanern mithalten konnte und äußerst stolz auf die eigenen Fähigkeiten war. Die ungeschminkte Wahrheit aber war, dass die Westler Sechzehn-Stunden-Schichten schoben, während sie selbst Fotos machten, mit Wartungsarbeiten beschäftigt waren, oder Tagebuch schrieben und ansonsten Däumchen drehten. Das war natürlich jedem hier bewusst, wodurch sie zwar als Raumfahrer respektiert – schließlich waren sie noch immer die kleinste Gemeinschaft der Welt – aber trotzdem auch nicht als gleichwertig betrachtet wurden. Zumindest war er sich da sehr sicher.
»Also, weiter mit der Fehleranalyse«, sagte Felicity, und ihre Stimme klang unter der Maske, als spreche sie unter Wasser.
»Im PMA 3 gibt es insgesamt achtundvierzig elektronische Systeme mit etwa gleichvielen Kabelverbindungen. Die ersten Flammen kamen an der blauen Nut auf, also können wir zumindest die Schließmechanismen ausschließen«, schlug Roy vor. Der untersetzte Amerikaner hatte als Einziger ein Headset auf und war mit der Bodenkontrolle verbunden.
Das Gespräch ging einige Minuten hin und her, bis ein lauter Knall zu hören war und sie alle erschraken. Der beißende Geruch nach verbranntem Gummi wurde immer schlimmer.
»Wir evakuieren!«, sagte Roy schließlich, nachdem er der Stimme in seinem Ohr gelauscht hatte, die sich weit unter ihnen in Houston in Sicherheit befand.
»Nein, wir lassen die Station nicht einfach im Stich …«, wandte Felicity ein.
»Aber Ground Control hat den Befehl gegeben, dass …«
»Sie ist die Kommandantin!«, rief Max mit deutschem Akzent. Er klang aufgebracht. »Sie ist hier oben, Ground Control nicht.«
»Also, was machen wir?«, fragte Adrian.
»Roy, schalte den Strom zum Harmony ab! Am wahrscheinlichsten ist ein Kurzschluss!«, befahl Felicity. »Dima, hol die Speicherkarten aus dem Harmony raus. Max, Ventilation abschalten!«
Adrians Freund und Kollege nickte und stieß sich behände mit den Füßen ab, glitt zwischen ihm und Roy hindurch und passierte bereits den runden Verbindungsteil zwischen beiden Modulen, um die massiven Speicherkarten aus den Wänden zu ziehen.
»Felicity, wir sollen evakuieren!«, beharrte Roy, der entsprechend ihrer Ausbildung sofort hätte handeln müssen. Adrian hatte ihn nie besonders gemocht mit seiner schroffen Cowboy-Art, aber dass jemand wie er durch die Tests hatte durchkommen können, war ihm ein Rätsel.
»Ich kann ihn abschalten!«, schlug er vor, nachdem Max bereits damit beschäftigt war, die Sojus für die Evakuierung vorzubereiten, was Felicity ihm gerade aufgetragen hatte.
»Du brauchst den Zugangscode.« Sie schüttelte den Kopf und sah gehetzt zwischen ihrem NASA-Kollegen und dem Harmony hin und her, wo Dima bereits die dritte Speicherkarte herausgezogen und ihr einen Stoß in ihre Richtung gegeben hatte. Nun flog sie wie die beiden anderen wie ein winziges Raumschiff durch die Schwerelosigkeit zu ihnen ins Destiny.
»Wir sollten sofort …«, sagte Roy mit rotem Gesicht.
»PROTOKOLL!«, brüllte Adrian ihn an, und der kurze Schock schien zu helfen, denn der Amerikaner nickte plötzlich und drehte sich eilig zu einem der Laptops an der Wand und hackte wie wild auf der Tastatur herum.
»Adrian, du …« Weiter kam Felicity nicht, denn es gab einen Knall und eine grelle Stichflamme schoss durch das Harmony-Modul, nur einen Durchgang weiter, wo Dima hektisch dabei war, ihre Daten physisch zu sichern. Er schrie auf, als sich einige der Feuerblasen, die sich als Kugeln in der Schwerelosigkeit bewegten, in sein Bein fraßen. Dutzende weitere gelb-roter Kugeln, die wie kleine Dämonen aus der Hölle an den technischen Geräten vorbeiflogen, hielten auf sie und das Destiny-Modul zu.
»Scheiße!«, fluchte Felicity und hob die Abdeckung der Notverriegelung von der Wand, ehe sie mit der Faust darauf schlug. Die Sicherheitsluke zwischen den Modulen schloss sich mit einem Zischen, und Harmony wurde augenblicklich entlüftet. Der gesamte Druck wurde in einem Stoß ins Vakuum gesaugt und Adrian sah, wie sein Freund hinter dem dicken Bullauge zu zucken begann, die Adern im Gesicht blau. Sein Todeskampf dauerte insgesamt zwei Minuten, wie man später feststellen würde, doch Felicity ließ ihnen keine Zeit, zu trauern. Sie scheuchte sie zur Sojus und blieb selbst zurück. Da niemand mehr wagte zu widersprechen und ihnen der Schock ins Gesicht geschrieben stand, saßen sie Minuten später in der engen Raumfähre und rasten unter Anleitung von Ground Control auf die Erde zu.
Wochen später war Roy entlassen worden und Felicity wurde als Heldin verehrt, weil sie zurückgeblieben war, um die Station im Orbit zu halten und, so gut es ging, zu reparieren, bis eine mehrköpfige Ablösung kam. Aber an Dima erinnerte man sich nur als denjenigen, der es nicht geschafft hatte, der tragisch ums Leben gekommen war.
Dabei war es Roys Schuld gewesen, weil er sich nicht an die Anweisungen gehalten und damit das Team im Stich gelassen hatte. Für Adrian hatte festgestanden, dass er nie wieder ins All wollte, nach diesem Erlebnis, das, entgegen den Medienberichten, nichts mit Heldentaten oder einem gerade noch gut gegangenen Abenteuer zu tun gehabt hatte, sondern mit einer geradezu enttäuschenden Echtheit, die nichts Erhabenes an sich hatte. Er hatte auch im Protokoll vermerkt, dass er zwar nicht einverstanden gewesen war mit Felicitys Entscheidung, den Evakuierungsbefehl von Ground Control zu ignorieren – obwohl sie damit im Endeffekt recht behalten hatte, weil ein Operator einen Datensatz fehlinterpretiert hatte und glaubte, der Brand würde sich innerhalb weniger Sekunden durch einen Kabellauf ins Destiny fortsetzen. Trotzdem hätten sie es tun müssen, dann wäre zumindest Dima nicht gestorben und sie hätten nicht erst mit einem wertvollen Leben beweisen müssen, warum es die Regel gab, dass das Team als Einheit arbeitete, selbst wenn einem Einzelnen eine bestimmte Entscheidung nicht gefiel.
»Hey, alles in Ordnung?«
Adrian blickte auf und sah Mette, die zwischen zwei der großen, schlanken Bäume auf ihn zu kam. Sie watschelte auf die für sie typische Art, die ihn auf sympathische Weise an einen jener Pinguine erinnerte, die er als Jugendlicher mit seinem Vater in Kamtschatka gejagt hatte, wenn der gröbste Schnee des Winters sich zurückzog und die weiten Ebenen vor der Küste passierbar machte. Ihre Wangen wirkten auch jetzt noch besonders rosig, wo die Hitze ihre gesamte Haut glühen ließ. Sie hatten ihren verletzten Fuß grob mit Stöcken und einer zerfaserten Liane geschient, die sie von einem der Bäume gezogen hatten. Trotzdem benötigte sie den massigen Stock, auf den sie sich sichtlich aufstützte.
»Ja, alles okay«, sagte er und blickte sich ein letztes Mal ins eigene Gesicht, ehe er sich rasch die Hände wusch und noch etwas Wasser über Augen, Stirn und Wangen rieb. Dann stand er auf und füllte eine der leeren Injektordosen mit einem Schwenk aus dem Fluss auf, ehe er ihn ihr reichte. Sie nickte dankbar und trank. Da das improvisierte Gefäß so klein war, wiederholte er den Vorgang noch einige Male, bis sie zufrieden den Kopf schüttelte.
»Du siehst so grübelig aus.«
»Grübelig?«, fragte er und mühte sich ein Lächeln ab. »Das ist doch nicht mal ein Wort.«
»Falls nicht, würde ich es für deinen Gesichtsausdruck erfinden«, gab sie zurück und legte ihm eine Hand auf die Schulter, die er blinzelnd beäugte. Sie bemerkte es und zog sie rasch zurück, als hätte sie sich verbrannt. »Oh, entschuldige. Ich wollte nicht zu persönlich sein. Ich wollte nur … also ich … ich bin da, wenn du über was reden willst und …« Sie brach ab.
Ich bin es nicht gewohnt, Nähe zu zeigen. Mein Vater war Soldat und hat mich mit zehn Jahren jeden Morgen geweckt, um in klirrender Kälte ums Haus zu laufen, und meine Mutter war kälter als die Polarnacht. Ich kann mich immer nur an ihr Gesicht erinnern, das zu sagen schien: »Konzentrier dich. Du wirst nicht der Beste, wenn du mir am Rockzipfel hängst, aber wenn du in der Schule fleißig bist. Steh für dich selber gerade und lass dich nicht von anderen aufrichten!«
Laut sagte er: »Nein, schon gut. Entschuldige. Ich … alles ist in Ordnung. Ich bin bloß etwas erschöpft, das ist alles.«
»Das ist meine Schuld, ich halte euch bloß auf und …«
»Nein«, fuhr er sie brüsk an und sie schreckte überrascht zurück. Er fürchtete bereits, sie könnte über den unebenen Waldboden stürzen, doch sie fing sich wieder und schluckte. »Du hältst uns nicht auf. Du bist ein Teil des Teams.«
»Ähm, danke«, murmelte sie kleinlaut, und er bemühte sich um eine freundliche Miene, obwohl ihn noch immer viele Sorgen umtrieben. Sie tranken Wasser aus einem fremden Fluss, ohne etwas darüber zu wissen. Es könnte kontaminiert sein oder einfach nur deshalb tödlich, weil es ein fremdes Mikrobiom beinhaltete, mit dem ihr von der Erde geprägtes Immunsystem nicht klarkam, weil alles fremd war. Sie hatten nichts zu essen, und die Luft war eindeutig radioaktiv oder sonst wie toxisch, weil sich bereits wieder erste Anzeichen von Abszessen bei ihnen allen bildeten. Außerdem wussten sie nicht, wo sie waren, hatten kaum echte Orientierungspunkte und tappten bezüglich dieser Welt im Dunkeln, ohne geistig und körperlich auf der Höhe zu sein.
»Jeder von uns ist wichtig«, erklärte er eindringlich. »Und jedem von uns kann und wird etwas passieren, und wir werden niemanden zurücklassen, klar?«
»Klar.« Sie nickte, ging jedoch nicht weiter, als er sich in Gang setzte. Also hielt auch er inne und drehte sich zu ihr um.
»Was?«
»Du wolltest das alles nicht.«
»Was meinst du?«
»Du wolltest nicht, dass wir Nasaku trauen, dass wir uns aus der Air Force Base schleichen und überhaupt den Teleporter benutzen, ohne ihn richtig erforscht zu haben. James’ Ansicht, dass es besser sei in den Apfel zu beißen, anstatt ihn jahrelang zu vermessen, war dir von Anfang an suspekt, und du hast dagegen geredet.«
»Das ist nicht wichtig.« Er winkte ab. »Wir haben entschieden und jetzt sind wir hier.«
»Doch, es ist wichtig. Dir hat es nicht gefallen, und trotzdem hast du mitgezogen und sogar aktiv daran teilgehabt, dass wir Nortons – offenbar merkwürdig gut gemeinter – Falle auf den Leim gehen und Nasaku helfen, einfach nur, weil wir ihr vertrauen, ohne dafür konkrete Anhaltspunkte zu haben«, sagte Mette und musterte ihn forschend. »Warum? Wenn es eine Anführerpersönlichkeit im Team gibt, dann ja wohl dich. Stattdessen hast du gefolgt.«
Adrian überlegte eine Weile und wägte seine Gedanken und Worte sorgfältig ab, damit sie einerseits seiner wirklichen Wahrheit entsprachen und andererseits auch möglichst ihrer getreu über seine Lippen kamen.
»Ein Anführer ist nicht immer der, der die Entscheidungen trifft. Es kann auch derjenige sein, der sie mitträgt.« Er blickte ihr in die Augen. »Oder diejenige, die dafür sorgt, dass niemand über Bord geht. Nicht die lauteste Stimme im Raum führt, sondern jede einzelne zu ihrer Zeit, wenn sie es ist, der man Gehör schenken sollte. Norton war ein guter Anführer – auf seine Art. James ist es auch, auf seine Art und in den passenden Situationen. Bei der Sache mit Nasaku habe ich kein Richtig oder Falsch gesehen, und wir mussten etwas riskieren. Ich bin Kosmonaut und niemand, der gerne ins kalte Wasser springt. Ich analysiere Probleme und handle so rational wie möglich. Das war nicht das, was in der Situation gefordert war, weil es keine Punkte gab, an denen man sie rational anfassen konnte. Also habe ich mich angeschlossen.«
»Du hast dich angeschlossen?«, fragte sie, und wieder einmal sah er in ihrem Blick deutlich mehr, als diese watschelige, rundliche Frau mit dem leichten Schweißgeruch und der wirren Haarmähne erahnen ließ. »Oder bist du nicht ausgeschert?«
Weniger wache Geister hätten gedacht, dass beides das Gleiche sei, sie jedoch hatte ihn offenbar besser verstanden als gedacht, also lächelte er bloß.
»Nur wer zu folgen weiß, weiß auch, wie er führt«, gab er bewusst nebulös zurück.
Mette lächelte nur und nahm dankend seinen Arm an, um sich abzustützen und mit ihm durch die Bäume zu der kleinen Lichtung zu humpeln, auf der das Team im Moment schlief. Nachdem sie diesen Ort gefunden hatten – durch das Blätterdach konnte man im Osten noch den riesigen Schatten der Mauer erkennen – waren sie alle an den Fluss gestürzt und hatten, ohne nachzudenken, getrunken, bis ihnen schlecht wurde und ihre Mägen rebellierten. Niemand hatte auch nur einen Gedanken daran verschwendet, dass es giftig für sie sein könnte. Natürlich nicht, wären sie sonst verdurstet. Ihre Körper hatten instinktiv die Kontrolle übernommen und dafür gesorgt, dass sie die nächsten Stunden oder gar Minuten überlebten und sich nicht mit einer Zukunft auseinandersetzten, die sie womöglich nie erreichen würden.
Jetzt schliefen sie alle, lagen zusammengerollt auf dem trockenen Moosbett zwischen großen Wurzeln, die wie natürliche Mauern aus Holz die Lichtung umgaben und für ein archaisches Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit sorgten. Meeks schnarchte laut, doch James, Mila und Justus lagen in Fötusstellung mit jeweils einer Armlänge Abstand daneben und sahen aus wie erschlagen, also schien es sie offenbar nicht so sehr gestört zu haben wie ihn selbst und Mette.
»Was denkst du, was das ist?«, fragte die Dänin flüsternd, als er ihr geholfen hatte, sich an einen der Bäume zu lehnen, und deutete hinauf in die Baumkronen, die sich über ihren Köpfen ineinander verwoben und ein komplexes Muster aus Ästen und Blättern bildeten. Die Blätter selbst waren grün wie auf der Erde, doch auf vielen von ihnen leuchteten blaue Punkte, bei denen es sich nicht um Glühwürmchen – oder ein Xeno-Äquivalent – handeln konnte, da sie sich nicht bewegten.
»Keine Ahnung«, antwortete er wahrheitsgemäß. »Eine phosphoreszierende Substanz oder ein Lebewesen, das sich nicht bewegt, was ich mir kaum vorstellen kann. Außer es handelt sich um Pilzflechten. Dann wäre der Befall allerdings massiv und das würde wiederum auf Fressfeinde schließen lassen.«
»Aber wir haben noch keinerlei Insekten oder Ähnliches gesehen.«
»Stimmt.« Er blickte hinauf und genoss den Anblick des blauen Glitzerns überall, das ihn an einen romantischen Sternenhimmel erinnerte. Hätte es nicht so fremdartig ausgesehen und er nicht daran gedacht, dass es sich abgeschnitten von der Heimat auf einem fremden Planeten befand, hätte er es sicherlich schön gefunden. »Es scheint jedenfalls nicht gefährlich zu sein.«
»Zumindest nicht direkt.«
»Ja.« Er deutete auf die anderen. »Du solltest auch etwas schlafen. Dein Fuß wird es dir danken.«
»Mein Fuß scheint mir gar nichts mehr zu danken«, brummte sie leise, nickte jedoch und rutschte an der rauen Rinde in ihrem Rücken herunter, bis sie halbwegs angelehnt halb zu sitzen und halb zu liegen schien. »Was ist mit dir?«
»Ich bleibe wach. Einer muss Augen und Ohren offen halten.«
Sie gähnte vernehmlich. »Daran haben wir eben gar nicht gedacht.«
Adrian nickte.
»Wir sind ziemlich unvorsichtig, oder?«
»Wir sind traumatisiert und desorientiert.« Er winkte ab. »Das ist zu erwarten.«
»Du aber nicht«, meinte sie müde.
»Schlaf jetzt, Mette. Es wird bald hell und du solltest zumindest noch ein oder zwei Stunden nachholen. Ich komme schon klar, glaub mir.«
Mette nickte nach kurzem Zögern und schloss dann die Augen.
2
»Fette Mette! Fette Mette! Fette Mette!«, hörte sie den Chor ihrer Mitschüler skandieren, als sie mit gesenktem Kopf und eingezogenen Schultern durch das Tor der Lyshøjskolen Grundschule ging. Den Blick hielt sie zu Boden gerichtet, in der Hoffnung, dass die Jungen und Mädchen sich schnell wieder anderen Beschäftigungen zuwenden würden, wenn sie das Interesse an ihr verloren, weil sie sich nicht wehrte. Sie wollte nur, dass es aufhörte, einfach aufhörte. Hätte sie schreien und in diesem Moment die ganze Welt ausblenden können, hätte sie es getan. Aber wenn sie ihre Angst hinausschrie, würden alle Kinder auf sie schauen und es nur noch schlimmer machen. Jeden Morgen ging sie mit diesem schweren Gewicht in ihrem Magen auf den Schulhof, mit der Angst, dass es wieder geschah.
Lass dich nicht ärgern, Mettilde, klangen die Worte ihrer Mutter in ihrem Kopf nach. Die Kinder sind bloß neidisch, weil du so ein kluges Köpfchen bist. Dann hatte sie sie auf die Stirn geküsst, wie sie es immer tat, und hektisch das Frühstück vorbereitet – gezuckerte Cornflakes mit Milch – und dann ihre Verpflegung für die Schule zusammengelegt: zwei Päckchen Orangensaft, zwei Schokoriegel und einen Apfel, bevor sie auf ihre Armbanduhr geschaut und einen Fluch unterdrückt hatte, weil sie wieder zu spät zur Arbeit kam.
»Mami, kann ich dich was fragen?«, hatte Mette gefragt.
»Später, Mettilde. Ich muss jetzt ganz schnell zur Arbeit, sonst feuert Said mich noch, weil ich schon das dritte Mal zu spät bin diese Woche. Heute Mittag gehst du zu Tante Friga, nicht vergessen.«
Natürlich. Ihre Mutter hatte einen zweiten Job angenommen, als Putzfrau im örtlichen Gymnasium. Mette malte sich bereits aus, wie sie später dort landen würde und man sie auslachte: Mettes Mami putzt das Klo!
»Ist gut.« Sie mochte Tante Friga nicht. Wann immer Mette bei ihr war, redete sie nur darüber, wie schlecht ihr Papa sei und dass er ihre Schwester mit der gemeinsamen Tochter allein gelassen habe. Dann weinte sie und kochte das Mittagessen, und jedes Mal fielen die Tränen in das Essen, was Mette als äußerst abstoßend empfand.
»Mettilde, warum weinst du denn?«
Sie sah auf. Ihre Mutter stand in der Tür zur Küche, die zu dem beengten holzvertäfelten Flur führte, in dem Mettes großer Ranzen stand, auf dem sich die vielen dunklen Flecken befanden, wo ihre Mitschüler sie angespuckt hatten, wenn sie glaubten, dass sie es nicht bemerken würde.
»Ich will nicht in die Schule gehen, Mami!«
»Oh, Mettilde!« Mit mitfühlendem Blick kam ihre Mutter zu ihr und schloss sie in die Arme. Wenn dieser Moment, in dem sie sich geschützt und geborgen fühlte, doch ewig dauern könnte, weit weg von all den bösen Mädchen und Jungen, die sich einen Spaß daraus machten, sie zu quälen. »Was ist denn los mit dir?«
»Die anderen Kinder hassen mich!«
»Nein, die hassen dich doch nicht. Sch!«
Mette schluchzte.
»Sie sind bloß neidisch, weil du zwei Klassen übersprungen hast. Ignorier ihr Gerede einfach, hörst du? Eines Tages wirst du erkennen, dass das alles unwichtig ist und sie diejenigen sind, die dein Haus putzen und dein Auto waschen, während du einen schönen Job als Professorin an der Universität in Kopenhagen antrittst, jawohl.«
Mette wusste nicht, was eines Tages bedeuten sollte und wie es unwichtig sein konnte, dass sie jeden Morgen in die Hölle gehen musste, aber sie verstand eines: Ihre Mutter weinte nachts, genau wie sie selbst, und bemühte sich tagsüber, ein freundliches Gesicht zu machen und Mette nichts davon merken zu lassen.
»Hey, Fettbacke!« Ihre Erinnerungen an den heutigen Morgen zerplatzten wie eine Seifenblase. Vor ihr stand Helga aus der dritten Klasse, umringt von ihren Freundinnen, die sie gehässig anstarrten und sich gemeine Witze zutuschelten.
»Hallo«, murmelte sie kleinlaut. Nicht auffallen. Ich muss sie ignorieren.
»Dein Ranzen ist aber riesig!«, staunte Helga und deutete auf den kastenförmigen Rucksack auf ihrem Rücken, ehe sie zu den anderen Mädchen blickte und alle zu lachen begannen. »Was ist da drin? Ganz bestimmt Süßigkeiten, oder? Du kannst ja nicht aufhören zu essen.«
»Bloß Sachen für den Unterricht.«
»Na klar! Seht mal, was Mette schon alles kann«, äffte die Drittklässlerin ihren Mathelehrer nach. »Bravo, Mette, gut gemacht.«
Die sind neidisch, dachte sie, ohne es wirklich zu glauben. So wie Mami es gesagt hat. Wenn ihre Mutter das sagte, stimmte es ja vielleicht, immerhin war sie erwachsen und Mette nicht.
Sie wusste, wie sich das anfühlte, denn sie war selbst häufig neidisch. Neidisch auf die Viertklässler, die schon so groß und kräftig waren und sich von Drittklässlern nichts gefallen lassen mussten. Neidisch auf die Kinder, die gut im Sport waren und nicht so unförmige Beine hatten wie sie, die nicht sofort außer Atem waren oder gehänselt wurden, weil sie angeblich stanken. Sie war neidisch auf die Mädchen mit kurzen Haaren, die nicht ständig an ihren Locken gezogen wurden, wenn sie durch den Flur gingen. Neidisch auf die, die Freunde hatten und nicht alleine im Bus sitzen mussten. Neidisch auf diejenigen, die sich nicht fühlten, als seien sie ganz allein, obwohl sie ständig von anderen umgeben waren.
»Ich kann euch ja helfen«, sagte sie schließlich, als sie Mitgefühl mit den Mädchen vor sich verspürte. Sie waren neidisch darauf, dass Mette klüger war als sie und zwei Klassen übersprungen hatte. Sie waren neidisch auf ihre guten Noten. Vielleicht bekamen sie sogar Ärger mit ihren Eltern, weil sie nicht gut genug waren. Das musste bestimmt schrecklich sein.
»Helfen?«, fragte Helga und wirkte für einen Moment überrascht. Ihre Augen wurden groß und ihr war anzusehen, dass sie damit nicht gerechnet hatte. Auch ihre Freundinnen warfen sich irritierte Blicke zu.
»Ja. Ich kann euch bei den Hausaufgaben helfen, damit ihr bessere Noten habt.«
»Das ist echt eine tolle Idee, Mette!«, zeigte sich ihr Gegenüber begeistert und drehte sich zu den anderen, die kurz darauf ebenfalls nickten und in die Hände klatschten. Zwei von ihnen kamen um Mette herumgelaufen und rissen so fest an ihrem Ranzen, dass sie nach hinten purzelte und heftig auf den Po stürzte. Ein dumpfer Schmerz breitete sich in ihren Beinen aus. Die obere Verschlusslasche des Ranzens riss, und der Inhalt wurde weit über den vom Herbstregen nassen Schulhof verteilt. Helga zeigte auf die beiden Schokoriegel.
»Ha! Süßes für die fette Mette!«
Noch eh sie begriffen hatte, was geschah, hatten sie sie ihr weggenommen. Die Notizbücher und Stifte ließen sie liegen.
»Was ist denn?«, stichelte Helga mit gespielt freundlichem Ton. »Warum schwitzt du denn wieder so? Hast du Angst, dass du zu wenig Süßes fressen kannst?«
Die anderen Mädchen lachten. Mette fing an zu weinen.
»Macht man das in der ersten Klasse so? Guckt mal, jetzt heult sie wie ein Baby. Wie ein Erste-Klasse-Baby, da gehört sie nämlich auch hin!«
»Ich dachte, sie ist zu schlau zum Heulen?«, fragte eins der anderen Mädchen, während Mette begann, auf dem Boden herumzukrabbeln und ihre Bücher und Blätter zusammenzusammeln, die sich bereits mit dem schmutzigen Regenwasser auf dem geteerten Schulhof vollsaugten und die Tinte verlaufen ließen. Wie sollte sie denn jetzt bloß ihre Hausaufgaben vorzeigen? Wenn sie schlechte Noten bekam, würde ihre Mutter noch trauriger sein, als sie es ohnehin schon ständig war. Sie freute sich immer so sehr, wenn Mette gute Zensuren mit nach Hause brachte, dass diese Momente zu den schönsten gehörten – und davon gab es nicht besonders viele, seit sie aus Holstebro hergezogen waren.
»Wenn sie so krabbelt, sieht sie aus wie ein Schwein!«, befand Alma, eine selbst für Drittklässler großgewachsene Blondine aus Helgas Klasse.
Die anderen lachten gackernd.
»Sie ist so fett – glaubt ihr, dass sie im Regen noch dicker wird, wie ein Schwamm?«
»Vielleicht läuft die ganze Schokolade aus ihr raus.«
»Sie kann euch nicht hören, sie kann ja nur grunzen wie ein Schwein.«
Die Schulklingel dröhnte über den Pausenhof und rief zum Beginn der ersten Stunde.
»Bis später, fette Mette!«, rief Helge glucksend und dann liefen sie und die anderen Drittklässlerinnen in das zweistöckige Gebäude aus gelb angemalten Holzlatten, während Mette mit Tränen in den Augen damit beschäftigt war, alles in ihren Ranzen zurückzustopfen. Die Hälfte der Schulsachen war vollkommen durchnässt und die andere Hälfte so verwaschen, dass sich kaum noch etwas erkennen ließ.
»Bist du wach?« Mette schreckte aus ihrem Traum auf, der sich aus schmerzhaften Erinnerungen an gleich mehrere Erlebnisse zusammengesetzt hatte und sie mit einem vertrauten Gefühl der Traurigkeit zurückließen, als sie blinzelnd die Augen öffnete. Vor ihr hockte James, großgewachsen und sehnig mit diesem attraktiven Gesicht eines modernen New Yorker Intellektuellen, der ebenso aus ihrer Umgebung gefallen zu sein schien, wie sie selbst.
»Äh, jetzt ja«, erwiderte sie schlaftrunken und rieb sich die Augen. Ihr Rücken war eine einzige Verspannung, und die Rinde des Baumes, an den sie sich gelehnt hatte, musste ihr gezacktes Muster tief in ihre Haut gedrückt haben, so wie sie sich fühlte.
»Oh, tut mir leid. Ich dachte, dass du …«
»Schon gut.« Sie winkte ab. Es war bereits hell – zumindest, wenn man das schmutzige Zwielicht als hell bezeichnen konnte, das durch die Blätter fiel. Die blau leuchtenden Pünktchen waren kaum noch zu erkennen. »Ist alles in Ordnung?«
»Ja.« Er nickte. »Ich bin auf einen der Bäume geklettert und habe gesehen, dass in Richtung Westen Feuer gebrannt haben.«
»Feuer? Meinst du so wie Waldbrände?«
»Nein, eher Lagerfeuer, schwer zu sagen. Wir haben uns gedacht, dass wir dorthin gehen. Vielleicht lebt dort jemand.«
»Falls dort wirklich jemand lebt«, wandte sie ein. »Wäre es dann klug, einfach dorthin zu gehen? Selbst wenn hier wirklich andere Menschen leben – die können oft genug ziemlich grausam sein.«
»Ja, da hast du wohl recht.« James nickte erneut und seufzte bedrückt. »Aber wir brauchen was zu essen und wissen nichts über diesen Ort. Ich glaube nicht, dass …«
»Was?«, hakte sie nach, als er keine Anstalten machte, seinen Satz zu beenden.
»Ah.« Er winkte ab. »Schon gut. Ich wollte dich fragen, was du davon hältst.«
Sie wollten sie nicht vor vollendete Tatsachen stellen, was sie freute. Mit einem Blick über seine Schultern konnte sie sehen, dass die anderen nicht mehr schliefen. Meeks und Mila waren fort, und Adrian und Justus hockten über einige Äste und Schlingpflanzen gebeugt in der Mitte der Lichtung.
»Was glaubst du nicht, James?«, hakte sie nach. »Ich glaube nicht, dass wir hier an einem Ort sind, an dem wir uns verhätscheln und die Wahrheit vorfiltern können, um auf Gefühle zu achten.«
»Du hast recht«, gab er sich einsichtig und verzog entschuldigend das Gesicht. »Wir werden nicht lange überleben, fürchte ich. Wo auch immer wir hingehen: Es wird weit sein. Und ohne Essen werden wir Probleme bekommen.«
Er ist wirklich clever, dachte sie anerkennend. Jetzt hat er das Gespräch so geführt, als hätte ich mir im Moment selbst eingestanden, dass klare Worte nötig sind, um hier zu überleben. Was auch immer er ab diesem Augenblick vorschlägt oder sagt, kann ich damit nicht mehr als zu krass oder gefährlich abstempeln, weil es ja meine eigene Idee war. Obwohl es seine gewesen ist.
»Wo sind die anderen?«
»Mila und Meeks wollten sich am Fluss waschen, und Justus und Adrian bauen dir eine neue Krücke.«
Mette lächelte dankbar. »Sie sind zu gut zu mir. Ich denke, dass ich euch …«
»Nein«, unterbrach er sie. »Ich will nichts hören über deinen Fuß, dass du uns langsamer machst oder darüber, dass wir dich zurücklassen sollen.«
»Das wollte ich auch nicht vorschlagen«, log sie.
»Dann ist ja gut. Komm, wir schauen mal, was dabei herauskommt, wenn ein ehemaliger Kampfflieger und Ingenieur für Supraleitertechnik und ein Astrophysiker und Quantenforscher versuchen, ohne Werkzeug eine Krücke zu basteln«, schlug James vor und half ihr auf die Beine. Sein Atem roch genauso unangenehm säuerlich, wie ihr eigener vermutlich auch. Nicht nur, dass sie sich hier nicht die Zähne putzen konnten – auch die fehlende Nahrung sorgte dafür, dass ihr Körper Aceton über die Mundschleimhaut – ähnlich wie beim Fasten – ausschied. Bei ihr war es vermutlich am schlimmsten, da der Körper bei fehlender Nahrungszufuhr auf die eigenen Energievorräte in Form von Körperfett zurückgriff und die frei werdenden Fettsäuren in Aceton umwandelte, das einfachste Keton der Carbonylgruppe. Es roch in etwa nach faulendem Obst.
»Alles in Ordnung?«, wollte James wissen, nachdem sie sich auf seinen Arm gestützt hatte.
»Nur die Gedanken einer dicken alten Chemikerin, die sich in etwa so fehl am Platz fühlt wie ein Eisbär in der Wüste.«
»Glaub mir, hier sind wir alle Eisbären.«
Mette musterte ihn aus den Augenwinkeln und musste lächeln. Dieser eine Satz war für sie wie eine kleine Offenbarung, ein heller Silberstreif in ihrem Geist, und für ihn nur eine bloße Bemerkung, die er in ein paar Minuten vergessen haben würde. Ob sie möglicherweise doch an genau dem richtigen Ort war? So oder so sollte sie diesen Gedanken besser für sich behalten, würden die anderen ihn doch sicher nicht verstehen, oder zu Recht ganz und gar absurd finden.
Wie sich herausstellte, war die neue Krücke deutlich angenehmer als ihr improvisierter Gehstock, denn sie besaß nach oben hin eine gekrümmte Schleife aus einem gebogenen feuchten Ast, der entlang des eigentlichen Stocks mit gezwirbelten Schlingpflanzenfasern zusammengehalten wurde und annähernd angenehm in ihrer Achselhöhle auflag. Sie dankte den beiden immer wieder, und sie schienen sich zu freuen.
Als Mila und Meeks zurückkamen, setzten sie sich schließlich in Bewegung und entschieden sich dazu, dem Flusslauf zu folgen, der ohnehin in Richtung der Überreste jener Stadt führte, die sie von der Mauer aus hatten sehen können. Natürlich mochte es sich doch noch um etwas komplett Anderes handeln, das sie im spärlichen Mondlicht der vergangenen Nacht falsch interpretiert hatten, aber bis dahin wollte sie an dem Gedanken festhalten, dass sie eine Nacht mit einem Dach über dem Kopf schlafen oder gar Menschen treffen würden.
»Was machen wir eigentlich, wenn wir wirklich auf andere treffen?«, fragte sie schließlich, nachdem sie eine Weile schweigend über Stock und Stein gegangen waren. Sie empfand die Stille als bedrückend, obwohl sie immer häufiger von Vogelgezwitscher unterbrochen wurde, je weiter sie sich von der Mauer entfernten. »Wir können ja nicht einfach ›Hallo‹sagen.«
»Wieso eigentlich nicht?«, fragte Justus, der gerade an der Reihe war, sie abzustützen. Selbst mit der Krücke konnte sie kaum alleine gehen, da sie sonst zu viel Druck auf ihr geschientes Sprunggelenk ausübte, das bei jedem Schritt heftig schmerzte.
»Weil wir ihre Sprache nicht sprechen würden.«
»Wenn es wirklich so ist, dass es sich um Menschen handelt, dann können wir uns schon mit Händen und Füßen verständigen. Wir teilen immerhin unsere Mimik und Gestik.«
»Vor ein paar Jahren hatten doch ein paar Naturvölker auf den Andamanen das erste Mal Kontakt mit Fremden aus der zivilisierten Welt«, meinte Meeks. »Die wurden von den Kerlen mit Pfeil und Bogen abgeschossen, weil man sie für Dämonen gehalten hat.«
»Ich habe davon gehört.« Mette nickte und versuchte, den Schweiß zu ignorieren, der ihr über das Gesicht lief und in ihren Augen und den kleinen Fissuren in ihren Lippen brannte. »Genau so etwas macht mir Sorgen. Ein paar in Lumpen gehüllte Fremde, die ihre Sprache nicht sprechen, könnten für die unterschiedlichsten Reaktionen sorgen.«
»Als die ersten Siedler in Nordamerika anlandeten, haben die Indianer auf Rhode Island sie sehr freundlich empfangen und sie sogar durch den ersten Winter gebracht, den die Europäer nicht überlebt hätten«, sagte James, der direkt hinter Adrian ging, der ihnen den einfachsten Weg an den größten Wurzeln und unwegsamsten Moosbetten vorbei suchte. »Auch die Ureinwohner Südamerikas haben die Portugiesen und Spanier sehr freundlich empfangen mit Gastfreundschaft und Geschenken.«
»Und heute gibt es größtenteils nur noch Nachfahren der Europäer dort«, brummte Justus.
»Ja, und wir können dafür sorgen, dass es hier nicht auch so kommt.« James hielt inne und schnaubte. »Vielleicht kein gutes Beispiel.«
»Wenn wir auf jemanden treffen, haben wir ja dich«, bemerkte Mette freundlich und hoffte, dass er es als das Kompliment auffasste, das sie gemeint hatte und nicht als zynischen Seitenhieb auf seine dunklere Seite als Betrüger, von der Norton ihnen berichtet hatte.
»Falls wir das tun, hoffen wir, dass es wirklich Menschen sind. Dann brauchen wir für einen friedlichen Erstkontakt nicht einmal eine gemeinsame Sprache. Körpersprache und Tonalität machen nicht nur in Verhandlungen achtzig Prozent der Musik, sondern in so ziemlich jeder menschlichen Interaktion.«
Die nächsten Stunden gingen sie wieder schweigend am Fluss entlang, der etwa zwei Dutzend Meter breit an ihnen vorbeifloss, das Wasser braun und schlammig wie körniger Kaffee. Die Erschöpfung setzte ihnen spürbar zu und sorgte für eine Art Trance in ihrer Gruppe, die nur daraus bestand, mechanisch einen Fuß vor den anderen zu setzen. Bald schon klangen der Gesang und das Gezänk der Vögel wie ein Spottlied, das sie Meter um Meter begleitete, und in diesem eintönigen Trott aus Erschöpfung, Hitze und dem unguten Gefühl zu träumen, konnte man beinahe vergessen, wo man sich befand. Mette glaubte sich bald auf einem äußerst kräftezehrenden Waldspaziergang in ihrer Heimat, der einfach nicht enden wollte. Die Bäume und das Unterholz mit den vielen Farnen und Schlingpflanzen und feuchten Büschen sah zwar eher aus wie ein tropischer – oder zumindest subtropischer – Urwald, doch alles inklusive der Vögel war vertraut genug, um zu vergessen, dass sie möglicherweise Dutzende oder Hunderte von Lichtjahren von der Erde und allem, was sie kannten, entfernt waren.
Nein, nicht allem, was wir kennen, ermahnte sie sich. Wir kennen auch das hier alles. Da fließt Wasser, meine Füße gehen auf Moos, es riecht typisch nach Wald und die Vögel klingen wie daheim.
Adrian brauchte sie schließlich nicht überreden, als er irgendwann eine Pause vorschlug. Sie setzten sich an eine kurze grasbewachsene Böschung, wo der Fluss einen größeren Bogen machte, und fielen erschöpft in sich zusammen. Der Acetongeruch vereinigte sich zwischen ihnen zu einer beißenden Wolke, doch sie brachte nicht einmal genügend Kraft zusammen, um sich davor zu ekeln.
Adrian schöpfte mit den leeren Injektordosen Wasser aus dem Fluss und gab jedem von ihnen eins in die Hand. Mette nickte ihm zu und murmelte einen knappen Dank. Es schmeckte erdig und trotzdem schüttete sie es sich gierig in den Mund und nahm dankend an, als der Kosmonaut ihr nachschenkte.
»Habt ihr das gehört?«, fragte Mila irgendwann, als Mette gerade auf dem Rücken lag und mit geschlossenen Augen versuchte, das Brennen in ihren Gliedern zu ignorieren, um durchatmen zu können.
»Was denn gehört?«, brummelte Meeks erschöpft.
»Ich habe etwas Knacken gehört!«
»Wahrscheinlich bloß ein Vogel oder ein Kleintier.«
»Was, wenn nicht?«, beharrte sie.
»Ich gehe mal nachsehen«, seufzte James und klang, als würde er sich ächzend aufrappeln. Mette schaffte es nicht, ihre Augen zu öffnen, um nachzusehen.
»Und ich komme mit«, entschied Mila. Sie klang wirklich besorgt.
3
Milas Augen wollten sich nicht öffnen, als wären sie mit zähem Harz verschmiert. Es kostete sie unendlich viel Kraft, die Lider auch nur zu den leichtesten Zuckungen zu bewegen. Von irgendwoher drängte sich ihr ein unangenehm gleichförmiges Piepen auf, das an Intensität zuzunehmen schien, obwohl sie gleichzeitig wusste, dass es sich nicht veränderte. Ihre Kehle fühlte sich an wie mit Sandpapier zerkratzt, und jedes Schlucken wurde zur Pein.
»Sie ist wach!«, rief jemand. Die Stimme klang sehr aufgeregt. Warum klang sie so aufgeregt?
»Puls stabilisiert sich«, antwortete jemand anders. Diesmal war es ein Mann. In dem Meer aus sich überlagernden Feldern aus helleren und dunkleren Flecken, die sie sah, verschob sich etwas. Da war auch ein nicht lokalisierbarer Schmerz, der ihre Nervenbahnen durchflutete wie eine blasse Erinnerung unter einer dicken Schicht des Vergessens.
»Gospozha Schaparowa, können Sie mich hören?