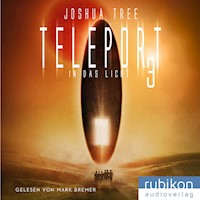4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im venezolanischen Maracaibo-See kommt es bei einer Ölbohrung zur Katastrophe. Der Auslöser: ein außerirdisches Artefakt, das in der Dunkelheit unter der Erde verborgen lage einer streng geheimen Einrichtung des US-Militärs soll ein internationales Forscherteam herausfinden, was es mit dem mysteriösen Objekt auf sich hat, das jegliche Technologie in seiner Nähe mit einem instabilen Magnetfeld zerstört. In seinem Inneren befindet sich ein Raum, der wie für Menschen gemacht zu sein scheint. Nach einem schockierenden Todesfall sind sich die zusammengewürfelten Wissenschaftler aus den USA, Europa und Russland sicher, dass es sich um ein Teleportmedium handelt. Doch schon bald sehen sie sich einer grundlegenden Frage gegenüber: Warum fallen diejenigen ins Koma, die sich hinein begeben? Reisen sie überhaupt an einen anderen Ort oder ist alles nur eine Illusion? Ob Traum oder Wirklichkeit, die andere Seite des Teleporters stellt sich als eine Hölle heraus, die nicht bloß das Team, sondern das gesamte Projekt vor eine Zerreißprobe stellt - denn dort draußen sind sie nicht allein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
TELEPORT
JOSHUA TREE
INHALT
Teleport
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Nachwort
TELEPORT
Joshua Tree
PROLOG
Das Bohrschiff sah aus wie eine graue, von Salz zerfressene Müllhalde, zweihundertfünfundfünfzig Meter lang und zweiundvierzig Meter breit. Ein hässlicher Koloss, geformt aus Stahl, Schmutz und den monetären Träumen reicher Manager von einem anderen Kontinent, die mit der dreckigen Arbeit nichts zu tun haben wollten, mit der sie so viel Geld verdienten. Es besaß so viele Aufbauten, die wie ein dichter Wald aus seinem Rumpf ragten, dass einem die Augen schwirren konnten, doch all das wurde dominiert vom eigentlichen Bohraufsatz. Ein einhundert Meter langer Turm aus spindeldürren Verstrebungen, dessen Spitze aus zwei gelb gestrichenen Fingern bestand, in dem sich jede Menge Messfühler und die armdicken Bolzen der Zugsicherung befanden.
Die Deep Sea Explorer, wie sie reichlich euphemistisch genannt wurde, schleppte sich gemächlich und mit einer Begleitflotte aus kleineren Kähnen und Versorgungsschiffen durch die Mündung des Maracaibo-Sees, vorbei an der namensgebenden Stadt, deren Häuser das linke Ufer überwucherten wie fleckige Pilze.
Von seiner Position auf dem Heck des Hauptschiffs, das die kleine Flotte anführte, empfand Anders Larsson die Fahrt durch die Meerenge wie eine Vergewaltigung der natürlichen Schönheit dieses Ortes. Das Wasser hatte eine bläuliche Farbe mit leichtem Grünstich und hob sich von der langen Major-Rafael-Urdaneta-Brücke ab, die im Hintergrund als ein Silberstreif die beiden Ufer miteinander verband und erst vor wenigen Stunden unter großem Tamtam aufgeklappt war. Die Bewohner von Maracaibo waren zu Tausenden gekommen, um dem Spektakel beizuwohnen. Nicht etwa, weil die gemächliche Prozession besonders ansehnlich gewesen wäre – nein, es waren die Träume des Volks, die das mit der Schönheit übernahmen, ihre Fantasie. Die Deep Sea Explorer bedeutete Wohlstand für die ganze Region. Zumindest war es das, was die venezolanische Regierung monatelang zu versichern versucht hatte. Doch deswegen war Anders nicht hier. Er war gekommen, um die Bohrbemühungen zu überwachen und für die Einhaltung der Zeitpläne zu sorgen und nicht, um sich mit den politischen Lügen zu befassen, die für die Beauftragung seines Arbeitgebers gesorgt hatten. Eigentlich handelte es sich dabei gar nicht um seinen Arbeitgeber, sondern ein Kunstunternehmen, einen diplomatischen Frankenstein. Vor einem Jahr hatten Prospektoren von Shell ein neues Ölreservoir unter dem See entdeckt, der ohnehin schon eine reichhaltige Quelle für das Schwarze Gold war, doch die ersten Proben hatten Ingenieure der russischen Baschneft genommen. Ohne Zweifel hatte es an den engen Verbindungen zwischen russischer und venezolanischer Regierung gelegen, dass es zu diesem Vorfall kam, wie die EU-Kommissionspräsidentin es genannt hatte, aber schließlich war es zu einer Einigung gekommen, mit der alle Seiten unglücklich, aber gierig, leben konnten: Es wurde eine europäisch-russische Firma gegründet, um die neue Quelle auszubeuten. Dass die Datenlage kaum eindeutig genug war, um sich im Vorfeld so zu streiten, hatte offenbar niemanden interessiert. Anders aber wusste, dass der gewaltige Hohlraum unter dem Meeresboden – denn der See war eigentlich gar kein See, sondern eine Einmündung des Golfs von Venezuela – zu einem geringen Prozentsatz auch eine Blase aus verdichtetem Methangas sein könnte. Keine schöne Vorstellung.
»Warum machen Sie so ein Gesicht?«, fragte Alexei Jewtschenkow, der russische Chefingenieur, der neben ihm mit den Ellenbogen auf der Reling lehnte und ebenfalls den hässlichen Haufen Schiffe musterte, die vom Schmutz ihrer Arbeit gezeichnet waren. Er zündete sich eine Zigarette an und inhalierte zischend.
»Rauchen ist eine schlechte Angewohnheit, aber für jemanden, der im Erdölsektor arbeitet, ziemlich selbstmörderisch.«
»Ah.« Jewtschenkow winkte ab. »Noch sehe ich kein Öl, und ich habe Grund zum Feiern.«
»So?« Anders zog eine Braue hoch.
»Es ist warm!« Der Russe steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen und breitete die Arme aus. »Tropische Temperaturen, frische Seeluft, ein neues Projekt mit guter Bezahlung! Was will man mehr?«
»Wenn wir gefunden haben, was wir zu finden glauben.«
»Seien Sie nicht so schwarzmalerisch. Meine Landsleute haben die schwarze Brühe gefunden, also ist sie auch da.«
»Der gesamte Seeboden ist voller Öl, aber ein Reservoir wie das, was wir gefunden haben, klingt fast zu gut, wenn Sie mich fragen«, entgegnete Anders mürrisch.
»Denken Sie ein bisschen positiv. Die Flotte ist da, morgen Nacht können wir mit der ersten Bohrung anfangen.« Jewtschenkows rollender Akzent passte irgendwie zu dem derben Erscheinungsbild der Schiffe, die sie gemächlich verfolgten. »Dann stehen wir hier und sehen zu, wie unsere Verträge zu Gold gemacht werden.«
»Nein, wir werden nicht hier stehen.« Anders schüttelte den Kopf.
»Ich weiß nicht, was Sie tun werden, aber ich muss erst übermorgen …«
»Haben Sie irgendetwas über diesen Ort gelesen, bevor Sie in den Flieger gestiegen sind?«, unterbrach er seinen russischen Kollegen.
»Ja. Die Wetterdaten und wie hoch die Anden sind, die den See einrahmen.«
Anders verkniff sich ein frustriertes Seufzen.
»Ach, kommen Sie!« Jewtschenko rollte mit den Augen. »Also gut. Warum also werden wir hier nicht stehen?«
»Weil das hier der Ort mit den meisten Blitzen pro Quadratkilometer der Welt ist. So gut wie jede Nacht gibt es heftige Gewitter. Der See ist dreißig Grad warm, die hohen Ausläufer der Anden, die Ihnen so gut gefallen, halten die tagsüber verdunstende Flüssigkeit in dem geologischen Becken fest und nachts kühlen die Hänge der Berge deshalb deutlich schneller ab als die warme Luft über dem See. Jetzt, im Hochsommer, wurden schon bis zu einhundert Blitze pro Quadratkilometer registriert – pro Nacht. Fünf Ölfördereinrichtungen geraten jedes Jahr in Brand oder werden zerstört. Am Ufer kommt es wöchentlich zu Todesfällen und ganze Herden von Nutztieren werden von den Entladungen getötet.« Anders nickte, als er bemerkte, dass sein Kollege blasser wurde. »Ihr hohes Gehalt, über das Sie sich so freuen, hat also den sprichwörtlichen Haken.«
Den Rest der Fahrt schwiegen sie, bis sie nach zehn Stunden an ihrem Ziel angelangten. In der Zwischenzeit hatte Anders bereits in der kleinen Messe gegessen, letzte Checks und Berichte seiner Mitarbeiter überprüft und den Plan für die Initialbohrung abgesegnet. Das Binnenmeer war an seiner tiefsten Stelle nur fünfunddreißig Meter tief, was für ein Bohrschiff wie die Deep Sea Explorer, die bis zu vierzehntausend Meter tief bohren konnte, ein Witz war. Trotzdem war dies nicht sein bisher leichtestes Projekt. Das vermutlich nachgewiesene Erdöl-Reservoir befand sich in über neuntausend Metern Tiefe, und der Boden war durchsetzt von winzigen Wasseradern, die mit Meerwasser gefüllt waren – perfekten Leitern für die elektrischen Entladungen, die den See jede Nacht zum Kochen brachten. Hinzu kam, dass die Gefahr bestand, keinen direkten Kanal bohren zu können, sondern immer wieder gegen Brüche im Sediment ankämpfen zu müssen. Abgesehen davon sah er vor seinem geistigen Auge schon eine ähnliche Katastrophe wie die von BP im Golf von Mexiko heraufziehen, nachdem die ersten Blitzkaskaden eine falsch abgedichtete Leitung in Brand gesetzt hatten.
Los ging alles um 23 Uhr Ortszeit auf der Brücke der Dolphin, dem einzigen annähernd gemütlichen Schiff ihrer Ausbeuterflotte, auf dem das Management – und damit er und Jewtschenko als Projektleiter untergebracht waren. Gemeinsam standen sie auf der Brücke und beobachteten die Deep Sea Explorer, ein Konglomerat aus Lichtern in der Dunkelheit, umgeben von den Begleitschiffen, die wie kleinere Auswüchse in der Nähe ihre Position hielten. Aus einem Kilometer Entfernung sah der Koloss in ihrer Mitte beinahe aus wie ein Standbild, hätten die vielen Reflexionen auf der gekräuselten Oberfläche des Sees sich nicht unruhig hin und her bewegt.
»Que trae desgracia«, sagte einer der venezolanischen Ingenieure in der Nähe des Captains, der desinteressiert einen Kaffee schlürfte.
»Was sagt er?«, wollte Anders wissen.
»Irgendwas von Unglück«, antwortete Jewtschenko achselzuckend. »Aber keine Sorge, die sind hier alle abergläubisch.«
»Wegen der Blitze, nehme ich an.«
»Ja. Habe einen Reiseführer gelesen. Die Einheimischen halten den Mittelpunkt des Sees für verflucht – unter anderem auch wegen der Blitze. Angeblich sind hier viele Fischer verschwunden.«
»Verschwunden?«
»Gesunken, keine Ahnung.« Der Russe zuckte erneut mit den Schultern.
»Na dann.« Anders nahm sein Funkgerät vor den Mund. »Also gut, fangt an. Ständige Druckkontrolle, und ich will, dass die Ventile nicht über neunzig Prozent belastet werden. Klar?«
Er erhielt eine Bestätigung seines Cheftechnikers an Bord des Bohrschiffs und brummte zufrieden. Rote Lichter begannen über dem Bohrturm zu rotieren, ein sicheres Zeichen dafür, dass das Projekt also endlich begonnen hatte.
Das wenig überraschend angesagte Gewitter zog eine halbe Stunde später herauf und kündigte sich mit tiefem Donnergrollen an, das von der Mündung des Binnenmeers heranrollte. Eine halbe Stunde später – Anders war noch als einer der wenigen wach und verfolgte die Vorgänge auf der Deep Sea Explorer mit Fernstecher und Funkgerät – hatte es sie erreicht und hüllte die gesamte Flotte mit dichtem Regen, markerschütterndem Donner und so vielen Blitzen ein, dass er immer wieder blinzeln musste, um die gleißenden Nachbilder loszuwerden. Zeitweise war der komplette Horizont erleuchtet und er glaubte, Dutzende Entladungen gleichzeitig zu sehen, die sich wie gezackte Sehstörungen zwischen den erdrückenden schwarzen Wolkenmassen und der aufgepeitschten See bildeten.
Es war ein unheimlicher Anblick, der ihm die Nackenhaare zu Berge stehen ließ. Nur ein Gewitter, erinnerte er sich und mahnte sich zur Ruhe, doch die nächsten Blitze schlugen unmittelbar neben dem Bohrschiff ein und sorgten dafür, dass weiße Gischt an mehreren Stellen gleichzeitig aufspritzte. In ihrem Licht sahen die Schiffe bizarr aus, wie albtraumhafte Schemen aus kantigem Metall und mit scharfen Klingen. Hatten ihm diese Einschläge einen Schrecken eingejagt, wurde es kurz darauf noch schlimmer. Sekunde um Sekunde krachten die gewaltigen elektrischen Impulse ins Wasser und schienen sich immer konzentrischer auf die Deep Sea Explorer zuzubewegen. Anders konnte Unregelmäßigkeiten auf den tanzenden Wellen ausmachen und zuckte erschrocken von seinem Fernstecher zurück, als er realisierte, dass es sich dabei um tote Fische handelte.
Über sein Funkgerät fing er die ersten panischen Funksprüche von Sicherheitstechnikern auf dem Bohrschiff ab, deren anfänglich besorgte Rückfragen nun umgeschlagen waren. Irgendjemand wurde auf die Krankenstation gebracht – es war schwer herauszuhören, da so viele Mitarbeiter durcheinander riefen, teilweise in unterschiedlichen Sprachen.
»Meyer! Kommen!«, brüllte er aufgebracht auf dem Kanal seines Sicherheitsingenieurs.
»Larsson? Hier ist die Hölle los! Wir haben zwei Einschläge, die zwar keinen strukturellen Schaden angerichtet haben, aber mehrere Arbeiter haben Verbrennungen davongetragen, und die Venezolaner flippen total aus. Die wollen evakuieren!«, antwortete sein deutscher Mitarbeiter mit vom Funk zerkratzter Stimme.
»Sind die verrückt geworden? Drohen Sie mit fristloser Kündigung – ist mir egal! Das sind nur Blitze!«
»Das versuche ich ja, aber …«
»Meyer? Was ist los?«
»Ähm, wir haben hier etwas Komisches auf den Bodensensoren. Da baut sich eine Menge Energie auf.«
»In welcher Form?«
»Strom.«
»Da unten?«
»Ja, außerdem gibt es irgendeine magnetische Anomalie, die der Bohrkopf registriert hat. Er zieht beinahe fünf Grad nach links.«
»Unmöglich!«
»Larsson, ich sage Ihnen, das steht hier …« Die Verbindung brach ab, und als Anders immer wieder den Senden-Knopf drückte und in das Mikrofon brüllte, ohne eine Antwort zu bekommen, sah er auf und durch die Brückenfenster. Zuerst war da nur dieses unterschwellige Gefühl, dass etwas passierte, ohne dass er eine Veränderung gesehen hätte. Doch dann begannen die vielen Lichter auf der Deep Sea Explorer zu wackeln und zu tanzen. Der Koloss aus Stahl vibrierte, als stünde er auf einer Rüttelplatte, und dann plötzlich geschah etwas, das er zwar mit den Augen wahrnahm, sein Gehirn aber nicht begreifen konnte. Das Schiff wurde zusammengequetscht wie eine Cola-Dose, die Hülle schlug Falten und bekam Risse, wurde auf die Größe eines Lkw zusammengeballt, umtost von den auf sie einstürmenden Fluten des Binnenmeers. Die Begleitflotte geriet ebenfalls in Bewegung, wurde mehrere Meter nach unten und in Richtung ihres zerstörten Mittelpunkts gezogen, als würden unsichtbare Hände aus der Tiefe an ihnen zerren.
»Was passiert da?«, rief Larsson, ohne eine Antwort zu erwarten. Die gesamte Brückencrew war erstarrt, bis der Captain anfing, wilde Befehle auf Italienisch zu brüllen. Der Horizont der Zerstörung vor Anders’ Augen drehte langsam ab, als ihr Schiff nach Backbord zog und die Maschinen unter lautem Wummern die Flucht einleiteten. »Wo ist mein Schiff?«
Der komprimierte Blechberg, der gerade im Wasser versank, hinterließ einen mächtigen Strudel, angepeitscht von immer weiteren Blitzen, die konzentriert genau dort einschlugen, wo sich eben noch ein über zweihundertfünfzig Meter langes Schiff befunden hatte. Die Nacht schien besonders dunkel und der Donner ohrenbetäubend, als die Deep Sea Explorer verschwand, und sich die Flotte in heilloser Flucht auflöste.
Anders schreckte hoch und atmete heftig. Das Herz pochte wie ein Dampfhammer in seiner Brust, und kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn.
»Mr. Larsson?«, hörte er eine undeutliche Stimme und sah sich gehetzt um. Er lag in seiner Koje auf der Dolphin und blickte in das kastenförmige Gesicht eines unrasierten Mannes. Jewtschenko. »Sie sind da.«
»Ich … ich komme gleich«, versicherte er seinem Kollegen und quälte sich aus den nassen Laken, ehe er sich unter die Dusche stellte und den Regen aus prickelnden Tropfen über sein Gesicht laufen ließ. Die Bilder des Traums perlten nur langsam wie besonders hartnäckiger Schmutz von ihm ab. Die letzte Woche war die reinste Hölle gewesen. Nicht nur hatten sämtliche einheimischen Mitarbeiter und Zulieferer die Segel gestrichen, es weigerten sich auch viele der europäischen und russischen Angestellten, ihre Verträge zu erfüllen – nicht, dass Anders eine Idee gehabt hätte, wie das noch gehen sollte. Dann waren die Sachverständigen des Deep-Sea-Konglomerats losgeflogen, ohne jemals hier bei ihnen auf dem See anzukommen. Stattdessen hatte es sich dabei um diplomatische Sondergesandte mit ihren jeweiligen Beraterstäben von EU und Kreml gehandelt, die eine so seltsam unterkühlte Art an den Tag gelegt hatten, dass es sich nur um Geheimdienstmitarbeiter handeln konnte. Sie hatten ihn, Jewtschenko und die Brückencrew tagelang befragt, ehe die ersten Kriegsschiffe eingetroffen waren. Zuerst die USS Brixton, ein Navy-Kreuzer, und dann die Kuzneszow der Russen, ehe vor drei Tagen jeweils sechs Schiffe beider Nationen den Mittelpunkt des Sees erreicht hatten. Es handle sich bloß um ein gemeinsames Manöver nach einer Einladung des venezolanischen Präsidenten, hatte man ihnen versichert, als wenn die USA und Russland jemals einvernehmliche Operationen durchführen würden. Seither bebte das Wasser ununterbrochen, und die Menge an toten Fischen auf der Oberfläche nahm noch weiter zu.
Nachdem er sich abgetrocknet hatte, zog er sich an und nahm seinen Trolley, den er bereits am Abend zuvor gepackt und neben die Tür gestellt hatte. Auf dem Achterdeck liefen längst die Rotoren des Helikopters warm, der sie zum internationalen Flughafen bringen würde. Jewtschenko und der Captain der Dolphin saßen schon in der Passagierkabine auf ihren Sitzen und hatten sich die dicken Kopfhörer aufgesetzt, um ihre Ohren vor dem Lärm zu schützen. Anders begann trotz des Sturmwinds, unter den er sich duckte, um zu den beiden zu gelangen, erneut zu schwitzen.
Auf seinem Sitzplatz lag ein eingeschlagener Faltordner mit Gummiband, den er erst aufnehmen musste, ehe er sich setzte und mit den Fersen seinen Trolley unter dem Stuhl verstaute.
»Ist eine Unterlassungserklärung«, sagte Jewtschenko über Funk.
»Eine Unterlassungserklärung? Wofür?«, fragte Anders, als er sich das Mundstück vor die Lippen gefummelt hatte und ungelenk das Gummiband von dem Metallbügel entfernte. »Zweihundert Seiten?«
»Ja. Ihre und meine Leute wollen offenbar nicht, dass wir über diese verrückte Sache sprechen.«
»Aber … zweihundert Seiten?«
Der Helikopter hob wie in Zeitlupe ab und wackelte dabei leicht.
»Sie haben die Militärübung eine Woche vordatiert. Angeblich gab es einen Unfall mit einem Atom-U-Boot unter unserer Bohrflotte, und das eigentlich geheime Manöver ist dadurch aufgeflogen«, erklärte der Russe und schürzte die Lippen.
»So ein …« Anders winkte ab. »Ist ja auch egal. Mit zweihundert Seiten haben die sicher alles abgedeckt, was auch nur im Entferntesten mit Venezuela zu tun hat, um uns vor Gericht mundtot zu machen.«
»Und pleite«, fügte Jewtschenko hinzu.
Ihr Hubschrauber beschrieb einen langen Bogen, vorbei an der dicht zusammengeklumpten Flotte aus amerikanischen und russischen Kriegsschiffen, die einen beinahe perfekten Kreis bildeten. Zwei Versorgungsschiffe, dicke Klötze aus grauem Stahl, befanden sich in ihrer Mitte, und von ihren Decks ragten riesige Kräne, von denen sich Stahlseile wie Spinnenfäden in die blauen Fluten herabsenkten, über das freie Gewässer zwischen ihnen. Die Kreuzer und Zerstörer in der direkten Umgebung begannen, mit ihren Nebelwerfern den Himmel einzudunkeln und sich vor neugierigen Blicken aus dem Orbit oder Flugzeugen zu verstecken, die die Flugverbotszone umgingen. Doch Anders erhaschte gerade noch einen Blick auf einen ovalen Schatten, den die Kräne aus der Tiefe hoben. Erst dachte er an einen riesigen Wal, aber die Form war zu gleichförmig und perfekt, auch wenn die Ränder durch die Wassereffekte verschwammen und alles andere als klar waren.
»Was ist das?«, hauchte er und brauchte nicht zu fragen, um zu wissen, dass sich dieser mysteriöse Schatten dort befand, wo vor einer Woche die Deep Sea Explorer gesunken war.
»Das muss das Wrack sein!«, meinte Jewtschenko und beugte sich über die Armlehne seines Sitzes, doch der Rauch war bereits so dicht, dass ihre Blicke ausgesperrt blieben.
Das ist nicht das Wrack, dachte Anders.
1
James tat, als würde er das Einsatzbriefing lesen, hatte die Dokumente jedoch so vor sich gehalten, dass die beiden Mitarbeiter des Außenministeriums sein Smartphone nicht sehen konnten, das in der aufgeklappten Innenseite lag. Der Flug von Washington nach Mombasa dauerte ewig, und an Schlaf war nicht zu denken. Dafür war er viel zu nervös. Dieser Einsatz war zu delikat, um überhaupt nur eine ruhige Minute haben zu können. Also züchtete er kleine Pixel-Hühner, legte neue Felder an und verlegte winzige Bäche, um seine digitale Farm zu hegen und zu pflegen.
Das Spiel war ein brauchbarer Zeitvertreib, um ihn abzulenken, nicht etwa, weil er sich große Sorgen gemacht hätte, den Auftrag in den Sand zu setzen, sondern durch die besonderen Bedingungen, die der mit sich brachte. Seit drei Jahren wartete er auf diese Gelegenheit, und nun war es so weit: das richtige Einsatzgebiet zur richtigen Zeit. Nun wartete er auf nichts sehnlicher als eine Nachricht, checkte schon seit insgesamt zwanzig Stunden und einunddreißig Minuten seinen Posteingang und zur Sicherheit auch das E-Mail-Postfach. Nichts. Keine Antwort.
»Mr. Hamilton?«
Er sah auf und in das Gesicht einer der beiden in blau-weiße Uniformen gekleidete Flugbegleiterinnen, die den Service in dem kleinen Learjet übernahmen. Ihr Lächeln war so makellos wie das perfekt gefaltete heiße Tuch auf dem Tablett, das sie ihm entgegenhielt.
»Danke.« Er zupfte es vorsichtig herunter und wusch sich damit die Hände – und als keiner guckte, auch schnell das Gesicht.
Die Ministeriumsmitarbeiter Carl Vega und Mitch Blake, zwei feiste Beamte aus Washington mit dicken Bäuchen und schütterem Haar, räkelten sich auf ihren Sitzen und lösten sich aus dem Halbschlaf, der sie die letzten Stunden umnebelt und James ein wenig Ruhe gegönnt hatte.
»Guten Morgen«, sagte Vega mit belegter Stimme und räusperte sich schleppend.
»Guten Morgen«, antwortete James.
»Wir landen bald?«
»Es gibt gleich Frühstück, also in etwa einer Stunde.«
»Haben Sie gar nicht geschlafen?« Vega rieb sich die Augen und glättete sein Hemd.
»Nicht nötig.«
»Diese Sache ist wirklich wichtig, Mr. Hamilton. Vincent Debongo ist ein wichtiger Informant für die CIA und …«
»… Sie müssen ihn unbedingt vernehmen, um zu wissen, was er verraten haben könnte. Schon klar. Außerdem ist sein Vater ein extrem reicher Industrieller in Kenia.« James tippte auf seine Dokumentenmappe und klappte sie zu, sodass ihm das Smartphone dabei vom Tisch verdeckt in den Schoß fiel. »Ich bin alles durchgegangen.«
In Wahrheit hatte er keine einzige Zeile des CIA-Berichts gelesen, nachdem er sicher gewesen war, dass dort nichts Unerwartetes zu finden war.
»Gut, dann wissen Sie auch, dass …«
»… Vincent Debongo ein V-Mann bei Boko Haram ist. Ihre Augen und Ohren bei einer der schlimmsten Terrororganisationen der Welt. Das waren doch die Worte des Staatssekretärs?«
»Genau.« Vega hob die Hände und gab auf. »Also gut.«
»Sie müssen mir vertrauen. Ich bin der Beste in meinem Job.«
»Das sagte man uns«, wich der Beamte aus und nickte lächelnd, als er sein eigenes heißes Tuch bekam.
Ihr Business-Jet landete um 9 Uhr Ortszeit auf dem Moi International Airport und rollte gemächlich zum kleinen Privatterminal, wo eine ganze Heerschar Geheimdienstmitarbeiter ihre Ausweise und Sonderdokumente überprüfte, mit einem riesigen Arsenal an Stempeln bearbeitete und sie dann in einen großen VW-Geländewagen verfrachtete, der eines von insgesamt drei Fahrzeugen mit getönten Scheiben war, die auf sie warteten. Die Soldaten, die sie begleiteten, trugen zwar schlabberige Uniformen und Kalaschnikows mit abgeriebenen Holzelementen, aber James hatte genug Erfahrungen in Afrika gesammelt, um zu wissen, dass diese Kerle hart im Nehmen waren und vermutlich besser ausgebildet als sie aussahen.
Ihr kleiner Konvoi raste jenseits jeder erlaubten Geschwindigkeit über die staubigen Straßen der versmogten Stadt, brach sämtliche Verkehrsregeln und scherte sich nicht um rote Ampeln. Mehr als einmal glaubte James, dass sie einen Unfall bauen würden, und schnallte sich lieber an. Blake, der andere Ministeriumsmitarbeiter, war bereits weiß angelaufen und sah aus, als müsse er sich jeden Augenblick übergeben.
Es wurde erst besser, als sie die Stadt verließen und über endlose Schotterpisten in Richtung Westen rasten. Er war noch nie in Kenia gewesen, was ihn die letzten drei Jahre besonders enttäuscht hatte, und er hatte es sich definitiv anders vorgestellt. Das Land in der Nähe des großen Deltas aus Flüssen und Binnenmeeren, das diesen Moloch einer Stadt umgab, war erstaunlich grün und gut bewässert. Er sah Bananenplantagen und Maniokfelder so weit das Auge reichte. Die Sonne brannte heiß genug auf sie herab, um ihm das Gefühl zu geben, dass die Hitze durch das Dach seinen Scheitel aufheizte, auch wenn das vermutlich nur Einbildung war, und die Klimaanlage lief auf voller Leistung. Trotzdem schwitzte er dort, wo Rücken und Gesäß Kontakt mit dem Kunstleder der Sitzbank im Fond hatten.
Mit jedem Kilometer, den sie weiter nach Westen kamen, wurde die Landschaft karger und trockener. Grüne Felder wurden durch braune ersetzt, auf denen keine alten Landmaschinen mehr fuhren, sondern Hunderte Männer und Frauen mit Tüchern auf den Köpfen einfache Werkzeuge in die Erde rammten, um sie zu pflügen oder die spärliche Ernte einzuholen. Blätter wurden durch vertrocknete Äste ersetzt und Gräser durch hellen Sand. Die Reifen ihrer wie wahnsinnig rasenden Autokolonne wirbelten riesige Staubwolken hinter ihnen auf, die er im Rückspiegel sah wie eine Sturmfront, wie sie sich durch den leichten Südwind nach Norden verlagerten und die Feldarbeiter einhüllten und sich auf ihre wenigen Pflanzen legten. Es war wie der Blick auf eine reale Metapher, die ihm zeigte, wie die Welt funktionierte. Die einen fuhren in luxuriösen Autos durch die Landschaft, ihre weichen Körper von der kühlen Luft einer Klimaanlage umweht, während die anderen mit einfachsten Mitteln versuchten, der Erde Nahrung zu entreißen und dabei vom Dreck der anderen erstickt wurden.
Die Welt in einem Satz, dachte er und begann auf seiner Unterlippe zu kauen, als die schemenhaften Gestalten in den Staubwolken langsam wieder erkennbar waren. Ob sie sich überhaupt noch darüber ärgerten? Oder einfach weiterarbeiteten und es hinnahmen?
»Alles in Ordnung?«, fragte Vega mit besorgter Stimme. Sein Hemd war schon durchgeschwitzt, wo es von den Speckröllchen auf Spannung gebracht wurde. »Sie sehen unruhig aus.«
»Keine Sorge, der Deal wird funktionieren.«
»Was macht Sie da so sicher?«
James zuckte mit den Schultern. »Ich habe Erfahrung, und Ihr Boss hat den besten angefordert, oder?«
Er sah, dass Blake sich auf dem Beifahrersitz umdrehte und zu ihnen auf die Rückbank sah, um etwas zu sagen, doch James hob eine Hand, um ihm zuvorzukommen.
»Hören Sie, alle beide. Mir kam bloß in den Sinn, wie seltsam es ist, hier zu sein.«
»Was meinen Sie?« Vega runzelte die Stirn.
»Die CIA macht einen Deal mit dem kenianischen Geheimdienst, dessen Abkürzung ich nicht einmal kenne. Diese Leute hier«, er deutete aus dem Fenster, obwohl gerade keine Felder mehr zu sehen waren, »schuften ihr ganzes Leben, um einen Dollar pro Tag zu verdienen, haben Schwielen an den Händen, schmerzende Rücken und eines ihrer fünf Kinder wird im nächsten Jahr verhungern. Wie viel Geld haben wir zur Verfügung, hm?«
»Ungefähr zwanzig Millionen US-Dollar«, antwortete Vega, als habe es sich nicht um eine rhetorische Frage gehandelt.
»Was man mit diesem Geld wohl anfangen könnte, anstatt damit ein Spiel zu spielen, das seit einhundert Jahren nur Chaos gestiftet hat.«
»Sie meinen, wir sollten es lieber spenden? Damit die mehr zu Essen haben, nur damit die Boko Haram sie in ein paar Monaten abschlachtet?«
»Kommen Sie, das glauben Sie doch selbst nicht. Die CIA will bloß an Ihren Informanten herankommen, um unsere eigenen Leute zu schützen. Ohne den Anschlag auf unsere Botschaft in Mombasa hätten wir keinen Finger gerührt. Wie lange würde es wohl dauern, diese Terroristen auszuschalten, wenn wir wirklich wollten?«
»Das zu beurteilen, ist nicht unsere Aufgabe«, brummte Blake und drehte sich wieder um. »Sie sind hier, weil sie Vincent Debongo persönlich kennen.«
»Ich brauche keine Motivationsspritze. Außerdem habe ich ihn vor zwei Monaten fünfzehn Minuten bei einem Botschaftsempfang in Kapstadt gesprochen, wo er mit seinem Vater zu Gast war. Das ist wohl kaum ein besonderer Draht.«
»Die Agency braucht Sie so motiviert wie möglich, damit Sie Ihr Bestes geben können. Und das Ministerium auch. Alles Weitere braucht uns nicht zu kümmern.«
»Natürlich nicht. Also holen wir unseren reichen Sohn da raus und verbessern die Welt«, schnaubte James und blickte wieder aus dem Fenster, um das Gespräch zu beenden. Mittlerweile gab es außer verschiedenen Brauntönen kaum noch etwas für das Auge zu entdecken, sah man von den Bergen ab, die aussahen, als wären sie mit Flugrost überzogen. Sie waren schroff und zerklüftet und besaßen gleichzeitig eine rohe Schönheit, die etwas Unberührtes, Authentisches ausstrahlte, so wie dieser gesamte Kontinent, bei dem er sich nie sicher war, ob er ihn lieben oder hassen sollte. Er hatte genügend Gründe, um beides mit ganzem Herzen zu tun, so viel stand jedenfalls fest.
Rukanga, ihr Zielort und vereinbarter Treffpunkt, war angeblich ein Dorf, wie ihm Wikipedia hatte versichern wollen, doch der Kurzbericht der CIA war da schon deutlich realistischer gewesen: Es handelte sich um vielleicht ein Dutzend Hütten mit Wellblechdächern und grob gezimmerten Holzwänden, die noch aus der Kolonialzeit zu stammen schienen. Nie standen mehr als zwei an einem Platz und die wenigen knorrigen Bäume, die es hier gab, verdeckten kaum die Nachbarhäuser, die jeweils einige hundert Meter weiter entfernt waren.
Ihr Konvoi fuhr bis vor ein besonders langes dieser einstöckigen Gebäude, über dessen Eingang »Moi High School Kasigau« geschrieben stand und hielt dann mit quietschenden Reifen an. Es dauerte eine Minute, bis die von ihnen aufgewirbelte Staubwolke sie eingeholt hatte und vorübergezogen war, dann drehte sich ihr Fahrer zu ihm um.
»Wir sind da«, sagte er mit starkem Akzent und ernster Miene.
»Also gut. Dann kommt jetzt wohl mein Part«, sagte James, nickte und wollte aussteigen.
»Moment mal. Was ist mit Ihrer Tasche?«, fragte Vega und deutete auf die kleine Aktentasche im Fußraum.
»Ist das sein erstes Mal?«, fragte James in Blakes Richtung und schüttelte den Kopf, bevor er ausstieg und die Tür hinter sich zuschlug. Nach dem metallischen Knall wurde es still, bis ein heißer Wind vertrocknete Blätter von Affenbrotbäumen um seine Füße wehte. Die Schule war von rostbraunem Staub umgeben, der winzige Windhosen bildete, und wirkte verlassen, doch er wusste es natürlich besser. Also ging er über den kurzen Schotterweg zur Eingangstür, ohne dem Drang nachzugeben, sich nach seiner Eskorte umzudrehen. Er kannte dieses Bedürfnis, diesen basalen Instinkt, wenn er nach seinem Stamm rufen wollte. Unterstützung, Hilfe, einfache Nähe. Aber die jetzt anstehende Phase musste ohne all das funktionieren.
Das war sein Job.
Er klopfte an das trockene Holz und spürte dessen raue Maserung an seinen Knöcheln. Ein Kenianer in Waldtarnuniform öffnete ihm und presste ihm die Mündung einer Pistole gegen die Stirn. Das Metall war kalt und fühlte sich dadurch auf absurde Weise angenehm an.
»Ich bin unbewaffnet«, sagte er und schluckte. Das Wissen, dass der Tod ab jetzt eine sehr reale Möglichkeit für den Ausgang dieses Tages war, fuhr ihm bis ins Mark und elektrisierte ihn gleichzeitig von den Fußsohlen bis in die Haarspitzen. Es gab keinen Platz mehr für Kummer oder Sorgen, nur noch Atemzüge, pfeilschnelle Gedanken, die Aufnahme jedes noch so winzigen Geruchspartikels. Jeder seiner Sinne schäumte über vor Aufmerksamkeit und Fokussierung, als hätte jemand einen Intensitätsregler über das Maximum hinausgedreht.
»Vortreten, tumba!«, fauchte der Mann und zerrte ihn an der Schulter herein, ehe er einen finsteren Blick auf die Geländewagen warf und die Tür zuschlug. Sie standen in einem kaum beleuchteten Raum, einem riesigen Klassenzimmer – dem einzigen dieser angeblichen High School. Vier weitere Bewaffnete standen oder saßen um zwei Tische herum und hatten ihre Gewehre geschultert. Das Weiß ihrer Augen leuchtete in ihren ebenholzfarbenen Gesichtern, wie es bei Raubtieren in der Dämmerung der Fall war.
James wurde grob nach Waffen durchsucht, doch natürlich hatte er nichts dabei außer seinem Smartphone. Einer der Terroristen nahm es und entfernte den Akku, ehe er sich beides in die Tasche steckte. Danach zog er einen schwarzen Jutesack aus seinem Rucksack und stülpte ihn ihm über den Kopf. James’ Welt wurde schlagartig stockfinster, als er grob von hinten gepackt wurde und dann nach vorne stolperte. Jemand drückte ihm mit etwas Spitzem in den Rücken, aus dem seine Fantasie und seine Erfahrung die Mündung einer Kalaschnikow machten. Der Beutel roch nach einer Mischung aus Staub und Schweiß mit einer Note Zimt, die ihn verwirrte. Die Scharniere einer Tür quietschten kaum hörbar, doch James’ im Ausnahmezustand auf Hochtouren laufendem Gehirn entging der unangenehme Laut nicht, ebenso wenig wie das Rascheln des Windes an einem losen Stück Lack an der Hintertür, durch die er geschoben wurde. Dann setzte man ihn in ein Auto, das nach von der Sonne ausgeblichenem Leder roch. Die Luft wurde schlagartig stickig, sobald die Türen geschlossen waren und der Motor aufheulte.
Angst verspürte er keine – zumindest nicht mehr, als er es in Situationen wie dieser gewohnt war. Er hatte genügend Erfahrung, um zu wissen, wie das hier funktionierte, und noch geschah nichts außer der Reihe. Da sie für ihn ohnehin nichts bekommen würden als Ärger, konnte er sich entspannen – und das tat er auf seine Weise. Er genoss die gesteigerten Sinne, den metallischen Geschmack in seinem Mund, als hätte er zu viele Schmerzmittel genommen. Nichts spielte mehr eine Rolle als die Geräusche, die ihn umgaben, das Gefühl des Sitzes unter seinem Gesäß und an seinem Rücken, getragen zu werden und nichts dafür tun zu müssen, befreit von repetitiven Gedanken über unwichtige Dinge, die mit dem wirklichen Leben nichts zu tun hatten. Denn das bestand hier und jetzt nur aus Einatmen und Ausatmen, dem Wahrnehmen von einem Moment und dem nächsten – und das gleichzeitig. Simpel und intuitiv, als kümmere sich sein Körper selbst um all das. Es brauchte kein Zutun mehr, einfach nur seine Anwesenheit.
Die Fahrt dauerte lange, zwei oder drei Stunden, wenn es auch unmöglich zu schätzen war, da es ihm wie eine Ewigkeit vorkam und gleichzeitig wie die Dauer eines Fingerschnippens. Ihr Fahrzeug hielt an und beendete damit das endlose Brummen des Motors und das Kratzen und Knacken des Schotters in den Radkästen. Türen wurden geöffnet und Sätze in der hiesigen Landessprache ausgetauscht, dann zerrte man ihn hinaus in die sengende Hitze und das allgegenwärtige Kreischkonzert der Heuschrecken.
Der Sack wurde von seinem Kopf gerissen, und die Helligkeit der prallen Sonne strömte auf ihn ein wie ein Laserbombardement. Er kniff ächzend die Augen zusammen und blinzelte immer wieder gegen die Schmerzen in seinen Netzhäuten an, bis er die Umrisse von fünf Gestalten ausmachen konnte, von der eine kleiner war als die anderen. Erst nach und nach erkannte er, dass sie gar nicht kleiner war, sondern auf einem Stuhl gefesselt saß. Jeweils rechts und links standen zwei schwer bewaffnete Männer in dunkler Tarnkleidung. Ihre Gesichter waren emotionslos.
Ein sechster Mann trat seitlich in sein Blickfeld. Er war unbewaffnet und trug eine muslimische Gebetskappe auf dem Kopf. Auch wenn es schwer zu sagen war, glaubte James nicht, dass er in der Schule gewesen war.
»Guten Tag«, sagte er und straffte sich, um ein wenig Würde zurückzugewinnen. Dabei nahm er eine möglichst steife Haltung ein.
»Sie sind Mr. Schmidt?«, fragte der Mann – der Anführer?
»So können Sie mich nennen. Sie wissen ja sicher, wie das funktioniert.«
»Gut. Ich bin Shahir. Wir können jetzt verhandeln.«
James sah zu Vincent Debongo, einem untersetzten jungen Mann mit berechnendem Blick und weichem Mund, der einen schmutzigen Nadelstreifenanzug trug und mit Panzertape an einen einfachen Stuhl gefesselt war. Sie standen inmitten einer steinigen Halbwüste, die in einigen hundert Metern Entfernung von felsigen Hügeln eingerahmt war. Die Sonne brannte erbarmungslos auf sie herab und ließ ihn in Schweiß ausbrechen.
»Geht es Ihnen gut, Mr. Debongo?«, fragte er neutral.
Der junge Mann deutete ein Nicken an.
»Wurde Ihnen psychische oder körperliche Gewalt angetan?«
»Nein.«
»Wurden Ihnen potenziell gefährliche Stoffe injiziert oder Ihre Gesundheit auf irgendeine mögliche Art und Weise langfristig gefährdet?«
»Nein.«
»Gut. Dann können wir die Verhandlung beginnen.«
»Wir wollen fünfzig Millionen US-Dollar«, kam Shahir direkt zur Sache. Sein auf und ab tanzender afrikanischer Akzent hatte etwas von einem stotternden Motor und wirkte dadurch auf skurrile Weise bedrohlich. Passend für jemanden, der vermutlich schon mehr Menschen amputiert und Kinder abgeschlachtet hatte als es in einem durchschnittlichen, amerikanischen Horrorfilm der Fall war. Es war leicht zu übersehen, mit wem man es zu tun hatte, wenn zwei Menschen ein normales Gespräch führten, aber James tat das nicht.
»So viel Geld existiert nicht. Nicht für das hier.«
Shahir gab einem seiner Männer einen Wink, woraufhin der eine Pistole zog und sie Debongo an die rechte Schläfe hielt.
»Wenn Sie die Verhandlung jetzt beenden wollen, dann nur zu.« James schluckte, um Nervosität vorzutäuschen, die er betont bemüht zu überdecken versuchte. »Ich sage Ihnen, was dann passiert: Sie haben keine Geisel mehr und ich keinen Verhandlungsgegenstand. Danach haben Sie zwei Optionen: Sie lassen mich gehen und haben den amerikanischen und kenianischen Steuerzahler ein bisschen Geld gekostet. Ein großer Sieg für Ihre Organisation? Ich glaube nicht. Sie können mich auch erschießen – obwohl ich das nicht begrüßen würde – und dann war dies die letzte Lösegeldverhandlung für Boko Haram. Die CIA wird sich dann gut überlegen, wofür sie in Bezug auf Sie und Ihre Leute ihr Geld ausgibt. Sie verstehen doch, was ich meine, oder?«
Shahir warf ihm einen langen Blick zu, den James erwiderte, ehe er entsprechend seiner selbstgegebenen Rolle zu Boden blickte, als wäre er eingeschüchtert.
»Ich wäre für keine der beiden Optionen«, fuhr er fort, um die vorgeblich unangenehme Stille zu füllen. »Wenn ich erfolgreich bin, bekomme ich vielleicht eine Gehaltserhöhung und behalte meinen Job, und Sie haben mehr Geld auf dem Konto. Wie klingt das für Sie?«
»Wie der Spruch eines Verkäufers«, sagte Shahir, gab seinem Lakaien jedoch einen Wink, woraufhin der die Pistole zurück in sein Beinholster steckte.
»Ich bin ein Verkäufer. Ich verkaufe Zukunft. Die Zukunft von Mr. Vincent Debongo hier und eine Zukunft für Sie.« James klatschte in die Hände und rieb die rauen Innenflächen aneinander. »Also. Mr. Debongos Vater ist bereit, Ihnen zehn Millionen US-Dollar zu bezahlen, wenn Sie seinen Sohn jetzt freilassen und mit mir zum Übergabeort zurückbringen.«
»Zehn Millionen?« Shahir wollte erneut eine Hand heben.
»Warten Sie. Das ist eine Menge Geld. Davon kann man eine Menge Kalaschnikows kaufen und so«, beeilte sich James zu sagen, als würde er nervös, und wischte sich mit dem Handrücken frischen Schweiß von der Stirn.
»Dreißig Millionen.«
»Ich habe einen Neffen, sein Name ist Jeremy. Zu seinem vierten Geburtstag wollte er unbedingt die neue Ritterburg von Playmobil haben. Sie kennen doch Playmobil, oder?« Der Terroristenanführer warf ihm einen finsteren Blick zu. »Gut, also er wollte diese Burg haben, hatte aber schon eine. Sie war kleiner und nicht ganz so eindrucksvoll wie diese neue, die er im Spielzeugladen gesehen hatte, also hat er das gemacht, was Kinder in seinem Alter so machen: geheult wie ein Schlosshund. Aber meine Schwester war clever. Sie hat ihm gesagt, dass er sie haben kann, wenn er dafür seine alte Burg hergibt. Er bekommt nicht beide.«
»Kommen Sie zum Punkt, Mann, sonst zeige ich Ihnen meine alte Machete!«, knurrte Shahir.
»Also, äh …« James schluckte. »Er war erst vier Jahre alt, aber er hat es verstanden und sich zwei Jahre später daran erinnert, als er gerade in die Schule wollte. Er hatte einen neuen Schulranzen ins Auge gefasst und meine Schwester wollte ihm den neuen nicht kaufen, weil seiner ja noch gut war. Er hat sie daran erinnert, was mit der Burg war, und sie hat gesehen, dass …«
»Dreißig Millionen!«
»Sehen Sie: Wenn sie jetzt dreißig Millionen bekommen – die ich nicht zur Verfügung habe – war das das letzte Mal, dass Sie eine Ritterburg von uns kriegen. Wenn Sie einen neuen Schulranzen wollen, werden wir uns daran erinnern, dass Sie Ihre alte Burg nicht hergeben wollten und ein gieriger Junge waren.«
»Nennen Sie mich ein verdammtes Kind, Momba?«, brauste der Mann auf, und seine rechte Hand fuhr zu der rostigen Machete an seinem Gürtel.
»Er sagt Ihnen, dass Sie in Zukunft auch einen neuen Schulranzen bekommen könnten«, sagte Debongo. Er klang ein wenig erschöpft, sah aber weder verletzt noch dehydriert aus.
Shahir musterte James eingehend und fletschte dabei die Zähne wie ein Raubtier, ehe er einen längeren Blick mit seiner Geisel austauschte und schließlich nickte.
»Zwanzig Millionen.«
»Fünfzehn. Ich habe einen Ruf zu verlieren!«
»Achtzehn!«
»Gut, abgemacht.« James hielt seine Hand nach vorne, mit der Innenfläche nach oben, woraufhin Shahir einem seiner Männer einen Wink gab. Der griff sich in die Tasche und legte ihm Smartphone und Akku in die Hand. Er baute es rasch wieder zusammen und öffnete die einzige App, die sich darauf befand. »Ich brauche die Bankverbindung.«
Shahir hielt ihm sein eigenes Telefon hin, auf dem die entsprechenden Daten zu sehen waren. James veranlasste die Überweisung und wartete, bis das Gerät seines Gegenübers nach einigen Minuten Stille einen lauten Dreiklang von sich gab. Statt gierig zu lächeln, wie er es schon oft bei der Gegenseite gesehen hatte, veränderte sich die Miene des Kenianers kaum.
»Sie können Ihr Handy eingeschaltet lassen«, sagte er und gab seinen Männern ein Zeichen, woraufhin zuerst Vincent Debongo und dann ihm ein schwarzer Sack über den Kopf gestülpt wurde. James zerrte man zu dem Stuhl und fesselte ihn mit Panzertape an eines der Beine.
Er beschwerte sich nicht, hatte er doch mit so etwas gerechnet.
»Mr. Hamilton, ich …«, setzte Debongo an.
»Nicht«, war alles, was er erwiderte, und dann schwiegen sie. Durch den Sack aus kratziger Baumwolle war seine Welt dunkel mit vielen winzigen, funkelnden Sternen am Firmament und einer brütenden Hitze, die ihm den Schweiß in Sturzbächen in den Stoff seines Anzugs laufen ließ. Irgendwann verfiel er in eine Art Trance aus Durst und Erschöpfung, fühlte sich fiebrig, unruhig und gleichzeitig, als hätte man ihm ein Sedativum gespritzt. Das Auf und Ab in dem Gekreische der Heuschrecken, die es irgendwie schafften, in diesem kargen Land zu leben, wurde immer unangenehmer, als würde es sich auf ihn zubewegen und ihn mit seiner Lautstärke erdrücken wollen. So bemerkte er zuerst nicht die Motorengeräusche, die sich näherten, bis sie schon so nah waren, dass er das Quietschen ihrer hydraulischen Bremsen hören konnte, die vom allgegenwärtigen Staub gequält wurden.
»Das hat aber lange gedauert«, murrte er, als einer der kenianischen Soldaten ihm den Sack vom Kopf zog und ein anderer an seiner Panzertape-Fessel nestelte. Die Augen hielt er noch geschlossen, bis er und Debongo vollständig befreit waren. Erst dann blinzelte er unter erneutem Protest seiner Netzhäute gegen das gleißende Licht an und sah Vega und Blake, die vor ihm standen und sich mit den Händen Luft zufächelten.
»Und?«, fragte Vega und nippte an einer Wasserflasche, die er nach einem grimmigen Blick von James vom Mund nahm und ihm reichte.
»Achtzehn Millionen«, antwortete er atemlos, nachdem er das Wasser in einem Zug geleert und sich vergewissert hatte, dass auch die Geisel versorgt wurde.
»Achtzehn? Sie lassen nach.«
»War eine extrem harte Verhandlung.« Er drehte sich zu Debongo. »Sind Sie bereit, nach Hause zu gehen?«
»Ja.« Der junge Mann nickte sichtlich müde. »Danke, Mister …«
»Schon gut«, unterbrach James ihn und klopfte ihm auf die Schulter. »Wir sollten jetzt von hier verschwinden.«
2
James warf einen Blick in den Spiegel und versuchte vergeblich, die Krähenfüße in seinen Augenwinkeln zu glätten. Die Wassertropfen liefen in glitzernden Perlen über seine Haut. Sie schien in den letzten vierundzwanzig Stunden gealtert zu sein. Er schien älter geworden zu sein.
Die Tür zu den Toilettenräumen öffnete sich und zwei Männer in feinen Anzügen kamen herein, lachten dabei und wurden erst ruhiger, als sie ihn sahen. Nachdem sie ihm kurz zugenickt hatten, gingen sie zu den Pissoirs und führten ihre Unterhaltung etwas leiser fort, während sie sich erleichterten. James nahm eines der frischen Handtücher aus dem Bastkorb zwischen den Waschbecken und tupfte sich Gesicht und Hände ab, ehe er ein letztes Mal in den Spiegel sah. Seine gebräunte Haut ließ ihn immer noch jünger aussehen, als es seine leicht grau melierten Schläfen taten, und sein fein säuberlich konturierter Dreitagebart hob seine markante Kinnlinie hervor. Seine Kurzhaarfrisur mit den geschorenen Seiten und dem etwas volleren Oberhaar schien aus der Zeit gefallen zu sein, doch er empfand es als Statement, und so wandte er sich zufrieden ab. Im Flur vor den Toiletten glättete er ein letztes Mal seinen maßgeschneiderten stahlgrauen Anzug mit dem roten Hemd und überprüfte den Sitz der breiten weißen Schnürsenkel seiner roten All Stars, ehe er den Knoten seiner dunkelblauen Krawatte hochschob und sich in den Empfangsbereich des Anwesens begab. Seine schwarze Aktentasche hatte er unter einem der beiden Waschbecken stehen lassen.
Normalerweise handelte es sich dabei um den Eingangsbereich zur Stadtvilla der Debongos, einer der größten Industriefamilien Kenias. Die große Doppeltür, an der livrierte Bedienstete standen, die an englische Stuarts erinnerten, führte zu einem pompösen Aufgang, vor dem bis gerade eben noch im Minutentakt die Limousinen der geladenen Gäste angehalten hatten. Große Säulen säumten die Halle vor den rechts und links nach oben führenden Treppen, die in einer Art Terrasse im dritten Stock auf Höhe der goldenen Kronleuchter mündeten, auf der William Debongo in einem traditionellen kenianischen Gewand stand, auf dem Kopf eine Gebetskappe in den Farben des Landes. Er gehörte zur muslimischen Minderheit und war der einzige Großindustrielle, der aus ihr hervorgegangen war – ein Grund dafür, dass jeder Bürger des Landes seinen Namen kannte. Hinzu kam, dass die dezenten folkloristischen Töne der Band auf dem Podium unter den Treppen von seiner Tochter komponiert worden waren, die in ganz Afrika ein Superstar war und weltweit die Opernhäuser und Konzertsäle füllte. Sein ältester Sohn, Justin Debongo, war ein viel gefragter Herzchirurg mit eigener Klinik in Nairobi. Den Blicken nach zu urteilen, die Debongo ihm da oben zuwarf, während sie miteinander sprachen, konnte das Mittlere der drei Kinder – Vincent – einem nur leidtun. Er hatte verschiedenen Zeitungsberichten zufolge sein Studium in den USA abgebrochen, um Fußballspieler zu werden, nach einem Kreuzbandriss aber nicht zurück zu seiner vielversprechenden Form gefunden. Er stand in einen schlichten Anzug gekleidet zwischen seinem Vater und seinem älteren Bruder und schien alles dafür zu geben, nicht aufzufallen. Doch James sah auch von hier unten zwischen den etwa einhundert geladenen Gästen im Treppenhaus das wütende Blitzen in seinen Augen, die wie weißer Brokat in seinem dunklen Gesicht leuchteten.
»Mr. Hamilton«, nuschelte jemand neben ihm, und er senkte den Blick von der Terrasse zu Vega und Blake, die sich mit Martinigläsern in der Hand an ein paar Gästen vorbeizwängten und an ihn herantraten. Vega kaute offenbar gerade auf einer Olive herum und deutete mit dem kleinen Holzspieß auf James. »Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen wütend darüber war, dass wir einen Tag länger bleiben, weil Sie sich in Ihrem Erfolg sonnen wollen, aber die Drinks sind wirklich fantastisch.«
»Und ich habe gehört, dass es gleich noch ein Buffet geben soll!«, fügte Blake hinzu und schob den Gürtel zurecht, der seinen stattlichen Bauch zurückhielt. »Keine Ahnung, wen Sie dafür angerufen haben, aber ich bin Ihnen nicht böse.«
»Freut mich«, erwiderte James kurz angebunden und schielte erneut zur Terrasse hinauf, doch dort waren noch immer nur die drei Debongos zu sehen. Also begann er sich auf die Zehenspitzen zu stellen und unter den Gästen nach einem vertrauten Gesicht zu suchen.
»Eins verstehe ich nicht«, fuhr Vega fort und schlürfte an seinem Drink. »Es wird eh niemand erfahren, was Sie getan haben. Bedeutet das, dass das Essen so gut ist?«
»Ich weiß es nicht, habe hier noch nie gegessen.«
»Der kleine Scheißer, Vincent«, meinte Blake und schnaubte. »Gestern erst gerettet worden und heute zerrt sein Vater ihn schon vor die Reichen und Schönen der Stadt.«
»Hatte wahrscheinlich nie wirklich Angst um ihn. Eher um seine Kohle.«
»Er zahlt doch nur die Hälfte davon.«
»Ja, und jetzt stehen neun Millionen weniger auf seinem Konto. Ein Geschäftsmann wie er lässt das nicht auf sich sitzen«, war sich Blake sicher. »Er will den Verlust irgendwie nutzen, und das tut er hier doch. Der große Mann, der seinen Sohn zurückgeholt hat, das eine Kind, das nicht zu Großem bestimmt zu sein schien, das jetzt für immer daran erinnert werden wird.«
»Als derjenige, der entführt wurde?«
»Ja.«
»Klingt nicht besonders heldenhaft«, befand Vega.
»Ist doch egal. Menschen geht es nur um Geschichten. Die Geschichte vom herausragenden Chirurgen, die Geschichte der Jahrhundertmusikerin und die Geschichte des von islamistischen Terroristen entführten Nichtsnutz, der in Gefangenschaft über sich selbst hinausgewachsen ist. Was er Schreckliches erlebt haben muss, und doch steht er jetzt und heute hier und sieht nicht einmal traumatisiert aus. Die Leute wollen bloß ’ne coole Story, ich sag’s dir. Hey, Hamilton, was ist los?«
»Hm?«
»Suchst du wen?« Blake runzelte die Stirn und begann sich ebenfalls umzusehen.
»Nein, schon gut. Ich wollte nur wissen, wie voll es schon ist«, entgegnete James, als das helle Klirren eines Löffels auf Glas erklang und sich die gedämpften Gespräche nach und nach legten. Alles richtete sich nun in Richtung Terrasse aus und die Blicke gingen empor, dorthin, wo William Debongo gerade sein Sektglas an einen Bediensteten abgab und sich mit den Händen auf die Sandsteinbalustrade abstützte.
»Herzlich Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin sehr froh, Sie alle hier und heute begrüßen zu können und zwar mit meinen beiden Söhnen Justin und Vincent«, rief Debongo in einem so satten Bariton, der keinen Zweifel daran ließ, dass der Siebzigjährige ein herausragender Verkäufer war. Applaus brandete auf, woraufhin er beschwichtigend die Hände hob, als sei das alles gar nicht nötig. »Wie Sie alle wissen, wollte kaum jemand glauben, dass die Boko Haram auch in Kenia aktiv werden würde, obwohl wir lange davor gewarnt haben. Diese Terroristen sind eine Plage – mittlerweile in weiten Teilen Afrikas, und wir können es uns nicht leisten, weiterhin wegzuschauen.«
Zustimmende Rufe erhoben sich, erneuter Applaus.
»Ich habe mich darum dazu entschlossen, persönlich tätig zu werden, um unser Land zu schützen«, fuhr Debongo fort. »Nicht mit Feuer und Schwert, wie diese Barbaren es tun. Ich will nicht Hass mit Hass vergelten. Ich will, dass sie hier in Kenia keine Wurzeln schlagen können. Boko Haram bedeutet im nigerianischen Hausa so viel wie ›Bücher sind Sünde‹,zitieren viele Medien. Aber das ist nicht ganz korrekt. Haram stammt zwar aus dem Arabischen und bedeutet Sünde oder Tabu, aber Boko schließt im modernen Sprachgebrauch sämtliche nichtislamischen oder westlichen Lehren mit ein. Man könnte es also mit ›Bildung ist tabu‹übersetzen.«
»Tz«, machte Blake. »Boko Haram gehört seit 2015 zum IS.«
James ignorierte ihn und hörte Debongo weiter zu.
»Ich bin überzeugt, dass wir aus ihrem Namen die beste Waffe gegen sie ableiten können: Bildung. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere muslimischen Kinder, aber auch konversionsgefährdete Kinder anderer Religionen die Bildung bekommen, die sie brauchen, um den Wahnsinn und die leeren Versprechungen dieser Fanatiker zu durchschauen.