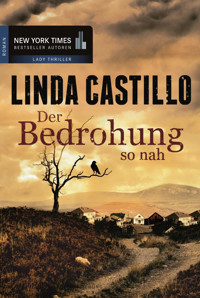9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine teuflische Idee - ein göttlicher Plan - eine ewige Schuld Als das gleißende Scheinwerferlicht des entgegenkommenden Fahrzeugs sie blendet, bleibt ihnen nicht einmal mehr die Zeit, um zu schreien. Auf der regennassen Straße im ländlichen Ohio sterben in dieser Nacht drei Menschen. Ein amischer Vater und zwei seiner Kinder. Als Polizeichefin Kate Burkholder die Unfallstelle genauer untersucht, kommen ihr erste Zweifel: War das wirklich ein Unfall, oder steckt noch etwas anderes dahinter? "Überzeugende Charaktere, exzellenter Plot und ein haarsträubendes Finale." USA TODAY
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Linda Castillo
Teuflisches Spiel
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Helga Augustin
FISCHER E-Books
Inhalt
Dieses Buch widme ich allen begeisterten Lesern meiner Bücher.
Schweigen kann die grausamste Lüge sein.
Virginibus Puerisque von Robert Louis Stevenson
Prolog
Das Klappern der Hufeisen auf Asphalt hallte in den Baumkronen wider. Paul Borntrager hatte den vierjährigen Amerikanischen Traber vor sechs Monaten auf einer Auktion in Millersburg gekauft, und zwar wider besseres Wissen. Der große und starke Wallach – von seiner Tochter Norah sogleich Sampson getauft, nach dem größten Pferd der Welt – war tatsächlich eine Herausforderung gewesen, denn frisch von der Rennbahn, fiel er aus dem Trab und scheute vor Autos und freilaufenden Hunden. Aber nach sechs Monaten Training und zahllosen Fahrten hatte Sampson sich doch als gute Investition erwiesen, und Paul war froh, das Risiko eingegangen zu sein. Heute gehörte das Pferd zu den schnellsten Trabern, die er jemals besessen hatte, und ihn zu fahren war ein Vergnügen.
Die ledernen Zügel lagen fest, aber weich in seiner Hand. Das Klirren des Geschirrs und das rhythmische Knarren des Buggys versetzten Paul in eine schläfrige, kontemplative Stimmung. Die Kinder waren den ganzen Nachmittag brav gewesen, obwohl sie bei dem Termin in der Klinik über eine Stunde hatten warten müssen. Jetzt waren sie still, aber das lag sicher an der Eiscreme, die er ihnen im Dairy Dream gekauft hatte. Sobald sie aufgegessen war, würde das Geschnatter weitergehen. Bei der Vorstellung musste er lächeln. Es war ein guter Tag gewesen.
Die Dämmerung nahm rasch zu, und aus einzelnen tiefhängenden Wolken nieselte es. Paul hoffte auf Regen, denn der extrem trockene Sommer hatte dem Getreide auf den Feldern sehr zugesetzt. Schnalzend und mit einem Schnicken der Zügel trieb er Sampson in einen starken Trab. Zwar hatte er hinten am Buggy batteriebetriebene Lichter und ein reflektierendes »Langsam-fahrendes-Vehikel«-Schild angebracht, doch im Dunkeln war Paul nicht gern auf der Straße. Die Englischen hatten es immer eilig und fuhren viel zu schnell. Und seit es Mobiltelefone und SMS gab, achteten sie noch weniger auf den Verkehr als zuvor.
»Guck mal, Datt! Die sunn is am unnergehn!«
Beim Klang der Stimme seines vier Jahre alten Sohnes musste Paul lächeln. Er blickte nach rechts zum Wegesrand, wo über dem blutroten Blattwerk von Ulmen, Ahorn- und Walnussbäumen die untergehende Sonne mit leuchtend rosa Fingern die Wolkendecke durchstach.
»Der Herr hat uns mit einem weiteren schönen Tag gesegnet.«
»Datt, David will nicht mit mir Klatschen spielen«, beschwerte sich die sechs Jahre alte Norah hinten im Buggy.
Das Spiel hatte ihre Mamm ihr vor kurzem beigebracht, und seither nervte sie ihren älteren Bruder damit.
»Er will bestimmt erst mal sein Eis essen«, meinte Paul.
»Aber er ist schon fertig.«
David, sein achtjähriger und somit ältester Sohn, schob den Kopf aus dem Inneren des Buggys und sah zu ihm hoch. »Klatschen ist was für Mädchen, Datt. Verlang nicht, dass ich so was mit ihr spiele.«
Über die Schulter hinweg blickte Paul seine Tochter an. »Da hat er nicht ganz unrecht, Norah.«
Das Mädchen beugte sich zu ihrem Bruder vor und legte ihm die Hand auf den Arm, die Finger voll Schokoladeneiscreme.
»Ich verrat’s ja auch keinem«, sagte sie todernst.
Jetzt musste Paul lachen, und die Liebe zu seinen Kindern durchströmte ihn so heftig, dass seine Brust schmerzte. Nicht zum ersten Mal an diesem Tag dankte er Gott für all die Segnungen, die ihm zuteilgeworden waren.
»Wir sind fast zu Hause. Sing doch stattdessen eins von den Klatschliedern«, sagte er, in Gedanken schon bei der unübersichtlichen Kreuzung vor ihnen. Falls Sampson dort scheute, wollte er vorbereitet sein.
Paul zog die Zügel straffer und reckte den Kopf vor, um nach herannahenden Fahrzeugen Ausschau zu halten. Die Bäume standen hier dicht zusammen und behinderten die Sicht, doch es waren keine verräterischen Scheinwerfer zu sehen, und auch Motorengeräusche oder das Zischen von Autorädern auf dem Asphalt hörte er nicht. Er konnte seine Fahrt ungefährdet fortsetzen.
Hinten im Buggy begann Norah Bei Müllers hat’s gebrannt-brannt-brannt zu singen:
Bei Müllers hat’s gebrannt-brannt-brannt,
da bin ich hingerannt-rannt-rannt.
Da war ein Apfelbaum-baum-baum,
da wollt’ ich Äpfel klau’n-klau’n-klau’n.
Dann hörte Paul das Klatschen und wusste, dass Norah ihren älteren Bruder rumgekriegt hatte. Sie war eine geschickte kleine Verhandlungsführerin und besaß große Willensstärke. Wie ihre Mutter, dachte er schmunzelnd.
Sie hatten die Kreuzung schon fast erreicht und die Straße ganz für sich allein. Schnalzend trieb er Sampson zur Eile an und stimmte in das Lied der Kinder mit ein:
Da kam ein Polizist-zist-zist,
der schrieb mich auf die List’-List’-List’.
Wie aus dem Nichts heulte plötzlich ein Motor auf, als ob ein Düsenjäger vom Himmel fallen würde. Paul erhaschte einen Blick auf das kreischende schwarze Ungeheuer zu seiner linken Seite. Wie ein scharfes Messer schnitt die Angst durch seinen Bauch, und Adrenalin durchflutete seinen Körper. Zu spät zog er an den Zügeln und schrie: »Brrr!«
Das Pferd rutschte mit den Hufen über den Asphalt.
Der Aufprall war fürchterlich. Er hörte, wie Holz und Fiberglas splitterten. Dann explodierte der Buggy in tausend Teile. Pauls Seite brannte, er flog durch die Luft, glaubte den Schrei eines Kindes zu hören, schoss auf den Erdboden zu, knallte auf.
Als er zu sich kam, lag er mit dem Gesicht in matschiger Erde. Dürres Gras stach in seine Wangen, er schmeckte Blut. Langsam drang der Gedanke zu ihm durch, dass er schwer verletzt war. Doch was war mit den Kindern? Wo waren sie? Warum waren sie so still? Er musste zu ihnen und sich vergewissern, dass es ihnen gutging.
Bitte, lieber Gott, behüte meine Kinder.
Er versuchte, sich zu bewegen, und stöhnte vor Anstrengung, doch sein Körper versagte ihm den Dienst. Er horchte nach Kinderstimmen, nach Weinen, nach irgendeinem Lebenszeichen. Doch außer dem nieselnden Regen auf dem Asphalt und dem Flüstern des Windes in den Bäumen blieb alles still.
1. Kapitel
Mit dem Regen kommt die Flut. In meiner Kindheit war das einer der Lieblingssprüche meiner Mamm. Damals verstand ich den tieferen Sinn ihrer Worte nicht, denn wann immer etwas »Mehr« wurde, bedeutete das für ein amisches Mädchen wie mich meistens etwas Gutes. Die Welt um mich herum glich einem dahinrauschenden Fluss mit Stromschnellen und Untiefen voller Geheimnisse, die ich mir kaum ausmalen konnte. Ich war begierig, den Fluss zu befahren, wollte in alle dunklen Felsspalten tauchen und ihre streng gehüteten Geheimnisse lüften. Erst in meinen Zwanzigern wurde mir bewusst, dass der Fluss auch über seine Ufer treten und zu einer tödlichen Gefahr werden konnte.
Meine Mamm ist inzwischen tot, und ich bin seit fünfzehn Jahren keine Amische mehr, doch den alten Spruch zitiere ich immer noch gern, besonders wenn es um meine Arbeit bei der Polizei und um mein eigenes Leben geht.
Seit drei Uhr heute Nachmittag fahre ich nun schon Streife, und für einen Freitag ist der Polizeifunk gespenstisch still, nicht nur in Painters Mill selbst, sondern in ganz Holmes County. Bis jetzt habe ich bloß einen Strafzettel wegen Überschreitens der Höchstgeschwindigkeit ausgestellt, und das hauptsächlich deshalb, weil der achtzehnjährige Fahrer ein Wiederholungstäter ist und irgendwann jemanden totfährt, wenn er so weitermacht. Seit etwa einer Stunde patrouilliere ich in den Seitenstraßen und gebe mir alle Mühe, nicht über ernstere Dinge nachzudenken, wie zum Beispiel über meine Beziehung mit State Law Agent John Tomasetti, die wesentlich komplizierter geworden ist, als wir beide das gedacht hätten.
Wir haben uns vor fast zwei Jahren während der Untersuchungen zu den Schlächter-Morden kennengelernt. Ein grauenhafter Fall, bei dem ein brutaler Serienmörder in Painters Mill wütete. Tomasetti, damals Agent beim Ohio Bureau of Identification and Investigation, war zur Unterstützung geschickt worden, und meine persönliche Verwicklung in den Fall hatte die ganze Situation ziemlich haarig gemacht. Also denkbar schlechte Umstände, besonders für den Beginn einer Beziehung, beruflich wie privat. Doch irgendwie war aus dem, was eine Katastrophe biblischen Ausmaßes hätte werden können, etwas Neues und vollkommen Unerwartetes geworden. Wir versuchen immer noch herauszufinden, was diese Bindung für uns bedeutet, und ich denke, er ist besser darin als ich.
Denn wie bei allen zwischenmenschlichen Beziehungen kann man sich noch so sehr bemühen, die Dinge einfach zu halten, irgendwann wird es dann doch wieder kompliziert. Tomasetti und ich sind an einem Scheideweg angelangt, Veränderung liegt in der Luft. Das muss nicht zwangsläufig negativ sein, doch leicht sind Veränderungen fast nie. Unentschlossenheit kann zermürbend sein, besonders wenn man an einer Gabelung steht und sich nicht entscheiden kann, in welche Richtung man gehen soll. Wobei jeder Weg auch noch in eine komplett andere Welt führt.
Momentan gelingt es mir nicht besonders gut, meine Probleme beiseitezuschieben, weshalb ich mir – wie zu meiner Zeit als Streifenpolizistin – ein bisschen Chaos wünsche. Zum Beispiel eine Kneipenschlägerei. Oder eine häusliche Auseinandersetzung, natürlich ohne dass jemand ernsthaft verletzt wird. Was das wohl über mich aussagt, dass ich mich lieber mit ein paar stinkenden Trinkern beschäftige als mit den Entscheidungen, die in meinem Leben anstehen?
Als ich auf den Parkplatz von LaDonna’s Diner einbiege, um mir ein Schinkensandwich mit Tomate und Salat und einen Kaffee zum Mitnehmen zu holen, erwacht mein Funkgerät knisternd zum Leben. »Sechs zwei drei.« Es ist Jodie Metzger, die abends in der Telefonzentrale arbeitet.
Ich nehme das Mikro. »Was gibt es, Jodie?«
»Chief, gerade kam ein Notruf von Andy Welbaum rein. Schwerer Unfall auf der Delisle Road, Kreuzung County Road 14.«
»Jemand verletzt?« Ich blicke in den Rückspiegel und mache auf dem Parkplatz eine Kehrtwende. Das Abendessen kann warten.
»Ein Buggy ist beteiligt. Welbaum sagt, es sieht schlimm aus.«
»Schicken Sie einen Krankenwagen hin, und benachrichtigen Sie Holmes County.« Fluchend biege ich nach links auf die Main Street, mache Blaulicht und Sirene an und jage den Motor auf achtzig Stundenkilometer hoch. »Bin auf dem Weg.«
Sobald das Industriegebiet von Painters Mill hinter mir liegt, trete ich richtig aufs Gas, und der Tacho zeigt einhundert an. Nur Sekunden später knistert erneut das Funkgerät mit der Meldung ans Sheriffbüro in Holmes County. Ich biege nach links auf die Delisle Road ab, eine kurvige Asphaltstraße durch dichte Wälder, tagsüber landschaftlich reizvoll, doch nachts hochgefährlich, vor allem wegen des vielen Wilds in dieser Gegend.
Noch etwa eine Meile bis zur Kreuzung Delisle und County Road 14. Mit heulendem Motor beschleunige ich auf einhundertzwanzig, Briefkästen und schwarze Baumstämme fliegen seitlich an meinem Explorer vorüber. Vom nächsten Hügel aus sehe ich die Scheinwerfer eines einzigen Fahrzeugs. Kranken- und Streifenwagen sind noch nicht eingetroffen, ich bin die Erste am Unfallort.
Etwa zwanzig Meter vor der Kreuzung erkenne ich Andy Welbaums Pick-up. Welbaum wohnt nicht weit von hier und ist wahrscheinlich auf dem Heimweg von der Fabrik in Millersburg. Der Wagen steht halb auf dem Seitenstreifen, wie hastig abgestellt, die Scheinwerfer sind auf die Überreste eines zerstörten vierrädrigen Buggys gerichtet. Ein Pferd sehe ich nicht, es ist entweder nach Hause gelaufen oder tot. Nach dem Zustand des Buggys zu urteilen vermutlich Letzteres.
»Verdammt.« Ich steige voll auf die Bremse, komme schlitternd auf dem Schotterbankett zum Stehen, mache Warnblinklichter und Fernlicht an und schiebe den Schalthebel auf Parken. Mit ein paar Warnfackeln vom Rücksitz und der MagLite springe ich aus dem Wagen, reiße die Schutzkappen von den Fackeln und verteile die Leuchten auf der Straße. Dann mache ich mich auf zum Buggy.
Alle meine Sinne sind in Alarmbereitschaft, und mehrere Dinge fallen mir gleichzeitig auf: In der südwestlichen Ecke der Kreuzung liegt reglos ein Rotfuchs mit Geschirr. Etwa zehn Meter davon entfernt ist der seitlich umgekippte amische Buggy in zwei Teile gerissen. Gesplittertes Holz, zwei fehlende Räder, und Trümmer im Umkreis von zehn Metern – Holzstücke und Fiberglasbrocken. Doch ich registriere noch mehr: den Schuh eines Kindes, einen flachkrempigen Hut inmitten von braunem Gras und trockenem Laub.
Und mir wird klar, dass es schlimm ist. Schlimmer als schlimm. Es wäre ein Wunder, wenn das jemand überlebt hat.
Auf halbem Weg zum Buggy sehe ich das erste Opfer. Ein Kind. Wie in Zeitlupe kommt alles um mich herum zum Stillstand, als hätte jemand in meinem Kopf einen Schalter umgelegt.
»Scheiße. Scheiße.« Ich renne hin, falle auf die Knie. Es ist ein kleines Mädchen mit blauem Kleid, sechs oder sieben Jahre alt. Ihre schiefhängende Kapp ist blutgetränkt von einer Kopfverletzung.
»Schätzchen«, flüstere ich mit erstickter Stimme.
Das Kind liegt auf dem Rücken, die Arme seitlich ausgestreckt, die pummeligen Hände offen. Ihr Gesichtsausdruck ist so entspannt, dass sie auch schlafen könnte. Aber ihre Haut ist grau und der Mund geöffnet, zwischen den blauen Lippen schimmern kleine weiße Milchzähne. Die Augen sind schon glasig, blicklos, und die Füße nackt. Der Zusammenstoß muss so gewaltig gewesen sein, dass ihre Schuhe weggeflogen sind.
Wie ferngesteuert drücke ich aufs Ansteckmikro am Revers und melde einen Verkehrsunfall. Mit Toten. Als ich aufstehe, zittern mir die Beine, mir ist schlecht, und ich schlucke etwas, das wie Galle schmeckt. Die Nacht um mich herum ist so still, dass ich den abkühlenden Motor des Pick-ups in einiger Entfernung ticken höre. Selbst die Grillen und Nachtvögel sind verstummt, wie aus Andacht angesichts des Unglücks, das sich vor wenigen Minuten hier ereignet hat.
Im Licht der Autoscheinwerfer schwirren Insekten. Ich nehme ganz schwach ein Weinen wahr, leuchte mit der Taschenlampe in die Richtung und sehe Andy Welbaum schluchzend neben seinem Wagen am Boden sitzen, das Gesicht in den Händen vergraben.
»Sind Sie verletzt?«, rufe ich ihm zu.
Er sieht mich an, als wundere er sich über diese Frage. »Nein.«
»Wie viele waren im Buggy? Haben Sie nachgesehen?« Ich laufe umher und blicke mich um, entdecke ein weiteres Opfer.
Welbaums Antwort höre ich nicht mehr, bin schon unterwegs zu dem amischen Mann auf dem grasbewachsenen Seitenstreifen. Er liegt auf dem Bauch, den Kopf zur Seite gedreht, im schwarzen Mantel und dunklen Hosen. Die große Blutlache, die um ihn herum das Gras tränkt, und das verdrehte linke Bein mit dem Fuß, der in die falsche Richtung zeigt, versuche ich auszublenden. Er ist bei Bewusstsein und sieht mit einem Auge in meine Richtung.
Ich knie mich neben ihn.
»Es wird alles gut«, sage ich, »Sie hatten einen Unfall, ich bin hier, um zu helfen.«
Er öffnet den Mund. An seinem Vollbart erkenne ich, dass er verheiratet ist, und frage mich, ob auch seine Frau hier irgendwo liegt.
Ich lege die Hand auf seine, die ganz kalt ist. »Wie viele weitere Personen waren im Buggy?«
»Drei … Kinder.«
Mein Herz setzt für eine Sekunde aus. Ich will nicht noch mehr tote Kinder finden. Ich streichele seine Hand.
»Gleich ist Hilfe da.«
Unsere Blicke treffen sich. »Katie …«
Meinen Namen aus dem blutigen Mund zu hören erschüttert mich. Die Stimme kenne ich, auch das Gesicht, und dann trifft mich die Erkenntnis wie ein Schlag. Es ist Jahre her, aber manche Menschen vergisst man nie. Paul Borntrager ist einer davon. »Paul.« Noch während ich den Namen ausspreche, wappne ich mich gegen das starke Gefühl, das er bei mir auslöst.
Er will etwas sagen, doch aus seinem Mund fließt nur Blut. Auch die Zähne sind blutig, doch seine Augen setzen mir am meisten zu. Eins ist ganz verschwunden, in dem anderen Auge sehe ich eine große Pein, weil Paul sich der Situation vollkommen bewusst ist. Ich kenne den Menschen, der in diesem kaputten Körper gefangen ist. Ich kenne seine Frau. Ich weiß, dass mindestens eines seiner Kinder tot ist, und befürchte, dass er mir die schlimme Wahrheit ansieht.
»Nicht sprechen«, sage ich. »Ich sehe nach den Kindern.«
Sein Auge schwimmt in Tränen, als ich aufstehe und weggehe, und ich spüre seinen brennenden Blick auf mir. Im Lichtschein der Taschenlampe suche ich die Umgebung nach weiteren Opfern ab, höre Sirenen in der Ferne und bin erleichtert, dass bald Hilfe da ist. Eine feige Reaktion, ich weiß, aber alleine bin ich dieser Situation hier nicht gewachsen.
Ich denke an Pauls Frau, Mattie. Vor ganz langer Zeit war sie meine beste Freundin, doch wir haben seit zwanzig Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Auch wenn sie mir inzwischen fremd geworden ist, wäre es mir unerträglich, sie heute Abend hier sterben zu sehen.
Ich durchquere den Straßengraben, und meine Stiefel versinken im Schlamm. Auf der anderen Seite entdecke ich einen kleinen Jungen, der zusammengesunken an einen dicken Ahornbaum gelehnt sitzt. Er sieht aus wie eine Puppe, schutzlos und zerbrechlich. Hoffnung erfüllt mich, als ich in der kalten Nachtluft Dampf aufsteigen sehe. Atemwölkchen, denke ich, doch beim Näherkommen werde ich eines Besseren belehrt: Der Dampf ist kein Zeichen von Leben, sondern von Tod – er steigt von dem sich abkühlenden Blut auf, das aus dem Jungen geflossen ist. Ich gehe zu ihm hin, knie nieder und schaudere beim Anblick seines geschundenen Gesichts: Augen und Mund stehen offen, seitlich am Kopf hängt ein faustgroßer Fleischlappen an einer klaffenden Wunde. Keinem Kind sollte so etwas jemals passieren dürfen.
Mir ist übel, und ich schließe die Augen. »Gottverdammt«, stoße ich aus und rappele mich wieder auf die Füße.
Einen Moment lang stehe ich einfach nur da, umgeben von Toten und Sterbenden, überwältigt von all dem vergossenen Blut. Ich bin fassungslos, dass ein solches Gemetzel in meiner Stadt passiert ist, während ich Streife fuhr, und ich bin maßlos wütend darüber, dass ich es nicht hatte verhindern können.
Ich muss mich zusammenreißen, muss meine Arbeit machen und zwinge mich, mit der Taschenlampe über den Boden zu leuchten. Über mir fährt ein Windstoß durch die Äste, Blätter segeln herunter. Aus dem dichten Unterholz steigen Nebelfetzen auf, und ich stelle mir vor, es wären Seelen, die ihren Körper verlassen.
Ein Wimmern reißt mich aus meiner Erstarrung. Ich wirbele herum, leuchte nach links und entdecke ein weiteres Kind im kaputten Drahtzaun entlang der Baumgrenze. Ich laufe hin. Aus etwa sechs Metern Entfernung sehe ich, dass es ein Junge ist, acht oder neun Jahre alt. Wieder schöpfe ich Hoffnung, als ich sein Stöhnen höre, mitleiderregende Laute, die mich schmerzen, doch mir gleichzeitig auch Mut machen, weil er noch lebt.
Ich knie mich neben den Jungen, der auf der Seite liegt, den linken Arm furchtbar verdreht über dem Kopf. Ausgekugelte Schulter, denke ich, vielleicht ist auch der Arm gebrochen. Das ist nicht lebensbedrohlich, meistens sind es ja die unsichtbaren Verletzungen, die am schlimmsten sind.
Er hat die Augen offen, die gebogenen Wimpern zucken beim Blinzeln auf und ab. Sein Hals und die Vorderseite seiner Jacke sind voller Blut wie auch das Gesicht, doch ich kann keine Wunde sehen.
Vorsichtig streichele ich mit den Fingerspitzen über seine Hand, hoffe, dass die Berührung ihn tröstet. »Schätzchen, kannst du mich hören?«
Er stöhnt, atmet angestrengt, hyperventiliert. Seine Hand zuckt bei der Berührung, und er schreit auf.
»Bleib ganz ruhig liegen«, sage ich. »Ihr hattet einen Unfall, aber du bist bald wieder gesund.« Ich versuche, mich in ihn hineinzuversetzen, will Worte finden, die ihn trösten. »Ich heiße Katie und bin hier, um dir zu helfen. Deinem Datt geht es gut, der Doktor ist schon auf dem Weg. Aber du darfst dich nicht bewegen.«
Ein Beben geht durch seinen kleinen Körper, er stößt einen Laut hervor, und aus seinem Mundwinkel läuft Blut. Ich höre ein Gluckern in seiner Brust und schließe fest die Augen, muss mich zusammenreißen.
Wag es ja nicht, auch diesen Kleinen noch zu holen, blafft eine kleine Stimme in meinem Kopf.
Das Bedürfnis, ihn vom Zaun wegzugziehen und in die Arme zu schließen, ist riesengroß. Doch man darf Unfallopfer nicht bewegen. Wenn er eine Kopf- oder Rückgratverletzung hat, könnte jede Veränderung der Körperlage noch mehr Schaden anrichten. Oder ihn umbringen.
Der Junge starrt geradeaus, blinzelt. Sein Atem geht immer noch schwer, seine Brust rasselt. Er bewegt sich nicht, versucht nicht, mich anzusehen. »… Sampson …«, flüstert er.
Ich weiß nicht, wer das ist, bin nicht einmal sicher, ihn richtig verstanden zu haben oder ob er bei Bewusstsein ist und weiß, was er sagt. Doch das ist alles egal. Ich streiche mit dem Daumen sanft über seine Hand. »Psst.« Ich beuge mich zu ihm hinab. »Nicht sprechen.«
Er bewegt leicht den Kopf, sucht meinen Blick. Seine Augen sind grau. Wie Matties, wird mir klar. Doch die Angst und Pein, die ich darin sehe, sollte kein Kind ertragen müssen. Tränen rollen über seine Wangen, die Lippen zittern. »Tut weh …«
»Alles wird gut.« Ich will Optimismus ausstrahlen, doch mein Gesicht ist wie aus Gips.
Ein vages Lächeln umspielt seinen Mund, dann erschlafft sein Gesicht, sein Körper. Die Augen sehen ins Leere.
»He, du.« Ich drücke seine Hand, er darf nicht ohnmächtig werden. »Halt durch, Kleiner.«
Er reagiert nicht.
Das Sirenengeheul ist jetzt ganz nahe, und ich höre den knatternden Dieselmotor eines Feuerwehrautos. Weitere Wagen kommen mit quietschenden Reifen auf dem nassen Asphalt zum Stehen, und schon beim Aussteigen rufen sich die Ersthelfer Anweisungen zu.
»Hier drüben!«, schreie ich. »Ein verletztes Kind!«
Ich bleibe bei dem Jungen, bis ein Rettungssanitäter hinter mich tritt. »Wir übernehmen ab hier, Chief.«
Er ist ungefähr in meinem Alter, hat einen Bürstenschnitt und trägt die blaue Jacke des Holmes-County-Rettungsteams. An seiner Schulter hängt eine Erste-Hilfe-Tasche, unter seinem Arm klemmt eine Halskrause, und insgesamt macht er einen kompetenten, gut ausgebildeten Eindruck.
»Bis vor einer Minute war er noch bei Bewusstsein«, informiere ich ihn.
»Wir werden gut für ihn sorgen, Chief.«
Ich stehe auf und trete zurück, mache Platz.
Er kniet neben dem Jungen. »Ich brauche hier eine Schaufeltrage«, ruft er über die Schulter zurück.
Ein zweiter Sanitäter kommt mit einer reflektierenden Rettungsdecke auf die andere Seite des Jungen, ein dritter stapft mit einer hellgelben Schaufeltrage durch den Straßengraben.
Ich lasse sie ihre Arbeit tun, drehe mich um und drücke auf mein Ansteckmikro. »Jodie, können Sie den Coroner benachrichtigen?«
»Roger.«
Ich blicke hinüber zu Paul Borntrager, dessen Gesicht ich nicht sehen kann, aber bewegen tut er sich nicht. Ein Feuerwehrmann kniet neben ihm.
Überall wimmelt es jetzt von Feuerwehrleuten und Sanitätern, die sich um die Verletzten kümmern und die Umgebung nach weiteren Opfern absuchen. Jeder Streife fahrende Polizist weiß inzwischen, dass Fahrzeuginsassen ohne angelegten Sicherheitsgurt – was bei Buggys immer der Fall ist – sehr weit aus einem Fahrzeug geschleudert werden können, besonders wenn hohe Geschwindigkeit im Spiel ist. Zu Beginn meiner Polizeilaufbahn in Columbus hatte ich mit einem Unfall zu tun, bei dem ein Sattelschlepper von der Straße abgekommen und kopfüber in eine dreißig Meter tiefe Schlucht gestürzt war. Der Fahrer, der seinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, überlebte schwer verletzt. Seine Frau war nicht angeschnallt und wurde über fünfzig Meter weiter weg gefunden, nach fast zwanzig Minuten Suche. Hätten wir sie früher entdeckt, hätte sie vielleicht überlebt, erzählte mir der Coroner hinterher. Niemand sprach je wieder über diesen Unfall, doch ich werde die Lektion daraus nie vergessen.
Ich suche systematisch die Umgebung nach weiteren Verletzten ab, aber finde keine mehr.
Schließlich mache ich mich auf den Weg zurück zu Paul, der inzwischen auf eine Tragbahre geschnallt auf den Abtransport wartet. Eine blaue Plane ist über ihm ausgebreitet, auf die der Regen fällt. Er ist tot.
Ich bin zutiefst geschockt, auch wenn ich weder mit Paul noch mit Mattie seit Jahren gesprochen habe. Ich verspüre eine immense Wut auf den Fahrer, der das zu verantworten hat. Und Kummer, weil Paul tot ist und Mattie die Nachricht überbracht werden muss, sehr wahrscheinlich von mir.
»O Mattie«, flüstere ich. Vor langer Zeit einmal waren wir unzertrennlich gewesen – wir waren mehr Schwestern als Freundinnen. Wir haben uns von unserem ersten Schwarm erzählt, von unserem ersten Liebeskummer und wie wir das erste Mal etwas stibitzt hatten. Mattie war für mich da, als ich im Alter von vierzehn Jahren zum ersten Mal im Leben mit Gewalt in Berührung kam, in Gestalt eines amischen Mannes namens Daniel Lapp. An jenem Sommertag veränderte sich mein Leben unwiderruflich, doch unsere Freundschaft blieb davon unbeschadet. Als ich dann mit achtzehn Jahren entschied, das schlichte Leben aufzugeben und aus Painters Mill wegzugehen, gehörte Mattie zu den wenigen, die mich unterstützten, obwohl sie wusste, dass es das Ende unserer Freundschaft bedeutete.
Danach verloren wir uns aus den Augen. Wir schlugen unterschiedliche Lebenswege ein – ich machte eine Ausbildung und wurde Polizistin, Mattie trat der Glaubensgemeinschaft bei, heiratete Paul und gründete eine Familie. Schließlich bin ich als Polizeichefin nach Painters Mill zurückgekehrt, aber unsere Freundschaft haben wir nicht erneuert, winken uns höchstens gelegentlich freundlich auf der Straße zu. Doch jene prägenden Jahre mit den scheinbar endlosen Sommern, als die Zukunft so vielversprechend vor uns lag und wir noch Träume hatten, habe ich nie vergessen.
Aber für eine von uns sind heute Nacht alle Zukunftsträume zerstört worden. Ich gehe hinüber zu Andy Welbaums Pick-up, einem alten Dodge mit Rostflecken auf der Kühlerhaube und einer Delle am hinteren Kotflügel. Erst jetzt, als ich mir den Schaden am Wagen ansehe, wird mir klar, dass Andy nicht in den Unfall verwickelt war.
Andy Welbaum lehnt an der vorderen Stoßstange eines Krankenwagens von Holmes County. Jemand hat ihm einen Regenschutz gegeben, doch unter der gelben Plastikhaut zittert er wie Espenlaub.
Als ich auf ihn zugehe, hebt er den Kopf und sieht mich an. Er ist etwa vierzig Jahre alt, hat fast keine Haare mehr und pflaumengroße dunkle Ränder unter den traurigen Augen. »Wird das Kind überleben?«, fragt er.
»Ich weiß es nicht«, antworte ich schroff, dann hole ich tief Luft, um meine Gefühle in den Griff zu kriegen. »Was ist passiert?«
»Ich bin wie immer um diese Zeit von der Arbeit gekommen und hab das Tempo gedrosselt, um auf die Landstraße abzubiegen, als ich das ganze zersplitterte Holz und die anderen Sachen über die Straße verstreut sah. Ich bin ausgestiegen, um zu sehen, was los ist …« Kopfschüttelnd blickt er hinab auf seine Füße. »Chief Burkholder, ich schwöre bei Gott, so was hab ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. All die Kinder, verdammt nochmal.« Er sieht aus, als würde er gleich wieder anfangen zu weinen. »Arme Familie.«
»Dann waren Sie also nicht in den Unfall verwickelt?«
»Nein, Ma’am. Der war schon passiert, als ich kam.«
»Haben Sie noch irgendetwas davon mitgekriegt?«
»Nein.« Er verzieht das Gesicht. »Es muss aber gerade vorher passiert sein, ich schwör’s, da ist noch Staub rumgeflogen.«
»Haben Sie irgendein anderes Fahrzeug gesehen?«
»Nein«, stößt er aufgebracht aus. »Der Fahrer ist abgehauen.«
»Was ist danach passiert?«
»Ich hab die 911 angerufen und dann geguckt, ob ich jemandem helfen kann. Ich war ja Sanitäter in der Armee.« Er verstummt, sieht wieder auf den Boden. »Aber da war nichts zu machen.«
Ich nicke, kann mich kaum beherrschen. Jemand hat drei Menschen umgebracht – darunter zwei Kinder – und einen Jungen schwer verletzt und ist einfach weitergefahren, ohne zu helfen oder zumindest Hilfe zu holen.
»Tut mir leid, dass ich so barsch war«, sage ich.
»Schon gut. Mir ist schleierhaft, wie ihr Cops tagtäglich mit so was klarkommt. Hoffentlich finden Sie den Mistkerl, der das gemacht hat.«
»Ich muss Ihre Aussage aufnehmen. Können Sie noch einen Moment bleiben?«
»Sicher, solange Sie mich brauchen.«
Als ich mich von ihm abwende, hält gerade ein Streifenwagen vom Holmes County-Sheriffbüro mit rotierendem Blaulicht am Fahrbahnrand. Gleichzeitig fährt ein Notarztwagen mit dem einzigen Überlebenden zum Krankenhaus. Später werden sich der Coroner und seine Mitarbeiter um die Toten kümmern.
Ich steige über ein großes Stück Holz vom Buggy hinweg, dessen schwarzer Anstrich sich scharf von dem blassen Gelb der Bruchstelle abhebt. Ein paar Meter weiter liegt ein Mädchenschuh, unweit davon entfernt eine Wolldecke. Und eine Brille.
Wahrscheinlich wird der Fall in den Zuständigkeitsbereich des Sheriffbüros von Holmes County fallen, doch ich möchte unbedingt bei den Untersuchungen dabei sein. Für Rasmussen ist das sicher kein Problem, denn zum einen ist meine amische Herkunft ein Plus, zum anderen ist seine Dienststelle – genauso wie meine – unterbesetzt, und er wird für jede Hilfe dankbar sein.
Da der verletzte Junge abtransportiert worden ist, müssen als Nächstes alle Beweise gesichert und dokumentiert werden. Dazu brauchen wir einen Generator und Arbeitsleuchten, und dann muss ein Deputy kommen, der für die Rekonstruktion von Unfällen ausgebildet ist. Wenn das Sheriffbüro selbst keinen hat, muss einer von der State Highway Patrol angefordert werden.
Ich denke an Mattie Borntrager, die zu Hause auf ihren Mann und ihre Kinder wartet, und ich weiß, dass ich so schnell wie möglich zu ihr muss.
Doch zuvor brauche ich von den Sanitätern noch Informationen über den Zustand des verletzten Jungen. Ich will gerade losgehen, als jemand meinen Namen ruft, ich drehe mich um und sehe Rupert »Glock« Maddox, einen meiner Officer, auf mich zulaufen. »Ich bin so schnell wie möglich gekommen«, sagt er. »Was ist hier passiert?«
Ich sage ihm das wenige, was ich weiß. »Der Fahrer ist flüchtig.«
»Scheiße.« Er blickt zum Krankenwagen. »Gibt es Überlebende?«
»Ein kleiner Junge«, antworte ich. »Acht oder neun Jahre alt.«
»Wird er’s schaffen?«
»Keine Ahnung.«
Unsere Blicke treffen sich, und wir denken wohl beide dasselbe. Als Gesetzeshüter in einer Kleinstadt will man die Einwohner, die man zu beschützen geschworen hat, vor Unheil bewahren, besonders die unschuldigen Kinder. So etwas wie das hier nimmt man persönlich. Ich kenne Glock lange genug, um zu wissen, dass er genauso empfindet.
Wir gehen zur Kreuzung, um eine Vorstellung vom Unfallhergang zu bekommen. Die Delisle Road verläuft in Nord-Süd-Richtung, die County Road 14 von Osten nach Westen, mit jeweils einem Stoppschild an allen vier Seiten. Fünfundfünfzig Meilen Höchstgeschwindigkeit. Die Gegend ist waldreich und hügelig, und aus welcher Richtung man sich der Kreuzung auch nähert, man kann unmöglich den nahenden Verkehr sehen.
Glock spricht zuerst. »Sieht aus, als wäre der Buggy auf der Delisle Road Richtung Süden gefahren.«
Ich nicke zustimmend. »Das zweite Fahrzeug war auf der County Road 14 Richtung Osten unterwegs, wahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Hat das Stoppschild überfahren und ist voll in den Buggy geknallt.«
Er sieht zur Kreuzung. »Hat ihn richtiggehend aufgespießt.«
»Und nicht einmal angehalten, um die 911 anzurufen.«
»Wahrscheinlich ist Alkohol im Spiel.«
»Wie meistens bei Fahrerflucht.«
Er deutet mit dem Kopf zu Andy Welbaum. »Hat er den Unfall gesehen?«
»Er war als Erster hier und ist ziemlich fertig.« Ich blicke an ihm vorbei zu dem zerstörten Buggy. »Auf jeden Fall muss das Fahrzeug, das den Buggy aufgespießt hat, vorne eingedrückt sein. Ich gebe eine Suchmeldung nach einem unbekannten Fahrzeug mit beschädigter Vorderfront raus.«
Er sieht zu dem Trümmerfeld. »Haben Sie sie gekannt, Chief?«
»Vor langer Zeit einmal. Ich hole jetzt den Bischof und fahre mit ihm zur Farm, um die Angehörigen zu benachrichtigen. Nehmen Sie Welbaums Aussage auf?«
»Mach ich.« Ich spüre seinen Blick auf mir, doch ich sehe ihn nicht an, will meine Gefühle angesichts des Unglücks, das der amischen Familie widerfahren ist, nicht zeigen.
Er blickt wieder weg, lässt es gut sein. »Dann mache ich mich mal an die Arbeit.« Er klopft sich aufs Ansteckmikro. »Rufen Sie an, wenn Sie was brauchen.«
Ich nicke geistesabwesend, wende mich wieder dem Tatort zu, dem zerstörten Buggy und den Überbleibseln aus dem Leben der Opfer, die wie Abfall auf der Straße verstreut sind. Und ich frage mich nicht zum ersten Mal, was für ein Mensch das sein muss, der so etwas verursacht und nicht einmal anhält, um zu helfen oder Hilfe zu rufen.
»Pass nur auf, du Scheißkerl, dich werde ich kriegen.«
2. Kapitel
Mit zu den schwersten Aufgaben einer Polizeichefin gehört die Benachrichtigung der Angehörigen, wenn jemand umgekommen ist. Dieser Pflicht musste ich während meiner Dienstzeit schon mehrere Male nachkommen, und ich glaube, dass mich die Erfahrung mitfühlender oder geschickter beim Überbringen so einer vernichtenden Nachricht gemacht hat. Doch ich ahne jetzt schon, dass mir meine ganze Erfahrung in diesem Fall nicht viel helfen wird.
Als ich die lange unbefestigte Straße zu Bischof Troyers Farm entlangpresche, durchschneiden meine Scheinwerfer die Dunkelheit. Im Haus brennt kein Licht, wahrscheinlich schlafen der Bischof und seine Frau schon seit Stunden, obwohl es noch nicht einmal einundzwanzig Uhr ist. Ich parke neben einem baufälligen Schuppen, nehme meine Taschenlampe und gehe zur Hintertür. Die Schlafzimmer befinden sich im ersten Stock, und die Troyers sind auch nicht mehr die Jüngsten, weshalb ich die Fliegentür aufziehe und mit der Taschenlampe laut an die Tür klopfe.
Es dauert ein paar Minuten, bis sich im Haus etwas rührt. Dann geht die Tür auf, der Bischof hält mir eine Laterne vors Gesicht und sieht mich aus zusammengekniffenen Augen an. »Katie Burkholder?«
Ich kenne Bischof Troyer schon seit meiner Kindheit. Als Teenager fand ich ihn ungerecht und kleinlich, denn er hatte mich auf dem Kieker, weil ich anders war – und anders zu sein ist bei den Amischen niemals gut. Ganz egal wie klein mein Vergehen war, er übte keine Nachsicht, und mehr als einmal bestrafte er mich extrem hart, wenn ich eine Regel gebrochen hatte. Jetzt, wo ich älter bin, empfinde ich ihn als liebenswürdig und gerecht, Eigenschaften, die er aus Überzeugung zu vereinbaren sucht, besonders hinsichtlich der Regeln der Ordnung oder dem ungeschriebenen Gesetz der Kirchengemeinde. Trotzdem sind wir auch schon aneinandergeraten, seit ich hier Polizeichefin bin. Er missbilligt meinen Entschluss, dass ich die Gemeinde verlassen habe, er kritisiert meinen Lebensstil und einige der Entscheidungen, die ich getroffen habe. Doch auch wenn er nicht zögert, sein Missfallen offen auszudrücken, kann ich jederzeit auf seine bedingungslose Hilfe zählen, sollte ich jemals in einer Krise stecken.
Aber heute Abend wird Mattie Borntrager seinen Glauben und seine Unterstützung brauchen, um die nächsten Stunden durchzustehen. Und auch für sie wird er da sein.
»Was der schinner is letz?«, fragt er mit krächzender Stimme. Was ist denn los?
Ich starre ihn einen Moment lang an, versuche meine Gedanken zu ordnen und in Worte zu fassen – dass wir sofort zur Farm der Borntragers fahren und Mattie die Nachricht überbringen müssen, bevor sie es von jemand anderem erfährt. Dass ich zurück zum Unfallort fahren und mit den Ermittlungen anfangen muss, die vermutlich lang und aufreibend sein werden. Doch es geschieht etwas, das mir in den vergangenen Jahren noch nie passiert ist: Ich breche in Tränen aus.
»Katie?«
Ich versuche noch, den ersten Schluchzer als Hustenanfall zu kaschieren, und räuspere mich lautstark, doch die nachfolgenden Tränen verraten mich.
Entsetzen breitet sich auf Bischof Troyers Gesicht aus, gefolgt von tiefer Sorge. »Komm herein.«
Abwehrend hebe ich beide Hände, bin wütend auf mich selbst, dass ich in so einem Moment die Fassung verliere. Hier geht es nicht um mich und meine Gefühle, ermahne ich mich, sondern um eine junge Mutter, deren Welt gleich zerbrechen wird. »Paul Borntrager und zwei seiner Kinder sind heute Abend umgekommen«, sage ich.
»Paul?« Er drückt die Hand auf die Brust und macht einen Schritt zurück, wie von einer unsichtbaren Kraft gestoßen. »Die Kinder? Wie?«
Ich berichte ihm schnell von dem Buggy-Unfall. »Mattie weiß es noch nicht, Bischof. Ich muss es ihr sagen und dachte, es wäre gut, wenn Sie dabei sind.«
»Ja, natürlich.« Offensichtlich erschüttert, sieht er auf das lange Flanellhemd, das er trägt. »Ich muss mich anziehen.« Doch er macht keine Anstalten zu gehen. »Welches Kind hat überlebt?«
»Ein Junge. Das älteste Kind, glaube ich.«
»David.« Er nickt. »Mein Gott. Ist er in Ordnung?«
»Ich weiß es nicht. Sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht.« Mit dem Jackenärmel wische ich mir die Tränen ab.
Er drückt meinen Arm. »Katie, vergiss nicht, dass Gott immer einen Plan hat. Es steht uns nicht zu, das zu hinterfragen, wir müssen es akzeptieren.«
Seine Worte sollen mich trösten, doch das tun sie nicht. Alles hinzunehmen gehört zu jenen Glaubenssätzen der Amischen, die ich damals wie heute vehement ablehne. Vielleicht weil meine eigene Philosophie so grundlegend anders ist. Ich weigere mich, den Tod von drei unschuldigen Menschen als Teil eines göttlichen Plans zu akzeptieren. Und dem Scheißkerl, der das zu verantworten hat, werde ich ganz bestimmt nicht vergeben.
Zehn Minuten später sind Bischof Troyer und ich in meinem Explorer auf dem Weg zur Farm der Borntragers. Die Angst sitzt mir im Nacken, eine dunkle Präsenz, deren eiskalten Atem ich spüre.
Zuvor hatte Glock angerufen und gesagt, dass einer von Sheriff Rasmussens Deputys eine Spezialausbildung zur Rekonstruktion von Unfallhergängen hat, was extrem hilfreich ist. Zudem können wir so die Ermittlungen auf zwei Behörden beschränken, das Holmes County-Sheriffbüro und meine Polizeidienststelle in Painters Mill. Rangeleien um irgendwelche Zuständigkeiten sind nicht mein Ding. Wenn eine andere Behörde die Mittel zur Verfügung hat, die ich brauche, bin ich die Erste, die um Hilfe bittet. Doch bei diesem Fall bin ich erleichtert, nicht auf Unterstützung von außen angewiesen zu sein.
Die unbefestigte Straße zur Farm der Borntragers endet an einem Waldstück, an dessen Rückseite der Painters Creek verläuft. Weder der Bischof noch ich reden, als das Haus in Sicht kommt. Es ist jetzt fast einundzwanzig Uhr dreißig, Paul und die Kinder hätten schon vor Stunden zurückkommen müssen. Mattie ist bestimmt krank vor Sorge.
Als ich auf den Hof einbiege, sehe ich auf der Rückseite des Hauses im Küchenfenster den gelben Schein der Laterne. Wahrscheinlich wandert Mattie unruhig umher und fragt sich, wo ihre Familie bleibt und ob sie zum Nachbarn gehen und deren Telefon benutzen soll. Gleich werden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr, und ich hasse es, ihr das antun zu müssen.
Beim Parken streifen meine Scheinwerfer über den durchhängenden Drahtzaun eines Hühnerstalls. Vom Licht aufgeschreckt, flattern zwei Zwerghühner von ihrer Stange, gackern vor Empörung.
»Wie heißen Matties Kinder, und wie alt sind sie?« Ich stelle den Motor aus, sehe den Bischof nicht an.
»David ist acht«, antwortet er. »Samuel war der Jüngste, ungefähr vier, glaube ich. Norah ist gerade sechs geworden.«
Ich nehme die MagLite, stoße meine Tür auf und steige aus dem Wagen. Als ich das Auto umrunde, um dem Bischof beim Aussteigen zu helfen, höre ich die Fliegentür zuschlagen. Ich sehe zum Haus, wo Mattie Borntrager mit wehendem Rock und einer Laterne in der Hand die Treppe hinuntereilt. »Hallo?«, ruft sie. »Paul? Bist du das? Wer ist da?«
Den Schein der Lampe auf den Boden gerichtet, gehe ich ihr entgegen. »Mattie, wir sind es, Kate Burkholder und Bischof Troyer.«
»Was? Aber warum …« Abrupt bleibt sie wenige Meter vor mir stehen. Ihr Blick wandert zum Bischof und wieder zurück zu mir. »Katie?« Sie klingt alarmiert. Selbst im düsteren Licht der Laterne sehe ich die Verwirrung in ihrem Gesicht. »Ich dachte, es ist Paul«, sagt sie. »Er ist mit den Kindern in die Stadt gefahren, sie sollten schon lange wieder zu Hause sein.«
Sie ist vollständig angezogen mit gemustertem Kleid, Kapp und Sneakers. Wahrscheinlich wollte sie gerade das Haus verlassen, vielleicht um zu telefonieren.
Als ich nichts sage, versteinert ihr Gesicht, und ihr Blick verrät Misstrauen und Angst, weil anstatt ihres Mannes und ihrer Kinder der Bischof und ich vor ihr stehen. Ich bin maßlos erleichtert, dass Bischof Troyer bei mir ist, weil ich es allein vielleicht nicht schaffen und alles noch schlimmer machen würde.
»Warum bist du hier?« Jetzt steht Panik in ihrem Gesicht, und einen Moment lang glaube ich, dass sie gleich die Laterne auf den Boden wirft, zurück ins Haus läuft und die Tür verriegelt. »Wo ist Paul? Wo sind meine Kinder?«
»Sie hatten einen Unfall«, sage ich. »Es tut mir leid, Mattie, aber Paul und zwei der Kinder sind tot. David hat überlebt.«
»Was? Was?« Halb Schrei, halb Schluchzer, kommen die Worte aus ihrem Mund, hallen wie das Heulen eines tödlich verwundeten Tieres wider. »Nein. Das ist nicht wahr. Unmöglich. Sie sind nur in die Stadt gefahren. Sie kommen bald nach Hause.« Flehentlich blickt sie den Bischof an, dass er meine Worte Lügen straft. »Ich verstehe nicht, warum sie so etwas sagt.« Der alte Mann legt ihr die Hand auf die Schulter. »Es ist wahr, Mattie. Sie sind jetzt bei Gott.«
»Nein!« Sie wirbelt so schnell herum, dass die Flamme in der Laterne heftig flackert. »Das würde Gott nie tun! Er würde sie nicht zu sich holen!«
»Manchmal tut Gott Dinge, die wir nicht verstehen«, sagt der Bischof leise. »Wir sind Amische. Wir akzeptieren das.«
»Ich akzeptiere das nicht.« Sie macht einen Schritt zurück, doch der alte Mann folgt ihr, behält Körperkontakt.
Ich nehme ihr vorsichtig die Laterne aus der Hand. »David ist im Krankenhaus«, sage ich. »Er braucht –«
Bevor ich zu Ende sprechen kann, geben ihre Beine nach, und sie sinkt auf die Knie. Ich will ihr wieder aufhelfen, auch der Bischof versucht es, doch Mattie wehrt uns ab, beugt sich vornüber und rollt sich wie ein Embryo zusammen. »Neeeiiin!« Sie gräbt ihre Hände ins Gras, reißt ganze Büschel heraus. »Neeeiiin!«
Ich lasse ihr Zeit, sehe zum Bischof. Die Entschlossenheit und Stärke in seinem faltigen Gesicht machen mir Mut, und nicht zum ersten Mal wird mir klar, warum dieser Mann das Oberhaupt der Kirchengemeinde ist. Selbst angesichts dieser unfassbaren Tragödie ist sein Glaube unerschütterlich.
Der Bischof kniet neben Mattie und legt ihr wieder die Hand auf die Schulter. »Das ist eine schwere Last für dich, mein Kind, aber David braucht dich jetzt.«
»David! Mein süßer, lieber Junge«, stößt sie hervor, richtet sich auf und wischt die Tränen von den Wangen. »Wo ist er? Ist er verletzt? Ich muss zu ihm, bitte.«
Ich helfe ihr zusammen mit dem Bischof vorsichtig auf die Füße. Sie schwankt, und ich halte sie fest im Arm, spüre ihr Zittern und wünschte, ich könnte ihren Schmerz lindern und ihr etwas von ihrer Last abnehmen. »Er ist im Krankenhaus. Ich fahre dich hin.«
Sie weint lautlos, wischt sich die Tränen mit zitternder Hand weg, doch es ist nutzlos bei diesem unablässigen Strom. Langsam und zögerlich gehen wir zum Haus, ich lasse sie vor der Treppe los, gehe hoch und mache die Fliegentür auf. Der Bischof hilft ihr hinein. Wir durchqueren den Vorraum, wo eine alte Wäschemangel Zeuge unserer traurigen Prozession wird, und erreichen die Küche. Eine einzige Laterne brennt auf einem großen rechteckigen Tisch mit blauweiß karierter Tischdecke und zwei Bänken links und rechts. Beim Anblick des Tisches muss ich an all die gemeinsamen Mahlzeiten denken, die hier nie wieder stattfinden werden.
Während Bischof Troyer Mattie auf einen Stuhl hilft, gehe ich zur Spüle und fülle Leitungswasser in ein Glas. Sie akzeptiert es wortlos, als hätte sie sich in eine Art Trance geflüchtet, trinkt einen Schluck und sieht mich dann an. »Wie geht es David?«
»Ich weiß es nicht«, antworte ich ehrlich.
»Ich muss zu ihm.« Sie steht auf und sieht sich in der Küche um wie an einem fremden Ort, als wüsste sie nicht, was sie als Nächstes tun soll. »Paul würde jetzt wissen, was zu tun ist.«
Ich trete neben sie und umfasse sanft ihren Arm. »Wir sind hier«, sage ich. »Wir helfen dir.«
Bischof Troyer löscht die Kerze, und wir gehen zur Tür.
Als Mattie, der Bischof und ich in der Notaufnahme des Pomerene Hospital in Millersburg eintreffen, erfahren wir, dass David sofort nach der Einlieferung in den Operationssaal gebracht worden ist. Die meisten Krankenhäuser würden ohne die Zustimmung der Eltern keine Operationen an einem minderjährigen Patienten durchführen, es sei denn, es ginge um Leben und Tod. Was bedeutet, dass Davids Verletzungen lebensgefährlich sind. Doch das behalte ich für mich.
Den Weg zum Aufzug in den zweiten Stock schafft Mattie nur mit Mühe. Neugierige Blicke folgen uns in den Wartebereich vor den Operationssälen, und wieder einmal stelle ich erstaunt fest, dass es in diesem Teil von Ohio anscheinend immer noch Menschen gibt, die noch nie Amische gesehen haben.
Erst im hellen Neonlicht des Warteraums vor der Tür zu den Operationssälen wird mir bewusst, dass die Blicke nicht dem Bischof gelten, sondern Mattie, und es hat nichts damit zu tun, dass sie eine Amische ist. Sondern mit der Tatsache, dass sie wunderschön ist.
Doch das war Mattie schon immer. In unseren Teenagerjahren waren die Jungen der Glaubensgemeinde so von ihrer Schönheit fasziniert, dass sie in ihrer Rumspringa keine Mühe scheuten, »zufällig« mit ihr zusammenzutreffen. Mattie tat immer so, als merke sie es nicht, was natürlich doch der Fall war, und ich bemerkte es auch. Verglichen mit ihr habe ich eher gewöhnlich ausgesehen, war ein schlaksiger Wildfang und dazu noch eine Spätentwicklerin. Ich habe Mattie ihre Schönheit wirklich gegönnt, wäre allerdings auch gern schön gewesen und habe sie heimlich beneidet. Und versucht, so zu lachen wie sie, so zu reden, sogar so wie sie die Kapp zu tragen, mit baumelnden Bändern auf dem Rücken. Eigentlich haben Amische kaum Möglichkeiten, ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen, besonders hinsichtlich der Kleidung. Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, gerade auch für Mädchen im Teenageralter, die fest entschlossen sind, ihre eigene Identität zu finden; und wir waren ziemlich kreativ darin, unsere Individualität auszudrücken.
Mattie hat drei Kinder geboren, doch sie ist immer noch schlank und rank, und obwohl sie viel in der Sonne arbeitet, hat sie eine makellose helle Haut mit nur leicht gebräunten Wangen. Das ungewöhnliche Grau ihrer Augen wird unterstrichen von langen, seidigen Wimpern. Sie ist schön ohne jede Kosmetik.
Sie geht weder in ein Fitnessstudio, noch lässt sie sich die Haare bei einem angesagten Friseur färben. Ihre Kleider sind selbstgemacht und die Schuhe bei Wal-Mart in Millersburg gekauft. Doch wenn Mattie Borntrager einen Raum betritt, halten die Leute mit ihrer Beschäftigung inne und sehen sie an. Es ist, als würde sie von innen heraus leuchten, ein Licht, das nicht einmal von unvorstellbarem Kummer gelöscht werden kann.
Ich hole zwei Kaffee aus dem Automaten und bringe sie Mattie und dem Bischof, die auf dem Sofa im Warteraum sitzen. Im Fernseher an der Wand läuft eine Sitcom, die ich noch nie gesehen habe. Er ist viel zu laut eingestellt, doch die beiden scheinen das nicht zu bemerken.
»Ich versuche, ein paar Informationen zu bekommen«, sage ich.
Im Schwesternzimmer erfahre ich, dass Davids Zustand als kritisch eingestuft und er sofort operiert wurde, als sein Blutdruck abfiel. Der Arzt befürchtete, dass er innere Blutungen hätte – an einem Organ, oder vielleicht war eine Ader geplatzt –, und wollte keinesfalls warten.
Ich gehe zurück in den Warteraum und überbringe Mattie die Nachricht. Sie schließt die Augen, beugt sich vornüber und neigt den Kopf, die Ellbogen auf den Knien. Ihre Lippen bewegen sich, und ich weiß, dass sie betet. Bei den Amischen ist Kummer Privatsache. Sie nehmen Schicksalsschläge in der Regel stoisch hin, ihr Glaube gibt ihnen großen Halt. Doch da sie auch nur Menschen sind und manche Emotionen einfach zu gewaltig, hilft selbst ein unerschütterlicher Glaube nicht immer.
Auf Pennsylvaniadeutsch fragt mich Mattie, ob es sich um ein Missverständnis handeln könnte. Ob die Englischen mir vielleicht die falschen Informationen gegeben hätten. Sie fragt, ob vielleicht Gott einen Fehler gemacht hat. Ich antworte ihr nicht, und der Bischof weicht meinem Blick aus, als er ihr versichert, dass Gott keine Fehler macht, es ihr nicht zusteht, Ihn zu hinterfragen, und dass sie Seinen Willen akzeptieren muss.
Bischof Troyer weiß, was ich von dem Dogma, alles zu akzeptieren, halte. Als ich noch eine Amische war und vom Schicksal ungerecht behandelt wurde, habe ich mit Wut darauf reagiert. Das ist auch heute noch so. Die Unfähigkeit, alles fraglos zu akzeptieren, war einer der vielen Gründe, warum ich nicht dazugepasst habe. Für Mattie ist das vollkommen anders. Auch wenn wir beide auf gleiche Weise erzogen wurden, so haben wir meistens in sehr unterschiedlichen Welten gelebt. Doch angesichts der Geschehnisse am heutigen Abend würde ich es verstehen, wenn sie mit dem unfairen Schicksal haderte oder Gott beschimpfte, dass er das zugelassen hat. Natürlich tut sie nichts dergleichen.
Ich habe ihr noch nicht gesagt, dass der Fahrer des anderen Wagens geflohen ist, aber sobald ich mehr Informationen habe, werde ich es tun – hoffentlich bevor die halbe Stadt es weiß oder Gerüchte kursieren. Doch momentan sehe ich keinen Sinn darin, ihr noch mehr Kummer zu bereiten.
Als ich nach einer Weile beschließe, sie allein zu lassen und zu gehen, ist Mattie wieder in Schweigen versunken. Sie sitzt mit gesenktem Kopf neben Bischof Troyer, das Taschentuch in den Händen fest umklammert, als würde sie sich damit am Leben festhalten.
Auf dem Weg aus der Notaufnahme zum Explorer spüre ich, wie sehr mich meine Verbindung zu Mattie belastet. Es ist nie gut, wenn man als Polizist eine persönliche Beziehung zu dem Fall hat, an dem man arbeitet. Gefühle trüben die Wahrnehmung und das Urteilsvermögen und haben in der Polizeiarbeit nichts zu suchen. Doch als Polizeichefin einer Kleinstadt, wo fast jeder jeden kennt, kann ich mir nicht den Luxus erlauben, die Verantwortung jemand anderem zu übertragen.
Obwohl ich mir schwöre, meine Arbeit von der lange zurückliegenden Freundschaft mit Mattie nicht beeinflussen zu lassen, weiß ich doch, dass meine Loyalität und meine Vergangenheit, der ich niemals entkommen konnte, mich angreifbar machen.
3. Kapitel
Das Haus war wirklich nichts Besonderes, genaugenommen hatte er noch nie etwas Unscheinbareres gesehen. Laut seinem Immobilienmakler war es ein »reparaturbedürftiges viktorianisches Unikat, mit Betonung auf reparaturbedürftig«, wobei dieser ihn betreten ansah, als Tomasetti erwiderte: »Wohl eher ein heruntergekommenes Stück Scheiße, mit Betonung auf Scheiße.«
Das knapp zweieinhalb Hektar große Grundstück mit Farmhaus, halbzerfallener Scheune und sturmgeschädigtem Silo lag am Ende eines etwa fünfhundert Meter langen Feldwegs. Neben einem großen Baumbestand gab es auch einen zweitausend Quadratmeter großen See, angeblich mit Welsen und Karpfen. Das Haus selbst hatte vier Zimmer und gerade sein hundertjähriges Jubiläum gefeiert, und im Prospekt sah es ehrwürdig und malerisch aus. Doch dieser Eindruck war bei der Besichtigung vor Ort sofort zerstört worden.
Schneestürme, Hagel und sengende Sonne hatten dem Haus einhundert Jahre lang zugesetzt, ohne dass es jemals renoviert worden war. Die Holzverkleidung war teilweise verrottet, der ehemals weiße Anstrich ein schmutziges Grau. Zudem musste Tomasetti sich schon sehr täuschen, wenn da nicht Wespen aus dem fünf Zentimeter großen Spalt beim Fundament schwärmten. Der Rest der Außenverkleidung, inklusive Gauben, musste abgeschliffen, grundiert und neu gestrichen werden – eine nicht gerade billige Angelegenheit. Von den schönen Holzfensterläden, die früher einmal sämtliche Fenster zierten, lagen bis auf zwei alle auf dem Boden und verrotteten im kniehohen Unkraut. Und die letzten beiden hingen auch nur noch lose in rostigen Angeln, knarrten im Wind und verliehen dem Haus das Aussehen eines gekenterten Schiffs. Die rundherum verlaufende Veranda war sicher einmal ein Blickfang gewesen, doch jetzt hingen die Holzbohlen durch, so dass das Haus zu grinsen schien, wenn man darauf zufuhr. Es war allerdings nicht das herzliche Grinsen eines Patriarchen, der stolz auf seinen Besitz blickt, sondern eher das schiefe, zahnlose eines alten Säufers.
Um ein Haar hätte Tomasetti den Wagen wieder gewendet und wäre umgekehrt, doch irgendwie hatte der Ort trotz allem etwas Reizvolles. Zudem hatte der Immobilienmakler ihn mit den »erstaunlichen Möglichkeiten« des Hauses zugetextet, die »einmalige Investitionsgelegenheit« betont und ihn daran erinnert, dass die Zwangsversteigerung bevorstand und es deshalb zum Spottpreis zu haben war. Und so hatte Tomasetti es sich schließlich auch von innen angesehen.
Im Vergleich zu den meisten Farmhäusern in Ohio war es mit seinen zweihundertsiebzig Quadratmetern klein. Die Schlafzimmer und ein Badezimmer lagen im ersten Stock, der Wohnbereich und ein zweites Badezimmer im Erdgeschoss. Keine schlechte Einteilung, wenn man bedachte, dass es aus der Zeit des Ersten Weltkriegs stammte, als Woodrow Wilson Präsident der Vereinigten Staaten war.
Das Alter zeigte sich auch im Inneren des Gebäudes, doch der Verfall wurde von unerwarteter Originalität und einer Architektur gemildert, die man heute nur noch selten findet. Sämtliche Zimmer hatten schmale, aber hohe Fenster mit handgefertigten Holzrahmen und dadurch viel Tageslicht. Die drei Meter fünfundsechzig hohen Wände krönte am oberen Rand kunstvoller Stuck, und ein großer Rundbogen trennte das Esszimmer vom Wohnbereich. Die Küche war noch »im Urzustand« – für Tomasetti ein Synonym für »muss komplett ersetzt werden«. Als er den verschlissenen olivgrünen Teppichboden anhob, stieß er auf eine Goldmine in Form eines glänzenden Eichenbodens, der offensichtlich noch niemals freigelegen hatte. Für Design oder Farbe hatte er zwar keinen Blick, aber für Potential, und das alte Haus barg jede Menge davon.
Da Tomasetti sich aber grundsätzlich nicht leicht überzeugen ließ und das Haus am Ende als »Schrotthaufen« bezeichnete, hatte der Makler beim Abschied ziemlich deprimiert dreingeschaut. Um das alte heruntergekommene Farmhaus zu vergessen, war er anschließend nach Richfield ins Büro gefahren und hatte sich in die Arbeit gestürzt – auf seinem Schreibtisch lag der Fall einer unbekannten Toten, deren sterbliche Überreste in Cortland, Ohio, gefunden worden waren.