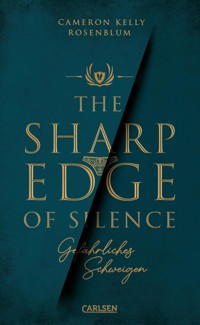
9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Hochaktuell und beklemmend: Ein System aus Macht, Gewalt und Schweigen, das sexuelle Gewalt fördert Lycroft Phelps ist eins der renommiertesten Internate des Landes: Jahrhundertealte Traditionen, efeuberankte Backsteingebäude, Ruderclub. Doch hinter der schönen Fassade herrscht eine toxische Männlichkeitskultur unter den Schüler*innen, die sexuelle Übergriffe begünstigt und verharmlost. Als Außenseiterin Quinn Opfer eines Übergriffs durch einen Elitesportler wird, will sie blutige Rache ... Intensiv und dicht aus drei Perspektiven erzählt! »Ein schonungsloses Buch, das emotional herausfordert und uns viel zu sagen hat.« Kirkus Reviews
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
CAMERON KELLY ROSENBLUM
The Sharp Edge of Silence – Gefährliches Schweigen
P Aus dem Englischen von Katharina Diestelmeier und Anne Brauner O
Lycroft Phelps ist eins der renommiertesten Internate des Landes: Jahrhundertealte Traditionen, efeuberankte Backsteingebäude, Ruderclub. Doch hinter der schönen Fassade herrscht eine toxische Männlichkeitskultur unter den Schüler*innen, die sexuelle Übergriffe begünstigt und verharmlost. Als Außenseiterin Quinn Opfer eines Übergriffs durch einen Elitesportler wird, will sie blutige Rache. Doch als sie stattdessen ihr Schweigen bricht, löst dies unter den Mädchen eine Welle von Solidarität aus. Gemeinsam mit der Hilfe von Top-Schülerin Charlotte und dem schüchternen Max schafft sie es, das System ins Wanken zu bringen.
Intensiv und dicht aus drei Perspektiven erzählt!
»Ein schonungsloses Buch, das emotional herausfordert und uns viel zu sagen hat.«
Kirkus Reviews
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb befindet sich
am Ende des Buches eine Content Note. Achtung, diese enthält Spoiler!
Wir wünschen euch das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer Carlsen Verlag
WOHIN SOLL ES GEHEN?
Buch lesen
Viten
Content Note
Für Mom und Dad,die mich Resilienz lehrten
Ich enthalte Vielheiten.
Walt Whitman
LYCROFT PHELPS SCHOOL
Gegr. 185612 Liberty StreetWhitney, New Hampshire 03026
Dr. Griffin Frye
Rektor
An
Charlotte Tate Foresley
26 Deer Path Rd.
Thornwood, IL 60063
Liebe Charlotte,
es ist mir eine große Ehre, dir einen Platz an der Lycroft Phelps School anzubieten. Ich freue mich, dir als Erster zu deinen hervorragenden Leistungen als Schülerin in der Unterstufe zu gratulieren. Unser Zulassungsausschuss ist extrem wählerisch. Wir vertrauen darauf, dass du dich mit deinem neugierigen Verstand und deiner vorbildlichen Persönlichkeit hier an der Lycroft Phelps erfolgreich entwickelst. Wie so viele andere begabte »Crofter« wirst du Leidenschaften und Ziele für dich entdecken und Freundschaften schließen, die dich ein Leben lang begleiten werden. In der Anlage findest du die Unterlagen für die Einschreibung und den Verhaltenskodex für Schüler, die du bitte mit deiner Familie durchliest, unterschreibst und bis zum 15. April zurücksendest.
Wer wirst du an der Lycroft Phelps sein? In dem angehängten Katalog findest du die große Bandbreite der Sport- und Freizeitangebote. Zusätzlich zu diversen Sportarten (im vergangenen Frühling gewann die Jungenmannschaft die Northeast Prep School Conference!) bieten wir Darstellende Künste, Robotik, einen A-cappella-Chor und eine Start-up-AG an, um nur einige zu nennen. Die Leiterin der Tanzausbildung Celeste Chu freut sich darauf, deine beeindruckende Tanzerfahrung in unsere hauseigene Schule Ballet Northeast zu integrieren und dir zu helfen, dein Talent weiterzuentwickeln.
Seit 1860 ziehen exzellente Lycroft-Phelps-Absolventen von hier weiter an die besten Elite-Colleges und -Universitäten der Vereinigten Staaten. Sie haben auf nationaler und internationaler Ebene bedeutende Beiträge in Kunst, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft geleistet. Du bist auf dem besten Wege dazu, dir einen Namen zu machen, Charlotte Tate Foresley. Herzlichen Glückwunsch!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Griffin Frye, ’Croft ’86
M.A. Williams College
Dr. phil. Columbia University
Dant mentem animumque deducemini – Führe mit Herz und Verstand
LYCROFT PHELPS SCHOOL
Gegr. 185612 Liberty StreetWhitney, New Hampshire 03026
Dr. Griffin Frye
Rektor
An
Maxwell Hannigan-Loeffler
368 W. 67th St.
New York, NY 10023
Lieber Maxwell,
Es ist mir eine große Ehre, dir ein Stipendium der Gründerstiftung der Lycroft Phelps School anzubieten. Herzlichen Glückwunsch! In diesem vierjährigen Stipendium sind sämtliche Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Studiengebühren und schulbezogene Ausgaben vom ersten Schuljahr bis zum Abschluss enthalten. Zurzeit unterrichten wir nur zwei weitere Stipendiaten der Gründerstiftung an unserer Schule. Du hast unseren Zulassungsausschuss mit deinen außergewöhnlichen Fähigkeiten im MINT-Bereich sowie den zahlreichen Auszeichnungen in Mathematik und Naturwissenschaften sehr beeindruckt. Wir sind sicher, dass dir eine beispielhafte Karriere an der Lycroft Phelps und in der weiteren Zukunft bevorsteht, und vertrauen darauf, dass du in unserem neuen Kessler-MINT-Gebäude interessanten Herausforderungen begegnest sowie dich initiativ in der Abteilung einbringst. Eines Tages möchten wir dich in dem Netzwerk hochgradig erfolgreicher Absolventen der Lycroft Phelps sehen.
Wer wirst du an der Lycroft Phelps sein? In dem angehängten Katalog findest du die große Bandbreite der Sport- und Freizeitangebote. Wie so viele andere begabte »Crofter« wirst du auf unserem schönen Schulgelände Leidenschaften und Ziele für dich entdecken und Freundschaften schließen, die dich ein Leben lang begleiten werden. In der Anlage findest du die Unterlagen für die Einschreibung, Details zum Stipendium der Gründerstiftung und den Verhaltenskodex für Schüler, die du bitte mit deiner Familie durchliest, unterschreibst und bis zum 15. April zurücksendest. Solltest du noch Fragen haben, erreichst du mich jederzeit in meinem Büro.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Griffin Frye, ’Croft ’86
M.A. Williams College
Dr. phil. Columbia University
Dant mentem animumque deducemini – Führe mit Herz und Verstand
LYCROFT PHELPS SCHOOL
Gegr. 185612 Liberty StreetWhitney, New Hampshire 03026
Dr. Griffin Frye
Rektor
An
Quinn Luddington Walsh
2636 Shore Rd.
Southport, CT 06890
Liebe Quinn,
es ist mir eine große Ehre, dich an der Lycroft Phelps School begrüßen zu dürfen. Seit sechs Generationen weiß deine Familie den Wert der Charakterbildung zu schätzen. Wer wirst du an der Lycroft Phelps sein, Quinn?
SEPTEMBER
P • O
1
Donnerstagabend
Q
P Zehnte Klasse O
Ich schleiche durch die Bäume – verborgen, sichtbar, verborgen, sichtbar – und achte auf Wurzeln und Felsen und Erde, schwammig von Blattfäule. Das Waldgebiet zwischen den befestigten Wegen ist verwildert und ausgetrocknet, es schlürft die Dunkelheit zwischen Kerben in der Rinde und Scharten im Fels. Der Himmel ist nie so dunkel wie jetzt zwischen Sonnenuntergang und Mondaufgang.
So viel dazwischen.
Ich bin zwischen mir und mir, denke ich. Ich spüre meine Knochen, aber meine Haut erkenne ich nicht wieder. Dieses fremde neue Ich giert nach der Macht der Nacht. Ich weiß, wer ich war. Ich weiß nicht, wer ich sein werde. Aber was ich mir holen will, das weiß ich genau: Officer Doughtys Revolver.
Denn Colin Pearce muss sterben.
Vorsichtig steige ich über das stachelige Skelett einer umgefallenen Kiefer. Gestern Abend habe ich mir daran die Strumpfhose aufgerissen und das Knie aufgeschürft. Der Baum ist ein Orientierungspunkt, gleich bin ich da. Im schwarzen Netz der Blätter erscheinen erleuchtete Vierecke. Vor mir liegt Haus Anderson, dort ist der Sicherheitsdienst der Lycroft Phelps School untergebracht.
Am Waldrand bleibe ich stehen. Sechs Meter Rasen trennen mich von Officer Doughty. Es ist kalt für September und mein Atem geht stockend. In kurzen Stößen steigen vor meinem Gesicht Wölkchen auf. Ich beiße die Zähne zusammen und atme durch die Nase aus, damit ich nicht noch deswegen erwischt werde.
Doughty sitzt eingerahmt von dem erleuchteten Fenster am Schreibtisch und schreibt Protokoll. Es ist drei Minuten vor acht und ich höre praktisch die Sekunden ticken, bis er auf die Uhr sieht und den Feierabend einläutet. Gleich wird er seine Vertretung, Officer McPhee, der in einem aufgemotzten Golfcart über den Campus brummt, anfunken und sich für heute abmelden. Doughty wird Haus Anderson abschließen, in seinen Pick-up steigen und nach Hause fahren.
Jetzt klappt er das Protokollbuch zu, neigt das Kinn zur Wanduhr und geht wie erwartet zu der kleinen Toilette.
Ich bin ganz in Schwarz gekleidet wie Tom Cruise in diesen Mission: Impossible-Filmen, die ich früher mit Dad geschaut habe. Wie ein Spion renne ich über den Rasen und schmiege mich an die Holzverkleidung des alten Häuschens aus den 50ern. Dann werfe ich einen Blick durch das gekippte Fenster. Mittlerweile weiß ich, dass es nur einen Hauptraum gibt, in dem ein Schreibtisch, mehrere Stühle und in der Ecke eine Pritsche stehen. Ein Computerbildschirm mit mehreren geöffneten Fenstern zeigt abwechselnd körnige Schwarz-Weiß-Szenen auf dem Schulgelände. Wenn der Sicherheitsdienst auch nur den Hauch einer Ahnung hätte, wären diese Kameras in die dunklen Ecken gerichtet. Stattdessen kommt es mir vor, als würde hier der virtuelle Werbe-Rundgang von der Lycroft-Phelps-Webseite gesendet: Kolonnaden aus Backstein und Efeu, weiße Kuppeln mit blauen Spitzen, großzügige Innenhöfe mit hübsch geometrisch angeordneten Wegen. Hält Doughty es wirklich für nötig, die bronzenen Gründerstatuen von John Lycroft und Erastus Phelps per Kamera zu überwachen? Andererseits kann ich diese Ignoranz zu meinem Vorteil nutzen. Sobald ich die Waffe habe.
Die Toilettenspülung rauscht und die Badezimmertür knarrt. Ich tauche ab, höre seine Schritte näher kommen, das Rollen des Schreibtischstuhls auf den abgenutzten Holzdielen und wie er das Knie auf das verschlissene grüne Sitzkissen stützt. Er ist so nah, dass ich ihn anstupsen könnte, wenn die Mauer nicht wäre. Mir schwindelt, als mich das Gefühl meiner Macht durchströmt, und meine Brust blubbert vor Lachen – ein Lachen, das meinen Plan zunichtemachen würde, wenn es herauskäme.
Lass das!, ermahne ich mich und das Lachen gerinnt zu Wut, die sich in meiner Kehle sammelt, in mir versickert und nur noch leise brodelt.
Doughty verlagert das Gewicht und nimmt ein Schulterholster ab, das normalerweise unter seiner unförmigen LPS-Sicherheitsdienst-Jacke verborgen ist. Bestimmt wissen nur wenige, dass Doughty eine Knarre hat. Als ob er jemals an der LPS herumballern würde. Aber ich weiß es. Und Wissen ist alles.
Er zieht die Schreibtischschublade auf und nimmt den Revolver aus dem engen Lederfutteral – sanft, ehrfürchtig, beinahe liebevoll. Vielleicht erinnert ihn nur die Waffe daran, was er tun könnte, wenn er nicht für die Lycroft Phelps arbeiten würde.
In den Bäumen höre ich John Lennon singen: Happiness is a warm gun, bang, shoo-oo-oo-oot shoot, und blitzartig bin ich fünf Jahre alt und sitze mit Dad in seinem Büro bei uns zu Hause. Er setzt den Tonarm auf die Schallplatte, das Weiße Album der Beatles. »Das ist Größe, Q«, sagt er. »Hör gut zu.« Lächelnd schließt er die Augen. Die Nadel faucht, packt zu, dann: She’s not – a girl – who misses much. Dad singt den doo-doo-doo-Part leise mit und öffnet die Augen bei oh, yeah. Ich muss kichern. Er schwenkt mich durch die Luft, als Ringos Schlagzeug einsetzt und tanzt mit mir durchs Zimmer. Ich wünsche mir diese Version meiner selbst so sehnlichst zurück, dass ich kurz die Augen zusammenkneifen muss, um die Vision aufzulösen und mich wieder auf Doughty zu konzentrieren.
Das dumpfe Geräusch des Revolvers auf Holz hallt in meinem Bauch nach. Mein Blut pulsiert in den Schläfen. Ich bin schwach und aufgedreht zugleich.
Is a warm gun, yeah.
Er hängt das Holster an den Haken an der Wand, schließt die Schublade ab und öffnet eine andere, in die er die Schlüssel legt. Nicht gerade ein bombensicheres System, aber schließlich hegt er nicht den geringsten Verdacht. Und da ich unsichtbar bin, wollen wir ihm seine Nachlässigkeit noch mal verzeihen.
Ich drücke mich erneut flach gegen die Mauer, als er das Fenster schließt, höre, wie er den Griff nach unten dreht und das Licht dimmt. Gleich wird er sich bei seinem Stellvertreter, Officer McPhee, melden. Sogar durch die Scheibe kann ich die verzerrte Stimme hören: »Hey, Boss.« Das ist die Gelegenheit.
Lautlos renne ich um das Gebäude auf die andere Seite der Veranda, ich fliege fast. Moment, ich bin ein Geist, denke ich. Aber das kann nicht sein, ich habe mir in die Wange gebissen und schmecke Blut, als ich mit meiner Zunge darübertaste.
Ich suche mir einen dicken Baum aus, so nah an der Veranda, wie ich es wage. Beim letzten Versuch war ich zu weit weg. Heute will ich sehen, welchen Zahlencode er eingibt, um das Haus zu verriegeln. Doughty kommt aus dem Haus und schließt die Tür. Er tippt auf Tasten, die wie bei einem Telefon in einem Drei-mal-vier-Tastenfeld angeordnet sind. Ich muss mir nur die Abfolge merken. Mein Blick ist voll konzentriert.
Blip. Blip.
Drei-drei …
Bliep. Bliep. Bliep. Blip.
Neun-sieben-neun-sieben? Oder sechs-vier-sechs-vier?
Doughty dreht sich in meine Richtung, um zu seinem Pick-up zu gehen. Schuhe knirschen auf dem Weg. Die Wagentür wird geöffnet. Zugeknallt. Der Motor springt an, der Wald erstrahlt in grellem Licht. Die Reifen drehen, spucken Schotter, und die Scheinwerfer machen einen Schwenk.
Und Stille. Ich bin allein.
Doughty könnte etwas vergessen haben und zurückkommen. Also warte ich, an den Baum gelehnt. Über den Hügeln jenseits des Lake Edith geht ein asymmetrischer Mond auf und wirft kleine Stückchen aus Licht aufs Wasser, die der See wie Pailletten trägt. Du musst dich für diesen Ort nicht schön machen, Edith, sage ich in Gedanken. Du bist zu gut für sie. Ich rühre mich erst, als der Mond von den Hügelkuppen abrückt und in das Blau vordringt.
Dann schleiche ich zur Tür und halte meine behandschuhte Hand vor die Tastatur.
Ich gebe ein: 3–3 … 9–7–9–7. Obwohl ich kein Entriegelungsgeräusch höre, drehe ich vorsichtshalber den Knauf.
Nichts. »Mist.«
Ich starre auf die Zahlen, sie sollen den Code preisgeben.
Zögerlich drücke ich 3–3–6–4–6–4 und rüttele am Knauf. Wieder nichts.
Dunkelblaue, fließende Schatten schimmern in meinen Augenwinkeln. Die Ziffern vibrieren. Ich könnte schwören, dass er diese Zahlenfolge eingegeben hat. Ich weiß es. Vielleicht war die 3–3 aber auch eine 6–6. Ich habe nur noch eine Chance, wenn ich davon ausgehe, dass das System bei einem vierten Versuch automatisch gesperrt oder schlimmstenfalls der Alarm ausgelöst wird.
6–6–3–1–3–1.
Stille.
Der Knauf lässt sich nicht bewegen. Ich werfe den Kopf in den Nacken und bin kurz davor, aus voller Kehle SCHEISSE zu brüllen, als ein Haufen Kids vom See den Hügel heraufkommt. »Scheiße!«, flüstere ich stattdessen und verstecke mich hinter dem dicken Baum.
Es sind Jungs. Einer sagt etwas. Den genauen Wortlaut kann ich nicht verstehen, aber es muss etwas richtig Widerliches gewesen sein, weil die anderen so lachen, als wüssten sie, dass sie das nicht tun sollten. Neue Schüler vermutlich, gerade erst angekommen, die sich noch nicht trauen, nicht zu lachen. Es schnürt mir die Kehle zu und einen Augenblick habe ich Angst, mich zu übergeben.
Nein. Ich verbiete es mir.
Als sie außer Sichtweite sind, erwäge ich einen letzten Versuch. Eine laute Sirene kann ich absolut nicht riskieren. Ich könnte mich für heute natürlich in Sicherheit bringen, aber dann würden sie die Sicherheitsvorkehrungen verschärfen – die irgendwo in den 1970er-Jahren stecken geblieben sind, was mir sehr zugutekommt.
Ich blicke in den pechschwarzen Himmel, während meine abgehackten Atemzüge über mir verdampfen. Für heute Abend bin ich hier fertig. Aus dem Wald zischen zwei Fledermäuse hervor, in einem rasanten Tanz zu einer Sternenmusik, die nur sie hören können. Ich fühle mich so furchtbar einsam, dass ich mich am liebsten hinlegen würde. Einschlafen und nie mehr aufwachen, das wäre gut. Die Fledermäuse verschwinden. Als eine Träne über meine Wange rinnt, wische ich sie weg.
Ich krame meine AirPods aus der Jackentasche. Der Anfang von Gimme Shelter von den Rolling Stones überrollt mich wie ein undeutlicher Traum, bis jede einzelne Zelle hellwach ist. Die Bongos finden meinen Herzschlag.
Ich bin wieder bereit und husche fledermausschnell zurück in die Schatten der Bäume, die mein Geheimnis bewahren.
CHARLOTTE FORESLEY
P Elfte Klasse O
Zum hundertsten Mal lese ich auf dem Laptop die Aufgabe.
Aus welchem Antrieb heraus bewirbst du dich in diesem Jahr als Junge Choreografin / Junger Choreograf?
Es ist keine Fangfrage. Trotzdem starre ich sie jetzt seit einer guten halben Stunde an. Meine Finger schweben über der Tastatur. Nicht nachdenken, Charlotte. Denk ausnahmsweise mal nicht nach. Die Bewerbung muss bis Schulschluss morgen um drei bei Madame Chu sein, der Leiterin des Ballett-Begabtenprogramms an der Lycroft Phelps. Madame Chu ist schwer zu durchschauen. Soll ich mich vor ihr in den Staub werfen oder erwartet sie irgendeine Aussage über meine künstlerische Leidenschaft? Möglicherweise nichts davon. Oder beides.
Ich tippe.
Es wäre mir eine Ehre, in einer Reihe mit so vielen ausgezeichneten Tänzerinnen und Tänzern …
»Würg!« Ich drücke auf Löschen. Der Bildschirm macht ein glucksendes Geräusch, als wäre er ganz meiner Meinung. Dann merke ich, dass ich eine Nachricht bekommen habe. Von Grace, meiner besten Freundin von zu Hause. Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten.
Grace: Wow, cooles Bild. Du wohnst echt an einem Filmset!
Sie bezieht sich auf ein Foto vom Schulhof heute in der Mittagspause. Riesige Ahornbäume, deren Kronen sich rot zu färben beginnen; Schüler, die in kleinen Grüppchen auf dem Rasen zu Mittag essen.
Ich: Ja, oder? Es sieht aus wie das Gemälde mit den vielen kleinen Punkten aus dem Art Institute in Chicago, das wir so toll fanden – das aus Ferris macht blau.
Ein weiteres Glucksen des Computers. Grace ruft mich über FaceTime an. Ich werfe einen Blick über beide Schultern, um sicherzugehen, dass ich hier in der Abteilung der Bibliothek mit den Nachschlagewerken wirklich allein bin. Gleichzeitig schäme ich mich dafür. Ich weiß auch nicht, warum es mir so schwerfällt, zu meinem früheren Thornwood-Ich zu stehen, sobald ich hier bin. Auf jeden Fall ist die Luft rein und ich nehme den Anruf an.
Auf dem Bildschirm taucht Grace auf. »Ha! Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte – im Stil einer neuenglischen Privatschule.«
»Genau!«, sage ich. »Du fehlst mir.«
»Du mir auch.«
»Bewirb dich einfach. Dann könntest du schon im Januar hier sein.« Das wird sie nicht tun und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es so eine gute Idee wäre, aber in einer vollkommenen Welt würde es so laufen, also bleibe ich dabei.
»Na ja, nicht alle haben das Zeug für die LPS, Char.«
Ich mache den Laptop leiser. »Komm schon. Als ob ich das Zeug dazu hätte. Ich kann mich einfach nur gut verstellen.«
Sie schaut skeptisch. »Bullshit. Charlotte Foresley hat absolut das Zeug für die LPS. Immerhin haben sie dich auf die Startseite ihres Webauftritts gesetzt.« In Erwartung meines Ausrasters grinst sie breit.
»Was? Im Ernst?«, kreische ich. »Woher weißt du das?«
Ich klicke auf den Tab, um die Seite zu öffnen. Von dort aus loggt man sich auch ins Schülerportal ein, das heißt, buchstäblich jeder auf dem Campus wird das Bild zu sehen bekommen. Grace sagt: »Deine Mutter hat es auf Insta gepostet. Was sonst?«
»O nein«, stöhne ich.
»Sie sollten euch da wirklich mehr Zugang zu Social Media erlauben. Sogar deine Mutter ist öfter online als du. Bitter.« Ich mache mir nicht die Mühe, mit Grace darüber zu diskutieren. Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, nicht so viel mit Social Media zu tun zu haben.
Ich starre das Foto an. Es zeigt unseren Fortgeschrittenenkurs fürs Training auf Spitze beim Aufwärmen an der Stange. Auch Hannah, meine Zimmergenossin und beste Freundin hier, ist dabei. Aber das einzige Gesicht, das aus der Perspektive der Kamera zu erkennen ist, ist meins. Es sieht aus, als würden alle meine Pose nachmachen. »O Gott, mein Port de bras. Grauenhaft.« Schaudernd klicke ich die Seite weg.
»Na, dein Perfektionismus blüht und gedeiht ja«, neckt Grace mich. »Wen interessieren schon Ballettarme? Ich will alles über deinen scharfen neuen Freund wissen.«
Ich beuge mich tiefer über den Laptop. »Pscht! Mann, Grace!«, flüstere ich.
Sie schlägt sich die Hand vor den Mund. »Oh, fuck! Ist er etwa da?«
»Nein, aber es hätte gut sein können!«, sage ich leise. »Und Seb ist auch nicht wirklich mein Freund.« Wie kann ich mit wenigen Worten eine ganze Schulkultur erklären … »Hier sagt keiner mein Freund oder meine Freundin.«
»Es sagt keiner ›mein Freund‹?« Sie lächelt ungläubig. »Okaaay. Du warst doch letztes Schuljahr mit Seb bei der Prom …«
»Beim Sommertanz«, verbessere ich sie, dann lenke ich ein. »Stimmt, es ist wie eine Prom.«
Sie verdreht die Augen. »Genau. Bei der du heftig mit ihm rumgemacht hast. In den Sommerferien hat er dich dauernd angerufen. Du hast ihn in seinem Ferienhaus auf Cape Cod besucht, auf dem Rückweg zur Schule – sie malt Anführungszeichen in die Luft –, obwohl es gar nicht auf dem Weg liegt. Und ihr seid bloß Kumpel?«
»Nein. Aber mein Freund klingt irgendwie so krass. Als Begriff.« Grace hebt die Augenbrauen. Ich finde mich selbst nicht besonders überzeugend. »Von wegen Schubladen und so«, füge ich hinzu, aber das macht es auch nicht besser. Ehrlich gesagt verstehe ich es selbst nicht. Am liebsten würde ich laut vom Glockenturm jodeln, dass ich Seb McNeillys Freundin bin.
»Hattet ihr schon Sex?«
»Grace«, sage ich peinlich berührt.
»Charlotte.«
Das Geräusch kommt von hinten und ich weiß sofort, wer es ist. Panisch knalle ich den Laptop zu, drehe mich um und stoße ungewollt einen leisen Schrei aus.
Da steht Seb, die Hände in den Taschen. Seine Augen funkeln amüsiert.
»Wow«, sagt er mit einem warmen, ansteckenden Lachen. »Warum so nervös?«
Ich merke, wie mein Mund versucht zu lächeln, aber mein Herz klopft wie verrückt. »Du hast mich erschreckt.« In seinem Gesicht suche ich nach Anzeichen dafür, dass er uns gehört hat. Aber er grinst nur. Vollkommen undurchdringlich.
»Tut mir leid«, sagt er glucksend. »Aber was sitzt du hier auch in der gruseligsten Ecke der ganzen Bibliothek.« Er zieht einen Lexikonband aus dem Regal, bläst den Staub weg und betrachtet das Buch wie einen Dinosaurierknochen. »Wer benutzt so was denn noch?«
»Niemand. Genau deshalb sitze ich ja hier.« Als ich aufstehe, versuche ich meine Atmung zu beruhigen und stelle mich direkt zwischen ihn und den Laptop, als könnte Grace ihn plötzlich aufklappen und die beiden würden mich gemeinsam auslachen. Ich ziehe erst einen Ellbogen an die Brust, um meine Schulter zu dehnen, dann den anderen. »Hier gibt es null Ablenkung.« Ich lächle und hoffe, wieder halbwegs cool rüberzukommen.
Es funktioniert. Seb schüttelt den Kopf, als wäre ich ein bezauberndes Rätsel, und legt das Buch auf den Tisch. Dann stellt er sich hinter mich und massiert mir mit den Daumen die Schultern. Ich widerstehe dem Drang, mich an ihn zu schmiegen wie eine Katze.
»Da kenne ich einen besseren Ort«, sagt er. »Einen viel, viel besseren.« Er dreht mich zu sich um und legt nacheinander meine Arme um seinen Hals. Ich bin zwar ziemlich groß, aber Seb ist eins neunzig und wir passen einfach perfekt zusammen. Dann beugt er sich vor und wir küssen uns. Er ist frisch geduscht. Mit den Fingern fahre ich durch sein babyweiches Haar, das sich im Nacken kräuselt. Mit einem »Mmm« löst er sich von mir. »Komm mit.« Er gibt mir einen Klaps auf meine Gesäßtaschen. »Das will ich dir unbedingt zeigen.«
Als würde ich darüber nachdenken, kneife ich die Augen zusammen. Er soll nicht wissen, dass ich ihm sogar in einen aktiven Vulkan hinein folgen würde. »Okay.« Ich drehe mich um, klappe den Laptop wieder auf und schließe FaceTime. Tut mir leid, Grace, denke ich. Sie wird es verstehen.
Seb blättert in dem Lexikonband. Es ist das C. »Hey! Chrom. Das hatten wir gerade.« Beim Auswendiglernen des Periodensystems für seinen Chemie-Leistungskurs habe ich ihm geholfen. Den hatte ich schon letztes Jahr belegt.
Er schließt die Augen. »Erstes Element in der sechsten Nebengruppe, ein silberweißes sprödes Übergangsmetall.« Blinzelnd fügt er hinzu: »Glänzend und anlaufbeständig.«
Ich glaube, ich liebe ihn.
»Top!«, sage ich und setze mir den Rucksack auf.
Auf dem Weg durch den Lesesaal spüre ich die Blicke auf uns und hebe das Kinn wie bei einer Ballettaufführung. Sonst würde ich an Ort und Stelle zerfließen. Vor Hunderten von Zuschauern zu tanzen ist kein Problem für mich, aber wenn ich hier durchgehen muss, wo lauter Mädchen Seb begaffen und sich fragen, was so toll an mir ist, würde ich mich am liebsten in Luft auflösen. Mir vorzustellen, dass ich auf der Bühne stehe, ist eine Tänzerinnen-Superkraft. Schätze ich.
Draußen riecht es süßlich und intensiv. Es ist mein dritter Herbst auf der Lycroft Phelps und ich kann mich gar nicht sattsehen. Ich liebe diesen Jahreszeitenwechsel. Die bunten Blätter, die orangefarbenen Kürbisse vor steinernen Mauern, die Pullis, Stiefel und Schals – himmlisch.
Seb und ich gehen dicht nebeneinanderher, vorbei an den Gründerstatuen. Lycrofts und Phelps’ Bronzehälse sind seit dem Abendessen mit grün-weißen Schulschals verziert worden. Auf einem Schild steht: Samstag: LPS gegen Tofton! In Lycrofts gebeugtem Ellbogen steckt ein Football.
»Warum machen die Ruderer so was nicht?«, frage ich.
»Und die Tänzer?«, erwidert Seb. »Mit Tutus oder so?«
Ich stoße ihn mit der Schulter an, weniger, weil er es verdient hätte, sondern eher, weil es mir einen Grund bietet, ihn zu berühren.
»Hier lang.« Er führt mich über einen schmalen, leicht abschüssigen Pfad, der sich zwischen Spangler Hall – dem Speisesaalgebäude – und dem Wald erstreckt. Dort, wo die Sonne gerade untergegangen ist, scheint ein rosafarbenes Stück Himmel zwischen den Blättern hindurch, aber sonst sind die Bäume dunkel, verflochten und wild, wie in einem Hexenmärchen.
Ein plötzliches Knacken, ein Rascheln von Zweigen und Blättern. Mir läuft es kalt den Rücken runter.
Wir bleiben stehen. »Äh, was war das?« Ich klinge gar nicht so erschrocken.
»Weiß nicht«, sagt Seb. »Ein Waschbär oder so. Oder vielleicht ein Fuchs.«
»Es hat sich nach was Größerem angehört.« Ich schaue mit zusammengekniffenen Augen in die Finsternis.
»Der Wald kann Geräusche verstärken«, sagt er, aber ich sehe, dass er ebenfalls die Augen zusammengekniffen hat. Dann setzt er wieder seinen normalen Gesichtsausdruck auf und schnaubt belustigt. »Vielleicht war es der … Lycroft-Yeti!« Mit einem Knurren packt er mich an der Taille. Ich schreie auf und schlage seinen Arm weg. Es ist albern, ich weiß, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ein Yeti/Fuchs/Wolf mich erwischen würde, aber Seb niemals. So etwas ist in seinem Leben nicht vorgesehen. Er wird sorglos über uns Erdverhafteten dahinschweben, bis er mit neunundneunzig friedlich in einem Adirondack-Gartensessel entschläft, den Sonnenuntergang über der Cape Cod Bay vor Augen. Das weiß ich so sicher, wie ich den Tendu beherrsche. Als wir um eine Kurve biegen, hake ich mich bei ihm unter und bin froh, Haus Anderson, den Stützpunkt des Sicherheitsdienstes, direkt unterhalb von uns zu entdecken. Mit einem kurzen Knirschen seiner Schuhe auf dem Kies bleibt Seb stehen. »Da sind wir.« Wir stehen vor einer kleinen Hütte im Schatten von Spangler Hall.
Ich sehe ihn an. »Verstehe ich nicht.«
Er steht zwischen mir und der Tür. »Das hier ist das älteste Gebäude des Campus. Die Alte Bibliothek von 1856.«
»Okaaay.«
Er nimmt die Hand aus der Hosentasche und klappert mit einem Schlüsselring. Bevor ich die richtige Frage stellen kann, steckt er den Schlüssel ins Schloss.
»Moment mal«, sage ich. »Wir dürfen hier nicht rein. Oder?« Ich finde es furchtbar, wie ich klinge. Spießig. Feige.
»Keine Sorge«, entgegnet er, während er am Schloss hantiert.
»Dir ist schon klar, dass der Sicherheitsdienst gleich da vorne ist, oder? In Sichtweite.« Das hier kommt mir viel zu leichtsinnig vor. »Ist das nicht Einbruch oder so?«
Statt einer Antwort zieht er die Tür auf. »Nach dir, Charlotte.«
Mir wird klar, dass dies nicht der richtige Moment ist, um Charlotte Tate Foresley zu sein, hochbegabte Elftklässlerin, Ballettsolistin und Mentorensprecherin. Mit anderen Worten: Dies ist nicht der richtige Moment, um ich zu sein. Nach einem letzten Blick auf Haus Anderson streife ich das brave Mädchen vor der Tür ab und betrete den verdunkelten Raum. Der würzige Geruch nach antikem Holz und alten Büchern hüllt uns ein. Seb betätigt einen altertümlichen Schalter. Zwei Sekunden lang passiert nichts. Dann erleuchten vier Tiffany-Stehlampen aus farbigem Glas alle Ecken des Zimmers. Vor den raumhohen Bücherregalen hält ein mächtiger Globus Wache. Sogar eine dieser rollenden Bibliotheksleitern gibt es.
»Wow«, sage ich.
»Und, habe ich zu viel versprochen? Es sieht aus wie einer der Tatorte aus Cluedo! Man kann hier geradezu noch den Abdruck von Lycrofts Hintern sehen.« Seb zeigt auf einen Ledersessel vor dem Kamin.
Ich lache, dann sage ich: »Im Ernst jetzt, wie …«
»Schhh. Es ist alles gut. Bereit für das Beste?« Er steigt auf die Leiter. »Schubs mich an.«
Mit einem fragenden Lächeln gebe ich seinem Bein einen Stoß. Grinsend rollt er davon. Als die Leiter anhält, schiebt er sich selbst langsam weiter vor bis zu einem ins Holz eingelassenen Schrank. Er öffnet ihn und zaubert ein Silbertablett mit einer Kristallkaraffe und zwei passenden Gläsern hervor. Das gäbe ein sehr edles Hochzeitsgeschenk ab. »Siehe da«, sagt er, als er von der Leiter steigt. »Der Familien-Scotch.«
Er stellt das Tablett auf einen Couchtisch und schenkt uns beiden ein. Sebs Familie gehört McNeilly Scotch, eine weltberühmte Whiskybrennerei. Bevor ich nach Cape Cod gefahren bin, hat mein Vater gefragt, ob ich meinem neuen Freund nicht eine Flasche für ihn zu Weihnachten abknöpfen könne, woraufhin meine Mutter ihm einen Klaps versetzt hat.
Ich werfe Seb einen Blick zu und nehme das Glas. Er stößt mit seinem dagegen und entlockt ihm so einen zarten Glockenton. »Prost.« Als er einen Schluck nimmt, tue ich es ihm gleich, benetze allerdings nur die Lippen mit der Flüssigkeit. Sie schmeckt wie feuriger Hustensaft.
Ich mache ein Geräusch wie »Uähh!«.
Er lacht. »Gewöhnungsbedürftig, ich weiß. Aber du wirst schon noch auf den Geschmack kommen.«
Ich lächele, seine Worte weisen in eine Zukunft.
Als wäre er hier zu Hause, lässt er sich aufs Sofa fallen und klopft auf das Kissen neben sich. »Morgen habe ich meinen ersten Lateintest, also sollte ich mich wohl ranhalten. Und du?«
Ich würde ihn gern nach dem Schlüssel fragen, aber warum sollte ich seinen Zaubertrick kaputtmachen? »Hab auch viel zu tun«, sage ich und setze mich neben ihn.
Sebs Selbstbewusstsein breitet sich wie durch Osmose aus, und kurz darauf habe ich ebenfalls das Gefühl, hierherzugehören. Ich ziehe mir die Schuhe aus und schiebe meine Zehen unter seinen Oberschenkel. Er sitzt aufrecht da, bildet den Querbalken zu meinem T. Fast eine Stunde lang machen wir unsere jeweiligen Hausaufgaben in friedlicher Koexistenz, die mich von unserem Berührungspunkt bis hinauf in die Wangen wärmt. Eigentlich sollte ich an meinem Essay für die Jungen Choreografen arbeiten, aber die Ballett-Charlotte hat in meinem Kopf nicht gleichzeitig Platz mit der Seb-Charlotte, deshalb mache ich Mathe. Nach jeder gelösten Aufgabe belohne ich mich mit einem Blick auf Seb. Er hat hellbraunes Haar mit von der Sonne aufgehellten Strähnen, und seine Augen, die konzentriert auf der Seite in seinem Lateinbuch ruhen, passen irgendwie zu seiner Haarfarbe. Hannah hat sie McNeilly-Gold getauft.
Um es ganz klar zu sagen: Seb McNeilly ist auf bestimmt sechzehn Arten absolut scharf. Wie ich an einem solchen Ort neben ihm auf dem Sofa gelandet bin, ist so unerklärlich wie ein wunderschöner Traum.
Ich berechne gerade Potenzen, als Seb plötzlich unvermittelt »Neeiiin« sagt und auf sein Handy starrt. Er spricht leise, das Wort strömt zwischen seinen Lippen hervor wie ein langsamer tantrischer Atemzug. In der Sprache Sebastian McNeillys bedeutet das, etwas Krasses ist passiert. Ich bin zwar keine Seb-Muttersprachlerin, aber eine geübte Gesprächspartnerin. Die Reise nach Cape Cod hat mich in die hohe Kunst des Understatements eingeführt, die seine Familie praktiziert. Sie leben nach der Devise: Ruhe bewahren und noch einen Gin Tonic trinken. (Meinen Beobachtungen bei diversen Familientreffen in den Ferien zufolge lautet die Devise bei uns dagegen eher: Wein trinken und die Wahrheit sagen, komme, was da wolle.)
»Mhm?« Ich hebe nur den Blick. Übereifer ihm gegenüber wäre mein Todesurteil, da bin ich mir ziemlich sicher.
Er fährt sich mit den Fingern durchs Haar. »Chauncey ist raus«, sagt er und sieht mich blinzelnd an.
Ich kneife die Augen zusammen. Chauncey – der in Wirklichkeit John Ceezak heißt, was zu John Cee abgekürzt wurde und später, nach einer legendären Party in dem Jahr, bevor ich hergekommen bin, zu Chauncey – ist Sebs Zimmergenosse und bester Freund. Chauncey ist der Golden-Retriever-Welpe der Zwölften: blond, beliebt und nicht gerade der hellste Hund der Meute.
»Raus?«, wiederhole ich.
»Von der Schule verwiesen. Bis Januar.« Seb hat den Blick ins Nichts gerichtet.
»Warum?« Ich lasse nicht erkennen, dass mein Herz kleine Bourrée-Schritte tanzt. Weniger Chauncey bedeutet mehr Seb für mich.
»Mr Larabee hat ihm ein Plagiat nachgewiesen. Mann, Chauncey«, schimpft Seb, dann seufzt er und scrollt durch sein Handy. »Sein Großvater schickt ihn zum Häuserbauen nach Guatemala. Für eine neue Perspektive, sagt er.«
»Könnte funktionieren.«
»Vielleicht.« Seb schlägt sich auf die Knie, steht auf und geht zum Fenster. »Aber unser Boot ist solange am Arsch.«
Seb rudert im ersten Boot der Mannschaft zusammen mit sieben anderen Ruderern und dem Steuermann, auch bekannt als Chauncey. Sie sind richtig gut. Gut genug, um den Talentsuchern der Eliteuniversitäten aufzufallen. Seb ist der Schlagmann, der die Schlagfrequenz für das Boot vorgibt. Also so was wie der Kapitän, denke ich, obwohl Seb das von sich weist. Natürlich.
»Chauncey ist doch bloß der Steuermann«, sage ich. »Ihr seid die, die rudern.«
»Der Steuermann ist unverzichtbar. Er ist quasi das Hirn des Bootes.«
»Ausgerechnet.«
»Das ist nicht witzig«, sagt Seb, lächelt aber, und wie üblich macht mein Herz einen Knicks. Dann packt er seinen Rucksack. Wir gehen also, stelle ich fest und fange ebenfalls an zu packen. Nachdem er den alten Lichtschalter gedrückt hat, hält Seb mir die Tür auf und folgt mir auf den Pfad hinaus. Es fühlt sich ungelogen so an, als würden wir unser eigenes Haus verlassen. Und das gefällt mir.
Unser Atem bildet Comicwolken über uns. »Ganz schön kalt für September, sogar nach New-Hampshire-Standard.« Ich kuschele mich an sein Sweatshirt, sobald er die Tür abgeschlossen hat.
»Aber ich finds genial, du nicht?« Er zieht mich an sich. Wir verlieren das Gleichgewicht und lachen. Über uns malen die Sterne Tupfen auf das endlose Himmelstuch.
»Doch.« Ich finde alles genial, wenn ich mit dir zusammen bin, sage ich nicht.
Nachdem wir ein paar Schritte gegangen sind, bleibt Seb unvermittelt stehen. »Hey, ich habs.« Unsere Blicke begegnen sich. Ich habe keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht. Nach inzwischen fast vier Monaten.
»Was?«
»Du könntest unser Steuermann sein.«
Mein Herz macht einen Satz. Ich soll für sie steuern?! Das meint er doch wohl nicht ernst. »Ha!« Ich wende den Blick ab und gehe weiter. »Ja, klar.«
»Warum nicht? Du bist leicht, klug und deutlich attraktiver als Chauncey. Und ich bins leid, bei jedem Training seine jämmerliche Visage vor Augen zu haben.«
»Ein schmeichelhaftes Angebot, das ich leider ablehnen muss«, sage ich. »Ballett. Keine Zeit.«
»Scheiß aufs Ballett«, flüstert er mir ins Ohr, bevor er mir einen langen, zarten Kuss gibt, und ich denke ernsthaft darüber nach, aufs Ballett zu scheißen. Aber dieses Jahr bin ich endlich Solotänzerin und habe die Chance, bei den Jungen Choreografen zu gewinnen. Außerdem tanze ich schon, seit ich vier bin. Da sollte ich nicht einfach …
Ich verliere mich in seinem Duft, seinen Lippen und seinen Händen, die meinen Brustkorb streicheln. Knacks-knacks!
Wir zucken voreinander zurück.
Ein ziemlich großes Etwas stürmt durch den Wald.
»Das war jetzt aber näher dran!«, flüstere ich. Mein Herz rast wie ein Metronom auf Speed.
Wieder ist knackendes Gehölz zu hören. Ich springe zurück in Sebs Arme.
Wir stehen reglos da und halten unwillkürlich den Atem an.
»Das ist ein Mensch«, sagt er so leise, dass ich es kaum höre. Ich nicke an seiner Brust und stelle mir irgendwas aus einem Scream-Film vor, aber er macht sich los, hat Mut gefasst. Das genaue Gegenteil von mir.
»Bist du das, Pearce?«, ruft Seb in den Wald. »Du Perversling!«
Ich sehe Seb an. »Warum sollte Colin Pearce uns folgen?« Sein Blick huscht zu mir und wieder weg.
»Gruselig«, sage ich, aber nur zu mir.
Weiteres Blätterrascheln. Eine dunkle Gestalt flitzt zwischen den Bäumen hindurch. Mir stehen die Haare zu Berge.
»Pearce!«, brüllt Seb. Wir warten.
»Würde er nicht wenigstens antworten?«, hauche ich. Seb sagt nichts. »Komm, wir laufen«, füge ich hinzu. »Eins, zwei …«
Bevor ich drei flüstern kann, rennen wir los wie bei der Zombieapokalypse. Wir bleiben nicht stehen, als wir den Innenhof erreichen oder als wir an den Gründerstatuen und erschrockenen Mitschülern vorbeilaufen. Erst als wir bei Haus Fisher, meinem Wohnheim, ankommen, lassen wir uns keuchend auf die kalten Steinstufen sinken.
»Was … was war das?«, frage ich.
Seb nimmt meine Hand und hält sie ein paar Atemzüge lang fest. Dann fängt er an zu lachen. Das beruhigt mich ganz und gar nicht. Warum sollte uns einer von Sebs Mannschaftskollegen und guten Freunden verfolgen? Und wenn er es nicht war, wer dann? Trotzdem lache ich mit, lasse mich ganz bewusst von Sebs hermetisch abgeriegelter Welt verschlucken. Dann küsse ich ihn – gierig, als könnte ich mir dadurch seine Eigenschaft aneignen, so aufzutreten, als gehörte die Welt ihm. Er stutzt und schaut mir in die Augen. Ich habe uns beide überrascht und bin verlegen, aber er erwidert bloß meinen Kuss.
Auf Sebanesisch existiert kein Wort für Angst. Ob das vorhin nun Colin war, der Lycroft-Yeti, ein Schwarzbär oder ein entflohener Serienmörder – für Sebastian Cope McNeilly III. ist es nur ein weiteres Abenteuer. Etwas, das eben passiert, nachdem man sich in das älteste Gebäude einer der angesehensten Privatschulen des Landes geschlichen hat, um dort erstklassigen Scotch aus Kristallgläsern zu trinken, die man irgendwie vorher dort deponiert hat. Zum ersten Mal fühlt sich mein Leben abseits der Bühne verwegener an als darauf. Ich atme Sebs frischen männlichen Duft ein. Es ist gefährlich, sich so sehr in einen Typen wie ihn zu verlieben, aber ich kann einfach nicht das Geringste dagegen tun.
MAX HANNIGAN-LOEFFLER
P Elfte Klasse O
»Wir sind doch hoffentlich gleich durch mit der Sache, oder? Bitte!«, sagt Colin Pearce. Er passt kaum auf den Stuhl, seine Ellbogen und Knie ragen in die Luft wie bei einem Kran. Wir sind im Labor im zweiten Stock und der Putzmann hat schon zweimal gefragt, ob er jetzt staubsaugen kann.
Colin und ich arbeiten zusammen an unserem Physik-Sonderprojekt. Wir sollen die Anfangs- und die Endgeschwindigkeit waagerecht abgeschossener Projektile berechnen, wenn die Erdanziehung die einzig wirksame Kraft ist. Der Luftwiderstand ist natürlich auch eine Kraft, aber Mrs Lewis hat gesagt, der Einfachheit halber solle ich das in diesem Experiment weglassen. Es ist schließlich erst September.
»Wir wären gleich durch«, antworte ich und lasse ihn selbst den Satz vervollständigen: Wenn du mal ein bisschen mitarbeiten würdest. Aber ich sehe Colin dabei nicht an, denn wir wissen zwar beide, dass er auf mich angewiesen ist, um eine gute Note zu bekommen, aber wir sind uns ebenfalls beide bewusst, dass er genug potenzielle Energie in einem Fuß hat, um mich mit einem einzigen Tritt von hier zum Speisesaal zu befördern. Bei starkem Gegenwind.
Pearce stößt ein kehliges Lachen aus. »Chill mal, Mr Spock.« Er beugt sich vor und nimmt eine Kugellagerkugel in die Hand. Dabei blinzelt er, als hätte er noch nie eine gesehen, obwohl sie uns als die erwähnten Projektile dienen, die wir eine Rampe runterrollen lassen, seit wir hier sind. »Dann gib mir was zu tun.«
»Damit sind wir fertig«, sage ich. »Du kannst den Abstand von ihrem Landepunkt zu dem der anderen messen.« Ich habe die Kugeln mit Grafitspänen bestäubt, damit wir erkennen können, wo sie landen und wie weit sie nach der Landung noch rollen. Diese Daten geben einen weiteren Hinweis auf die Geschwindigkeit.
Er nimmt das Maßband und geht in die Hocke. »Von hier nach hier?«
Ich atme lautstark aus. »Genau.«
Colin verkündet das Ergebnis und ich tippe es in den Taschenrechner. Das wiederholen wir mehrmals und dann berechne ich den durchschnittlich zurückgelegten Weg und die gerollte Strecke nach der Landung. Colin hört aufmerksam zu und lächelt vor sich hin, während er mitschreibt. Ich ärgere mich immer noch über mich selbst, dass ich mich bereit erklärt habe, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist zwar alles andere als dumm, aber stinkfaul. In den beiden Jahren, die ich jetzt hier auf der Lycroft Phelps bin, hatte er mich nicht auf dem Radar – wahrscheinlich bewege ich mich einfach unterhalb seines Blickfelds –, deshalb hat es mich völlig unvorbereitet getroffen, als er mich nach der ersten Stunde fragte, ob wir das Projekt zusammen machen wollen.
»Ich kann das auf Karten ausdrucken, damit es für die Präsentation gut aussieht«, sagt er jetzt, als hätte er meine Gedanken gehört und sich erinnert, dass er vielleicht auch irgendwas zu diesem Projekt beitragen sollte.
»Okay, das ist …«
Aber er hat das Handy aus der Tasche gezogen und zieht die Augenbrauen zusammen. »Fuck«, sagt er. »Chauncey, du Vollidiot!« Ich werfe einen Blick über die Schulter, falls Chauncey hinter mir steht, aber wir sind allein. Colins Daumen huschen über das Display, dann schiebt er seinen Stuhl unter den Labortisch. Er macht sich zum Gehen bereit und überlässt das Aufräumen mir.
Ich überlege, ob ich fragen soll, was los ist mit Chauncey. Er hatte letztes Jahr das Zimmer mir gegenüber und ist eigentlich ein anständiger Kerl. Verglichen mit seinen Freunden zumindest. Außerdem ist er kaum größer als ich. Vielleicht kommt er mir auch deshalb nicht so unnahbar vor. Oder vielleicht hat er mich deshalb besser im Blick. Egal, ich habe das Gefühl, Colin hätte gerne, dass ich nachfrage, also lasse ich es. »Hier«, sage ich stattdessen und gebe ihm die Schachtel für die Rampe.
Er wirft sie zu mir zurück. »Tut mir leid, Mann. Ich muss jetzt echt los.« Todernst sieht er mich an, aber das Nächste sagt er ganz bestimmt bloß, um es selbst zu hören. »Chauncey hat einen Schulverweis kassiert und jetzt hat das schnellste Boot in der Geschichte der Lycroft Phelps keinen Steuermann mehr.« Er presst die Lippen zusammen, schüttelt den Kopf und rauscht an mir vorbei zur Tür raus.
»Arschloch«, sage ich, als er weg ist.
»Ich würde dann jetzt saugen?«, fragt der Putzmann.
»Oh …« Ich nicke energisch. »Damit habe ich nicht Sie gemeint …«, füge ich hinzu und werde rot.
Er winkt kichernd ab und schaltet den Staubsauger ein.
Ich räume die Rampe und alles andere in unser Fach und lasse den Putzmann im Labor zurück. Die Schule hat letztes Jahr einen coolen Übergang aus Glas gebaut, ein fünfeckiges Prisma, das das alte Winfield-Naturwissenschaftsgebäude mit dem neueren Kessler-MINT-Gebäude verbindet. Nachts leuchtet es blau und ich stelle mir vor, dass ich das Google-Hauptquartier verlasse, auf dem Weg in mein CO2-neutrales Zuhause zu meiner heißen Freundin (die entweder Alexandra Buchanan ist, die Zehntklässlerin aus der Naturerlebnis-AG, oder ihr zumindest sehr ähnlich sieht). Auf meinem Weg durch das Glas-Prisma sehe ich Colin unter mir, der in einem Lichtkegel auf dem Fußweg auf und ab geht und wild gestikulierend in sein Handy spricht. Wahrscheinlich heult er wegen Chauncey rum. Als er aufhört zu reden, um zuzuhören, bildet sein Atem Wolken über seinem Kopf und ich lächele, weil es so aussieht, als hätte er sich spontan selbst entzündet. Ich weiß schon, dass das bei Menschen unmöglich ist, wegen dieser ganzen 70-Prozent-Wasser-Geschichte, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen.
Eine Bewegung im Wald hinter ihm erregt meine Aufmerksamkeit.
Ich bleibe stehen. Mein Herz schlägt schneller. An das glatte Holzgeländer gelehnt starre ich in die Dunkelheit.
Da ist es wieder! Ich trete vom Fenster zurück. Wir sind hier am Fuß der White Mountains, also ist es wahrscheinlich ein Tier. Etwa einmal im Jahr taucht ein Elch auf dem Campus auf. Oder, denke ich hoffnungsvoll, es ist ein Bär, der Pearce anfällt.
Aber mein Gefühl sagt mir, dass es was anderes ist. Die Bewegung wirkt irgendwie … kalkuliert. Raubtierhaft, vielleicht. Katzenartig. Eine Wildkatze? Als die Gestalt zwischen ein paar Bäumen hindurchschleicht, erkenne ich, dass sie zweibeinig ist. Und trotz der Legenden über den Lycroft-Yeti ist mir klar, dass es ein Mensch sein muss. Das Wort Amoklauf schießt mir wie eine Patrone durch den Kopf. Ich sollte so schnell wie möglich aus dieser durchsichtigen Röhre verschwinden. Also renne ich ins Naturwissenschaftsgebäude und stelle mich an ein Fenster im Treppenhaus. Ich wähle Nils’ Nummer und sage mir, dass die Eingänge zum Campus mit Toren gesichert sind. Dann widerspreche ich mir selbst damit, dass Sicherheit immer eine Illusion ist; das Schulgelände umfasst 500 Hektar, von denen ein Großteil in wilde Natur übergeht. Nils geht nicht ran. Ich weiß sowieso nicht genau, wie er mir helfen könnte.
Dann sehe ich, wie der Typ – er ist schwarz gekleidet wie ein Scharfschütze der US Navy SEALS – hinter einem Baum hervorhuscht und sich hinter einen Felsen kauert. Mir wird übel.
Pearce kriegt nichts davon mit und bellt weiter in sein Handy.
Keine Ahnung, ob der Typ bewaffnet ist. Ich sehe nur seine Schultern und den Kopf hinter dem Stein aufragen. Eigentlich sollte ich den Campus-Sicherheitsdienst anrufen oder den Notruf wählen, aber ich bin wie erstarrt.
Colin steckt sein Handy in die Tasche und geht den Weg zum Innenhof entlang, der von Laternen erhellt wird. Der Kerl beobachtet Colin, dann rennt er von einem Versteck zum nächsten. Gott! Er stalkt Pearce?
»Hey! Ist da jemand?«, rufe ich durch das Gebäude, aber natürlich bin ich immer noch allein. Ich könnte durch das fünfeckige Prisma zurückrennen, um den Putzmann zu holen. Allerdings will ich weder den Stalker aus den Augen lassen noch durch den gläsernen Gang laufen. Ich mache hilflose Schritte in drei Richtungen gleichzeitig.
Wenn ich laut nach Colin rufe, könnte das den Stalker triggern.
Aber ich habe seine Nummer.
Mit feuchten Fingern wähle ich. Colins Handy leuchtet auf und strahlt sein Gesicht an. Er wirft einen Blick aufs Display und tippt darauf.
»Hey«, sagt Colin.
»Pearce!«, zische ich leise. »Da ist ein …«
»Hier ist Colin. Hinterlasst eine Nachricht.« Piep.
Ich starre mein Handy an. »Soll das ein Scherz sein, verdammte Scheiße?« Er hat mich weggedrückt? »Okay, dann stirb halt.« Aber das meine ich natürlich nicht so und kriege plötzlich Panik, dass ich vielleicht gerade sein Schicksal besiegelt habe. Ich poltere die Treppe runter und drücke die Tür auf.
Colin ist inzwischen ein ganzes Stück den Weg rauf. Der Stalker ist verschwunden und ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Ich bin kurz davor, Pearce zu rufen, als ihm der Golfwagen des Campus-Sicherheitsdienstes mit der blauen Lampe entgegengerollt kommt.
»Gott sei Dank«, sage ich. Es ist Doughtys Stellvertreter, Officer McPhee. Er hebt zum Gruß die Finger vom Lenkrad. Colin hebt ebenfalls die Hand, dann biegt er um die Ecke von Spangler Hall zum Innenhof. McPhee rollt an mir vorbei. Ich stehe unbeweglich in der Tür des Naturwissenschaftsgebäudes und wäge meine Optionen ab. Es ist ja eigentlich nichts passiert. Soll ich es einfach auf sich beruhen lassen? Aber was, wenn doch noch was passiert und ich nichts gesagt habe?
»Officer McPhee!«, rufe ich.
McPhee dreht sich zu mir um, nickt und wendet den Wagen. Ich muss unwillkürlich daran denken, wie ich als Vierjähriger mit meinem roten Cozy-Coupe-Rutschauto gefahren bin. Der Gedanke ist verstörend. »’n Abend«, sagt McPhee. »Was kann ich für dich tun?« Er ist ein stämmiger Rotschopf, der mich an mehrere meiner Cousins auf Seiten der Hannigans erinnert. Das beruhigt mich ein wenig und ich schildere, was ich gesehen habe. McPhee kratzt sich skeptisch am Kinn. »Bist du sicher?«
Ich nicke. »Colin wurde auf jeden Fall von jemandem verfolgt. Aber ich weiß natürlich nicht, ob der, na ja, wirklich gefährlich war.« McPhees struppig rote Monobraue bildet einen Fünfundvierzig-Grad-Winkel.
Jetzt kommts. Er hat mich erkannt. An der LPS gibts nicht so viele kleine Schüler. Ich trete von einem Fuß auf den anderen und bereite mich auf das Unausweichliche vor.
»Bist du nicht der Junge, der letztes Jahr wegen des verdächtigen Geruchs angerufen hat? Shanahan?« Er lässt seine Hand kreisen, während er versucht, sich an den zweiten Teil meines Namens zu erinnern.
Treffer, versenkt.
»Hannigan-Loeffler«, verbessere ich ihn.
»Ja, stimmt«, sagt er, als hätte die Möglichkeit bestanden, dass ich ihm einen falschen Namen nenne.
»Es roch gefährlich.« Ich klinge, als wollte ich mich verteidigen, was mich ärgert.
Letzten Dezember bin ich von Gasgeruch im Wohnheim wach geworden und dachte, es gebe ein Leck in der Leitung. Alle Bewohner wurden um zwei Uhr morgens evakuiert und standen zitternd in Unterwäsche draußen, während die Feuerwehr das Gebäude überprüfte. Noch dazu war gerade Prüfungswoche.
Die Schulverwaltung hat meine Identität geheim gehalten, daher wurde ich nicht völlig fertiggemacht, aber ich hatte immer den Verdacht, dass sie glaubten, ich hätte mir das nur ausgedacht. Was total bescheuert gewesen wäre. Warum hätte ich das tun sollen? »Vielleicht habe ich den Gasgeruch nur geträumt, schon möglich.« Ich betrachte meine Füße. »Aber das hier ist etwas ganz anderes. Ich bin hellwach und er stand genau da!«, sage ich und zeige auf den Felsbrocken. Da ich merke, dass er mir das nicht abkauft, füge ich hinzu: »Wollen Sie es wirklich drauf ankommen lassen, dass Sie sich irren?«
Widerwillig nimmt McPhee das Walkie-Talkie aus seinem Halfter und benachrichtigt die Polizei von Whitney. Während wir warten, notiert er sich meine Angaben. Aber als der Streifenwagen auftaucht und ich alles wiederhole, habe ich das Gefühl, die Geschichte klingt irgendwie absurd. Die Polizeibeamten, die in makellosen blauen Uniformen vor mir aufragen, nicken respektvoll, wirken jedoch nicht im Geringsten beunruhigt. Sie leuchten mit Taschenlampen in den Wald und rascheln sicherheitshalber ein wenig in den Blättern herum. Dann steigen sie zufrieden wieder in den Wagen. Der Fahrer, ein bulliger älterer Mann mit Knollennase, sieht mich durchs Fenster an. In gedehntem Neuengland-Akzent sagt er: »Ich mache das jetzt schon verdammt lange, mein Junge, und das sieht mir sehr nach einem Schülerstreich aus.«
McPhee schaut mich mitfühlend an. »Hatte dich in letzter Zeit jemand auf dem Kieker, Max?«
Die denken bestimmt, angesichts der vielen gut aussehenden Supersportler hier muss ich ganz schön was einstecken. Selbst wenn man das Verhältnis von coolen Typen zu Nerds großzügig berechnet, steht es 25:1 gegen mich. Ich habe mich mit dieser Tatsache abgefunden und beschließe, wegen McPhees Einschätzung nicht beleidigt zu sein.
»Nee, aber wahrscheinlich haben Sie recht.« Inzwischen steht hier meine Würde auf dem Spiel. »Crofter sind halt Crofter.«
Der Neuengländer sieht stirnrunzelnd in den Wald. »Das kannst du laut sagen.« Die Art, wie er dabei ausatmet, lässt mich vermuten, dass er kein großer LPS-Fan ist. »Na dann, alles roger. Bis zum nächsten Mal, Jimmy.« Er nickt McPhee zu.
»In welchem Wohnheim hast du dein Zimmer, Haus Stevens oder Haus Atwood?«, fragt der mich, als sie weg sind.
»Stevens.«
»Soll ich dich mitnehmen?«
Mir ist nicht ganz klar, ob er mir das aus Mitleid oder Langeweile anbietet. Ich werfe einen Blick in den Wald. »Okay.«
Wir steigen in den Golfwagen.
Als ich die Treppe zu meinem Zimmer hochgehe, frage ich mich, ob es sich wirklich lohnt, auf diese Schule mit ihrem ganzen prätentiösen Getue zu gehen. Aber mit einem Abschluss von hier kann ich mir ziemlich sicher später die Uni aussuchen. Außerdem schicken sie mich zu allen internationalen Robotik-Wettbewerben. Und es ist gratis, wie mich mein Vater gerne erinnert. Meine Eltern haben eine Designfirma in SoHo. Wir gehören zur Mittelschicht, würde ich sagen, aber ohne das Stipendium könnte ich nie auf so ein schickes Internat gehen. Ich habe noch zwei Geschwister, deren College auch bezahlt werden muss. »Max lässt sie gut aussehen«, sagt meine Mutter. Aber abgesehen von meinem Mitnerd Nils respektiert mich außerhalb des Mathe- und NW-Fachbereichs niemand. Ich bin wie ein Exponent: Ich vergrößere zwar den Wert des Ansehens der Schule, aber ich bin so klein, dass man mich gar nicht wahrnimmt.
Als ich die Tür öffne, sehe ich Nils mitten im Zimmer auf dem Boden liegen. Er schläft, einen Knöchel über sein aufgestelltes Bein gelegt, der Textmarker ist ihm aus der Hand gerutscht. Auf seinem Bauch liegt ein aufgeschlagenes Buch mit dem Titel Kunst im Wandel der Zeit. Er sieht so lächerlich aus, dass ich lospruste. Am liebsten würde ich seinen Umriss mit Kreide nachzeichnen, wie an einem Tatort.
»Nils.« Ich stoße ihn mit dem Fuß an. »He, wach auf, Alter.«
»Ich bin wach«, sagt er und wischt sich den Mund mit dem Ärmel ab.
»Du hast ein Bett.«
»Ich … hatte nicht vor …« Er rekelt sich.
»Einzuschlafen?«
»Genau«, sagt er gähnend.
»Gut gemacht.« Ich hänge meinen Rucksack über die Lehne des Schreibtischstuhls. Der Textmarker fliegt über meine Schulter und landet auf dem Schreibtisch.
»Daneben.«
»Das war ein Warnschuss«, sagt er vom Boden aus.
Solche beknackten Dialoge sind der Grund, weshalb ich noch hier bin.
Ich drehe mich um. »Du wirst es nicht glauben, aber ich habe heute Abend einen Stalker gesehen, der hinter Pearce her war.«
Jetzt steht er und hüpft auf einem Bein. Wahrscheinlich ist sein Fuß eingeschlafen. »Was?«
»Ich schwöre.«
Nils setzt sich aufs Bett und massiert sich den Fuß. Ich erzähle erneut meine Geschichte. Als ich fertig bin, wandern seine Augenbrauen noch höher.
»Ich weiß«, sage ich. »Klingt verrückt. Pearce hat nichts gemerkt.« Ich ziehe mir die Schuhe aus. »Aber wahrscheinlich hatte die Polizei recht und es war bloß ein Schüler.«
Nils sieht einen Moment aus dem Fenster. »Erzähl das bloß nicht Pearce.«
»Warum nicht?«, frage ich.
»Darum. Diese Typen zerfleischen sich doch gegenseitig. Vielleicht ist Pearce jetzt doch mal dem falschen Schwachkopf auf den Sack gegangen.«
»Diese Wendung der Geschichte gefällt mir«, sage ich. Nils geht an mir vorbei zur Toilette auf dem Flur.
Beim Ausziehen stelle ich mir den schwarz gekleideten Typen vor und versuche ihn in Gedanken zu verwandeln, von unheimlich zu … witzig? Es klappt nicht so recht. Ich kriege dieses katzenartige Anschleichen nicht aus dem Kopf. Als Nils zurückkommt, sage ich: »Mein Hirn hat ihn einfach als Raubtier wahrgenommen.« Ich öffne und schließe die Finger, um ein Warnblinklicht nachzuahmen.
Nils lächelt. »Max, stehst du vielleicht unter dem Einfluss deiner ganzen« – er macht meine Geste nach – »True-Crime-Serien?«
»Ja.« Lachend greife ich nach Zahnbürste und Waschlappen. »Du hast recht.« Als ich mir am Waschbecken das Gesicht abtrockne und in den Spiegel schaue, denke ich, wie viel entspannter mein Leben wäre, wenn es sich in Nils’ Kopf abspielen würde statt in meinem.
Q
It’s just a shot away! Shot away! Shot away!
Der Mond sprenkelt den Wald mit silbernem Licht und meine AirPods blenden alle natürlichen Geräusche aus, als wäre ich in meiner eigenen Schneekugel, die über den Nachthimmel schwebt. Eine Illusion, ich weiß – eine, die mit einem Knall zerplatzt, wenn mich jemand erwischt. Am liebsten würde ich diesen Teil von Gimme Shelter raushauen wie Mick Jaggers Background-Sängerin, stattdessen flüstere ich mit. Das Risiko ist zu groß. Nur mein Plan – und meine Wut dahinter – halten mich davon ab, in die kalte, sternenlose Ewigkeit abzudriften.
Wütend zu bleiben, erdet mich. Meine ältere Cousine Macy mag ein ziemliches Weichei sein, aber sie hat diese Wut in mir geweckt. Die Wut lässt mich weiteratmen, die Wut hat mich nach Lycroft Phelps zurückgebracht.
Der Arsch muss zahlen, hatte Macy im Juni bei uns zu Hause geschäumt. Damals lag ich schlapp auf meinem Fenstersitz, wo ich seit meiner Rückkehr aus der Schule geschlafen hatte. In mein Bett gehörte ich nicht mehr hinein, zu meiner blumigen Tagesdecke, meinen Daunenkissen und Mr Paws, meinem kahl werdenden Teddy. Vielleicht wäre das alles anders gelaufen, wenn meine Mutter noch am Leben wäre, ist sie aber nicht. Gott sei Dank ist Macy da. Bevor sie kam, um mich zu retten, waren meine Gedanken vollkommen von einer finsteren Wolke eingenommen – einem rauchigen Phantomnebel, der mein totes Inneres widerspiegelte. Nacht für Nacht waberte er unter meiner Kleiderschranktür hervor und glitt über die breiten Holzdielen, den blauen geflochtenen Teppich und hoch zum Kissen auf dem Fenstersitz. Mir war bewusst, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis er mich verschlingen und auslöschen würde.
Und irgendwie wollte ich das auch.
Manchmal will ich es immer noch.
Deshalb brauche ich die Wut.
Nur noch wenige Takte, dann ist der Song zu Ende und ich höre wieder meinen keuchenden Atem und das Knacken der Stöcke unter meinen Converse. Ein Stück den Hügel hinauf entdecke ich ein Pärchen in der Nähe der Alten Bibliothek. Um ihnen nicht zu begegnen, biege ich tiefer in den Wald ab, genau in dem Moment, als das Gitarrenriff zur Eröffnung des Stones-Songs Can’t You Hear Me Knocking aus meinen AirPods erklingt und mir wieder Energie gibt. Die Klangebenen des Songs vermischen sich mit Kindheitserinnerungen – wie Dad mit mir über die Veranda oder den Hobbyraum oder die Küche wirbelt, wie er mir die Akkorde auf meiner Gitarre zeigt. Stumm bilde ich mit den Lippen die Worte und sehe die Noten vor mir. Als durch die Äste und Blätter erneut der Weg auftaucht, bleibe ich ruckartig stehen.
Er steht unter einem Laternenpfahl und telefoniert. Er ist es. Mein Herz zappelt in meiner Brust, ein Schmetterling in der Falle, an dem ich ersticken könnte. Ich will weglaufen, kann aber nicht. Sogar aus dieser Entfernung hat er mich eisern im Griff. Wenn ich den Revolver hätte … ich forme ihn mit der Hand, blicke mit zusammengekniffenen Augen über meinen Finger, ziele …
Er dreht sich um und geht. Meine Füße beschließen ohne meine Anweisung, ihm zu folgen. Ich husche zu einem großen Felsen. Weiter zu einem Baum. Und dem nächsten. Die Musik ist erneut verstummt; mein Atem jagt, mein Mund ist trocken. Er sagt etwas. Ich kann es nicht verstehen, aber seine Stimme kriecht in mein Ohr.
Als er in den Wald schaut, wirkt seine Haut in diesem Licht blau …
Zitternd beuge ich mich über meine Knie, verstecke mich.
Und mit einem Mal sehe ich mich selbst in jener Nacht. Am 31. Mai. Eine Raupe, die sich auf dem Rasen des Amphitheaters krümmt, vor den Marmorstatuen der neun griechischen Musen. Er ragt über mir auf und steckt das Hemd in die Hose. Zieht den Reißverschluss hoch.
Jetzt stell dich doch nicht so an.
Seine italienischen Lederschuhe, leise im taufeuchten Gras.
Schsch
Schsch
Schsch
»Officer McPhee!«, ruft jetzt plötzlich jemand.
Mir fällt wieder ein, wo ich bin. Die AirPods sind rausgefallen. Ich taste über das modrige Laub und werfe einen schnellen Blick hinter dem Baum hervor. Er ist weg, aber irgendetwas ist da los. Ich habe keine Zeit, nachzusehen. Meine Finger haben die AirPods gefunden. Als ich sie aus dem Dreck klaube, ist es mir egal, dass ich auch etwas Kleines, Schleimiges mit erwischt habe, das vielleicht sogar lebt. Ich schließe meine Hand darum, kehre in die Dunkelheit zurück und renne.
2
Freitag:Unterricht
7.22 Uhr
Doughty: Hey, was ist das da im Protokoll von letzter Nacht? Du hast die Polizei in Whitney gerufen?
McPhee: Ein Schüler hat eine schwarz gekleidete Person gemeldet, die am MINT-Block durch den Wald geschlichen ist. Ich habe die Kollegen gebeten, mal nachzuschauen, man weiß ja nie. Aber vor allem um den Jungen zu beruhigen. Waren wahrscheinlich nur Zwölftklässler, die irgendeinen Mist gemacht haben.
Doughty: Welcher Schüler war das?
McPhee: Max Hannigan-Loeffler. Elftklässler. Er war ziemlich fertig, bis wir ihn überzeugt haben, dass es nur der übliche Unsinn war und kein Scharfschütze.
Doughty: Ha! Wieso kommt mir der Name bekannt vor?
McPhee: Die undichte Gasleitung?
Doughty: Ah, stimmt. Das muss ich wohl an den Rektor weitergeben. Sonst erfährt er noch von anderen, dass die Polizei hier war.
McPhee: Ja, er mag bekanntlich keine Überraschungen. Ich schlafe jetzt mal weiter.
Doughty: Bis später.
CHARLOTTE
Es ist gar nicht so einfach, cool zu bleiben, wenn ein ganzer Tisch voller Zwölftklässler zu lachen anfängt, sobald du näher kommst, vor allem, wenn vier der Jungs aussehen wie Schauspieler an einem Filmset. Seb sitzt mit Colin Pearce und zwei anderen Ruderern, Khalid Zia und Tyler Wiggins, auf der Terrasse vor Spangler Hall unter den großen Buntglasfenstern. Khalid kommt aus dem angeblich super wohlhabenden Jupiter in Florida. Er gehört zu der Art Typen, die nur so zum Spaß ihre Freunde bloßstellen, deshalb werde ich in seiner Gegenwart immer nervös. Tyler dagegen macht Seb Konkurrenz, was das Aussehen angeht. Dunkle Haare, noch dunklere Augen und ein verschmitztes Grinsen. Sein Vater ist Filmproduzent und seine Mutter ein ehemaliges Supermodel. Ich sag es jetzt einfach: Seine Lippen laden sehr zum Küssen ein. In der Neunten haben Hannah und ich ihn jeden Abend in der Bibliothek beobachtet. Er hatte keine Ahnung. Aber dann bekam Tyler Besuch von seinem ebenso scharfen Lover aus L.A. So einige Mädchen der LPS haben an jenem Tag ein paar Tränen vergossen. Khalid und Colin sehen zwar nicht so gut aus wie Seb und Tyler, aber der athletische Körperbau und das selbstbewusste Auftreten machen das wett. Die Tänzerin in mir hat versucht zu analysieren, was genau an ihrer Körpersprache Selbstbewusstsein ausstrahlt. Die Kopfhaltung? Die leicht gestrafften Schultern? Der Gang? Oder kommt es einfach aus ihrem Inneren und verbreitet sich über das ungezwungene Lächeln wie ein unterschwelliges WLAN-Signal?
Dies ist der Moment für meine Ballett-Superkraft. Ich richte mich auf, lasse die Schultern sinken und überprüfe meinen Gang. Grace hat unrecht: Ich bin keine geborene Lycrofterin. Jetzt gerade bin ich zu 100 Prozent choreografiert.
»Was ist denn so witzig?«, frage ich. Es klingt gezwungen, was nicht gut rüberkommt, deshalb gleiche ich es damit aus, dass ich meine flachen Schuhe wie Ausrufezeichen auf den Terrassenstufen klappern lasse. Seb streckt die Hand aus und streicht mir über die Finger. Mein Herz macht einen Satz wie ein Goldfisch.
»Nichts«, sagt er grinsend. Dann wendet er sich an die anderen. »Der Coach wird uns einfach den Steuermann aus dem zweiten Boot zuteilen.«
Tyler und Khalid stöhnen auf. »Bloß nicht Dougie Nelson. Den Typen ertrag ich nicht«, knurrt Tyler.
»Ihr seid nicht hier, um Freunde fürs Leben zu werden«, sagt Colin und ahmt dabei Coach Follett, ihren Rudertrainer, nach. »Ihr seid hier, um zu gewinnen.«
»Haha!«, sagt Khalid und ich weiß nicht genau, ob das ironisch gemeint ist.
Seb legt mir den Arm um die Taille. »Ich habe versucht, Charlotte als Steuermann anzuwerben«, verkündet er und zieht mich an sich. »Scheiß Ballett.«
Einen Moment lang sagt niemand etwas und mir wird übel.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















