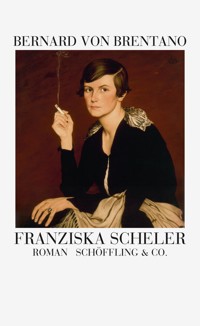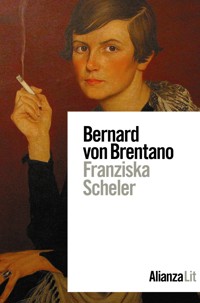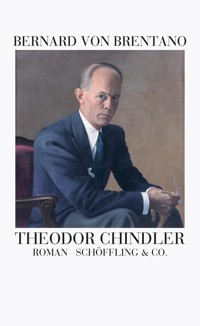
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Dieser Roman eines deutsch-katholischen Bürgerhauses vor dem Hintergrund der Kriegszeit ist ein vorzügliches Buch, mit leichter und sicherer Hand gemeistert, klug, klar und fesselnd." Thomas MannIm gutbürgerlichen Haushalt der Chindlers spielt man Klavier und geht sonntags in die Kirche. Es ist das Jahr 1914. Theodor Chindler, Abgeordneter für die katholische Zentrumspartei und Familienoberhaupt, macht Politik im Berliner Reichstag, während seine Söhne Ernst und Karl fürs Vaterland an die Front ziehen. Zu Hause diskutieren die anderen Familienmitglieder hitzig über den Kaiser, das Elend in den Lazaretten und den Seekrieg - und so brechen die politischen Überzeugungen auseinander. Als sich Tochter Maggie gegen den Willen des Vaters der Arbeiterbewegung zuwendet und sich der jüngste Sohn Leopold in einen Mitschüler verliebt, ist auch in der Heimat nichts mehr so, wie es war. Bernard von Brentano erzählt aus den Hinterzimmern der Politik während des Ersten Weltkrieges, vom elenden Sterben in den Schützengräben - aber vor allem von einer Familie in Zeiten sozialer wie lebensweltlicher Umwälzungen. Der Roman "Theodor Chindler", der 1936 im Schweizer Exil entstand, wurde oft mit Heinrich Manns "Der Untertan" oder "Professor Unrat" verglichen. Ein Zeit- und Sittengemälde, das bis heute nicht an Eindringlichkeit verloren hat."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Erstes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Zweites Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Drittes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Viertes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fünftes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sechstes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Nachwort
1
2
3
4
5
Autorenporträt
Über das Buch
Impressum
Das Gegenteil eines Fehlers ist ein anderer Fehler
Theodor Chindler
Erstes Buch
1
Das Gebäude des »Allgemeinen Anzeigers«, der größten Zeitung der kleinen Stadt, lag am Siegesplatz. Links davon stand, aus rotem Sandstein aufgeführt, die Hauptpost. Schräg ihr gegenüber lag die Mehlhandlung von Werner oder, besser gesagt, das Haus, in dem die Werner-Buben wohnten, zwei Jungens, die ihrer Stärke und bodenlosen Frechheit wegen bei einem Teil der Bevölkerung berühmt, bei andern berüchtigt waren. Es standen noch mehr Häuser auf dem Platz. Aber die genannten waren die bekanntesten, und die Leute, die in den anderen wohnten, kannten, wie man zu sagen pflegt, wahrscheinlich nur sich selber.
Höher als drei Stockwerke war übrigens kein Haus. Alle waren klein und provinzlerisch und der ganze Platz mehr eine Lücke zwischen Häusern als eine durchdachte Anlage. In der Mitte stand das Kriegerdenkmal von 1871, eine unförmige Frau aus Eisen, die ihrer gewaltigen, nur halb bedeckten Brüste wegen von Vorübergehenden oder von Schuljungen betrachtet wurde. Die Kalender zeigten den 1. August 1914. Es war heiß, fast schwül, aber eine große Menge von Menschen drängte sich auf dem Platz zu den Schaufenstern der Zeitung. Jeder wollte mit eigenen Augen das Extrablatt über die Mobilmachung lesen, das die Redaktion ausgehängt hatte.
»Da! Dort! Da bringen sie etwas!« rief jemand. Der Ausruf brachte neue Bewegung in die gezwängte Masse, und die Leute versuchten, wieder nach vorn, dem Redaktionsgebäude zuzudrängen. Ein kleiner buckliger Mensch, der als Austräger des »Anzeigers« stadtbekannt war, öffnete die Ladentür und stand nun, zwischen Tür und Menschen eingekeilt, einen Stoß Extrablätter auf den Armen, ängstlich und ärgerlich vor der Menge. In diesem Augenblick kam ein Offizier, der von einem Trommler und einem Schutzmann begleitet wurde, aus einer Seitenstraße. Der Trommler schlug einen Wirbel. Sofort verstummte die Menge und lauschte. Aber der Offizier verlas seine Meldung so leise, daß ihn nur ein kleiner Teil der Leute verstehen konnte. »Das ist der Assessor Gerber«, sagte eine Frau, die weit hinten stand.
Als der Offizier fertig war, wurde wieder getrommelt, aber die Menge wartete nicht und begann den Choral zu singen: »Nun danket alle Gott«. Ein paar Schulbuben und jüngere Leute kletterten auf den Sockel des Siegerdenkmals. Als die erste Strophe verklungen war, trat ein Kommis, der sich durch eine kräftige Baßstimme hervorgetan hatte, einem älteren Mann von oben auf den Hut. »Warum singen Sie eigentlich nicht?« fragte er, als sich der Mann wütend umdrehte.
»Wieso?«
»Wieso? Weil Sie den Mund gehalten haben.«
»Jeder nach seiner Art«, antwortete der Mann und drehte sich wieder um.
Der Jüngling gab nicht nach. »Sind Sie vielleicht ein Serbe oder sonst ein ausländisches Vieh?« fragte er so laut, daß man es im ganzen Umkreis hören konnte.
»Ich bin von Mannheim«, antwortete der Mann.
»Hut herunter!« rief nun jemand.
Der Mann bückte sich, zog seinen Hut tief über die Ohren und hielt ihn mit beiden Händen fest. »Ich leide an einer Mittelohrentzündung«, erklärte er seiner Nachbarin. »Ich muß mich vor Erkältung schützen.«
Die Uhr auf der Post schlug eins. »Donnerwetter, ein Uhr, jetzt komme ich zu spät«, sagte ein Junge, der so hoch auf das Denkmal hinaufgeklettert war, daß er sich an dem Schwert der Germania festhalten konnte. Mit zwei Sätzen sprang er herunter, drückte sich, den Kopf vorstoßend, gebückt durch die Menge und lief, was er konnte, durch eine Seitenstraße davon.
Die Stadt war regellos gebaut. Das Villenviertel, in dem die wohlhabenden Leute wohnten, grenzte unvermittelt an einen Stadtteil, in dem viele Fabriken standen. Die Straße lief schnurgerade, aber plötzlich traten die Häuser zurück, kleine Vorgärten erschienen und eine Villa reihte sich an die andere. Vor dem Haus Nr. 100 blieb der Knabe, der so rasch vom Siegesplatz fortgelaufen war, stehen und sah vorsichtig an der Fassade empor, ob wohl jemand aus den Fenstern schaue. Zu seinem Erstaunen waren im Erdgeschoß alle Läden herabgelassen. Er versuchte, das schwere eiserne Gartentor zu öffnen. Es war verschlossen. Was ist denn hier los? dachte er und klingelte kurz zweimal, wie es den Kindern des Hauses befohlen war. Die Köchin kam heraus und schloß auf. »Wo bleibst du denn?« fragte sie den Knaben. »Es ist gleich halb zwei Uhr!«
»Ißt man schon?«
»Natürlich! Deine Großmama ist gekommen und das Fräulein Chindler aus Wiesbaden auch.«
Als Leopold Chindler das Eßzimmer betrat, saß die Familie um den Tisch. Der Junge, der noch ganz außer Atem war, wollte sich eben entschuldigen, als er sah, daß der Tisch zwar voll, aber weder sein Vater noch seine Mutter anwesend war. In dem Lehnstuhl, in dem sonst nur der Professor Chindler sitzen durfte, saß Frau von Beaufort, die Schwiegermutter des Hausherrn. Wie immer hielt sie sich starr aufgerichtet, die linke Hand mit den vielen farbigen Ringen auf die Lehne des Sessels gestützt und die Rechte, welche die Gabel hielt, zum Munde führend. Neben ihr saß Tante Friederike, die Schwester des Hausherrn. Ihr folgte die Erzieherin der Tochter, Mademoiselle Du Pont, die neben ihrem Zögling Margarethe Chindler saß. Gegenüber saß Fräulein Wendt, die Erzieherin der Söhne, und Leopold sah sofort, daß sein jüngerer Bruder Hans die Gelegenheit seiner Verspätung benutzt hatte, um ihm seinen Platz neben der Wendt wegzunehmen.
Das rot tapezierte Zimmer war dunkel und kühl. Die schmale Glastür, die über die Veranda in den Garten führte, war geschlossen und die Vorhänge zugezogen. Der Schäferhund saß wie gewöhnlich auf einem Küchenstuhl am Fenster und beobachtete mit gespitzten Ohren die Essenden. Niemand sprach ein Wort. Der Knabe, verwirrt durch den Kontrast zwischen dem begeisterten Jubel auf der Straße und der krankenhausartigen Stille des Raumes, setzte sich schweigend, um seine Suppe zu löffeln.
»Ich habe dich nicht beten sehen«, sagte Frau von Beaufort zu ihrem Enkel, den sie seit seinem Eintritt in das Zimmer nicht aus den Augen gelassen hatte.
Leopold erhob sich, murmelte eine Entschuldigung und hatte eben das Zeichen des Kreuzes gemacht, als sich die Tür zum Salon öffnete und seine Mutter ins Zimmer trat. Sie hielt ihr kleines, weißes Taschentuch in der Hand, und die Tischgesellschaft sah, daß sie weinte.
»Ach, Mami«, rief Margarethe, als sie ihre Mutter so außer sich sah, und wollte aufspringen, aber Frau von Beaufort machte Mademoiselle Du Pont ein Zeichen, die das Mädchen auf den Stuhl zurückzog.
»Das muß jetzt ein Ende nehmen«, sagte Frau von Beaufort zu ihrer Tochter. »Ich würde einen Arzt kommen lassen. Mir scheint das krankhaft.«
»Er wirft ihn hinaus. Er ist ja ganz verrückt. Sein Herz kann das nicht aushalten. Er wird sterben«, antwortete Frau Chindler. Sie stellte sich vor die Verandatür und als sie sich nun umwandte, schien ihr etwas einzufallen. »Die Kinder«, sagte sie, »sollen hinaufgehen und oben essen. Vielleicht kann ich ihn dann bewegen, hereinzukommen und etwas zu sich zu nehmen.«
Sofort erhoben sich die Erzieherinnen und drängten die beiden erstaunten Knaben aus der Tür. Auch Margarethe, ein Mädchen von neunzehn Jahren, folgte ihnen.
»Weißt du, daß wir Krieg mit Rußland haben?« flüsterte Leopold seiner Schwester ins Ohr.
Das Mädchen sah krampfhaft gradeaus und tat, als höre es nichts.
2
Der Mann, der es an diesem Mittag ablehnte, wie gewöhnlich mit seiner Familie zu essen, war der Professor Dr. Theodor Chindler, der Besitzer der Villa in der Ludwigstraße Nr. 100, ein bekannter, ja, wie viele Leute sagten, ein berühmter Bürger der kleinen Stadt.
Ursprünglich aus Schlesien stammend, war die Familie Chindler unter Friedrich dem Großen (dem II., wie man deutlich betont in der Familie Chindler sagte) ihres katholischen Glaubens wegen nach Süddeutschland gewandert, wo Chindler in Karlsruhe als Sohn eines in badischen Diensten stehenden Geheimen Rates 1851 geboren wurde. Ein hübscher Mensch, ein guter Schüler und ein glühender Bewunderer von Görres, dem nachzueifern er sich bestrebte, machte er seine Examina mit Auszeichnung und hatte sich eben an der Universität Bonn als Privatdozent für Geschichte habilitiert, als der Kulturkampf das katholische Lager in gewaltigen Aufruhr versetzte. Anfangs, nach der Erklärung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes, die Pius XI. 1870 verkündet hatte, war Chindler, wie viele Katholiken, erstaunt und zögernd geblieben. Noch jung, ohne Verpflichtungen an ein Amt und seines Reichtums wegen an eine Kaste, hatte er nachgedacht und mit Freunden debattiert. Hatte nicht die ältere und auch noch die mittelalterliche Kirche die Unfehlbarkeit den allgemeinen Konzilien zugesprochen? Jetzt hieß es, an die Unfehlbarkeit eines einzigen Mannes glauben. Ja, die Definitionen des Papstes sollten an sich und nicht erst durch die Zustimmung der Kirche unabänderlich sein.
Dieser Pius war ein entschlossener Mann. Das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis der Mutter Jesu, das er in den fünfziger Jahren verkündet hatte, mochte noch hingehen. Aber dieses neue, diktatoriale Dogma? War nicht der Papst Honorius seines Irrtums wegen vom 6. allgemeinen Konzil verurteilt worden? Konnte nicht Pius irren wie Honorius?
Die Debatten wurden heftiger, und Chindler zog sich zurück, die Kämpfe als theologische bezeichnend, um ihren politischen Charakter nicht untersuchen zu müssen. Auch war er noch jung und das Leben farbig. Von einer Reise nach Genf, die er gemeinsam mit seiner Schwester Friederike machte, brachte er einige französische Bücher mit, die er mit wachsender Bewunderung las. Flauberts »Geschichte der Frau Bovary« fesselte ihn so, daß er Tag und Nacht grübelte und mit benommenem Kopf herumlief. Er zweifelte nicht, daß in diesem Buch die Liebe selber geschildert wurde. Aber wo hatte man in seiner Heimat je solche Liebe und solche Menschen gesehen? Er las »Germinie Lacerteux« der Brüder Goncourt und endlich »Die Elenden« von Hugo. »Solange die drei Probleme des Jahrhunderts nicht gelöst sind«, schrieb er an seine Schwester, »die Entwürdigung des Mannes durch das Proletarierdasein, die Schändung des Weibes durch den Hunger, die Verwahrlosung des Kindes durch die geistige Finsternis, worin es gehalten wird, solange …« Aber Fräulein Chindler teilte seine Liebe zu diesen Büchern nicht. Auch seine Freunde blieben stumm. Deutschland war noch zu klein und zu mittelalterlich. Chindler begann zu glauben, in Deutschland könne es keine Proletarier geben, und Frauen wie Frau Bovary für verachtenswerte französische Weiber zu halten. Er kehrte wieder zu seinem geliebten Görres zurück.
Um die gleiche Zeit unterwarf er sich in der Frage der Unfehlbarkeitserklärung. »Das Entscheidende«, dozierte er seinen Freunden, »ist die Unterwerfung unter die Autorität der Kirche und die Annahme einer einzelnen Lehre, weil sie von der Kirche vorgetragen wird. Katholisch sein heißt nicht, diesen oder jenen Lehrpunkt als richtig annehmen. Katholisch sein heißt, den ganzen Glauben hinnehmen.«
So war die Bahn frei und der Weg vorgezeichnet, als der Kulturkampf sein Leben änderte. Von Anfang an kämpfte Chindler auf der Seite Roms und gegen Bismarck. In seinem Haß gegen die Berliner Regierung saßen mehr Gründe als nur der religiöse. Im Sommer 1866, bei Verwandten in Darmstadt zu Besuch weilend, hatte er dort den Einmarsch der preußischen Truppen erlebt. Vom Fenster aus sah er die fremden Husaren mit geladenem Karabiner an der Straßenecke stehen, und man saß gerade bei Tisch, als sie eindrangen und in ihrem Dialekt mehr Quartier verlangten, als Platz vorhanden war. Die Erinnerung an diesen Vorfall, die in der Familie gepflegt wurde, vergaß er nicht.
Der Kampf zwischen Berlin und Rom zog sich hin. Chindlers Kollegen warnten. An der Universität Bonn befahl nicht der Papst, sondern die Regierung, und man machte Chindler darauf aufmerksam, daß er sein Leben lang Privatdozent bleiben werde, falls er auf seiner bismarckfeindlichen Haltung beharre. Chindler gab nicht nach.
Verwandte seiner Mutter luden ihn nach Hannover ein und machten ihn mit Windthorst bekannt, dem Führer der katholischen Zentrumspartei. Chindler war begeistert, und von Stund an kämpfte er in zwei Lagern. Als religiöser Mensch verteidigte er die Kirche und die Ansprüche, die Rom an die deutsche Regierung stellte, als Politiker kämpfte er für die Stärkung der Zentrumspartei. An der Universität las er, von der gesamten Dozentenschaft boykottiert, vor vier Studenten über die Definition der Seele bei Aristoteles.
Um der wachsenden Vereinsamung zu entgehen, trat er einem kleinen Verein bei, der von einem Pfarrer geleitet wurde.
3
Etwas über dreißig Jahre alt verheiratete er sich. Im Hause eines Kaufmanns begegnete er Elisabeth von Beaufort. Man glaubte, er mache der jüngeren Schwester der Hausfrau den Hof und lud ihn fast täglich ein. Aber Chindler beobachtete Fräulein von Beaufort, welche als Kinderfräulein im Hause angestellt war. Sie war arm und nicht schön, aber Chindler liebte sie und wußte nicht, wie er sich verhalten sollte.
»Soll ich sie heiraten?« schrieb er an seine Schwester.
Fräulein Chindler reiste herbei und zog Erkundigungen ein. Fräulein von Beaufort war die einzige Tochter eines ehemaligen Offiziers und Gutsbesitzers. Als ihr Vater ihre Mutter heiratete, stand er als Rittmeister bei einem Kavallerieregiment in Düsseldorf. Kurz nach der Hochzeit nahm er seinen Abschied, um sich, von dem Geld seiner Frau lebend, ganz griechischen und lateinischen Studien widmen zu können, die er schon als Offizier begonnen hatte. Er dachte daran, sich als Dozent niederzulassen, als er über Nacht in Armut versank. Frau von Beaufort war nämlich nicht reich, sondern nur die einzige Nichte eines außerordentlich reichen Kaufmannes in Köln, der ihr, wie alle Welt wußte, seine gewaltigen Besitzungen an der Mosel zu hinterlassen versprochen hatte. Herr von Beaufort hatte nun seine Frau überredet, auf diese ebenso große wie sichere Erbschaft Geld im voraus aufzunehmen. Davon lebte er mit Frau und Kind auf einem kleinen Landhaus in der Nähe von Koblenz.
Da starb jener Onkel, Herr von Beaufort fuhr nach Köln, um den Mann zu beerdigen und das Testament zu öffnen. Tatsächlich war seine Frau die einzige Erbin jener riesigen Besitzung an der Mosel, aber die Besitzung war nicht mehr da. Der Kaufmann, ein alter Herr von achtzig Jahren, hatte sie für 300000 Mark, und das heißt für den zehnten Teil ihres Wertes, an einen Händler verkauft. Noch in Köln nahm Herr von Beaufort einen Rechtsanwalt, der den Händler verklagte. Man behauptete, der alte Kaufmann sei bei Abschluß jenes unnatürlichen Vertrages nicht mehr im Besitz seiner geistigen Kräfte gewesen, aber der Beweis war nicht zu führen. Als der Prozeß verloren und das Geld, das man vorher aufgenommen hatte, zurückbezahlt war, besaß die Familie Beaufort nur noch die Pension, die Herrn von Beaufort als Rittmeister a.D. zustand.
»Es sind sonderbare Verhältnisse«, sagte Fräulein Chindler, als sie ihrem Bruder erzählt hatte, was ihr berichtet worden war.
»Ach was«, antwortete Chindler. »In allen Familien herrschen sonderbare Verhältnisse. Wenn sie mich nimmt, heirate ich sie.«
»Sie ist ehrgeizig …«
»Weil sie gebildet ist. Sie kann Französisch und Englisch, und seit sie mich kennt, hat sie angefangen, Lateinisch zu lernen.«
»Die Art, wie sie sich in ihrer Stellung benimmt, gefällt mir nicht!«
»Weil die Stellung nicht zu ihr paßt.«
»Weil sie hochmütig ist. Das paßt zu uns auch nicht.«
»Besser als wenn sie demütig wäre.«
»Ich halte sie für berechnend.«
»Das ist nicht wahr.«
»Du bist verliebt«, sagte Friederike.
»Natürlich«, antwortete Chindler.
Einige Zeit darauf heiratete er Fräulein von Beaufort.
Der Kulturkampf ging zu Ende. In Rom war Leo XIII. zur Herrschaft gekommen, und Bismarck einigte sich mit ihm, über den Kopf der katholischen Partei hinweg. Außer sich über diesen Verrat, griff Chindler noch einmal in den Streit ein, Windthorst verteidigend, zur Fortsetzung des Kampfes auffordernd. Aber die Kirche war müde und wollte Ruhe haben. Chindler verscherzte sich lediglich noch die Sympathie des Klerus und saß nun zwischen allen Stühlen. Angewidert und verbittert warf er seine Studien hin, um einen anderen Beruf zu ergreifen. Windthorst erfuhr davon, ließ ihn kommen, überredete ihn, sich ganz der Politik zu widmen und verschaffte ihm ein Mandat der Zentrumspartei für den Reichstag im Wahlkreis von Neustadt.
Frau Chindler hatte an dem Leben in Bonn wenig Gefallen gefunden. Die Frau eines Privatdozenten zu sein, der, von aller Welt gemieden, einer Handvoll Studenten unverständliche Dinge beibrachte, langweilte sie. Da war die Politik etwas anderes. Unter ihrem Einfluß folgte Chindler dem Rat des alten Politikers von Hannover. Weil er die Universität für immer verließ, schenkte man ihm zum Abschied den Titel Professor.
4
Außer sich vor Zorn über den unverständlichen Befehl seiner Mutter war Leopold mit seinen Geschwistern und den Erzieherinnen die Treppe bis zum zweiten Stock hinaufgestiegen, wo die Kinderzimmer lagen. Die Köchin brachte etwas Fleisch und Gemüse, aber Leopold stocherte nur in seinem Teller herum. »Warum«, maulte er, »müssen wir oben essen? Ich habe nichts getan. Dafür wird man bestraft. Es ist alles Quatsch wie immer.«
Auch Mademoiselle Du Pont hatte keinen Appetit. Alle Leute sprachen vom Krieg. Sie fürchtete sich. In Frankreich lebte keiner ihrer Verwandten mehr. Wohin sollte sie gehn? Wo ihr Brot verdienen? Margarethe umarmte sie und versuchte sie zu trösten. Aber sie drückte sich so ungeschickt aus, daß sie den Kummer der armen Jungfer zum Überlaufen brachte. Mademoiselle Du Pont bemerkte plötzlich, wie allein sie in der Welt stand, die in eine ihr unerklärliche Bewegung gekommen war. Sie besaß nichts außer einem Koffer. Angst packte sie, und sich abwendend, um nicht gesehen zu werden, fing sie an, leise zu weinen.
Frau Chindler trat ins Zimmer. Sie hielt noch die Serviette vom Mittagstisch in der Hand, was einen komischen Eindruck machte. Aber ihr Gesicht war bleich und ernst, und Leopold sah, daß sie die Lippen fest zusammengepreßt hielt, ein böses Zeichen.
»Was macht ihr hier oben? Ich will, daß ihr alle gleich in den Garten geht und normale Gesichter macht. Sie brauchen auch nicht zu weinen, Mademoiselle, das regt meine Kinder nur auf.«
Die bestürzte Gruppe verließ das Zimmer. Man wurde heute wirklich viel gejagt. Nur Leopold wurde von seiner Mutter festgehalten. »Dein Vater«, sagte sie, »will wissen, warum du so spät nach Hause gekommen bist?«
Die Frage war unehrlich. Professor Chindler lag in seinem Arbeitszimmer, das er abgeschlossen hatte, und wütete mit Gott und der Welt gegen den Krieg, gegen alle Politiker und alle Menschen. Er hatte gar nicht gemerkt, daß Leopold zu spät zum Essen gekommen war. Aber Frau Chindler liebte es, sich vor den Kindern hinter ihrem Mann zu verschanzen. Sie hatte fünf geboren und ihrer Meinung nach kein einziges davon bisher richtig zu erziehen verstanden. Alle waren nicht so, wie sie sein sollten. Nun versuchte sie, wenigstens an den beiden Jüngsten zu verbessern, was nur zu verbessern war.
»Es ist doch Krieg, Mami«, sagte Leopold zu seiner Mutter.
Frau Chindler stampfte mit dem Fuß auf. »Das ist Unsinn. Wer hat dir das gesagt?«
Ein Auto fuhr auf der Straße vor, und gleich darauf kreischte das Gartentor, das wieder nicht geschmiert worden war. Elisabeth Chindler ließ den Jungen stehen, der sich sofort aus dem Staube machte, und lief ans Fenster. Sie beugte sich weit hinaus, was ihr nicht leicht fiel, weil sie in letzter Zeit dick geworden war, und konnte gerade noch sehen, daß der Telegraphenbote gekommen war. Sein gelbes Rad lehnte an der Buche, die vor dem Hause stand.
Das Auto, ein grüner, offener Tourenwagen, war gegenüber am Hause des reichen Kommerzienrats Weber vorgefahren. Elisabeth Chindler umklammerte die Eisenstange vor dem Fenster. Wie man im Theater den Mann, der den Dolch hinter dem Rücken hält, auf den Helden zugehen sieht, sah sie Webers einzigen Sohn in einer neuen, grauen Uniform, die ihm gut stand, aus dem Wagen steigen und den Säbel nachschleppend auf das Haus zugehen. Gleichzeitig öffnete sich bei Webers die Haustür. Frau Weber, die auf einem Bein gelähmt war und eine blonde Perücke trug, hinkte mit gepeitschter Hast die Treppe herunter, verlor dabei ihren Stock, lief trotzdem weiter, schwankend, die Hände erhoben, bis sie in die Arme ihres Sohnes fiel.
Also war doch Krieg.
Es klopfte. Die Köchin kam ins Zimmer und brachte zwei Telegramme. »Lies vor«, sagte Frau Chindler, »ich habe meine Brille im Eßzimmer gelassen.« Sie setzte sich in einen Sessel und fügte hinzu: »Ich will tapfer sein.«
Die Köchin riß das Papier auf und las: »Eintreffe 4 Uhr. Karl.«
»Und das andere?«
»Eintreffe zum Abschied fünf Uhr. Ernst.«
Frau Chindler wandte sich ab und schaute wieder aus dem Fenster auf das Webersche Haus hinüber. Das Auto war fortgefahren. Die Straße lag leer, heiß und gelb. Am Himmel waren keine Wolken.
»Ich glaube, Sie sollten hinuntergehen«, sagte die Köchin. »Der Herr Professor röchelt so merkwürdig.«
»Er läßt mich ja nicht in sein Zimmer«, sagte Elisabeth Chindler, »oder hat er jetzt seine Tür aufgeschlossen?«
»Ich weiß es nicht«, sagte die Köchin. Nach einer Weile, als Frau Chindler immer noch schwieg, fragte sie: »Ist denn jetzt wirklich Krieg?«
Frau Chindler antwortete nicht, und die Köchin wiederholte ihren Vorschlag. »Sie sollten wirklich hinuntergehen. Es kann dem Herrn etwas zustoßen. Dann machen Sie sich Vorwürfe.«
Therese Schmelzenbach arbeitete seit zwanzig Jahren im Hause Chindler. In dieser langen Zeit hatte sie so viel Zank und Streit bei denen gesehen, die ihr Befehle erteilten, daß sie sich neuerdings einige Freiheiten herausnahm. Anfangs hatte sie sich gewundert, daß sich reiche Leute so beschimpften wie bei ihr zu Haus betrunkene Bauern. Mit der Zeit aber merkte sie, daß Mensch eben Mensch ist, mit dem einen Unterschied, daß die einen Geld haben und die andern nicht.
»Ich habe mir keine Vorwürfe zu machen«, sagte Frau Chindler. »Was soll aus dem Haus werden, wenn ich mich auch einsperre und die Läden herunterlasse? Ach, ich möchte mich gern gehenlassen! Mein ganzes Leben lang habe ich mich zusammennehmen müssen …« Sie preßte wieder ihre Lippen zusammen. »Mir erlaubt niemand, mich gehenzulassen … wo meine Söhne kommen … vielleicht zum letzten Male … der Herr Karl und der Herr Ernst …« Sie fing an zu weinen, und weil sie kein Taschentuch zur Hand hatte, trocknete sie sich die Augen mit der Serviette.
Therese betrachtete Frau Chindler. Was da vor ihr saß, war einerseits ihre Arbeitgeberin, anderseits ein unglückliches Weib, das sich anscheinend nicht zu helfen wußte. Sie legte die Telegramme auf den Tisch und ging aus dem Zimmer.
5
1886 hatte Elisabeth Chindler geheiratet. In den ersten Monaten ihrer Verlobungszeit liebte sie Theodor Chindler. Dann merkte sie an der Art, wie er sich in den politischen und religiösen Kämpfen verhielt, daß er (ihrer Ansicht nach) ein schwankender Mensch war. Sie erschrak und überlegte. Heiraten wollte sie, und dieser Mann war nicht nur eine gute Partie, sondern der Ausweg aus der Misere ihres Elternhauses und der bedrückenden Stelle in Bonn, welche eine Folge jener Misere war. Aber sie sagte sich, es werde viel auf sie zukommen. Zunächst nahm sie ihre Sprachstudien wieder auf, die sie im Jubel der ersten Wochen ihrer Liebe vernachlässigt hatte. Aber nach der Hochzeit merkte sie, daß es auf andere Dinge ankommen werde, auf die Führung des Haushalts, auf die Überwachung des kleinen Vermögens und hauptsächlich auf die Karriere ihres Mannes.
Nur keinen Mann haben, der nichts war.
Als der Prozeß ihrer Eltern um die Erbschaft des Onkels endgültig verloren war, fing ihr Vater an zu trinken. Abend für Abend schloß er sich in sein Zimmer ein und soff Rotwein, bis er lallte. Dabei ging er, wie ein Wolf im Käfig, fortwährend von einem Zimmer ins andere und schlug jedesmal, so fest er nur konnte, die Tür hinter sich zu. Elisabeth, die mit ihrer Mutter im ersten Stock schlief, zählte die Schläge. Päng … jetzt war er in den Salon gegangen. Bumm … jetzt hatte er die Salontür zugeschlagen. Päng … jetzt war er wieder in seinem Arbeitszimmer angekommen. So ging das Nacht für Nacht. »Du bist an allem schuld«, sagte er zu seiner Frau, wenn er mittags aufgestanden war, »du mit deiner verfluchten Verschwendungssucht!«
»Du hast den Salat doch nur gegessen, wenn er gut angemacht war«, antwortete Frau von Beaufort.
»Da hast du deine Mitgift …« sagte er zu seiner Tochter und warf ihr ein leeres Portemonnaie an den Kopf.
Elisabeth Chindler stöhnte. Sie erinnerte sich noch genau an die kleine blaue Geldtasche, die sie in Köln gekauft und ihrem Vater zu Weihnachten geschenkt hatte. Diesen Beutel hatte er ihr an die Haare geworfen.
Nein, nein, nur keinen Mann haben, der nichts war!
Als sie mit ihrem Mann Bonn und die verhaßte Universität verließ, atmete sie auf und schwärmte für Windthorst.
Man zog nach Neustadt. Aber was war das für ein langweiliges Nest. Die Stadt hatte 105000 Einwohner, davon 85000 Arbeiter. Der Rest waren Beamte, die sogar in der Mode mit der Regierung gingen, Offiziere, die sich nur ängstlich herbeiließen, mit dem ultramontanen Professor zu verkehren (übrigens Train und Troß, mit dem ein vornehmer Kavallerist wie Elisabeths Vater nie verkehrt haben würde), und reiche, teilweise enorm reiche Fabrikanten, die alle so liberal waren, daß sie nur mit Liberalen umgingen.
Nach einer Weile merkte Elisabeth, daß man vom Regen in die Traufe gekommen war. In Bonn hatte man Chindlers boykottiert; in Neustadt beachtete man sie wenig. Erst als sich ihre finanziellen Verhältnisse besserten und das Ehepaar Diners geben konnte, lockerten sich die Widerstände. Man sprach über sie und begann sie zu besuchen.
Ach ja, die Armut!
Auch Chindler hatte bei einer Spekulation, zu der ihn ein Kölner Bankier verleitet hatte, Geld verloren. Der Rest, der blieb, langte noch zum Leben, aber nur zu einem sehr einfachen Leben, bei dem jede Ausgabe eingeteilt sein wollte und jede unvorhergesehene Rechnung zu Streitigkeiten zwischen den Eheleuten führte, die man zwar voraussehen, aber trotzdem nicht abstellen konnte. Jedesmal, wenn Chindler zu Sitzungen der Fraktion nach Berlin fuhr, brauchte er mehr Geld als vorberechnet war, und Elisabeth jammerte dann, weil alle Berechnungen wieder kaputt waren.
»Du hast keine Ahnung von Geld«, schimpfte Chindler, »weil du …«
Er wollte etwas Kränkendes sagen, beherrschte sich aber und schwieg. Aber Elisabeth fühlte, was er hatte sagen wollen, und spürte in solchen unvollendeten Sätzen Anspielungen auf die Vorkommnisse in ihrem Elternhaus heraus.
»Ich bin ein Weib«, sagte sie zu ihrer Schwägerin, mit der sie sich befreundet hatte, »ich kann keine Karriere machen. Aber Theodor ist gescheit. Er muß es schaffen. Meinst du nicht?«
Friederike Chindler nickte als Antwort mit dem Kopf.
Theodor Chindler war nicht ehrgeizig. Schon nach kurzer Zeit langweilte ihn seine Statistenrolle in der Politik, und er dachte darüber nach, wie er es anstellen könnte, wieder an einer Universität anzukommen.
»Das geht doch nicht«, sagte Elisabeth Chindler, als sie ihn durchschaute. »Du weißt genau, daß man nie wieder an eine Universität kommt, wenn man einmal eine Professur aufgegeben hat.«
Chindler hörte sie an und wußte, daß seine Frau die Wahrheit sagte. Aber er spürte ihre Freude darüber, daß diese Karriere kaputt war, die sie nicht geliebt hatte. Das erbitterte ihn.
»Wenn kein Geld da ist«, sagte er, »und ich wie ein Kuli leben muß, kann ich auch nur ein Kuli sein. Karriere kann man nur mit Geld machen.«
»Hat Krupp Geld gehabt, als er anfing?« fragte Frau Chindler.
»Bin ich Krupp?«
»Du könntest mehr sein, wenn du nur wolltest!«
»Dann bist du noch lange nicht Frau Krupp …«
»Ich habe fünf Kinder geboren und aufgezogen«, antwortete Elisabeth Chindler. »Ich habe meine Pflicht getan. Und ich habe noch mehr getan. Als wir anfingen, ich meine, als dir dieser Schuft in Köln die Mexikaner aufhängte, die dann alle nichts mehr wert waren, hatten wir 150000 Mark und 6000 Rente. Das war wenig. Aber meine eiserne Sparsamkeit brachte es dahin, daß wir heute 200000 und 8000 Rente haben …«
»… und das Haus …?«
Elisabeth Chindler wachte aus ihren Träumen auf und rollte die Serviette zusammen, die auf ihrem Schoß lag.
Wer hatte eben gesagt: »Und das Haus?« Es war mit der Stimme Chindlers gesprochen worden.
Die Tür stand auf und das Zimmer war leer. Die Köchin war längst wieder in der Küche. Als sich die schwere Frau erhob und in die Mitte des Zimmers trat, senkte sich der Boden. Davon gingen die Türen des großen, weißlackierten Kinderzimmerschrankes auf, die nicht sorgfältig verschlossen worden waren, und breiteten ihre Flügel lautlos auseinander.
Elisabeth Chindler erschrak, aber ihre Erinnerungen waren heftiger als alles, was um sie herum geschah. Der Krieg, der sich vor ihr erhob wie ein Berg, der aus einer Ebene aufsteigt, warf sie zum ersten Male seit Jahr und Tag auf sich selber zurück.
Ja, das Haus! Kurz vor der Jahrhundertwende hatte Chindler von einer Verwandten 60000 Mark geerbt und sofort beschlossen, sich ein Haus bauen zu lassen. Er wollte aus der Etage heraus und wünschte sich einen Garten mit Bäumen und Blumen. Elisabeth Chindler kämpfte gegen diese Absicht, und es kam zu bösen Auftritten.
»Wenn man 180000 Mark hat«, sagte sie, »gibt man nicht ein volles Drittel her, um sich ein Haus zu bauen. Das ist Verschwendung, die an den Bettelstab bringt.«
»Wir haben 240000 Mark«, antwortete Chindler, »und du siehst, daß ich nur ein Viertel hergebe.«
»Wenn du 60 ausgibst«, beharrte sie, »bleiben nach meiner Zählung nur 180 …«
Über dieser wirklich etwas närrischen Rechnerei veruneinigten sich die beiden wie kaum je zuvor.
»Ich habe es ein für allemal satt«, donnerte Chindler, als wäre der Tag der Abrechnung gekommen, »ich bin es definitiv leid«, brüllte er, zornbebend im Zimmer auf und ab gehend, »daß du dich noch fernerhin um das Geld kümmerst, das mir und sonst niemanden auf der Welt gehört. Damit wird jetzt Schluß gemacht.«
»Du vergißt, daß wir Kinder haben«, antwortete Frau Chindler, »an die ich denken muß, wenn sonst niemand an sie denkt.«
Nur heraus mit deiner Seele, dachte Chindler, und sagte es auch.
»Kinder … Kinder … von morgens bis abends Kinder. Ich wünsche eine Frau zu haben und nicht mehr mit der Erzieherin meiner Kinder zu leben. Wahrhaftig, die Gelegenheit ist gut, und es ist gut, daß es endlich soweit ist. Du mußt dich jetzt sofort und endgültig entscheiden, Elisabeth. Hundertmal habe ich dich darum gebeten … jetzt verlange ich, daß du mir schwörst, hörst du, feierlich schwörst, von heute an nur noch an mich zu denken, nur noch an mich.«
Niemals, dachte Frau Chindler, werde ich mich davon abbringen lassen, an meine Kinder zu denken. Aber sie sagte es nicht. Um das Gespräch abzulenken, fing sie wieder vom Hausbau an, trotzig bei ihrer Behauptung verharrend, ein solches Unternehmen sei in ihrer Lage unverantwortlich und verschwenderisch.
Chindler ließ sich nicht mehr ablenken. »Ich verlange Antwort«, sagte er.
Elisabeth schwieg. »Unter Schmerzen habe ich meine Kinder geboren«, sagte sie endlich hoffärtig und etwas übertrieben, als Chindler fortfuhr, darüber zu klagen, daß sie seit Jahr und Tag weit weniger sein Weib sei als die Mademoiselle der Kinder und die Schreiberin des Küchenzettels.
Chindler fuhr herum. »Mir wäre es lieber gewesen«, antwortete er, »du hättest sie mit etwas mehr Vergnügen empfangen!«
Dieser Satz saß. Fünfzehn Jahre lang hatte sich Elisabeth Chindler ihrem Mann nicht hingegeben, sondern überlassen, eine Pflicht erfüllend, die sie verachtete. Chindler wußte längst, daß sie über alle Fragen ihres Ehelebens mit ihrem Beichtvater sprach, einem dicken, bäurischen Pfarrer, dessen Unbildung ihm zuwider war. Diesmal stellte er sie zur Rede.
»Du mischst die Kirche in Dinge, die sie nichts angehen«, sagte er, »und soweit sie sie angehen, ist sie auf meiner Seite.«
Elisabeth erkannte sofort die Gefahr. »Das Beichtgeheimnis gilt auch zwischen Eheleuten«, sagte sie.
»Ich will dein Beichtgeheimnis nicht wissen«, antwortete Chindler, »aber ich will, daß du mit mir offen und frei redest und danach dein Verhalten änderst. Du bist mit mir verheiratet und nicht mit Herrn Müller. Das ist es, was ich will und was sein muß.«
»Habe ich dir jemals etwas verweigert?« fragte Elisabeth.
Chindler wurde bleich vor Zorn über diese Doppelzüngigkeit. Diese Frau wußte doch ganz genau, was er hatte sagen wollen. Er suchte nach Worten, wie er sich maßvoll ausdrücken könne, dann fuhr es aus ihm heraus: »Alles hast du mir verweigert«, schrie er, »und … vom … vom ersten Tag an … alles!«
Elisabeth lachte. »Dann möchte ich wissen, woher unsere Kinder gekommen sind?«
»Nicht aus deiner Leidenschaft«, sagte Chindler. »Ach, was es mich gekostet hat, Jahr um Jahr mit einem Menschen zu leben, dessen Körper ein Stein ist und dessen Seele …«
»Dir Jahr um Jahr treu gewesen ist«, unterbrach ihn Elisabeth.
»Du warst deinem Kopf treu … alles was du sagst ist falsch … den Umständen, den Verhältnissen warst du treu. Du hast vom ersten Tag an getan, was du wolltest, und was ich wollte, war dir so Wurst, so gleichgültig …«
Elisabeth Chindler erschrak und änderte den Ton. »Was hast du denn gewollt?« fragte sie. »Was willst du denn?«
»Paß auf«, sagte Chindler. »Du meinst, ich sei in der Falle. Du glaubst, das wäre ein gutes Eisengitter: die Kinder, du, die Verhältnisse, meine Stellung, die Religion. Irre dich nicht, sage ich dir, irre dich nicht! Wenn man die Welt so verachtet wie ich, wird man es leicht ertragen, sich von ihr verachten zu lassen. Es könnte mir eines Tages einfallen, euch alle aus diesem Tempel hinauszuwerfen! Huiit … in einem schönen Bogen …«
»Laß mich jetzt gehen«, sagte Elisabeth. »Es paßt sich nicht, daß sich ein Mann in deiner Stellung so fahren läßt. Tausende von gläubigen katholischen Männern und Frauen, die dir als ihrem Führer ihre Stimme gegeben haben, wären erschüttert, wenn sie dich so reden hörten.«
»Aber der einzige Mensch, der erschüttert sein sollte beim Anblick dessen, was er durch Hochmut und Pfäfferei anrichtet, bleibt so kalt wie ein alter Tisch dabei.«
Elisabeth stand auf, um aus dem Zimmer zu gehen.
»Du sollst diese Sache mit mir zu Ende reden«, schrie Chindler, »hast du verstanden, Elisabeth?« Dann senkte er seine Stimmer wieder und sagte: »Das ist das einzige, was sich nicht paßt, diese Schweigetaktik zu üben, nicht zu Ende zu reden, zu glauben, das renkt sich wieder ein, weiter zu lügen.«
»Ich bin kein Parlamentarier«, sagte Elisabeth, »ich kann nicht debattieren.«
»Du bist ein Mensch«, sagte Chindler, »du hast eine Zunge.«
»Wenn du ein wenig lauter schreist, werden dir nicht nur die Dienstboten, sondern auch die Nachbarn zuhören können.«
»Ich muß brüllen, weil du deine Ohren gegen meine Worte verstopfst.«
»Ich darf nicht hören, was sich für eine Mutter meiner Stellung zu hören nicht paßt.«
»Wer verbietet das?«
»Gott!«
»Du hast dir einen Gott zurechtgemacht, der dir dient!«
»Ja, Gott stützt meine schwachen Kräfte, damit ich mich behaupten kann. Aber jetzt bin ich müde.«
Elisabeth Chindler öffnete die Tür und wollte hinausgehn. Da sprang Chindler heran und packte sie am Hals.
»Willst du mich vielleicht auch noch prügeln?« fragte Elisabeth.
»Laß doch deinen Hochmut fahren, Elisabeth«, sagte Chindler. »Ich will dich nicht prügeln, sondern ich bitte dich darum, mich nicht länger zu prügeln. Verstehst du das denn nicht?«
»Ich soll dich geprügelt haben? Du bist verrückt geworden«, sagte Elisabeth. Als ihr Mann sie losließ, schlüpfte sie aus der Tür, lief die Treppe hinauf in ihr Zimmer, warf sich aufs Bett und weinte.
6
Chindler war in sein Zimmer gegangen. Auf dem Schreibtisch lag ein Stoß Akten, den man aus der Parteizentrale gebracht hatte. Als der Abgeordnete die Türe geschlossen hatte, erhob sich aus einem grünen Sessel, der vor dem Bücherschrank stand, Herr Sissmaier, der Sekretär, der seit einer Stunde auf den Befehl wartete, nach Hause gehen zu dürfen. Chindler hielt seinen Zwicker gegen das Fenster, und während er ihn mit seinem Taschentuch putzte, um das Zittern seiner Hände zu verbergen, fragte er den Schreiber: »Wie ist denn die Stimmung für die Wahlen bei euch?«
»Ich weiß es auch gar nicht so recht«, antwortete der Sekretär, ein dicker Fünfziger, mit einem roten Schnurrbart, »meine Frau meint immer, die Sozzen würden halt sehr viel machen. Sie haben ja jetzt alle Freiheiten.«
»Werden sie mich schlagen?«
Der Sekretär staunte über die Frage. Dann lachte er: »Das glauben Sie doch selber nicht, was Sie da sagen, Herr Professor.«
»Heutzutage ist vieles möglich«, sagte Chindler, »die Menschen sind bösartig. Gestern abend war der Polizeidirektor bei mir und bot mir an, über die Wahltage eine Schutzwache in mein Haus zu legen. Da dachte ich, daß es mit meiner Beliebtheit nicht mehr weit her sein kann.«
»Ja, nun, bei den Sozzen sind Sie nicht beliebt. Das ist kein Wunder.«
»Und bei euch?«
Der Sekretär schaute den Abgeordneten an und drehte die Spitzen seines Schnurrbarts. Diese merkwürdigen Fragen wunderten ihn. »Sie meinen bei dem katholischen Volk?«
»Ja.«
»Da stehen Sie hoch in Achtung, wenn ich mich so ausdrükken darf.«
»Warum? Wofür? Weshalb?«
Chindler hatte sich seinen Zwicker wieder aufgesetzt und betrachtete die kleinen Augen des Sekretärs, der keine Antwort gab. »Warum stehe ich hoch in Achtung, Sissmaier, sagen Sie es mir einmal?«
»Aber das wissen Sie doch selber und können es direkt fühlen, wenn Sie sonntags morgens mit der Frau Gemahlin in die Kirche kommen, und alles guckt und still ist und Ihnen Platz macht und Sie anschaut, und der Herr Pfarrer selber auf der Kanzel sich verbeugt, wenn es einmal bei Ihnen ein bißchen spät geworden ist. Und Sie haben die Frau Gemahlin, die bei meiner Frau im Verein ist, und die vielen Kinder, die alle ordentlich sind, und das schöne Haus und doch nichts Unmäßiges … ich weiß gar nicht … ich möchte mich beinahe wundern, daß Sie so fragen!«
»Und meine Politik?«
»Ich meine, die wäre richtig. Die katholische Sache macht doch gut vorwärts. Daß man jetzt in Bickenbach drüben, was doch ein Lauseort ist, eine Kirche baut, verdankt man Ihnen, das weiß doch jeder.«
Chindler lachte. Die Schmeichelei war ihm angenehm. Die schwarze Empire-Uhr auf seinem Schreibtisch schlug. »Es ist fünf Uhr«, sagte er, »ich muß zum Bischof fahren, die Akten können ja liegen bleiben.«
»So, zum hochwürdigsten Herrn?« sagte Sissmaier.
»Ja«, antwortete Chindler und verabschiedete den Sekretär.
7
Während des Streites mit Elisabeth hatte Chindler, wie er glaubte, endgültig den Entschluß gefaßt, sich von dieser Frau zu trennen. Es ist unwürdig und unerträglich, dachte er, während er im Zug nach M. saß, der Residenz des Bischofs, die eine halbe Bahnstunde von Neustadt entfernt lag. Ja, unwürdig, das ist die richtige Bezeichnung. Sie ist keifend und dumm und das schlimmste ist, wie sie alles verdreht. Sie hat mein ganzes Leben verdreht. Die katholischen Männer und Frauen wären keineswegs ungehalten, wenn sie erführen, daß ich dieser Person den Star steche, höchstens über mein Verhalten, über meine Knechtschaft, über dieses Dahinvegetieren, das ich betreibe.
Das Abteil erster Klasse, in dem der Abgeordnete fuhr, war leer. Chindler betrachtete den Staub, der auf dem roten Polster lag. Jedesmal, wenn er in neuerer Zeit über sein Leben nachdachte, meinte er, er stecke nunmehr so tief im Sumpf, daß keine Rettung für ihn mehr möglich sei. Bestand nicht sein Leben aus Aufstehen, Zähneputzen, Stumpfsinn, Essen, Stumpfsinn, wieder ins Bett gehen? Seine Einkünfte wurden von seinen Kindern und dem Haushalt gefressen. Wenn er, der in der Stadt für vermögend galt, sich einmal zwei oder drei Flaschen Wein an einem Abend leistete, gab ihm schon der Gedanke an die Rechnung einen Stich, weil er wußte, daß er diese Ausgabe entweder werde vor seiner Frau verschweigen müssen, und sich in den nächsten Wochen wieder vom Munde einsparen, oder es werde wieder Anspielungen auf Verschwendungssucht setzen.
Der Zug hielt. Chindler setzte seinen schwarzen Sommerstrohhut auf, der ihm das Aussehen eines Geistlichen verlieh, und verließ das Abteil. Vor dem Bahnhof nahm er einen Wagen. Als er vor dem Palais des Bischofs hielt, öffnete sich die Tür des großen Gebäudes und der Domkapitular Schäfer trat heraus. Chindler bezahlte den Kutscher und der Domherr blieb stehen, um zu sehen, wer zum Bischof käme. Da er kurzsichtig war, konnte er über die weitgeschwungene Treppe hinweg den Ankommenden noch nicht erkennen. Chindler stieg die Treppe hinauf, erkannte den Geistlichen und grüßte. Auch Schäfer zog seinen Hut tief herab, und die beiden Männer unterhielten sich eine Weile über die bevorstehenden Wahlen. Als sie sich verabschiedet hatten, trat Chindler in das Palais, blieb aber hinter der Tür stehen. Die Begegnung mit Schäfer hatte ihn aus seiner Verzweiflung geweckt. Schäfer galt nicht nur als der klügste Mann in der bischöflichen Verwaltung, sondern war es auch. Ehrgeizig und gewandt hatte er unter dem Vorgänger des jetzigen Bischofs die Geschäfte eigentlich geleitet und gehofft, als Nachfolger gewählt zu werden. Aber das Domkapitel, das ihn fürchtete, hatte ihm nur wenig Stimmen gegeben, und obgleich man ihn mit einem Reichstagsmandat entschädigte, war er tief getroffen. Nachdem er seinen Schock überwunden hatte, war er daran, sich auch unter dem neuen Bischof die alte ministerartige Stellung wieder aufzubauen, die er unter dem alten innegehabt hatte. Die Eingeweihten wußten, daß er mit Hilfe von Pfarrern und Kaplänen ein Netz von Spionen unterhielt, die ihm laufend über alle Persönlichkeiten der Diözese Bericht erstatteten. Chindlers erster Gedanke nach der Begegnung war: Dieser Mann wird erfahren, warum ich gekommen bin. Der Gedanke erschreckte ihn. Was will ich denn hier? dachte er. Ich fahre zum Bischof persönlich, um mein Privatleben zu erleichtern? Das ist wahnsinnig. Man wird mich hinauswerfen, sehr höflich natürlich, aber morgen weiß es der Sprengel und übermorgen die Fraktion. Was soll ich eigentlich dem Bischof sagen? Soll ich von ihm die Scheidung verlangen, die er nicht aussprechen kann? Es ist doch immer dasselbe. Man kann nur weiterleben, wenn man oben steht. Ja, wenn ich Macht hätte, wenn ich dem Bischof sagen könnte, ich möchte bitten, in unauffälliger Weise meine Ehe … Aber das gibt es doch alles nicht … Hier gibt es doch Gesetze und keine Ausnahmen und keine Menschen.
Chindler überlegte, ob es nicht besser sei, unangemeldet wieder heimzufahren. Hilf dir selber, dann hilft dir Gott (sogar dieser …) dachte er. Ein Diener, der ihn eintreten gesehen hatte, kam mit leisen Schritten auf ihn zu und meldete höflich, der hochwürdigste Herr lasse bitten.
Verwirrt und verärgert stieg Chindler die Treppe hinauf, unterwegs doch noch den unglücklichen Entschluß fassend, mit dem Bischof von Mensch zu Mensch, gleichsam als Beichtender, wie sich Chindler noch im letzten Moment einredete, über seine Schwierigkeiten zu reden, ohne Bestimmtes zu verlangen, ja zu sagen.
Der Bischof war ein alter Mann mit einem knochigen Gesicht, der in seinem Leben schon von vielen Kämpfen zwischen Eheleuten gehört hatte. Chindler begann zu reden, aber während er sprach, merkte er, daß der Mann, der ihm zuzuhören schien, an etwas anderes dachte. Ich gefährde meine Stellung, wenn ich auch nur noch zwei Minuten so weiterrede, überlegte Chindler. Dieser alte Fuchs wird Mittel und Wege finden, die Fraktion wissen zu lassen, was er mit mir erlebt hat.
Und die Fraktion …? Chindler sah die Gesichter dieser trokkenen, samt und sonders etwas gebeugten Herren mit runden Manschetten vor sich, die niemals von persönlichen Dingen sprachen, es sei denn von der Karriere ihrer Söhne.
Mit großer Schlauheit und der Erfahrung eines alten Parlamentariers lenkte er das Gespräch von seinem eigentlichen Gegenstand ab, und fragte nur, und sogar das ganz beiläufig, wie lange Herr Pfarrer Müller noch in Neustadt bleiben werde. Er habe Grund, anzunehmen, daß ein gewisser Einfluß, den Müller im Beichtstuhl auf seine Frau nehme, nicht dienlich für das kostbare Gut des Friedens in seiner Familie sei, und er glaube, daß er als treuer Sohn der Kirche und Mann, der an so sichtbarer Stelle in der Öffentlichkeit stehe, die Pflicht habe, hier vorbeugende Maßnahmen mindestens zu erwägen.
»Ich schätze Herrn Müller sehr«, sagte Chindler abschließend, »aber die Einfachheit seines Denkens, die ihm auf der andern Seite wieder eine vorbildliche Würde verleiht, ist in Gefahr, einer etwas komplizierten Situation, wie der meines Lebens und meiner Lage, nicht völlig gewachsen zu sein.«
»Die Einfachheit, mein lieber Professor«, antwortete der Bischof und hob die ringgeschmückte Hand, »die Einfachheit, die Sie übrigens schön geschildert haben, ist oft die beste Arznei gegen das, was wir, oder sagen wir lieber unsere Großstadtnerven manchmal als kompliziert anzusehen geneigt sind.« Dann überlegte er eine Weile. Er war etwas verwirrt durch die Rede, die er angehört hatte, aber er hatte wohl gemerkt, daß Chindler, den er lange kannte, anfangs etwas anderes hatte sagen wollen als das, was er schließlich sagte.
Chindler sah, daß der Bischof nachdachte, anstatt zu reden, und fing an, über die politische Lage zu sprechen. Das Zentrum hatte in der abgelaufenen Wahlperiode zusammen mit den Konservativen die Mehrheit im Reichstag gebildet, und Chindler gehörte zu jenem (allerdings schwachen) Flügel seiner Fraktion, der die Ansicht vertrat, man könne einerseits von der Regierung mehr verlangen als geschehe, andererseits aber werde die Sozialdemokratie ernten, was man mit diesem unnatürlichen Bündnis säe.
Aber der Bischof, der sich über den Zweck dieses überfallartigen Besuches immer weniger klar war, ging auf die Politik nicht ein. Dieser Chindler war ein begabter Parlamentsredner, aber ein etwas undurchsichtiger Mensch. Er lenkte das Gespräch zurück und versprach, den Pfarrer Müller einmal kommen zu lassen. Nun lächelte Chindler, als sei dies alles gewesen, was er erbeten habe, küßte dem Bischof den Ring und ging. Genützt habe ich mir mit diesem Besuch nicht, dachte er, als er heimfuhr. Hoffentlich hat er nicht gemerkt, was ich eigentlich wollte.
8
Unterdessen hatte Elisabeth Chindler von Herrn Sissmaier erfahren, daß ihr Mann auf dem Wege zum Bischof war. Erschrocken kleidete sie sich rasch an und ging zu ihrem Beichtvater.
Der Pfarrer, ein Mann von vierzig Jahren, der aber älter aussah, weil er ziemlich dick war und ein rotes Gesicht hatte, entsetzte sich, als ihm Elisabeth Chindler ausführlich erzählte, was sich zwischen ihr und ihrem Mann ereignet hatte.
»Sie müssen auch dieses Opfer bringen, mein sehr verehrtes Beichtkind«, sagte er schließlich, »und es ist nicht etwa, wie Sie vielleicht denken könnten, meine schwache Stimme und meine geringe Erfahrung, die jene Forderung an Sie erheben, sondern der ausdrückliche Wille der heiligen Kirche selber.«
Elisabeth Chindler ärgerte sich. Sie fühlte es und beschloß, auch diesen sündigen Ärger noch zu beichten, zuvor aber die andere Sache ganz zu klären. Sie könne sich, sagte sie, ihrem Mann nicht mit Freuden hingeben. Sie habe es nie gekonnt und jetzt sei sie schließlich eine alte Frau, alt, nicht vielleicht den Jahren, aber den Erlebnissen nach, und schließlich habe sie schon viele Kinder geboren. Sie könne nicht, ja, sie wolle auch nicht.
Der Beichtstuhl des Pfarrers stand neben dem Portal der Kirche an einen hölzernen Verschlag gelehnt, den man als Windfang eingebaut hatte. In dieser Ecke war es noch dunkler als in der übrigen Kirche. Trotzdem schmiegte sich Frau Chindler dicht an das kleine Holzgitter, hinter dem der Geistliche saß. Sie hatte ihm eben geantwortet, als sie ein Geräusch hörte und sofort innehielt. Auch der Pfarrer schien es gehört zu haben, denn er schlug den grünen Vorhang auseinander, der ihn verbarg, und beugte sich aus dem Verschlag hinaus. Ein Mädchen von ungefähr acht Jahren, das von einer jüngeren, schlanken Frau begleitet wurde, war eingetreten. Der Pfarrer setzte seinen Zwicker auf und erkannte Margarethe Chindler und Mademoiselle Du Pont.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!