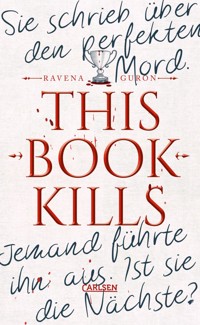
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Dark Academia trifft auf Murder Mystery – intelligent, witzig und völlig unvorhersehbar! »Ich will gleich zu Beginn klarstellen: Ich habe Hugh Henry Van Boren nicht getötet. Ich habe nicht mal dabei geholfen. Na ja, zumindest nicht mit Absicht.« Die 16-jährige Jess passt als mittellose Stipendiatin nicht besonders gut in ihr Elite-Internat. Nur in ihrem Lieblingsfach blüht sie auf: Kreatives Schreiben. Aber dann wird Hugh Henry Van Boren getötet, eines der reichsten Kinder der Schule – und zwar auf genau dieselbe Art wie eine Figur in Jess' neuester Geschichte. Und damit nicht genug: Jess erhält eine SMS, in der ihr für die Inspiration gedankt wird. Auf die Botschaft folgen weitere … Um herauszufinden, von wem die Nachrichten stammen, braucht Jess Verbündete. Doch fast alle in ihrem Umfeld hatten einen Grund, Hugh tot sehen zu wollen, und Jess hat keine Ahnung, wem sie noch vertrauen kann. Bald wird ihr klar: Wenn sie dieses Rätsel nicht löst, wird sie die nächste sein … »Für alle Fans von Karen McManus.« The Observer »Eine beglückende Lektüre, mit jeder Menge völlig unerwarteter Plot-Twists.« The Bookseller ***Ein temporeicher Young-Adult-Thriller, der fesselt, Spaß macht und so clever geschrieben ist, dass es einem den Atem verschlägt.*** Amazon Best Books of the Year 2023!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ravena Guron –This Book Kills
Aus dem Englischen von Katja Hildebrandt
Die 16-jährige Jess passt als mittellose Stipendiatin nicht besonders gut in ihr Elite-Internat. Nur in ihrem Lieblingsfach blüht sie auf: Kreatives Schreiben. Aber dann wird Hugh Henry Van Boren getötet, eines der reichsten Kinder der Schule – und zwar auf genau dieselbe Art wie eine Figur in Jess’ neuester Geschichte. Und damit nicht genug: Jess erhält eine SMS, in der ihr für die Inspiration gedankt wird. Auf die Botschaft folgen weitere … Um herauszufinden, von wem die Nachrichten stammen, braucht Jess Verbündete. Doch fast alle in ihrem Umfeld hatten einen Grund, Hugh tot sehen zu wollen, und Jess hat keine Ahnung, wem sie noch vertrauen kann. Bald wird ihr klar: Wenn sie dieses Rätsel nicht löst, wird sie die nächste sein …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Viten
Für Mom, für alles
1
Nur, damit das von vornherein klar ist: Ich habe Hugh Henry Van Boren nicht umgebracht.
Ich habe nicht mal dabei geholfen. Jedenfalls nicht mit Absicht.
Mum glaubt, dass ich in so einer Art Trauma gefangen bin. Sie ist keine Psychologin oder so was – aber sie schaut sich ständig irgendwelche Dokus an und ist deshalb der Meinung, bei allem Möglichen den totalen Durchblick zu haben. Angeblich soll es mir beim Verarbeitungsprozess helfen, alles aufzuschreiben, was passiert ist. Kompletter Bullshit, wenn ihr mich fragt, aber als ich das auf nette Art laut ausgesprochen habe, setzte Mum ihren eiskalten Blick auf, der so viel bedeutet wie: Tu lieber, was ich dir sage, Jess Choudhary, oder du bekommst diesen Pantoffel zu spüren.
Geschlagen hat mich Mum aber noch nie. Sie droht immer nur damit.
Egal, ob das nun was bringt oder nicht – ich schreibe jetzt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit in dieses Notizbuch, auch wenn ich die ganze Sache lieber vergessen würde.
Also los, hier kommt meine Geschichte, die ganze Misere.
Die ersten Anzeichen dafür, dass sich etwas Ungutes zusammenbraute, bemerkte ich schon in der Woche, bevor Hugh umgebracht wurde.
Ich saß am Ende eines der langen, auf Hochglanz polierten Holztische im Speisesaal. Meine beste und einzige Freundin, Clementine-Tangerine Briggs, ließ an dem Tag das Abendessen ausfallen – weshalb ich allein saß –, um sich ihrem neuen Projekt zu widmen: einem sehr ausführlichen Podcast über die prekäre Situation des Titicaca-Riesenfroschs. Diese Froschart mit dem Spitznamen »Skrotum-Frosch« war anscheinend vom Aussterben bedroht (Clem beharrte darauf, dass auch hässliche Kreaturen es verdienten, geschützt zu werden). Und ja, Clementine-Tangerine ist ihr echter Name. Ihre Eltern betreiben eine Bio-Supermarktkette und haben sie nach einem ihrer Kassenschlager benannt, denn die bringen das meiste Geld ein und Clems Eltern lieben Geld.
Vor mir, an die Kristallkaraffe mit Orangensaft gelehnt, stand ein aufgeschlagenes Buch. Ich tat allerdings nur so, als würde ich lesen, damit die anderen dachten, ich würde mit Absicht alleine am Tisch sitzen und wolle nicht gestört werden. Total geheimnisvoll und viel zu cool, um Freunde zu haben. Ganz bestimmt ließen sich alle davon täuschen. Nicht.
Niemand saß auch nur ansatzweise in meiner Nähe, so als wäre ich die falsche Seite eines Magneten und würde alle abstoßen. Am anderen Ende der langen Bank lästerte meine Zimmergenossin lautstark mit ihren Freundinnen über irgendwen, ihr schrilles Lachen dröhnte in meinen Ohren, und trotzdem wünschte ich mir, ich könnte mich einfach zu ihnen setzen.
Was ich aber natürlich nie tun würde. Im Gegensatz zu den anderen Schülerinnen und Schülern der Heybuckle School passte ich nicht ins Bild. Was ich auch tat und egal, wie sehr ich mich bemühte, nett zu sein – die anderen würden in mir immer nur das arme Mädchen sehen. Den Sozialfall.
Um meine Rolle der mysteriösen Einzelgängerin glaubhafter zu machen, blätterte ich in regelmäßigen Abständen eine Seite um.
Als ich ungefähr die Hälfte von meinen Fish and Chips gegessen hatte, legte Millicent Cordelia Calthrope-Newton-Rose (so unglaublich es auch ist, auch sie heißt wirklich so) einen ihrer großen Auftritte hin, indem sie die Flügeltüren zum Speisesaal dramatisch aufstieß und damit alle Blicke auf sich zog.
Dann stolzierte sie den Gang zwischen den Tischen entlang und schwang ihre Hüften, als wäre sie auf dem Catwalk. Ihre blonden Locken hüpften auf den Schultern auf und ab, während sie mit zusammengekniffenen Augen und Laserblick die Anwesenden scannte. Den grauen Rock der Schuluniform hatte sie an den Hüften hochgekrempelt, um ihre langen Beine zur Geltung zu bringen, und die Krawatte baumelte um ihren Hals, als wäre sie ein modisches Accessoire. Millie lief immer so herum – nicht mal die Lehrer wagten es, sie deswegen zu ermahnen.
»Wo ist Hugh?«, verlangte sie zu wissen.
Sie sprach laut genug, um von allen im Saal gehört zu werden, aber niemand antwortete. Ich saß am weitesten von ihr entfernt, sackte aber trotzdem sicherheitshalber noch ein Stück in mich zusammen. Hugh hatte umringt von seinen Freunden ganz in Millies Nähe gesessen und richtete sich nun zu seiner vollen Größe von gut 1,80 Metern auf. Genau wie sie sah er unfassbar gut aus: blonde Locken umrahmten seine rosigen Wangen, auf seinem wie aus Stein gemeißelten Gesicht sah man nur selten ein Lächeln, die breiten Schultern waren gut trainiert. Die beiden hätten ohne Probleme eines dieser berühmten Modelpaare werden können. Also, ihr wisst schon – wenn er sie nicht betrogen und ihn dann nicht jemand umgebracht hätte.
»Ich bin hier, Baby«, sagte Hugh gelangweilt und steckte die Hände in die Hosentaschen. »Was ist los?«
»Was los ist?«, presste Millie hervor. »Du verlogenes, hinterlistiges Stück …«
»Ach, du hast es also herausgefunden.« Hugh zog die Hände aus den Taschen und strich seine rot-goldene Schulkrawatte glatt. Seine Miene war teilnahmslos, fast gleichgültig, als hätte er damit gerechnet, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. »Vielleicht sollten wir nicht hier darüber sprechen …«
»Du hast mich BETROGEN!«, schrie Millie. »Du Abschaum, du verlogener Dreckskerl. DRECKSKERL.« Sie beugte sich über den Tisch und schrie ihm das Wort immer wieder direkt ins Gesicht, als wäre sie eine Schallplatte, die einen Sprung hatte.
Hugh zuckte nur mit den Schultern und schien völlig unbeeindruckt. »Ich habe einfach das Gefühl, dass wir uns auseinandergelebt haben.«
Das klang total vernünftig, und noch dazu blieb er so gelassen, dass bestimmt die Hälfte der Anwesenden zustimmend nickte, obwohl Hugh der Betrüger war und Millie im Recht. Sie schien zu merken, wie sich die Leute auf Hughs Seite schlugen, denn im nächsten Moment stieß sie einen spitzen Schrei aus, schnappte sich eine Karaffe vom Tisch und schüttete ihm den Orangensaft ins Gesicht. Das klebrige Zeug durchnässte auch sein Hemd.
»Was zur Hölle!« Panisch rieb Hugh sich die Augen. »Wasser, schnell … sie hat meine Augen erwischt … es brennt wie verrückt …«
Hughs Freund Eddy langte nach einem Wasserkrug, aber Millie war schneller. Kurzerhand schleuderte sie Hugh auch das Wasser ins Gesicht.
»Wer von euch will wissen, mit wem mich dieser Abschaum betrogen hat?« Aufgebracht fuchtelte sie mit dem leeren Krug herum.
Hugh versuchte vergeblich, mit einer feuchten Serviette die gelben Flecken auf seinem zuvor schneeweißen Hemd abzutupfen. »Die gehen nie wieder raus«, sagte er mit geröteten Wangen. »Widerlich. Das muss ich wegschmeißen.« Das versaute Hemd schien ihn mehr zu treffen als die Tatsache, dass seine Freundin ihre dreijährige Beziehung beendete.
Die anwesenden Lehrer saßen wie erstarrt an ihrem Tisch in der vordersten Reihe, einige mit in der Luft schwebenden Gabeln und halb geöffnetem Mund. Das Küchenpersonal lehnte auf dem Tresen in der Durchreiche und starrte verwundert in den Speisesaal, um zu sehen, was hier los war. Alle warteten darauf, dass Millie weiterredete und den Namen ausspuckte, vorher würde keiner der Erwachsenen sie aufhalten. Mir war vollkommen klar, was als Nächstes passieren würde, und es gab absolut nichts, was ich dagegen tun konnte.
Als Millie erneut mit den Augen den Saal absuchte, wünschte ich mir noch mehr als sonst Freunde, mit denen ich zusammensitzen könnte. So ganz allein war ich ihr schutzlos ausgeliefert – ich die Gazelle, sie die Gepardin, bereit zum Angriff. Ich versuchte, mich noch kleiner zu machen, aber Millie fixierte mich bereits.
»Du«, stieß sie aus und stürmte auf mich zu.
Jetzt drehten sich alle zu mir um. Hitze schoss mir in die Wangen. Hier und da hörte man jemanden flüstern und bald war der gesamte Saal von einem Summen erfüllt wie von einem Bienenvolk.
Shit.
Nie zuvor war mir meine Zunge dermaßen bewusst gewesen. Drückte sie sich immer so gegen meine Zähne?
»Wo ist sie?« Millie hatte sich direkt vor mir aufgebaut, ihr Rosenparfüm – das garantiert von einem bekannten Modedesigner und natürlich unfassbar teuer war – benebelte mir die Sinne. »Wo ist diese kleine Schlampe, die mir meinen Freund ausgespannt hat?«
Ich hatte einen völligen Blackout. In meinem Kopf war nichts als Watte und meine Kehle war wie zugeschnürt. Selbst wenn ich gewollt hätte, wäre kein Laut über meine Lippen gekommen.
Hugh sah von seinem ruinierten Hemd auf. »Jade hat damit nichts zu tun«, sagte er seufzend und ließ die durchtränkte Serviette auf den Tisch fallen. »Lass deine Wut an mir aus, schließlich bin ich der Grund dafür.«
Wenn er nicht von verdünntem Orangensaft durchnässt gewesen wäre, hätte das sicher heroischer gewirkt. Und außerdem – ich würde ihn natürlich nie vor all den Leuten auf seinen Fehler hinweisen, aber ernsthaft? Der Typ hatte fast jedes Unterrichtsfach mit mir zusammen, seit wir dreizehn waren, und er wusste immer noch nicht, wie ich heiße? Jess ist ja nicht gerade ein Name, den man sich nur schwer merken kann.
Millie warf den Kopf in den Nacken und stieß einen gurgelnden Schrei aus. Sie schüttelte ihre Mähne wie eine Löwin, während sie wild in alle Richtungen blickte. »Abschaum!«, kreischte sie. »Abschaum!«
Keine Ahnung, warum sie dieses eine Wort so besonders toll fand oder warum sie bis jetzt noch kein einziges gewöhnliches Schimpfwort benutzt hatte. Doch im nächsten Moment wurde mir klar, dass sie gerade erst richtig loslegte, ihre Stimme wie eine Sängerin erst mal aufwärmte, um dann zum großen Finale anzusetzen. Sie schleuderte Hugh jede erdenkliche Beleidigung entgegen, die man sich nur vorstellen kann, wobei ihre Stimme immer dröhnender wurde, je länger er das Ganze einfach nur reaktionslos über sich ergehen ließ.
»Du demütigst mich –«
»Das schaffst du ganz allein, Baby«, entgegnete Hugh sanft.
»Wage es ja nicht, mich Baby zu nennen. Ich werde dich umbringen!«, schrie sie. Mit der verschmierten Wimperntusche sah sie so aus, als hätte sie zwei Veilchen. »Ich. Werde. Dich. Umbringen.«
Und das tat sie dann auch.
Kleiner Scherz, so ist es natürlich nicht gewesen. Aber wenn, dann wäre diese Geschichte jetzt wenigstens vorbei und tausend Mal weniger belastend für mich.
In Wirklichkeit ging in diesem Moment die Tür zum Speisesaal auf und meine beste Freundin Clem kam hereinspaziert.
Alle Augen richteten sich auf sie, auch Millies.
Die stieß einen spitzen Schrei aus, der bestimmt kilometerweit zu hören war und überall die Hunde aus ihrem Dämmerschlaf weckte.
Verwirrt blieb Clem wie angewurzelt stehen.
Und Millie ging auf sie los.
2
In dem Moment kamen die Lehrer wieder zur Besinnung und erinnerten sich, wofür sie hier bezahlt wurden.
»Millicent Cordelia«, dröhnte die Stimme von meiner Englischlehrerin Mrs Henridge durch den Saal. »Sie gehen wohl besser ins Büro der Schulleiterin.«
Die Direktorin Mrs Greythorne war eine strenge und sachliche Frau, die so aussah, als würde sie ihre Samstagabende damit verbringen, ihre Zertifikate für besondere Schulverdienste zu polieren. Zudem hatte sie eine beeindruckende natürliche Autorität, und selbst Millie graute es sicher davor, ihr einen Besuch abstatten zu müssen.
Millie hatte auf halbem Wege innegehalten. Keine Ahnung, was sie vorgehabt hatte, vielleicht wollte sie Clem zu Boden ringen? Aber nicht mal sie würde die Anweisung einer Lehrerin oder eines Lehrers missachten. Sie schnaubte und warf ihre Haare zurück.
»Das hier ist noch nicht vorbei«, sagte sie so laut zu Clem, dass ihre Stimme durch den ganzen Saal hallte.
Clem sah von Millie zu Hugh und zog ihre Nase kraus, so wie sie es immer tat, wenn sie nachdachte. Im nächsten Moment leuchteten ihre Augen auf und ihr Mund verzog sich zu einem Grinsen. Oh nein. Diesen Gesichtsausdruck kannte ich nur zu gut. Sie hatte eine ihrer Ideen.
Im nächsten Moment griff Clem sich eine Karaffe mit Orangensaft, genau wie Millie es getan hatte. Die anderen im Saal begannen zu flüstern und auch Millie wirkte verwirrt. Wollte Clem Hugh ebenfalls mit Saft überschütten? Oder Millie?
Weder noch. Den Blick immer noch auf Millie gerichtet, goss Clem sich den Saft selbst über die Schuluniform, und zwar bis auf den letzten Tropfen.
»So«, sagte sie zu Millie, »ich hab das schon mal für dich erledigt.«
Millie knurrte. Ich fand, dass Clem ihren Standpunkt bereits ausreichend klargemacht hatte, aber sie griff nach einer weiteren Karaffe.
»Ich wurde nach diesem Saft benannt!«, verkündete sie, als alle anfingen zu klatschen.
»Schütten! Schütten! Schütten!«
Und das tat Clem auch, breit grinsend, als hätte sie die beste Zeit ihres Lebens. Dann nahm sie sich eine dritte Karaffe.
»Clementine!«, rief Mrs Henridge und erhob sich. »Hören Sie sofort damit auf. Um Himmels willen, Orangensaft ist zum Trinken da. Gehen Sie sich umziehen. Und Sie, Millicent, machen, dass Sie zur Schulleiterin kommen – jetzt.«
Millies Blick glitt von Clem zu mir und ein leises Lächeln spielte um ihre Mundwinkel. Die Botschaft war klar: Ich hatte über Clem und Hugh Bescheid gewusst, also hatte sie es auch auf mich abgesehen. Mir lief ein Schauer über den Rücken, als sie auf dem Absatz kehrtmachte und mit gerecktem Kinn und hoch erhobenem Kopf den Speisesaal verließ.
Jetzt waren alle Augen auf Clem gerichtet. Sie war klein und hatte kurzes, kupferfarbenes Haar, das ihr wirr vom Kopf abstand. In ihrer Miene lag immer etwas Schelmisches, weshalb die Lehrer sie als potenzielle Unruhestifterin ansahen. Die Ärmel ihres Blazers hatte sie hochgekrempelt und sie trug bunte Buttons an der Kleidung mit den Aufschriften RECYCLE und NOBODY CARES. Eine ihrer Socken war nach unten gerutscht.
Clem schüttelte sich wie ein Hund nach dem Baden und verteilte Orangensaftspritzer in sämtliche Richtungen.
»Bin gleich wieder da!«, verkündete sie grinsend und schlenderte aus dem Saal.
Alle wandten ihren Blick zu Hugh, der ihr mit dümmlicher, liebeskranker Miene nachsah. Fast könnte man meinen, seine Pupillen hätten sich zu Herzen geformt.
Gemächlich und bedacht verließ auch er den Raum, die Arme steif an seinen Oberkörper gepresst. Millie hatte bei ihrem Angriff gut gezielt, der Saft war größtenteils in seinem Gesicht gelandet. Trotzdem verhielt er sich so, als wäre sein Hemd ein unbezahlbares Kunstobjekt, das nun wegen ein paar gelber Flecken ruiniert war. Wahrscheinlich würde er die nächsten drei Stunden unter der Dusche stehen und dann das Hemd zu Asche verbrennen.
Ich tat wieder so, als würde ich mein Buch lesen, und wartete ungeduldig darauf, dass Clem zurückkam. Schon nach einer Viertelstunde betrat sie mit noch feuchtem Haar und frischen Klamotten, an die sie wieder ihre Buttons gepinnt hatte, den Speisesaal. Sie lief auf mich zu, als müsste sie sich um nichts in der Welt Sorgen machen. Und auf einmal wurde mir etwas klar: Trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede gab es auch eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen Millie und Clem. Ihre Herkunft, vor allem das damit verbundene Geld, sorgte für ein so weitreichendes Selbstvertrauen, als würde ihnen die Welt zu Füßen liegen und sie würden anderen Menschen nur gestatten, ebenfalls darin zu leben.
Clem setzte sich mir gegenüber und schnappte sich sofort ein paar der mittlerweile kalt gewordenen Pommes von meinem Teller.
»Na, wie läuft’s?«, fragte sie, als wäre nichts geschehen.
Ich starrte sie bloß an (so wie fast alle anderen im Saal auch). Clem kaute einfach weiter, als würde sie davon nichts mitbekommen.
»Mein Podcast ist ein totaler Flop, nur damit du Bescheid weißt. Und ich sterbe vor Hunger – warum hast du nicht mehr Pommes genommen?« Clem zog das Tablett zu sich und stopfte sich die Reste meines Essens in den Mund. »Der Spermienfrosch interessiert keine Sau.«
»Skrotum-Frosch«, korrigierte ich sie automatisch. Ungläubig blinzelte ich ein paarmal. Noch immer verlor sie kein Wort über das, was gerade passiert war. »Millie hat das mit dir und Hugh herausgefunden, nur falls das eben nicht bei dir angekommen ist.« Kurz sah ich über meine Schulter auf Hughs leeren Platz am Tisch seiner Freunde. Die anderen im Saal redeten inzwischen wieder in normaler Lautstärke miteinander.
Clem mied meinen Blick und starrte stattdessen auf die Pommes. »Diese Szene mit dem Orangensaft … das war nicht gerade eine Glanzleistung von mir«, sagte sie. »Millie hat schließlich alles Recht der Welt, wütend zu sein.«
»Stimmt«, sagte ich.
»Es ist nur … Ich habe gesehen, was sie bei Hugh mit dem Saft angerichtet hat, und bin selbst wütend geworden. Er hasst solche Schweinereien.« Sie lehnte sich zu mir vor und sprach mit gesenkter Stimme weiter. »Das liegt an dem Einbruch damals, als er noch ein Kind war. Die Diebe haben echt viel geklaut, aber das eigentliche Problem war, dass sie nicht wussten, was von den Gegenständen im Haus wirklich wertvoll war und was nicht, weil Hughs Eltern so seltsame Kunstobjekte besitzen, die wie ganz normale Alltagsgegenstände aussehen. Deshalb wurden auch seine Buntstifte, die Holzeisenbahn und sein Lieblingskuscheltier, der Elefant Roger, geklaut. Am Ende haben die Einbrecher das ganze Haus dermaßen demoliert, dass Hugh jede Form von Chaos und Unordnung immer wieder daran erinnert …«
»Ernsthaft?« Erstaunt sah ich sie an.
Clem grinste nur und wandte sich dem Schokoladenkuchen mit Vanillesoße zu, den ich mir noch aufgespart hatte. Sie aß, als würde sie gerade einen Hungerstreik beenden – etwas, was sie tatsächlich schon mal ausprobiert hatte.
»Nein, Dummerchen. Du glaubst aber auch alles! Hugh hat nur so einen Sauberkeitsfimmel und ich wollte ein Zeichen für ihn setzen.« Sie atmete tief ein. »Dass Millie das mit uns irgendwann herausfindet, war doch klar. Hugh hat schon eine ganze Weile darüber nachgedacht, die Sache mit ihr zu beenden.«
»Und du bist dir sicher, dass er dich liebt?«, fragte ich. »Es gibt doch diesen Spruch: Wenn er mit dir betrügt, wird er auch dich betrügen.«
»Er liebt mich wirklich«, sagte sie mit fester Stimme, so als würde sie verkünden, dass morgen die Sonne scheint. »Und ich liebe ihn. Er ist süß – und ja, er ist oft auch ziemlich ernst, aber das liegt nur daran, dass er sich über vieles Gedanken macht.«
Ich warf ihr einen zweifelnden Blick zu. Hugh war zwar nicht dumm, aber wenn er die Wahl hätte, dann würde er jemanden dafür bezahlen, ihm das Denken abzunehmen. Da war ich mir sicher.
»Und wenn er irgendwann doch wieder mit Millie zusammen sein will? Die beiden waren unzertrennlich. Weißt du noch, wie er mal für ihren Geburtstag den kompletten Gemeinschaftsraum mit Rosen geschmückt hat und ein paar aus dem Chor dafür bezahlte, ihr den ganzen Tag hinterherzulaufen und Ständchen zu singen?«
Das war mein letzter Versuch, Clem klarzumachen, dass Hugh und Millie zusammengehörten, egal, was passierte. Die beiden waren gleich im ersten Jahr hier an der Schule zusammengekommen, also mit dreizehn. Von Anfang an hatten sie sich wie zwei Magnete gegenseitig angezogen – oder vielleicht auch nur ihre Münder. Für mich war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass sie irgendwann mal heiraten würden und große, blonde Kinder bekämen.
»Aber wenn er Millie so sehr liebt, warum hat er dann was mit mir angefangen?«, fragte Clem.
Ich wusste, dass sie mich nicht ernst nahm, aber ich blieb hartnäckig. »Um Aufmerksamkeit zu erregen. Um zu beweisen, dass er jede haben kann. Und mir fallen noch ein paar weitere Gründe ein.« Aber es nützte alles nichts. Ich hatte schon so oft versucht, Clem davon zu überzeugen, dass die Sache mit Hugh keine gute Idee war. Im Grunde, seit sie mir das erste Mal davon erzählt hatte – vor neun Monaten, kurz vor den Sommerferien.
»Tja, musst du wissen, ob du weiter hier sitzen und über irgendwelche Gründe spekulieren willst«, meinte Clem und stand auf, »oder ob du lieber mitkommst, um rauszufinden, ob Hattie irgendwo Schokolade hat, die wir klauen können. Wenn du zu lange überlegst, esse ich alles alleine auf!«
Noch bevor ich überhaupt reagieren konnte, war sie schon weg. Lächelnd schob ich mein Tablett auf den Rollwagen aus Metall, der für das dreckige Geschirr bereitstand.
Unsere Freundschaft war in vielerlei Hinsicht seltsam. Clem hätte wahrscheinlich genauso beliebt sein können wie Millie. Aber als ich an meinem dritten Tag auf dieser Schule allein beim Essen saß – frustriert und mit dem Wunsch, einfach nur nach Hause gehen zu können –, hatte Clem lautstark ihr Tablett mir gegenüber auf den Tisch gestellt.
»Ich habe gehört, Miss Bilson und Coach Tyler hatten mal was miteinander. Widerlich, oder?« Sie beugte sich zu mir rüber und klaute ein paar Pommes von meinem Teller.
Ich starrte sie nur an, ohne zu kapieren, was das werden sollte.
»Willst du hören, woher ich das weiß? Anscheinend hat sie letztes Jahr jemand beim Knutschen erwischt. Und zwar im Lehrerzimmer, wo jeder durch die große Glastür reingucken kann. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Public displays of affection, aber die Lehrer haben hier doch richtige Wohnungen, mit einer kleinen Küche und allem Drum und Dran. Warum knutschen sie nicht da?«
Und so machte sie immer weiter, ohne sich darum zu scheren, wie unbehaglich ich mich fühlte. So unbehaglich, dass ich gar nicht reagieren konnte. Als wir aufgegessen hatten, schlug sie vor, in ihr Zimmer zu gehen und uns die Nägel zu machen. Und schon bald war ich dankbar, sie zu haben. Ich konnte gar nicht glauben, dass sie ausgerechnet mich dazu auserkoren hatte, mit ihr Zeit zu verbringen, wo sie doch auch mit allen anderen hier hätte befreundet sein können. Es war mir schleierhaft, warum sie sich die Mühe machte.
Als ich mich allmählich in ihrer Nähe wohlfühlte, begann ich, ihr sogar zu widersprechen. Sie grinste nur – und seitdem waren wir beste Freundinnen.
Als ich aus dem Speisesaal kam, wartete Clem im Flur auf mich. Wir liefen den dunkel getäfelten Korridor entlang bis zum Ehrensaal.
Fast alle Flure der Schule führen dorthin. Eigentlich handelte es sich bei dem Saal um keinen richtigen Raum, sondern um einen großen, kreisförmigen Bereich, der die Eingangshalle mit dem Ost- und Westflügel verband. Für gewöhnlich traf man nach dem Abendessen die Schulleiterin Mrs Greythorne hier an. Sie wollte sicherstellen, dass wir leise zu den abendlichen Aktivitäten gingen. Doch heute war sie weit weg in ihrem Büro und hielt vermutlich gerade Millie einen Vortrag darüber, dass nette und anständige Schülerinnen ihrem Freund nicht drohten, ihn umzubringen. Selbst, wenn er sie betrogen hatte.
Auf einer Seite des Ehrensaals befanden sich die riesigen Eingangstüren der Schule. Jeden Abend um zehn Uhr wurden sie verschlossen, obwohl man sich hier kaum Gedanken um Einbrecher machen musste. Die Heybuckle School war umgeben von mehreren Morgen Wiesen und Feldern inmitten der weitläufigen englischen Landschaft.
Dicke hohe Steinmauern umgaben das Schulgelände, sehr zum Leidwesen einiger Schüler, wie zum Beispiel auch Clem, die es lustig fänden, aus der Schule abzuhauen (auch wenn es natürlich nichts gab, wohin man überhaupt gehen konnte. Wir waren auf Busse oder Taxis angewiesen, um zum nächstgelegenen Dorf zu gelangen, das mindestens fünfzehn Kilometer entfernt war).
Nach zehn Uhr abends war die Schule also bis zum nächsten Morgen wie ein Gefängnis. Abgesehen von den alarmgesicherten Notausgängen führte kein Weg hinaus.
»Schon komisch, wenn Mrs Greythorne nicht hier ist«, sagte Clem und deutete in den Ehrensaal, vor dem sie stehen blieb.
»Ja, Millie ist gerade bei ihr …«
Auf einmal wirkte Clem seltsam angespannt. Offensichtlich dachte sie endlich richtig über die Konsequenzen ihrer leichtsinnigen Entscheidung nach, sich in Hugh zu verlieben. Vielleicht kam sie doch noch zur Vernunft und zog einen Schlussstrich unter die Sache.
»Hoffentlich macht Mrs Greythorne Millie nicht allzu sehr die Hölle heiß«, sagte Clem. Sie biss sich auf die Unterlippe und fuhr sich mit der Hand durch die Haare, wodurch sie noch mehr abstanden als eh schon. »Das alles ist ja nicht ihre Schuld.« Clem schaffte es allerdings nie lange, ernst zu bleiben. Und so hellte sich ihre Miene gleich wieder auf, als sie ihr Handy aus der Tasche ihres Blazers zog. »Wetten, sie hat darüber schon was gepostet? Ich muss unbedingt sehen, zu welcher Äußerung sich die legendäre Millicent Cordelia Calthrope-Newton-Rose über mich herablässt.« Während sie scrollte und scrollte, presste sie ihre Lippen immer fester aufeinander. »Kaum zu glauben – kein einziges Wort über die Sache …«
»Klingt, als wärst du enttäuscht.« Ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen. Das war eins der Dinge, die ich an Clem so liebte. Beleidigungen prallten vollkommen an ihr ab, es interessierte sie nicht, was andere von ihr hielten.
»Nein, warte!«, sagte sie mit erhobener Hand. »Da ist es. Oh ja. Sie hat ein grauenhaftes Foto von mir gepostet und mir kleine Teufelshörner verpasst. Sogar eine ganze Reihe davon. Ich finde ja, sie hätte sich mehr über meine Haare auslassen sollen. Zurzeit sehen sie einfach furchtbar aus, wie sie zu allen Seiten abstehen. Was für eine bescheuerte Idee, sie selbst zu schneiden – lass mich das bloß nie wieder machen.« Clem hielt inne und sah mich an. »Oh, warte, nicht, dass ich auf ihrer Seite aus Versehen etwas like. Gib mir mal dein Handy zum Spionieren.«
»Mein Akku ist alle.«
Und zwar schon seit einer Weile, aber ich war noch nicht zum Aufladen gekommen. Ich verspürte auch nicht den Drang, meinen Mitschülern Nachrichten zu schicken, schließlich sah ich sie jeden Tag. Und Mum war dazu übergegangen, mir E-Mails zu schreiben, oft mit Links zu irgendwelchen Artikeln. Zum Beispiel darüber, wie Menschen, die Apfelessig direkt aus der Flasche tranken, hundert Jahre alt wurden.
Vor ein paar Jahren gab es mal die Schulregel, dass wir tagsüber die Handys abgeben mussten. Mir war das ziemlich egal, aber andere Schüler machten einen riesigen Aufstand, den die Lehrer ignorierten – bis sich der Regia Club einschaltete. Der Club trug früher einmal den lateinischen Namen Sodalitas Regia, was »Königliche Geheimgesellschaft« bedeutet, aber mit der Zeit vermischten sich das Lateinische und das Englische, und heraus kam Regia Club. Die Vereinigung war eine der vielen merkwürdigen Traditionen dieser Schule: eine Geheimgesellschaft, in der nur ausgewählte Schüler zugelassen waren – nämlich die, deren Familien seit Generationen, über Jahrhunderte hinweg, zur reichen Oberschicht gehören. Es wurde oft darüber gewitzelt, dass Heybuckle im Grunde vom Regia Club geleitet wurde, denn wenn dessen Mitglieder etwas forderten, wurden ihre Anweisungen befolgt. So lief das schon immer. Und das galt nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer. Ehemalige Clubmitglieder bekamen angeblich ohne Weiteres einflussreiche Jobs in Banken, als Journalisten, in den erfolgreichsten Anwaltskanzleien oder sie besetzten hohe Posten in der Regierung. Ein Netzwerk aus Ehemaligen half den Karrieren der Schulabgänger nur zu gern auf die Sprünge.
Wegen des Handyverbots hängte der Regia Club überall in der Schule Banner auf – mit Aufschriften wie DER REGIA CLUB IST GEGEN FASCHISMUS und DER BESITZ VON MOBILTELEFONEN IST EIN GRUNDRECHT. Und siehe da, wir durften die Handys auch tagsüber behalten, solange dadurch der Unterricht nicht gestört wurde. Heybuckle versuchte, die Internetnutzung zu kontrollieren, indem das WLAN mit etlichen Beschränkungen versehen wurde, und verließ sich darauf, dass der Empfang schlecht war. Allerdings war es einem schlauen Fuchs gelungen, die Beschränkungen zu umgehen, sodass jetzt alle wieder nach Lust und Laune irgendwelchen Mist auf Social Media verbreiten konnten. Und genau das machte Millie sich offensichtlich gerade zunutze.
»Dann passe ich eben besonders gut auf«, sagte Clem und wandte sich wieder ihrem Handy zu.
»Hey, Jess«, sagte jemand hinter mir.
Ich wirbelte herum. Summer Johnson (die wie ich eine Stipendiatin war und somit einen völlig gewöhnlichen Namen hatte) kam mit großen Schritten aus Richtung der Bibliothek auf mich zu. Ihre blonden Haare waren zu einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden und die intensiven braunen Augen fixierten mich. Sie hatte also mal wieder das Abendessen ausfallen lassen, um zu lernen. Dieses Mädchen machte einfach nie Pause.
Es war zu spät, um so zu tun, als hätte ich sie nicht gehört. Und mir war vollkommen klar, was sie von mir wollte: unser Schreibprojekt besprechen. Summer und ich sollten gemeinsam eine Kurzgeschichte für Gaben und Talente schreiben, dieses unnütze Fach, das wir belegen mussten. Heybuckle bot viele Extrakurse an, die es an meiner alten Schule nicht gab, wie zum Beispiel einen zur Bienenhaltung oder den Automobilclub. Damit konnten wir uns später in den Bewerbungsschreiben für die Uni oder für einen Job von den anderen abheben. Vor ein paar Jahren hatte man sich im Schulvorstand besorgt darüber gezeigt, dass nur wenige Schüler diese zusätzlichen Aktivitäten wahrnahmen. Deshalb wurde den letzten beiden Jahrgängen eine sehr beliebte Freistunde gestrichen, und alle waren verpflichtet, in der Zeit einen Wahlpflichtkurs zu belegen – entweder Gaben und Talente oder Freiwilligendienst.
Da man beim Freiwilligendienst die Art der Aufgabe nicht wählen konnte, hatte ich mich dagegen entschieden. Gartenarbeit oder so was wäre völlig okay für mich gewesen, aber manche Schüler wurden auch als Aushilfe im Pflegeheim eingesetzt. Auf keinen Fall wollte ich irgendwo zu Smalltalk gezwungen sein. Und so wählte ich Gaben und Talente, kurz G&T. Um in den Kurs aufgenommen zu werden, sollte jeder seine »Gabe« benennen, die er oder sie den anderen vermitteln konnte (bei mir das Schreiben). Zudem musste man ein paar akademische Schwächen auflisten (meine ist eindeutig Mathe), bei denen uns wiederum ein anderer aus dem Kurs helfen konnte. Auf diese Weise konnte jeder aus dem G&T-Kurs »Tutor von Mitschülern« in seinen Lebenslauf schreiben, und Simsalabim – die Schule mit einem perfekt abgerundeten Portfolio abschließen.
Summer hatte die Idee, dass wir für G&T eine Kriminalgeschichte schreiben, aber wir konnten uns ewig nicht einigen, welche Richtung wir ihr geben und welche Elemente darin vorkommen sollten (ich wollte jede Menge willkürliche, verrückte Details einbauen, wohingegen Summer die Leserschaft mit purer Langeweile umzubringen versuchte).
Bei jeder anderen Aufgabe hätte ich mich breitschlagen lassen, genau das umzusetzen, was Summer wollte – aber nicht, wenn es ums Schreiben ging. Das war eins der wenigen Dinge, bei denen ich mir meiner Sache sicher war.
»Er schreibt Hilfe? Im Ernst?«, presste Summer durch zusammengebissene Zähne hervor. Der Saum ihres Rocks endete unterhalb des Knies, genau so, wie es in den Schulregeln festgelegt war.
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich dachte, es wäre eine witzige Ergänzung.«
»Das Ganze soll eine ernst zu nehmende Kurzgeschichte werden …«
»Ehrlich gesagt interessiert sich niemand für G&T«, unterbrach Clem sie und sah von ihrem Telefon auf.
Summer knurrte so laut und verärgert wie ein Bär.
»Ich finde meine Ideen ziemlich originell«, sagte ich.
»Originell? Von wegen«, schnaubte Summer. »Die Zweige sind lächerlich. Was für ein Mörder soll das sein, der jemanden umbringt und dann noch Zeit dafür hat, Zweige zu sammeln und mit ihnen HILFE zu schreiben?«
»Ein kreativer Mörder«, erwiderte ich in dem Versuch, mich nicht entmutigen zu lassen. Auf diese Idee war ich nämlich richtig stolz. Die Leiche in der Geschichte wurde im Wald gefunden. Ihre todesstarre Hand schien nach den Zweigen greifen zu wollen, mit denen gerade so außerhalb ihrer Reichweite das Wort HILFE gelegt war. Mir gefiel diese Szene gerade deshalb so gut, weil sie so unüblich und abgefahren war, dass keiner meiner Mitschüler darauf kommen würde.
Summer rollte so sehr mit den Augen, dass ich mich schon fragte, ob sie womöglich nach hinten gedreht stecken bleiben könnten, um für immer ihr riesiges Gehirn anzustarren.
»Ich weigere mich, diese absurden Details drin zu lassen. Dass die Mordwaffe ausgerechnet ein Pokal sein soll, ist schon schlimm genug.«
»Hey, ich fand das cool«, sagte ich. Das war so ein spontaner Einfall gewesen, der mir auf dem Weg durch den Ehrensaal zu einem von Clems Lacrosse-Spielen gekommen war.
»Oooh, Millie hat diese Sache mit mir und den scharfen Peperoni gepostet«, warf Clem ein. Ihr Magen knurrte so laut, dass man es in der Stille des Korridors hören konnte. »Nun komm schon, Jess. Wenn ich nicht endlich Schokolade bekomme, sterbe ich vor Hunger. Ich bin kurz davor, zehn von diesen Peperoni zu essen, auch wenn ich mich danach in Milch ertränken müsste.«
»Man hätte den Typen auch einfach erstechen können.« Summer ignorierte Clem. »Aber nein. Er musste ja unbedingt einen Pokal über den Kopf gezogen bekommen.«
»Schreibst du es nun so auf oder nicht?«, fragte ich. Langsam wurde ich ungeduldig.
Bisher hatten Summer und ich abwechselnd unsere Ergänzungen dazugeschrieben. Das Ganze wäre natürlich viel einfacher, wenn wir in einem digitalen Dokument arbeiten würden, aber Mrs Henridge hatte diese seltsamen Regeln, was Kreatives Schreiben anging. Ihrer Meinung nach zählte nur, was handschriftlich zu Papier gebracht wurde, denn genau so hatten die besten Autoren der Geschichte ihre Werke verfasst. Summer hatte angeboten, die finale Version in ihr rotes Spiralbuch abzuschreiben. Um die Geschichte abzugeben, musste sie die Seiten dann nur noch vorsichtig aus dem Buch heraustrennen.
Summers Nasenflügel blähten sich auf und sie biss sich von innen auf die Wangen. Einen Moment herrschte Stille, dann schnaubte sie. »Na schön. Morgen früh treffen wir uns in der Bibliothek, um meinen Teil zu korrigieren, und dann schreibe ich das Ganze noch vor dem Unterricht ab.« Sie verzog ihr Gesicht, als würden ihr die Worte Schmerzen bereiten, und stolzierte die Treppe hinauf.
»Die hat echt ein Problem«, sagte Clem und sah ihr hinterher.
3
Ich mochte Hugh noch nie. Selbst als er noch nichts mit Clem hatte, hielt ich ihn für falsch. Ich glaube, meine Antipathie begann gleich in dem Moment, als ich ihn kennenlernte. Das war, als wir in der ersten Stunde diese furchtbare Erzählrunde abhielten, um das Eis zu brechen.
Ich kann mich noch so gut daran erinnern, weil ich schon da bereute, das Stipendium der Heybuckle School angenommen zu haben. Das Gebäude war viel zu protzig, die Uniform zu förmlich. Insgesamt gab es nur sechshundert Schüler und Schülerinnen auf die sechs Jahrgänge verteilt, sodass es schwer war, sich in der Masse zu verstecken. Und dann noch all diese merkwürdigen Traditionen – wie zum Beispiel die, am ersten Schultag jedes Trimesters in aller Herrgottsfrühe aufzustehen, um einen nahe gelegenen Hügel hochzusteigen und dabei eine brennende Kerze zu halten, die nicht ausgehen durfte. Wurde man mit einer erloschenen Kerze erwischt, musste man den Hügel wieder hinuntergehen, um noch einmal von vorne anzufangen. Als ich das erste Mal daran teilnahm, war es so windig, dass ich fünf Anläufe brauchte und am Ende komplett mit Matsch bedeckt, total erschöpft und den Tränen nahe war.
Aber das Schlimmste damals zu Beginn war, wie verwirrt mich alle ansahen, als ich sagte, dass ich Jesminder heiße. Als würden sie mir nicht glauben, dass das tatsächlich ein Name ist. Ich vermisste meine alte Schule in London, in der ich nicht weiter auffiel. Meine Klassenkameraden und ich kannten uns schon ewig und machten uns liebevoll über unsere überfürsorglichen Eltern lustig.
Während ich also damals mit Hugh bei dieser Kennlernrunde saß, flog Hughs Blick immer wieder zu Millie hinüber, und es war offensichtlich, dass er nicht mit mir in ein Team gewollt hatte. Wir sollten in Zweiergruppen etwas über das Leben des anderen in Erfahrung bringen und uns dann gegenseitig der Klasse vorstellen. Zuerst hatte nur ich ihn mit Fragen gelöchert und mir Notizen gemacht.
»Wo kommst du denn her?«, fragte er endlich und schnippte mit einem Lineal einen Papierknödel gegen Millies Haar. Sie drehte sich um und warf ihm einen wütenden Blick zu, er aber grinste nur.
»Äh … aus London«, sagte ich und nahm eine andere Sitzposition ein.
Er sah mich zum ersten Mal wirklich an und zog die Augenbrauen zusammen. »Nein, wo du herkommst, will ich wissen.«
»Aus London«, wiederholte ich mit zusammengebissenen Zähnen. Mir war schon klar, wonach er eigentlich fragte, aber diese Antwort würde ich ihm nicht geben. Ich kam nun mal aus London. Dort war ich geboren und aufgewachsen. In Indien war ich noch nie gewesen.
Er versuchte es anders. »Wo kommen deine Eltern her?«
»Aus London«, sagte ich wieder. Beide waren ebenfalls in London zur Welt gekommen. Mein Vater war allerdings gestorben, als ich zwei war.
»Nein, ich meine, wo kommt ihr ursprünglich her? Woher stammt deine Familie?«
Ich beschloss, dass es weniger ermüdend sein würde, ihm seine Klischees zu lassen. »Aus Indien. Genauer gesagt aus Punjab.«
»Warum hast du das nicht gleich gesagt?« Er verdrehte die Augen.
Als wir uns schließlich gegenseitig der Klasse vorstellen sollten, erzählte ich den anderen, dass er Hugh Henry Van Boren hieß und eines Tages ein Herzog sein würde, dass er in einem Landhaus mit zehn Zimmern aufgewachsen war und zwei Hunde sowie drei Katzen besaß.
Und er erzählte den anderen, dass ich Jasminther Irgendwas hieß und aus Indien käme.
Der G&T-Kurs fand einmal die Woche statt und wurde von Mrs Henridge unterrichtet, die erst seit September an der Heybuckle war. Allerdings hatte man eher den Eindruck, sie würde hier zum Inventar gehören. Sie hatte bereits den Ruf weg, eine fordernde Lehrerin zu sein, die Strafen verteilte wie Süßigkeiten. Sie trug Nadelstreifenkostüme und ihre Stimme dröhnte wie ein Nebelhorn. Auch als Summer argumentiert hatte, dass es reinste Zeitverschwendung wäre, mit mir zusammen eine Kurzgeschichte schreiben zu müssen, hatte Mrs Henridge lautstark dagegengehalten.
Als ich den Klassenraum betrat, saß Summer bereits auf ihrem Platz in der ersten Reihe. Knapp nickte sie mir zu.
»Jess«, sagte sie.
»Summer«, antwortete ich.
So liefen die Gespräche meistens zwischen uns. Nur weil wir die beiden einzigen Stipendiatinnen unseres Jahrgangs waren, hieß das noch lange nicht, dass wir etwas gemeinsam hatten. Geschweige denn, dass wir Freundinnen waren.
Ich setzte mich allein in die mittlere Reihe. Mein Wahlpflichtkurs fand immer dienstagnachmittags statt, während Clem beim Lacrosse-Training war. Ich hasste es, ohne sie im Unterricht zu sitzen, weil ich dann niemanden zum Reden hatte. Aber die Fenster gingen auf die Sportplätze hinaus, und so konnte ich sie wenigstens dabei beobachten, wie sie über das Spielfeld heizte und allen anderen blitzschnell auswich.
Als Nächstes erschien Arthur Applewell, ein verhältnismäßig klein gewachsener Junge mit mausbraunen Haaren, der nur selten den Mund aufmachte. Wenn er es verhindern konnte, ging er nie in die Sonne, weshalb er weiß wie die Wand war.
Seine Zwillingsschwester, Annabelle Applewell (die ausschließlich Annabelle und keinesfalls Annie genannt werden wollte, wie sie mal einen Lehrer angepflaumt hatte), war ihm dicht auf den Fersen, setzte sich aber ans andere Ende der mittleren Reihe und nahm ihre Nagelfeile zur Hand. Die Zwillinge würdigten einander kaum eines Blickes.
Während meiner ersten Jahre an der Heybuckle hatte ich mit Annabelle und zwei anderen Mädchen ein Zimmer geteilt. Ab dem fünften Jahrgang durfte man in ein Zweibettzimmer umziehen und Annabelle war mir als Zimmergenossin zugewiesen worden. Doch obwohl wir schon so lange auf engstem Raum zusammenlebten, wusste ich fast nichts über sie (außer dass sie schnarchte, gern zeichnete und es liebte, zu lästern und mit ihrem vielen Geld zu prahlen). Sie war immer nett mir gegenüber, aber an einer Freundschaft war sie nicht interessiert. All ihre Freunde waren laut, selbstbewusst und genauso unfassbar reich wie sie.
Bis vor Kurzem hatte sie noch genauso mausbraunes Haar gehabt wie ihr Bruder, aber als das neue Schuljahr losging, kam sie mit wasserstoffblonder Mähne zurück nach Heybuckle. An den Wochenenden durften wir unsere eigenen Klamotten tragen, und Annabelle nutzte diese Gelegenheit, um sich von Kopf bis Fuß in Designerfummel zu schmeißen, an denen die Label Gucci, Prada oder Chanel nicht zu übersehen waren. Im Gegensatz zu Arthur hatte sie sich einen gefakten Dialekt zugelegt – posh versteht sich. Nur wenn sie sich ärgerte, verfiel sie in ihre alte Sprechweise, und für diese kurzen Augenblicke war sie wieder die Annabelle, die in einer Doppelhaushälfte in East London aufgewachsen war. In solchen Momenten mochte ich sie am liebsten.
Die Applewells waren eine interessante Familie, das fand ich schon von Anfang an. Mr und Mrs Applewell waren zunächst als Anwälte von Z-Promis gehobener Mittelstand. Aber als sie vor einigen Jahren einen Fall von hohem öffentlichen Interesse gewannen, vervierfachte sich ihr Vermögen. Die Klatschblatt-Mentalität ihrer Klienten schien in gewisser Weise auf sie abgefärbt zu haben. Sie hatten fünf Kinder – vier Mädchen und einen Jungen – und ihre Namen begannen alle mit einem A, sodass sie ausnahmslos die Initialen AA hatten. Wie die Anonymen Alkoholiker. Oder die Batterien.
Schließlich betrat auch Hugh den Klassenraum, gefolgt von seinem besten Freund Tommy Poppleton, der, wie ich fand, besser aussah als Hugh. Tommy hatte dunkles, verwuscheltes Haar und grüne Augen, die so funkelten, als wäre er der Hüter eines aberwitzigen Geheimnisses. Seine Ärmel waren hochgekrempelt und wie immer umgab ihn dieser moschusartige Duft. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber irgendwas an seinem Geruch lässt jedes Mal meine Knie weich werden. Nur ein kleines bisschen.
Um zu ihren Plätzen ganz hinten im Raum zu gelangen, mussten sie an meinem Tisch vorbeigehen. Hugh fummelte auf seinem Handy herum und nahm mich nicht mal wahr. Tommy aber lächelte mir zu und ich lächelte zurück. Ich hatte noch ein paar andere Fächer mit ihm, aber bis jetzt noch keinen Grund gehabt, mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Durch das Fenster sah ich, wie Clem das Lacrosse-Team beim Aufwärmen anführte – gerade drehten alle die Arme wie Windmühlen. Hoffentlich verlor Clem nicht die Nerven. Millie trug das gleiche neonfarbene Leibchen wie sie, die beiden würden also im selben Team spielen. Was allerdings noch lange nicht hieß, dass Clem vor Millie in Sicherheit war.
Millies Ausraster im Speisesaal vor einer Woche hatte dazu geführt, dass Clem und Hugh aus ihrer Beziehung kein Geheimnis mehr machten. Ständig bekamen sie Ärger, weil sie in den Korridoren beim Knutschen erwischt wurden. Clem hatte jetzt zwar nur noch selten Zeit für mich, aber ich gab mir Mühe, mich für sie zu freuen … auch, wenn die beiden sich wie die Turteltauben aufführten, was mir einen heftigen Brechreiz bescherte. Hugh war nicht mal ausgeflippt, als Clem aus Versehen seinen Rucksack in den Dreck fallen ließ.
In der Zwischenzeit wanderte Millie wie eine tickende Zeitbombe durch die Schule und schien nur auf den passenden Moment zu warten, um hochzugehen. Wenn ich sie irgendwo sah, bog ich in einen anderen Flur ab und hoffte, sie hatte mittlerweile vergessen, dass ich über Clem und Hugh Bescheid gewusst hatte. Ihren Freunden konnte ich allerdings nicht komplett aus dem Weg gehen. Und die wechselten jedes Mal, wenn sie mich sahen, verschwörerische Blicke, als wären sie Eingeweihte in Millies Rachepläne.
Von draußen drang ein schriller Pfiff zu uns hinein. Das Lacrosse-Trainingsspiel hatte begonnen.
Summer schob sich mit dem Stuhl nach hinten und drehte sich zu mir um.
»Die finale Version der Kurzgeschichte«, sagte sie und hielt mir einen Papierstapel hin.
Schnell überflog ich die Seiten, um sicherzugehen, dass sie mich nicht reingelegt und vergessen hatte, die Zweige, den Pokal und die Position der Leiche in die Geschichte einzuflechten.
»Scheint alles zu passen«, sagte ich und gab ihr den Stapel zurück.
Mit einem zufriedenen Lächeln legte sie die Papiere auf Mrs Henridges Schreibtisch.
Draußen ertönte erst ein Schrei, dann gleich der nächste. Millie hatte Clem attackiert und jetzt rollten beide über den Rasen. Der Trainer wollte sie mit der Pfeife zur Ordnung rufen, aber weder Clem noch Millie schien das zu interessieren.
Innerhalb von Sekunden standen alle an der Fensterfront, um besser sehen zu können. Alle bis auf Arthur, der einfach sitzen blieb. Er hatte nur einen flüchtigen Blick nach draußen geworfen und war dann gleich wieder in Gedanken versunken, was auch immer es war, worüber er sich den Kopf zerbrach.
Ich zuckte zusammen, als Millie die Oberhand gewann und Clems Gesicht mit ihren perfekt gepflegten Fingernägeln bearbeitete. Clem heulte auf und stieß Millie von sich runter, die Schläger lagen irgendwo unbeachtet im Gras.
»Also echt, sie müssen sich doch meinetwegen nicht so doll streiten«, sagte Hugh mit einem fetten Grinsen im Gesicht. Sein Atem beschlug die Fensterscheibe.
»Du bist ein richtiges Arschloch«, fuhr Summer ihn an.
»Wenigstens steckt bei mir kein Stock drin«, gab er zurück, ohne sie anzusehen.
»Im Gegensatz zu dir kann ich was dagegen tun und ihn rausnehmen. Du aber, Hugh Henry Van Boring, du wirst immer ein Arschloch bleiben.«
Ich sah mich um und wollte Summer anerkennend zulächeln – doch stattdessen erhaschte ich Tommys Blick. Er biss sich von innen auf die Wangen, als müsste er sich davon abhalten, ebenfalls zu grinsen. Sofort wandte ich den Blick wieder ab und starrte so lange an die Decke, bis ich den drohenden Lachflash erfolgreich bekämpft hatte.
Clem und Millie rangen immer noch miteinander, und ich war so damit beschäftigt, um den Gesundheitszustand meiner besten Freundin zu bangen, dass ich von Mrs Henridges Erscheinen gar nichts mitbekommen hatte.
»Guten Tag, alle miteinander. Was ist da draußen denn so interessant?« Mit klackernden Absätzen schritt sie zu uns hinüber. »Um Himmels willen, warum unternimmt denn niemand was? Was denkt sich Coach Tyler nur?«
Offensichtlich wollte der Trainer nicht dazwischengehen. Man warf sich ja auch nicht zwischen zwei raufende Hunde, aus Angst, gebissen zu werden. Und genau wie man es bei Hunden machte, hatte sich Coach Tyler einen großen Eimer Wasser besorgt, dessen Inhalt er jetzt über die beiden Mädchen goss.
Ihre Schreie waren bestimmt bis ins nächste Dorf zu hören.
»So, das reicht jetzt«, sagte Mrs Henridge, während sie noch einen missbilligenden Blick nach draußen zum Trainer warf. »Lassen Sie uns anfangen.«
Ich wandte mich vom Fenster ab und sah, dass Hugh bereits wieder auf seinem Platz saß. Immer noch grinsend ordnete er die Bücher auf dem Tisch und legte seinen Kuli, den Bleistift und das Lineal in einer geraden Linie vor sich hin.
Er bemerkte, wie ich ihn anstarrte, und in seinem Blick lag etwas, das ich zu dem Zeitpunkt nicht richtig einordnen konnte.
Diese Unterrichtsstunde war die letzte, die ich vor seinem Tod mit ihm zusammen hatte. Danach bekam ich ihn nur noch flüchtig zu Gesicht. Vermutlich hatte sich deshalb dieser Ausdruck in seinen Augen in mein Gedächtnis gebrannt. Erst viel später wurde mir klar, was mich an seinem Blick irritiert hatte.
Ich hatte erwartet, Sorge in seiner Miene zu erkennen, weil Clem verprügelt worden war.
Doch stattdessen sah ich Triumph.
4
Clem und Millie wurden für den restlichen Nachmittag vom Training ausgeschlossen und bekamen danach die Standardstrafe ihres Trainers aufgebrummt: alle Sportbälle der Schule reinigen. Das dauerte ewig, und vor allem war es total sinnlos, weil die Bälle gleich am nächsten Tag wieder dreckig wurden. Eine absolut grausame Strafe.
Abendessen gab es ab 18:00 Uhr, und Clem durfte mitessen, solange sie pünktlich um 18:50 Uhr am Geräteschuppen erschien.
»Diese blöde Ziege«, grummelte Clem. Sie wickelte Spaghetti auf ihre Gabel und ignorierte die Tatsache, dass Millie am Tisch hinter uns saß und ihr vernichtende Blicke zuwarf. »Im Ernst, sie läuft herum wie ein begossener Pudel. Man möchte doch meinen, dass sie mittlerweile drüber hinweg ist, aber nein, stattdessen geht sie beim Training auf mich los. Ich hatte nicht mal Zeit zu entscheiden, ob ich nicht lieber Pazifistin bin und keinen einzigen Finger rühre, um mich zu verteidigen – was übrigens superwitzig gewesen wäre. Das hätte sie vollkommen aus dem Konzept gebracht.«
Ich wollte gerade darauf hinweisen, dass Millie erst vor einer Woche das Herz gebrochen wurde – noch dazu in aller Öffentlichkeit. Aber ich kam nicht dazu, weil sich in dem Moment drei Jungs aus dem ersten Jahr auf die Bank stellten und in einem Mooning-Act ihre Hinterteile in Richtung des Lehrertisches streckten. Sogleich brachen im gesamten Speisesaal Jubelrufe aus und es wurde lautstark mit dem Besteck auf die Tische getrommelt.
»Regia Club! Regia Club!«, ertönte es aus allen Ecken.
Ich kämpfte gegen den Drang an, die Augen zu verdrehen. Der Regia Club begnügte sich nicht damit, an der Heybuckle die Zügel in der Hand zu halten, um sich das Leben hier zu erleichtern (wovon oft auch die restliche Schülerschaft profitierte, als zusätzlicher Bonus sozusagen, wie zum Beispiel bei der Sache mit der Handynutzung; außerdem ging das Gerücht um, der Club hätte dafür gesorgt, dass der Gemeinschaftsraum des fünften Jahrgangs noch vor dem winzigen Lehrerzimmer renoviert wurde). Nein, die Mitglieder schickten auch hin und wieder anonyme Nachrichten oder Briefe an die übrigen Schülerinnen und Schüler, in denen sie eine Mutprobe verlangten. Ich fürchtete mich davor, jemals so eine Nachricht zu erhalten, denn die Mutproben waren meistens so was wie Nacktbaden im See oder als Flitzer durch den Gemeinschaftsraum laufen. Ganz offensichtlich fanden die Clubmitglieder es am spaßigsten, wenn andere blankzogen.
Meist waren die Mutproben allerdings harmlos, eher peinlich als alles andere. Aber wenn man sie nicht ausführte, musste man dafür büßen: Ein fieses Gerücht wurde gestreut oder deinen Freunden wurde eine Woche lang verboten, mit dir zu reden. Es kam aber nur selten zu solchen Vergeltungsakten, denn selbst wenn die Strafen recht harmlos klangen, waren sie das in Wirklichkeit gar nicht. Schließlich befanden wir uns hier auf einem Internat und es gab absolut kein Entkommen.
Ich glaube, Mrs Greythorne hatte mal versucht, den Regia Club aufzulösen, mit der Begründung, dass er zu Aufsässigkeit und Mobbing führe. Aber die Tradition war so alt wie die Schule selbst und wird wohl noch lange nach ihrer Pension weiterleben.
Die drei popowackelnden Jungs wurden zu Mrs Greythorne geschickt, was sie allerdings absolut nicht entmutigte, weil sie immer noch von den meisten anderen im Saal angefeuert und beklatscht wurden.
»Wetten, die müssen nur irgendwelche Sätze hundert Mal abschreiben«, murmelte Clem, als die drei sich auf den Weg machten, »und nicht wie ich die Drecksarbeit erledigen?«
Um halb sieben verließen auch Clem und ich den Speisesaal. Sie steuerte ihr Zimmer an, um ihre Schuluniform gegen einen schlabberigen Trainingsanzug einzutauschen.
»Wenigstens werde ich nicht gezwungen, einen orangen Gefängnisanzug anzuziehen«, sagte sie. »Zu meiner Klobürsten-Frisur würde das fürchterlich aussehen.«
Ich machte mich auf den Weg zu meinem Zimmer, voller Vorfreude auf den Showdown des Thrillers, den ich gerade las. Aber als ich schon fast die Tür erreicht hatte, drangen verärgerte Stimmen auf den Flur hinaus, die selbst durch die dicke Eichentür zu hören waren.
Beim Eintreten sah ich, dass Annabelles Freundin Lucy Huang bei uns abhing. Ich kannte Lucy ziemlich gut, weil wir beide komischerweise aus irgendeinem Grund immer wieder ausgewählt wurden, um für die Fotos der Schulbroschüre zu posieren – mit gefaktem Lachen, als hätten wir unfassbar viel Spaß miteinander. Wenn ich für jedes Mal, das ich tatsächlich mit meinen ach so diversen Freunden auf den großzügigen Rasenflächen von Heybuckle saß, einen Penny bekommen würde, dann wäre ich so vermögend wie jetzt auch – nämlich gar nicht.
Genauso wenig, wie ich mit Summer befreundet sein wollte, nur weil wir beide Stipendiatinnen waren, wollte ich mit Lucy befreundet sein, nur weil wir beide zufälligerweise zu den wenigen Schülerinnen auf Heybuckle gehörten, die für Diversität standen. Lucys Lästereien waren noch schlimmer als Annabelles und ihre Familie war vermutlich genauso reich wie die Applewells.
Als Lucy und Annabelle mich sahen, verstummten sie sofort. Ganz offensichtlich wollten sie nicht, dass ich mitbekam, worüber sie sich stritten – ich vermutete, es ging um irgendwelche Celebritys und ob der eine heißer war als der andere. An den Wänden neben Annabelles Bett hingen etliche Poster von Berühmtheiten, obwohl es verboten war, etwas an die Wand zu pinnen. Unzählige Plastiktüten mit Klamotten stapelten sich auf ihrer Seite des Zimmers. Es war ein Hobby von ihr, ständig neue Sachen im Wert von mehreren Hundert Pfund zu bestellen und alles, was ihr nicht gefiel, wieder zurückzuschicken.
Hier war ich also nicht erwünscht, deshalb beschloss ich, mich in die Bibliothek zurückzuziehen. Ich sammelte meine Bücher zusammen, was eine Weile dauerte, und dann suchte ich ewig nach meinem Taschenrechner, bis mir wieder einfiel, dass Clem ihn sich geliehen und noch nicht zurückgegeben hatte. Annabelle warf mir ihren zu, um mich endlich loszuwerden.
Auf dem Weg zur Bibliothek lagen die Flure gespenstisch leise und verlassen da, auf dem glänzend polierten Holzfußboden hallte jeder meiner Schritte wider. Die meisten meiner Mitschüler waren entweder noch im Speisesaal oder in ihren Zimmern oder Gemeinschaftsräumen. Ein kalter Wind blies mir in den Nacken. Das Gebäude war alt und viel zu groß für die verhältnismäßig geringe Schülerschaft und es gab jede Menge ungenutzte Klassenräume. Ich kam mir vollkommen allein vor, bis ich in ein steinernes Treppenhaus einbog, das zum Hauptkorridor führte. Auf einmal drangen leise, gespenstische Stimmen zu mir. Ich erstarrte, als ich Millies gepflegten Dialekt erkannte.
»Du musst aufhören, verstanden?«, zischte sie. Ihre Stimme hallte vom unteren Ende der Treppe zu mir hinauf.
Damit Millie und ihr Gesprächspartner – wer auch immer es sein mochte – nicht merkten, dass sie nicht mehr allein waren, hielt ich wie angewurzelt inne. Der Chance, sie zu belauschen, konnte ich nicht widerstehen. Ich sah auf die Uhr, es war 18:46 Uhr, also würde sie es wohl kaum mehr schaffen, rechtzeitig beim Nachsitzen zu erscheinen.
»Ich hab dir doch aber sonst auch immer bei allem Möglichen geholfen«, sagte eine Jungenstimme, die ich nicht zuordnen konnte. Das Echo im Treppenhaus verfälschte die Tonlage und die Heybuckle-Jungs klangen eh alle gleich – sie sprachen jede Silbe so deutlich aus, als hätten sie Sprechunterricht von der Queen höchstpersönlich erhalten. »Ich würde alles für dich tun –«
»Komm endlich über diese bescheuerte kleine Schwärmerei hinweg«, fuhr Millie ihn an. »Deinetwegen komme ich noch zu spät. Geh mir aus dem Weg –«
»Was ist auf einmal los mit dir?«, fragte der Typ mit beinahe flehender Stimme. »Sag es mir einfach und ich bringe alles wieder in –«
»Geh mir aus dem Weg!«
Es folgte ein grunzender Laut und dann wurde eine Tür zugeschlagen.
»Das hat wehgetan!«, rief der Junge, doch Millie war schon längst verschwunden. Ich verharrte noch ein paar Sekunden auf der Stelle, bevor ich die Treppe hinabstieg, und als ich unten ankam, war niemand mehr zu sehen.
Schnell verdrängte ich das Gespräch wieder aus meinem Kopf. Ich war froh darüber, dass Millie zur Abwechslung mal mit etwas anderem beschäftigt war, als einen Plan für ihre Rache an Clem zu schmieden. Jede andere hätte bestimmt unbedingt herausfinden wollen, wer Millies geheimnisvoller Verehrer war, aber mir war das egal. Clems Techtelmechtel mit Hugh war ausreichend Drama für mich.
Den restlichen Abend verbrachte ich mit meinen Mathehausaufgaben, die mir den letzten Nerv raubten. Eigentlich könnte man meinen, dass es auf dem Internat keine Hausaufgaben geben dürfte. Schließlich ist man ja genau genommen nie zu Hause.
Tja, falsch gedacht. Hier nennen sie sie einfach Schularbeiten. So viel dazu.
Die Mathehausaufgaben waren echt schwer und ich kam nur mühsam voran, so als würde ich mir einen Weg durch zähflüssigen Sirup bahnen. Ich gehörte hier nicht zu den Besten, das wusste ich, aber ich war auch keine Niete. Ich konnte mir Dinge wirklich gut merken. Nicht, dass ich ein fotografisches Gedächtnis hätte oder so was, aber es fiel mir leicht, mir Sachen einzuprägen. So hatte ich auch das Stipendium bekommen – indem ich viele alte Aufnahmetests der Heybuckle School durcharbeitete und Glück hatte, dass in meiner Version dieselben Fragen drankamen.
Clem war es schleierhaft, warum mir Mathe so wichtig war. »Dir liegt Englisch viel mehr, warum spielt es da eine Rolle, dass du schlecht in Mathe bist?«, fragte sie mich immer wieder.
Für mich spielte es nun mal eine Rolle. Alle anderen hier taten immer so, als wären sie oberschlau, selbst wenn das gar nicht stimmte – Fake it until you make it schien das inoffizielle Motto der Schule zu sein. Aber diese Fähigkeit besaß ich nicht. Niemand redete offen darüber, dass das make it für die meisten hier bedeutete, einfach auf den Tag zu warten, an dem ihre Eltern ihnen einen Top-Job besorgten. Ich dagegen musste mich alleine durchwurschteln und hatte ständig das Gefühl, beweisen zu müssen, dass ich meinen Platz an der Heybuckle auch wirklich verdient hatte – selbst wenn meine Punktzahl bei Tests in der oberen Hälfte lag. Leute wie Clem gingen durchs Leben mit dem Wissen, dass es ihnen etwas schuldig war, und das Leben bewies ihnen, dass sie damit richtiglagen. Aber Leute wie ich waren dem Leben etwas schuldig.
Mum meinte, Heybuckle würde mir all die Möglichkeiten bieten, die sie selbst nie bekommen hatte. Sie war mit sechzehn von der Schule abgegangen, um zu arbeiten. Damals war in unserer Familie der Weg auf die Uni undenkbar, für Mums Eltern zählte bloß ein Job, egal welcher, der Geld einbrachte, denn das brauchten sie dringend. Meine Großeltern sprachen kein Englisch, nur Panjabi. Als sie noch am Leben waren, versuchte ich mich mit den wenigen Brocken Panjabi, die ich sprach, mit ihnen zu verständigen, was mehr schlecht als recht funktionierte. Nach ihrem Tod hatte ich keine Gelegenheit mehr, die Sprache zu sprechen, und mit der Zeit vergaß ich alles, was ich gelernt hatte – mit ihnen war auch meine letzte wirkliche Verbindung nach Indien gestorben. Ich selbst gehörte im Grunde nirgendwo richtig hin. Niemand würde mich ohne Weiteres als Engländerin erkennen. Aber ich könnte auch nicht einfach ein Leben in Indien führen, dafür war ich zu britisch.
Je länger ich an der Heybuckle war, desto klarer wurde mir, dass mir trotzdem nicht dieselben Möglichkeiten offenstanden wie den anderen hier. Meine Mitschülerinnen und Mitschüler könnten beschließen, eine Weltreise zu machen, und ihre Eltern hätten nichts dagegen. Selbst, wenn sie sich einen Job aussuchten, der zwar genau das war, was sie schon immer machen wollten, aber nur einen Hungerlohn einbrachte, wäre das kein Problem, denn sie könnten vom Vermögen ihrer Eltern leben. Ich dagegen musste vernünftig sein und mir genau überlegen, was ich als Nächstes tat. Ich hatte kein Sicherheitsnetz.
Und deshalb war mir meine Mathenote nicht egal.
Ich blieb den ganzen Abend in der Bibliothek und kämpfte mich durch die Hausaufgaben. Andere kamen und gingen, aber ich beachtete sie gar nicht, sondern versuchte, konzentriert zu bleiben. Kurz bevor die Bibliothek geschlossen wurde, sammelte ich meine Sachen zusammen und machte mich auf den Weg zurück zu meinem Zimmer. Ich kam am Gemeinschaftsraum des fünften Jahrgangs vorbei, aus dem eine Horde Schüler strömte. Dort traf ich auf Hattie Fritter, Clems Zimmergenossin, die in unbehaglichem Schweigen neben mir lief, da wir beide denselben Weg hatten.
Hattie war eine von diesen Naturmenschen, die gern wandern gingen und sich am liebsten im Freien aufhielten. Genau wie ich war sie eher der ruhige Typ, sodass wir selten miteinander sprachen. An meinem Zimmer angekommen, sagte ich Tschüs und schlüpfte hinein. Annabelle schlief schon, was ungewöhnlich war, denn normalerweise blieb sie lange wach und schrieb sich mit ihren Freundinnen Nachrichten. Im Dunkeln machte ich mich fürs Bett fertig.
Am nächsten Morgen traf ich mich mit Clem zum Frühstück. Im Speisesaal war eine seltsame Stimmung. Zwar quatschten und lachten die meisten wie sonst auch, aber manche blickten ernst oder sogar ängstlich drein.
Wir setzten uns an einen der langen Tische, und es war fast so, als würde man ein Feuer dabei beobachten, wie es sich langsam ausbreitete – nach und nach waren immer mehr ernste Gesichter zu sehen. Kate Dulfity, deren Familie seit dem frühen 19. Jahrhundert eine edle Juweliergeschäftskette besaß, lief umringt von Freunden an uns vorbei. Sie hatte feuerrotes Haar und Sommersprossen und wirkte immer so, als hätte sie gerade etwas verloren – was vermutlich auch stimmte. Sie war total unorganisiert und dafür bekannt, ständig irgendwo etwas liegen zu lassen – ihre Wasserflasche, ihre Büchertasche oder auch ihren Laptop. Ich kannte sie nicht besonders gut, aber sie war in meinem Mathekurs und spielte Lacrosse. Clem hatte mir mal erzählt, dass sie und die anderen aus ihrem Team Kate oft sicherheitshalber frühere Trainingszeiten sagten. Da Kate kein Zeitgefühl hatte – vermutlich, weil sie ihr Handy und ihre Uhr regelmäßig verbummelte –, verabredeten sich die anderen bereits eine Stunde vor dem eigentlichen Beginn mit ihr.
»Hey, Kate«, rief Clem. »Alles klar?«













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















