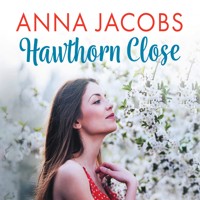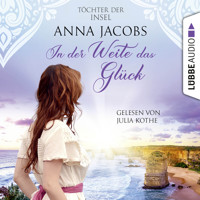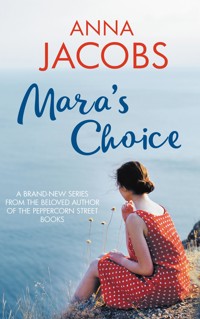9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Auftakt der neuen großen Australien-Saga!
Lancashire, 1857: Die siebzehnjährige Liza ist mit ihrer Arbeit als Dienstmädchen zufrieden - bis ihre Arbeitgeber den Plan fassen, nach Australien auszuwandern. Noch dazu beschließt ihr Vater, dass sie einen älteren Witwer heiraten soll. Als dieser sich jedoch an ihr vergeht, steht für Liza die Entscheidung fest: Sie muss fliehen. Sie schließt sich ihren Arbeitgebern an und begibt sich auf die lange Reise nach Australien.
An Bord des Schiffes stellt Liza zu ihrem Entsetzen fest, dass sie schwanger ist. Selbst wenn sie die Reise überlebt, wird das anstrengende Leben einer Siedlerin durch ein uneheliches Kind noch schwieriger. Doch in Australien angekommen entdeckt Liza nach und nach, dass das Leben ihr neben schlimmsten Entbehrungen auch Möglichkeiten bietet, von denen sie zu Hause in Lancashire nie geträumt hätte ...
Bewegend. Emotional. Fesselnd. Die neue Love-and-Landscape-Saga der Bestseller-Autorin Anna Jacobs vor der atemberaubenden Kulisse Australiens.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
»Anna Jacobs Bücher zeigen ein beeindruckendes Gespür für menschliche Gefühle.« Sunday Times, UK
»Eine packende Erzählstimme.« Sunday Star Times, NZ
»Jacobs ist eine Meisterin darin, lebhafte und einprägsame Charaktere zu erschaffen.« Booklist, USA
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Die Sehnsucht nach Glück.
Lancashire, 1857: Die siebzehnjährige Liza ist mit ihrer Arbeit als Dienstmädchen zufrieden – bis ihre Arbeitgeber den Plan fassen, nach Australien auszuwandern. Noch dazu beschließt ihr Vater, dass sie einen älteren Witwer heiraten soll. Als dieser sich jedoch an ihr vergeht, steht für Liza die Entscheidung fest: Sie muss fliehen. Sie schließt sich ihren Arbeitgebern an und begibt sich auf die lange Reise nach Australien.
An Bord des Schiffes stellt Liza zu ihrem Entsetzen fest, dass sie schwanger ist. Selbst wenn sie die Reise überlebt, wird das anstrengende Leben einer Siedlerin durch ein uneheliches Kind noch schwieriger. Doch in Australien angekommen entdeckt Liza nach und nach, dass das Leben ihr neben schlimmsten Entbehrungen auch Möglichkeiten bietet, von denen sie zu Hause in Lancashire nie geträumt hätte ...
Bewegend. Emotional. Fesselnd. Die neue Love-and-Landscape-Saga der Bestseller-Autorin Anna Jacobs vor der atemberaubend Kulisse Australiens.
Anna Jacobs
Töchter des Südsterns
Die Freiheit am Horizont
Aus dem Englischen von Michael Krug
KAPITEL 1
März 1857
Dorothy Pringle stand an der Tür und sah ihrem aufgeweckten jungen Dienstmädchen lächelnd bei der Arbeit zu. Es duftete nach Politur und Blumen. Durch die Fenster schien strahlend die Frühlingssonne herein. Und Liza, die nicht bemerkte, dass sie beobachtet wurde, summte leise vor sich hin, während sie den Tisch deckte, behutsam jeden Teller platzierte und das Besteck penibel daneben anordnete.
Als der Türklopfer ertönte, schaute die junge Frau auf. Erschrocken zuckte sie zusammen. »Oh. Ich wusste nicht, dass Sie da sind, Mrs P.«
Eindringlich ertönte der Klopfer erneut. Er bat nicht um Aufmerksamkeit, er verlangte danach.
»Soll ich hingehen, Ma'am?«
»Nein, das übernehme ich. Mach du hier fertig.«
Liza setzte die Arbeit fort. Es bereitete ihr Freude, den Tisch schön zu gestalten. Tatsächlich liebte sie alles daran, einer so netten Herrin zu dienen. Als sie eine gedämpfte Unterhaltung hörte – eine tiefe, grollende Männerstimme und die leisen Töne ihrer Arbeitgeberin –, hielt sie stirnrunzelnd inne. Der Mann klang wie ... Aber das konnte nicht sein, oder?
Mrs Pringle kehrte zurück. Sie wirkte verwirrt. »Es ist dein Vater.«
Als Con Docherty ihr unaufgefordert ins Zimmer folgte, warf Liza ihrer Herrin einen besorgten Seitenblick zu. Was wollte ihr Vater hier? Und obendrein drängte er sich mit seinen schmutzigen Stiefeln in den Salon. Es war nicht der letzte Freitag im Monat, an dem er regelmäßig ihren Lohn abholen kam. Beklommen schlug ihr Herz schneller. Gab es zu Hause etwa Ärger?
Con warf einen mürrischen Blick auf die Hausherrin, die ihm kaum bis zur Schulter reichte und ihn doch stets einschüchterte. »Ich fürchte, ich bin hier, um meine Tochter mitzunehmen, Mrs Pringle. Sie kann nicht länger für Sie arbeiten. Ihre Mutter ist krank. Sie wird zu Hause gebraucht.« Er wandte sich an seine Tochter. »Geh und pack deine Sachen, Mädchen!«
Zweifelnd schaute Liza zwischen den beiden hin und her und wartete darauf, dass ihre Herrin das Wort ergriff.
»Du kannst wiederkommen, wenn es deiner Mutter besser geht«, meinte Dorothy beschwichtigend.
Con räusperte sich. »Ich fürchte, wir werden sie von jetzt an zu Hause brauchen. Wenn Sie mir also noch bezahlen, was ihr zusteht, belästigen wir Sie nicht länger.«
Liza hatte an der Tür innegehalten und gelauscht. Unwillkürlich rutschte ihr ein enttäuschtes Wimmern heraus. Als ihr Vater ihr einen finsteren Blick zuschleuderte, klatschte sie sich die Hand auf den Mund. Wenn man wusste, was gut für einen war, stritt man nicht mit ihm und handelte nicht seinen Wünschen zuwider. Aber diesen Ort zu verlassen, war das Letzte, was sie wollte. Zu Hause fand sie es grauenhaft.
Innerhalb einer halben Stunde hatte sie ihre Sachen gepackt und ging mit ihrem Vater in Richtung des Orts. Auf der Schulter trug er die Korbtruhe, die sie nur mit Müh und Not anzuheben vermochte, wenn sie voll war. Er hingegen schien das Gewicht kaum zu bemerken. Liza sorgte sich entsetzlich um ihre Mutter, doch er hatte ihr den Mund verboten, als sie erneut herauszufinden versucht hatte, was nicht stimmte. Also lief sie schweigend und bang neben ihm einher.
Sobald sie die Erhebung hinter sich hatten, die das Dorf Ashleigh von Pendleworth trennte, gingen die hübschen Wege in kopfsteingepflasterte Straßen über. Beherrscht wurde der Ort von der riesigen Fabrik mit ihrem hohen, rauchenden Schornstein und den beiden großen Häusern, Pendleworth Hall und Rawley Manor. Sie lagen im Nordosten und Nordwesten, von wo sie alles aus sicherer Entfernung überblickten. In der Pendleworth Hall wohnten die Ludlams – ihnen gehörte neben der Fabrik noch etliches anderes im Bezirk. Die Rawleys lebten schon ewig in ihrem Herrenhaus, engagierten sich jedoch neuerdings nicht mehr sonderlich in der Ortschaft, die in den letzten zwanzig Jahren auf die doppelte Größe angewachsen war.
Von Ashleigh aus konnte man weder die Fabrik noch die beiden großen Herrensitze sehen. Dort draußen schmeckte die Luft süßer. Besonders liebte Liza die mächtigen schattenspendenden Bäume rund um das Haus. Im Ort bekam man allein vom Atmen einen rußigen Geschmack im Mund. Außerdem wirkte alles düsterer, von den grauen Schieferdächern bis hin zu den quadratischen Steinen des Pflasters der Hauptstraßen. Sogar die roten Backsteine der kleinen, von den Ludlams zur Unterbringung ihrer Arbeiter gebauten Reihenhäuser hatte der Rauch aus dem großen Schornstein der Fabrik zu einer ungewissen trüben Schattierung von Braun verdunkelt. Jeden Monat, wenn ihr Vater den Lohn abholen kam und sie für ihren freien Sonntag mit nach Hause nahm, hatte Liza das Gefühl, von den schmalen Gassen wie von einem Schraubstock erdrückt zu werden. Das hatte sie nicht weiter gestört, als sie gewusst hatte, dass sie abends zu den Pringles zurückkehren würde. Doch vor dem Gedanken, hierbleiben zu müssen, graute ihr.
Sie versuchte nicht noch einmal, etwas zu sagen, sondern konzentrierte sich allein darauf, mit den langen Schritten ihres Vaters mitzuhalten. Da Liza und ihre Schwester ganz nach ihrer Mutter kamen, reichte sie ihm nur bis zur Schulter. Ihre beiden älteren Brüder gerieten nach Pa und waren bereits stämmige Männer. Bei Kieran ließ es sich noch nicht abschätzen. Er war eben erst neun Jahre alt geworden.
Am unteren Ende der Market Road bogen sie in die Underby Street. Dort befand sich der Laden mit dem verblassten Schild über dem Schaufenster – DOCHERTY, GEBRAUCHTBEKLEIDUNG. Auf einer schmuddeligen Karte an der Tür stand: Bestpreise geboten. Lizas Schritte gerieten ins Stocken. Sie wollte nicht an diesen Ort zurück. Nicht, nachdem sie eine Kostprobe einer anderen Art von Leben erhalten hatte, bei dem man jeden Tag genug zu essen bekam. In einem Haus, das allzeit ordentlich und sauber gehalten wurde – und in dem man nicht angebrüllt wurde, geschweige denn für eine unpassende Bemerkung geschlagen.
Während sie den Laden mit seinen Kleiderstapeln und dem säuerlichen Geruch durchquerten, rümpfte sie die Nase und versuchte, nicht einzuatmen. Beim Betreten der Küche sah sie ihre Schwester an der Tür zur Spülkammer. Aber da ihr Vater »Beeilung!« raunte, winkte sie Nancy nur zu und folgte ihm nach oben.
Durch die offene Tür des vorderen Schlafzimmers sah sie ihre Mutter unruhig schlafen. Allerdings sah sie Gott sei Dank nicht so schlecht aus, wie Liza befürchtet hatte. Ihr Vater lud die Truhe im hinteren Zimmer ab und schaute zurück zum vorderen.
»Wird ihr guttun, dass du hier bist und dich um alles kümmerst. Und mir wird es guttun, wenn du mir wieder im Laden hilfst. Jetzt raus aus den feinen Sachen. Zieh dich um und komm dann nach unten. Ich will was essen, und du kochst besser als unsere Nancy.«
»Ja, Pa.« Aber sobald Mama wieder auf den Beinen wäre, würde sie bestimmt zurückdürfen – wenn ihre Stelle dann noch frei wäre. Liza drückte fest die Daumen. Bitte lass sie niemanden finden, der meinen Platz einnimmt! Die Pringles zahlten keinen hohen Lohn. Deshalb hatten sie ein Mädchen aus der Underby Street eingestellt. Vielleicht bestand also eine Chance.
Als Liza unten ankam, war ihr Vater in den Laden verschwunden. In der Spülküche wusch Nancy, gerade erst zwölf und klein für ihr Alter, halbherzig das Geschirr ab. »Ich bin so froh, dass du zurück bist. Pa hat schon die ganze Woche fürchterliche Laune, und Niall hat mich heute Morgen geschlagen.« Sie schniefte trübsinnig und rieb sich mit einer nassen, geröteten Hand über einen Bluterguss auf ihrer Wange.
»Tja, da kann man jetzt nichts machen. Sieh zu, dass du mit dem Abwasch fertig wirst. Mama würde einen Anfall kriegen, wenn sie herunter in diese Unordnung käme. Sobald sie aufwacht, bringen wir ihr eine Tasse Tee nach oben.«
»Ich kann nicht alles machen«, brummelte Nancy mit mürrischer Miene.
»Natürlich nicht. Ich koche Pa zuerst etwas zu essen, danach räumen wir zusammen auf.«
Nur musste sie davor in den Laden gehen und ihn um Geld bitten, damit sie Tee und Lebensmittel kaufen konnte, da sie kaum etwas zu Hause hatten. Natürlich verschlimmerte sich dadurch seine Laune, und er schrie sie an. In den zwei Jahren, die sie woanders gelebt hatte, schien sich nichts geändert zu haben, dachte Liza kläglich. Nur sie. Und sie hatte sich stark verändert. Dieser Ort fühlte sich nicht mehr wie ein Zuhause an – und sie hatte auch keine Lust, sich alles gefallen zu lassen.
Am nächsten Tag sah Pa ihre Truhe durch und entnahm ihr Lizas feine Arbeitskleidung, um sie in seinem Laden zu verkaufen.
Als sie ihn anflehte, es nicht zu tun, setzte es heiße Ohren. Da wurde ihr klar, dass er sie nicht zu den Pringles zurückkehren lassen würde. In jener Nacht weinte sie ins Kissen. Und als sich Nancy umdrehte und sich an sie kuschelte, flüsterte sie: »Hier bleibe ich nicht! Da kann er machen, was er will, ich bleibe nicht!« Sobald es ihrer Mutter besser ginge, würde sie sich einen Weg ausdenken, um zu entkommen – irgendwohin, so weit weg, dass ihr Vater sie nie wieder finden würde.
Als er kurz ausging, um sich »die Gurgel mit Bier zu befeuchten«, holte sich Liza aus dem Laden einige ihrer besseren Sachen, versteckte sie unter den Haufen derer, die eher Lumpen glichen, und hoffte, er würde es nicht bemerken.
Die nächsten zwei Wochen blieb ihr kaum eine Minute zum Nachdenken, weil sie nicht nur Mama versorgen musste, sondern auch ihre älteren Brüder Niall und Dermott. Die beiden erwarteten, von vorn bis hinten von ihr bedient zu werden, sobald sie von der Mühle nach Hause kamen. Sie nahmen sich zusammen mit Pa stets den Großteil des Essens, wodurch herzlich wenig für die jüngeren Kinder verblieb.
Liza wusste, dass es fortan wieder darben hieß, und in ihr regte sich verbitterte Verärgerung über die gierige, rücksichtslose Art ihrer Brüder. Die jüngeren Mitglieder der Familie Docherty verhungerten zwar nicht, bekamen aber auch nicht genug zu essen. Mehr als einmal lieferte sie sich scharfe Wortgefechte mit Niall. Er war von jeher weitaus garstiger als Dermott gewesen. Als er sie eines Tages schlug, zückte sie die Bratpfanne und drohte ihm Vergeltung an, wenn er sie je wieder anfasste.
Zum Glück lachte Dermott an der Stelle.
»Was ist so komisch?«, fragte Niall mit knurrendem Unterton.
»Die Größe – damit droht sie dir?« Und mit der Wortmeldung zog sich Dermott aus dem Geschehen zurück.
Niall setzte ein Grinsen auf. »Unsere Liza will mich also verprügeln? Mit welcher Armee?« Er hob sie von den Beinen und warf sie mehrmals lachend hoch, während sie panisch kreischte.
Die beiden jungen Männer schmunzelten, als sie gingen.
Liza schaute ihnen nach, die Hände in die Hüften gestemmt. Tja, sie hatte die Worte durchaus ernst gemeint. Diese grobe Behandlung würde sie sich nicht länger gefallen lassen.
Als Andrew Pringle von einem seiner ausgedehnten Streifzüge durch das Land heimkehrte, begrüßte Dorothy ihn mit den Worten: »Lizas Vater hat sie mitgenommen, damit sie zu Hause aushilft. Anscheinend ist ihre Mutter krank. Ich muss mich nach einem Ersatz umsehen. Und dabei hatte ich das Mädchen gerade so gut angelernt.«
Er schürzte die Lippen und bedachte sie mit einem Seitenblick.
Da wusste sie, dass er etwas im Schilde führte. Vor angespannter Erwartung setzte ihr Herz einen Schlag aus. Diese Miene verhieß nie etwas Gutes.
»Spar dir die Mühe der Suche nach einem anderen Dienstmädchen, meine Liebe. Wir hätten Liza ohnehin bald kündigen müssen.«
»Sie kündigen ... aber warum?« Hatte er etwa noch mehr von ihrem Geld durch einen seiner dummen Pläne verloren? Doch hoffentlich nicht, oder? Nein, denn er strahlte sie an wie ein Dorftrottel, mied nicht ihren Blick und murmelte kein Verlustgeständnis wie schon so oft.
Er legte ihr einen Arm um die Schultern. »Ich habe gute Neuigkeiten für dich, Liebste.«
Mit bangem Herzen begleitete sie ihn in den kleinen Salon. Vor lauter Anspannung fragte sie, noch bevor sie Platz genommen hatten: »Worum geht es?«. Seine und ihre Vorstellungen von guten Neuigkeiten unterschieden sich oft erheblich voneinander.
»Ich habe entschieden, dass es uns hier in Pendleworth nie wirklich gut gehen wird. Ein Industriebezirk bietet für einen Mann wie mich schlichtweg nicht genug Möglichkeiten.«
Dorothy spürte, wie sich ihre Beklommenheit steigerte und wie ein Bleigewicht in ihrem Magen einnistete. »Sag es einfach rundheraus, Andrew«, bat sie.
Nach einem weiteren seiner abwägenden Blicke holte er tief Luft und sagte schnell: »Nun – ich habe beschlossen, nach Australien auszuwandern.«
Einen Moment lang dachte sie, sich verhört zu haben. Sie konnte ihn nur blinzelnd anstarren, während sie die Worte verarbeitete. Doch wie sie es auch versuchte, sie ergaben immer dieselbe Bedeutung. »Nach Australien auswandern!«, sagte sie matt. »Aber ... aber warum willst du dorthin?«
Nun mied er ihren Blick doch. »Wir gehen alle, Dorothy. Tatsächlich ... tatsächlich habe ich unsere Überfahrt bereits gebucht.«
»Was?« Einige Augenblicke lang drehte sich alles um sie herum. Am liebsten hätte sie ihn angebrüllt. Aber hatte es schon je etwas gebracht, wütend zu werden? Auf seine eigene ruhige Weise war er so unverrückbar wie die Pennine Hills. »Das verstehe ich nicht. Warum sollten wir nach Australien wollen? Das ist ein Ort für Sträflinge, nicht für anständige Leute.« Und anständige Leute waren sie, so verarmt sie auch sein mochten. An dem Gedanken richtete sie sich immer auf.
»Du denkst an Sydney. In Westaustralien gibt es weitaus weniger Sträflinge, und selbst die nur, weil man dort danach verlangt hat. Überwiegend reisen die Menschen als freie Siedler hin.«
»Tja, ich will das trotzdem nicht.«
»Das Urteil darüber musst du schon mir überlassen, meine Liebe. Immerhin bin ich das Familienoberhaupt, und ich bin aufrichtig davon überzeugt, dass wir uns auf der anderen Seite der Welt ein besseres Leben erschaffen können. In England verschlimmert sich die Lage nur zusehends. Und man hat mir gesagt, dass die Kolonien großartige Möglichkeiten bieten, wenn man bereit ist, hart zu arbeiten – was ich hoffentlich bin.«
Andrew schenkte ihr ein strahlendes Lächeln. Wie ein kleiner Junge, der ihr ein Geschenk überreicht hatte. Ihre Stimmung sank weiter, denn diesen Ausdruck hatte er nur in den Augen, wenn er tief in einen seiner Pläne eingetaucht war. Durch seine gute Laune zuletzt hätte sie ahnen müssen, dass er etwas im Schilde führte. Allerdings erfreute es sein Gemüt immer, wenn der Frühling nahte und er mehr Zeit draußen in seinem geliebten Garten verbringen konnte. Deshalb hatte sie sich nichts dabei gedacht. »Du kannst ja einfach alleine hinreisen. Finde heraus, wie es dort ist. Und wenn es vielversprechend aussieht, folgen Kitty und ich dir später.«
»Ich fürchte, das geht nicht. Ihr hättet nämlich keine Unterkunft, wenn ihr bleibt. Abgesehen davon ist der Platz einer Frau an der Seite ihres Ehemanns. Und eine Tochter sollte bei ihren Eltern leben, bis sie heiratet. Vor allem ein Einzelkind wie unsere liebe Kitty.«
Einen Moment lang konnte Dorothy kaum atmen. Dann drangen die Worte doppelt so laut wie üblich aus ihr. »Was soll das heißen, wir hätten keinen Platz zum Wohnen? Wir haben doch dieses Haus.«
»Nicht mehr. Ich habe es an Mr Ludlam verkauft. Weißt du, wir werden das Geld brauchen, um ein Stück Land in Australien zu kaufen. Ein Gehöft. Meine Vorfahren waren Bauern, und jetzt werde ich auch einer. Deshalb ist es bisher nicht so gut für mich gelaufen. Ich habe gegen meine Natur gehandelt.«
Dorothy hatte Mühe, die Worte richtig zusammenzusetzen. Sie platzten in kurzen, zornigen Schüben aus ihr hervor. »Aber ... aber was, wenn alles ... was, wenn es schiefgeht?« Die meisten seiner Pläne scheiterten, doch bisher hatten sie dann immer das Haus gehabt – und ihre kleine Rente. Diesmal würden ihnen nur noch die fünfzig Pfund bleiben, die sie jedes Jahr erhielt, das Vermächtnis einer alten Tante, eigentlich als Taschengeld gedacht, nicht für Haushaltsausgaben. Er nahm es ihr ohnehin immer sofort ab.
Andrew wischte ihre Einwände weg. »Ich lasse nicht zu, dass es schiefgeht. Jetzt muss ich dringend anfangen, meinen Schuppen zu räumen. Und du musst im Haus beginnen, wir stechen nämlich nächsten Monat in See. Mitnehmen können wir nur das Nötigste – und keine Möbel. Tatsächlich kommt es uns gelegen, dass Liza gegangen ist. Aber Maggie begleitet uns natürlich. Immerhin ist sie seit fünfzehn Jahren bei uns. Ich bin sicher, sie lässt uns nicht im Stich. Deshalb habe ich auch für sie eine Überfahrt gebucht.«
Nachdem er gegangen war, saß Dorothy eine lange Weile steif, regungslos und entsetzt da. Das war schlimmer als alles, was er bisher getan hatte. Viel schlimmer. Sie beschloss, Kitty vorerst nichts zu sagen, weil ihr vor der Reaktion ihrer Tochter graute. Aber sie vertraute sich Maggie an, die sie fassungslos anstarrte, bevor sie in Tränen ausbrach.
»Mrs P., hat er das wirklich getan?«
Dorothy konnte nur unglücklich nicken. »Du kommst doch mit uns, Maggie, oder?«
»Wie könnte ich denn? Ich muss an Mama denken – und an meine Schwestern. Wie könnte ich denn?«
Nachdem ihre Tochter an jenem Abend zu Bett gegangen war, unternahm Dorothy einen neuen Versuch. »Andrew, ich habe nachgedacht. Es wäre so viel sinnvoller, dass du zuerst nach Australien reist und die Lage dort begutachtest. Kitty und ich können einstweilen bei meiner Schwester bleiben. Du weißt ja, wie vernarrt Nora in das Mädchen ist. Sie nimmt uns bestimmt auf.« Und sie würde sie dafür mit kleinen Diensten und regelmäßig zum Ausdruck gebrachter Dankbarkeit bezahlen lassen. Aber das wäre es wert.
Er bedachte sie mit einem finsteren Blick. »Kommt nicht infrage! Du bist meine Ehefrau und kommst mit. Dasselbe gilt für unsere Tochter. Hast du ihr schon davon erzählt?«
»N-Nein.«
»Dann mache ich es morgen früh selbst.«
Die Neuigkeit stürzte Kitty zunächst in einen Koller. Danach weinte sie in regelmäßigen Abständen immer wieder, bis ihre Augen verquollen und ihre Nase gerötet waren. Dorothy argumentierte, schimpfte und bettelte. Sie versuchte alles, was ihr einfiel, um ihren Mann zur Vernunft zu bringen, umso mehr, da Maggie sie eindeutig nicht begleiten würde. Aber nichts, was Kitty oder sie taten oder sagten, konnte ihn von seiner Entscheidung abbringen.
Es kam nicht oft vor, dass sie weinte, doch diesmal tat sie es genauso bitterlich wie die fünfzehnjährige Kitty.
Ihre Tränen vertrieben Andrew zwar aus dem Haus in den von ihm so geliebten Garten, den er selbst pflegte. Aber seine Meinung änderten sie nicht.
Als es Lizas Mutter gut genug ging, um auf dem Schaukelstuhl in der Küche zu sitzen, besserten sich die Umstände in der Underby Street ein wenig. Mary Docherty war so sanftmütig und zurückhaltend wie eh und je, aber Con ließ seine Frau von niemandem herumkommandieren. Das Recht behielt er sich ausschließlich selbst vor. Deshalb konnte sie die jüngeren Kinder etwas vor den beiden ältesten Söhnen schützen und auch das Essen gerechter aufteilen.
Eines Abends ein paar Tage später kam Pa mit strahlender Miene ins Hinterzimmer und gab Liza ein Zeichen. »Komm kurz in den Laden, Mädchen, ja? Ich habe gute Neuigkeiten für dich.«
Ihr Gesichtsausdruck hellte sich auf, als sie ihm in der Hoffnung folgte, er würde sie zu ihrer früheren Stelle zurückkehren lassen. Die von ihr versteckte Kleidung hatte er nicht gefunden, und bestimmt hätte Mrs P. Verständnis dafür, wenn sie nicht mehr alle ihre alten Sachen hätte.
»Komm hier rüber ins Licht.« Er packte sie und fuhr mit der Hand auf eine Weise über ihren Körper, die ihr einen protestierenden Laut entlockte. Sie versuchte, zurückzuweichen. »Jetzt steh gefälligst still!«, herrschte er sie an, bevor er leidenschaftslos die Erhebungen ihrer Brüste betastete, die Haut ihrer Oberarme kniff und sie erst in die eine, dann in die andere Richtung drehte. Nach dem anfänglichen Schrecken traute sie sich nicht mehr, zu protestieren, denn Con Docherty war voll und ganz der Herr in seinem Haus. Selbst Niall und Dermott wagten es nicht, ihm zu trotzen.
Schließlich schob er sie weg, schürzte die Lippen, legte den Kopf schief und fragte: »Wie alt bist du jetzt?«
»Achtzehn.«
Er nickte. »Dachte ich mir. Du bist eine erwachsene Frau, so viel steht fest.«
Was war an diesem Abend nur in ihn gefahren? Wann hatte er sich schon je für sie interessiert? Für ihn zählten seine Söhne, nicht die Töchter.
»Teddy Marshalls Frau ist inzwischen seit zwei Monaten tot. Ist schwer für einen Mann, auf sich allein gestellt zu sein. Er braucht eine Frau, die sich um ihn kümmert.« Mit einem wissenden Lächeln fügte er hinzu: »Und ihm natürlich das Bett wärmt.«
Liza starrte ihn entsetzt an. Sie ahnte, was als Nächstes folgen würde.
»Also hab ich ihm gesagt, dass er dich heiraten kann. Ich hab gesehen, dass du ihm gefallen hast, als er letzte Woche in den Laden gekommen ist. Das wird besser für dich, als für die hochnäsige Pringle zu arbeiten. Du wirst dein eigenes Haus haben, und Teddy wird anständig für dich sorgen. In ein paar Minuten kommt er vorbei, dich besuchen. Dann bringen wir gleich alles unter Dach und Fach.« Nachdem er sie erneut gemustert hatte, fügte er spontan hinzu: »Nur machst du besser was anderes mit deinem Haar, als es wie ein altes Weib zu einem Dutt zurückzuknoten. In der unteren Lade da sind Bänder. Benutz eins davon.« Sein Blick wurde sanfter. »Ist schön, dein Haar. Eine schwarzhaarige Irin, ganz wie die Familie deiner Mama. Sind gut aussehend, die Brennans.« Er ballte die Hand zur Faust und betrachtete sie bewundernd. »Dafür sind die Dochertys stärker gebaut.«
Einen Moment lang konnte sich Liza nicht rühren! Und als sie schließlich die Stimme wiederfand, drang sie schrill und fiepend aus ihr. »Aber Pa, Mr Marshall ist alt!«
Seine Miene verfinsterte sich. »Er ist höchstens fünfunddreißig. Jünger als ich. Mit fünfunddreißig ist ein Mann in der Blüte seiner Jahre, lass dir das gesagt sein, junge Dame. Nur die Frauen verwelken, wenn sie die dreißig hinter sich haben. Schau dir nur deine Mutter an. Früher hatte sie rosige Wangen und strahlende blaue Augen wie du.« Kurz wurde sein Blick abwesend, bevor er in sanfterem Ton ergänzte: »Und auch, wenn man's ihr nicht mehr ansieht, Mary war hübscher, als du es je sein wirst – deine Züge sind zu scharf geschnitten.«
Verzweifelt zermarterte sich Liza das Hirn nach einer Möglichkeit, ihn umzustimmen. »Aber Pa, ich will noch nicht heiraten. Niemanden.« Schon gar nicht Mr Marshall. Ähnlich wie ihr Vater war er ein großer, plumper Mann, nur hässlicher. Mrs Marshall war unlängst zusammen mit dem jüngsten Baby im Kinderbett gestorben, aber er hatte noch drei Söhne, und so jung sie auch sein mochten, sie entwickelten sich bereits zu Tyrannen. Lizas kleiner Bruder Kieran hatte eine Heidenangst vor ihnen. Sie schauderte bei der Erinnerung daran, wie Mr Marshall sie bei seinem letzten Besuch des Ladens in einem Winkel überrascht und sich an ihr gerieben hatte. Ihr war davon übel geworden, und sie hatte erwartet, dass ihr Vater dagegen protestieren würde. Aber das hatte er nicht. Nun wurde ihr klar, worum es ging. Es war der wahre Grund, warum sie von Mrs Pringle nach Hause geholt worden war. Zweifellos hatte Mr Marshall ihren Vater mit Geld dazu geködert, die Sache zu beschleunigen. Tja, sie würde dem nicht zustimmen. Auf keinen Fall!
Ihr Vater stupste sie an. »Das ist die beste Chance, die du je kriegen wirst. Du wirst dauerhaft gut versorgt sein. Junge Männer haben nicht so viel Geld wie ältere.«
»Das mache ich nicht.«
Finster starrte er sie an. »Sei nicht dumm, Mädchen! Zeig ausnahmsweise mal ein bisschen Vernunft!«
Auf der Straße draußen ertönte das Geräusch von Holzschuhen. Dann bimmelte die kleine Messingtürklingel an ihrer gekringelten Feder. Lächelnd drehte sich Con um. »Da bist du ja, Junge. Hab meinem Mädel hier gerade gesagt, dass du sie heiraten wirst.«
Teddy Marshall nickte. »Gut.« Seine Aufmerksamkeit galt allein Liza. Gemächlich wanderte sein Blick ihren Körper auf und ab.
Voller Grauen starrte sie zurück. Er hatte schütteres braunes Haar, eine klobige Nase und roch immer säuerlich, als wüsche er sich noch seltener als ihr Vater. Seine verstorbene Frau hatte er geschlagen, ihr so manchen Bluterguss beschert und ihr einmal gar den Arm gebrochen – das wusste jeder.
»Es tut mir leid, aber ich will nicht heiraten«, sagte sie mit möglichst fester Stimme. Innerlich schlotterte sie dabei vor Angst beim Gedanken, sich ihrem Vater zu widersetzen.
Beide Männer ignorierten sie.
»Dann rede ich gleich morgen früh mit dem Priester, ja?«, sagte Teddy über ihren Kopf hinweg.
»Aye. Je eher es erledigt ist, desto besser. Unsere Nancy ist zwölf. Sie kann mir stattdessen im Laden helfen, und meine Mary wird sich einfach zusammenreißen müssen.«
»Aber, Pa ...«
Con drehte sich seiner Tochter zu. »Von dir wollen wir keine Albernheiten mehr hören, Mädchen. Du wirst tun, was ich dir sage, oder bei Gott, du bekommst meinen Handrücken zu spüren.«
Sie schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, aber ich will niemanden heiraten.« Liza nickte dem anderen Mann zu und versuchte, ihre Weigerung zu mildern. »Trotzdem danke, Mr Marshall.«
Ihr Vater trat auf sie zu und versetzte ihr einen Schlag auf den Hinterkopf, ehe er sie zu seinem Freund stieß. »Bleib hier und rede mit Teddy. Er wird dich schnell umstimmen. Ich muss etwas mit deiner Mama besprechen.« Bevor Liza protestieren konnte, war er weg.
Mr Marshall näherte sich ihr rasch und packte sie. Liza kreischte und versuchte, sich zu befreien. Er achtete nicht darauf und begann, sie zu betatschen. Seine Finger kniffen ihre Nippel. Sie wand sich, sollte ihn treten, doch er war so viel größer und massiger, dass sie sich wie ein Spielzeug in den Händen eines ungeschickten Kinds vorkam.
»Ich mache es nicht!«, stieß sie hervor und schaute finster zu ihm hoch. »Niemand kann mich zwingen, in der Kirche Ja zu sagen. Lassen Sie mich los!«
»Du wirst es tun«, widersprach Marshall. »Und ob wir dich zwingen können.« Wieder kniffen sie seine Finger. Unwillkürlich schrie sie vor Schmerz auf.
Als er dazu ansetzte, ihren Rock hochzuschieben, ertönte hinter ihnen ein Hüsteln. Dann sagte ihr Vater: »Das reicht, Kamerad. Ein bisschen Anfassen ist eine Sache, aber mehr kriegst du vor der Hochzeit nicht. Meine Liza ist 'ne anständige junge Dame. Sie bleibt unberührt, bis Pater Michael euch vermählt hat.«
Teddy ließ Liza los, atmete tief durch und rückte seine Hose zurecht. »Tja, dann erledigen wir das besser schnell.«
»Gehen wir ins Pub und besprechen wir die Einzelheiten. Ein, zwei Bierchen werden dir die Wartezeit verkürzen.«
Lachend brachen die beiden Männer auf. An der Tür drehte sich Marshall noch einmal um und starrte das bleiche, zitternde Mädchen im Laden an. »Ich freu mich schon darauf, 'ne Frau aus dir zu machen, Liza Docherty.«
Sie schüttelte den Kopf und riss sich zusammen, bis die beiden verschwunden waren. Dann holte sie tief und schluchzend Luft. Mr Marshalls Holzschuhe klapperten laut über den Gehweg. Die Sohlen ihres Vaters klangen daneben wie ein schwaches Echo. Mr Marshall war generell ein lärmender Mensch. Und seine Söhne verbreiteten mit ihren Holzschuhen mit Eisenkappen unter anderen Kindern regelrecht Angst und Schrecken. Für eine junge Stiefmutter wären die drei die Hölle auf Erden.
Liza konnte sich erst wieder rühren, als die Schritte der Männer am Ende der Straße verklungen waren. An der Stelle kam ihre Mutter in den Laden zu ihr. »Er hat es dir gesagt, Liebes, nicht wahr?«
Liza wischte sich die Tränen ab. »Du hast gewusst, was er vorhat, Ma – du hast es gewusst!«
Die Stimme ihrer Mutter klang müde. »Er hat es mir erst heute Morgen gesagt.«
»Warum hast du mich nicht gewarnt?«
»Was hätte das gebracht?«
»Ich hätte vielleicht Zeit gehabt, mir etwas zu überlegen. Eins kann ich dir sagen, Ma. Ich werde Mr Marshall nicht heiraten.«
Mary sah ihre Tochter an. »Dein Vater wird dich dazu zwingen.« Ihre Stimme klang so tonlos, als wäre es ihr einerlei.
Liza starrte sie an. Mit Mr Marshall verheiratet, würde auch sie bald so aussehen. Wie ihre Mutter und seine vorherige Frau. Gebrochen. Deprimiert. In dem Moment entschied sie, dass sie alles tun würde, um einem solchen Los zu entrinnen. Wenn nötig, würde sie sogar von zu Hause ausreißen.
»Liza, Schatz ...«
»Ich werde ihn nicht heiraten«, wiederholte sie, bevor sie lauthals hinzufügte: »Das mache ich nicht!« Die Haufen alter Kleidung dämpften ihre Worte allerdings, und ihre Mutter war bereits zurück ins Hinterzimmer geschlurft. »Ich mache es sicher nicht«, flüsterte Liza und schniefte weitere drohende Tränen weg, bevor sie ihrer Mutter folgte.
KAPITEL 2
Josiah sah seinen Vater an. Bei dem Ausdruck völliger Abscheu in Saul Ludlams Gesicht zog sich alles in ihm zusammen. Jene volltönende Stimme hörte sich bei Predigten in der Kirche gut an, bestürmte die Ohren jedoch wie ein Hammer, wenn sie in einem Haus erhoben wurde.
»Wenn deine Mutter nicht wäre, würde ich dich auf der Stelle vor die Tür setzen!«
Josiah holte tief Luft. Die Erleichterung darüber, nicht verstoßen zu werden, vermengte sich mit der Wut, die sich in den vergangenen Jahren in ihm aufgestaut hatte. Verflucht sollte sein Vater sein! Für wen hielt er sich eigentlich, dass er seine Söhne zwang, von ihm für sie ausgewählte Frauen zu heiraten, ob sie ihnen gefielen oder nicht. Obendrein verlangte er von ihnen allen, zu Hause zu bleiben, wodurch sogar ein so riesiger Herrensitz wie Pendleworth Hall ständig vor übellaunigen Erwachsenen und ihrer Frustration überzuquellen schien.
Erschwerend kam hinzu, dass Saul Ludlam äußerst knausrig Geld an seine Angehörigen verteilte. Für jegliche größere Ausgaben musste man um zusätzliche Mittel betteln. Er behandelte seine drei erwachsenen Söhne – zwei davon mittlerweile selbst Väter – nach wie vor wie Schuljungen, ließ sie als Befehlsempfänger in den Familienbetrieben arbeiten und erwartete, dass sie jedem seiner Worte gehorchten. Matthew und Isaac schien das nicht zu stören. Josiah jedoch hasste sowohl das ihm aufgezwungene Leben als auch seinen Erzeuger – und sich selbst verachtete er, weil er nichts dagegen unternahm.
Dröhnend ertönte die Stimme seines Vaters erneut. Zur Betonung schlug der Mann auf den Schreibtisch. »Nun? Hast du nichts zu erwidern?«
»Ich bin dankbar für deine ... deine Nachsicht.« Als sich Josiah die Worte abrang, wurde ihm regelrecht übel von der Heuchelei seines Vaters, eines Schürzenjägers, der seine sanftmütige Ehefrau vielfach betrogen hatte, doch stets so tat, als führte er ein untadeliges Leben. Aber wenn ein wenig ums Maul geschmierter Honig den Zorn seines Vaters zu lindern vermochte, musste sich Josiah wohl oder übel auf die Zunge beißen, bis sie blutete. Denn ohne eigenes Geld war er hilflos.
»Spar dir die vermaledeite Dankbarkeit für deine Mutter auf. Sie hat mich auf Knien angefleht, dich nicht hinauszuwerfen.« Saul atmete tief durch. »Obwohl ich es immer noch möchte. Und vielleicht auch mache, wenn das jemand in der Kirche herausfindet ...«
Die Uhr tickte laut, während Josiah auf die Verkündung seine Strafe wartete. Es hagelte immer Vergeltung, wenn jemand seinen Vater erzürnte. Der Mann verstand sich meisterlich darauf, es einem auf verschiedenste Weise heimzuzahlen, wenn man ihn beleidigte.
»Hörst du mir eigentlich zu, Josiah?«
»Ja, Sir. Und ... und ich bin dankbar für die Chance, Wiedergutmachung zu leisten.«
Sauls Stimme wurde noch lauter. »Wiedergutmachung? Aus meiner Sicht gibt es keine Möglichkeit, wie du Wiedergutmachung leisten kannst. Der einzige Weg, diese Familie vor Schimpf und Schande zu bewahren, besteht darin, dich loszuwerden. Und das habe ich vor.«
»Sir?«
»Also schicke ich dich« – um die Folter zu verlängern, legte er eine gefühlt ewig währende Pause ein, bevor er mit sichtlichem Genuss fortfuhr – »nach Australien.« Er lächelte zufrieden über den entsetzten Ausdruck im Gesicht seines Sohns, ehe er hinzufügte: »Das ist der am weitesten entfernte Ort, den ich kenne. Anscheinend nimmt man dort so gut wie jeden als freien Siedler auf. Sogar dich.« Insgeheim war er Andrew Pringle dankbar, der ihn auf die Idee gebracht hatte.
In seiner Fassungslosigkeit vergaß Josiah, die Zunge zu hüten. »Australien! Was zum Teufel soll ich denn dort? Das mache ich nicht.«
»Es ist deine Entscheidung. Aber du willigst entweder ein, nach Australien zu reisen, oder du verschwindest noch heute aus meinem Haus.« Saul lehnte sich mit vor der Brust verschränkten Armen lächelnd in das weiche braune Leder seines Stuhls zurück.
Nach einer angespannten Stille zwischen ihnen platzte Josiah heraus: »Herrgott noch mal, du meinst das ernst, nicht wahr?«
»Missbrauche nicht den Namen des Herrn.« Saul Ludlam beugte sich vor und stützte die Hände auf den breiten Mahagonischreibtisch. Die Reaktion seines Sohns erfüllte ihn eindeutig mit Befriedigung. »Mir ist egal, was du dort machst. Aber ich kann dir versichern, Josiah, wenn du je wieder einen Fuß in dieses Land setzt, melde ich dich persönlich den Behörden – die dich mit Sicherheit hinter Schloss und Riegel stecken werden.«
Josiahs Kehle fühlte sich vor Frustration wie zugeschnürt an. Er hatte keine Möglichkeit, sich der Verbannung ins Exil zu widersetzen, denn sogar die großzügige Mitgift seiner Frau war von den Rawleys an seinen Vater bezahlt und von ihm in das Familienunternehmen »investiert« worden. Während er um Kontrolle über seine Wut kämpfte, konnte er einige Augenblicke lang weder sprechen noch klar denken.
Mit einem breiten Lächeln warf Saul ihm einen weiteren Brocken hin. »Ich habe für dich nächsten Monat eine Überfahrt auf der Louisa Jane gebucht und gebe dir genug Geld mit, um dort ein Stück Land zu kaufen. Du hast dich ja immer gern draußen aufgehalten. Landwirtschaft sollte zu dir passen.«
»Landwirtschaft?«
»Was denn sonst?«
»Aber davon verstehe ich nicht das Geringste.«
»Das ist mir durchaus bewusst. Deshalb habe ich vor, Benedict Caine mit dir nach Australien zu schicken, und sei es nur um Catherines willen. Es ist ihre Pflicht, ihren Ehemann zu begleiten, trotzdem möchte ich nicht, dass es ihr an etwas mangelt. Caine ist der geborene Unruhestifter, und ich werde froh sein, ihn aus dem Haus zu haben, aber er kennt sich mit Landwirtschaft aus und kann dir alles Nötige beibringen.«
»Es muss doch etwas anderes geben, was ich tun kann. Einen anderen Ort. Vielleicht Amerika? Dort bieten sich einem Mann wie mir viel mehr Möglichkeiten und ...«
»Australien oder gar nichts. Und Landwirtschaft habe ich gewählt, weil mir das eine solide Lebensweise zu sein scheint.« Saul setzte jenes Lächeln auf, mit dem er zeigte, dass er die Oberhand über jemanden hatte und es genoss. »Wohlgemerkt, du wirst hart arbeiten müssen, wenn du vernünftig essen willst, nachdem dein Startkapital aufgebraucht ist – und glaub bloß nicht, dass ich dich großzügig damit ausstatte. Du bekommst genug, um etwas zu beginnen, und nicht mehr.«
Josiah brauchte Abstand von dem Hass, der aus den Augen seines Vaters sprach, deshalb entfernte er sich zum Fenster. Er bemühte sich, seiner Stimme einen ruhigen Klang zu verleihen. »Ist dir dabei auch in den Sinn gekommen, dass ich Pendleworth vermissen könnte?« Er schaute hinaus auf die Landschaft, die er aufrichtig liebte, und verfluchte zum wiederholten Mal das Schicksal, das ihn nur zum dritten Sohn erkoren hatte. Dem, der keine Chance darauf hatte, das Anwesen je zu erben, umso weniger, da seine beiden Brüder bereits eigene Söhne gezeugt hatten.
Von hinten prasselten weitere Worte auf ihn ein. »Mich kümmert nicht, was du vermissen magst und was nicht.«
Josiah schloss die Augen und fürchtete, er könnte zu weinen beginnen. Wie üblich ließ einem sein Vater keine andere Wahl, als sich seinen Wünschen zu beugen. Nur waren sie diesmal regelrecht furchterregend.
»Ich tue das auch für Catherine, die einen Ehemann wie dich nicht verdient. Vielleicht versuchst du ja in den Kolonien einen Neubeginn und baust dir ein anständiges Leben auf. Bekommst Kinder.«
Darauf fiel Josiah keine Erwiderung ein. Sein Vater hatte sein Eheweib für ihn ausgesucht und prompt das von ihr mitgebrachte Geld beschlagnahmt. Dabei hatten sie beide nichts mitzureden gehabt, obwohl er später herausgefunden hatte, dass Catherine durchaus bereitwillig gewesen war. Er hingegen nicht, wie er in ihrer Hochzeitsnacht verdeutlicht hatte. Das hatte sie damals aufgebracht und kränkte sie nach wie vor, wie er wusste und bedauerte. Aber obwohl er immer noch in einem Ausziehbett in ihrem Ankleidezimmer schlief, hatten sie sich mittlerweile gut angefreundet. Immerhin kannten sie sich schon seit der Kindheit. Für ihn war sie mehr wie eine Schwester. Manchmal, wenn sein Mut sank und die Welt allein von Elend erfüllt zu sein schien, hielt nur sie ihn davon ab, seinem Leben ein Ende zu setzen.
»Hör gefälligst zu, wenn ich mit dir rede, Josiah!«
Er nickte, während er verzweifelt überlegte, wie er diesem Los entrinnen könnte. Es musste einen Weg geben. Vielleicht durch seine Mutter. Oder Catherines Vater. Falls es eine Möglichkeit gab, würde er sie finden.
»Ich stelle dir Saatgut und Werkzeug zur Verfügung. Alles, was ein Bauer braucht, um Land zu bewirtschaften. Danach liegt es an dir, ob du überlebst oder nicht.«
»Vater, bitte ...« Mit brüchiger Stimme beendete Josiah sein Flehen abrupt, als er den entschlossenen Ausdruck im Gesicht seines Vaters sah.
»Wenn du knapp bei Kasse bist, gäbe es natürlich eine Möglichkeit, dir mehr von mir zu verdienen ...« Saul verstummte und wartete.
Schließlich fragte Josiah: »Wie?« Dabei wappnete er sich innerlich für das Schlimmste.
»Am Tag der Geburt deines ersten Kinds schicke ich dir fünfhundert Pfund. Für jedes Weitere danach bekommst du zweihundert.« Saul schmunzelte humorlos. Seine Miene vermittelte deutlich, dass er nicht wirklich damit rechnete. Schließlich zog er seine große goldene Taschenuhr hervor und warf einen Blick darauf. »Du solltest besser los und Catherine mitteilen, was beschlossen worden ist. Deine Mutter unterrichte ich selbst davon. Bestimmt wird sie den Rest des Tags weinen.«
»Und Benedict Caine? Weiß er schon, was du für ihn geplant hast?« Verbarg sich vielleicht darin eine Möglichkeit, noch etwas zu ändern?
Aber nein, auch Benedict war ein drittgeborener Sohn. Sein Vater hatte die Northbrook Farm gepachtet, das größte Grundstück auf dem Pendleworth-Besitz. Zweifellos würde Martin Caine den Hof übernehmen, sobald sein Vater zu alt für die Bewirtschaftung wäre. Der mittlere Bruder Paul war nach Lancaster gezogen und arbeitete wie sein Großvater mütterlicherseits als Möbelschreiner. Auch Benedict besaß ein Händchen für Holzarbeiten. Als Junge hatte er erstaunliche Schnitzereien hervorgebracht. Aber da er wie sein Vater das Land liebte, war er in Northbrook geblieben. Er war ein gut aussehender Bursche und bei den jungen Frauen in der Gegend überaus begehrt, doch er hatte bislang nicht geheiratet. Klug von ihm. Weiber verursachten mehr Ärger, als sie wert waren.
Saul Ludlam hantierte bereits mit irgendwelchen Unterlagen. »Caine ist noch nicht über meine Pläne informiert.«
»Was, wenn er nicht mit mir nach Australien will?«
»Oh, er wird dich begleiten. Ich werde es ihm unmöglich machen, sich zu weigern – obwohl es mir nichts ausmacht, ihm die bittere Pille ein wenig zu versüßen, wenn er meinen Wünschen nachkommt.« Saul stand auf.
Damit war die Unterhaltung eindeutig zu Ende. Josiah wusste, dass er die Lage nur verschlimmern würde, wenn er bliebe und weiter diskutierte. Also ging er und trat den Weg zum Rosengarten an, um nachzudenken, bevor er mit Catherine darüber reden würde. Es musste einen Ausweg geben. Irgendeinen!
Beim Essen an jenem Abend blickte Jack Caine den Tisch entlang zu seinem jüngsten Sohn. »Mr Ludlam möchte dich morgen früh sehen, Benedict. Pünktlich um neun Uhr in seinem Haus.«
»Mich?«
»Aye. Hat heute eigens die Kutsche angehalten, um es mir zu sagen.«
Benedict runzelte die Stirn. »Was um alles in der Welt will der alte Teufel?«
Jack zuckte mit den Schultern.
»Ach, Junge, was hast du bloß angestellt?«, fragte seine Mutter. »Du weißt doch, wie wütend Mr Ludlam war, als du mit seinen Arbeitern geredet und zu ihnen gemeint hast, sie sollten besser bezahlt werden. Das hast du nicht etwa schon wieder gemacht, oder?«
»Ich hab gar nichts gemacht. Aber er sollte ihnen wirklich mehr zahlen. Alle anderen Arbeitgeber in der Gegend tun es. Sogar der alte Rawley.«
»Mr Ludlam lässt seine Arbeiter nicht darben. In harten Zeiten stellt er ihnen Lebensmittel und dergleichen zur Verfügung.«
»Die Leute könnten sich selbst kaufen, was sie brauchen, wenn sie einen gerechten Lohn bekämen. Das würde nicht mal seine Kosten erhöhen. So macht er es nur, weil er gern mehr Kontrolle über die Leute auf seinem Besitz hat.«
»Sohn, sprich morgen bloß nicht vorlaut mit ihm!«, sagte Jack Caine eindringlich. »Immerhin ist er unser Grundherr – und der Pachtvertrag für den Hof steht nächstes Jahr zur Verlängerung an.«
Benedict atmete tief durch. »Er muss doch irgendetwas darüber gesagt haben, was er will. Hast du denn gar keine Ahnung?«
Jack schüttelte zwar den Kopf, allerdings fiel Benedict auf, dass sein Vater seinen Blick mied. »Sag mir doch einfach, was du weißt.«
Aber er rückte mit nichts heraus. Am meisten auf der Welt fürchtete Jack Caine den Verlust seiner Farm, deshalb achtete er penibel darauf, Saul Ludlam nicht zu verärgern. Hätte sein Verpächter ihn aufgefordert, nackt durch den Ort zu laufen, er hätte auch das gemacht, um das Gehöft zu behalten. Die Caines lebten dort bereits seit weit über hundert Jahren, die Ludlams hingegen erst seit etwa fünfzig Jahren in dem großen Haus. Benedict wusste, dass es seinen Vater umbringen würde, wenn er woanders hinziehen müsste.
Er seufzte. »Na schön. Ich gehe morgen zu ihm.«
»Sieh zu, dass du dich davor ein bisschen herausputzt«, sagte seine Mutter eindringlich. »Zeig Respekt.«
Liza sah das Plakat beim Einkaufen für ihre Mutter. Es hing im Schaufenster von Mrs Baxters Stoffladen in der Nähe des Markts und war ein wenig verrutscht. Liza blieb stehen, um es zu lesen, musste jedoch bei den längeren Wörtern einen Passanten um Hilfe bitten. Der freundliche ältere Herr ging danach weiter, sie hingegen verharrte, betrachtete die großen schwarzen Buchstaben und murmelte bei sich, was sie besagten.
EMIGRANTIN NACH AUSTRALIEN
BEDIENSTETE MIT UNTADELIGEM
CHARAKTER GESUCHT
ÜBERFAHRT WIRD FÜR GEEIGNETE JUNGE DAMEN BEZAHLT
REFERENZEN UNERLÄSSLICH
Liza wünschte, sie könnte besser lesen. Aber sie hatte gerade lang genug zur Schule gedurft, um das Alphabet zu lernen und sich durch einfache Lesebücher zu mühen. Danach hatte sie zu Hause mithelfen müssen.
Als ein junger Mann anhielt und das Plakat betrachtete, nahm sie allen Mut zusammen und fragte ihn, wo Australien lag.
»Auf der anderen Seite der Welt, meine Liebe. Viel weiter weg von England geht es kaum.« Noch etwa eine Minute lang ließ sie den Blick sehnsüchtig auf das Plakat gerichtet, bevor sie weiterging.
»Dort könnte er mich nie und nimmer finden.« Kurz gestattete sich Liza den Traum, eine Stelle als Dienstmädchen für eine nette Familie zu bekommen, über das Meer zu segeln und ihren Vater oder Mr Marshall nie wiederzusehen – dann holte sie wie immer die Wirklichkeit ein. Für Töchter von Con Docherty hielten Träume nie lang dem unbarmherzigen Tageslicht stand.
»Aber wenn ich könnte, würde ich gehen!«, beteuerte sie in die Richtung des Plakats und blieb wieder stehen. Sie balancierte den schweren Einkaufskorb auf der Hüfte, während sie ein drittes Mal die Einzelheiten über das Schiff und die Kosten für Migranten durchging. Ihr war alles recht, um die Rückkehr nach Hause hinauszuzögern. Die für ihre Mutter übernommenen Besorgungen verschafften ihr die einzige kleine Freiheit, die sie hatte.
Sie seufzte. Ungeachtet ihrer Haltung hatten ihr Vater und Mr Marshall bereits mit Pater Michael die Vermählung vereinbart. Für Liza hatte es mehrmals heiße Ohren gesetzt, als sie sich weiterhin geweigert hatte, den Freund ihres Vaters zu heiraten, dennoch ließ sie sich nicht von ihrer Meinung abbringen. Der Priester war zu ihnen nach Hause gekommen, um Liza zu besuchen. Allerdings war ihr Vater dabei anwesend, weshalb sie nicht offen sprechen konnte. Und der Geistliche hatte gemeint, Kinder sollten ihren Eltern gehorchen. Nur war Liza kein Kind mehr, und sie würde sich von Pa nicht das gesamte Leben ruinieren lassen.
Die Worte auf dem Plakat verschwammen, als ihr Tränen in die Augen traten. Mürrisch senkte sie den Blick auf den neuen braunen Rock und das blaue, in keiner Weise dazu passende Oberteil. Beides hatte muffig nach Schweiß gerochen, als ihr Vater ihr die Sachen zugeworfen hatte, doch Liza hatte sie seither gewaschen. Was sollte sie nur tun? Ihre Mutter erwies sich als keine Hilfe – sie flehte Liza nur unablässig an, den Wünschen ihres Vaters zu gehorchen, weil er es am besten wüsste. Und sie betonte immer wieder, Mr Marshall würde anständig verdienen, was für eine Frau das Wichtigste wäre.
Liza sah keinen anderen Ausweg, als von zu Hause auszureißen – nur wie bewerkstelligte man das ohne Geld?
Sie warf einen Blick zur Uhr der Bank ein Stück die Straße hinunter. Noch fünf Minuten, nahm sie sich vor. Dann gehe ich zurück.
»Be-dien-stete mit un-un...«, las sie erneut.
»Untadeligem Charakter«, half ihr eine Stimme neben ihr.
Liza drehte den Kopf und erblickte Mrs P.
»Wie geht es dir, Liebes? Und was ist mit deiner Mutter? Ist sie auf dem Weg der Besserung?«
»Danke, Mrs P., mir geht's gut, und meiner Mama auch schon viel besser.«