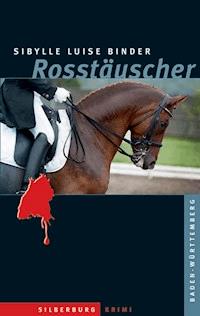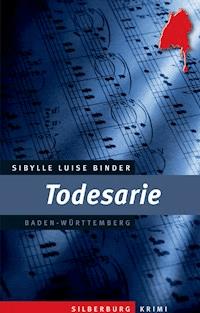
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Musikjournalistin Juliane ist natürlich darauf gefasst, dass die Sopranistin bei der "Rigoletto"-Premiere an der Stuttgarter Oper erwürgt wird und im Sack landet. Blöd ist nur, wenn das zu früh passiert und die Sängerin dann tatsächlich tot ist. Und noch blöder ist es, wenn diese Sängerin eine Freundin von ihr war und obendrauf der Regisseur der Oper verdächtigt und verhaftet wird. Der wiederum ist Julianes ehemalige, aber unvergessene und sehr große Liebe. Juliane beginnt nachzuforschen und stellt dabei fest, dass das Leben ihrer Freundin mindestens so kompliziert war wie ihr Tod. Da ist der Gesangslehrer, der eine berechtigte Abneigung gegen seine Schülerin hatte; da ist der trauernde Witwer, den die Verstorbene nach allen Regeln der Kunst betrogen hat; da ist der Assistent des Witwers, der eigene Interessen pflegt; da ist der jugendliche Liebhaber, der auch einiges zu verbergen hat, und schließlich ist einer davon hinter Juliane her …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sibylle Luise Binder Todesarie
Sibylle Luise Binder
Todesarie
Ein Baden-Württemberg-Krimi
Sibylle Luise Binder, Mitte fünfzig und in Stuttgart zuhause, ist seit einem Vierteljahrhundert als Journalistin und Autorin tätig. Neben einer ganzen Reihe von Sachbüchern über Pferde und Reiten hat sie Mädchenbücher und Krimis geschrieben. Wenn sie nicht mit Tieren befasst ist, beschäftigt sie sich gerne und ausführlich mit Oper und Geschichte.
Nach »Tierisch giftig« und »Rosstäuscher« ist »Todesarie« ihr dritter Krimi im Silberburg-Verlag.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1. Auflage 2016
© 2016 by Silberburg-Verlag GmbH, Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen. Alle Rechte vorbehalten. Umschlaggestaltung: Christoph Wöhler, Tübingen. Coverfoto: © caracterdesign – iStockphoto.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1750-9 E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1751-6 Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1484-3
Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:www.silberburg.de
INHALT
1. Der Auftrag
2. Ganz grosse Oper
3. Intermezzi
4. Eine Beerdigung und drei Fotos
5. Alles Clärchen?
6. Singe, wem Gesang gegeben
7. It’s a men’s world
8. Herrenbesuch
9. Wer anderen eine Grube gräbt
10. Alles für die Katz
11. Mit Pauken und Trompeten
12. Wer einmal lügt …
13. Jauchzet, frohlocket
14. Mit bitterem Nachgeschmack
15. Cherchez la femme
16. Das blaue Cembalo
17. Der letzte Vorhang
Weitere Bücher und E-books aus dem Silberburg-Verlag
1. DER AUFTRAG
»Oh nein, Gerry, das ist nicht dein Ernst!« Ich zappelte auf dem unbequemen Stuhl im Büro meines Ressortleiters hin und her. »Kannst du nicht gehen?«
»Ich?« Gerhard Forster schaute mich an, als ob ich ihm etwas Unanständiges vorgeschlagen hätte. »Du weißt, dass ich mit dem Gejaule in der Oper nichts am Hut habe! Das ist dein Ressort, Juliane, und ich verstehe überhaupt nicht, warum du dich so anstellst. Was ist denn dein Problem?«
Ich seufzte. Da hatte ich schon vor zwei Wochen einen unserer freien Mitarbeiter auf die Premiere angesetzt und der war mehr als glücklich darüber, einen so schönen, wichtigen Job übernehmen zu dürfen. Doch eben hatte mich mein Boss mit der nicht so frohen Mitteilung überrascht, dass der Freie mit einem frisch operierten Blinddarm im Marienhospital lag, woraus sich logisch ergab, dass ich zur Premiere zu gehen hatte. Schließlich konnte die Stuttgarter Allgemeine ein solches Großereignis wie eine neue Produktion des »Rigoletto« zur Eröffnung der Wintersaison im Großen Haus der Stuttgarter Staatstheater nicht ignorieren, auch wenn die zuständige Musikredakteurin lieber überall statt dort hingegangen wäre.
»Ach, Gerry!« Ich hoffte immer noch, meinen Vorgesetzten überreden zu können, für mich zu übernehmen. »Ich habe da wirklich ein Problem. Die Hauptdarstellerin ist eine Freundin von mir. Wir kennen uns seit anno juck und wir haben sogar mal in einer WG zusammengelebt.«
Gerhard Forster lehnte sich zurück und faltete die Hände über dem Bauch. »Schatzi, wenn man das zum Kriterium machen würde, könnten wir ja nichts in der Region rezensieren! Ich kenne meine Jazz-Vögelchen und Literaten und bin mit vielen von denen seit Jahren befreundet. Das gehört doch zum Job! Woher würden wir Infos kriegen, wenn wir nicht so und so viele Freunde und Bekannte in dem Bereich hätten, in dem wir tätig sind?« Ich wollte etwas einwerfen, doch Gerhard hob die Hand und bremste mich. »Mädel, nu sträub doch nicht gleich wieder das Gefieder! Du hast doch deinen Leuten in den fünfzehn Jahren, die du jetzt diesen Job machst, auch schon beigebracht, dass sie mit Kritik leben müssen.«
»Ja, schon …«
Es half wohl nichts: Ich musste meinem Chef die Wahrheit sagen.
»Gerry, mein Hauptproblem ist in diesem Fall der Regisseur.« Noch einmal tief Luft holen. »Philipp Boch und ich – wir haben uns mal sehr gut gekannt, bevor er seine jetzige Frau geheiratet hat. Und unsere Beziehung ist damals mit einem ziemlichen Knall auseinandergegangen und …« Ich zögerte und setzte neu an. »Schau, wenn ich ihn verreiße, wird er denken, dass ich immer noch sauer wegen damals bin. Und wenn ich ihn lobe …«
»… glaubt er, du bist immer noch von ihm beeindruckt?« Gerhard grinste. »Verrat mir eines, Mäuschen: Wie bist du die letzten Jahre drum herumgekommen, deinen Ex zu rezensieren? Ich habe ja von Klassik nicht viel Ahnung, aber der Mann ist eine Institution in Stuttgart – den kenne selbst ich. Du erzählst mir jetzt hoffentlich nicht, dass der nur in unserer Klatsch- und Tratsch-Spalte, aber nicht im Feuilleton stattfindet?«
»Nein, natürlich nicht«, beruhigte ich meinen Ressortleiter. »Wir haben – ich zitiere aus unserem Blatt – ›Deutschlands besten Bariton seit Dietrich Fischer-Dieskau‹ des Öfteren abgefeiert. Und das Porträt von ihm, das wir vor vier Jahren zu seinem Fünfzigsten gedruckt haben, kam von Herrn Spatz, meinem geschätzten Vorgänger, der sehr beglückt darüber war, wieder einmal seinen Lieblingssänger interviewen zu dürfen.«
»Tja – aber den Spatz kannst du nicht zu dieser Premiere schicken. Der ist inzwischen so taub, dass er Wagner und Mozart nicht mehr unterscheiden kann!«
Ich seufzte und schaute Gerhard Forster so schmelzend wie möglich an. »Kannst du wirklich nicht?«
»Goldstück, deine Gewissensnot rührt sogar mein verhärtetes Herz. Aber ich habe heute Abend eine Verabredung.« Er federte mit einer Geschicklichkeit, die für einen so rundlichen Mann erstaunlich war, aus seinem Sessel hoch und kam um den Schreibtisch herum. Mit der Hand auf meiner Schulter sagte er: »Du wirst eine brillante und faire Rezension schreiben. Sollte es dabei nötig sein, dem Herrn Boch eine vor das sicherlich hochsensible Schienbein zu ballern, darf er sich bei mir beschweren, okay? Wenn du magst, erzähle ich ihm dann, dass du mindestens drei Liebhaber hast, die allmorgendlich den Boden küssen, auf dem du wandelst, und dass du es daher überhaupt nicht nötig hast, irgendeinem Sängerknaben – möge er auch noch so gut knödeln – hinterherzutrauern.«
* * *
Auch wenn die Parkplatzsuche in Stuttgarts Osten eine Pest ist, wusste ich, warum ich mir eine Wohnung im Dunstkreis der Musikhochschule gesucht hatte. Von der Kernerstraße aus waren es nämlich nur ein paar Schritte zum Eugensplatz, dann konnte ich am Galateabrunnen vorbei die Treppe – echte Stuttgarter »Stäffele« – zum Urbansplatz hinunterwetzen. Das tat ich zweimal in der Woche – immer am Montagund Donnerstagnachmittag. Ich hatte nämlich meinen Job bei der Zeitung vor sechs Jahren auf fünfundzwanzig Stunden reduziert. Die restliche Zeit – eben Montag- und Donnerstagnachmittag – verbrachte ich an der Musikhochschule, wo ich mich bemühte, mehr oder minder gelangweilten Studenten etwas über Musikgeschichte (Montag) und Musikrezension (Donnerstag) beizubiegen. Und die Oper lag quasi gleich gegenüber.
Schließlich und endlich hat die Ecke, in der ich wohnte, noch den Vorteil, ausgesprochen »lärmtolerant« zu sein. Zum einen mussten hier alle damit leben, dass die Stadtbahn alle zwanzigMinutenquietschenddieKurvevomEugensplatzzur Heidehofstraße hinauf nahm, außerdem wohnten rundherum lauter Musiker. Wenn mir einmal danach wäre, meine Anlage aufzudrehen und den »Walkürenritt« so richtig schön krachen zu lassen, würde sich niemand im Haus beklagen. Unter mir residierte ein Schlagwerker mit seiner ihm angetrauten Geigerin. Die beiden übten häufig und lautstark. Und über mir hatte sich Mischa angesiedelt. Er war Dirigent mit einer starken Neigung zum Pianieren – vor allem, wenn er mal wieder vergaß, dass er in mich verliebt war, und einer seiner Verehrerinnen durch eine gefühlvoll vorgetragene Chopin-Etüde imponieren wollte.
Ich stand dagegen eher auf Baritone – und das war auch der Grund, warum ich mich zwölfjährig entschieden hatte, Fagott zu spielen. Meine Eltern – mein Vater war Buchhalter in einem kleinen Verlag gewesen – waren sehr verwundert. Aber ich hatte zum Glück einen Großvater, der in Jugendjahren davon geträumt hatte, Sänger zu werden. Er unterstützte mich, obwohl er zuerst auch fand, dass Fagott kein Instrument für ein Mädchen sei. Später aber hatte er mir mein erstes eigenes Fagott gekauft und kam zu jedem Konzert, bei dem ich spielte. Auf jeden Fall dachte ich an ihn – er war Jahre zuvor gestorben –, als ich Philipp das erste Mal hörte.
Ich war als Fagottistin mit dem Süddeutschen Sinfonieorchester und den »Carmina Burana« auf Sommertour – ein idealer Ferienjob für eine Studentin. Das Geld dafür würde mir durchs halbe Wintersemester helfen. Dennoch war ich bei der Generalprobe nicht dabei – an dem Tag hatte ich meinen Lehrer noch an der Oper vertreten.
Als ich vor dem ersten Konzert zur Stellprobe kam und in der Gemeinschaftsgarderobe mein Fagott zusammenbaute, standen da drei Chorsängerinnen, die in den höchsten Tönen vom Solo-Bariton schwärmten, wobei sie offenkundig weniger an seinem Gesang als an seinem »Knackarsch«, den »Samtaugen« und seinen »schnuckeligen Locken« interessiert waren. Der Herr hatte aber offenkundig nicht nur die Damen im Chor beeindruckt. Kaum hatte ich nämlich meine Kehrseite auf den Stuhl im Orchester verpflanzt, als sich schon die Bratscherin vor mir umdrehte und befand, dass der Sänger ein »richtiges Sahneschnittchen« sei.
Die Jungs um mich herum – ich war mal wieder die einzige Frau unter den Bläsern – verdrehten die Augen. Ich testete mit einem kräftigen Quietschen mein Rohrblatt, steckte es auf mein Fagott und beschied der Kollegin an der Bratsche, dass der Herr Bariton aussehen könne wie eine Kröte im Frack, solange er gut singe und einigermaßen musikalisch sei.
»Ich sehe ja eh nur seinen Rücken!«, sagte ich abschließend.
In diesem Moment hörte ich ein sonores Lachen neben mir und sah auf. Meine Augen wanderten über schmale Hüften in Jeans, einen flachen Bauch, eine muskulöse Brust und breite Schultern auf ungefähr 190 Zentimetern Höhe und trafen dabei ein Paar braune Augen, in denen goldene Fünkchen tanzten.
»Kröte«, sprach die dunkle Stimme, die zu den Augen gehörte, »ist nicht nett. Wie wäre es mit einem verwunschenen Frosch?«
»Und der möchte von unserer fagottierenden Prinzessin geküsst werden? Dafür müssen Sie aber verdammt gut singen«, feixte der Oboer, der neben mir saß.
Der Besitzer der braunen Augen deutete eine Verbeugung an. »Ich werde mein Bestes tun.« Dann sah er mich noch einmal an und obwohl es mir überhaupt nicht passte, fühlte ich ein Flattern im Magen. »Ich glaube, ich würde sehr gerne von Ihnen geküsst werden.«
Ich musste nur eine Viertelstunde warten, bis unser Dirigent mir Gelegenheit gab, des Wunderknaben Wunderhorn zu hören. »Aestuans Interius«, das Lied des von der Venus Getriebenen – und da war Kraft und Leidenschaft, Eroberungswille und Männlichkeit, aber die Aggressivität durch Disziplin gebändigt und das Fortissimo durch Samt gepolstert. Die Stimme ging mir unter die Haut und ich musste mich zur Ordnung rufen. Himmel, ich war doch nicht da, um den Solisten anzusabbern – auch nicht, wenn er so sensationell sang …
Dann war die Probe vorbei.
Als ich mein Fagott einpackte, trat er neben mich. Er wirkte fast ein wenig verlegen und sehr jung, als er leise fragte: »Und?«
»Ich kann es nicht abstreiten: Der Frosch kann singen.«
»Gut genug für einen Kuss?«
Jetzt sah er aus wie ein Lausbub und als er sich über mich beugte, bekam ich einen Hauch von einem herb-frischen Rasierwasser in die Nase.
Er gefiel mir. Er gefiel mir sogar sehr.
Dennoch wich ich aus. »Aber doch nicht so öffentlich!«
Dabei musste ich mich zurückhalten, um nicht in seine weichen Locken zu fassen, die so sehr zum Wuscheln einluden.
»Fein – dann gehen Sie nach dem Konzert mit mir essen.«
»Danke, aber nein danke – ich bin schon mit meinen Kollegen verabredet.«
Das war eine glatte Lüge, aus meiner Verwirrung über die plötzlich aufflammenden Gefühle geboren. Es war erst ein paar Wochen her, dass ich den jungen Herrn, den ich für meine erste große Liebe gehalten hatte, mit einer anderen erwischt hatte, und ich war nicht willens, mich Hals über Kopf in eine Affäre zu stürzen – schon gar nicht mit einem Mann, der so umschwärmt war und wahrscheinlich bei jeder Tournee ein anderes Techtelmechtel hatte.
Dennoch nutzte ich die Pause bis zum Konzert, um ins Programmheft zu schauen, in dem nicht nur ein Bild von ihm, sondern auch sein Lebenslauf abgedruckt war. Dem entnahm ich, dass er Philipp Boch hieß, vor 36 Jahren als Sohn eines Kirchenmusikers in Lübeck geboren worden und mit zehn Jahren nach Stuttgart gekommen war, wo er im Hymnusknabenchor gesungen hatte. Nach dem Abitur absolvierte er ein Gesangsstudium in Stuttgart und am Mozarteum in Salzburg, sein erstes Engagement bekam er an der Volksoper in Wien, ein vielbejubeltes Debüt als Papageno, seitdem machte er eine steile Karriere: Figaro in München, Don Giovanni in Stuttgart, Barbier von Sevilla in Glyndebourne, Almaviva an der Met. Der Schlusssatz ließ mich die Stirn runzeln: »Philipp Boch ist verheiratet und Vater einer Tochter.«
Dementsprechend reagierte ich kühl, als er mich am nächsten Nachmittag auf der Probe wieder ansprach.
Doch Philipp war hartnäckig. Der dritte Tag unserer Tournee führte uns bei strahlendem Sonnenschein nach Konstanz. Wir wohnten sehr schick direkt am See in einem Hotel mit eigenem Badestrand, den ich nach dem Konzert noch einmal nutzte. Als ich aus dem Wasser steigen wollte, saß Philipp auf dem Steg. Er hatte seine Jeans ausgezogen und hängte die Füße ins Wasser. Mein Handtuch lag neben ihm.
Als ich aus dem Wasser geklettert war und es nahm, sprach er mich an. »Womit habe ich Sie verärgert, Juliane?«
»Sie haben mich nicht verärgert, Herr Boch«, antwortete ich und begann, mich abzutrocknen.
»Sie gehen mir aus dem Weg«, stellte er fest.
Ich atmete tief durch. »Herr Boch, es mag Ihnen vielleicht altmodisch und spießig erscheinen, aber eine Affäre mit einem verheirateten Mann steht auf meiner Wunschliste irgendwo zwischen Wurzelresektion und Furunkel an der Kehrseite.«
»Das finde ich weder altmodisch noch spießig, sondern vernünftig.« Er stand auf und schlüpfte wieder in seine Jeans. »Aber wie halten Sie es mit Männern, die in Trennung leben und deren Scheidung bereits eingereicht ist?«
»Sagen das nicht alle? Gleich nach ›Meine Frau versteht mich nicht‹?«, fragte ich und wickelte mir mein Handtuch um die Hüfte.
»Meine Frau versteht mich sehr wohl, doch leider bedeutet das nicht, dass wir unsere Lebensplanung in Übereinstimmung bringen können. Sie ist Ärztin mit Landpraxis, was, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, nicht unbedingt zu meinem Beruf passt. Meine Frau hat das erkannt und als Konsequenz daraus die Scheidung eingeleitet.«
»Zu deinem Missfallen?« Mir fiel gar nicht auf, dass ich ihn plötzlich duzte.
Er nickte und sah auf den See hinaus, in dem sich der Sternenhimmel spiegelte. »Ich weiß nicht, ob man das Missfallen nennen kann. Ich war traurig. Verena und ich waren zusammen, seit wir sechzehn waren, und wir haben eine Tochter, an der ich sehr hänge.«
Etwas in seinem Ton berührte mich so, dass ich bedauerte, ihn so aggressiv angegangen zu haben.
»Wie alt ist deine Tochter?«, fragte ich.
»Acht. Sie ist der Hauptgrund, warum Verena mit eigener Praxis aufs Land wollte.« Er schaute auf mich hinunter. »Sag, ist dir nicht kalt in deinem nassen Badeanzug? Du wirst dich verkühlen.«
Ich fröstelte tatsächlich im Abendwind, aber ich wollte die Unterhaltung nicht abbrechen. Ich räusperte mich und nahm Anlauf. »Äh – möchtest du vielleicht an der Bar noch was trinken? Ich ziehe mich nur schnell um, dann können wir uns dort treffen.«
»Fein.« Er strahlte mich an und legte die Hand für einen Augenblick auf meine Schulter. »Dann rauf und leg dich trocken! Ich warte an der Bar auf dich!«
Es wurde ein extrem langer Abend. Um genau zu sein: Er endete erst, als ich morgens gegen halb sieben – ich war wirklich nicht scharf darauf, dabei von irgendwelchen Kollegen gesichtet zu werden – aus Philipps Zimmer wieder in meines schlich.
Ab da waren wir zusammen und ich war glücklich. Es war ein wunderschöner Sommer, es war eine großartige Tour und sie endete damit, dass Philipp mich fragte, ob ich nicht aus meinem WG-Zimmer zu ihm ziehen wolle. Ich wollte. Ich liebte ihn und ich konnte mir nicht vorstellen, ohne ihn zu leben.
Das allerdings musste ich schon bald üben. Opernsänger waren die Nomaden unserer Zeit: Heute hier, morgen da, vier Wochen in Venedig, sechs Wochen in Wien, dazwischen eine Woche zuhause, dann schon wieder auf dem Sprung nach Amerika. Und was das anging, hatte ich dann schon bald die erste Auseinandersetzung mit Philipp. Unser erstes gemeinsames Weihnachten würde er nämlich in Florenz verbringen.
»Da sind ja Semesterferien, also kannst du mitkommen«, sagte er dazu.
Das sah ich nicht so. Weihnachten ist Hochsaison für Musiker: Weihnachtsoratorium mit dem Kirchenchor Kleinkleckersdorf, Messias mit der Chorvereinigung Stuttgart-Gablenberg, Weihnachtskonzert in der Leonhardskirche, Vertretung in der Oper, weil der Lehrer beim Adventskonzert der Hymnuschorknaben engagiert war – ich dachte nicht daran, auf all diese Engagements zu verzichten, um in Florenz die Sängergefährtin zu geben.
Philipp verstand das nicht. »Wenn du Geld brauchst, kann ich es dir geben. Ich will nicht so lange in Florenz alleine sein!«
Ich machte ihm klar, dass ich keine Lust hatte, von ihm abhängig zu werden, und mir daher meinen Lebensunterhalt auch weiterhin selbst verdienen wollte. Das fand er »stur« und im folgenden Streit stellte er meine Gefühle für ihn in Frage.
Zu Weihnachten war ich für drei Tage in Florenz. Danach reiste Philipp mit nur kurzer Zwischenstation in Stuttgartnach Japan – für sechs Wochen. Während seiner letzten Woche dort war ich dann auch noch mit einem anderen Problem konfrontiert. Meinrechter Armbegann wieder zu schmerzen.Ichhatte schon dreimal wegen Sehnenscheidenentzündung links und rechts pausieren müssen, doch dieses Mal kam es noch übler: Tennisellbogen – ohne je ein Racket in der Hand gehabt zu haben. Das Verdikt des Orthopäden war knallhart: Operation – undichsollemichdaraufeinstellen, mireinenBerufzusuchen, der die Gelenke nicht so belastet.
Ich war am Boden zerstört. Seit ich denken konnte, war es für mich klar gewesen, dass ich Musikerin werden wollte. Wenn andere Kinder spielten, hatte ich geübt, erst auf unserem alten Klavier, dann auf meinem Fagott. Ich hatte nie über einen anderen Beruf nachgedacht – und nun stand ich da, zweiundzwanzig Jahre alt und am Ende meiner Zukunftsträume.
Philipp tröstete mich am Telefon und lud mich nach Kyoto ein. »Hier können wir in Ruhe besprechen, wie es mit dir weitergeht. Ich habe eine Idee …«
Diese seine Idee stellte sich als Heiratsantrag heraus, wobei er mir schwäbisch-pragmatisch erklärte, es wäre ja früher oder später sowieso in diese Richtung gegangen, ergo könnten wir es auch gleich tun. Und als seine Frau könnte ich sowieso keinen Job machen, weil er mich an seiner Seite haben wolle.
Wir hatten einen lautstarken Krach. Ich warf ihm Chauvinismus vor, er nannte mich eine Kampfemanze, der ihr Stolz wichtiger sei als die Zuneigung zu ihm.
In Japan berappelten wir uns wieder – so weit, dass ich sogar seinen Rat annahm, mit Musikwissenschaft weiterzumachen. Obwohl ich dies zunächst zähneknirschend tat, stellte ich bald fest, dass es mich wirklich interessierte. Schließlich promovierte ich sogar.
Vor meiner Promotion kam die Trennung von Philipp. Der Auslöser war »Onegin«. Wir waren uns darüber einig, dass das eine der ganz großen Opern war und vermutlich das Beste, was Tschaikowsky geschrieben hat. Für mich stand auch ganz außer Zweifel, dass Philipp ein toller Onegin war. Aber damit hatte es sich auch schon mit der Harmonie. Über Herrn Onegin an sich waren wir uns gar nicht einig.
Wir waren im Bett, als die Diskussion ausbrach, und ich erklärte: »Also ehrlich, wenn ich Tatiana wäre, würde ich ihn auslachen, wenn er nach Jahren daherkommt und ihr eine Liebeserklärung macht.«
»Das kann ich mir vorstellen!«, bestätigte Philipp und setzte sich auf. »Du stellst deinen Stolz und deine Unabhängigkeit ja immer über alles!«
»Was willst du damit sagen?«
Ich fand es im Bett plötzlich so ungemütlich, dass ich auf die Kante rutschte und nach meinem Bademantel angelte.
»Ich finde es ironisch«, fand er. »Du verurteilst Onegin dafür, dass er so in seiner Attitüde gefangen ist, dass er die Wahrhaftigkeit von Tatianas Gefühlen nicht mehr erkennen kann. Andererseits steckst du so in deinem Krampf-Emanzen-Stunt, dass du meine Gefühle und Wünsche missachtest. Dir ist es wichtiger, deine Unabhängigkeit zu beweisen, als mit mir zusammen zu sein! Dich rührt es nicht, wenn ich dauernd alleine bin und mich dabei miserabel fühle.«
»Ja, da wären wir mal wieder. Du willst der Mittelpunkt meiner Welt sein. Ich brauche kein Studium, ich brauche keinen Job, ich kann meine Zeit damit verbringen, deine Socken zu stopfen, deine Hemden zu bügeln und dich anzuhimmeln. Meine musikalische Betätigung bestände am besten nur noch darin, dir zum Einsingen einen Ton zu geben. Toll!«
»Und wie stellst du dir das vor? Du bastelst zuhause an deiner Karriere – woraus immer die auch bestehen wird – und wir sehen uns alle drei, vier Wochen, wenn ich mal wieder nach Stuttgart komme?« Er atmete tief durch und ich sah, dass sich seine Ohren gerötet hatten. »Du, das hatte ich schon mal. Meine Ehe ist daran kaputt gegangen, dass meiner Frau ihr Beruf wichtiger war als ich. Glaubst du, dass ich mir das noch mal antue?«
»Vielleicht solltest du endlich mal dein antiquiertes Frauenbild überarbeiten! Deines scheint direkt aus dem Mittelalter zu stammen.« Ich war so wütend, ich hätte am liebsten etwas Porzellan zerlegt.
»Und vielleicht denkst du mal über deine Prioritäten nach! Entweder dein Job oder ich! Beides kannst du nicht haben!«
»Sag mal, Maestro, hast du was an den Augen? Habe ich eine große Nase und ein wallendes Gewand?«, fauchte ich. »Ich bin doch nicht Cosima Wagner, die nichts Besseres zu tun wusste, als ihr ganzes Leben in den Dienst des ihr ehelich angetrauten Obergenies zu stellen! Ich studiere nicht, damit ich nachher in der Küche bei der Zubereitung deiner Lieblingsgerichte über die Symbolik der Bach’schen Fuge nachdenken kann! Zählt eigentlich bei dir auch mal, was ich will, oder reden wir hier immer nur über dein Glück und Wohlbefinden?«
»Wer ist derjenige, der seit zwei Jahren ständig alleine ist, weil Madame studieren muss? Denkst du eigentlich dran, dass ich unterwegs schon mal das eine oder andere Angebot bekomme?«
»Oh ja – und von mir aus kannst du es annehmen! Vielleicht findet sich ja darunter eine doofe Blondine, die bereit ist, ihren Job als Friseuse aufzugeben, um mit dir um die Welt zu reisen!«
Das war es dann. Wir brüllten noch ein wenig und am Ende packte ich in meinem Zorn meinen Klimbim und zog in die WG zu meinen singenden Freundinnen Blandine und Mirja.
* * *
Ich vermute, dass wir uns unter anderen Umständen wenigstens für eine gewisse Zeit wieder zusammengerauft hätten. Aber Philipp reiste am nächsten Morgen nach New York, um an der Met den Onegin zu singen, und als er nach sechs Wochen zurückkam, hatte ich – heulend und kreuzunglücklich, aber wild entschlossen – meine Besitztümer bereits aus seiner Wohnung geholt.
Immerhin fand ich dann einen Job: Einer meiner Professoren arbeitete ab und zu für die Stuttgarter Allgemeine und vermittelte mir ein Gespräch mit dem Ressortleiter Kultur. Von da an schrieb ich dann erst mal über ganz kleine Veranstaltungen – Kirchenkonzert in Stuttgart-Zuffenhausen, Chorabend in Bärstetten-Grötzingen – und dann wurden die Aufträge zunehmend größer und interessanter. Außerdem bekam ich eine ganze Menge CDs zum Rezensieren und verdiente endlich wieder einigermaßen Geld. Und mehr noch: Nach einem Jahr bot mir Gerhard Forster von der Zeitung an, nach meinem Abschluss ein Volontariat in seiner Redaktion zu machen und dann als Musikredakteurin einzusteigen.
An der Geschichte mit Philipp hatte ich jedoch noch eine ganze Weile zu knabbern – unter anderem dadurch, dass meine WG-Mitbewohnerin und Freundin Blandine – ihre Mutter Waldgunde-Adolfine hatte sie in ihrem Drang nach Höherem nach einer Tochter von Franz Liszt benannt – ungefähr ein Vierteljahr nach unserer Trennung anfing, in höchsten Tönen von ihm zu schwärmen. Sie hatte es geschafft, in seine Meisterklasse an der Hochschule aufgenommen zu werden, und hätte den Unterricht gerne in einem Privatissimum nach Feierabend fortgesetzt. Ich litt drei Wochen beim Gedanken daran, dass sie es schaffen könnte, war aber zu stolz, es einzugestehen, nachdem Blandine die Hoffnung ausgedrückt hatte, dass ich über ihn hinweg sei, da er mich offenkundig »total vergessen« habe. Als sie erwähnt habe, dass sie mit mir zusammenlebe, habe er »nicht mit der Wimper gezuckt«, dafür aber weiter mit ihr geflirtet.
Zum Glück ging dieser Krug an mir vorüber, doch dafür erwischte es mich weitere drei Monate später, als ich mal wieder im Wartezimmer meines Orthopäden – meine Handgelenke ärgerten mich immer noch – durch die Klatschpresse blätterte. In einem dieser hochwertigen Presseprodukte fand ich einen Bericht von den Salzburger Festspielen – und mitten darin prangte das Foto eines strahlenden Philipp, der händchenhaltend mit einer Blondine durch Salzburg bummelte. Der Bildunterschrift entnahm ich, dass es sich beim weiblichen Part dieser »Salzburger Sommerromanze« um die »Society lady« Amelie von Weßling handelte, geschiedene Gattin eines Schokoladenfabrikanten, 37 Jahre alt. Sie war – das musste der Neid ihr lassen – ebenso schön wie elegant und als ich das nächste Mal an einem Spiegel vorbeikam und meinen Bauchansatz in einem verwaschenen T-Shirt über der formlosen Cargo-Hose sah, überlegte ich mir, was Philipp je von mir gewollt hatte.
Im Dezember erfuhr ich dann aus dem eigenen Blatt – die Stuttgarter Allgemeine hat ja auch ein Ressort »Land und Leute« –, dass Philipp seine Blondine geheiratet hatte. Mit ihr würde er sicher nicht über ihre Karriere diskutieren müssen – Amelie von Weßling-Boch hatte zwar einmal in Paris ein paar Semester Kunstgeschichte studiert, sich aber ansonsten nie der Gefahr ausgesetzt, ihre perfekt manikürten Fingernägel bei so etwas Profanem wie Arbeit zu ruinieren. Stattdessen wusste sie aber wahrscheinlich, wo in welcher Metropole Cardin und Chanel ihre Boutiquen hatten.
Ein paar Wochen nach der Hochzeit lief ich bei einer Premierenfeier in der Oper dem Paar in den Weg. Dummerweise konnte ich mich nicht einfach verkrümeln – ich war mit dem an diesem Abend gastierenden Startenor für ein Interview verabredet. Da stand ich nun, mit dem Sektgläschen in der Linken und einem Häppchen in der Rechten und schaute zu, wie Madame von Weßling-Boch in einem Kleid, das wahrscheinlich mehr gekostet hatte, als ich in einem Vierteljahr verdiente, Hof hielt. Sie unterhielt sich gerade mit dem Dirigenten und der Blick, mit dem sie mich streifte, kündete von gelangweiltem Desinteresse. Doch das änderte sich zwei Minuten später. Da war ich nämlich Sekt und Tellerchen losgeworden und hatte mir dafür am Büfett Philipp zugezogen, der plötzlich durch eine Seitentür aufgetaucht und strahlend auf mich zugekommen war.
»Juliane! Wir haben uns Ewigkeiten nicht gesehen!« Er beugte sich über mich und küsste meine Wange. »Gut siehst du aus!« Er strich mit einem Finger über mein Handgelenk. »Was machen die Gelenke?«
»Deutlich besser, seit ich nicht mehr so viel übe.«
Ich atmete tief durch. Einen Augenblick überlegte ich, ob ich ihm zur Hochzeit gratulieren sollte, aber ich wollte nicht lügen.
»Du hast toll gesungen. Es war schön, dich mal wieder live zu hören.«
Ich sagte nicht dazu, dass ich froh war, ihn nicht kritisieren zu müssen, sondern nur wegen des Tenors da war.
»Danke, man tut, was man kann.« Er lächelte mich an – und mir wurden die Knie weich. Da war alles in seinem Blick: Zärtlichkeit, Begehren, Zugehörigkeit. »Juliane …«
»Phil, Liebling, willst du mich deiner Freundin nicht vorstellen?«
Seine Frau war zu uns getreten und in ihrer Stimme klirrten Eiswürfel. Sie legte ihre Hand auf seinen Arm, wobei der Brillant neben ihrem Ehering aufblitzte wie ein Warnsignal.
»Aber selbstverständlich. Amelie, das ist Juliane Pfeiffer – oder ist das jetzt schon Doktor Pfeiffer?«
»Die Promotion ist seit zwei Wochen durch, Herr Kammersänger. Aber ich höre immer noch auf meinen Namen – ganz ohne Zusatz«, lächelte ich.
»Und ich guck immer noch, ob Herr Fischer-Dieskau in der Nähe ist, wenn jemand ›Herr Kammersänger‹ sagt«, gab er zurück.
Die goldenen Fünkchen in seinen Augen tanzten und für einen Augenblick war da die alte Vertrautheit, dieses »Wir gegen den Rest der Welt«-Gefühl.
»Juliane, meine Frau Amelie von Weßling-Boch.«
Ich bekam eine kühle Hand und einen noch kälteren Blick.
»Wie nett, Sie kennen zu lernen! Mein Mann hat schon so viel von Ihnen erzählt!«
Ich wagte einen Seitenblick auf Philipp und sah, dass seine Augen für einen Moment schmal geworden waren. Doch dann war die freundlich-undurchschaubare Maske, die er bei solchen Anlässen meist zeigte, wieder fest an ihrem Platz.
Also übte ich mich auch in Konversation. »Sie kommen aus Salzburg, nicht wahr, gnädige Frau? Wie fühlen Sie sich denn in Stuttgart?«
»Ach je, was soll ich sagen? Stuttgart ist nett, aber ein bisschen provinziell«, antwortete sie. »Aber wir kommen so viel rum, dass ich damit leben kann.« Sie entdeckte irgendwo in der Menge Bekannte, winkte ihnen zu und zog an Philipps Arm. »Liebster, da drüben sind die Bergmanns!« Und in meine Richtung: »Sie entschuldigen uns, Frau Pfeiffer?«
Weg waren sie, aber während der nächsten Stunde, in der ich auf meinen Tenorissimo warten musste, konnte ich das junge Glück bewundern: Wie sie seine Wange küsste, ihr perlendes Lachen immer, wenn er etwas Witziges sagte, wie sie ihm ein imaginäres Stäubchen vom Smoking bürstete, sich an ihn lehnte und ihn anhimmelte. Es war offenkundig, dass sie total in ihn verliebt war und er ihr zumindest sehr zugetan.
Und so saß ich am nächsten Morgen in der WG-Küche beim Frühstück und fragte Blandine: »Was, um Himmels willen, will er denn mit diesem blonden Hohlkörper?«
Blandine knabberte an ihrem Toast. »Vielleicht ist sie gut im Bett.«
Ich verdrehte die Augen. »Das ist mir zu billig. Außerdem müsste er sie deswegen nicht gleich heiraten.«
»Hast du eine Ahnung, was Männer alles dafür tun, ihren Spaß im Bett zu haben!« Blandine zog ihre langen Beine auf die Eckbank, fing ihre Katze ein und kraulte sie. »Im Ernst, Jule: Sie betet ihn offenkundig an und ist bereit, alles für ihn zu tun. Und er hat zwei Frauen hinter sich, die nicht bereit waren, ihn an die erste Stelle zu setzen, sondern eben mehr an ihrer Karriere interessiert waren.« Sie kicherte. »Wundert es dich, dass er von Emanzen genug und sich für den nächsten Versuch so ein richtiges Weibchen gesucht hat?«
»Soll er glücklich mit ihr werden!«, fauchte ich.
»Weißt du, was ich an der Geschichte am witzigsten finde?«
Blandine holte sich das letzte Croissant aus dem Korb, schmierte ordentlich Butter darauf und krönte das Ganze mit einem Löffel Erdbeermarmelade. Ich unterdessen beneidete sie wieder einmal darum, dass sie futtern konnte wie eine neunköpfige Raupe und dabei doch tannenschlank blieb.
Kauend sagte sie: »Ihre Reaktion auf dich war interessant. Sie scheint mächtig eifersüchtig zu sein.«
Ich verdrehte die Augen. »Blandine, ich glaube, die ist auf alles eifersüchtig, was seine Aufmerksamkeit auch nur für Sekunden von ihr ablenkt! Das hat nichts mit mir zu tun!«
»Schätzchen, so wie du das erzählt hast, war es sehr persönlich. Glaubst du wirklich, dass er ihr eine Menge über dich erzählt hat?«
»Eher nicht«, gestand ich ein. »Er war bezüglich seiner ersten Frau bei mir nie sehr auskunftsfreudig.«
»Siehst du! Warum behauptet sie das also? Und warum muss sie ihn so schnell von dir weglotsen? Sie ist sich seiner nicht sicher. Ich wette, dass sie es genervt hat, dass zwischen euch immer noch Funken fliegen.«
»Du hast mal gesagt, ich sei ihm gleichgültig!« Ich klang trotzig und ärgerte mich darüber.
»Ich war in ihn verknallt – und hatte keine Chance«, gab sie zu. »Ich wollte es nicht sehen, aber es war eindeutig, dass er immer noch an dir hängt. So wie du an ihm! Ich bin gespannt, was da noch rauskommt.«
»Nix, Blandine!« Ich stand auf und begann, den Tisch abzuräumen. »Abgesehen davon, dass er verheiratet ist, hätten wir ja immer noch dasselbe Problem. Ich wäre immer noch nicht bereit, alles für ihn aufzugeben.«
Und das war es dann. Ich stürzte mich nach meiner Promotion in meinen Beruf als Musikredakteurin, außerdem schrieb ich zwei Bücher und bekam anschließend einen Lehrauftrag an der Musikhochschule in Stuttgart.
Nur zu einem Ehemann hatte ich es nicht gebracht. Klar, ich hatte in den sechzehn Jahren, seit ich mich von Philipp getrennt hatte, nicht wie eine Nonne gelebt. Da war die eine oder andere Affäre gewesen und da war der französische Cellist Yves, mit dem ich fast sieben Jahre zusammen war. Er kam mir schließlich abhanden, weil ich heiraten und Kinder haben wollte, während er an seiner Freiheit hing. Aber ich weinte nicht mehr jede Nacht ins Kopfkissen. Im Gegenteil. Ich arrangierte mich mit meinem Single-Leben innerhalb eines netten Freundeskreises.
Dennoch beschloss ich, Mischa für die »Rigoletto«-Premiere zu engagieren. Man wusste ja nie, wen man danach auf der Party traf, und in einem solchen Fall zierte eine Frau nichts mehr als ein hübscher junger Mann, der sie verehrte.
2. GANZ GROSSE OPER
Die Musik des »Rigoletto« war toll, aber die Geschichte ließ mich jedes Mal sinnieren, ob Giuseppe Verdi und sein Librettist zu viel Grappa intus hatten, als sie die zusammenbastelten! Von Logik und Glaubwürdigkeit konnte darin keine Rede sein und insofern tat mir jeder Regisseur leid, der sich damit herumschlagen musste.
Ich rekapitulierte die Handlung, als ich mich mit Mischa widerwillig auf den Weg in die Oper machte, um den Auftrag hinter mich zu bringen.
Herr Rigoletto, seines Zeichens Hofnarr in Diensten des lüsternen Herzogs von Mantua, hält in seinem Haus sein ebenso blondes wie holdes Töchterlein Gilda versteckt. Das nutzt nur nichts. Der Herzog kriegt sie dennoch in die Finger, worauf sich Gilda sofort total in ihn verliebt.
Rigoletto beschließt, den Herzog umbringen zu lassen, wozu er sich des stadtbekannten Auftragskillers Sparafucile bedient. Nur hat der dummerweise ein Schwesterlein, das auch mit dem Herzog rummacht. Der Herr muss echt gut sein, jedenfalls bittet Mörders Schwesterlein ihren Bruder, den Herzog zu verschonen.
Nun hat der Killer ein Problem: Rigoletto will erst bezahlen, wenn Sparafucile ihm den toten Herzog in einem Sack übergeben hat. Also muss eine Leiche her. Sparafucile beschließt, den Nächsten umzubringen, der zur Tür reinkommt. Das ist – Gilda, die mitgekriegt hat, dass ihr geliebter Herzog gemeuchelt werden soll, und beschlossen hat, sich an seiner Stelle zu opfern (sie ist blond und er sehr gut …).
Herr Sparafucile scheint als Killer aber ein echter Pfuscher zu sein. Er übergibt Rigoletto den Sack, und als der auspackt, lebt Gilda noch und das sogar lange genug, um ihrem Vater noch eins vorzusingen, auf Deutsch: »Ich täuschte dich, Vater. Meine Liebe ließ mich für ihn sterben.« Ansonsten bittet sie für den Herzog um Vergebung und verspricht, im Himmel für ihn und ihren Vater zu beten, bevor sie dann wirklich und endgültig das Zeitliche segnet.
Nun saß ich mit Mischa auf den Presseplätzen – dritte Reihe Parkett links – im Großen Haus der Stuttgarter Staatstheater und versuchte mich auf die Musik zu konzentrieren.
Gilda-Blandine hatte zwar etwas Intonationsprobleme und schien nicht immer zu wissen, wo sie auf der Bühne eigentlich hingehörte, aber Paolo Desiderato als Rigoletto riss es heraus – der konnte sehr gut singen und schauspielern. Luigi Tavatore als Herzog sah zum Anbeißen aus und schlug sich für einen Debütanten in der Rolle wacker. Und ich mochte die Inszenierung. Philipp als Regisseur hatte modernisiert – aber diese Oper vertrug das gut.
Das Setting des ersten Aktes erinnerte an einen Cluburlaub, Rigolettos Haus war im Gegensatz dazu richtig schön bürgerlich-spießig und in Sparafuciles Kneipe leuchteten an der Wand die Spielautomaten, während die Gläser aussahen, als ob das Spülwasser dringend mal wieder gewechselt werden sollte. Doch bei allen Modernisierungen hatte Philipp die Oper nicht gegen den Strich gebürstet, nicht übertrieben, dafür aber für die Zuschauer eine Möglichkeit geschaffen, sich mit den Figuren und der Situation zu identifizieren.
Im Orchestergraben regierte an diesem Abend Armin Müller-Rehling, der Herr, den Blandine ein paar Jahre zuvor geheiratet hatte. Ich konnte ihn nicht ausstehen – der Mann verband die Arroganz, die für seinen Beruf typisch ist, mit der Ausstrahlung einer Profimaschine zur Herstellung von Eiswürfeln –, aber ich musste ihm doch wieder einmal zugestehen, dass er ein verflixt guter Dirigent war. Sein Verdi war opulent und doch transparent und er hatte keine Angst, die großen Melodiebögen mit viel Gefühl auszuspielen.
Ich war also bis kurz vor Ende des dritten Aktes rundum zufrieden. Ich formulierte im Geiste schon meine durchaus positive Rezension – Blandines Intonationsprobleme würde ich zwar erwähnen müssen, aber nicht zu hoch hängen. Jeder Sänger hat mal einen schlechten Tag, dafür muss man ihn nicht in die Pfanne hauen.
So schaute ich entspannt zu, wie Sparafucile Gilda erstach und sie mit einem gut gespielten Röcheln in sich zusammensank. Das Licht auf der Bühne ging aus, man hörte die Drehbühne rumpeln. Der letzte Aufzug folgte, nun vor Sparafuciles Haus am Ufer eines offenkundig ziemlich dreckigen Flusses, den es nur als Hintergrundprojektion gab. Rigoletto fuhr mit dem Kahn vor, Sparafucile half, den Sack mit der Leiche ins Boot zu verladen. Er bot auch noch seine Hilfe beim Versenken an, was Rigoletto aber ablehnte. So ging der Mörder ins Haus zurück, während Rigoletto sich in die Riemen legte – für einen Augenblick, denn dann hörte er aus Sparafuciles Haus die Stimme des Herzogs mit seiner großen Arie »La donna e mobile …« – »Trügerisch sind die Weiberherzen«.
Rigoletto glaubte zuerst, nicht richtig gehört zu haben, und sang sein »… illusion notturna è questa!« – »Es ist ein nächtlich Trugbild«. Doch dann wurde ihm klar, dass er wirklich den Herzog gehört hatte, und er beschloss, den Sack zu öffnen und nachzuschauen, wer oder was drin war.
Nun sollte man ja meinen, dass dem Herrn Hofnarren der Unterschied zwischen 186 Zentimetern und 90 Kilogramm Herzog und 166 Zentimetern und 47 Kilogramm Tochter schon bei der Sackübernahme hätte auffallen können, aber in der Oper beflirtet mancher ja auch die eigene Ehefrau, ohne was zu merken. Paolo Desiderato sang »Io tremo ... È umano corpo! Mia figlia!« – »Ich zittere, ein menschlicher Körper! Meine Tochter!« dementsprechend mit Aplomb. Dabei streifte er den Sack nach unten.
Blandines lange, blonde Perücke kam zum Vorschein und dann – eine Fratze, dunkel verfärbt, die Zunge heraushängend.
Paolo erstarrte in der Bewegung, sein Mund zu einem stummen Schrei geöffnet. Er schaute hilfesuchend zur Seite, gleichzeitig drang ein Geräusch – ein Gurgeln, gefolgt von einem erstickten »Nein!« – aus dem Orchestergraben. Das Orchester verstummte – ein Musiker nach dem anderen drehte sich um, schaute zur Bühne und hörte auf zu spielen. Und dann, nach einem schrecklich langen Moment, gingen die Lichter aus und der Vorhang fiel.
Ich schluckte. »Ich glaube, da ist etwas passiert«, sagte ich hilflos.
»Wenn das ein Scherz sein soll, ist es ein verdammt mieser«, stellte Mischa fest.
Hinter uns begannen die zwei Damen, die die ganze Zeit mit Bonbonpapierchen geraschelt hatten, ihre Habseligkeiten zusammenzusuchen, wobei sie ihrer Katastrophenfantasie freien Lauf ließen. Ihr Katalog an Erklärungen, was passiert sein könnte, reichte von Herzinfarkt des Dirigenten über Todesfall hinter den Kulissen bis zum Feueralarm. Der war anscheinend auch noch ein paar anderen Leuten in den Sinn gekommen, die nun ohne Rücksicht auf Verluste und über die Knie anderer Zuschauer hinweg Richtung Ausgang drängelten.
Nach einer kleinen Ewigkeit tat sich etwas auf der Bühne. Ein Scheinwerferkegel tastete über den Vorhang, blieb dann in der Mitte stehen, der schwere Stoff teilte sich und eine breitschultrige, dunkle Gestalt trat ins Licht. Ich erkannte Philipp in schwarzer Hose und schwarzem Rollkragenpullover, das Gesicht darüber kalkweiß und angespannt. Er räusperte sich – und plötzlich war wieder Ruhe im Haus und selbst die Zuschauer, die an den Türen standen, drehten sich um und schauten zur Bühne.
»Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen eine traurige Mitteilung machen: Unsere Gilda, Blandine Keller, hatte einen Unfall und ist tot. Ich denke, unter diesen Umständen werden Sie Verständnis dafür haben, dass wir die Vorstellung nicht fortsetzen können. Ich danke Ihnen!«
Eine angedeutete Verbeugung und dann war er schon wieder verschwunden. Dafür ging die Beleuchtung im Haus an und sämtliche Türen wurden geöffnet.
Ich konnte nicht fassen, was Philipp gesagt hatte. Blandine sollte tot sein? Diese Fratze im Sack sollte etwas mit Blandine zu tun gehabt haben? Das konnte nicht sein! Gut, wir hatten in den letzten vier, fünf Jahren wenig Kontakt gehabt. Ich vertrug mich nun einmal nicht mit Blandines Ehemann und ihre Affenliebe zu ihren Katzen war mir zunehmend auf die Nerven gegangen. Um genau zu sein: Wir hatten Streit bekommen, als Blandine von mir verlangt hatte, eine Tour nach Salzburg – und nein, ich hatte nicht beabsichtigt, zu meinem Vergnügen bei den Festspielen herumzuhüpfen – abzusagen, um mit ihr ihren Perserkater Florestan zu beerdigen. Und dazu sollte ich Blandine, die nie den Führerschein gemacht hatte, eine Stunde durch die Pampa an den Baggersee kutschieren, wo ihre Frau Mama und der Stiefvater ganzjährig einen Wohnwagen auf dem Campingplatz stehen hatten. Zum schon lange nicht mehr mobilen Zweitheim an einem See gehörte auch ein Inselchen und dort fand Florestan in einem mit Samt bezogenen Schuhkarton seine letzte Ruhe – ganz ohne meine Mitwirkung, denn ich war ja nach Salzburg gefahren, wo mich dann nicht nur ein Foto der Grabstätte, sondern auch eine Mail von Blandine ereilte, in der sie mir mitteilte, dass sie »menschlich schwer enttäuscht« sei, weil ich sie im Stich gelassen hatte. Sie zweifelte an meiner Freundschaft und litt darunter – sagte sie.
Warum dachte ich gerade jetzt daran? Blandine war tot!
Mischa und ich waren inzwischen in die Wandelhalle gegangen. Auf den ersten Blick sah es hier aus wie an einem normalen Premierenabend: gut gekleidete Frauen, die darauf warteten, dass ihre Begleiter ihre Mäntel holten. Doch auf den zweiten Blick sah man Schock und Ratlosigkeit in den Gesichtern. Und mir fiel auf, dass es sehr leise war. Die wenigen Opernbesucher, die sich unterhielten, sprachen mit gedämpften Stimmen.
Mischa kam mit meinem Mantel und seiner Jacke. Gemeinsam traten wir auf die große Freitreppe hinaus. Ich fröstelte in der kalten Nachtluft.
»Was machen wir jetzt, Jule?«, wollte Mischa wissen.
Ich kam nicht zum Antworten. Ich spürte, wie mein auf stumm geschaltetes Handy in meiner Hosentasche vibrierte, und nahm ab.
»Frau Doktor Pfeiffer?« Die Stimme war vage bekannt, dennoch konnte ich sie nicht gleich einordnen. Doch dann sprach der junge Mann schon weiter: »Alex Berlinger vom Nachtdienst. Sind Sie in der Oper?«
»Eben rausgekommen.« Ich ahnte schon, was der Redakteur von der Stuttgarter Allgemeinen von mir wollte, und blockte ab. »Herr Kollege, ich hätte mich schon gemeldet, aber im Moment weiß ich nichts – außer dass die Tote eine langjährige Freundin von mir war.«
»Oh, das tut mir leid«, erwiderte der Kollege und ich meinte zu hören, wie er dabei gelangweilt seinen Kaugummi von der einen in die andere Backentasche schob. »Ist ja auch kein Problem. Die Nachtausgabe ist raus, also reicht es, wenn wir morgen was kriegen.«
Einen Augenblick kämpfte ich gegen die Versuchung, ihn darauf hinzuweisen, dass ich als Musikredakteurin bestimmt nicht die Arbeit der Lokalredakteure machen würde, doch dann fiel mir ein, dass die Oper morgen bestimmt eine Pressemeldung herausgeben würde. Ich unterdessen würde wohl einen Nachruf auf Blandine schreiben müssen.
»Komm!« Mischa hatte sich, während ich mein Telefonat beendete, entschieden, was er tun wollte.
Er nahm mich an der Hand, führte mich die Freitreppe hinunter, nach links um das Haus herum und über den Parkplatz des Landtags in Richtung Künstlereingang in der Konrad-Adenauer-Straße. An den war aber nicht heranzukommen, denn davor standen mehrere Polizeiwagen und ein weißer Opel mit einem Blaulicht auf dem Dach. Dahinter fuhr gerade ein dunkelgrüner Kombi vor, aus dem zwei in schwarze Anzüge gekleidete Männer einen grauen Kunststoffsarg hoben und auf einen fahrbaren Untersatz stellten.
Sein Anblick traf mich wie ein Schlag in den Magen. Blandine war tot – und offenkundig war ihr Tod kein harmloser Unfall gewesen. Das Aufgebot an Polizei sprach dagegen – und in einem der Männer, die jetzt mit den Plastikboxen ins Haus kamen, erkannte ich den Chef der Spurensicherung der Stuttgarter Kripo, den ich während der Zeit, als ich Volontariat in der Lokalredaktion gemacht hatte, kennen gelernt hatte.
Mischa schaute mich an. »Mädchen, du siehst gar nicht gut aus! Komm, du musst ins Warme und brauchst etwas zu trinken!«
Ungeachtet des Polizeiaufgebotes rannten wir über die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Musikhochschule. An der Ecke davor schob Mischa mich in die Weinstube Becher. Der Wirt, der Mischa und mich in den letzten Jahren oft genug gesehen hatte und auch Blandine kannte, kam uns entgegen und nahm mir den Mantel ab.
»Mensch, Juliane, was ist denn passiert? Ich habe eben gehört, in der Oper sei die Vorstellung abgebrochen worden, weil Blandine Keller auf offener Bühne tot umgefallen ist!«
Ich konnte erst einmal nur nicken.
Dafür antwortete Mischa. »Das zwar nicht, aber sie ist tatsächlich tot. Mehr wissen wir allerdings auch nicht. Vor der Oper steht ein Riesen-Polizeiaufgebot. Die ermitteln wohl …«
Der Wirt führte uns zum Ecktisch. »Du siehst aus, als ob du erst mal einen Cognac brauchen würdest, Juliane. Warte, ich bring dir einen.«
»Danke, aber ein heißer Tee wäre mir erst mal lieber«, sagte ich. »Und dann ein Glas von deinem Roten.«
»Bring ich dir gleich. Und du, Mischa?«
»Dasselbe – aber kipp mir einen Schuss Rum in den Tee!« Der Wirt verschwand, dafür öffnete sich die Tür. Zwei Männer kamen herein, brachten einen Schwall kalter Luft mit und steuerten direkt den Ecktisch an.
Den großen Blonden, der sich jetzt aus seinem Anorak schälte und zur Begrüßung mit dem Knöchel auf den Tisch klopfte, kannte ich: Claus Schlotterbeck, einstmals ein Kollege in der Fagottklasse, heute das erste Fagott an der Oper.
»’n Abend, Jule!« Er deutete mit dem Kinn auf seinen rundlichen Begleiter. »Das ist Hanno, unsere zweite Klarinette. Hanno, das sind Jule, die Kritikerin der Stuttgarter Allgemeinen, und Mischa, ihr zahmer Dirigent.«
Hanno nickte und streckte mir eine Hand hin. »Guten Abend – wie zahm ist der Pinsler?«
Mischa knurrte, ich zwang mir ein kleines Lächeln ab. »Er beißt zumindest nur, was er isst – und ich glaube nicht, dass er scharf auf dich wäre.«
Die beiden Musiker setzten sich und orderten Bier, dann fragte Claus: »Wart ihr in der Premiere?« Er wartete nicht auf eine Antwort, sondern sprach gleich weiter: »Da tobt jetzt richtig der Bär! Habt ihr das noch mitgekriegt?« In seinen Augen blitzte Sensationslust. »Die sagen, jemand hätte die Keller um die Ecke gebracht!«
»Wie bitte?« Ich verschluckte mich fast an meinem zu heißen Tee und musste husten.
Mischa klopfte auf meinen Rücken, starrte dabei aber die beiden Musiker an. »Wie kann das denn sein? Ich meine, in den zwei Minuten zwischen ihrem letzten Auftritt und der Nummer mit dem Sack?«
Der Klarinettist antwortete: »Da hat wohl auf der dunklen Hinterbühne jemand auf sie gewartet, sie erwürgt und dann in den Sack gesteckt. Ich habe zufällig ein bisschen mitgehört, was die Polizisten gesagt haben.«
»Und den Requisiteur, der der Keller in den Sack helfen sollte, hat der Mörder ins kleine Requisitenlager gesperrt!« Claus hatte sein Bier bekommen und trank einen kräftigen Schluck.
»Und jetzt ist richtig Rambazamba!«, erzählte sein Kollege. »Der Herr Intendant, das sensible Seelchen, hat anscheinend in der Proszeniums-Loge einen halben Nervenzusammenbruch erlitten, als er die Leiche auf der Bühne gesehen hat. Darum musste ja auch Boch raus, um die Meute heimzuschicken. Den hat es danach aber auch erwischt – Notarzt, Tatütata!«
Mein Magen krampfte sich zusammen. »Wisst ihr, was er hat?«
»Keine Ahnung.« Claus zuckte mit den Schultern. »Der Portier hat was von Herzinfarkt erzählt – er sei mit Sauerstoffmaske, EKG und weiß nicht wie vielen Schläuchen abtransportiert worden.«
»Unterdessen saß der Kotzbrocken – ich meine unseren Herrn Generalmusikdirektor Armin Müller-Rehling – auf der Bühne und bemühte sich als trauernder Witwer ein paar Krokodilstränen zu produzieren, aber ziemlich erfolglos«, berichtete Hanno. »Dabei hat jeder gewusst, dass die Keller und er in den letzten Wochen wie Hund und Katz waren! Ihr hättet mal hören müssen, wie die sich in den Sitzproben angemacht haben!«
»Was das angeht, war aber auch ihr Auftritt mit Boch in der Kostümprobe vom Feinsten!« Claus hatte sich mittlerweile einen Wurstsalat geordert und kaute mit Appetit.
»Ich dachte, er geht ihr an die Kehle!«, tratschte Hanno, bemerkte dann erst, was er gesagt hatte, und sagte schnell: »Ups! Hab ich nicht so gemeint. Ich wollte nur sagen, dass Boch stinksauer war, weil die Keller unverschämt war. Sie hat einen Mordskäse zusammengesungen, hat ständig seine Regieanweisungen vergessen und sich dann gewundert, dass Boch fast die Wände hochgegangen ist!«
»Immerhin hat sie es geschafft, dass der Kotzbrocken und Boch, die sich ja normalerweise mögen wie Zahnschmerzen, einig waren. Die beiden brüllten im Duett. War schräg! Von Müller-Rehling sind wir gewohnt, dass er cholerische Anfälle bekommt und mit knallroter Birne durch den Orchestergraben tobt. Aber Boch? Der ist doch sonst ein Ausbund an Liebenswürdigkeit und guten Manieren! Aber auf der letzten Probe ist er hochgegangen wie eine Bombe! Ich glaube, ich habe den noch nie so sauer erlebt.«
»Den Boch muss seine Madame geärgert haben. Der war während der ganzen Produktion mies drauf«, wandte sein Kollege ein.
Mischa streckte die langen Beine. »In Sachen Zickigkeit ist Frau von Weßling-Boch ja auch unüberbietbar. Bei der können Diven noch was lernen!«
»Woher weißt du das denn?«, fragte ich erstaunt. »Ich wusste gar nicht, dass du die Dame kennst.«
Ich biss mir auf die Unterlippe. Da war es nun also wieder, mein altes Problem: In all den Jahren seit der Trennung von Philipp hatte ich es nie geschafft, eine Begegnung mit ihm zu überstehen, ohne Herzklopfen und weiche Knie zu bekommen. Gleichzeitig hatte ich aber immer vermieden, mehr als unbedingt notwendig über ihn zu sprechen. Ich hatte ja oft mitbekommen, wie die weibliche Hälfte der Szene ihn anhimmelte, angefangen von seiner Stimme, die wie »flüssiger Samt« sei, seine »sensationell sexy Beine« über seinen »sinnlichen Mund« bis hin zu seinen abwechselnd »geheimnisvoll« oder »melancholisch« genannten braunen Augen. Die andere, männliche Hälfte der Szene unterdessen lästerte über die doofen Hühner, die wegen Philipp halb in Ohnmacht fielen und angeblich in der Oper nichts hörten, weil sie viel zu beschäftigt damit waren, ihm auf die – zugegeben – langen, tollen Beine und den knackigen Hintern zu starren.
Es wäre mir ohne Ende peinlich gewesen, zur Riege der Boch-Groupies gezählt zu werden, und mein Stolz hätte ganz sicher nicht zugelassen, mir diesbezüglich von Mischa irgendwelche Sprüche anzuhören. Deswegen hatte ich nie mit ihm über Philipp gesprochen und wusste folglich nicht, dass er Amelie von Weßling-Boch kannte und kein Fan von ihr war.
»Ich hatte vor drei Jahren in Glyndebourne das Vergnügen mit ihr. Da war ich zweiter Kapellmeister und habe einige Proben mit ihrem Mann und Harriet Spaning korrepetiert. Madame saß in jeder, langweilte sich tierisch, verbreitete schlechte Laune, wollte aber nicht gehen – wahrscheinlich hatte sie Angst, dass Harriet ihren Philipp vernascht. Im Jahr davor hatte ich in Salzburg mit ihr das Vergnügen. Da hatte sie Stress, weil Claudia Theodoru als Zerlina ihren ehelich angetrauten Don Giovanni beschäkert hat.« Mischa grinste. »Ich glaube nicht, dass es viele heterosexuelle Männer unter achtzig gibt, die Claudimaus von der Bettkante schubsen würden – außer Boch. Den hätte seine Angetraute gar nicht so bewachen müssen.« Mischa kicherte, trank seinen Tee aus und bestellte mit einem Wink des leeren Glases das nächste. »Das ›La ci darem‹ war ganz großes Kino! Boch schnappte sich Claudia, rangierte sie gegen die Wand, griff ihr unters Röckchen und zog ihren Oberschenkel hoch. Es war perfektes Timing: Beim letzten Ton hatte er sie so im Griff, dass er sie in die Abblendung reinknutschen konnte. Seine Madame erbleichte bei jeder Probe – und hat dann drei Tage lang jedem erzählt, dass mit diesem Regisseur Salzburg von einer Kulturstätte zu einem Nightclub verkomme!« Er seufzte. »Unterdessen behauptete Claudia, sie warte darauf, dass Boch ein Heiligenschein wachse. Sie habe nicht gedacht, dass jemand so distanziert-höflich grapschen könne.«
Claus war mit seinem Wurstsalat und Bier durch und bestellte Nachschub. Während er auf sein Bier wartete, sagte er: »Ich verstehe sowieso nicht, wieso die Weßling-Boch so eifersüchtig ist. Er hat doch einen blütenreinen Ruf! Klar, er sieht gut aus, er ist charmant, er hat jede Menge Verehrerinnen, aber anscheinend ist er seiner Zimtzicke treu – auch wenn’s niemand versteht.«
»Immerhin, beim ›Rigoletto‹ ist sie uns erspart geblieben«, erzählte Hanno. »Sie scheint nicht in der Stadt zu sein – sie ist nicht mal zur Premiere aufgekreuzt. Aber ich denke nicht, dass jemand sie vermisst hat.«
»Ihr Mann vielleicht schon«, sagte ich.
Mischa hob eine Augenbraue, »Ich wusste gar nicht, dass du zu seinem Fanclub gehörst, Jule.«
Darauf wollte ich nicht antworten. Überhaupt fühlte ich mich zunehmend unwohl. Ich hatte die ganze Zeit versucht, den Gedanken an Philipp zu verdrängen, aber ich schaffte es nicht. Ich sah die ganze Zeit vor mir, wie er an die Rampe getreten war, um das Publikum nach Hause zu schicken. Er war schon da kreidebleich gewesen und ich erinnerte mich, dass er einmal mit der rechten Hand nach seiner Brust gefasst hatte.
Herzinfarkt. Vielleicht kämpfte er jetzt auf einer Intensivstation um sein Leben. Und Blandine war tot und lag nun in diesem grauen Kunststoffsarg, den die Bestatter ins Theater getragen hatten, während ich im Becher saß und mir Tratsch anhörte. Dabei war mir zum Heulen.
Ich trank meinen Wein aus. »Jungs, seid mir nicht böse, aber ich habe für heute genug. Ich möchte nach Hause.« Ich winkte nach dem Wirt und bezahlte meine Rechnung.
Mischa hatte ebenfalls einen Schein aus der Tasche gekramt und legte ihn mit einem »Stimmt so!« auf den Tisch. Dann stand er auf und lächelte die beiden Musiker an. »Gute Nacht – und ich hoffe, ihr habt wegen dieser Geschichte nicht zu viel Ärger.«
* * *
Ich hatte in der Nacht sehr wenig geschlafen und ab ungefähr sieben hatte ich mir am Computer die Zeit mit Spielen vertrieben. Die Konzentration zum Arbeiten brachte ich nicht auf und rechtfertigte das vor mir selbst damit, dass ich sowieso erst mit meinem Ressortleiter sprechen musste, den aber kaum vor neun anrufen konnte. Gerry würde natürlich einen Abgesang auf Blandine von mir erwarten. Doch so hartgesotten, dass ich den aus dem Ärmel hätte schütteln können, war ich nicht.
Um halb neun saß ich mit einem Becher Kaffee und dem Telefon auf dem Fensterbrett in meiner Küche und sah auf die schlafende Stadt hinunter.
Die Nummer war abgespeichert, beim fünften Klingeln meldete sich eine etwas genervt klingende Frauenstimme: »Staatstheater Stuttgart, guten Morgen.«
»Guten Morgen. Pfeiffer von der Stuttgarter Allgemeinen. Ich hätte gerne Frau Neidhard gesprochen.«
»Damit sind Sie nicht allein! Bei Frau Neidhard ist … halt, sie hat gerade aufgelegt. Ich verbinde Sie, Moment bitte.«
Es klickte, dann sagte eine dunkle Stimme, die recht müde klang: »Staatstheater Stuttgart, Pressestelle, Neidhard.«
»Guten Morgen, Nina.« Die Pressesprecherin des Theaters und ich hatten so oft miteinander zu tun, dass wir uns mittlerweile angefreundet hatten. »Wie geht es dir?«
»Frag nicht!«, stöhnte Nina. »Mein Telefon klingelt seit sieben im Minutenrhythmus, unten vor der Tür lauert ungefähr ein halbes Dutzend Fotografen, mein Intendant jault, weil er eine Pressekonferenz geben muss, und ich sollte eigentlich ein Statement basteln und rausgeben. Das Problem ist nur, dass ich keine Ahnung habe, was ich reinschreiben soll, und dass die ermittelnde Kommissarin, mit der ich mich abstimmen sollte, nicht erreichbar ist. Sind damit alle deine Fragen beantwortet?«
Ich atmete tief durch und rieb mit der freien Hand über meinen schmerzenden Magen. Ich bemühte mich dennoch, gelassen zu klingen. »Nur eine noch: Wie geht’s eurem Regisseur? Ich habe gehört, den hätte es auch umgehauen.«
»Das ist die einzig gute Nachricht«, antwortete Nina. »Er hat sich vor einer halben Stunde gemeldet: Er ist aus dem Krankenhaus raus, soll sich aber noch ein paar Tage schonen. Es war zum Glück nur ein Kreislaufkollaps.«
Ich war sehr erleichtert und atmete tief durch. »Danke, Nina. Das ist gut zu hören.«
»Ja, aber wenn Boch hört, was hier los ist, und dass die Presse von seinem Zusammenbruch erfahren hat – frag nicht, wer da wieder getratscht hat –, fällt er gleich noch mal um! Du weißt doch, wie Sänger sind!«
Ja, das wusste ich. Die waren alle nicht scharf darauf, dass ihre Wehwehchen öffentlich bekannt wurden. Für jedes Theater und jeden Konzertveranstalter ist der Ausfall eines Solisten ein Alptraum, weshalb man jemanden, der gesundheitlich angeschlagen ist, nicht gerne engagiert.
»Kein Problem, Nina – wenn er schon wieder fit ist, werde ich natürlich nicht darüber schreiben«, versprach ich.
»Danke, du erlöst mich von einer Sorge.«
»Gern geschehen. Aber eine Frage hätte ich doch noch: Herr Boch sprach gestern von einem Unfall. Inzwischen wird aber von Mord geredet.«
Nina zögerte einige Sekunden, dann gestand sie ein: »Kommt ja früher oder später raus: Die Kripo geht davon aus, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt. Frau Keller wurde erwürgt.«
»Holy Moly!«, rutschte mir heraus. »Ich hatte gehofft, dass das nur ein Gerücht ist.«
»Du hast schon davon gehört?«, fragte Nina. »Oh Mann, oh Mann – können wir hier eigentlich in der Nase bohren, ohne dass du davon erfährst?«
»Gut informiert zu sein, gehört zu meinem Job.«
Ich schloss die Augen und versuchte, durch festes Ausatmen den Schwindel zu vertreiben. Ich hatte am Abend davor nicht glauben wollen, dass Blandine wirklich ermordet worden war. Aber nun war es Realität. Und dann ging das Leben weiter – einfach so, ohne auch nur eine Sekunde innezuhalten und ohne mir die Chance zu geben, anders zu reagieren als professionell. »Wie geht es denn jetzt bei euch weiter? Habt ihr eine Zweitbesetzung für die Gilda?«, fragte ich.
»Ich weiß nicht, ob wir heute überhaupt spielen. Wir bräuchten ja nicht nur einen Ersatz für Frau Keller, sondern auch für unseren Generalmusikdirektor. Herr Müller-Rehling ist natürlich fix und foxi.«
»Kann ich mir vorstellen.« Ich zwang mich, kühl zu bleiben. »Macht ihr eine Trauerfeier im Haus?«
»Keine Ahnung. Ich muss erst mit dem Intendanten reden. Und der muss sich wohl mit Müller-Rehling ins Benimm setzen. Ich weiß bis jetzt nur, dass es bis zur Beerdigung noch eine Weile dauern kann, weil die Polizei eine Obduktion durchführen lässt.«
»Was für ein Alptraum!« Ich atmete noch einmal tief durch. »Du wirfst mir dein Statement in die Mail, wenn du so weit bist?«
»Aber sicher doch!« Bei Nina waren im Hintergrund Stimmen zu hören. »Du, bei mir geht es schon wieder rund.«
»Alles klar – dann mach weiter! Übersteh’s gut und danke!« Ich legte auf.
Ich beneidete Nina nicht um ihren Job. Die nächsten Tage würden garantiert schlimm für sie werden.
Aber wie ging es bei mir weiter? Ich beschloss, nicht mehr nachzudenken, sondern die Routine abzuarbeiten – und das bedeutete, erstmal unsere Online-Ausgabe zu bedienen. Keine halbe Stunde später – unter Druck zu arbeiten lernt man in meinem Job – stellte ich die Kurzmeldung fürs Internet ins System und hängte eine Notiz für den Online-Chef, meinen Ressortleiter und die Lokal-Redaktion daran, dass im Moment nicht mehr zu erfahren sei. Dann ging ich duschen.
Unter dem warmen Wasserstrom dachte ich darüber nach, dass ich Armin Müller-Rehling wohl einen Kondolenz-Brief schreiben musste. Auch wenn ich ihn nicht mochte – man wünscht niemandem, auf diese Art seine Frau zu verlieren. Und wie auch immer meine Gefühle ihm gegenüber waren: Blandine hatte ihn geheiratet. Allerdings war ich mir nicht sicher, ob sie ihn je geliebt hatte.
Ich erinnerte mich noch gut daran, wie sie von einem Engagement in Zürich zurückgekommen war und in den höchsten Tönen von Müller-Rehling geschwärmt hatte. Ich nahm es zuerst nicht ernst. In den gut zehn Jahren, in denen ich Blandine gekannt hatte, war ein breiter Strom von sogenannten »großen Lieben« und »perfekten Partnern« an mir vorübergezogen. Blandine war der Typ, der nach der ersten Nacht wusste, dass dieser nun der Prinz ist, auf den sie ihr Leben lang gewartet hatte. Nach der zweiten Nacht dachte sie über die Namen der gemeinsamen Kinder nach und zur dritten kam es sehr oft nicht, weil der betreffende Knabe vor der Umklammerung geflüchtet war.
Unter diesen Umständen war es wohl verständlich, dass ich nicht sofort den Hochzeitskranz gewunden hatte, als Blandine mir erzählte, dass sie während ihres Gastspieles in Zürich ein paarmal mit Armin Müller-Rehling ausgegangen war.
»Er ist wie ein Seelengefährte«, hatte sie geschwärmt. »Wir haben nicht nur die Musik gemeinsam, sondern auch unser Hobby – wir tauchen beide gerne.«
Als sie dann erwähnte, dass er »der perfekte Gentleman« sei, der sie nach den vergnüglichen Abenden jeweils ins Hotel gebracht und vor ihrer Zimmertür mit einem keuschen Kuss verabschiedet habe, klingelten bei mir die Alarmglocken. Ich überlegte, ob ich für das nächste Blandine-Liebesdrama die Kleenex-Vorräte aufstocken sollte.
Doch eine Woche später kreuzte Müller-Rehling, wie immer mit seinem Kofferträger Jochen Ölert, in Stuttgart auf, quartierte sich – was Blandine mächtig imponierte – in einer Suite im Schlossgartenhotel ein und begann, Blandine mit Rosen und Aufmerksamkeit zu überschütten. Am dritten Abend zeigte er ihr dann das Kingsize-Bett in dieser Suite. Die Vorstellung, die er dort gab, sei nicht eben brillant gewesen, doch Blandine war überzeugt, dass sie ihn mit ihren Verführungskünsten schon noch auf Vordermann bringen könne. Daraufhin begab sie sich – mit seinem Ölert im Schlepp – auf die Suche nach einem angemessenen Domizil für ihren Dirigissimus, der von Berlin umzusiedeln gedachte – ihretwegen. Sie konnte nämlich nicht nach Berlin ziehen, weil ihre Mutter die Trennung nicht verkraftet hätte.