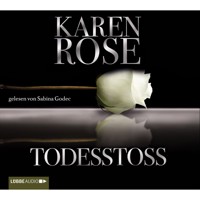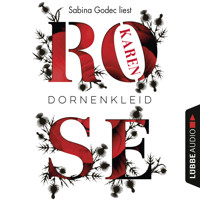9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Baltimore-Reihe
- Sprache: Deutsch
Furiose Spannung, rasante Action und ein Schuss Romantik: der 5. Thriller der Baltimore-Reihe von Bestseller-Autorin Karen Rose Hinter einem Sessel versteckt sich die elfjährige Jazzie vor dem Mann, der eben ihre Mutter im Zorn erschlagen hat. Sie hat ihn sofort erkannt – er aber hat sie nicht gesehen. Ab sofort wird Jazzie kein Wort mehr sagen, denn nur so glaubt sie, sich und ihre Schwester schützen zu können … Ein packender Ladythriller mit knallharter Gewalt und einer Prise Romantik Ihr halbes Leben war von einer Lüge bestimmt, jetzt will Taylor Dawson endlich die Wahrheit herausfinden über den Mann, den ihre Mutter ein Monster genannt hat: Clay Maynard, ihren Vater. Weil Clay in Baltimore als Sicherheitschef in einem Programm für traumatisierte Kinder arbeitet, besorgt Taylor sich dort eine Stelle als Praktikantin. Dabei kommt sie nicht nur ihrem Vater Clay nahe, sondern auch ihrem Kollegen Ford Elkhart. Bald entwickelt Taylor ein besonders enges Verhältnis zu zwei kleinen Mädchen, die den Mord an ihrer Mutter mit ansehen mussten und seitdem kein Wort mehr sprechen. Taylor ahnt, dass die kleine Jazzie weiß, wer ihre Mutter getötet hat. Was Taylor nicht ahnt: Der Killer hat längst beschlossen, sie alle drei aus dem Weg zu räumen. Mit ihrer Baltimore-Reihe hat die amerikanische Thriller-Autorin Karen Rose ein Millionen-Publikum begeistert. Die Baltimore-Reihe umfasst die folgenden sechs Thriller: - Band 1: "Todesherz" - Band 2: "Todeskleid" - Band 3: "Todeskind" - Band 4: "Todesschuss" - Band 5: "Todesfalle" - Band 6: "Todesnächte"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 806
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Karen Rose
Todesfalle
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Hinter einem Sessel versteckt sich die elfjährige Jazzie vor dem Mann, der eben ihre Mutter im Zorn erschlagen hat. Sie hat ihn sofort erkannt – er aber hat sie nicht gesehen. Kein Wort wird Jazzie sagen, denn nur so kann sie sich und ihre kleine Schwester vor dem Bösen schützen.
Die beiden traumatisierten Mädchen kommen in einem Therapieprogramm unter und fassen langsam Vertrauen zu der jungen Praktikantin Taylor. Taylor ahnt, dass Jazzie weiß, wer ihre Mutter getötet hat. Was Taylor nicht ahnt: Der Killer hat längst beschlossen, sie alle drei aus dem Weg zu räumen.
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Dank
Karen Rose bei Knaur
Eine Liste aller Karen-Rose-Romane in chronologischer Reihenfolge:
Verzeichnis der auftretenden Figuren in den Romanen von Karen Rose
Für meine Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt – danke, dass ihr all die Figuren aus meiner Fantasie so gern mögt wie ich. Dieses Buch ist eine Art »Valentinsgeschenk« an euch.
Für all die Väter und ihre bedingungslose Liebe zu ihren Kindern, auch die Stiefväter, die in ihre Rollen als Papas hineinwachsen, obwohl sie es eigentlich gar nicht müssten, es aber trotzdem tun. Mögen eure Kinder dieses kostbare Geschenk in Ehren halten.
Für meinen Liebsten, meinen Ehemann Martin, der unseren Töchtern stets der wundervollste Dad war, den man sich vorstellen kann.
Prolog
Jazzie Jarvis verlangsamte ihre Schritte, als sie die dritte der vier Treppen zu ihrem Zuhause erklommen hatte. Der Schweiß lief ihr über das Gesicht, und das Gewicht des Rucksacks lastete schwer auf ihren Schultern. Mama hatte vergessen, sie abzuholen. Wieder mal.
Normalerweise machte es ihr nichts aus, und auch der lange Marsch von dem Sommercamp nach Hause war halb so wild, aber die Hitze in Verbindung mit dem schweren Rucksack war schlicht unerträglich. Sie war völlig durchgeschwitzt.
Wenigstens konnte so niemand die Tränen sehen, die sie irgendwann nicht mehr hatte zurückhalten können. Denn Mama hatte es nicht nur versäumt, sie abzuholen, sondern auch den Kunstbasar vergessen. Dabei habe ich es ihr wieder und wieder gesagt. Sie hatte versprochen, dass sie kommen würde. Sie hat es versprochen.
Aber dann war sie nicht aufgetaucht. Über eine Stunde hatte Jazzie an ihrem Tisch gestanden, den Blick auf die Tür geheftet, alle ihre Projekte sorgfältig vor sich ausgebreitet – die Schale, selbst getöpfert, bemalt, glasiert und anschließend gebrannt, die Zeichnungen, mit denen sie sich so große Mühe gegeben hatte, und der hübsche Stein, den sie so lange mit Schmirgelpapier bearbeitet hatte, bis er wie ein Edelstein schimmerte. Alles hatte vor ihr gelegen und nur darauf gewartet, dass Mama es bewunderte.
Aber Mama hatte vergessen zu kommen, und Jazzie hatte nur mit Mühe die Tränen zurückgehalten, während all die anderen Moms und Dads vorbeigeschlendert waren und lächelnd ihre Arbeiten gelobt hatten. Und sie bemitleideten, weil sie die Einzige war, deren Mama nicht gekommen war. Danach hatten die anderen Eltern ihren Kindern geholfen, ihre Sachen zusammenzupacken und im Wagen zu verstauen.
Schicke Autos, weil es ein schickes Sommerlager war. Exklusiv. Und teuer.
Tante Lilah, Mamas Schwester, hatte dafür bezahlt, da Jazzies Mama das Geld nicht länger dafür aufbringen konnte, nachdem ihr Dad sie verlassen hatte. Eigentlich vermisste Jazzie ihn nicht. Er wäre sowieso nicht zum Basar gekommen, dachte sie bitter. Er hatte immer bloß gearbeitet, deshalb hatte sie ihn so gut wie nie zu Gesicht bekommen. Nicht mal sonntags, denn da war er mit Kunden auf den Golfplatz gefahren.
Mama war diejenige gewesen, die sie von der Schule abgeholt, zu Schulaufführungen und zur Zeugnisverleihung begleitet hatte. Aber jetzt … war sie so anders, gar nicht mehr wie früher, schon lange nicht mehr.
Schon seit Dad weg war, vielleicht sogar schon davor. Ihre kleine Schwester Janie konnte sich noch nicht einmal an die glücklichen Zeiten erinnern, selbst Jazzie hatte sie beinahe vergessen.
Während die anderen Eltern zusammenpackten, hatte Jazzie mit trotzig gerecktem Kinn ihre eigenen Sachen eingesammelt. Ihre Augen hatten gebrannt, aber sie war fest entschlossen gewesen, sich nichts anmerken zu lassen … schon gar nicht vor diesen reichen Kids, die sowieso auf sie herabschauten, weil ihre Mama bloß ein schäbiges, altes Auto fuhr.
Dabei war Jazzie früher ebenfalls Kind reicher Eltern gewesen. Bevor ihr Vater weggegangen war. Sie hatten in einem schönen Haus gewohnt und ein schönes Auto gehabt, jede Menge Klamotten, leckere Sachen zu essen. Hungern mussten sie auch jetzt nicht. Das hatten sie Onkel Denny, Dads Bruder, zu verdanken. Das verletzte zwar Mamas Stolz, aber sie ließ es zu, weil sie nicht wollte, dass es Jazzie und Janie an etwas fehlte. Und Tante Lilah sorgte dafür, dass sie Kleider zum Anziehen hatten, zwar keine superschicken Markensachen, denn Tante Lilah war … wie war noch mal das Wort dafür? Ja, genau … bescheiden.
Nicht geizig. Nicht egoistisch. Sondern bloß umsichtig in Gelddingen. Was Mama gerade lernte, weil sie jetzt arbeiten gehen musste und nur wenig verdiente. Sie wohnten in einer kleinen, schäbigen Dreizimmerwohnung im vierten Stock eines Apartmentgebäudes, dessen Aufzug wieder mal kaputt war. Und ihre Großmutter wohnte auch bei ihnen.
Jazzie verzog das Gesicht. Grandma war Daddys Mutter und konnte ziemlich gemein sein. Sie war diejenige, die Tante Lilah als geizig und egoistisch bezeichnete. Bloß weil Grandma dumm war. Sie hatte sich zu viel Geld geborgt und deswegen ihr Haus verloren, und alles nur wegen Jazzies Vater, der kein einziges seiner Versprechen gehalten hatte.
»Arschloch«, murmelte Jazzie und war ziemlich stolz, weil sie nicht gestottert hatte. Kein bisschen. »Arsch. Loch«, wiederholte sie und betonte dabei bewusst beide Silben, wie die Sprachtherapeutin es ihr beigebracht hatte, weil »Arschloch« gleich aus mehreren Lauten bestand, die ihr Mühe bereiteten. Vermutlich wäre die Therapeutin nicht begeistert, ausgerechnet dieses Wort so flüssig aus Jazzies Mund zu hören, aber das war ihr egal. Es war ein verdammt gutes Wort und den Aufwand wert, es zu üben, weil man es immer wieder brauchte. Sogar oft. Vor allem, wenn sie an ihren Vater dachte, was sie in letzter Zeit häufig tat. Seit sie aus ihrem alten Zuhause hatten ausziehen müssen.
Mama hatte mit allen Mitteln versucht, das Haus zu halten, aber ihr Sekretärinnengehalt genügte schlicht und einfach nicht. Dabei war es nicht ihre Schuld, sondern die ihres Dads, der, wenn man ihrer Grandma glauben wollte, immer alles richtig machte und bestimmt schon bald zurückkehren und sich um sie kümmern würde. Dieses »bald« zog sich nun schon fast drei Jahre hin.
Das war eine lange Zeit, wenn man elf war.
Jazzie zog sich am Geländer die letzte Stufe hoch. Sie hatte bloß einen Wunsch: sich aufs Sofa kuscheln und im kühlen Luftzug der Klimaanlage Cartoons schauen.
Auf dem Treppenabsatz blieb sie stehen. Die Wohnungstür stand offen, und Jazzie spürte es. Etwas fühlte sich falsch an … diese bleierne Angst, die sie regelrecht auf der Zunge schmecken konnte. Widerlich. Nach … am liebsten wäre sie in Tränen ausgebrochen. Nach Klo.
Nicht schon wieder, Mama. Nicht heute. Jazzie war todmüde, ihr war fürchterlich heiß, aber sie würde Mama sauber machen müssen. Janie sollte sie nicht so sehen. Auf keinen Fall.
Sie ließ die Schultern sacken, und ihre Augen füllten sich erneut mit Tränen. Verdammt, Mama. Manchmal war ihre Mutter so traurig. Zwar versuchten sie und Janie, sie aufzumuntern, aber nichts schien zu helfen. An manchen Tagen schaffte sie es noch nicht einmal, aus dem Bett aufzustehen, an anderen kam sie früh von der Arbeit nach Hause und trank so lange, bis sie auf dem Sofa einschlief. Das waren die Tage, an denen sie die Vorhänge vollständig zuzog, damit kein Lichtschimmer hereindrang. Dunkle Tage, in mehr als nur einer Hinsicht.
An diesen Tagen sammelte Jazzie die leeren Flaschen zusammen und warf sie in den Müll, dann machte sie ihre Mama sauber und breitete eine Decke über sie, damit es so aussah, als mache sie bloß ein Nickerchen und als sei nicht der Alkohol schuld an ihrem Zustand. Jazzie wollte nicht, dass Janie etwas mitbekam. Mit ihren fünf Jahren verstand ihre kleine Schwester nicht, was es mit diesen dunklen Tagen auf sich hatte.
Und heute stand ihnen wohl wieder einer bevor.
Jazzie würde nach ihrer Mama sehen und dann Tante Lilah anrufen, damit sie Janie aus dem Kindergarten abholte, weil Mama nicht Auto fahren durfte, wenn sie getrunken hatte. Jazzie würde das niemals zulassen. Deshalb musste sie die Schlüssel suchen und verschwinden lassen. Wieder mal.
Allmählich gehen mir die Verstecke aus. Es musste etwas passieren, allerdings konnte sie sich nicht vorstellen, was.
Vorsichtig drückte sie die Tür weit genug auf, um hindurchschlüpfen zu können. Es war dunkel, aber damit hatte sie gerechnet. Ohne den Rucksack abzunehmen, schlich sie auf Zehenspitzen ins Wohnzimmer, damit sie ihre Mutter nicht weckte – sie wusste, wie ungehalten Mama sein konnte, wenn sie getrunken hatte. Sie bahnte sich ihren Weg an den Möbeln vorbei – einige Sachen hatten sie aus dem alten Haus mitgenommen, schicke Möbel, die so gar nicht in den schäbigen Raum passen wollten, aber immerhin waren sie vertraut. Meistens schlief Mama auf dem Sofa … wahrscheinlich, weil sie sonst im selben Zimmer mit Grandma schlafen müsste, da hatte sie selbst es mit Janie als Zimmergenossin noch gut erwischt.
Der Sessel in der Ecke war sozusagen Jazzies Privatbesitz, seit Urzeiten, schon in ihrem alten Haus. Es gab ihr ein Gefühl von Sicherheit, sich darauf zusammenzukuscheln. Außerdem war er perfekt gewesen, um dahinter in Deckung zu gehen, wenn ihre Eltern sich gestritten hatten. Das hatte sie früher oft tun müssen. Vielleicht waren es ja doch nicht so glückliche Zeiten gewesen.
Sie stolperte über irgendetwas und konnte sich in letzter Sekunde an der Sofalehne festhalten, als sie ein lautes Geräusch hörte … ein Rascheln, dann ein Poltern und ein dumpfer Knall. Und dann eine Männerstimme, die fluchte.
Jemand ist hier. Im Garderobenschrank. Jazzie stockte der Atem. Was soll ich jetzt machen? O Gott? Was mache ich bloß? Sie öffnete den Mund, wollte nach ihrer Mama rufen, schloss ihn jedoch wieder. Nein. Verstecken ist besser.
Inzwischen hatten sich ihre Augen an das Dämmerlicht gewöhnt. Sie ging einen Schritt auf ihr Zimmer zu. Vielleicht kann ich mich ja unter dem Bett verstecken. Doch in diesem Moment polterte es erneut im Schrank, und die Tür schwang langsam auf. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Sie ging auf die Knie und kroch hinter den Sessel. Hier würde sie keiner finden, solange es dunkel im Raum blieb.
Bitte mach, dass er das Licht nicht einschaltet. Bitte.
Wieder fluchte der Mann im Schrank. Obwohl seine Stimme gedämpft war, verstand sie, was er sagte. Schlimme Schimpfworte. Und …
O Gott. O Gott. Sie kannte die Stimme. Was hatte er denn hier zu suchen? Wo ist Mama?
Sie konzentrierte sich darauf, ganz flach zu atmen, geräuschlos … bis ihr Blick auf den Fußboden vor dem Sofa fiel. Ein Schuh. Sie war über einen Schuh gestolpert.
Ihr Atem ging schneller, so schnell, dass es in ihrer Brust schmerzte. Mamas High Heel.
An ihrem Fuß.
Wie gebannt starrte sie ihn an, konnte den Blick nicht abwenden. Mamas Rock. Ihr hübsches Kostüm, das sie zu Hochzeiten und Schulfeierlichkeiten trug. Sie hatte sich in Schale geworfen.
Sie wollte kommen, dachte Jazzie. Mama hatte den Kunstbasar also doch nicht vergessen. Aber sie lag auf dem Fußboden. Bewegte sich nicht. Sie ist verletzt. Und ich muss ihr helfen.
Er hat ihr wehgetan. Schon wieder. Wut stieg in ihr auf. Sie wollte ihm auch wehtun. Wollte nach ihm treten, auf ihn einschlagen, bis er sie in Ruhe ließ. Aber er war größer und stärker als sie. Und fieser. Deshalb blieb sie, wo sie war. Warte ab. Warte einfach hier, bis er weg ist. Dann kannst du ihr helfen. Du kannst den Notruf wählen. Und dann Tante Lilah anrufen. Sie wusste immer, was zu tun war. Warte einfach. Warte, bis er weg ist.
Wieder und wieder sagte sie sich die Worte im Geist vor. Aber ihre Mutter lag so regungslos da. Bitte, mach, dass es ihr gut geht. Dass ihr nichts passiert ist. Sie lag zwischen Sofa und Couchtisch, allerdings konnte Jazzie ihr Gesicht nicht erkennen. Und auch nicht, ob sie noch atmete. Sag doch was, Mama. Egal, was. Bitte. Sie starrte sie an, in der Hoffnung auf ein Zucken, ein Stöhnen, irgendetwas. Starrte auf den Rock.
Er war … dunkel. Eigentlich war Mamas Kostüm doch weiß … oder sollte es zumindest sein. Aber es war ganz dunkel, fast schwarz. Voll großer schwarzer Flecke.
O Gott. O Gott. O Gott. Nein. Nein. Blutflecke. Mama war voller Blut. Jazzie presste sich die Hand auf den Mund, um den Schrei zu unterdrücken, der in ihrer Kehle aufstieg. Mich wird er auch finden. Und dann wird er auch mir etwas tun.
Nicht hinsehen! Nicht hinsehen! Sie kniff die Augen zusammen, um ihre Mutter nicht länger auf dem Boden liegen zu sehen. In diesem Moment ertönte ein lautes Poltern, gefolgt von berstendem Glas.
Mamas Sachen. Ihre Schätze. Die Weihnachtsdeko. Er machte alles kaputt. Jacken und Mäntel flogen herum, landeten in einem Haufen auf dem Boden. Er suchte nach etwas. Aber wonach? Und wieso?
»Verdammtes Miststück!«, schimpfte er. »Wo ist es? Wo hast du das verdammte Geld versteckt?« Eine Schachtel landete auf dem Boden. Wieder zerbarst etwas. Jazzie zog sich noch weiter hinter den Sessel zurück. Ihre Gedanken überschlugen sich. Die Schale in ihrem Rucksack, die sie für Mama getöpfert hatte … damit könnte sie ihm eins überbraten.
Aber das wäre völlig idiotisch. Er war viel zu groß. Sie riskierte einen Blick um die Lehne herum, als ein weiterer Fluch ertönte. Nein. Er war immer noch da. Nur noch eine Weile. Halt durch, Mama. Gleich hole ich Hilfe. Sie spähte am Couchtisch vorbei, versuchte im Dunkel zu erkennen, ob Mamas Augen offen waren. Und …
Nein. Nein, nein, nein, nein, nein.
Das … Etwas auf dem Fußboden. Das konnte unmöglich ihre Mama sein. Das war ja noch nicht einmal … ein Mensch. Doch, war es. Sie wusste es. Mama. Ein Schluchzer formte sich in ihrer Kehle. Wieder presste sie sich die Hand auf den Mund. O Gott, Mama. Meine Mama!
In diesem Moment flog die Schranktür ganz auf und knallte gegen die Wand, und dann kam er hereingestürmt.
Jazzie erstarrte. Er war groß, so wie sie ihn in Erinnerung hatte. Aber magerer. Er sah irgendwie … wilder aus. Noch gemeiner. Er trat mit dem Fuß gegen die Sachen, dann beugte er sich über dieses … Etwas auf dem Boden. Ihre Mama.
»Wo hast du das Scheißgeld versteckt?«, schrie er und verpasste ihr einen brutalen Tritt. »Los, mach’s Maul auf!«
Still, ganz still sein. Jazzie hielt den Atem an, versuchte, keinen Laut von sich zu geben.
»Verdammte Scheiße!« Er richtete sich auf und wich ein paar Schritte zurück. Ein entsetzter, verängstigter Ausdruck lag in seinen weit aufgerissenen Augen. »Sie ist tot.« Wieder fluchte er, allerdings schien er jetzt eher durcheinander als wütend zu sein. Offenbar kam er allmählich wieder zu Sinnen. Jazzie wusste noch, wie es früher gewesen war, wie er Mama angeschrien und geschlagen hatte, bis sie in Tränen ausgebrochen war.
Er wich noch weiter zurück, stolperte über den Kleiderhaufen. »O mein Gott, ich habe sie umgebracht«, flüsterte er und blickte auf seine Hände. »O Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße.«
Er holte Luft, stieß sie wieder aus. »Ruhig bleiben. Ganz ruhig. Du kriegst das hin. Du schaffst das.« Er nahm noch ein paar Atemzüge, fluchte ein weiteres Mal, wenn auch leiser. »Wasch dir die Hände. Dann machst du das Waschbecken sauber. Holst deine Jacke. Und dann siehst du zu, dass du hier rauskommst.«
Jazzie kauerte immer noch hinter dem Sessel und wiegte sich vor und zurück. Ihr Gesicht war tränennass. Ihre Zähne bohrten sich in ihre Handkante, und sie schlotterte, als hätte sie Fieber. Doch sie gab keinen Laut von sich. Keinen einzigen.
Sie wusste nur zu gut, was passieren würde, wenn sie es täte.
Sie hörte Wasser rauschen. Ein scharfer Geruch stieg ihr in die Nase, sodass es ihr schwerfiel, nicht zu niesen. Bleichmittel. Genau. Grandma benutzte das Zeug zum Saubermachen, deshalb stand eine Flasche im Schränkchen unter dem Waschbecken.
Er kehrte zurück. Jetzt waren seine Hände sauber. Wie betäubt sah Jazzie zu, wie er ein Kapuzenshirt aufhob. Mit einem Handtuch wischte er alles ab, den Tisch, die Türklinke, das Schloss und die Tür selbst, ehe er es in die Vordertasche seines Hoodies schob. Dann trat er hinaus und zog die Tür hinter sich zu.
Jazzie rührte sich nicht. Sie konnte sich nicht bewegen. Konnte nicht atmen. Stattdessen saß sie bloß da, wiegte sich vor und zurück und starrte auf ihre Mutter, während sie sich sagte, dass das alles bloß ein Traum sein konnte. Ein ganz, ganz schlimmer Traum.
1. Kapitel
»Fersen runter, Janie.« Taylor Dawson stand in der Mitte des Übungsplatzes und beobachtete das fünfjährige Mädchen auf dem Rücken des sanftmütigsten und geduldigsten Pferds, das sie je erlebt hatte. Janie, die ohnehin kerzengerade und stocksteif im Sattel gesessen hatte, presste die Lippen aufeinander, richtete sich etwas weiter auf und umfasste die Zügel noch fester.
Taylor wusste, dass die finstere Miene des Mädchens nicht ihr galt, auch wenn sie beinahe wünschte, es wäre so. Die kleine Perfektionistin in ihren Cowboy-Stiefeln mit Zebramuster ärgerte sich über sich selbst. Weil jemand sie korrigierte. Weil das bedeutete, dass sie nicht bereits perfekt war. Taylor unterdrückte einen Seufzer. Kenne ich nur zu gut. Kurz sah sie zu Janies großer Schwester hinüber, die die Kleine von der anderen Seite des Zauns mit Argusaugen bewachte. Taylor schenkte ihr ein ermutigendes Lächeln, das Jazzie jedoch nicht erwiderte, stattdessen zeichnete sich eine Mischung aus schlecht verhohlener Verzweiflung und wilder Entschlossenheit auf ihrer Miene ab. Mit ihren elf Jahren war sie die Beschützerin ihrer Schwester. Die unerschütterlich stumme Wächterin.
Denn in den zwei Wochen, seit Taylor ihr Praktikum bei Healing Hearts With Horses begonnen hatte, war kein Wort über Jazzie Jarvis’ Lippen gekommen. Und laut Taylors Chefin, Maggie VanDorn, hatte Jazzie auch in den zwei Wochen zuvor nicht gesprochen – seit dem Tag, als sie ihre Mutter in einer riesigen Blutlache vorgefunden hatte, das Gesicht nichts als eine blutige Masse.
Es wird alles wieder gut, würde Taylor sie so gern beruhigen. Für euch beide. Aber das konnte sie nicht versprechen. Niemand konnte das. Jazzie und Janie waren durch eine Hölle gegangen, die kein Kind jemals erleben sollte.
Taylor unterdrückte einen Schauder. Wie sollte jemand so etwas jemals verwinden? Erwachsenen gelang es nur selten, sich von dieser Art Trauma zu erholen. Wie sollten es dann zwei nun mutterlose Kinder schaffen, gesund zu werden, darüber hinwegzukommen?
Aber wenn es einen Ort gab, wo ihnen geholfen werden konnte, dann war es hier. Healing Hearts With Horses bot seit über einem Jahr Pferdetherapie an und konnte schon jetzt beachtliche Erfolge vorweisen – Taylor hatte sich vor ihrer Bewerbung umfassend über das Programm selbst, die Gründerin und Vorsitzende des Vereins, Daphne Montgomery-Carter, und ihr Team informiert.
Hauptberuflich arbeitete Daphne als Staatsanwältin, hatte es aber irgendwie geschafft, in ihrer »Freizeit« Spendengelder für die Einrichtung zu sammeln, und half bei den Therapiestunden aus, wann immer sie Zeit dafür fand, während sich Maggie VanDorn um das Tagesgeschäft kümmerte. Sie war eine versierte Reiterin und ausgebildete Therapeutin mit jahrelanger Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, die Opfer von Gewalttaten geworden waren.
Janies und Jazzies Genesungschancen waren durchaus gut, wenn sie sich gestatteten, sich ein wenig zu entspannen und Spaß zu haben. Könnte Taylor Janie zum Atmen bringen, während sie im Sattel saß, wäre immerhin ein Anfang gemacht, aber Neulinge wurden oft nur noch nervöser, wenn man sie daran erinnerte, nicht die Luft anzuhalten.
Könnte sie Janie dagegen zum Singen bewegen, wäre das Mädchen gezwungen, ganz automatisch tiefer zu atmen, ohne dass sie es mitbekam.
»Hey, Janie«, rief Taylor. »Wusstest du eigentlich, dass Ginger Musik mag?«
Janie musterte Taylor argwöhnisch. »Pferde mögen doch keine Musik.«
»Ginger schon. Sie liebt es sogar, wenn ich ihr etwas vorsinge. Vor allem, wenn ich sie reite. Das entspannt sie, fast wie eine Massage.« Das entsprach zwar nicht ganz der Wahrheit, wirklich gelogen war es aber auch nicht.
Taylor war geübt darin, anderen diese Beinahe-aber-nicht-ganz-Wahrheiten aufzutischen, das hatte sie von der Meisterin der Täuschung und Lüge gelernt. Herzlichen Dank dafür, Mom.
Sie verdrängte ihre aufkeimende Bitterkeit und lächelte Janie zu. »Kennst du zufällig ein schönes Lied?«
Ein vorsichtiges Nicken, aber kein Laut, was keine große Überraschung war. Im Gegensatz zu Jazzie, die keinen Ton sagte, machte Janie zumindest gelegentlich den Mund auf. In den Akten stand, dass Jazzie auch schon vor dem Tod ihrer Mutter eher zurückhaltend gewesen war und sehr unter ihrem Stottern litt, wohingegen Janie normalerweise ohne Punkt und Komma quasselte. Nun allerdings war sie spürbar verschlossener, und ihre Kommunikation beschränkte sich auf knappe, allenfalls aus vier oder fünf Wörtern bestehende Sätze. Nun ja, wer konnte es ihr schon verdenken?
»Kennst du ›Drei Chinesen mit dem Kontrabass‹?«, fragte Taylor und grinste, als Janie die Augen verdrehte – eine herrlich normale Reaktion für ein Kind, das vergessen hatte, sich wie ein Kind zu benehmen.
»Das ist doch was für Babys«, maulte sie.
Genau, und du bist ja schon so steinalt, dachte Taylor traurig, zwang sich jedoch weiterzulächeln. »Okay, wie wär’s dann mit ›Funkel, funkel, kleiner Stern‹? Kennst du das?«
»Logo«, brummte Janie. »Das kennt doch jeder.«
»Gut. Dann lass uns loslegen und Ginger eine Freude machen.« Taylor begann zu singen, aus voller Kehle und fürchterlich schief – leider war ihr kein Gesangstalent in die Wiege gelegt worden. Trotzdem sang sie das ganze Lied einmal allein, während Ginger geduldig im Kreis trottete, Janie immer noch stocksteif im Sattel. Bei der nächsten Runde stimmte das Mädchen jedoch ein.
Ohne zu zögern, ging Taylor zu »You Are My Sunshine« über, in der Hoffnung, dass das Mädchen das Lied ebenfalls kannte, und wurde prompt belohnt, als Janie auch hier mitsang. Nach der zweiten Runde dieses Lieds stellte sich endlich die gewünschte Wirkung ein: Die Anspannung schien aus Janies Schultern zu weichen, und ihr Rücken war nicht mehr ganz so kerzengerade. Sie legte nun auch beim Singen eine entschlossene Konzentriertheit an den Tag, wie bei allem, was sie tat, was zwar auf Kosten des Spaßes ging, aber immerhin atmete sie. Das war ein Anfang.
Taylor durchforstete ihr Gehirn nach den Liedern, die sie als freiwillige Betreuerin während des Studiums mit den Kindern im Sommerlager gesungen hatte, und verwarf sofort all jene, in denen zu viel Gewalt vorkam oder die von Müttern handelten, mit dem Ergebnis, dass … kein einziges übrig blieb. Nichts. Nada. Mist.
Doch Janie löste das Problem selbst, indem sie eine zornig verbissene halblaute Version von »Let it Go« aus Die Eiskönigin anstimmte. Danke schön, Disney, dachte Taylor.
Sie hörte, wie das Tor geöffnet und wieder geschlossen wurde, und Schritte, die zu schwer waren, um von Jazzie zu stammen. Außerdem hatte das Mädchen ohnehin zu große Angst vor Pferden, um sich zu ihnen zu gesellen. Also musste es Maggie VanDorn sein. Die Leiterin des Programms war eine tüchtige ältere Frau mit einem großen Herzen und jahrelanger Erfahrung in Sozialarbeit. Sie trat zu Taylor und drückte ihr eine Flasche kaltes Wasser in die Hand.
»Gute Idee, sie zum Singen zu bringen«, murmelte Maggie.
Taylor freute sich über das Lob. Sie wusste inzwischen, dass Maggie nichts sagte, was sie nicht auch so meinte. »Spaß macht es ihr zwar immer noch nicht, aber wenigstens atmet sie.«
»Es braucht Zeit, bis der Spaß zurückkommt«, meinte Maggie. »Viel Zeit. Apropos – Janies Stunde ist vorbei, und Sie brauchen eine Pause. Sie haben jetzt vier Stunden am Stück unterrichtet, und es wird Zeit, dass Sie eine Weile aus der Sonne kommen.«
»Mir geht’s gut«, gab Taylor zurück. »Ich stamme aus Kalifornien, schon vergessen? Ich bin mit der Sonne groß geworden.«
»Trotzdem«, beharrte Maggie. »Ich will nicht, dass Sie einen Hitzschlag bekommen und ausfallen. Ihr Gesicht ist schon mindestens so rot wie meine Tomaten.«
Taylor hob resigniert die Hände. »Okay, okay.« Sie kippte den Großteil des Wassers hinunter und spritzte sich den Rest ins Gesicht. Es war tatsächlich bullenheiß hier, das musste sie zugeben, heißer als zu Hause in Nordkalifornien, wo das Thermometer selten auf über 26 Grad stieg und Schwüle ein Fremdwort war. Hier dagegen, in diesem Vorort von Baltimore, war die 26-Grad-Marke bereits beim Frühstück geknackt gewesen, und als Höchsttemperatur wurden am Nachmittag über 36 Grad erwartet, außerdem herrschte eine derartige Luftfeuchtigkeit, dass sie wünschte, sie hätte Kiemen.
»Ich sorge dafür, dass Janie absteigt und sich wäscht, und dann bringe ich sie und Jazzie zu ihrer Tante zurück«, sagte Taylor und dachte an die Frau, in deren Augen sich eine Mischung aus Trauer, Angst und Wut spiegelte.
Lilah Cornell hatte an nur einem Tag ihre Schwester verloren und die Verantwortung für ihre beiden Nichten bekommen. Sie hatte früher unter Daphne als Staatsanwältin gearbeitet und war inzwischen auf dem besten Weg, bei der Generalstaatsanwaltschaft Karriere zu machen, was bedeutete, dass sie praktisch rund um die Uhr im Einsatz war.
All das hatte sich schlagartig geändert, als ihre Schwester getötet worden war, doch keiner auf der Farm hatte je ein Wort der Klage von ihr gehört. Immerhin hatte Lilah Hilfe. Der Vater der Mädchen war nicht länger bei der Familie, allerdings hatte seine Mutter Eunice zum Zeitpunkt des Mordes bei Valerie Jarvis und ihren Töchtern gelebt und auf die Mädchen aufgepasst, solange ihre Schwiegertochter bei der Arbeit war. Nach dem Mord war sie gemeinsam mit den beiden in Tante Lilahs schickes, aber zu kleines Apartment gezogen, was für alle Beteiligten eine enorme Umstellung bedeutete. Mittlerweile suchte Lilah nach etwas Größerem für sie alle, was jedoch eine weitere Belastung für die kleine Familie darstellte.
Lilah und Eunice schienen jedoch anständige Menschen zu sein, die die Mädchen von Herzen liebten. Lilah brachte die Mädchen an den Samstagen zur Therapie, während Eunice die Wochentage übernahm.
Taylor deutete auf das Fenster des Farmhauses, von dem aus sich ein Blick auf das diskret mit Mikrofonen ausgestattete Übungsareal bot. »Lilah wartet in der Lounge.«
Daphne und Maggie hatten das Esszimmer des Farmhauses in einen Wartebereich umfunktioniert, von wo aus Eltern und Vormünder ihren Kindern zusehen konnten. Transparenz war bei Healing Hearts oberstes Gebot, zudem rühmte sich das Programm, Kindern und Erwachsenen gleichermaßen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.
Maggie nickte knapp. »Ich kümmere mich um Ginger. Sie hat für heute auch genug. Die Nachmittagsstunden soll Gracie übernehmen.«
»Ja, Ma’am.« Taylor trat zu Ginger und Janie und lächelte, als sie das Mädchen immer noch leise singen hörte. Janie hatte ihren eisernen Griff um die Zügel gelockert und tätschelte Gingers Hals. Zwar lächelte sie nicht, dafür war der angespannte Zug um ihren Mund verschwunden. Kein Kind sollte so angespannt sein. Aber bei Kindern wie Janie war es nun einmal so. Genauso wie bei mir. Bis heute.
Taylor räusperte sich. »Ginger mag dich.«
Das Mädchen nickte ernst. Keine Erwiderung. Stattdessen lag ein Ausdruck zutiefst empfundener Erschöpfung in ihren Augen, als wäre sie es leid, ständig solche Angst haben zu müssen, hätte sich ihr jedoch inzwischen schlicht gebeugt. Auch das kannte Taylor nur allzu gut. Sie hatte diesen Ausdruck schon so oft im Spiegel gesehen.
»Höchste Zeit, aus dem Sattel zu steigen und etwas Kaltes zu trinken. Okay!« Taylor streckte die Arme aus, um das Mädchen aufzufangen, falls es fiel, doch Janie stieg mühelos ab und stand einen Moment lang reglos da, den Blick wie gebannt auf die Stute geheftet. Dann schlang sie zu Taylors Verblüffung die Arme um Ginger und streckte sich, um dicht an ihr Ohr zu kommen.
»Ich mag dich auch«, flüsterte sie.
Taylor blickte zu Maggie hinüber, deren Miene eine zärtliche, zugleich eindringliche Befriedigung verriet. Es lag auf der Hand, dass Janie einen Durchbruch geschafft hatte. Und ich durfte ihn miterleben, dachte Taylor, deren Augen brannten.
Allerdings gab sie sich nicht der Illusion hin, für diesen Durchbruch verantwortlich zu sein, nein, Maggie VanDorn war diejenige, die ganze Arbeit geleistet hatte, trotzdem teilte sie ihre Zufriedenheit. Danach konnte man süchtig werden. Das Problem ist bloß, dass ich nicht bleiben werde.
Eigentlich war sie nicht mit der Absicht nach Maryland gekommen, das Praktikum in voller Länge zu absolvieren oder länger als ein paar Tage zu bleiben, doch die kleinen Patienten von Healing Hearts hatten sie schneller und tiefer in ihren Bann gezogen, als sie vermutet hatte. Es würde verdammt schwer werden, alldem den Rücken zu kehren, sobald sie erledigt hatte, weshalb sie hergekommen war.
Gage Jarvis legte seine Krawatte um den Kragen seines nagelneuen Hemds und hätte fast geseufzt, als sich der matt glänzende Stoff an seine Haut schmiegte und die Krawattenseide mühelos durch seine Finger glitt.
Wie lange hatte er schon keine Krawatte mehr getragen? Wie lange kein richtiges Hemd mehr, verdammt?
Seine Finger kämpften mit dem Windsorknoten. Er wusste es genau: zwei Jahre, neun Monate und vierzehn Tage – an diesem Tag war er bei Stegner, Hall and Kramer gefeuert worden. Natürlich hatten sie behauptet, er sei aus freien Stücken gegangen, um sich »neuen Aufgaben zu widmen«, aber in Wahrheit hatte man ihn hinausgeworfen, weil er genau dasselbe getan hatte, was jeder Anwalt in der Kanzlei tat. Diese scheinheiligen, überheblichen, bigotten Arschlöcher. Verurteilen mich. Mich! Er war der Star unter den Juniorpartnern gewesen, hatte mehr Mandanten an Land gezogen als alle anderen. Mehr als fast alle anderen zusammen. Was ihm das Lob der Partner eingebracht hatte … bis Valerie zum Handy gegriffen und die Cops gerufen hatte. Häusliche Gewalt. Dieses elende Miststück.
Verdammt, an dem Tag hatte er ihr noch nicht einmal so sehr wehgetan. Und es tat ihm keineswegs leid. Sie hatte es verdient gehabt, wie immer. Er hätte sie viel schlimmer zurichten können, hätte dasselbe tun können wie vor einem Monat – sie verprügeln, bis sie nicht mehr aufgestanden war. Nie wieder. Das hätte ich schon vor zwei Jahren, neun Monaten und vierzehn Tagen tun sollen. Damit wäre uns allen eine Menge Ärger erspart geblieben.
Damals war sie eingeknickt und hatte ihre Anzeige zurückgezogen. Aber es war nicht genug und noch dazu zu spät gewesen. Die Partner hatten eine Durchsuchung seines Büros angeordnet, bei der sein Vorrat in der Schreibtischschublade gefunden worden war – zwar versteckt, trotzdem hatten sie ihn auf der Stelle gefunden, weil alle anderen ihre Vorräte an exakt derselben Stelle bunkerten.
Er hatte ab und zu mal eine Line genommen. Na und? Alle anderen taten doch genau dasselbe. Sie brauchten das Koks, um die extremen Arbeitszeiten zu bewältigen und im harten Konkurrenzkampf den Kopf über Wasser zu halten. Zu viele Möchtegernpartner, zu wenige freie Stellen. Die beschissenen Seniorpartner mussten entweder in Rente gehen oder den Löffel abgeben, bevor einer der Nachwuchssklaven den sprichwörtlichen Schlüssel zur Cheftoilette bekam. Denn bei Stegner, Hall and Kramer gab es diese Schlüssel noch, und Gage hatte unbedingt einen gewollt.
Und er hätte ihn auch bekommen, hätte Valerie nicht ihre bösartigen Lügen über ihn verbreitet. Und ihre Schwester. Das werde ich Lilah nie vergessen. Niemals! Aus eigenem Antrieb hätte Valerie nie im Leben die Polizei gerufen, nein, das hatte er einzig und allein Lilah zu verdanken.
Dieses verdammte Miststück hat mein beschissenes Leben zerstört. Aber er würde dafür sorgen, dass seine Schwägerin bis aufs Blut gedemütigt und abserviert, ihr Leben zerstört werden würde, so wie seines ihretwegen ruiniert war. Immerhin war Valerie aus dem Weg. Das musste reichen. Vorerst.
Ich bin wieder hier. Zurück in seiner alten Stadt und bereit, sich sein altes Leben zurückzuholen. Nein, nicht mein altes Leben. Sondern ein viel cooleres.
Denn er hatte einen neuen Job. Einen besseren als den alten. Schon bald hätte er wieder ein Spesenkonto, konnte essen gehen und …
Er ertappte sich dabei, wie er mit finsterer Miene in den Ganzkörperspiegel starrte, und verzog abrupt das Gesicht zu einem Lächeln. Schon besser, dachte er, voller Dankbarkeit, dass er nie auf Meth umgestiegen war, so wie dieser Romano. Er hatte zwar ein paar Narben von den Einstichstellen im Arm und schniefte ab und zu, aber seine Zähne waren nach wie vor perfekt.
Mit einem befriedigten Nicken ließ er den Blick über sein Spiegelbild schweifen. Der Anzug mochte nicht derselbe edle Zwirn sein wie früher, trotzdem stellte er eine enorme Verbesserung zu den letzten Jahren dar. Er passte – nicht wie angegossen, aber besser als noch vor einem Monat –, und das weiße Hemd ließ seine Sonnenbräune noch satter wirken. Die Bräune, die er sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Florida ehrlich verdient hatte, indem er den Strand jeden Morgen für die Gäste aufhübschte. Der Job hatte ihm geholfen, nicht wie … eine wandelnde Leiche auszusehen. Er mochte immer noch dünn sein, aber wenigstens nicht mehr wie ein Skelett.
Der letzte Monat in der Versenkung war unangenehm gewesen, aber er hatte die Zeit genutzt, um wieder in Form zu kommen, und die Mühe hatte sich ausgezahlt. Er wirkte kräftiger, beinahe gesund. Jünger. Das gefärbte Haar und der Bart waren zunächst eine praktische Notwendigkeit gewesen. Nach Valerie … nun ja, niemand hatte mitbekommen sollen, dass er wieder in der Stadt war.
Inzwischen gefiel ihm jedoch der Bart. Mit dem Daumen strich er sich übers Kinn – gerade stoppelig genug, um ihn wie einen Piraten aussehen zu lassen, verdammt sexy und ein ganz klein wenig verrucht. Wieder hielt er kurz inne, ließ die Arme sinken, ehe er aus purer Nervosität einen der Knöpfe seines Anzugs schloss.
Ja, er war nervös. Und ein echt mieser Typ. Ja, genau. Seit sein Leben aus den Fugen geraten war, hatte er ein paar Dinge tun müssen, auf die er keineswegs stolz war. Aber jetzt war er wieder auf dem aufsteigenden Ast. Er zupfte am Saum seines Jacketts und wischte einen Fussel vom Revers. Der heutige Morgen hatte das Ende dargestellt, das Letzte, was er noch hatte tun müssen.
An diesem Morgen hatte er die losen Enden gekappt, dafür gesorgt, dass Valerie und ihr – immer noch offiziell ungelöster – Mordfall endgültig zu den Akten gelegt werden konnte. Eigentlich hatte er es nicht auf diese Weise tun wollen, aber die Polizei von Baltimore hatte ihm keine andere Wahl gelassen. Ein Monat war vergangen, seit Valerie ihre gerechte Strafe bekommen hatte, und er hatte dem Baltimore Police Department wenige Tage später einen Verdächtigen praktisch auf dem Silbertablett serviert, aber diese Faulpelze hatten keine Anstalten gemacht, ihn festzunehmen.
Worauf zum Teufel warteten diese Typen eigentlich? Auf eine schriftliche Einladung in Goldbuchstaben, verdammt noch mal?
Ganz offensichtlich hatten sie Zweifel. Aber das war nicht länger sein Problem. Er hatte so lange gewartet, wie er nur konnte. Über einen Monat hatte er ihnen Zeit gegeben, Herrgott noch mal, aber am Montag musste er seinen neuen Job antreten, und das würde er bestimmt nicht mit einer drohenden Mordanklage tun. Also hatte er ein bisschen nachgeholfen, sein Geschenk mit einem hübschen Schleifchen versehen und dafür gesorgt, dass sie es fanden.
Mit angespanntem Kiefer starrte er sein Spiegelbild an. Zugegeben – das Ganze war nicht gerade sauber über die Bühne gegangen, stattdessen war es sogar zu einem unvorhergesehenen Kollateralschaden gekommen. Aber es gab keine Zeugen, und er hatte sicherheitshalber eine Maske getragen. Er hatte den Polizeifunk abgehört und wusste, dass es keine Fahndung gab, also hatte niemand mitbekommen, was er heute getan hatte.
Er bereute es nicht. Es war notwendig gewesen. Unmittelbar nach seiner Rückkehr in die Stadt hätte er die Scheißbullen am Hals gehabt, aber jetzt war alles klar. Er konnte offiziell »zurückkommen«, seine Mutter besuchen und hätte die perfekte Antwort auf ihre Frage parat, wo er den ganzen letzten Monat gesteckt hatte.
In der Entzugsklinik. Logo. Dank seines Bruders hatte er sogar einen konkreten Ort und Leute, die ihn dort gesehen hatten. Er war in einer Entzugsklinik in Texas gewesen.
Natürlich würde sie es ihm abkaufen. Sie war stets bereit, nur das Beste von ihm zu denken.
Sie war dumm wie Bohnenstroh. Andererseits traf das auf die Mehrzahl der Menschen zu.
Zum Glück nicht auf mich.
Was bedeutete, dass er Valeries Töchter besuchen und seiner Trauer Ausdruck verleihen musste. Er schnaubte verdrossen. Das wurde von ihm erwartet. Es würde seltsam aussehen, wenn er es nicht täte. Also würde er in den sauren Apfel beißen und die Brut dieses Miststücks besuchen.
Er würde sich sogar um sie kümmern. Ihnen mit Geld unter die Arme greifen. Sobald er wieder flüssig war, was noch eine ganze Weile dauern würde. Bis dahin musste Tante Lilah eben einspringen, schließlich hatte sie auch das Sorgerecht für die beiden.
Ein scharfes Klopfen an der Tür der Umkleidekabine riss ihn aus seinen Gedanken.
»Sir?« Es war der Verkäufer, ein unscheinbarer, grauhaariger Typ, den Gage bewusst ausgewählt hatte, weil er wusste, dass er dem Mann noch nie vorher begegnet war. Niemand sollte wissen, dass er hier gewesen war, er wollte nicht gezwungen sein, noch mehr lose Enden zu kappen.
Vorsichtig stieß er seinen angehaltenen Atem aus. »Ja?«, fragte er mit neutraler Stimme.
»Ich wollte nur hören, ob Sie vielleicht etwas brauchen.«
»Nein.« Gage schlüpfte aus dem Jackett und zog die Krawatte aus dem Kragen. »Ich nehme alles«, sagte er und überlegte, ob er den neuen Anzug gleich anbehalten oder in seine alten Sachen – Poloshirt und Freizeithose aus dem hiesigen Secondhandgeschäft, beides makellos sauber und so gut wie neu – schlüpfen sollte. Gebrauchte Klamotten kaufen zu müssen, war ihm enorm schwergefallen, aber die Kleider waren immer noch brauchbarer als die Fetzen, die er in Miami in seine Reisetasche gepackt hatte. All seine Sachen waren entweder fadenscheinig oder bürountauglich – ausrangierte Klamotten aus dem T-Shirt-Shop an der Promenade, wo er hier und da schwarzgearbeitet hatte.
»Wunderbar«, erklärte der Verkäufer erfreut. »Und wie möchten Sie gern bezahlen?«
Gages Blick fiel auf seine Hose. Er grinste. In seiner Tasche steckte ein Bündel Zwanziger, gewechselt aus einem Bündel kleinerer Scheine, die er sich am Morgen besorgt hatte, als er dem BPD einen Verdächtigen präsentiert hatte, den sie unmöglich noch länger ignorieren konnten.
Ein unglücklicher Kollateralschaden, das stimmte, zugleich jedoch ein glücklicher Geldsegen.
»In bar«, antwortete er.
Ich bin wieder da. Ich kriege alles zurück. Und ich werde nicht zulassen, dass es mir jemand wieder wegnimmt. Nie wieder.
Taylor begleitete die schweigende Janie in den Stall, wo sie ihren Helm verstauen und sich Hände und Gesicht waschen konnte. Jazzie wartete solange draußen und nahm Janie bei der Hand, während sie zum Haupthaus gingen. Keines der Mädchen sagte ein Wort.
Bis sie eintraten. Taylor blieb einen Moment stehen und unterdrückte ein wohliges Stöhnen, weil sich der Luftzug der Klimaanlage nach der sengenden Hitze so herrlich anfühlte.
»Ms T-Taylor?« Es war das erste Mal, dass Taylor Jazzies Stimme hörte.
Taylor gab sich alle Mühe, sich ihren Schock nicht anmerken zu lassen, als sie sich hinunterbeugte, um Jazzie in die Augen zu blicken. Mit ihren einen Meter fünfundsiebzig überragte sie die Kinder zumeist. »Ja, Jazzie?«
Jazzies Blick war starr, und sie schluckte hörbar, während sie zuerst ihre Schwester, dann Taylor ansah. »D-D-Danke«, flüsterte sie.
Gerührt richtete Taylor sich auf und merkte erst jetzt, dass sie unwillkürlich den Atem angehalten hatte.
»Gern geschehen«, flüsterte sie, ehe sie aus einem Impuls heraus die Arme um Jazzies magere Schultern legte. »Ich habe auch meine Mom verloren, vor nicht allzu langer Zeit, und es hat furchtbar wehgetan. So sehr.«
Das war die reine Wahrheit, denn obwohl Donna Dawson Taylor ihr ganzes Leben lang angelogen hatte, war sie ihr in tiefer Liebe verbunden gewesen. »Ich vermisse sie jeden Tag. Ihre Stimme, ihren Geruch, ihr Lächeln und ganz besonders ihre Art, mir zu sagen, dass sie mich lieb hat. Manchmal fehlt sie mir so sehr, dass es sich anfühlt, als würde ein Riese auf meiner Brust sitzen und die ganze Luft aus mir herauspressen. So als könnte ich nie wieder tief durchatmen.« Sie wählte ihre Worte mit Bedacht und folgte auch jetzt ihrem Instinkt, sprach aus, wovon sie sich wünschte, jemand hätte all das zu ihr gesagt. »Und manchmal wünsche ich mir, der Riese würde noch fester zudrücken, weil ich dann meine Mom wiedersehen könnte.«
Die Art, wie sich Jazzies Schultern versteiften, verriet Taylor, dass sie ins Schwarze getroffen hatte. Eine Sekunde verstrich, dann noch eine, dann spürte Taylor Jazzies Arme um ihre Taille. Das Mädchen vergrub das Gesicht an Taylors Seite, und ihr Körper wurde von Schluchzern geschüttelt, die einem das Herz brachen.
Taylor ging auf die Knie, drückte das Mädchen an sich, wiegte es sanft in den Armen, strich ihr übers Haar. »So ist es gut. Wein nur, solange du willst. Es ist in Ordnung.«
Nach ein paar Minuten verebbten die Schluchzer, doch Jazzie machte keine Anstalten, Taylor loszulassen, die ihr weiter übers Haar strich und sich erinnerte, wie sehr sie nach dem Tod ihrer eigenen Mutter eine Umarmung gebraucht hatte. Und wie dankbar sie gewesen war, als ihr Vater seine eigene Trauer verdrängt hatte, um sie zu trösten.
»Ich weiß, wie sehr du leidest«, flüsterte sie Jazzie ins Ohr. »Ich weiß, wie sehr Janie leidet. Es ist in Ordnung, wenn es wehtut. Hörst du, was ich sage?« Sie wartete, bis Jazzie nickte. »Gut, denn das ist sehr wichtig. Es ist in Ordnung, wenn es einem nicht gut geht. Trotzdem freue ich mich, dass Janie heute ein klein wenig Spaß hatte. Es bedeutet, dass der Riese einen Moment lang von ihrer Brust heruntergestiegen ist und sie atmen konnte. Vielleicht kannst du ja auch mal ein bisschen durchatmen, wenn du ihr zusiehst. Aber später, wenn der Riese dann plötzlich wieder da ist, darfst du keine Angst haben. Es heißt nicht, dass eine von euch etwas falsch gemacht hat. Es heißt nicht, dass das, was heute passiert ist, nichts zählt oder nicht wichtig war. Der Riese kommt und geht, aber irgendwann werden die Abstände, in denen er auftaucht, immer länger. Und dann kannst du wieder atmen. Und es wird nicht mehr ganz so sehr wehtun.«
Wieder nickte Jazzie, ehe sie sich von Taylor löste. Sie trat einen Schritt zurück und stand da, den Blick gesenkt, weil sie sich für ihren Gefühlsausbruch schämte. Behutsam hob Taylor mit dem Finger ihr Kinn an, damit das Mädchen ihr in die Augen sehen musste.
»Ich habe sehr oft geweint, als meine Mutter gestorben ist«, flüsterte Taylor und strich behutsam mit den Daumen über Jazzies Wangen. »Und ich war schon zweiundzwanzig.« Und meine Mutter wurde nicht brutal erschlagen. Ich hatte immerhin Gelegenheit, mich von ihr zu verabschieden. »Deshalb braucht es dir nicht peinlich zu sein, wenn du weinen musst.«
Jazzie nickte schniefend. Ihre dunklen Augen waren rot gerändert. Taylor zog eine ihrer Visitenkarten heraus. »Sie ist ein bisschen zerknittert, aber meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse stehen drauf. Du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du oder Janie etwas braucht, okay?«
Jazzie steckte die Karte ein, wandte sich ab und ging zu Janie und ihrer Tante, die bereits warteten. Lilah hielt die Hand auf die Brust gepresst, und auf ihren Wangen glitzerten ebenfalls Tränen. »Danke«, sagte sie mit einem zittrigen Lächeln, nahm ihre Nichten bei der Hand und führte sie hinaus.
Taylor erhob sich langsam. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Ich konnte helfen. Zumindest ein wenig. Und es hat sich viel zu gut angefühlt. Sollte also mein sorgsam ausgeklügelter Plan den Bach runtergehen, bleibt mir immerhin noch dieser Moment.
Schritte ertönten hinter ihr, zerstörten die Bittersüße des Augenblicks. Ihr blieb der Bruchteil einer Sekunde, um die Wärme eines menschlichen Körpers wahrzunehmen, ehe zwölf Jahre Selbstverteidigung ihre Wirkung zeigten, während die Stimme ihres Vaters in ihrem Kopf widerhallte.
Nummer eins auf den Solarplexus. Sie riss den Ellbogen nach hinten, spürte, wie er auf etwas Hartes traf, während ein Stöhnen an ihre Ohren drang. Mit geballten Fäusten wirbelte sie herum und sah einen großen, schlanken Mann, als ihre Rechte auch schon auf seinem Kinn landete. Nummer zwei aufs Kinn.
Sie ignorierte den Schmerz, der durch ihre Fingerknöchel schoss, als ihre Faust Kontakt mit dem betonharten Knochen machte, und folgte dem Ablauf, den man ihr beigebracht hatte. Nummer drei auf die Brust. Mit beiden Händen stieß sie gegen seine Brust, streifte die Bauchmuskeln unter seiner Haut.
Taylor hörte die tiefe Stimme, den wilden Fluch, der über seine Lippen kam, während ein scharfer, brennender Schmerz durch ihren Arm fuhr. Nummer vier – lauf um dein Leben!
Ein Schrei stieg in ihrer Kehle auf, als sie kehrtmachte, um sich in Sicherheit zu bringen. In diesem Moment ertönte ein dumpfes Poltern, der den Fußboden erzittern ließ. Der Kerl war geradewegs auf dem Hinterteil gelandet und blickte mit verblüffter Ungläubigkeit und erhobenen Händen zu ihr auf.
Sie stand da, spürte, wie ihre Angst allmählich nachließ, als das Adrenalin in ihren Adern verebbte und ihr Verstand wieder zu funktionieren begann. Du bist in Sicherheit. Du bist hier, auf der Farm. Auf der Farm.
In diesem Moment stieg eine neue, andere Art der Angst in ihr hoch. O Gott, was habe ich getan … wen habe ich … Ein Wimmern stieg in ihrer Kehle auf, kollidierte mit dem Schrei, der immer noch darin steckte, weshalb ihr lediglich schwere Atemzüge über die Lippen kamen.
Der Mann rappelte sich auf und massierte sich den Kiefer. Er betrachtete sie, als sei sie ein waidwundes Tier. Was durchaus nachvollziehbar war.
Er war groß, schätzungsweise gut fünfzehn Zentimeter größer als sie, hatte kurzes blondes Haar, breite Schultern und ein auffallend attraktives Gesicht, dessen Züge wie gemeißelt wirkten. Das reinste Model. Er schien etwa so alt zu sein wie sie, seine Augen wirkten allerdings deutlich älter.
Und sie hatte ihn umgenietet. O Gott. Erst jetzt merkte sie, dass ihr der Mund offen stand. Eilig klappte sie ihn zu. Diesmal gelang es dem Wimmern, sich um den Schrei in ihrer Kehle herumzumogeln. Erschrocken schlug sie sich die Hand auf den Mund.
»Brr! Immer schön ruhig«, sagte er leise. »Ich wollte Sie nicht erschrecken. Es tut mir leid.«
Moment mal. Taylor runzelte die Stirn. Hatte er ernsthaft »Brrr« gemacht? Ihr Entsetzen schlug in Verärgerung um. Ernsthaft? Nicht nur der Laut an sich ärgerte sie, sondern vor allem die Tonlage, tief und leise – genau dieselbe, die sie benutzte, um ängstliche Pferde zu beruhigen.
Ich bin kein Pferd, Freundchen, hätte sie ihm am liebsten an den Kopf geworfen. Andererseits hatte er sich entschuldigt, außerdem war sie aus einem bestimmten Grund auf die Farm gekommen, und der Kontakt zu den Leuten dort war Teil ihres Plans. Also, reiß dich zusammen. Sie ließ die Hände sinken und bewegte ihre schmerzenden Finger.
Mit einem angedeuteten Lächeln sah sie auf und blickte in ein Augenpaar im wunderschönsten Blau, das sie jemals gesehen hatte. So blau wie …
Verdammt! Wieder erfasste sie blankes Entsetzen, als ihr aufging, wen sie vor sich hatte. Seine schönen blauen Augen hatten exakt dieselbe Farbe wie die ihrer Chefin. Der Mann, der vor ihr stand, war Daphne Montgomery-Carters Sohn, Ford Elkhart.
Ich habe dem Sohn meiner Chefin einen Kinnhaken verpasst. Ich werde gefeuert. In diesem Moment mischte sich etwas anderes unter ihr Entsetzen. Erkenntnis. Ford war von einem einwöchigen Campingausflug zurück, mit dem Dillon, einer der Stallburschen, seinen Junggesellenabschied gefeiert hatte. Genau darauf hatte sie gewartet.
Sie waren zurück. Alle zusammen. Ihr Magen zog sich zusammen. Showtime.
2. Kapitel
Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Die Wut in den dunklen Augen, die auf Ford gerichtet waren, ließ die Frage auf seinen Lippen ersterben. Er sah zu, wie die Erkenntnis in ihnen aufflackerte, ehe die hübsche junge Frau vor ihm eine betont ausdruckslose Miene aufsetzte.
Hör auf, hier herumzustehen und sie wie der letzte Schwachkopf anzustarren. Los, sag etwas. Er riss sich zusammen und blickte auf ihre Hände, um sicherzugehen, dass sie nicht neuerlich die Fäuste geballt hatte. Sie hatte eine schlagkräftige Rechte. »Sie müssen Taylor Dawson, die neue Therapeutin, sein.«
Sie nickte zögerlich. »Zumindest noch so lange, bis Maggie mich hochkant feuert.« Sie stieß einen nahezu lautlosen Seufzer aus. »Es tut mir wahnsinnig leid. Habe … habe ich Sie verletzt?«
Er spürte, wie ihm die Röte ins Gesicht stieg. »Nur meinen Stolz durch die Frage.« Er lächelte und registrierte erleichtert das amüsierte Zucken um ihren Mund. »Keiner feuert hier jemanden. Das war meine Schuld. Ich hätte nicht einfach hinter Sie treten dürfen. Vor allem nicht hier, wo es so viele Menschen gibt, die Opfer von Gewalt geworden sind.«
»Sie haben mich erschreckt«, gestand sie leise. »Trotzdem … ich muss Maggie sagen, was ich getan habe.«
»Nicht, wenn wir einfach noch mal von vorn anfangen.« Ford streckte die Hand aus. »Hi, Taylor. Ich bin Ford Elkhart. Sie müssen die neue Therapeutin sein.« Er atmete auf, als sie seine Hand kräftig schüttelte und dann den Arm wieder sinken ließ. »Freut mich.«
Ihr Griff war fest, ihre Haut dagegen butterweich. Und Ford konnte nur staunen, dass es ihm aufgefallen war. Es war lange her, seit ein weibliches Wesen ihn so nervös gemacht hatte; und daran, dass es beim letzten Mal ein geradezu katastrophales Ende genommen hatte, wollte er jetzt lieber nicht denken.
Taylor lächelte. Obwohl sie kaum merklich die Lippen verzog, war es ein aufrichtiges Lächeln. »Noch bin ich keine richtige Therapeutin, sondern mache bloß ein Praktikum. Mir fehlt nach wie vor die Zulassung.«
Was er natürlich gewusst hatte. Dass sie ihn einfach hatte umnieten können, hatte ihn völlig aus dem Konzept gebracht. Das und die Tatsache, wie ihre Augen zu leuchten begannen, sobald sie lächelte. »Ich weiß. Meine Mutter hat mir erzählt, dass Sie gerade das Grundstudium hinter sich haben und als Nächstes Ihr Aufbaustudium in Angriff nehmen wollen. Meine Mutter ist Daphne.«
Ihr Lächeln schlug in ein Grinsen um. Und ein verschmitztes Glitzern erschien in ihren dunklen Augen. »Weiß ich. Ihre Mutter redet gern über Sie. Oft.«
Ford registrierte, wie seine Wangen wieder heiß wurden. »Mist.«
Ihr leises Lachen besänftigte ihn sofort wieder. »Sie ist sehr stolz auf Sie, und das soll auch jeder wissen.« Ihr Lächeln verblasste, als sich ein Anflug von Traurigkeit daruntermischte. »Sie können sich glücklich schätzen, sie zu haben.«
Ford runzelte die Stirn. »Ihre Mom lebt nicht mehr«, bemerkte er nach kurzem Zögern. »Ich habe gehört, was Sie zu Jazzie gesagt haben.«
»Wir haben sie vor anderthalb Jahren verloren.« Sie verzog das Gesicht. »Krebs.«
»Tut mir leid«, murmelte er. »Meine Mutter hatte auch Krebs. Das hat uns allen einen mächtigen Schreck eingejagt, aber am Ende hatten wir Glück.«
»Wir nicht«, erwiderte Taylor tonlos, ehe sie tief Luft holte. »Ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Meine Pause ist vorbei. Maggie duldet keine Verspätungen.«
»Ich glaube nicht, dass Sie es Ihnen allzu krummnimmt«, sagte Ford ruhig, trat jedoch zur Seite, um Taylor durchzulassen. »Sie schien ja ziemlich begeistert von Janies Fortschritten heute zu sein. Die Kleine kommt seit über einem Monat her, und wir haben sie noch nie so entspannt gesehen. Deshalb ist Maggie bestimmt der Ansicht, dass Sie Ihre Pause redlich verdient haben.«
Taylor kniff ihre dunklen Augen zusammen. »Sie haben mich beobachtet?«
Seine Wangen begannen, noch heißer zu glühen. »Ja, zumindest am Ende. Meine Mutter hat mir erzählt, dass Sie mit Janie draußen seien, und ich muss zugeben, dass mich die Neugier getrieben hat.«
Eigentlich hatte er sich Janies Therapiestunde ansehen wollen, sich dann jedoch dabei ertappt, wie sein Blick auf dem Rücken der schlanken jungen Frau mit dem dunklen geflochtenen Zopf unter der Oakland-Raiders-Mütze hängen geblieben war, wie gebannt von der Anmut und zugleich Entschlossenheit, mit der sie sich bewegte. Er hatte den Blick nicht von ihr wenden können. Und als Janie Ginger die Arme um den Hals geschlungen hatte …
Nun ja, Janies Tante Lilah war nicht die Einzige gewesen, die sich eine Träne abwischen musste. Normalerweise hätte er sich zurückgezogen, bevor die beiden kleinen Mädchen hereingekommen wären, weil er sie unter keinen Umständen erschrecken wollte, aber in diesem Fall war er dageblieben – und war froh darüber. Aber abgesehen von Janies großem Fortschritt, war der Sprung, den Jazzie heute gemacht hatte … geradezu gewaltig. Selbst in seiner Ecke waren ihm das freimütige Vertrauen des Mädchens und die Rührung in Taylors Augen nicht entgangen.
Taylor musterte ihn. »Neugierig, worauf?«
»Auf die neue Praktikantin, von der meine Mutter und Maggie so begeistert sind.« Er schob die Hände in die Hosentaschen, um sich daran zu hindern, den Schweiß im Nacken abzuwischen. »Jedenfalls haben Sie das toll gemacht. Ich habe vom ersten Tag an hier ausgeholfen, und die Jarvis-Mädchen gehören definitiv zu den Patienten, die schwer zu knacken sind.«
»Sie vermissen ihre Mutter«, sagte Taylor betrübt. »Ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie es für sie gewesen sein muss, ihre Leiche zu finden.«
»Und zu wissen, dass der Mörder nach wie vor frei herumläuft«, bestätigte er grimmig. Zwar waren Ermittlungen eingeleitet worden, doch zu einer Verhaftung war es bislang noch nicht gekommen.
»Stimmt. Ich habe es in der Akte gelesen.«
»Janie scheint das nicht zu belasten, aber Jazzie ist alt genug, um zu verstehen, was es bedeutet.«
Mit einem resignierten Seufzer schloss Taylor die Augen. »Zu verstehen. Angst zu haben. Und sich ständig zu fragen, ob er einem irgendwo auflauert. Ob er hinter einem Baum steht und nur darauf wartet, herauszuspringen und einen zu packen.«
Etwas an ihrem Tonfall ließ ahnen, dass sie sehr genau wusste, wie sich diese Angst anfühlte, und mit einem Mal war ihre Reaktion auf seine Gegenwart nachvollziehbar. Er wollte sie danach fragen, doch in diesem Moment schlug sie abrupt die Augen wieder auf, und der Ausdruck in ihren Augen ließ die Frage auf seinen Lippen ersterben.
Qual, dachte er. Etwas quält sie schrecklich.
»Ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie es sein muss, solche Angst zu haben«, sagte sie schnell – eine glatte Lüge, denn sie brauchte es sich nicht vorzustellen, sondern kannte dieses Gefühl nur zu gut, daran hatte er nicht den geringsten Zweifel. Trotzdem beschloss er, nicht weiterzubohren, denn sie schien durchaus ihre Gründe zu haben, weshalb sie ihm die Unwahrheit erzählte.
»Aber Sie wissen, wie es ist, seine Mom zu vermissen«, sagte er.
»Ja, deshalb habe ich mich in sie hineinversetzt. So weit, so gut.« Sie legte den Kopf schief, wobei die Sonne den rötlichen Stich in ihrem Haar aufschimmern ließ. »Wieso haben Sie sich in den Schatten versteckt?«
»Das habe ich gar nicht, sondern wollte nur Jazzie aus dem Weg gehen.« Ford seufzte. »Sie hat Angst vor Männern.«
Taylor sog scharf den Atem ein. »Hat ihr jemand etwas getan?«
Ford zuckte mit den Schultern. »Sie redet ja nicht, und in ihrer Akte steht offiziell nichts. Aber die Männer hier haben gelernt, sich von ihr fernzuhalten. Sie ist kräftiger, als sie wirkt, außerdem ist ihr rechter Haken nicht von schlechten Eltern«, fügte er wehmütig hinzu. »So wie Ihrer.«
Taylor sah ihn verblüfft an. »Sie ist auch auf Sie losgegangen?«
»Nicht auf mich, sondern auf Cole, meinen Bruder. Er hat sie erschreckt, als sie auf Janie aufgepasst hat. Jazzie mag erst elf sein, ist aber eine echte Glucke. Sie lässt Janie keine Sekunde aus den Augen.«
»Das ist mir auch schon aufgefallen. Und was ist mit Ihrem Bruder vorgefallen?«
»An dem Tag waren die Mädchen das erste Mal hier und entsprechend aufgeregt. Die reinsten Nervenbündel. Janie hat geweint, und Jazzie wollte sie trösten. Cole wollte bloß helfen, ist ihr dabei aber unabsichtlich zu nahe gekommen, deshalb ist sie auf ihn losgegangen. Sie hat ihm einen Hieb verpasst, und zwar so fest, dass er ein paar Schritte rückwärtsgetaumelt ist. Ich weiß nicht, wer mehr erschrocken ist, Cole, Janie oder Jazzie selbst. Ich glaube nicht, dass sie ihn verletzen wollte, ganz zu schweigen davon, ihm eins überzubraten, außerdem war sie sich bestimmt nicht mal darüber im Klaren, dass solche Kräfte in ihr stecken.«
»Tja, das kann ich nur zu gut nachvollziehen«, bemerkte Taylor und verdrehte die Augen. »Ich wollte Sie auch nicht umhauen. Ich bin Cole bloß einmal begegnet, bevor Sie gemeinsam zu diesem Campingausflug aufgebrochen sind, aber soweit ich mich erinnere, ist er ähnlich groß wie Sie. Wie um alles in der Welt hat Jazzie seinen Kiefer erreicht?«
»Er hat sich nach vorn gebeugt, um mit ihr zu reden. Natürlich hatte er keine Ahnung, dass sie so schnell Angst bekommen würde. Cole mag groß sein, aber in Wahrheit ist er noch ein Kind. Er ist gerade mal fünfzehn.«
Wieder riss Taylor die Augen auf. »Fünfzehn? Er sieht aus, als wäre er mindestens zwanzig.«
»Ich weiß. Der arme Kerl. Früher hat er deswegen regelmäßig Ärger in der Schule bekommen. Die Lehrer hatten größere Erwartungen an ihn, und die anderen Kids haben ihn aufgezogen, weil sie dachten, er sei ein paarmal sitzen geblieben. Jetzt geht er auf eine geeignetere Schule, wo ihn keiner mehr hänselt. Ich glaube, er vergisst manchmal, dass er ziemlich angsteinflößend wirken kann.«
»Ich nehme nicht an, dass er es in Zukunft so schnell wieder vergessen wird«, bemerkte Taylor trocken.
Ford konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Das glaube ich auch nicht. Und sein Bruder genauso wenig.«
Erneut verdrehte sie die Augen. »O Gott. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das wirklich getan habe.« Dann runzelte sie die Stirn. »Wieso hat Maggie mir nicht gesagt, dass Jazzie sich vor Männern fürchtet?«
Fords Miene wurde ebenfalls ernst. Wenn Maggie nichts gesagt hatte, bedeutete es, dass ihre Praktikantin noch nicht ihr hundertprozentiges Vertrauen genoss. Deshalb hätte er sich am liebsten geohrfeigt, weil er damit herausgeplatzt war. Er würde Maggie beichten müssen, dass er die Katze aus dem Sack gelassen hatte – eine Unterhaltung, der er keineswegs mit Freude entgegenblickte.
Andererseits hatte Maggie offensichtlich seiner Mutter nichts davon gesagt, dass sie ihrer Praktikantin noch nicht über den Weg traute, denn hätte sie es getan, wäre seine Mutter nicht so voll des Lobes über sie gewesen.
»Maggie verteidigt die Privatsphäre wie eine Löwin«, sagte er. »Wenn in der Akte des Jugendamts nichts stand und Jazzie selbst auch nichts gesagt hat, würde Maggie es immer für sich behalten, bis sie den richtigen Zeitpunkt für gekommen hält.«
»Das klingt ganz nach Maggie«, stimmte Taylor zu. »Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Ich habe mich darauf konzentriert, dass Janie sich im Sattel wohlfühlt, hauptsächlich, weil Jazzie nicht mitmachen und ich sie nicht bedrängen wollte, aber ich werde sie am Montag ein klein wenig mehr motivieren. Sie braucht all das hier genauso sehr wie Janie.«
»Äh …« Er zögerte, aus Angst, ein zweites Mal ins Fettnäpfchen zu treten, und in der Hoffnung, ihr nicht noch etwas unter die Nase zu reiben, wovon sie nichts geahnt hatte. »Am Montag haben wir geschlossen. Es finden keine Kurse statt.«
Einen Moment lang blieb ihre Miene ausdruckslos, doch dann schien es ihr wieder einzufallen. »Ach ja. Dillons Hochzeit. Er hat gesagt, ich soll kommen«, fügte sie verunsichert hinzu.
Ford unterdrückte einen Anflug von Verärgerung. Es sah ganz so aus, als hätte sie keine Lust, oder als sei ihr nicht ganz wohl dabei, weil Dillon sie eingeladen hatte. »Aber …?« Das Wort kam eine Spur zu schnell, zu barsch über seine Lippen, aber er konnte sich nicht beherrschen. »Sie fühlen sich in seiner Gegenwart unwohl.« Sollte sich jemand herausnehmen, gemein zu Dillon zu sein, bekommt er es mit mir zu tun. Und das galt schon zweimal für Dillons Verlobte Holly – was ihren Dillon anging, war mit ihr nicht zu spaßen.
Die beiden gingen auf die dreißig zu und litten unter dem Downsyndrom. Sie hatten sich ihre Unabhängigkeit hart erkämpft, und Ford würde niemandem erlauben, ihnen das Leben schwer zu machen, schon gar nicht an ihrem Hochzeitstag. Das galt auch für die neue Praktikantin, auch wenn sie noch so hübsch sein mochte.
Taylor kniff die Augen zusammen, als der Groschen endlich fiel. »Sie glauben, es liegt daran, dass er am Downsyndrom leidet, stimmt’s?« Ihr Kiefer spannte sich an. »Versuchen Sie gar nicht erst, es zu leugnen.« Sie machte auf dem Absatz kehrt und stapfte davon, während er ihr mit offenem Mund hinterhersah.
Es dauerte einen Moment, bis er begriff, einen zweiten, um zu registrieren, dass sie ihn stehen ließ, und einen dritten, bis ihm dämmerte, dass er das nicht wollte. Sie sollte nicht gehen. Nicht so.
»Taylor, warten Sie!« Er holte sie ein und schlug mit der flachen Hand die Tür des Aufenthaltsraums zu, bevor sie dazu kam, sie zu öffnen. »Sie haben recht. Ich hatte den Gedanken tatsächlich, und es tut mir leid.«
Sie erstarrte. Ihre Finger krallten sich so fest um den Türknauf, dass ihre Knöchel weiß hervortraten.