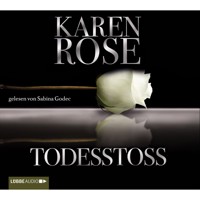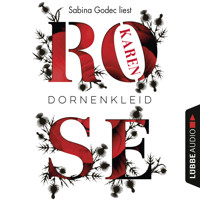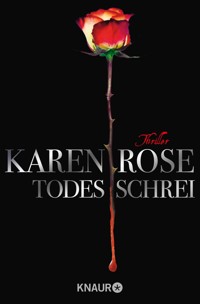
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Todes-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Schrei, so laut du kannst – keiner wird dich hören! Ein grausamer Serienkiller versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Der Killer hat eine morbide Vorliebe für mittelalterliche Folterinstrumente und überschreitet für seine makabren Werke jede menschliche Grenze. Die Schreie seiner Opfer verhallen ungehört, während er seine blutige Kunst perfektioniert. Als Detective Vito Ciccotelli und die brillante Archäologin Sophie Johannsen die Ermittlungen aufnehmen, entbrennt eine gnadenlose Jagd auf Leben und Tod. »Action und Gänsehaut pur!« Tess Gerritsen Karen Rose, Bestsellerautorin und Meisterin der Hochspannung, entführt die Leser in Todesschrei in die dunkelsten Abgründe der menschlichen Seele. Ein nervenaufreibender Thriller über die Jagd nach einem Serienkiller, bei der die Grenzen zwischen Gut und Böse zunehmend verschwimmen. Während die Ermittler alles riskieren, um den Mörder zu stoppen, entwickelt sich zwischen ihnen eine knisternde Anziehungskraft – doch auch ihre Gefühle müssen warten, solange der Killer noch auf freiem Fuß ist. Die Todes-Trilogie der Bestseller-Autorin Karen Rose besteht aus den folgenden Thrillern: - »Todesschrei« (Band 1) - »Todesbräute« (Band 2) - »Todesspiele« (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 795
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Karen Rose
Todesschrei
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Schrei, so laut du kannst – keiner wird dich hören!« Er hat eine Vorliebe für mittelalterliche Folterinstrumente. Für seine Kunst überschreitet er jede menschliche Grenze. Er lässt seine Opfer um ihr Leben schreien. Doch dann heften sich Detective Vito Ciccotelli und Archäologin Sophie Johannsen an seine Fersen, und eine Jagd auf Leben und Tod beginnt … Der Bestseller!
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Philadelphia, Samstag, 6. Januar
1. Kapitel
Philadelphia, Sonntag, 14. Januar, 10.25 Uhr
Sonntag, 14. Januar, 10.30 Uhr
Sonntag, 14. Januar, 12.25 Uhr
Sonntag, 14. Januar, 12.30 Uhr
2. Kapitel
Sonntag, 14. Januar, 14.00 Uhr
Dutton, Georgia, Sonntag, 14. Januar, 14.15 Uhr
Philadelphia, Sonntag, 14. Januar, 14.15 Uhr
3. Kapitel
Philadelphia, Sonntag, 14. Januar, 14.30 Uhr
New York City, Sonntag, 14. Januar, 17.00 Uhr
Philadelphia, Sonntag, 14. Januar, 17.00 Uhr
Dutton, Georgia, Sonntag, 14. Januar, 21.40 Uhr
New York City, Sonntag, 14. Januar, 22.00 Uhr
4. Kapitel
Philadelphia, Sonntag, 14. Januar, 22.30 Uhr
Sonntag, 14. Januar, 23.15 Uhr
Sonntag, 14. Januar, 23.55 Uhr
5. Kapitel
Sonntag, 14. Januar, 23.55 Uhr
Montag, 15. Januar, 00.35 Uhr
Montag, 15. Januar, 00.45 Uhr
Montag, 15. Januar, 00.55 Uhr
Montag, 15. Januar, 7.45 Uhr
6. Kapitel
Montag, 15. Januar, 8.15 Uhr
Montag, 15. Januar, 8.15 Uhr
Montag, 15. Januar, 8.45 Uhr
Dutton, Georgia, Montag, 15. Januar, 10.10 Uhr
Philadelphia, Montag, 15. Januar, 10.15 Uhr
Montag, 15. Januar, 12.25 Uhr
7. Kapitel
Dutton, Georgia, Montag, 15. Januar, 13.15 Uhr
Montag, 15. Januar, 13.40 Uhr
Montag, 15. Januar, 14.15 Uhr
Montag, 15. Januar, 15.00 Uhr
8. Kapitel
Montag, 15. Januar, 16.05 Uhr
Montag, 15. Januar, 16.45 Uhr
New York, Montag, 15. Januar, 16.55 Uhr
Montag, 15. Januar, 18.00 Uhr
Montag, 15. Januar, 18.45 Uhr
Montag, 15. Januar, 18.50 Uhr
Montag, 15. Januar, 20.15 Uhr
9. Kapitel
Montag, 15. Januar, 21.00 Uhr
Montag, 15. Januar, 21.55 Uhr
Montag, 15. Januar, 22.15 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 00.45 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 1.15 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 1.15 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 6.00 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 8.01 Uhr
10. Kapitel
Dienstag, 16. Januar, 8.35 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 9.15 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 9.30 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 10.30 Uhr
New York City, Dienstag, 16. Januar, 10.45 Uhr
11. Kapitel
Philadelphia, Dienstag, 16. Januar, 11.30 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 11.45 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 11.55 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 12.05 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 13.15 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 13.30 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 13.30 Uhr
New Jersey, Dienstag, 16. Januar, 14.30 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 15.20 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 16.05 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 16.10 Uhr
12. Kapitel
Dienstag, 16. Januar, 17.00 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 17.45 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 17.30 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 20.10 Uhr
13. Kapitel
Dienstag, 16. Januar, 21.55 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 22.00 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 22.15 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 23.25 Uhr
Dienstag, 16. Januar, 23.30 Uhr
14. Kapitel
Mittwoch, 17. Januar, 00.05 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 5.00 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 6.00 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 8.05 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 9.05 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 9.30 Uhr
15. Kapitel
Mittwoch, 17. Januar, 11.10 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 11.30 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 12.30 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 13.15 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 14.30 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 15.25 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 15.00 Uhr
New York City, Mittwoch, 17. Januar, 15.30 Uhr
Philadelphia, Mittwoch, 17. Januar, 16.45 Uhr
16. Kapitel
Mittwoch, 17. Januar, 17.20 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 18.25 Uhr
White Plains, New York, Mittwoch,17. Januar, 18.30 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 18.45 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 19.10 Uhr
17. Kapitel
Mittwoch, 17. Januar, 20.30 Uhr
Mittwoch, 17. Januar, 21.25 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 4.10 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 7.45 Uhr
18. Kapitel
Donnerstag, 18. Januar, 8.15 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 9.15 Uhr
New York City, Donnerstag, 18. Januar, 9.55 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 11.15 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 11.45 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 12.00 Uhr
New York City, Donnerstag, 18. Januar, 12.30 Uhr
Philadelphia, Donnerstag, 18. Januar, 14.15 Uhr
New York City, Donnerstag, 18. Januar, 14.45 Uhr
New York City, Donnerstag, 18. Januar, 15.03 Uhr
19. Kapitel
Philadelphia, Donnerstag, 18. Januar, 17.15 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 17.45 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 18.25 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 19.00 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 19.35 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 20.05 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 20.15 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 20.30 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 21.15 Uhr
20. Kapitel
Donnerstag, 18. Januar, 21.55 Uhr
Donnerstag, 18. Januar, 23.35 Uhr
Freitag, 19. Januar, 7.15 Uhr
Freitag, 19. Januar, 8.00 Uhr
21. Kapitel
Freitag, 19. Januar, 9.30 Uhr
Dutton, Georgia, Freitag, 19. Januar, 10.30 Uhr
Philadelphia, Freitag, 19. Januar, 10.45 Uhr
Freitag, 19. Januar, 13.35 Uhr
Dutton, Georgia, Freitag, 19. Januar, 14.45 Uhr
Philadelphia, Freitag, 19. Januar, 16.20 Uhr
Freitag, 19. Januar, 17.00 Uhr
22. Kapitel
Freitag, 19. Januar, 19.00 Uhr
Freitag, 19. Januar, 20.00 Uhr
Freitag, 19. Januar, 23.30 Uhr
Samstag, 20. Januar, 7.45 Uhr
Dutton, Georgia, Samstag, 20. Januar, 8.45 Uhr
Samstag, 20. Januar, 9.15 Uhr
Samstag, 20. Januar, 12.45 Uhr
Samstag, 20. Januar, 12.55 Uhr
23. Kapitel
Samstag, 20. Januar, 13.40 Uhr
Samstag, 20. Januar, 16.15 Uhr
Samstag, 20. Januar, 16.50 Uhr
Samstag, 20. Januar, 17.00 Uhr
Samstag, 20. Januar, 17.00 Uhr
24. Kapitel
Samstag, 20. Januar, 17.30 Uhr
Samstag, 20. Januar, 18.20 Uhr
Samstag, 20. Januar, 20.15 Uhr
Samstag, 20. Januar, 21.15 Uhr
Samstag, 20. Januar, 21.30 Uhr
Samstag, 20. Januar, 21.50 Uhr
Samstag, 20. Januar, 21.55 Uhr
25. Kapitel
Samstag, 20. Januar, 22.30 Uhr
Samstag, 20. Januar, 23.45 Uhr
Sonntag, 21. Januar, 3.10 Uhr
Sonntag, 21. Januar, 4.15 Uhr
Sonntag, 21. Januar, 4.50 Uhr
Sonntag, 21. Januar, 5.30 Uhr
Sonntag, 21. Januar, 7.20 Uhr
Sonntag, 21. Januar, 7.45 Uhr
Sonntag, 21. Januar, 7.50 Uhr
26. Kapitel
Sonntag, 21. Januar, 7.50 Uhr
Sonntag, 21. Januar, 13.30 Uhr
Sonntag, 21. Januar, 16.30 Uhr
Epilog
Samstag, 8. November, 19.00 Uhr
Danksagung
Gewidmet dem Andenken von
Dr. Zoltan J. Kosztolnyik,
Professor emeritus für Mittelalterliche Geschichte,
Texas A&M University
Obwohl ich nie das Privileg hatte,seine Bekanntschaft zu machen, hatte ich sowohldie Ehre als auch das Vergnügen, die Tochter,die er aufgezogen hat, kennenzulernen.
Und wie immer
meinem geliebten Mann Martin.
Jeden Tag bereicherst Du das Dasein Deiner Schüler,indem Du die Geschichte mit Deiner einzigartigenKombination von Leidenschaft, Klugheit und beißendemWitz zum Leben erweckst. Ihretwegen habe ich mich vor fünfundzwanzig Jahren in Dich verliebt.
Ob Du Dich nun als Kleopatra verkleidest,die Unabhängigkeitserklärung mit Hilfe von 80er-Jahre-Rockvideos demonstrierst oder die Monroe-Doktrinmit dem »Badger Badger Mushroom«-Tanz erläuterst – Du sorgst dafür, dass kein Schüler, der von Dir lernt,Dich je vergessen wird.
Du inspirierst mich. Ich liebe Dich.
Prolog
Philadelphia, Samstag, 6. Januar
Das Erste, was Warren Keyes bewusst wahrnahm, war der Geruch. Ammoniak, Desinfektionsmittel … und noch etwas. Was noch? Mach die Augen auf, Keyes. Er hörte die eigene Stimme in seinem Kopf widerhallen und mühte sich, die Augen aufzuschlagen. Schwer. Seine Lider waren so schwer, aber er gab nicht auf, bis es ihm gelang. Es war dunkel. Nein. Da war ein wenig Licht. Warren blinzelte einmal, zweimal, bis er einen flackernden Schein ausmachen konnte.
Eine Fackel, die an der Wand befestigt war. Sein Herz begann zu hämmern. Die Wand bestand aus nacktem Fels. Ich bin in einer Höhle. Was zum Teufel ist hier los? Mit einem Ruck versuchte er sich aufzusetzen, und ein greller Schmerz schoss durch seine Arme in seinen Rücken. Er schnappte nach Luft und fiel gegen etwas Flaches, Hartes zurück.
Er war gefesselt. O Gott. Hände und Füße waren fest zusammengebunden. Und er war nackt. Gefangen! Die Furcht stieg aus seinem Bauch auf und raste durch seine Glieder. Er wand sich, zappelte wie ein wildes Tier, kämpfte gegen die Fesseln an und musste einsehen, dass es nichts nützte. Keuchend sog er die Luft ein und schmeckte das Desinfektionsmittel. Das und …
Sein Atem stockte, als er den Gestank unter dem Desinfektionsmittel erkannte. Etwas Totes. Verwesendes. Er schloss die Augen und zwang die Panik nieder. Das kann nicht sein. Ich träume bloß. Das ist ein furchtbarer Alptraum, und gleich wache ich auf.
Aber er träumte nicht. Das hier war real. Er war auf einem leicht geneigten Brett festgebunden, seine Arme ausgestreckt über seinem Kopf gefesselt. Warum? Er versuchte zu denken, sich zu erinnern. Da war etwas … ein Bild in seinem Kopf, doch er konnte es nicht fassen. Er wollte die Erinnerung herbeizwingen, doch stattdessen setzten Kopfschmerzen ein – starke Kopfschmerzen –, und plötzlich tanzten schwarze Flecken über seine Pupillen. Gott, es fühlte sich an wie ein heftiger Kater. Aber er hatte nicht getrunken, oder?
Kaffee. Er erinnerte sich daran, Kaffee getrunken, seine Hände um einen heißen Becher gelegt zu haben. Er hatte gefroren. Er war draußen gewesen. Ich bin gerannt. Warum war er gerannt? Er bewegte die Handgelenke, spürte das Brennen seiner aufgescheuerten Haut, betastete mit den Fingerspitzen den Strick.
»Ah, du bist endlich wach.«
Die Stimme erklang hinter ihm, und er versuchte, den Kopf zu drehen, um etwas zu sehen. Und dann wusste er es, und der Druck in seiner Brust ließ etwas nach. Ein Film. Ich bin Schauspieler, und wir drehen einen Film. Eine historische Dokumentation. Er war gerannt und hatte etwas in der Hand gehabt – was? Er verzog das Gesicht, als er sich konzentrierte. Ein Schwert! Er hatte ein mittelalterliches Kostüm getragen, einen Helm, einen Schild … ja, sogar ein Kettenhemd, Herrgott nochmal! Jetzt endlich sah er die komplette Szenerie wieder vor sich. Er hatte ein formloses, kratziges, tunikaartiges Etwas angezogen, das seine Haut reizte. Er hatte ein Schwert in der Hand gehalten und war aus vollem Hals brüllend auf dem Außengelände von Munchs Studio durch den Wald gelaufen. Er war sich wie ein Vollidiot vorgekommen, aber er hatte es getan, weil es eben in dem verdammten Drehbuch gestanden hatte.
Aber dies hier, er zerrte ohne Erfolg erneut an den Stricken, stand nicht im Drehbuch.
»Munch.« Warrens Stimme war belegt, heiser und schmerzte in seiner wunden Kehle. »Was soll das?«
Ed Munch erschien zu seiner Linken. »Ich dachte schon, du wachst gar nicht mehr auf.«
Warren blinzelte, als das Licht der flackernden Kerze über das Gesicht des Mannes fiel. Sein Herz setzte einen Schlag aus. Munch hatte sich verändert. Er war doch alt gewesen, die Schultern gebeugt! Weißes Haar, gestutzter Schnurrbart. Warren schluckte. Aber jetzt stand Munch sehr aufrecht. Der Schnurrbart war fort. Und auch das Haar. Dieser Mann hier hatte einen glänzenden, kahlrasierten Schädel.
Munch war gar nicht alt. Wieder drang Furcht durch seine Eingeweide. Ihm waren fünfhundert Dollar für die Dokumentation versprochen worden, bar auf die Hand. Warren war misstrauisch gewesen – das war viel Geld für eine Geschichtsdoku, die, wenn er Glück hatte, auf PBS lief. Aber er hatte eingewilligt. Ein einziger komischer Alter stellte schließlich keine Bedrohung dar.
Aber der komische Alte war nicht alt. Bittere Galle stieg in Warrens Kehle auf. Was habe ich getan? Und dieser Frage folgte direkt eine andere, die viel beängstigender war: Was hat er mit mir vor?
»Wer sind Sie?«, krächzte Warren, und Munch hielt ihm eine Flasche Wasser an die Lippen. Warren wollte den Kopf wegdrehen, doch Munch packte sein Kinn und hielt ihn mit erstaunlicher Kraft fest. Seine dunklen Augen verengten sich, und nackte Angst ließ Warren erstarren.
»Es ist nur Wasser«, knurrte Munch. »Diesmal ja. Also trink schon.«
Warren spuckte ihm das Wasser ins Gesicht und wappnete sich, als der Mann die Faust hob. Aber dann ließ Munch die Hand sinken und zuckte die Achseln. »Du trinkst schon irgendwann. Ich brauche eine feuchte Kehle.«
Warren leckte sich über die Lippen. »Und warum?«
Munch verschwand hinter ihm, und Warren hörte etwas rollen. Kurz darauf wurde eine Videokamera an ihm vorbeigeschoben und in etwa zwei Meter Entfernung ausgerichtet. Und zwar direkt auf sein Gesicht. »Warum?«, fragte Warren noch einmal.
Munch blickte durch das Objektiv und trat zurück. »Weil du schreien sollst.« Er zog eine Braue hoch, doch seine Miene blieb völlig ausdruckslos. »Schreien tun sie alle. Und du wirst das auch.«
Entsetzen durchfuhr ihn, doch Warren kämpfte dagegen an. Bleib ruhig. Du wirst ihm nie entkommen, wenn du nicht ruhig bleibst. Munch war verrückt. Sei nett zu ihm, dann kannst du dich vielleicht irgendwie befreien. Er zwang sich zu einem Lächeln. »Kommen Sie, Munch, Sie lassen mich gehen, und wir sind quitt. Behalten Sie ruhig die Schwertkampfszene, die wir schon abgedreht haben. Ich will Ihr Geld nicht.«
Munch sah ihn noch immer ausdruckslos an. »Ich hätte dich sowieso nicht bezahlt.« Er verschwand wieder, kam jedoch kurz darauf mit einer weiteren Kamera zurück.
Warren dachte unwillkürlich daran, wie Munch ihm den Kaffee in die Hand gedrückt und darauf bestanden hatte, dass er ihn trank.
Es ist nur Wasser. Diesmal ja. Plötzlich stieg Zorn in ihm auf und verdrängte vorübergehend die Furcht. »Sie haben mich betäubt«, zischte er und holte tief Luft. »Hilfe! Hilf mir doch jemand!«, brüllte er so laut er konnte, doch das heisere Krächzen, das aus seiner Kehle drang, war erbärmlich und sinnlos.
Munch schwieg, reagierte nicht, sondern installierte eine dritte Kamera, so dass sie von oben herab zeigte. Jede seiner Bewegungen war methodisch, präzise. Ohne Hast. Ohne Furcht.
Und Warren begriff, dass niemand ihn hören konnte. Sein heißer Zorn ebbte ab und machte eiskalter Angst Platz. Warren begann zu zittern. Er musste hier raus. Es musste eine Möglichkeit geben. Etwas, das er sagen konnte. Tun konnte. Anbieten konnte. Oder er würde flehen. Um sein Leben.
»Bitte, Munch, ich werde alles tun, was Sie wollen …« Seine Stimme verebbte, als die Erkenntnis in seinen Verstand drang.
Schreien tun sie alle. Ed Munch. Alles zog sich in ihm zusammen, als ihn die Verzweiflung überkam. »Sie heißen gar nicht Munch. Edvard Munch, der Maler.« Das Gemälde einer makabren Gestalt, die gequält die Hände gegen die Wangen presste, schoss ihm durch den Sinn. Der Schrei.
»Es wird Munk, nicht Munch ausgesprochen, aber das scheint niemanden zu stören. Niemand begreift, wie wichtig die Einzelheiten sind«, fügte er verächtlich hinzu.
Einzelheiten. Darüber hatten sie schon einmal gesprochen, als Warren gegen die kratzige Unterwäsche protestiert hatte. Auch das Schwert war echt gewesen. Ich hätte diesen Mistkerl damit erlegen sollen. »Authentizität«, murmelte Warren, als er sich an das erinnerte, was er für die Marotte eines verschrobenen alten Mannes gehalten hatte.
Munch nickte. »Aha. Jetzt hast du verstanden.«
»Was haben Sie vor?«, fragte Warren.
Munch zog einen Mundwinkel hoch. »Das merkst du noch früh genug.«
Warren hatte Mühe zu atmen. »Bitte. Bitte, ich tue alles, was Sie wollen. Aber lassen Sie mich gehen.«
Munch erwiderte nichts. Er schob einen Wagen mit einem Bildschirm hinter die erste Kamera und überprüfte konzentriert und gelassen den Fokus jeder einzelnen.
»Das können Sie nicht machen«, brach es verzweifelt aus Warren heraus. Wieder zerrte er an den Stricken, bis seine Handgelenke brannten und die Arme aus den Gelenken zu springen schienen. Die Stricke waren dick, die Knoten unnachgiebig. Er würde sich nicht befreien können.
»Das haben die anderen auch gesagt. Aber ich habe es gemacht, und ich werde weitermachen.«
Die anderen. Es hatte andere gegeben. Überall hing der Geruch des Todes in der Luft und verspottete ihn. Hier waren andere gestorben. Und auch er würde hier sterben. Nein! Bitte nicht. Er hatte noch so viel zu tun. Alles, was er nie getan hatte, alles, was er nie gesagt hatte, kam ihm in den Sinn. Und in ihm stieg plötzlich eine ungeahnte Kraft auf. Er hob das Kinn. »Meine Freunde werden mich vermissen. Und meine Verlobte weiß, dass ich bei Ihnen bin.« Munch, der mit den Kameras fertig war, drehte sich um. In seinen Augen stand reine Verachtung. »Nein, weiß sie nicht. Du hast deiner Verlobten gesagt, du wärst bei einem Freund, dem du bei der Vorbereitung zu einem Vorsprechen helfen wolltest. Das hast du mir selbst heute Nachmittag erzählt. Mit dem Geld von den Aufnahmen wolltest du ihr ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Du wolltest, dass es ein Geheimnis bleibt. Und aus diesem Grund – und wegen der Tätowierung – habe ich dich ausgewählt.« Er hob die Schultern. »Außerdem passt du ins Kostüm. Nicht jeder kann ein Kettenhemd richtig tragen. Also – niemand wird dich suchen. Und selbst wenn, wird dich niemand finden. Sieh es ein – du gehörst mir.«
Alles in Warren erstarrte. Es war die Wahrheit. Er hatte Munch erzählt, dass er Sherry zum Geburtstag überraschen wollte. Niemand wusste, wo er war. Niemand würde ihn retten. Er dachte an Sherry, an seine Eltern, an jeden, den er liebte. Sie würden sich Sorgen machen. Ein Schluchzen stieg in seiner Kehle auf. »Du Mistkerl«, flüsterte er. »Ich hasse dich.«
Munchs Lippen zuckten, aber seine Augen leuchteten belustigt auf, und das war erschreckender als alles, was er zuvor gesagt hatte. »Das haben die anderen auch gesagt.« Er presste Warren erneut die Wasserflasche an die Lippen und kniff ihm die Nase zu, bis Warren nach Luft schnappte. Warren kämpfte, wehrte sich, aber Munch zwang ihn zu trinken.
»Und nun, Mr. Keyes, fangen wir an. Und vergessen Sie ja nicht zu schreien.«
1. Kapitel
Philadelphia, Sonntag, 14. Januar, 10.25 Uhr
Detective Vito Ciccotelli stieg, gründlich durchgeschüttelt, aus seinem Truck. Die alte, ungeteerte Straße, die zum Tatort führte, hatte seine ohnehin schon aufgewühlten Eingeweide in noch schlimmeren Aufruhr versetzt. Er holte Atem und bereute es augenblicklich. Nach vierzehn Jahren bei der Polizei war der Tod für ihn noch immer eine widerwärtige Überraschung.
»Das zieht einem ja die Schuhe aus.« Nick Lawrence verzog das Gesicht und warf die Tür seines Sedans zu. »Krass.« Sein breiter Carolina-Akzent dehnte das Wort auf vier Silben aus.
Zwei Uniformierte standen auf dem verschneiten Feld und starrten in ein Loch. Sie hielten sich Taschentücher vor die unteren Gesichtshälften. Eine Frau, deren Kopf gerade noch über dem Rand sichtbar war, hockte in der Grube. »Wie mir scheint, hat die Spurensicherung die Leiche schon ausgegraben«, bemerkte Vito trocken.
»Ach was.« Nick bückte sich und stopfte die Hosenbeine in seine Cowboystiefel, die auf Hochglanz poliert waren. »Okay, Chick, dann wollen wir mal loslegen.«
»Moment noch.« Vito griff hinter den Autositz, um seine Schneestiefel hervorzuholen, und zuckte zusammen, als ihn einer der Dornen in den Daumen stach. »Mist, verdammter.« Er saugte an der kleinen Wunde, bevor er die Rosen behutsam beiseitelegte und nach seinen Stiefeln griff.
Aus dem Augenwinkel sah er, wie sein Partner ernst wurde, aber er sagte nichts.
»Es ist jetzt zwei Jahre her. Genau heute«, sagte Vito verbittert. »Wie die Zeit vergeht.«
Nicks Stimme war sanft. »Die Zeit soll auch alle Wunden heilen.«
Nick hatte recht. Die zwei Jahre hatten Vitos Kummer abgeschwächt. Aber das Schuldgefühl … nun, das war eine ganz andere Geschichte. »Ich gehe nachher noch zum Friedhof.«
»Soll ich mitkommen?«
»Nein, schon okay. Aber danke.« Vito zog die Stiefel an. »Jetzt lass uns mal sehen, was sie gefunden haben.«
Sechs Jahre bei der Mordkommission hatten Vito beigebracht, dass es keine »einfachen« Morde gab – nur verschiedene Abstufungen von Grausamkeit. Sobald er am Rand des Grabes anhielt, das die Spurensicherung freigelegt hatte, wusste er, dass dies einer der grausameren Morde war.
Weder Vito noch Nick sagten etwas, während sie das Opfer betrachteten. Es hätte ewig unentdeckt bleiben können, wäre da nicht der ältere Mann mit seinem Metalldetektor gewesen. Die Rosen, der Friedhof und alles andere waren vergessen, als Vito sich auf die Leiche konzentrierte. Sein Blick wanderte von ihren Händen zu dem, was von ihrem Gesicht übrig geblieben war.
Ihre Jane Doe war klein, keine eins sechzig groß, und wirkte jung. Kurzes dunkles Haar umrahmte ein Gesicht, das schon zu verwest war, um es noch identifizieren zu können. Vito fragte sich, wie lange sie schon hier lag. Und zu wem sie gehörte. Ob jemand sie vermisst hatte. Ob jemand noch immer auf sie wartete.
Er spürte das schon vertraute Aufwallen von Mitleid und Trauer und schob es an den Rand seines Bewusstseins zu all den anderen Gefühlen und Erinnerungen, die er vergessen wollte. Jetzt musste er sich allein um die Leiche kümmern, Beweise und Fakten sammeln. Später würden Nick und er sich auf die Frau konzentrieren – die Frau, die einmal gelebt hatte und jemand gewesen war. Und sie würden es tun, um das kranke Schwein zu fassen, das ihren nackten Körper irgendwo auf einem offenen Feld verscharrt, das ihr sogar noch nach ihrem Tod Gewalt angetan hatte. Das Mitleid mündete in heillosen Zorn, als sein Blick wieder zu ihren Händen glitt.
»Er hat sie in Positur gelegt«, murmelte Nick neben ihm, und in seinen leisen Worten schwang derselbe Zorn mit, den auch er empfand. »Dieser Dreckskerl hat sie extra hübsch hergerichtet.«
O ja, das hatte er. Ihre Hände lagen aneinandergelegt zwischen ihren Brüsten, die Fingerspitzen zeigten zum Kinn. »Für ewig im Gebet gefaltet«, sagte Vito grimmig.
»Ein religiöser Mord?«, überlegte Nick laut.
»Hoffentlich nicht.« Eine dumpfe Vorahnung jagte ihm einen Schauder über den Rücken. »Religiös motivierte Mörder neigen dazu, es nicht bei einem Opfer zu belassen.«
Nick ging in die Hocke, um in das Grab zu sehen, das ungefähr einen Meter tief war. »Wie hat er es geschafft, dass die Hände so geblieben sind, Jen?«
CSU-Sergeant Jen McFain schaute auf. Sie trug eine Schutzbrille und eine Maske über der unteren Gesichtshälfte. »Mit Draht. Könnte Stahl sein, ist aber sehr fein. Er wurde um ihre Finger gewickelt. Ihr könnt es besser sehen, wenn die Gerichtsmedizin sie sauber gemacht hat.«
Vito runzelte die Stirn. »Es kommt mir komisch vor, dass ein Metalldetektor bei einem so dünnen Draht durch eine dicke Schicht Erde anschlägt.«
»Du hast recht. Das haben wir auch eher den Stangen zu verdanken, die euer Spinner dem Opfer unter die Arme geschoben hat.« Jen strich mit einem behandschuhten Finger an der Unterseite ihres eigenen Arms bis zum Handgelenk entlang. »Sie sind dünn und biegsam, haben aber genug Masse, um vom Detektor angezeigt zu werden. Mit den Stangen hat er die Arme in Position gebracht.«
Vito schüttelte den Kopf. »Warum nur?«
Jen zuckte die Achseln. »Vielleicht kann die Leiche uns mehr sagen. Hier in dem Loch ist nicht viel zu finden. Allerdings macht mich etwas stutzig …« Geschickt zog sie sich aus dem Grab. »Der alte Mann, der sie gefunden hat, hat mit einem normalen Gartenspaten gegraben. Er ist zwar ganz gut in Form, aber nicht einmal ich hätte bei diesen Temperaturen so tief graben können.«
Nick blickte in das Loch. »Das heißt, der Boden kann nicht gefroren gewesen sein.«
Jen nickte. »Genau. Als er den Arm ausgebuddelt hatte, hörte er sofort auf und rief die Polizei. Als wir eintrafen, haben wir vorsichtig Erde beiseitegeschafft, und es war ganz einfach, bis wir auf die Grabwand stießen – die war hart wie Stein. Seht euch mal die Ecken an. Sieht aus, wie mit einer Schiene gezogen. Und sie sind steinhart gefroren.«
Vito spürte ein Ziehen in der Magengrube. »Er hat das Grab ausgehoben, bevor es gefroren hat. Das heißt, er hat das alles im Voraus geplant.«
Nick zog die Brauen zusammen. »Und niemand hat das riesige Loch bemerkt?«
»Vielleicht hat er es mit irgendetwas bedeckt«, meinte Jen. »Und ich glaube auch nicht, dass die Erde, die er zum Aufschütten benutzt hat, von diesem Feld stammt. Ich lasse ein paar Tests machen. Aber im Moment ist das leider alles, Jungs. Und ich kann auch nichts mehr tun, bevor die Gerichtsmedizin hier eintrifft.«
»Danke, Jen«, sagte Vito. Er wandte sich an Nick. »Reden wir mal mit dem Besitzer von diesem Stück Land.«
Harlan Winchester war um die siebzig, aber sein Blick war klar und scharf. Er hatte auf dem Rücksitz des Streifenwagens gewartet und stieg aus, als er sie kommen sah. »Ich nehme an, Sie wollen von mir noch einmal dasselbe hören wie der Officer.«
Vito nickte und bemühte sich um ein freundliches Auftreten. »Ich fürchte ja. Ich bin Detective Ciccotelli, und das ist mein Partner, Detective Lawrence. Können Sie uns bitte sagen, was genau geschehen ist?«
»Tja, dabei wollte ich diesen blöden Metalldetektor nicht einmal haben. Er war ein Geschenk von meiner Frau. Sie hat Angst, dass ich nicht mehr genug Bewegung kriege, seit ich pensioniert bin.«
»Also sind Sie heute Morgen losmarschiert?«, drängte Vito ihn, und Winchester blickte finster drein.
»›Harlan P. Winchester‹«, sprach er mit hoher, nasaler Stimme, »›du sitzt jetzt schon mindestens zehn Jahre nur herum. Beweg deinen Hintern und geh spazieren.‹ Na ja, und da habe ich es einfach getan, weil ich das Gezeter nicht mehr ertragen konnte. Ich dachte, vielleicht finde ich was Interessantes, damit sie aufhört, mich zu nerven. Tja … dass ich eine Leiche finden würde, hätte ich allerdings nicht gedacht.«
»War die Leiche das Erste, was Ihr Detektor gemeldet hat?«, fragte Nick.
»Ja.« Seine Lippen verzogen sich zu einer feinen Linie. »Ich habe also meinen Spaten aufgeklappt. Dann fiel mir ein, dass der Boden garantiert zu hart zum Graben ist. Beinahe hätte ich ihn wieder weggepackt, aber dann hätte Ginny gemeckert, dass ich bloß eine Viertelstunde weg gewesen bin. Also habe ich angefangen zu graben.« Er schloss die Augen und schluckte, als sein großmäuliges Gebaren in sich zusammenfiel. »Mein Spaten … hat ihren Arm getroffen. Da habe ich aufgehört und die Polizei gerufen.«
»Können Sie uns etwas über dieses Stück Land sagen?«, fragte Vito. »Wer hat hier Zugang?«
»Jeder mit Geländewagen oder Vierradantrieb, nehme ich an. Man kann das Feld vom Highway aus nicht sehen, und der Weg, der es mit der Hauptstraße verbindet, ist nicht einmal geteert.«
Vito nickte und war dankbar, dass er seinen Truck genommen hatte und den Mustang neben dem Motorrad in der Garage hatte stehenlassen. »Die Straße ist wirklich gruselig. Wie kommen Sie hierher?«
»Na ja, heute bin ich zu Fuß gegangen.« Er deutete auf eine Baumreihe, von der aus eine einzelne Fußspur herführte. »Aber es ist das erste Mal, dass ich so weit marschiert bin. Wir sind erst vor einem Monat hergezogen. Das Land hat meiner Tante gehört«, erklärte er. »Sie hat es mir hinterlassen.«
»Ist Ihre Tante oft hergekommen?«
»Eher nicht, denke ich. Sie hat selten das Haus verlassen. Sie war ein wenig eigenbrötlerisch. Mehr weiß ich nicht.«
»Sir, Sie haben uns sehr geholfen«, sagte Vito. »Vielen Dank.«
Winchester ließ die Schultern hängen. »Kann ich jetzt gehen?«
»Natürlich. Die Kollegen werden Sie nach Hause bringen.«
Winchester stieg ein, und der Streifenwagen fuhr los, als ein grauer Volvo auf das Feld bog. Der Volvo parkte hinter Nicks Sedan, und eine adrette Frau Mitte fünfzig stieg aus. Gerichtsmedizinerin Katherine Bauer war angekommen. Es war Zeit, sich Jane Doe zu widmen.
Vito setzte sich in Richtung Grab in Bewegung, aber Nick rührte sich nicht. Er blickte nachdenklich auf Winchesters Metalldetektor, der im Lieferwagen der CSU lag. »Wir sollten auch den Rest des Felds überprüfen, Chick.«
»Du glaubst, dass noch mehr hier sind?«
»Ich glaube, wir sollten nicht fahren, ohne uns vergewissert zu haben, dass dem nicht so ist.«
Wieder spürte Vito eine dumpfe Vorahnung. Im Grunde wusste er bereits, dass sie etwas finden würden. »Du hast recht. Schauen wir nach, was es hier sonst noch so gibt.«
Sonntag, 14. Januar, 10.30 Uhr
»Haben alle die Augen geschlossen?« Sophie Johannsen sah ihre Studenten in der Dunkelheit mit gerunzelter Stirn an. »Bruce, Sie schummeln!«
»Tu’ ich gar nicht«, brummelte Bruce. »Außerdem ist es viel zu finster, um etwas zu sehen.«
»Jetzt machen Sie schon«, sagte Marta ungeduldig. »Knipsen Sie endlich das Licht an.«
Sophie schaltete das Licht ein und kostete den Augenblick voll aus. »Meine Damen und Herren … der Große Saal.«
Einen Moment lang sagte niemand ein Wort. Dann stieß Spandan einen lauten Pfiff aus, der von der Decke, sechs Meter über ihnen, widerhallte.
Bruce’ Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. »Sie haben es geschafft. Sie haben es endlich geschafft.«
Marta presste die Kiefer zusammen. »Nett.«
Sophie blinzelte bei dem kühlen Tonfall der jungen Frau, aber bevor sie eine Bemerkung machen konnte, hörte sie das Geräusch von Johns Rollstuhl, der hinter ihr vorbeifuhr und stehen blieb. John starrte an die gegenüberliegende Wand. »Und das haben Sie alles allein gemacht«, murmelte er. »Fantastisch.«
Sophie schüttelte den Kopf. »Nicht einmal annähernd. Sie alle haben mir schließlich geholfen – allein bei der Reinigung der Waffen und Rüstungen. Ohne Sie hätte ich das nie geschafft. Das war definitiv Teamarbeit.«
Im vergangenen Herbst hatten sich noch alle fünfzehn Teilnehmer ihres Seminars »Waffen und Kriegsführung« begeistert freiwillig gemeldet, im Albright Museum of History, wo sie angestellt war, mitzuarbeiten. Nun waren nur noch diese vier treuen Helfer geblieben. Seit Monaten waren sie jeden Sonntag hergekommen und hatten ihre Freizeit geopfert. Dass sie damit das Klassenziel erreichten, stand außer Frage, aber noch wichtiger war, dass sie all die mittelalterlichen Schätze berühren durften, die ihre Kommilitonen nur durch Glas bewundern konnten.
Sophie verstand die Faszination nur allzu gut. Sie wusste auch, dass das Gefühl, ein Schwert aus dem fünfzehnten Jahrhundert in einem nüchternen Museum in der Hand zu halten, nicht zu vergleichen war mit dem Moment, in dem man dieses Schwert selbst ausgrub, behutsam die Erde abbürstete und einen Schatz freilegte, den fünfhundert Jahre niemand zu Gesicht bekommen hatte. Sechs Monate lang hatte sie als Archäologin in Südfrankreich nur für diesen aufregenden Moment gelebt und sich jeden Morgen beim Aufwachen gefragt, was für Kostbarkeiten sie an diesem Tag vielleicht heben würden. Inzwischen konnte sie als Kuratorin des Albright Museum nur noch berühren, was andere ans Tageslicht geholt hatten. Im Augenblick musste sie sich damit zufriedengeben.
So schwer es ihr gefallen war, die französische Ausgrabungsstelle zu verlassen, so wusste sie doch jedes Mal, wenn sie am Bett ihrer Großmutter im Pflegeheim saß, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte.
Es waren Momente wie dieser, in denen sie den Stolz in den Mienen ihrer Studenten sah, die die Entscheidung leichter für sie machte. Und auch Sophie war stolz auf das, was sie erreicht hatten. Der neue Große Saal, der geräumig genug war, Gruppen von dreißig Besuchern aufzunehmen, war wirklich spektakulär. An der gegenüberliegenden Seite standen drei komplette Rüstungen in Habtachtstellung unter einem Arrangement von hundert Schwertern, die in einem Gittermuster aufgehängt worden waren. Kriegsbanner hingen an der linken Wand, an der rechten der Houarneau-Wandteppich, ein Juwel der Sammlung, die Theodore Albright I. während seiner glanzvollen archäologischen Karriere angehäuft hatte.
Sophie stellte sich vor den Wandteppich und genoss den Anblick. Der Houarneau-Teppich aus dem zwölften Jahrhundert raubte ihr jedes Mal aufs Neue den Atem. »Wow«, murmelte sie.
»Wow?« Bruce schüttelte grinsend den Kopf. »Wirklich, Dr. J, Sie sollten sich etwas Besseres als ›Wow‹ einfallen lassen. Sie können doch aus zwölf Sprachen auswählen.«
»Nur aus zehn«, korrigierte sie, und er verdrehte die Augen. Für Sophie war das Sprachenstudium immer ein praktisches Vergnügen gewesen. Die Kenntnis alter Sprachen erleichterte ihr die Forschung, aber sie liebte vor allem den so ganz anderen Rhythmus und die Nuancierung der Worte. Seitdem sie zurückgekehrt war, hatte sie wenig Gelegenheit gehabt, ihr Können anzubringen, und es fehlte ihr.
Und so ließ sie sich nun bei der Betrachtung des Teppichs dazu verführen. »C’est incroyable.« Das Französische erklang wie eine vertraute Melodie in ihrem Kopf, und das war nur natürlich, denn mit Ausnahme einiger weniger Besuche hier in Philadelphia hatte sie fünfzehn Jahre in Frankreich verbracht. Auf die anderen Sprachen musste sie sich ein wenig mehr konzentrieren, aber sie fielen ihr trotzdem nicht schwer. Griechisch, Deutsch, Russisch … sie pflückte die Worte aus ihrem Geist wie Blumen von einem Beet. »Katapliktikos. Ist ja irre! O moy bog.«
Marta zog eine Braue hoch. »Was übersetzt heißt?«
Sophies Lippen zuckten. »Wow … im Wesentlichen.« Sie blickte sich erneut zufrieden um. »Das wird der Hit bei unseren Führungen werden.« Ihr Lächeln verblasste. Der Gedanke an Führungen, vor allem an Museumsführer reichte aus, um ihr Vergnügen zu dämpfen.
John wendete seinen Rollstuhl, so dass er zu den Schwertern hinaufsehen konnte. »Aber Sie haben es enorm schnell zustande gebracht.«
Sie schob den unangenehmen Gedanken an Führungen beiseite. »Was ich Bruce’ Computersimulation zu verdanken habe. Er hat mir genau gezeigt, wo die Befestigungen angebracht werden müssen, und dann war alles ganz einfach. Es sieht wirklich authentisch aus.« Sie lächelte Bruce anerkennend zu. »Danke.«
Bruce strahlte. »Und warum die Paneele? Ich dachte, Sie wollten die Wände streichen.«
Wieder verblasste das Lächeln. »Da bin ich überstimmt worden. Ted Albright bestand darauf, dass das Holz den Raum eher wie einen echten Burgsaal aussehen lassen würde.«
»Und damit hat er recht gehabt«, sagte Marta, die Lippen ein wenig geschürzt. »So sieht es besser aus.«
»Ja, vielleicht schon, aber leider hat es auch mein Budget für dieses Jahr verschlungen«, erwiderte Sophie verärgert. »Ich hatte eine ganze Liste neuer Anschaffungen, die ich mir nun nicht mehr leisten kann. Wir konnten es uns ja nicht einmal leisten, die verdammten Paneele anbringen zu lassen.« Sie blickte auf ihre zerschrammten, schwieligen Hände. »Während Sie alle zu Hause waren, bis Mittag geschlafen und Truthahnreste vertilgt haben, war ich jeden Tag mit Ted Albright hier und habe die Bretter angebracht. Gott, war das ein Alptraum. Können Sie sich vorstellen, wie hoch der Saal ist?«
Das Debakel mit der Holzverkleidung war Grund für eine weitere Auseinandersetzung mit Ted Albright »dem Dritten« gewesen. Ted war der einzige Enkel des großen Archäologen und alleiniger Besitzer der Albright-Sammlung. Dummerweise war er zudem der Besitzer des Museums und Sophies Chef. Sie verfluchte den Tag, an dem sie zum ersten Mal von Ted Albright und seinem Museumskonzept gehört hatte, das sie eher an die Einrichtung eines Kuriositätenkabinetts erinnerte. Aber solange sich für sie nicht eine Position in einem anderen Museum auftat, machte sie eben diesen Job.
Marta wandte sich zu ihr um. Ihre Augen waren kalt und … enttäuscht. »Zwei Wochen allein mit Ted Albright zu verbringen klingt für mich nicht nach einem Alptraum. Der Mann ist attraktiv.« Ihre Stimme klang spitz. »Es wundert mich, dass Sie überhaupt irgendetwas geschafft haben.«
Unbehagliches Schweigen senkte sich über das Trüppchen, als Sophie schockiert die Frau anstarrte, für die sie vier Monate lang Mentorin gewesen war. Bitte nicht schon wieder. Doch leider hörte es scheinbar nicht auf.
Die jungen Männer tauschten verwirrte Blicke aus, aber Sophie wusste durchaus, auf was Marta anspielte. Die Enttäuschung, die sie eben in Martas Blick gesehen hatte, ergab nun Sinn. Wut und Ablehnung stiegen in ihr auf, aber sie verdrängte sie und beschloss, nur auf diese Andeutung einzugehen und zu ignorieren, was in der Vergangenheit geschehen war. Im Augenblick wenigstens.
»Ted ist verheiratet, Marta. Und nur der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass wir gar nicht allein waren. Teds Frau und seine beiden Kinder haben uns die ganze Zeit geholfen.«
Marta schwieg, doch ihr Blick blieb eisig. Verlegen stieß Bruce den Atem aus. »Okay«, sagte er. »Im letzten Semester haben wir also den Großen Saal aufpoliert. Was kommt als Nächstes, Dr. J?«
Ohne auf die Wut in ihrem Bauch zu achten, führte Sophie ihre Helfer zum Ausstellungsbereich hinter dem Großen Saal. »Das nächste Projekt ist die Waffenausstellung.«
»Ja!« Spandan stieß die Faust in die Luft. »Endlich! Darauf habe ich gewartet!«
»Na, dann hat das Warten jetzt ein Ende.« Sophie hielt an der Vitrine an, in der ein halbes Dutzend sehr seltener mittelalterlicher Schwerter ausgestellt waren. Der Houarneau-Teppich war atemberaubend, aber diese Waffen waren ihr aus der ganzen Sammlung am liebsten.
»Ich frage mich immer, wem sie mal gehört haben. Wer damit gekämpft hat«, sagte Bruce leise.
John rollte seinen Stuhl näher heran. »Und wie viele Menschen durch die Klinge gestorben sind«, murmelte er. Er schaute auf, die Augen hinter dem Haar verborgen, das ihm stets ins Gesicht hing. »Tut mir leid.«
»Schon in Ordnung«, sagte Sophie. »Das frage ich mich auch oft.« Ihre Lippen zuckten, als ihr etwas einfiel. »An meinem allerersten Tag als Kuratorin hat ein Kind versucht, den Anderthalbhänder aus dem 15. Jahrhundert aus der Halterung zu ziehen und Braveheart zu spielen. Mir ist fast das Herz stehengeblieben.«
Bruce schnappte entgeistert nach Luft. »Es war nicht hinter Glas?« Auch Spandan und John sahen sich entsetzt an.
Marta blieb ein wenig zurück. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt, den Kopf schief gelegt und schwieg.
Sophie überlegte einen Moment, beschloss dann aber, die Sache lieber unter vier Augen zu klären. »Nein. Ted ist der Meinung, dass eine Glasscheibe zwischen Fundstücken und Publikum den ›Unterhaltungseffekt‹ schmälert.« Darüber hatten sie sich zum ersten Mal gestritten. »Er hat eingewilligt, diese hier einzuschließen, unter der Voraussetzung, dass wir die weniger wertvollen im Großen Saal ausstellen.« Sophie seufzte. »Und dass wir diese kostbaren Stücke auf ›unterhaltsame‹ Art zeigen. Jedenfalls war die Vitrine hier ein vorübergehender Kompromiss, bis der Große Saal fertiggestellt war. Also – das ist unser neues Projekt.«
»Was genau soll denn ›auf unterhaltsame Art‹ bedeuten?«, wollte Spandan wissen.
Sophie zog die Stirn in Falten. »Irgendetwas mit Puppen und Kostümen«, sagte sie düster. Kostüme waren Teds große Leidenschaft, und wenn er nichts weiter verlangte, als Schaufensterpuppen zu kostümieren, dann konnte sie durchaus damit leben. Aber vor zwei Wochen hatte er sie in seinen neusten Plan eingeweiht, der Sophies Tätigkeitsprofil eine neue Variante hinzufügte: Um den Großen Saal richtig populär zu machen, würden sie Führungen geben … in historischer Kleidung! Hauptsächlich Sophie und Teds neunzehnjähriger Sohn sollten diese Führungen leiten, und nichts, was Sophie einwenden konnte, hatte Ted von seinem Plan abgebracht. Am Ende hatte sie sich rundweg geweigert – woraufhin Ted Albright einen Wutanfall bekommen und ihr mit Kündigung gedroht hatte.
Dabei war Sophie kurz davor gewesen, selbst zu kündigen. Doch als sie am gleichen Abend zu Hause die Post durchsah, musste sie feststellen, dass das Pflegeheim die Miete für Annas Zimmer angehoben hatte. Also schluckte Sophie ihren Stolz herunter, zog sich das verdammte Kostüm an und leitete Teds verdammte Führungen. Tagsüber. Am Abend verdoppelte sie ihre Anstrengungen, eine neue Stelle zu finden.
»Hat der Junge das Schwert denn beschädigt?«, fragte John.
»Zum Glück nicht. Wenn Sie damit umgehen, sollten Sie unbedingt Handschuhe tragen.«
Bruce wedelte mit seinen weißen Handschuhen wie mit einer Fahne zur Kapitulation. »Das tun wir doch immer«, sagte er fröhlich.
»Und das weiß ich zu schätzen.« Ihr war klar, dass er sie aufzumuntern versuchte, und auch dafür war Sophie ihm dankbar. »Ihre Aufgabe ist folgende: Jeder von Ihnen wird ein Ausstellungskonzept anfertigen, inklusive Platzbedarf und Kostenberechnung der Materialien, die Sie benötigen würden. Das möchte ich in drei Wochen sehen. Planen Sie nichts Aufwendiges. Mein Budget ist erschöpft.«
Sie überließ die drei Männer ihrer Arbeit und ging zu Marta, die reglos und mit steinerner Miene zugehört hatte. »Also – was ist?«, fragte Sophie.
Marta, eine zierliche Frau, musste den Hals recken, um Sophies Blick zu begegnen. »Wie bitte?«
»Marta, offensichtlich haben Sie etwas aufgeschnappt. Offensichtlich haben Sie außerdem beschlossen, es nicht nur zu glauben, sondern mich auch öffentlich damit zu konfrontieren. So wie ich es sehe, haben Sie jetzt zwei Alternativen: Entweder Sie entschuldigen sich, und wir arbeiten weiterhin zusammen, oder Sie bleiben bei Ihrer Haltung.«
Marta zog die Brauen zusammen. »Und dann?«
»Da ist die Tür. Dies ist ein Freiwilligenprojekt – und das gilt für beide Seiten.« Sophies Miene wurde sanfter. »Hören Sie, Sie sind ein nettes Mädchen und eine Bereicherung für unsere Museumsprojekte. Es wäre nicht schön, wenn Sie gingen. Mir wäre die erste Alternative lieber.«
Marta schluckte. »Ich habe eine Freundin besucht. Am Shelton College.«
Shelton. Die Erinnerung an die wenigen Monate, die sie an diesem College eingeschrieben gewesen war, verursachte Sophie noch immer Übelkeit – obwohl es schon zehn Jahre her war. »Es war nur eine Frage der Zeit.«
Martas Kinn bebte. »Ich habe vor meiner Freundin mit Ihnen angegeben. Sie wären mein Vorbild, meine Mentorin, eine kluge Archäologin, die es mit ihrem Verstand weit gebracht hätte. Meine Freundin aber hat nur gelacht und gesagt, Sie hätten es vor allen Dingen mit anderen Körperteilen so weit gebracht. Sie hätten mit Dr. Brewster geschlafen, damit Sie in sein Ausgrabungsteam in Avignon kämen – so hätten Sie Ihren Einstieg geschafft! Und in Frankreich wären Sie mit Dr. Moraux ins Bett gegangen und dadurch so rasant aufgestiegen. Hätten nur deswegen so jung schon ein eigenes Ausgrabungsteam bekommen. Ich habe meiner Freundin gesagt, dass das nicht sein kann – so etwas würden Sie nie tun.« Sie sah ihr direkt in die Augen. »Oder?«
Sophie wusste durchaus, dass sie jedes Recht der Welt hatte, Marta zu sagen, dass es sie überhaupt nichts anginge. Aber Marta war offenbar desillusioniert. Und gekränkt. Also riss Sophie die Wunde auf, die nie wirklich verheilt war. »Habe ich mit Brewster geschlafen? Ja.« Und sie empfand noch immer Scham. »Habe ich es getan, um in sein Ausgrabungsteam zu kommen? Nein.«
»Aber warum dann?«, flüsterte Marta. »Er war verheiratet.«
»Das weiß ich jetzt – damals wusste ich es nicht. Ich war jung. Er war um einiges älter und … hat mich belogen. Ich habe einen dummen Fehler begangen, Marta, und ich bezahle immer noch dafür. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich das, was ich erreicht habe, ohne Dr. Alan Brewster geschafft habe.« Allein seinen Namen auszusprechen hinterließ einen bitteren Geschmack auf ihrer Zunge, doch sie sah, wie Martas Miene sich änderte und sie akzeptierte, dass ihr Vorbild auch nur ein Mensch war.
»Und ich habe nie mit Etienne Moraux geschlafen«, fügte sie erbittert hinzu. »Ich stehe heute da, wo ich eben stehe, weil ich mich abgerackert habe. Ich habe mehr Artikel veröffentlicht als jeder andere, das Handwerk von der Pike auf gelernt und auch die elendste Routinearbeit erledigt. So sollten Sie es auch tun. Und, Marta – keine Bemerkungen mehr über Ted. Ob wir uns über das Museum streiten oder nicht – Ted liebt seine Frau und ist ihr absolut treu. Darla Albright ist einer der nettesten Menschen, denen ich je begegnet bin. Gerüchte wie diese können eine Ehe zerstören. Haben wir uns verstanden?«
Marta nickte erleichtert. »Ja.« Nachdenklich neigte sie den Kopf. »Sie hätten mich auch sofort rausschmeißen können.«
»Hätte ich. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich Sie noch brauchen werde – vor allem für diese neue Ausstellung. Ich habe überhaupt keinen Sinn für Mode – weder für die heutige noch für die aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Und deshalb werden wohl Sie Teds blöde Puppen anziehen müssen.«
Marta lachte leise. »Das mache ich gern. Danke, Dr. J. Dafür, dass ich bleiben kann. Und für Ihre Aufrichtigkeit. Wenn ich meine Freundin das nächste Mal spreche, sage ich ihr, dass meine ursprüngliche Meinung steht.« Sie lächelte charmant. »Ich möchte immer noch wie Sie sein, wenn ich erwachsen bin.«
Peinlich berührt schüttelte Sophie den Kopf. »O nein, das wollen Sie nicht. Und jetzt an die Arbeit.«
Sonntag, 14. Januar, 12.25 Uhr
Vito hatte überall dort eine rote Flagge in den Schnee gesteckt, wo Nick einen Metallgegenstand ausgemacht hatte. Nun standen Nick, Vito und Jen nebeneinander und blickten unglücklich auf die fünf kleinen Wimpel.
»Jede Markierung könnte ein weiteres Opfer bedeuten«, sagte Jen leise. »Wir müssen es herausfinden.«
Nick seufzte. »Wir werden das ganze Feld umgraben müssen.«
»Und dazu brauchen wir jede Menge Leute«, brummte Vito. »Kann die CSU das leisten?«
»Nein. Ich muss Unterstützung anfordern. Aber ich habe keine Lust, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, ohne sicher zu sein, dass unter den roten Dingern nicht nur Coladosen oder ein Haufen Nägel liegen.«
»Dann fangen wir doch einfach an einer Stelle zu graben an«, sagte Nick. »Mal sehen, was wir ausbuddeln.«
Jen runzelte die Stirn. »Ja, könnten wir. Aber ich will vorher wissen, was sich unter uns befindet. Ich möchte keine Beweise zerstören, nur weil wir falsch oder zu schnell vorgegangen sind.«
»Leichenspürhunde«, schlug Vito vor.
»Vielleicht, aber besser noch wäre ein Scan von diesem Grundstück. Ich habe so etwas einmal auf dem History Channel gesehen. Sehr cool.« Jen seufzte. »Natürlich kriege ich nie im Leben die Mittel, um einen Anbieter zu bezahlen. Okay, holen wir die Hunde und los.«
Nick hielt einen Finger hoch. »Nicht so schnell. In dieser Sendung ging es doch um Archäologie, richtig? Na ja, wenn wir uns einen Archäologen besorgen, dann könnte der vielleicht diese … diese Radarnummer machen.«
Jen warf ihm einen scharfen Blick zu. »Kennst du denn einen?«
»Nein«, sagte Nick. »Aber in der Stadt gibt es etliche Universitäten. Da muss doch jemand aufzutreiben sein.«
»Aber wir bräuchten jemanden, der es billig macht, am besten sogar kostenlos«, warf Vito ein. »Und es müsste jemand sein, dem wir vertrauen können.« Vito dachte an die verdrahteten Hände. »Die Presse hätte einen Heidenspaß, wenn derjenige plaudern würde.«
»Und uns würde man den Hintern grillen«, brummte Nick.
»Wem müsst ihr vertrauen können?«
Vito wandte sich um und entdeckte die Gerichtsmedizinerin hinter ihm. »Hi, Katherine. Fertig?«
Katherine Bauer nickte müde und zupfte sich die Handschuhe von den Fingern. »Die Leiche ist im Bus.«
»Ursache?«, fragte Nick.
»Kann ich noch nicht sagen. Ich denke, sie ist mindestens seit zwei oder drei Wochen tot. Allerdings muss ich erst ein paar Proben unter dem Mikroskop sehen, um es genauer bestimmen zu können. Also.« Sie neigte den Kopf zur Seite. »Was war das mit dem Vertrauen?«
»Wir würden das Grundstück gern scannen lassen«, sagte Jen. »Wir wollten uns umhören, ob irgendwer Professoren der archäologischen Abteilungen der Unis kennt.«
»Ja, ich«, sagte Katherine, und die drei starrten sie an.
Jen riss die Augen auf. »Ehrlich? Du kennst einen lebendigen Archäologen?«
»Ein toter würde uns wohl nicht viel nützen«, bemerkte Nick, und Jen wurde rot.
Katherine lachte in sich hinein. »Ja, ich kenne eine echte, lebendige Archäologin. Sie nimmt sich momentan eine Art … Auszeit. Es heißt, sie sei eine Expertin auf ihrem Gebiet. Und sie hilft uns bestimmt.«
»Und ist sie diskret?«, hakte Nick nach, und Katherine tätschelte mütterlich seinen Arm.
»Sehr. Ich kenne sie seit über fünfundzwanzig Jahren. Ich kann sie sofort anrufen, wenn ihr wollt.« Sie wartete mit hochgezogenen Brauen.
»Dann wissen wir wenigstens mehr«, sagte Nick. »Ich bin dafür.«
Vito nickte. »Rufen wir sie an.«
Sonntag, 14. Januar, 12.30 Uhr
»Gott, das ist fantastisch.« Spandan hielt den Anderthalbhänder, auch Bastardschwert genannt, behutsam und respektvoll in seiner behandschuhten Hand. »Sie hätten den Jungen damals doch bestimmt am liebsten erwürgt, als er es von der Wand gerissen hat.«
Sophie blickte auf das Langschwert, das sie aus dem Glaskasten genommen hatte.
Sie hatten eine »kreative Pause« eingelegt, um die »Möglichkeiten der Ausstellung visualisieren« zu können, aber Sophie wusste genau, dass sie alle nur das Schwert in der Hand halten wollten. Und sie konnte es ihnen nicht verdenken. Eine derart alte – und tödliche – Waffe schien eine magische Kraft zu besitzen.
»Ich war eher auf die Mutter wütend, die mit ihrem Handy telefonierte, anstatt auf den Jungen aufzupassen.« Sie lachte leise. »Zum Glück hatte mein Hirn noch nicht ganz umgeschaltet, daher habe ich sie auf Französisch angeblafft. Aber, na ja … manche Dinge sind wohl international verständlich.«
»Was ist passiert?«, fragte Marta.
»Sie hat sich bei Ted beschwert. Er hat ihr die Eintrittskarte erstattet und mich dann um einen Kopf kürzer gemacht. ›Du darfst die Besucher nicht verschrecken, Sophie‹«, ahmte sie ihn nach. »Ich kann mich noch gut erinnern, wie sie mich angestarrt hat, als ich mit ihrem Bengel am Schlafittchen zu ihr kam. Sie war kaum größer als er und musste den Kopf in den Nacken legen, um mich anzusehen. Manchmal hat es Vorteile, groß zu sein.«
»Hier sind bessere Sicherheitsmaßnahmen dringend nötig«, sagte John und musterte das Schwert aus der Wikingerzeit in seinen Händen. »Es erstaunt mich, dass noch niemand etwas Wertvolles geklaut hat.«
Sophie zog die Brauen zusammen. »Wir haben zwar ein Alarmsystem, aber Sie haben recht. Vorher wusste ja kaum jemand, dass es uns gab, aber seit wir Führungen machen, bräuchten wir dringend einen Wachmann.« Der Lohn für einen solchen Angestellten war fest in ihrem Budget eingeplant gewesen. Aber nein – Ted wollte ja eine Holzverkleidung! Solche Unvernunft konnte sie in den Wahnsinn treiben. »Ich weiß von mindestens zwei Fundstücken aus Italien, die nicht mehr in ihren Fächern liegen. Ich sehe schon dauernd bei eBay nach, ob sie angeboten werden.«
»Da wünscht man sich ja mittelalterliche Rechtsprechung zurück«, brummelte Spandan.
»Was war denn die Strafe für Diebstahl?«, fragte John.
Sophie stellte das Langschwert vorsichtig in die Vitrine zurück. »Kommt drauf an, ob es im frühen, Hoch- oder Spätmittelalter war, was gestohlen worden war, ob es ein brutaler Raub war oder ein heimlicher Diebstahl, wer der Dieb war und wer das Opfer. Manch ein gewalttätiger Räuber ist gehängt worden, aber kleine Diebstähle wurden meist durch eine Geldbuße oder Wiedergutmachung geregelt.«
»Ich dachte immer, Dieben hätte man die Hand abgeschlagen oder ein Auge ausgestochen.«
»Nicht üblicherweise«, erklärte Sophie und musste lächeln, als sie Johns offensichtliche Enttäuschung sah. »Es wäre nicht sehr klug von den Lords gewesen, Leute, deren Arbeitskraft sie brauchten, zu verstümmeln. Einhändige oder Einfüßige konnten nicht so viel erwirtschaften.«
»Keine Ausnahmen?«, fragte Bruce, und Sophie warf ihm einen amüsierten Blick zu.
»Sind wir heute etwas blutdürstig? Hm. Ausnahmen.« Sie dachte nach. »Außerhalb von Europa gab es sicherlich noch ziemlich lange Kulturen, die das Auge-um-Auge-Recht praktizierten. Diebe verloren eine Hand und den Fuß an der anderen Körperhälfte. In der europäischen Kultur findet man das Abschlagen der ›Hand, die es getan hat‹ noch im zehnten Jahrhundert. Allerdings kam diese Strafe nur zur Anwendung, wenn der Täter Kircheneigentum gestohlen hat.«
»Ihre Schätze wären damals ohnehin in einer Kirche gelagert worden«, sagte Spandan.
Sophie lachte leise. »Das ist wohl wahr. Also sollten wir froh sein, dass sie im Hier und Jetzt und nicht damals geklaut worden sind. So – die ›kreative Pause‹ ist vorbei. Schwerter weg und wieder ran an die Arbeit.«
Schwer seufzend erhoben sich Spandan, Bruce und Marta und zogen ab. John war geblieben. Ehrfurchtsvoll, als handele es sich um eine Opfergabe, hob er ihr das Schwert mit beiden Händen entgegen, woraufhin sie es mit beiden Händen entgegennahm. Liebevoll musterte sie den stilisierten Knauf. »Ich habe einmal etwas Ähnliches gefunden. An einer Ausgrabungsstelle in Dänemark. Nicht ganz so schön wie dies und nicht so intakt. Die Klinge war in der Mitte komplett korrodiert. Aber das Gefühl, es freizulegen, es zum ersten Mal seit Hunderten von Jahren zu sehen … als wäre es ganz allein für mich erwacht.« Sie blickte auf ihn herab und lachte verlegen. »Ich weiß, das klingt verrückt.«
Sein Lächeln war andächtig. »Nein, nicht verrückt. Sie vermissen es, nicht wahr? Da draußen zu sein?«
Sophie schob den Inhalt der Vitrine zurecht und verschloss sie. »An manchen Tagen mehr als an anderen. Heute ausgerechnet sehr.« Und morgen, wenn sie wieder eine Führung in einem »historischen Kostüm« machen würde, noch mehr. »Dann gehen wir mal und …«
Ihr Handy klingelte, und das überraschte sie. Nicht einmal Ted würde sie sonntags stören. »Hallo?«
»Sophie, hier ist Katherine. Bist du allein?«
Sophie straffte ihren Körper, als sie die Dringlichkeit in Katherines Stimme hörte. »Nein. Sollte ich das lieber sein?«
»Ja. Ich muss mit dir reden. Es ist wichtig.«
»Okay, bleib dran. John, tut mir leid, aber ich muss dieses Gespräch führen. Können wir uns mit den anderen in ein paar Minuten in der Halle treffen?« Er nickte und wendete den Rollstuhl. Als er fort war, schloss Sophie die Tür. »Schieß los, Katherine. Was gibt es?«
»Ich brauche deine Hilfe.«
Katherines Tochter Trisha war seit Kindergartenzeiten Sophies beste Freundin gewesen. Und Katherine war für Sophie wie die Mutter, die sie selbst nie gehabt hatte. »Was ist?«
»Wir müssen ein Feld freilegen, und wir müssen wissen, wo wir graben sollen.«
Sophies Verstand kombinierte augenblicklich Gerichtsmedizin mit Ausgrabung, was vor ihrem geistigen Auge ein Bild von einem Massengrab heraufbeschwor. Sie hatte in den vergangenen Jahren Dutzende von Grabstätten freigelegt und wusste genau, worauf es ankam. Sie spürte, wie sich ihr Puls bei dem Gedanken, wieder an einer echten Ausgrabung beteiligt zu sein, beschleunigte. »Wann brauchst du mich und wo?«
»Am liebsten schon vor einer Stunde auf einem Feld eine halbe Stunde nördlich der Stadt.«
»Katherine, ich brauche mindestens zwei Stunden, um meine Ausrüstung herzuschaffen.«
»Zwei Stunden? Wieso denn?« Im Hintergrund hörte Sophie diverse murrende Stimmen.
»Weil ich im Museum bin, und zwar mit dem Bike. Ich kann mir nicht alles auf den Sattel binden. Erst muss ich nach Hause und Grans Auto holen. Außerdem wollte ich sie am Nachmittag besuchen. Ich muss wenigstens kurz bei ihr vorbeifahren und nach ihr sehen.«
»Das mit Anna übernehme ich. Du fährst ins Whitman College und holst deine Ausrüstung. Einer der Detectives wird dich dort mit seinem Wagen abholen.«
»Okay, dann soll er zu dem Gebäude mit der komischen Affenskulptur kommen. Ich stehe um halb zwei davor.«
Man hörte mehr Gemurmel, mehr Murren. »Okay«, sagte Katherine schließlich leicht genervt. »Detective Ciccotelli möchte ausdrücklich betonen, dass diese Sache absolut vertraulich zu behandeln ist. Du darfst wirklich niemandem etwas sagen.«
»Schon begriffen.« Sie kehrte in den Großen Saal zurück. »Leute, ich muss weg.«
Die Studenten begannen augenblicklich, ihre Sachen zusammenzuräumen. »Ist mit Ihrer Großmutter alles in Ordnung, Dr. J?«, fragte Bruce und sah sie besorgt an.
Sophie zögerte. »Ich denke schon.« Es war besser, wenn ihre Schüler glaubten, es ginge um Anna. »Jedenfalls haben Sie jetzt einen freien Nachmittag. Wehe, Sie amüsieren sich zu sehr.«
Als sie fort waren, schloss sie ab, schaltete die Alarmanlage ein und machte sich so schnell, wie das Gesetz es gerade noch erlaubte, auf den Weg zum Whitman College. Ihr Herz hämmerte heftig. Seit Monaten wünschte sie sich in die Praxis zurück. Wie es aussah, konnte sie endlich wieder die Arbeit machen, die ihr am meisten lag.
2. Kapitel
Sonntag, 14. Januar, 14.00 Uhr
Er setzte sich zurück, blickte auf den Bildschirm und nickte zufrieden. Das war gut. Sehr, sehr gut. Wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf. Fasziniert betrachtete er die Standfotos aus dem Video mit Warren Keyes. Er hatte sein Opfer gut ausgewählt – Größe, Gewicht, Muskulatur. Die Tätowierung des jungen Mannes hatte sein Schicksal besiegelt. Warren war zum Opfer geboren gewesen. Und er hatte exzellent gelitten. Die Kamera hatte seine Qual ganz hervorragend eingefangen. Aber seine Schreie …
Er klickte die Audiodatei an, und ein markerschütternder Schrei gellte mit kristallener Klarheit aus den Lautsprechern und ließ ihn schaudern. Perfekte Tonhöhe, perfekte Intensität. Perfekte Inspiration.
Sein Blick wanderte zu den Gemälden, die er neben die Fotos gehängt hatte. Diese Bilderserie war wahrscheinlich seine bisher beste. Er hatte sie Warren stirbt genannt. Natürlich in Öl angefertigt. Er hatte festgestellt, dass Öl das beste Medium war, die Intensität des Gesichtsausdrucks und den in unerträglichem Schmerz aufgerissenen Mund festzuhalten.
Und die Augen. Inzwischen wusste er, dass es verschiedene Stadien gab, bis durch Folter der Tod eintrat. Das erste Stadium hieß Angst, danach kam Trotz, dann Verzweiflung, wenn das Opfer begriff, dass es wirklich nicht entkommen konnte. Das vierte Stadium, Hoffnung, hing ganz und gar davon ab, wie das Opfer mit Schmerz umging. Wenn es die erste Phase überstand, gönnte er ihm eine Pause, die gerade so lang war, dass Hoffnung in ihm aufsteigen konnte. Warren Keyes konnte Schmerz bemerkenswert gut aushalten.
Und dann, wenn alle Hoffnung erloschen war, kam das fünfte Stadium – das Flehen, das mitleiderregende Betteln um den Tod, die Erlösung. Gegen Ende das sechste Stadium, das letzte Aufbäumen von Gegenwehr, das Urbedürfnis zu überleben, das purer, animalischer Instinkt war.
Aber das siebte Stadium war das beste und eines, das sehr flüchtig war – der Moment des Todes selbst. Die plötzliche Entladung … der Energieschub, wenn das Körperliche seine Essenz aufgab. Der Augenblick war so kurz, dass nicht einmal die Kamera ihn vollständig festhalten konnte, so flüchtig, dass er dem menschlichen Auge entging, wenn man nicht konzentriert hinsah. Er hatte konzentriert hingesehen.
Und war belohnt worden. Sein Blick blieb an dem siebten Gemälde hängen. Obwohl es in der Serie das letzte war, hatte er es zuerst gemalt, war zu seiner Staffelei gehastet, während Warrens entfesselte Energie jeden seiner Nerven vibrieren ließ und ihm der letzte, perfekte Schrei noch in den Ohren hallte.
Und er hatte es gesehen, in Warrens Augen. Das undefinierbare Etwas, das er bisher allein im Augenblick des Todes entdeckt hatte. Zum ersten Mal hatte er es in der Claire-stirbt-Serie vor über einem Jahr festhalten können. War es wirklich schon so lange her? Ja, die Zeit verging wirklich im Flug, wenn man sich amüsierte. Und das tat er jetzt – endlich. Schon sein ganzes Leben jagte er hinter dem undefinierbaren Etwas her. Nun hatte er es gefunden.
Genie. So hatte Jager Van Zandt es genannt. Mit Claire hatte er die Aufmerksamkeit des Unterhaltungsmoguls geweckt, und obwohl er persönlich mehr von seinen Zachary- und Jared-Serien hielt, blieb Claire VZs Favoritin.
Natürlich hatte Van Zandt seine Gemälde nie gesehen, nur die Computeranimation, in der er Claire in »Clothilde« verwandelt hatte, eine französische Hure im Zweiten Weltkrieg, die von einem Soldaten erwürgt wurde. Clothilde war der Star von Behind Enemy Lines, Van Zandts neustem »Entertainment-Abenteuer«, geworden.
Die meisten Menschen nannten so etwas Videospiel. Van Zandt fand es schicker, jedem zu erzählen, er baue ein Unterhaltungsimperium auf. Vor Behind Enemy Lines existierte dieses Imperium bloß in Van Zandts Träumen. Doch diese Träume waren wahr geworden: Behind Enemy Lines war ein absoluter Verkaufshit, und alles dank Clothilde und seiner absolut realistischen Animation. Dank meiner Kunst.
Und das hatte auch Van Zandt begriffen und Clothildes Bild im Augenblick ihres Todes gewählt, um es auf der Verpackung abzudrucken. Es gab ihm immer einen Kick, die Schachtel zu sehen und zu wissen, dass es seine Hände waren, die um den Hals der Frau lagen.
VZ hatte sein Genie erkannt, aber er war sich nicht sicher, ob der Mann mit der Realität seiner Kunst umgehen konnte. Also ließ er ihn glauben, was dieser lieber glauben wollte – dass Clothilde eine fiktive Gestalt war und er selbst Frasier Lewis hieß. Schließlich kam es nur darauf an, dass sowohl Van Zandt als auch er bekamen, was sie wollten. VZ erhielt ein »Entertainment-Abenteuer«, mit dem er Millionen umsetzte. Und Millionen sehen meine Kunst.
Was sein ultimatives Ziel war. Er hatte eine Gabe. VZs Unterhaltungsprojekte waren schlichtweg der effektivste Weg, seine Gabe in kürzester Zeit einem möglichst großen Publikum zu präsentieren. Wenn er sich erst einmal etabliert hatte, würde er keine Animationen mehr brauchen. Die Gemälde würden sich von selbst verkaufen. Doch im Augenblick brauchte er Van Zandt, und Van Zandt brauchte ihn.
VZ würde sehr zufrieden mit seinem neusten Werk sein. Er drückte die Maus und betrachtete einmal mehr seine Animation von Warren Keyes. Sie war perfekt. Jeder Muskel, jede Sehne war zu sehen, während der Mann gegen seine Fesseln ankämpfte und sich unter Schmerzen wand, als die Knochen langsam aus den Gelenken gezerrt wurden. Auch das Blut war sehr schön geworden. Nicht zu rot. Sehr authentisch. Eine sorgsame Betrachtung des Videos hatte es ihm ermöglicht, jede Einzelheit von Warrens Körper zu kopieren, bis zum kleinsten Zucken.
Mit Warrens Gesicht hatte er sich quasi selbst übertroffen. Die Furcht war hervorragend eingefangen, und auch der Trotz und der Widerstand, den der Mann seinem Kidnapper leistete. Und der bin ich. Der Inquisitor. Er hatte sich selbst als alten Mann dargestellt, der den anderen in seinen Folterkeller gelockt hatte.
Was ihn auf einen Gedanken brachte. Es war Zeit, sein nächstes Opfer zu suchen. Er klickte die Internetseite USAModels an, diese hübsche kleine Website, die es ihm so einfach machte, die richtigen Gesichter für seine Arbeit zu finden. Gegen eine bescheidene Gebühr konnten Schauspieler und Models ihre Sedkarten auf dieser Seite ausstellen lassen, so dass jeder Hollywood-Regisseur nur auf ein Bild klicken musste, um die betreffende Person sofort zu Ruhm und Ehre zu katapultieren.
Schauspieler und Models waren die besten Opfer. Sie waren schön, konnten Gefühle dramatisieren, sie hatten Leinwandpräsenz. Außerdem hungerten sie nach Ruhm und waren meist so knapp bei Kasse, dass sie beinahe jeden Job annahmen. Er hatte bisher jedes Opfer mit einem Part in einer Dokumentation locken können, wodurch es ihm möglich war, immer wieder als der harmlose, alternde Geschichtsprofessor namens Ed Munch aufzutreten. Allerdings musste er sich eingestehen, dass er Munch langsam leid wurde. Vielleicht sollte er nächstes Mal Hieronymus Bosch verkörpern. Na bitte – wenn das kein künstlerisches Genie war.
Er überflog die Bilder, die seine letzte Suche ergeben hatte. Er hatte zunächst fünfzehn mögliche Kandidaten gefunden, zehn davon jedoch rasch als ungeeignet eingeordnet – sie waren nicht arm genug, um sich von seinem Angebot locken zu lassen. Von den restlichen fünf waren drei so gut wie pleite. Ein Finanzcheck hatte erbracht, dass sie kurz vor dem totalen Bankrott standen.
Er hatte diese drei Anwärter eine Woche lang beschattet und herausgefunden, dass nur einer einsam genug war, um später nicht gesucht zu werden. Das war eine wichtige Komponente. Seine Opfer durften niemanden haben, der regelmäßig nach ihnen sah. Am besten waren Ausreißer wie die kleine Brittany mit den gefalteten Händen. Oder wie Warren und Billy, die den Kontakt mit ihm geheim gehalten hatten.
Von all den verbliebenen Kandidaten war Gregory Sanders der beste. Von seiner Familie verstoßen, allein. Das hatte er am Abend zuvor herausgefunden, als er Sanders in eine Bar gefolgt war. Er hatte sich als Geschäftsmann verkleidet, Sanders ein paar Drinks spendiert und den armen Burschen seine traurige Geschichte erzählen lassen. Sanders hatte niemanden. Und daher war er die perfekte Wahl.
Er klickte Gregorys Kontaktbutton an und schickte seine Standard-E-Mail los. Er hatte größtes Vertrauen in die Maßnahmen, die er zur – sowohl körperlichen als auch elektronischen – Verschleierung seiner Identität getroffen hatte. Spätestens morgen hatte Greg sein Angebot angenommen. Spätestens Dienstag hatte er ein neues Opfer. Und einen neuen Schrei.
Er stieß sich vom Tisch ab und erhob sich steif. Diese verdammten Winter in Philadelphia. Heute waren die Schmerzen wirklich stark. Abgesehen von dem Rausch, den seine Kunst ihm verschaffte, hatte sie noch einen anderen Nutzen – wenn er malte, vergaß er den Phantomschmerz, für den es keine Heilung gab, keine verdammte Erleichterung.