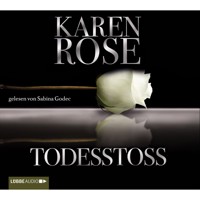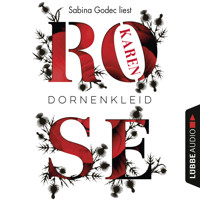9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Baltimore-Reihe
- Sprache: Deutsch
Dramatisch, leidenschaftlich, nervenaufreibend – der vierte Thriller in Karen Roses Baltimore-Reihe im neuen Look! Todesschüsse in Baltimore – ein Wahnsinniger versetzt die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Seine eigentlichen Zielobjekte: Detective Stevie Mazzetti und ihre Tochter. Privatermittler Clay Maynard, der schon seit langem ein Auge auf die hübsche Polizistin geworfen hat, versucht, die beiden in Sicherheit zu bringen. Panisch und in Todesangst erlebt Stevie den Albtraum ihres Lebens ein zweites Mal. Denn vor acht Jahren wurden bereits ihr Mann und ihr Sohn auf offener Straße Opfer eines brutalen Schusswechsels. Stevie beschleicht ein fürchterlicher Verdacht: Wurden sie damals womöglich gar nicht zufällig Opfer eines Verbrechens? Die perfekte Mischung aus nervenaufreibender Spannung, prickelnder Leidenschaft und erschütternder Dramatik! Die Baltimore-Thriller von Karen Rose sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Band 1: "Todesherz" - Band 2: "Todeskleid" - Band 3: "Todeskind" - Band 4: "Todesschuss" - Band 5: "Todesfalle" - Band 6: "Todesnächte"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1024
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Karen Rose
Todesschuss
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Todesschüsse in Baltimore – ein Wahnsinniger versetzt die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Seine eigentlichen Zielobjekte: Detective Stevie Mazzetti und ihre Tochter. Privatermittler Clay Maynard, der schon seit langem ein Auge auf die hübsche Polizistin geworfen hat, versucht, die beiden in Sicherheit zu bringen. Panisch und in Todesangst erlebt Stevie den Alptraum ihres Lebens ein zweites Mal. Denn vor acht Jahren wurden bereits ihr Mann und ihr Sohn auf offener Straße Opfer eines brutalen Schusswechsels.Nur langsam gelingt es Stevie und dem smarten Ermittler, Licht in einen verwickelten Fall zu bringen, der beinah ein Jahrzehnt in die Vergangenheit zurückreicht. Dabei beschleicht Stevie ein fürchterlicher Verdacht: Wurden ihr Mann und Sohn damals womöglich nicht zufällig Opfer eines Verbrechens?
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Dank
Karen Rose bei Knaur
Eine Liste aller Karen-Rose-Romane in chronologischer Reihenfolge:
Verzeichnis der auftretenden Figuren in den Romanen von Karen Rose
Erklärung
Für meine liebe Freundin Mandy, die Retterin der Pferde. Und der Katzen, Hunde, Ziegen, Hühner und Kühe. LOL. Danke, dass du mein Leben bereicherst.
Und wie immer für Martin, meinen ganz persönlichen Helden. Ich liebe dich.
Prolog
Ich kann nicht. Ich kann das nicht.
Die Worte dröhnten so laut in John Hudsons Kopf, dass sie das Piepen der Kasse vorne im Laden übertönten. Die Kundin zahlte ihre Einkäufe und ging, ohne zu ahnen, dass vor dem Regal mit dem Motoröl ein kaltblütiger Mörder stand.
Ich bin kein Mörder. Noch nicht.
Aber gleich. In weniger als fünf Minuten wirst du einer sein. Die Verzweiflung zog ihm die Kehle zu und brannte in seinem Magen. Sein Herz schlug plötzlich zu schnell und zu fest. Ich kann das nicht. Hilf mir, Gott, ich kann nicht.
Du musst aber. Die kleingedruckte Schrift auf der Rückseite der Ölflasche, die zu lesen er vorgab, verschwamm, als Tränen in seine Augen stiegen. Er wusste, was er zu tun hatte.
Mit zitternder Hand stellte John die Flasche zurück ins Regal. Er schloss die Augen und spürte das Brennen der heißen Tränen, die ihm über die vom Wind geröteten Wangen liefen. Er wischte sich mit dem Fingerknöchel die Augen, die rauhe Wolle der Handschuhe kratzte auf seiner wunden Haut. Blind griff er nach einer anderen Plastikflasche. Die Sekunden tickten. Er kannte das Risiko, er wusste, was es ihn kosten würde, wenn er ausführte, was man ihm aufgetragen hatte. Aber er wusste auch, welchen Preis er zahlen musste, wenn er es nicht tat.
Die SMS war heute Morgen gekommen. Eine SMS ohne Worte. Es waren auch keine nötig gewesen. Das angehängte Bild hatte alles gesagt.
Sam. Mein Junge.
Sein Sohn war längst kein Junge mehr. John wusste das. Mit zweiundzwanzig war sein Sohn ein Mann. Aber John hatte die besten Jahre im Leben seines Sohnes verpasst, weil er sich an nicht mehr viel erinnern konnte. In jener Zeit hatte sich bei ihm alles immer nur um den nächsten Schuss gedreht, um all das Zeug, ohne das er nicht leben zu können geglaubt hatte. Auch jetzt war er high, wenn auch nur gerade genug, um zu funktionieren – nicht jedoch, um ihn gegen das Grauen dessen, was er zu tun hatte, abzustumpfen.
Seine Sucht hatte ihn öfter, als er zählen konnte, mit dem Tod in Berührung gebracht. Im Rausch hatte er seine Frau verprügelt und manchmal fast umgebracht, und nun schien es, als würde er seinen Sohn umbringen.
Sam hatte es geschafft, ihr Viertel zu verlassen, clean zu bleiben, etwas aus sich zu machen. Sam hatte eine Zukunft. Vielmehr, er konnte eine haben, wenn John tat, was ihm aufgetragen worden war.
Mein Gott. Wie schaffe ich das nur? Mit bebender Hand klappte John sein Handy auf und betrachtete das Bild, das ihm mit der SMS geschickt worden war: sein Sohn, bewusstlos, an einen Stuhl gefesselt, aus dem Mundwinkel rann ein dünner Faden Blut. Sein Kopf hing schlaff zur Seite, eine behandschuhte Hand hielt ihm einen Pistolenlauf an die Schläfe.
Wie kann ich das tun? Wie kann ich nicht?
Der Auftrag war ursprünglich am Tag zuvor per SMS gekommen, von einer Nummer, die John nie mehr hatte sehen wollen. Aber er hatte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, und nun musste er seine Schuld bezahlen. Man hatte ihm das Zielobjekt durchgegeben, Ort und Zeit ebenso.
Das Zielobjekt kam jeden Abend auf dem Heimweg von der Arbeit in diesen Laden. John musste nur pünktlich aufkreuzen. Den Job erledigen. Es wie einen Zufall aussehen lassen. Falscher Ort, falsche Zeit.
Aber er hatte es gestern nicht geschafft. War nicht in der Lage gewesen, den Mini-Markt zu betreten. Hatte sich nicht dazu durchringen können, den Abzug durchzudrücken.
Also war der Einsatz erhöht und eine zweite SMS geschickt worden, diesmal mit dem Foto als Anhang. Und Sam war das Druckmittel. Mein Sohn. Es tut mir leid. Es tut mir so leid.
John hörte das leise Piepen, das beim Öffnen der Türen ertönte. Bitte lass es nicht ihn sein. Bitte lass ihn heute nicht vorbeikommen. Bitte nicht!
Aber wenn er es nicht ist, kannst du ihn auch nicht umbringen. Und dann wird Sam sterben.
»Hey, Paul.« Die Stimme kam von der Kassiererin, eine Afroamerikanerin über fünfzig, die viele Kunden mit Namen begrüßte. »Was gibt’s Neues aus den geheiligten Hallen?«
Johns Herz sank. Er ist es.Also tu, was du tun musst.
»Gar nichts«, antwortete Paul. Er klang müde, wodurch John seine Aufgabe irgendwie noch grausiger vorkam. »Es ist immer dasselbe. Die Cops stecken sie in den Knast, und wir geben alles, damit sie dort auch bleiben, aber meistens sind sie so schnell wieder auf der Straße, dass die Tür sie nicht mal mehr in den Hintern trifft.«
»Verteidiger. Miese Bande«, murmelte die Kassiererin. »Immer dasselbe, auch was die Zahlen angeht?«
»Meine Mutter ist ein Gewohnheitstier«, sagte Paul und grinste ein wenig schief.
»Und Sie sind ein guter Junge, dass Sie für sie jeden Abend die Lottoscheine holen.«
»Das macht sie glücklich«, erwiderte er schlicht. »Sie braucht nicht viel.«
Tu es endlich. Bevor er dir noch sympathischer wird.
Langsam bewegte er sich ans Ende des Ganges, um sich der Kasse zu nähern. Er tat, als müsse er sich am Kopf kratzen, griff unter seine Orioles-Baseballkappe und zog die Skimaske, die er darunter versteckt hatte, über sein Gesicht. Es hätte schlimmer kommen können. Er, die Kassiererin und sein Zielobjekt waren die Einzigen im Laden. Wenn er auch noch viele Zeugen töten müsste … Wenigstens das bleibt mir erspart!
»Das macht dann zehn Dollar«, sagte die Kassiererin. »Und wie geht’s Ihrer Frau? Schwangerschaft problemlos?«
Seine Frau ist schwanger. Tu das nicht. Tu das nicht!
Ohne auf das Geschrei in seinem Kopf zu achten, wirbelte John herum und zog dabei seine Waffe.
»Stehen bleiben, keiner bewegt sich«, knurrte er. »Hände hoch, so dass ich sie sehen kann.«
Die Kassiererin erstarrte. Johns Zielobjekt erbleichte, doch es hob die Hände und drehte die Handflächen nach vorne. »Geben Sie ihm, was er will, Lilah«, sagte Paul ruhig. »Nichts in diesem Laden ist Ihr Leben wert.«
»Was wollen Sie?«, flüsterte Lilah.
Das nicht. Das hier nicht.
Tu es. Oder Sam wird sterben. Daran zweifelte John nicht. Das Foto der SMS stieg vor Johns geistigem Auge auf. Die Hand, die die Waffe an Sams Kopf hielt, hatte bereits getötet. Sie würde Sam erschießen.
Tu. Es.
Mit zitternder Hand richtete John den Lauf auf Pauls Brust und drückte ab. Lilah schrie auf, als der Mann zu Boden ging. John sah eine Bewegung im Augenwinkel. Lilah hatte eine Waffe unter der Theke hervorgezogen. Mit zusammengepressten Kiefern schoss John ein zweites Mal, und Lilah sackte über der Theke zusammen. Blut rann aus dem Loch im Kopf, das John ihr verpasst hatte.
Es ist getan. John wurde übel. Raus hier, bevor du dich übergeben musst.
Er ging auf die Tür zu, als er plötzlich verblüfft erstarrte. Paul mühte sich wieder auf die Füße. Auf seinem weißen Hemd war kein Blut zu sehen. Löcher, ja, aber kein Blut. John dämmerte es. Der Mann trug eine Schutzweste.
Verdammt! John hob die Waffe und zielte diesmal auf die Stirn.
Plötzlich vernahm er das Piepen der sich öffnenden Tür. Johns Blick huschte nach links.
»Daddy!«
Oh, nein. Ein kleiner Junge. Der Teufel hatte nichts von einem Kind gesagt.
Verdammt, verdammt! Was jetzt? Was soll ich tun?
Und dann passierte alles rasend schnell. Viel zu schnell. Paul stürzte sich auf John und griff nach der Waffe. Sie rangen, während John versuchte, die Hand des anderen von der Pistole zu lösen.
Ich muss zielen können. Nur einmal richtig zielen. Er richtete den Lauf der Waffe auf den Arm seines Opfers, damit dieses ihn losließ, als der kleine Junge mit geballten Fäusten auf ihn zusprang. »Daddy!«
John schoss, und Paul schrie vor Schmerz auf. Das Kind verstummte.
Entsetzt blickten John und Paul zu Boden, wo der Junge in einer sich schnell ausbreitenden Blutpfütze lag. Die Kugel hatte Pauls Arm durchschlagen und war in die Brust des Kindes gedrungen. Es atmete nicht mehr.
Nein. Es wird sterben. Ich habe ein Kind erschossen. Nein. »Nein«, presste er hervor.
Paul sackte auf die Knie und warf sich über den Jungen. »Weg von ihm«, knurrte er. Er überprüfte den Puls, versuchte hektisch, mit den Händen den Blutfluss zu stoppen, doch sie zitterten zu sehr. »Paulie!«, brüllte er. »Paulie, ich bin’s, Daddy. Ich bin hier. Ich kümmere mich um dich. Alles wird wieder gut. Du musst mir nur zuhören, okay? Hör auf meine Stimme. Alles wird wieder gut!«
John hatte schon einen Schritt nach vorne getan, bevor er es bemerkte. Er hatte helfen wollen. Den Jungen retten wollen.
Kummer und Zorn brachten Paul dazu, sich auf die Knie zu stemmen, und er richtete sich auf, um John die Waffe aus der Hand zu schlagen. Gleichzeitig schirmte er das Kind mit seinem Körper ab. »Du Dreckschwein! Geh weg von meinem Sohn!«
Sam. John musste es beenden, andernfalls würden beide Söhne umsonst sterben. Er zwang seine Hand zur Ruhe, hob die Waffe und zielte auf Pauls Kopf. Dann feuerte er. Der Mann plumpste zu Boden und fiel über das Kind.
»Es tut mir so leid. Gott, es tut mir so leid.« John taumelte aus dem Laden und schaffte es bis zu seinem Wagen, doch seine Finger zitterten so sehr, dass er eine Weile erfolglos versuchte, den Schlüssel ins Zündschloss zu stecken, bis er endlich traf. Mit quietschenden Reifen fuhr er vom Parkplatz. Schon konnte er Sirenen hören.
Er musste weg. Musste Meldung machen, um Sam zurückzubekommen. Und dann … war ihm alles egal. Wenn die Cops ihn fassten … egal. Er musste nur Sam in Sicherheit bringen. Er verließ die Hauptstraße und fuhr wie betäubt durch die kleinen Straßen und Gassen, die er so gut kannte. Er war auf Autopilot.
Er war … innerlich wie tot. Ich habe die Frau umgebracht. Den Mann. Ich habe den kleinen Jungen umgebracht.
Ich habe ein Kind erschossen. Ich. Habe. Ein Kind. Erschossen.
Seine Kehle verschloss sich. Er konnte nicht mehr atmen. Er hatte seinen eigenen Sohn gerettet. Und den eines anderen getötet. Sam würde das nicht gutheißen. Sam würde ihn mehr denn je hassen, denn sein Sohn hatte eine sehr klare Vorstellung von Gut und Böse, Richtig und Falsch. Sam hätte nie zugelassen, dass sein Vater töten würde, um sein Leben zu retten.
Also darf er es nicht wissen. Ich werde es ihm einfach nicht sagen.
Er hatte den Treffpunkt erreicht, wo man ihm Sam zurückzugegeben versprochen hatte. John stieg aus dem Wagen, doch seine Beine gaben unter ihm nach. Er plumpste auf Hände und Knie und rang keuchend und würgend nach Luft. Doch so viele Atemzüge er auch tat, keiner brachte Erleichterung. Er würde ersticken. Er atmete zwar, aber seine Lungen bekamen einfach nicht genug Luft.
Ich habe ein Kind umgebracht. Ein unschuldiges Kind. Dafür muss ich büßen. Aber erst brauche ich Sam wieder. Dann …
»Ich werde mich stellen«, flüsterte er heiser. Aber noch bevor er diese Worte formuliert hatte, wusste er schon, dass er es nicht tun würde. Er war schon zweimal im Gefängnis gewesen. Niemals würde er dorthin zurückkehren. Er würde das schändliche Geheimnis dessen, was er getan hatte, mit ins Grab nehmen.
Er stemmte sich hoch, taumelte zurück zum Wagen, setzte sich hinters Steuer und gab eine SMS ein.
Es ist getan. Jetzt will ich meinen Sohn. Lebendig. Sofort. Wenn nicht, verrate ich alles. Er drückte auf Senden, steckte das Handy in die Tasche, lehnte sich zurück und schloss die Augen.
Ein paar Sekunden später summte es. Eine SMS war eingetroffen. Aber er hatte keine Vibration in seiner Tasche gespürt. Er wollte sich gerade aufsetzen, als er ein anderes Geräusch hörte, das er nur zu gut kannte. Das Klicken einer Pistole, die entsichert wurde.
Er schaute auf. Sah das Gesicht im Rückspiegel. Der Teufel selbst. Der Mann, mit dem er vor einem Jahr eine Abmachung getroffen hatte.
Ich hätte die Verurteilung akzeptieren und in den Knast gehen sollen.
Es wäre seine dritte Haftstrafe gewesen. Aller guten Dinge sind drei. Er wäre Jahre von Sam getrennt gewesen. Tja, das werde ich jetzt wohl sowieso sein. Für immer.
Weil der Teufel selbst ihm einen Lauf an den Hinterkopf hielt.
»Ich habe getan, was Sie wollten«, flüsterte John. »Ich habe alles getan, was Sie wollten.«
»Ich weiß. Und du hast es gut gemacht.«
»Was ist mit meinem Sohn?«
»Er wird freigelassen. Und er wird sich an nichts erinnern können.«
»Gut.« Es lag ihm ein »Danke« auf der Zunge, aber er beherrschte sich. Es gab nichts zu danken. Eine Frau, ein Mann und ein Kind waren tot. Er hätte den Hahn niemals durchgezogen, wenn der Teufel ihn nicht dazu gezwungen hätte.
Der Teufel hat mich dazu gezwungen. Er lachte laut auf und wusste, dass er hysterisch klang. Das Letzte, was er sah, war den Teufel, der im Rückspiegel den Kopf schüttelte.
1. Kapitel
Als es an der Bürotür klopfte, hob Todd Robinette den Blick und starrte düster auf das dunkle Holz. Er musste nicht fragen, wer dort draußen stand, er wusste es genau. Wenn Robinette rief, kamen seine Leute im Laufschritt. An jedem anderen Tag und zu jedem anderen Anlass wäre er über ihr bedingungsloses Engagement erfreut gewesen. Heute jedoch nicht. Und zu diesem Anlass ganz sicher nicht.
Haut ab, hätte er am liebsten geknurrt. Ich will das allein machen. Denn wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird … Aber er wusste, dass es nicht darum ging. Sein Personal war das beste. Seine Leute würden auftauchen, den Job erledigen, wieder verschwinden. Kein Chaos. Keine Schweinerei. Keine hässlichen Spuren, die die verdammten Cops finden konnten. Keine Sorgen.
Also belüg dich nicht selbst, Arschloch. Er stieß langsam den Atem aus. Na gut. Ich will das hier selbst machen. Ich will Chaos. Ich will eine Schweinerei. Ich will, dass die Cop-Schlampe mich um Gnade anfleht.
Das war die ungeschminkte Wahrheit. Er wollte, dass sie starb, aber das war nicht genug. Seit acht langen Jahren wünschte er sich, dass sie litt. Weil das, was sie ihm angetan hatte, mit einem simplen Tod nicht wiedergutzumachen war.
Ich könnte es tun. Ich hätte es verdient. Niemand würde es herausfinden. Niemand würde auch nur etwas vermuten.
Doch leider ließ sich niemals voraussagen, ob nicht doch jemand etwas sah. Es brauchte nur einen übereifrigen Zeugen, und alles brach zusammen und erforderte eine blitzschnelle Rettungsaktion. Blitzschnelle Rettungsaktionen neigten dazu, unsauber ausgeführt zu werden. Oder verdammt viel Geld zu kosten.
Diese Lektion hatte er vor acht Jahren gelernt, als er noch allein auf sich gestellt gewesen war, ein Bursche mit einem Job, dem kaum jemand Beachtung geschenkt hatte. Heute war sie gültiger denn je. Er hatte an Macht gewonnen, aber mit der Macht war auch das öffentliche Interesse an ihm gekommen. Heute berief er Vorstandssitzungen ein und hielt Reden vor potenziellen Spendern. Er konnte nicht einfach losziehen und Leute ermorden. Was eigentlich ausgesprochen ärgerlich war.
Auf der anderen Seite war seine öffentliche Präsenz auch ein großartiges Alibi, und zum Glück brauchte all die Macht auch Personal. Er hatte eine Direktorin für Public Relations, eine Sicherheitsmannschaft und eine Abteilung für Produktentwicklung – alle mit Experten besetzt. Noch wichtiger vielleicht: Er besaß eine Putzkolonne, die darauf spezialisiert war, Bedrohungen zu beseitigen, sobald sie auftraten. Ein kluger Mann würde diese Leute die Arbeit machen lassen, für die sie gut bezahlt wurden, und Todd Robinette war ein kluger Mann.
Er warf einen Blick auf das Foto auf seinem Schreibtisch. Ich bin ein kluger Mann, der zu viel geopfert hat, um nun alles zu verlieren.
Wie viele Nächte hatte er wach gelegen und sich Sorgen gemacht, sein Opfer könnte vielleicht doch nicht genug gewesen sein? Viel mehr, als er in Erinnerung behalten mochte, vor allem im ersten Jahr.
Und wie viele Nächte hatte er sich vorgestellt, wie es wäre, wenn er sie dauerhaft zum Verstummen brachte? Ebenfalls mehr, als er zählen mochte, vor allem im vergangenen Jahr. Die letzten zwölf Monate hatten seine Nerven arg strapaziert, aber er war ruhig geblieben und hatte sich zusammengerissen. Denn der richtige Zeitpunkt war noch nicht da gewesen.
Jetzt aber ist es so weit. Jetzt war nicht nur der richtige Zeitpunkt, sondern der ideale Zeitpunkt. Eine solche Chance würde er vielleicht nie wieder bekommen. Und es spielt keine Rolle, wer die Aufgabe erledigt, solange sie nachher tot ist.
Als es wieder klopfte, knurrte Robinette: »Herein.«
Henderson, das vertrauenswürdigste Mitglied seiner Reinigungsmannschaft, schloss die Tür hinter sich und blieb vor dem Schreibtisch stehen. Die Augen leuchteten bei der Aussicht auf ein neues Abenteuer. »Robbie. Was hast du für mich?«
Robinette holte tief Luft. »Einen wichtigen Job.« Er schloss den Schrank hinter seinem Schreibtisch auf, zog eine Mappe heraus und schob sie über die polierte schwarze Granitplatte, auf der sich neben dem gerahmten Foto nur noch ein schlanker Laptop und ein vielbenutzter Zauberwürfel befanden. »Detective Stefania Nicolescu Mazzetti, Mordabteilung. Wird Stevie genannt.«
Henderson betrachtete Mazzettis Foto, das an den Ordner geheftet war. »Darf ich fragen, warum?«
Sie hat mich gedemütigt. Fast vernichtet. Sie verhöhnt mich mit der bloßen Tatsache ihrer Existenz. Und sie kann mich unter die Erde bringen.
Aber er sprach nichts davon aus. Wie nah sie daran gewesen war, ihn in Handschellen abzuführen, wusste niemand. Zumindest niemand, der noch am Leben war.
Robinette drehte den silbernen Bilderrahmen so, dass Henderson das Gesicht auf dem Foto sehen konnte. »Sie hat meinen Sohn getötet.«
»Ah. Sie ist also diejenige, die Levi auf dem Gewissen hat.« Mit verengten Augen und unverhohlener Abneigung prägte sich Henderson Mazzettis persönliches Profil ein. »Sonst noch etwas, was ich wissen müsste?«
»Ja. Sie ist im Augenblick ausgesprochen wachsam. Allein in dieser Woche ist sie dreimal körperlich angegriffen worden. Das erste Mal war es eine Messerattacke, das zweite Mal hat ein Koloss von einem Mann ihr eine satte Gerade verpassen wollen. Heute Nachmittag hat man auf sie geschossen. Keiner hat nennenswerten Schaden angerichtet.«
»Keiner? Waren es Leute von uns?«
Robinette schnaubte. Als ob er derartige Inkompetenz tolerieren würde. »Unsinn. Diese Polizistin hat mehr Feinde als ein Krokodil Zähne. Wenn die vordersten Reihen wegbrechen, wachsen sofort neue nach.«
»Wir könnten unseren Angriff also den ›Krokodilzähnen‹ in die Schuhe schieben«, schloss Henderson trocken.
»Ganz genau.« Weswegen der Zeitpunkt derart ideal war.
»Konnte einer der Angreifer entkommen?«
»Der dritte. Der Schütze.« Was Robinette von großem Nutzen sein konnte. »Den Kerl mit dem Messer hat sie entwaffnen können und dann am Boden gehalten, bis Verstärkung kam. Dem Boxer ist es nicht viel besser ergangen. Der Schütze jedoch saß in einem weißen Camry, mit dem er nach dem Schuss abgehauen ist.«
Henderson war wider Willen beeindruckt. »Sie ist nur eins sechzig groß? Scheint einiges auf dem Kasten zu haben.«
»Dummerweise ja. Deshalb will ich, dass du das übernimmst. Du hast noch mehr auf dem Kasten.« Zum Beispiel ein Scharfschützenabzeichen der Armee, eine atemberaubende Trefferquote, eine roboterhafte Konzentrationsfähigkeit und eine kaltblütige Zähigkeit, die jeden Terrier beschämt hätte.
Beim Militär war Henderson einer der wenigen Menschen gewesen, in deren Gegenwart Robinette sich sicher gefühlt hatte. Das hatte sich nicht geändert. Was sich dagegen geändert hatte, war die Flagge, unter der sie kämpften. Vor langer Zeit und weit, weit weg war sie rot, weiß und blau gewesen. Nun war sie hundertprozentig grün. Und mit Bildchen von Franklin, Lincoln und sogar Washington versehen. Geld. Kalt, hart, ergiebig. Das Einzige, was wirklich zählte.
»Jemand muss sich um Mazzetti kümmern«, fuhr er fort. »Und du bist von all meinen Leuten am besten dazu ausgebildet.«
Henderson nickte knapp. »Das ist wahr. Warum sind all die anderen hinter ihr her?«
»Ihr ehemaliger Partner war bestechlich. Er ließ sich von reichen Eltern anheuern, die ihre missverstandenen Kinderchen davor bewahren wollten, für begangene Verbrechen ins Gefängnis zu wandern. Der Partner streute falsche Beweise aus, verhaftete die Falschen, kassierte viel Geld dafür, und alle waren zufrieden … bis er erwischt wurde. Jetzt ist er tot.«
»Und sie war auch daran beteiligt?«
»Ich denke ja«, log er, »aber das tut außer mir offenbar keiner.« Sein Leben wäre so viel leichter gewesen, wenn sie ebenfalls in diese Sache verstrickt gewesen wäre. »Sie sind hinter ihr her, weil sie versucht, all das, was Silas Dandridge verbockt hat, wieder geradezubiegen.«
Die kalten, blauen Augen leuchteten auf. »Silas Dandridge? An den Namen kann ich mich erinnern. Als ich im Sudan war, kam ein Artikel über ihn über den Newsfeed, das muss im März vergangenen Jahres gewesen sein. Er hat doch für den Anwalt gearbeitet, der ein ganzes Team von korrupten Cops unter sich hatte, nicht wahr?«
»Cops und Ex-Häftlinge. Stuart Lippman stand auf Chancengleichheit bei seinen Angestellten. Nun ist auch er tot.«
Henderson zog nachdenklich die Brauen zusammen. »Ich kann mich erinnern, in dem Artikel gelesen zu haben, dass Lippman eine Datei all seiner Handlanger und deren Verbrechen besaß, die ›im Falle seines gewaltsamen oder ungewöhnlichen Todes‹ automatisch an die Staatsanwaltschaft gehen sollte.«
Zum Glück war die Liste nicht vollständig, dachte Robinette, nickte jedoch. »Diese Datei war Lippmans Lebensversicherung. Sie hielt seine Handlanger davon ab, ihn umzubringen, und sorgte außerdem dafür, dass sie sich gegenseitig im Auge behielten. Wenn jemand den Boss verraten hätte, hätten alle darunter gelitten.«
»Schlau. Warum also hat diese Polizistin so viele Feinde, wenn niemand glaubt, dass sie daran beteiligt war?«
»Weil sie in den wiederaufgenommenen Lippman-Fällen ermittelt. Allein im vergangenen Monat konnte sie vier abschließen: drei Vergewaltiger und ein bewaffneter Räuber, für die drei Unschuldige in Zellen saßen und für fremde Sünden bezahlten. Es gibt Leute, die gar nicht glücklich darüber sind, dass sie ausgerechnet in dieses Wespennest gestochen hat.«
»Kann ich mir denken. Drei Vergewaltiger und ein bewaffneter Räuber. Die Lady ist wirklich umtriebig.«
Robinette zuckte die Achseln. »Sie hat gerade ein bisschen Zeit zur Verfügung.«
»Hat man ihr gekündigt, nachdem die Sache aufgeflogen war? Mit gefangen, mit gehangen?«
Schön wär’s. »Nein. Nach Dandridges Enttarnung hat es eine Untersuchung der Dienstaufsichtsbehörde gegeben, aber sie wurde entlastet.« Sogar hundertprozentig und ganz ohne Zuhilfenahme von grünen Scheinchen. Sie war ein Cop, den man nicht kaufen konnte. »Sie ist momentan krankgeschrieben. Eine der irren Ku-Klux-Klan-Groupies im Millhouse-Fall hat sie vor dem Gerichtshof angeschossen.«
»Ach ja, das habe ich im Fernsehen gesehen. Als ich zwischen zwei Aufträgen in Madrid war, schaffte die Meldung es in die internationalen Nachrichten. War das nicht kurz vor Weihnachten? Eine Sechzehnjährige hat sich aufgeregt, weil der Vater ihres Kindes wegen Mordes schuldig gesprochen worden war, und vor dem Gerichtsgebäude wild um sich geschossen. Sie hat mindestens zwei Cops erwischt, richtig? Und ist sie nicht anschließend ebenfalls erschossen worden?«
»Ja. Von Mazzetti.«
»Das war Mazzetti? Sie hat die Kleine mitten zwischen den Augen erwischt, obwohl sie selbst blutete wie ein angestochenes …« Henderson brach abrupt ab. »Tut mir leid, Robbie. Das war sehr taktlos von mir.«
Robinette hob die Schultern. »Das war es zwar, deswegen ist es aber nicht weniger wahr. Wir hatten ja bereits festgestellt, dass Mazzetti durchaus gewisse Fähigkeiten besitzt.« Er verstummte verbittert. Auch seinen Sohn hatte Mazzetti direkt zwischen die Augen getroffen. »Zwei der drei letzten Angriffe wurden von reichen Eltern initiiert, die verärgert sind, dass sie ihre Sprösslinge nun doch zur Rechenschaft zieht. Der Schütze ist nicht erwischt worden, aber ich gehe von einem ähnlichen Motiv aus. Solche Attacken werden sich wahrscheinlich fortsetzen. Bis jemand sie endlich ausschaltet.«
»An welcher Stelle ich ins Spiel komme.«
»Ja. Und du musst losschlagen, bevor die Cops sie in irgendein sicheres Haus stecken. Falls das geschieht, haben wir unsere Chance vertan. Das würde mich ziemlich ärgern.«
»Keine Sorge. Ich werde mich darum kümmern.«
»Gut. Um dir deinen Job ein bisschen einfacher zu machen, kann ich dir verraten, dass sie morgen Nachmittag um drei im Harbor House Restaurant sein wird.«
Henderson runzelte die Stirn. »Und woher weißt du das?«
»Weil morgen der fünfzehnte März ist. Seit sieben Jahren geht sie jeden fünfzehnten März um drei Uhr dorthin.« Was er wusste, weil er sie seit so langer Zeit beschatten ließ. »Sie trifft eine Psychologin, die aus Florida kommt. Dr. Emma Townsend.«
Henderson blätterte durch die Seiten der Mappe. »Kein Foto von dieser Townsend?«
»Google sie. Sie hat eine Seite bei Amazon. Sie schreibt Selbsthilfebücher zur Trauerbewältigung. Mir wär’s lieb, wenn sie nicht stirbt, aber wenn du Mazzetti nicht anders erwischen kannst, dann tu, was du tun musst.«
Ausdruckslos schaute Henderson von der Akte auf. »Mazzetti hat ein Kind?«
»Cordelia«, sagte Robinette. »Sie ist sieben. Falls Mazzetti sich im Restaurant nicht blicken lässt, kommst du über ihre Tochter an sie heran. Sie hat Samstagnachmittag Ballettunterricht.«
»Ja, ich sehe es. Stanislaskis Studio. Also gut. Ich rufe an, sobald die Sache erledigt ist.«
»Nein, tust du nicht. Und ich brauche die Akte zurück.« Henderson reichte ihm die Mappe, und Robinette schob den Inhalt in den Schredder unter seinem Tisch. »Ich will keine zurückverfolgbare Spur, weder in Papierform noch elektronisch. Nichts, was die Cops finden könnten. Wenn du es geschafft hast, werde ich auf CNN davon erfahren. Okay – das ist alles.«
Henderson ging, aber Robinettes Bürotür schloss sich nicht ganz. Wieder klopfte jemand leicht gegen den Türrahmen. »Robbie? Hast du einen Moment Zeit?« Fletcher steckte den Kopf zur Tür herein.
»Klar.« Robinette winkte den Leiter seiner Entwicklungsabteilung ins Zimmer. »Nicht dass ich noch zum Arbeiten kommen könnte.«
»Wann ist das schon je der Fall?« Beim Anblick von Levis Bild, das nicht mehr an seinem gewohnten Platz stand, schwand Fletchers Grinsen. »Du willst es also endgültig tun.«
»Es« musste nicht näher bezeichnet werden. Fletcher war auf Levis Beerdigung für ihn da gewesen – Fletcher, Henderson, Miller und Westmoreland. Seine Freunde. Ein vertrauenswürdiges Team.
Die Begräbniszeremonie hatte mit offenem Sarg stattgefunden, weil Stevie Mazzetti wirklich eine verdammt gute Schützin war. Das Loch, das ihre Kugel in Levis Kopf hinterlassen hatte, war so sauber gewesen, dass der Visagist des Beerdigungsinstituts keine Mühe gehabt hatte, es zu überschminken.
Und wie sein Sohn so dagelegen hatte … so friedlich hatte er seit Jahren nicht ausgesehen.
Robinette stellte den Silberrahmen wieder an die ursprüngliche Stelle. »Ja. Ich werde es endlich tun. Das heißt, Henderson wird es tun.«
»Das wurde auch Zeit«, sagte Fletcher mit belegter Stimme. »Wir hätten es auch schon vor acht Jahren für dich erledigt, aber ich verstehe, warum du warten wolltest. Du hast mehr Geduld als wir anderen.«
»Nein, eigentlich nicht.« Nur weniger Lust, in den Knast zu wandern. »Aber wo wir gerade von Geduld sprechen – was haben die Tests ergeben? Bringt das unanständig teure Equipment, das wir deiner Meinung nach so dringend gebraucht haben, tatsächlich die erwünschten Ergebnisse?«
Fletcher schob ihm ein schlichtes Blatt Papier über den Tisch. »Hier. Bilde dir selbst ein Urteil.«
Auf dem Zettel war kein Firmenlogo zu sehen. Nichts deutete auf eine Verbindung zwischen Fletchers Lieblingsprojekt und Filbert Pharmaceutical Labs hin. Oder zum Präsidenten des Unternehmens. Zu mir also. Oder zum Vorstandsvorsitzenden. Ebenfalls zu mir also.
Denn alle anderen Führungskräfte des Unternehmens waren tot. Robinette warf einen raschen Blick auf den bunten Zauberwürfel. Mögen sie in Frieden ruhen.
Robinette las die Zusammenfassung, die in Fletchers präziser Handschrift erstellt war. Die Neuigkeiten waren gut. Sehr gut sogar. Er senkte das Blatt und nickte Fletcher knapp zu. »Du bist ein verdammtes Genie.«
»Ich weiß«, sagte Fletcher feierlich und grinste. »Es ist noch nicht so gut, wie es irgendwann einmal sein wird, aber in der Zusammensetzung jetzt schon doppelt so lange haltbar wie alles andere, was es bisher gibt.«
»Hat sich die Kunde schon verbreitet?«
»Oh, ja. Ich habe die Bestätigung von drei Gruppen, die Demoproben erhalten haben. Im Einsatz war die Wirkkraft genauso groß wie am Tag der Herstellung – wie versprochen. Man ist beeindruckt.«
Robinette zog die Brauen zusammen. »An wem ist es getestet worden?«
»Wen kümmert’s? Nichts ist in die Nachrichten gedrungen. Ich habe sehr genau hingehört und -gesehen.«
»Gut. Einen Vorfall, der das Interesse der Medien weckt, können wir nicht gebrauchen.«
»Mach dir keine Gedanken. Unsere Kunden sind immer diskret gewesen. Außerdem wissen sie, dass wir ihnen nichts mehr verkaufen, wenn sie erwischt werden.« Fletchers Augenbraue wanderte aufwärts. »Und sie wollen mehr. So viel ich herstellen kann und so schnell wie möglich.«
Robinette überschlug rasch im Kopf, welchen Gewinn sie damit erzielen konnten, und nickte zufrieden. »Wie bald kannst du die erste Ladung für den Versand fertig machen?«
»Ist schon alles verpackt. Wir rechnen damit, dass die nächste Charge Impfstoff bis Freitag versandfertig ist. Westmoreland und Henderson werden die Fracht begleiten.«
Bis dahin würde Henderson Robinettes Sonderauftrag erledigt haben. »Wunderbar. Nicht dass unser Gut in die falschen Hände gerät.«
Fletchers Augen leuchteten gierig auf. »Wobei die falschen Hände die sind, die uns kein Geld hinhalten.«
»Sehr richtig.« Robinette steckte auch diesen Zettel in den Schredder. »Nimm dir das Wochenende frei. Du hast es dir verdient.«
»Ein paar von uns wollen morgen Abend in die Stadt. Ein, zwei Bier trinken, ein bisschen Spaß haben. Du solltest mitkommen. Wie in alten Zeiten.«
»Ich kann nicht. Brenda Lee meint, ich darf in der Öffentlichkeit nicht mehr trinken – schlechte PR angesichts meiner Bemühungen zur Bekämpfung von Drogen- und Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen.« Fletcher war im Bereich Chemie ein Genie, doch Brenda Lee Miller war eine wahre PR-Zauberin. »Außerdem ist sie noch immer sauer wegen der bierseligen ›Auseinandersetzung‹ von damals.«
Sie, der es gelungen war, Robinette von einem Mordverdächtigen in eine Stütze der Gesellschaft zu verwandeln, war nicht gerade entzückt gewesen, als sie im Jahr zuvor eine Kneipenschlägerei zu verwischen hatte. Sie hatte recht gehabt: Beinahe wären acht Jahre harter Arbeit ruiniert worden, nur weil Robinette diesem Vollidioten ein paar Hiebe verpassen musste. Zum Glück war Brenda Lee außerdem seine Anwältin, so dass sie die Sache diskret, still und gründlich erledigt hatte.
Robinette hätte sich gewünscht, dass seine Frau ebenso still und diskret reagiert hätte. Doch Lisa war so wütend gewesen, dass sie das Thema noch heute immer wieder zur Sprache brachte.
Fletcher zuckte die Achseln. »Dann trinkst du eben nicht. Spaß haben kannst du trotzdem. Ich hab’s jedenfalls nötig. Und sei mir nicht böse, wenn ich das mal so sage: du auch.«
»Ich könnte mir vorstellen, dass Lisa böse wäre, wenn du das mal so sagst«, erwiderte Robinette trocken. Er hatte erwartet, dass Fletcher die Augen verdrehen würde, und wurde nicht enttäuscht. »Nun ja, sie ist schließlich meine Frau.«
»Ja, doch, ich erinnere mich. Ich war auf der Hochzeit. Sie ist … oh, ich bin sicher, dass sie auch Vorzüge hat. Zum Beispiel …« Fletcher gab vor, intensiv zu grübeln, zuckte dann aber wieder die Acheln. »Mist. Mir will nichts einfallen.«
Robinette schnaubte. »Sie hat Geld und großartige Verbindungen, und sie sieht verdammt gut aus.« Und durch sie vergisst der Rest der Welt meine unglückselige Vergangenheit. »Denk sie dir einfach als geschäftliches Accessoire, wie eine teure Krawatte.«
»Eher wie ein Galgenstrick.«
»Fletch«, murmelte Robinette warnend. »Das lass ich dir nur durchgehen, weil wir schon so lange befreundet sind.«
»Und weil ich das verdammte Genie bin, das dich unanständig reich macht.«
»Auch das. Aber hüte dich. Sie ist meine Frau, ob du sie nun magst oder nicht. Im Übrigen könnte ich sowieso nicht mit euch um die Häuser ziehen. Lisa und ich müssen morgen an einer Veranstaltung teilnehmen.«
Fletcher zog die Stirn in Falten. »Wieder eine Preisverleihung für den ›Wohltäter des Jahres‹? So eine Trophäe hast du doch gerade bekommen, nicht wahr?«
»Brenda Lee hat die Anlässe wie Dominosteine arrangiert. Dieser Preis folgt auf die Eröffnung einer weiteren Jugendentzugsklinik, die sie auf Levis Todestag gelegt hat.« Sein Sohn war high gewesen, als er vor Mazzetti und ihrer sogenannten Ermittlung geflohen war. Nachdem Mazzetti erst Robinette beschuldigt hatte, seine zweite Frau ermordet zu haben, hatte sie ihre Meinung geändert und stattdessen Levi des Mordes bezichtigt. Robinettes Sohn hatte die Angst gepackt, und er hatte panisch und völlig desorientiert die Flucht ergriffen. Mazzetti hatte sein Kind auf der Flucht abgeknallt wie einen räudigen Köter.
»Na, dann wünsche ich euch viel Spaß«, sagte Fletcher säuerlich. »Ich muss jetzt los.«
Als Robinette wieder allein war, lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück. Und schloss die Augen. Morgen um die gleiche Zeit würden seine Probleme vorbei sein. Dank Henderson wäre Stevie Mazzetti nicht mehr am Leben. Und dank Fletcher würden Robinettes private Schatztruhen bald schon überquellen.
Eine Treppe. Mist. An die Treppe hatte sie gar nicht mehr gedacht.
Detective Stevie Mazzetti blieb stehen und musterte finster die vier Stufen, die hinauf zur Eingangstür des Harbor House Restaurants führten. Obwohl sie seit vielen Jahren regelmäßig hierherkam, hatte sie sie noch nie bemerkt. Und nun kamen sie ihr vor wie ein verdammter Berg!
Sie umklammerte den Griff ihres Gehstocks so fest, dass ihre Knöchel zu schmerzen begannen. Es sind bloß vier Stufen. Die wirst du ja wohl schaffen. Aber würde sie sie auch schnell schaffen?
Mit einem Blick über die Schulter vergewisserte sie sich, dass nirgendwo messerschwingende Fieslinge lauerten, die nur darauf warteten, dass sie sich einen Moment Verwundbarkeit gönnte. Sie konnte sich, wie sich in der vergangenen Woche bereits gezeigt hatte, auch jetzt durchaus gegen einen Idioten mit einem Messer oder einen prügelnden Möchtegernboxer wehren, und sie würde es notfalls noch einmal tun.
Wenn es sich allerdings um einen Schützen handelte, saß sie wie auf dem Präsentierteller. Gestern hatte sie Glück gehabt. Der Schütze hatte sie nicht richtig anvisieren können, war aber dumm genug gewesen, dennoch auf sie zu feuern. Daher hatte er sie verfehlt.
Doch die Straßen hier in der Innenstadt boten sehr viel mehr Möglichkeiten, um sich zu verbergen und dennoch hervorragend zielen zu können. Normalerweise hätte sie es vermieden, auf eigene Faust draußen unterwegs zu sein, zumindest bis die laufenden Ermittlungen endlich abgeschlossen waren. Aber heute war der fünfzehnte März.
Heute vor acht Jahren hatte man ihren Mann und ihren Sohn kaltblütig ermordet und von jetzt auf gleich aus Stevies Leben gerissen. Aber Stevie hatte sich aus der Dunkelheit und der tiefen Depression herausgearbeitet, und das hatte sie vor allem der Frau zu verdanken, die nun im Restaurant auf sie wartete.
Seit acht Jahren war dieser Lunch mit ihrer alten Freundin Emma eine Verabredung, die sie niemals sausen ließ, was immer in ihrem Leben gerade geschah.
Und wer immer auch in der Nähe lauern und auf einen Moment der Unachtsamkeit von ihrer Seite warten mochte: Stevie weigerte sich, sich zu verstecken, obwohl Familie und Freunde sie unaufhörlich dazu drängten.
Das ist mein Leben. Ich will es nicht wie eine Gefangene im eigenen Haus verbringen.
Zum Glück sah sie niemanden, der ihr verdächtig vorkam. Dafür entdeckte sie nun ein Schild, das sie auf den Behinderteneingang hinwies, doch bei dem Tempo, mit dem sie sich im Moment vorwärtsbewegte, würde sie vermutlich zehnmal so lange brauchen, als wenn sie diese verdammten vier Stufen in Angriff nahm. Wodurch sie zehnmal so lange im Freien wäre.
Und ich bin ohnehin schon zu spät. War ja klar. Seit sie am Tag der Urteilsverkündung in einem kontroversen Mordfall auf der Treppe zum Gerichtshof angeschossen worden war, brauchte sie für alles viel länger. Sie hatte damals erwartet, dass es gefährlich werden würde, die Anklägerin zu beschützen. Sie hatte jedoch nicht erwartet, mit einem tiefen Loch im Bein auf der Intensivstation zu erwachen. Nun, drei Monate später, hatte sie immer noch Mühe, zur Normalität zurückzukehren. Was zum Teufel Normalität auch sein mag.
Sie spannte alle Muskeln an, packte das Geländer und hievte sich so rasch sie konnte die kurze Treppe hinauf. Ein paar weitere plumpe Schritte, und sie hatte das Vordach erreicht. Außer Sicht von der Straße, lehnte sie sich gegen einen Stützpfeiler. Sie brauchte die Deckung, um sich einen Moment zu erholen.
Weil sie nach Atem rang, als habe sie einen Marathon hinter sich anstelle von vier Stufen, Herrgott noch mal. Sie schwitzte und zitterte, und dann kam der Schmerz, der ihr in die Hüfte fuhr und das Bein entlangschoss. Sie biss die Zähne zusammen, ballte hilflos eine Hand zur Faust und krampfte die andere um den Griff des Gehstocks, während die Woge über sie hinwegspülte. In ihrem Sog brach der Zorn, der stets am Rand ihres Bewusstseins lauerte und nun von Schmerz und Frustration befeuert wurde, mit aller Macht hervor.
Zur Hölle mit dir, Marina Craig. War es nicht schlimm genug, dass sie wegen des kleinen Miststücks fast über den Jordan gegangen wäre? Musste sie jetzt auch noch jede Treppe hochkriechen wie ein … wie ein Krüppel?
Krüppel. Der Begriff war nicht politisch korrekt, aber das war Stevie egal. Es war schließlich ihr Körper. Ihr ruiniertes Bein. Ich kann dafür jedes verdammte Wort benutzen, das ich benutzen will.
Hör auf. Die Stimme der Vernunft schnitt durch ihre stumme, kindische Schimpftirade. Es geht dir besser. Jeden Tag schaffst du ein bisschen mehr. Und immerhin bist du am Leben. Der letzte Satz rüttelte sie jedes Mal wach.
Sie lebte. Andere hatten kein solches Glück gehabt. Marina Craig schon gar nicht. Nachdem ihre Kugel sie von den Füßen gerissen hatte, hatte Stevie ebenfalls das Feuer eröffnet. Marina war tot gewesen, bevor sie noch auf der Treppe zu Boden gegangen war. Erst sechzehn Jahre alt.
Aber sie war auch eine eiskalte Killerin gewesen, die erbarmungslos jeden, der sich an jenem Tag vor dem Gericht eingefunden hatte, abgeknallt hätte. Denn die Staatsanwaltschaft hatte ihren Freund, einen achtzehnjährigen weißen Rassisten, des zweifachen Mordes angeklagt. Und Marina war bestens vorbereitet zum Gerichtsgebäude gekommen: Mit ihrer modifizierten Glock hätte sie noch größeren Schaden anrichten können, wäre sie nicht gestoppt worden.
Ich habe das Richtige getan. Ich habe Leben gerettet. Meins eingeschlossen. Ich bin am Leben.
Und dafür war sie dankbar. Wahrhaft dankbar. Aber sie war es auch leid, sich dadurch … so unzulänglich zu fühlen. Bald. Nur noch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Reha. Bald wäre sie wieder wie früher.
»Und dann wird alles gut«, flüsterte sie. »Alles wird gut.«
Das musste es auch, denn das hatte sie ihrer Tochter versprochen, und sie hatte Cordelia noch nie angelogen.
»Alles wird wieder gut«, hatte sie ihr vor zwölf Stunden ins Ohr geflüstert, während sie sie in den Armen gehalten und sich mit ihr gewiegt hatte, bis das Schluchzen ihrer Tochter abgeebbt war. Es war der Satz, den sie ihr in jeder Nacht, die Cordelia aus Alpträumen aufschreckte, ins Ohr flüsterte. Was zum Glück langsam seltener vorzukommen schien. Offenbar zeigten die Sitzungen mit der Kinderpsychologin endlich Wirkung.
Bald würde auch Cordelia wieder normal sein. Und dann wird wirklich alles wieder gut.
Im Moment war das Leben alles andere als gut. Wie lange war es schon nicht mehr normal? Wie lange war es her, dass ihre Tochter die Nächte durchgeschlafen hatte?
Die Antwort durchfuhr sie wie ein Stich. Ein Jahr. Es war ein ganzes Jahr her. Das letzte Mal, als alles normal gewesen ist, habe ich hier gestanden. Genau hier.
Nur wenige Wochen nach ihrem letzten Jahrestreffen mit Emma war ihre Welt zusammengebrochen – dank Silas Dandridge, pensionierter Detective der Mordabteilung und ihr ehemaliger Partner. Stevie hatte ihn als Mentor betrachtet, als Freund. Bei der Arbeit hatte er ihr Rückendeckung gegeben. Privat hätte sie ihm jederzeit ihr Kind anvertraut.
Doch dann hatte Silas Cordelias Leben bedroht, ihr einen Pistolenlauf in die Rippen gerammt. Er hatte ihr Vertrauen verraten. Er hatte sie alle verraten. Fahr zur Hölle, Silas Dandridge. Ich hoffe, es gefällt dir dort.
Und es war ebenfalls Silas zu verdanken, dass Stevie sich in diesem Augenblick hinter einem Pfeiler verbergen musste, weil es keineswegs abwegig war, dass einer seiner ehemaligen Kunden – oder schlimmer noch: ein ehemaliger Komplize – dort draußen auf sie wartete, um sie ein für alle Mal mundtot zu machen. Was ihr höllisch auf die Nerven ging. Aber wenigstens kann ich auf mich selbst aufpassen.
Ihre Tochter war eine ganz andere Geschichte. Cordelia war erst sieben. Silas war das Ungeheuer, das durch ihre Alpträume spukte, doch endlich schien der Schrecken nachzulassen.
Genau wie ihr Zittern. Doch sie war durch die Ereignisse der vergangenen Woche noch immer hochgradig angespannt, und sie konnte das Restaurant nicht als Nervenbündel betreten – Emma würde es sofort bemerken. Psychologen neigten ärgerlicherweise dazu, in dieser Hinsicht ausgesprochen sensibel zu sein.
Stevie sammelte sich, atmete ein paarmal ein und aus und drückte die Tür auf. Sie war entschlossen, die Zeit, die sie mit Emma hatte, nicht zu vergeuden. Ihre Freundin hatte ihr über Pauls Tod hinweggeholfen, wie keine andere Person es hätte tun können.
Sieben Jahre lang hatte Stevie sich am Ende dieser Essensverabredung jedes Mal besser gefühlt. Gestärkt. Sie war nicht sicher, ob die Erwartung, sich besser zu fühlen, heute nicht etwas zu hoch gegriffen war, aber sie würde sich durchaus mit ein wenig Frieden bescheiden.
Ach, verdammt. Henderson fuhr am Restaurant vorbei, bog rechts ab und beobachtete im Rückspiegel, wie Stevie Mazzetti das Restaurant betrat.
Die einzigen wertvollen Informationen aus Robinettes Akte betrafen Ort und Datum der Verabredung. Alles andere war nicht zu gebrauchen.
Mazzetti hätte laut den Angaben erst um drei hier auftauchen dürfen, doch nun betrat sie den Laden eine Stunde früher als erwartet. Wäre sie um drei eingetroffen, wäre sie um diese Zeit gestorben. Weil ich auf dem Dach des Gebäudes gegenüber auf sie gewartet und sie erschossen hätte, sobald sie die Stufen zur Tür hinaufgegangen wäre.
Wäre Mazzetti pünktlich gekommen, wäre ihre Erschießung der einfachste Tötungsauftrag in der Geschichte der Menschheit gewesen. Die Polizistin hatte fast eine Minute gebraucht, um die vier Stufen zu bewältigen. Sie wäre wie eine Zielscheibe auf dem Schießstand gewesen.
Aber nein. Sie war zu früh. Eine verdammte Stunde zu früh.
Henderson hätte es dennoch rechtzeitig aufs Dach geschafft, wenn nicht die Suche nach dem Töchterchen ebenfalls länger gedauert hätte als geplant. Denn die kleine Cordelia war keinesfalls beim Ballett, wie Robinette ihm versichert hatte. Sie und ihre Tante waren an einen Ort gefahren, der gute zwanzig Minuten weiter entfernt lag.
Also bin ich zwar noch gut in der Zeit, aber dennoch zu spät. Die Schuld Robinettes Fehlinformationen zuzuschreiben war jedoch absolut sinnlos. Das hatte Henderson auf die harte Tour gelernt, und die Erinnerung daran war bitter. Verdammt. Der Wagen schlingerte ein wenig, und Henderson blickte verblüfft aufs Lenkrad. Meine Hände zittern. Dieser Auftrag erwies sich als anstrengender als erwartet. Ein Drink würde das Zittern beheben.
Erst wenn du fertig bist. Du kannst feiern, wenn du den Job erledigt hast. Jetzt wird geplant.
Henderson parkte den weißen, gemieteten Camry hinter dem Gebäude dem Restaurant gegenüber. Eine morgendliche Erkundungsfahrt hatte ergeben, dass dieses Haus den besten Schusswinkel bot. Und wenn mich jemand sieht, wird er der Polizei berichten, dass es sich um einen weißen Camry gehandelt hat – dasselbe Modell, in dem der glücklose Schütze von gestern entkommen ist. Somit würde man auch nach dieser Tat nach dem gestrigen Schützen suchen, so dass kein Verdacht auf Robinette fallen würde. Oder auf mich, was das angeht.
Die Spannung verdichtete sich, bis sie förmlich in der Luft zu spüren war. An die Arbeit. Es war Zeit, den Tod von Levi Robinette zu rächen. Es war an der Zeit, Robbie den lange überfälligen Frieden zu verschaffen.
2. Kapitel
Osterglocken. Der Anblick der Blumen, die die Auffahrt zur Farm säumten, erinnerte Clay Maynard an strammstehende Soldaten. Er machte sich nicht viel aus Blumen, bewunderte aber die Zähigkeit der kleinen gelben Blüten. Es war noch so kalt, dass er seinen Atem sah, aber die Osterglocken schien das nicht zu stören.
Seine Mutter hatte Narzissen geliebt. Die Erinnerung, wie sie sich um ihre Blumen kümmerte, war eine, die er hütete und oft heraufbeschwor, wenn alles um ihn herum in Dunkelheit zu versinken drohte. Heute war ein solcher Tag.
Der fünfzehnte März. Der Tag, an dem Stevie Mazzettis Mann und Sohn ermordet worden waren. Der Tag, an dem ihr Dasein derart in seinen Grundfesten erschüttert worden war, dass sie sich bis zum heutigen Tag auf keinen anderen Mann mehr einlassen wollte. Auf keinen anderen? Oder nur nicht auf dich?
Er holte vorsichtig Luft und schob den Gedanken rigoros aus seinem Bewusstsein. Schob Stevie aus seinem Bewusstsein. Oder zumindest in einen Winkel. Er hatte schon viele, viele Male versucht, sie gänzlich aus seinen Gedanken zu verbannen, aber es klappte nie, und er hatte es aufgegeben. Sie wollte ihn nicht, er sie jedoch immer noch, so sehr er sich auch dafür hätte verfluchen mögen. Und so war es, seit er sie zum ersten Mal gesehen hatte – sie, Polizistin mit Leib und Seele auf der Spur eines Mörders und Löwenmutter, die ihr Kind beschützte.
Damals war sie am Boden zerstört und wild entschlossen zugleich gewesen. Und sie hatte ihn begehrt, was sie sehr unglücklich gemacht hatte. Er wollte aber, dass es sie glücklich machte, wollte der Mann sein, der sie den Verlust ihres Ehemannes vergessen ließ. Er wollte der Mann sein, mit dem sie noch einmal neu begann.
Er wollte, dass sie die Frau war, mit der er noch einmal neu begann.
Man kriegt aber nicht immer, was man will. Clay hatte keine Ahnung, wie oft er sich diesen Spruch von seinem Dad hatte anhören müssen. Aber wie gewöhnlich hatte sein Vater recht.
Wenigstens hatte Clay sich seine Würde bewahren können, nachdem Stevie ihm im Dezember mit ihrem klaren Nein den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Er war seitdem kein einziges Mal an ihrem Haus vorbeigefahren, nicht einmal, um sich zu vergewissern, dass es ihr gutging. Für den Rest der Welt sollte es so aussehen, als sei Clay darüber hinweg und nun unterwegs zu neuen Ufern. Und vielleicht würde es eines Tages tatsächlich so sein.
Ganz plötzlich sah er an einer Seite einen großen gelben Klecks, wo die Blumen ihre ordentlichen Reihen aufgegeben hatten und buchstäblich zu einer Wiese explodiert waren.
Seine Mutter hätte den Anblick von so viel Gelb geliebt. Er beschloss, heute früh Feierabend zu machen und ihr ein paar Osterglocken aufs Grab zu legen. Das hätte ihr gefallen. Und es würde auch seinen Vater glücklich machen. Weiß Gott, er hatte dem alten Herrn in letzter Zeit wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Vielleicht würde er heute noch zur Küste fahren und ihn zum Essen einladen.
Als zu seiner Rechten ein Pfiff ertönte, warf Clay einen Blick zum Beifahrersitz hinüber. Sein IT-Techniker Alec Vaughn betrachtete mit großen Augen zwei nagelneue Stallgebäude und eingezäunte Weiden, auf denen ein gutes Dutzend Pferde grasten.
»Wow«, sagte Alec atemlos. »Wenn Daphne etwas beschlossen hat, dann wird keine Zeit vergeudet.«
»Nein, wahrhaftig nicht.«
Die Farm und die Anbauten gehörten der Staatsanwältin Daphne Montgomery, eine gute Freundin und Kundin Clays. Daphne besaß ein Privatvermögen, das sie der Scheidung einer sehr unglücklichen Ehe verdankte. Der Preis für ihren Reichtum war hoch gewesen, aber nun genoss sie die Möglichkeit, Projekte zu fördern, an die sie glaubte. Vor drei Monaten hatte Daphne verkündet, dass sie ihrer ohnehin schon stattlichen Liste von Wohltätigkeitsaufgaben eine neue hinzufügen würde. Sie wollte Kindern, die Opfer von Gewaltverbrechen geworden waren, die Chance bieten, sich mit Pferden anzufreunden, denn eine innige Beziehung zu einem Tier schien vielen zu helfen, ihr Trauma zu überwinden. Clay verstand nicht so recht, was die Menschen an Pferden fanden, aber um ihn ging es hier ja auch nicht.
»Daphne hat schon Anmeldungen aus dem ganzen Land«, erzählte er Alec. »Kinderschutzbunde, staatliche Einrichtungen, verzweifelte Eltern. Also hat sie Gas gegeben. Die neuen Ställe stehen erst seit vergangener Woche. Die Bauinspektion hat am Mittwoch ihren Segen gegeben, und die Pferde sind am Donnerstag angekommen. Sie will mit der ersten Gruppe beginnen, sobald wir das Gelände sicher gemacht haben.«
Daher ihr heutiger Ausflug zur Farm. Das eine Standbein von Clays Unternehmen – Privatermittlung – war immer dann gefordert, wenn bereits Probleme aufgetreten waren. Das Sicherheitssegment dagegen zeigte potenzielle Schwachstellen auf und richtete Systeme ein, die die Entstehung bestimmter Probleme verhindern sollten. Überwachungstechnik und Personenschutzmaßnahmen waren Clays Spezialität.
Durch ihre Arbeit für die Staatsanwaltschaft war Daphne einem hohen Risiko ausgesetzt, und ihr Vermögen machte sie als Opfer noch sehr viel attraktiver. Nun brachte sie noch Kinder auf das Anwesen. Kinder, die bereits traumatisiert waren, zogen Kriminelle an wie Magneten. Aber nicht, solange ich hier aufpasse.
»Ich wusste gar nicht, dass man sich bereits anmelden kann«, sagte Alec. »Als ich gestern Abend auf dem Server einen Security-Check gemacht habe, stand noch nichts auf der Website.«
»Daphne hat noch kein offizielles Formular entworfen. Sie hat nur diese eine Ankündigung vor ein, zwei Monaten in den Lokalnachrichten gemacht. Die Sendung ist über die Website des Senders abrufbar, und seitdem trudeln ständig neue E-Mails mit Anfragen ein. Sie hat mir ein paar gezeigt.«
»Und?«
Clay atmete geräuschvoll aus. »Und sie …« … sind entsetzlich zu lesen. »Sie weisen auf einen enormen Bedarf hin. Kinder, die seit Jahren in Therapie sind, aber immer noch starke Kontaktschwierigkeiten haben. Was mich allerdings nicht sonderlich überrascht hat.« In den zehn Jahren beim Marine Corps und weiteren zehn bei der Polizei waren ihm zahllose Kinder begegnet, die Opfer von Gewaltverbrechen geworden waren.
Dazu gehörte auch der junge Mann, der auf dem Beifahrersitz seines Trucks saß. Zum Glück hatte Alec sein Trauma schon vor Jahren verarbeitet, doch natürlich hatte die Erfahrung ihn nachhaltig verändert. Unter anderem hatte Alec eine einzigartige Sensibilität für das Leiden anderer entwickelt. Der Junge sah Emotionen, die andere Menschen verzweifelt zu verbergen versuchten. Meine eingeschlossen.
Doch obwohl ihm das ein gewisses Unbehagen bereitete, hatte Clay gelernt, sich auf diese Sensibilität zu verlassen. Alecs IT-Fähigkeiten verschafften ihnen erschreckend leichten Zugang zu den unterschiedlichsten Online-Quellen, aber gerade sein Einfühlungsvermögen, besonders schwer zugängliche menschliche Quellen betreffend, hatte sie schon mehr als einmal bei ihren Ermittlungen weitergebracht.
Die Auffahrt endete vor dem größten Stallgebäude, vor dem bereits ein halbes Dutzend Fahrzeuge eine Reihe bildeten. Clay stellte sich hinter den Chevy Suburban, der Daphnes Sohn Ford gehörte, und schaltete den Motor ab. Lange würde es nicht mehr hell sein. Sie mussten sich an die Arbeit machen.
»Daphne nennt das neue Programm ›Pferdetherapie‹«, fügte Clay mit einem Seufzen hinzu. »Aber ich nenne es Sicherheitsalptraum.«
»›Alptraum‹ ist ein wenig dramatisch, denkst du nicht? Wir reden hier über kleine Kinder, nicht über al-Qaida.«
»Stimmt, wir reden über Kinder. Aber wir müssen auch die ehrenamtlichen Helfer, die Therapeuten, die Pferdetrainer und die Stallburschen überprüfen. Sogar die Eltern und die gesetzlichen Vormunde.«
Alec nickte nachdenklich. »Tja, du hast recht. Das sind verflixt viele Leute.«
»Und ob. Jede Person, die sich hier aufhält, muss überprüft und überwacht werden.« Zumal zu viele Menschen in Daphne eine Möglichkeit sahen, bei einem gerichtlichen Vergleich Kasse zu machen. Sie brauchte genauso viel Schutz wie die Kinder. »Wir müssen möglichst alle Risiken für Gewalt gegen Daphne oder ihre Schutzbefohlenen ausschließen. Es würde mich nicht wundern, wenn irgendein Mistkerl, den sie vor Gericht gebracht hat, versuchte, sich hier als Freiwilliger einzuschleichen, um sich an Daphne persönlich zu rächen.«
Aber Daphne kümmerte es natürlich einen feuchten Kehricht, dass sie sich in Gefahr begab. Ihr Verlobter sah das allerdings anders. FBI Special Agent Joseph Carter hatte Clay ein überaus großzügiges Budget zur Verfügung gestellt, damit er sie – und jeden, dem sie helfen wollte – beschützte.
Clay besaß nicht viele echte Freunde, aber Daphne gehörte definitiv dazu. Er hätte diesen Job auch umsonst gemacht. Aber er war nicht dumm. Wenn Carter gewillt war, ihm einen Blankoscheck zu geben, würde er ihn ganz sicher annehmen. Aufträge wie diese sicherten ihnen die Brötchen. Die Ermittlersparte wurde längst nicht so gut bezahlt, und Fälle wie dieser waren eher rar. Aber auch seine Leute mussten essen und Miete zahlen.
»Ich sorge schon dafür, dass du alles und jeden auf diesem Grundstück im Blick hast«, versprach Alec. »Wir werden in jedem Stall eine Kamera installieren.«
»Nicht nur eine in jedem Stall. Ich will in jeder Box eine. In jedem Winkel jeder Weide. Ich will über jedes Eichhörnchen informiert sein, das über die Wiese huscht.«
»Das wird aber ziemlich viel Arbeit«, sagte Alec skeptisch. »Weit mehr, als ich eingeplant habe. Außerdem habe ich gar nicht so viele Kameras bestellt. Natürlich kann ich den Lieferumfang noch einmal erhöhen, aber es wird ein paar Tage dauern, alle zu installieren. Okay. Fangen wir heute einfach mit dem an, was wir haben.«
»Klingt gut. Ich schätze, dass wir mindestens vier Tage hierfür brauchen, vielleicht sogar länger. Du arbeitest mit DeMarco und Julliard zusammen.«
Alec zog die Brauen zusammen. »An die Namen kann ich mich gar nicht erinnern.«
»Weil du sie nicht kennst. Seit du bei uns bist, haben wir noch keine Installation von einer solchen Größenordnung vorgenommen. Die beiden haben früher schon für mich gearbeitet, und ich vertraue ihnen hundertprozentig. Sie werden die Gräben ziehen und die Kabel verlegen. Deine Rolle wird es sein, sicherzustellen, dass jede Kamera betriebsbereit und mit der Schaltstelle verbunden ist. Ich bleibe heute hier, um mich zu vergewissern, dass alles seinen Gang nimmt, dann komme ich einmal täglich her. Fragen?«
»Nein. Ich leg dann mal los.« Alec fing an, Kameras zu entladen und sie in den Stall zu tragen.
Clay ließ ihn allein und nahm sich einen Moment Zeit, das Anwesen in Augenschein zu nehmen. DeMarco wanderte den runden Trainingsbereich ab, den Daphne die »Arena« nannte. Bei diesem Wort musste Clay unwillkürlich an Gladiatoren und Löwen statt an Kinder und Pferde denken, aber egal.
Daphne selbst befand sich in ebenjener Arena. Sie trug einen leuchtend pinkfarbenen Anzug und hielt ein großes graues Pferd an der Longe. Sie winkte ihm zu, dann wandte sie sich um und schickte dem Mann, der am Zaun lehnte, einen Luftkuss. Dass Joseph Carter hier war, überraschte ihn nicht. Es hätte ihn eher verwundert, wenn dem nicht so gewesen wäre. Der Bundesagent hob eine Hand zum Gruß, und Clay schlug seine Richtung ein.
Fast wäre er gestolpert, als er plötzlich den Minivan bemerkte, der verborgen zwischen dem Escalade des Agenten und DeMarcos schmutzigem Truck geparkt war. Das war Stevies Minivan. Herrgott.
Clay biss die Zähne zusammen und zwang seine Füße, weiterzugehen. Falls sie hier war, würde er verschwinden. Aber nicht, bevor er nicht wenigstens einen Blick auf sie geworfen hatte. Nur einen kurzen Blick. Was bist du doch für ein Jammerlappen.
Er blieb neben Joseph stehen und war stolz auf sich, dass er die circa fünfzig Schritte bewältigt hatte, ohne sich den Hals auf der Suche nach der Frau zu verrenken, die nichts mit ihm zu tun haben wollte. »Hey, Carter.«
»Sie ist nicht hier«, antwortete Joseph ruhig. »Nur Izzy und Cordelia.«
Clay atmete tief ein, spürte das Brennen der kalten Luft in seinen Lungen und stieß sie pustend wieder aus. Stevies Schwester und Tochter. Nicht Stevie selbst. Das ist gut, ermahnte er sich mit Nachdruck. »Und was machen sie hier?«
»Izzy will Fotos für die Broschüre schießen«, erklärte Joseph. »Daphne hat eine Benefizveranstaltung geplant und Izzy engagiert, die Fotos für das PR-Material zu machen. Sie wird auch bei dem Event selbst fotografieren.«
»Ich wusste gar nicht, dass Izzy Fotografin ist.«
»Ist sie eigentlich auch nicht. Sie hat im Januar ihre Stelle im Kaufhaus verloren. Fotografieren ist ihr Hobby, das sie zu einem Job auszubauen versucht, bis sich vielleicht eine andere Möglichkeit auftut.«
»Ist sie gut?«
»Sie ist sogar sehr gut«, ließ sich eine gutgelaunte Stimme hinter ihnen vernehmen. Clay wandte sich um und sah Izzy mit einer teuren Kamera um den Hals vor sich. Sie grinste frech, aber ihre dunklen Augen, die denen ihrer Schwester so ähnlich waren, musterten ihn ernst. »Clay. Schön, dich zu sehen.«
»Gleichfalls. Wie geht’s Cordelia?« Stevies kleine Tochter hatte Clay schon vor Monaten ein Stückchen vom Herzen gestohlen.
»Sie ist im Stall beim Striegeln. Sie freut sich bestimmt, dich zu sehen, wenn du ein bisschen Zeit hast.« Sie wandte sich an Joseph. »Ich bin in ein paar Minuten fertig. Ich habe eigentlich fast alles, was ich brauche, aber die Sonne ist inzwischen gewandert, und die Schatten fallen anders. Danke«, fügte sie hinzu, als Joseph das Tor für sie öffnete. »Cordy ist in der zweiten Box auf der rechten Seite«, sagte sie mit Blick zu Clay.
Clay stieß sich vom Zaun ab. »Ich schau eben bei Cordelia rein, dann mache ich mich an die Arbeit.«
»Hey, Clay, warte noch.« Joseph stellte sich so, dass er mit Clay sprechen und gleichzeitig Daphne im Auge behalten konnte. »Daphne will eine Brautparty für Paige organisieren.«
Clay verzog das Gesicht. Paige Holden war seine Partnerin bei den Ermittlungen und die Verlobte von Josephs Bruder Grayson. Mit dem dritten Dan in Karate und ihrer Waffenexpertise war Paige für sein Unternehmen sehr wertvoll, als Freundin allerdings noch mehr. Grayson konnte sich glücklich schätzen, und er wusste es.
Aber eine Brautparty … Daphne hatte ihn, halb im Scherz, dazu eingeladen, aber Clays Vorstellung von Freundschaft erstreckte sich nicht auf derartig fremdes, potenziell feindliches Gebiet. »Ja, ich weiß. Ich habe vor, an diesem Abend weit, weit weg zu sein.«
»Grayson und ich auch. Wir werden uns ein Boot mieten und zum Angeln rausfahren. Grayson hat dazu mehr Lust als auf einen Junggesellenabend. Bislang sind es nur J.D., Grayson und ich, aber wir würden uns freuen, wenn du mitkämst – sofern du Zeit hast.«
Eine angenehme Wärme durchströmte Clay und löste ein paar der Knoten in seiner Brust, eine wahre Wohltat nach dem Schock, den ihm die Anwesenheit von Stevies Wagen versetzt hatte. »Dafür nehme ich mir gerne frei. Habt ihr schon ein Boot gechartert?«
»Noch nicht. Warum?«
»Mein Vater besitzt eins, das in Wight’s Landing liegt. Manchmal nimmt er Kleingruppen mit. Er kennt die besten Stellen für Rotbarsche. Er macht euch bestimmt einen guten Preis.«
»Wunderbar. Schick mir seine Kontaktdaten per SMS, ja? Dann buche ich.«
»Mach ich. Bis später.« Clay setzte sich in Richtung Stall in Bewegung, um Cordelia Mazzetti zu begrüßen. Anschließend würde er DeMarco und Julliard helfen, die Kanäle für die Kabel zu graben. Wenn er sich körperlich restlos verausgabte, würde es ihm vielleicht gelingen, Cordelias Mutter aus seinem Kopf zu verbannen.
Der Anblick ihrer Freundin beruhigte Stevie sofort. Ihre Sorge, ihr Zorn und ihre Traurigkeit waren noch da, aber sehr viel gedämpfter. Erträglich. »Emma.«
Emma wandte den Kopf, und ein strahlendes Lächeln erblühte auf ihrem Gesicht, als sie sich erhob und ihr die Arme entgegenstreckte. »Stevie.«
Stevie drückte sie fest an sich. Von der Größe her passten die beiden hervorragend zueinander. Stevie war auf Strümpfen ehrliche eins sechzig. Emma Townsend Walker behauptete, sie sei eins achtundfünfzig, aber das war gelogen, denn ihre Freundin brauchte schon Absätze, um auf eins fünfundfünfzig zu kommen.
In jeder anderen Hinsicht waren sie diametral verschieden. Emma war ganz Mädchen, liebte Kleider, Make-up und Schmuck, während Stevie sich in Jeans und T-Shirt und der Waffe im Schulterholster am wohlsten fühlte. Emma war Akademikerin und hatte schon mehrere Bücher veröffentlicht. Stevie konnte meist nie lange genug still sitzen, um ein Buch zu lesen.
Eine bemerkenswerte Ausnahme war allerdings Grünes Ei mit Speck, das früher Cordelias Lieblingsbuch gewesen war. Stevie hatte viele schöne Erinnerungen an Vorlesestunden mit ihrer kleinen Tochter, die auf ihrem Schoß gesessen und ihr mit kleinen dicken Fingern beim Umblättern geholfen hatte.
Eine zweite Ausnahme, vielleicht noch bemerkenswerter, war Emmas Buch Mundgerecht,