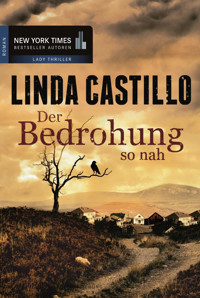9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Du hättest dich fügen müssen. Du hättest nicht fortlaufen dürfen. Jetzt ist dein Schicksal besiegelt. Polizeichefin Kate Burkholder sucht fieberhaft drei vermisste Amisch-Mädchen. Sadie Miller ist verschwunden. Ein aufmüpfiger Amisch-Teenager aus Painters Mill. Ihre Familie ist verzweifelt. Verbittet sich aber jede Einmischung. Als Kate Burkholder, die Spezialistin für Amisch-Delikte, gerufen wird, ahnt sie Schlimmes. Denn gerade wurde die blutgetränkte Tasche des Mädchens gefunden. Und da sind noch mehr vermisste Mädchen im gesamten County. Wo sind sie und was ist mit ihnen geschehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Linda Castillo
Tödliche Wut
Thriller
Über dieses Buch
Du hättest dich fügen müssen.Du hättest nicht fortlaufen dürfen. Jetzt ist dein Schicksal besiegelt.Polizeichefin Kate Burkholder sucht fieberhaft drei vermisste Amisch-Mädchen.Sadie Miller ist verschwunden. Ein aufmüpfiger Amisch-Teenager aus Painters Mill. Ihre Familie ist verzweifelt. Verbittet sich aber jede Einmischung. Als Kate Burkholder, die Spezialistin für Amisch-Delikte, gerufen wird, ahnt sie Schlimmes. Denn gerade wurde die blutgetränkte Tasche des Mädchens gefunden. Und da sind noch mehr vermisste Mädchen im gesamten County. Wo sind sie und was ist mit ihnen geschehen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wurde in Dayton/Ohio geboren und arbeitete lange Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie sich der Schriftstellerei zuwandte. Ihre Thriller, die in einer Amisch-Gemeinde in Ohio spielen, sind ein internationaler Erfolg, die ersten drei Bände ›Die Zahlen der Toten‹, ›Blutige Stille‹ und ›Wenn die Nacht verstummt‹ standen wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die Autorin lebt mit ihrem Mann in Texas.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Epilog
Dank
Ich hatte das große Glück, mit einigen meiner Kate-Burkholder-Krimis auf Lesereise zu gehen, und muss sagen, dass diese Reisen zu den Glanzlichtern meiner Karriere gehören.
Ich möchte dieses Buch den Buchhändlern, Bibliothekaren, Rezensenten, Lesern und Bloggern widmen, die in den Lesungen waren, meine Bücher gekauft, rezensiert, in ihren Blogs diskutiert und mir ihre Gedanken darüber geschrieben haben.
Ich weiß jeden Einzelnen von euch zu schätzen.
Prolog
Becca hatte schon als Kind gewusst, dass ihr Leben einmal tragisch enden würde. Warum ihr das bereits so früh klar war und welches Schicksal sie erwartete, konnte sie nicht sagen. Doch sie glaubte an Vorsehung, und so war es keine Überraschung, als sie erkannte, dass sie auch jung sterben würde.
Mit sieben Jahren hatte sie ihre Mamm über den Tod ausgefragt. Wenn ein Mensch stirbt, hatte diese erklärt, kommt er zu Gott in den Himmel. Die Antwort gefiel Becca und spendete ihr großen Trost. Danach hatte sie nie wieder mit ihrem Schicksal gehadert, fürchtete weder die Nähe noch die Unausweichlichkeit des Todes.
Auch jetzt, acht Jahre später, als sie am vereisten Ufer des Mohawk Lake stand und über die riesige Eisfläche starrte, übten die Worte ihrer Mutter immer noch eine besänftigende Wirkung auf sie aus. Der Einbruch der Dämmerung tauchte den See in ein monochromes Licht, in dem Himmel und Horizont in einem grauen Band zusammenflossen und kaum noch voneinander zu unterscheiden waren. Mindestens ein Dutzend Hütten von Eisfischern waren über den zugefrorenen See verteilt, doch nur in einer brannte Licht. Alle anderen waren dunkel, die Englischen offensichtlich nach Hause gegangen.
Als Becca das Eis betrat, drang der Wind durch ihren Wollmantel bis auf die Haut. Schneegestöber toste flüsternd über die raue Oberfläche und stach ihr wie Sand ins Gesicht. Der steifgefrorene Saum ihres Kleides schürfte an ihren nackten Waden. Sie wanderte schon eine ganze Weile umher und konnte ihre Hände und Füße kaum mehr spüren. Aber das war belanglos. Sie würde bald zu Hause sein, hatte nicht mehr weit zu laufen.
Becca liebte diesen See, im Sommer wie im Winter. Als kleines Mädchen hatten sie und ihr Bruder Schlittschuhe von ihrem Datt bekommen und viele Winternachmittage mit Eishockeyspielen zugebracht. Im darauffolgenden Frühling lief sie schneller Schlittschuh als alle ihre amischen Freunde, und sogar schneller als ihr älterer Bruder. Dem hatte es nicht gefallen, von einem Mädchen vorgeführt zu werden. Aber ihr Datt hatte gelacht und in die Hände geklatscht und gesagt, sie könne fliegen. Ein Lob von ihm hatte Seltenheitswert und gab ihr stets das Gefühl, etwas Besonderes zu sein – sie wurde beachtet, und selbst ihre kleinen Leistungen waren bedeutsam.
Fortan hatte der See in ihrem Leben einen besonderen Platz eingenommen. Hier versteckte sie sich vor dem Rest der Welt, vor all ihren Problemen. Es war der Ort, an dem sie träumen lernte. Niemand konnte sie auf dem Eis einfangen. Niemand anfassen. Niemand konnte ihr weh tun.
Denn das hatte er getan.
Becca war neun Jahre alt gewesen und hatte auf einem Baumstumpf gesessen und ihre Schlittschuhe geschnürt, als ihr Bruder sie entdeckte. Er hatte sie runtergestoßen, mit dem Gesicht in den Schnee gedrückt und sie genommen, gleich dort am gefrorenen Ufer. Von da an hatte Becca gewusst, dass sie verdammt war.
Als ihre Mamm sie später nach der Schramme im Gesicht fragte, erzählte Becca, was ihr Bruder getan hatte. Und natürlich gab Mamm ihr die Schuld. Du hättest dich heftiger wehren sollen. Du hättest mehr beten müssen. Du solltest nicht so nachtragend sein. Am Ende hatte sie dann Becca aufgetragen, ihre Sünden dem Bischof zu beichten.
Die Erinnerung daran trieb Becca die Tränen in die Augen. Wieso war sie schuld am Verhalten ihres Bruders? Hatte sie ihn auf irgendeine Weise in Versuchung geführt? Stimmte mit ihr etwas nicht? Bestrafte Gott sie für die Unfähigkeit, ihm zu vergeben? Oder war das einfach das Los, das sie tragen musste?
Bei jedem Schritt über das Eis knirschte der Schnee unter ihren Füßen. Sie war fast in der Mitte des Sees, als sie über einen Hubbel stolperte und hinfiel. Die Kälte schnitt ihr wie tausend Rasierklingen in Hände und Knie. Es war dumm zu weinen, doch sie konnte nicht anders. Sie hatte gedacht, dass sie keine Angst haben und sich auch nicht so alleine fühlen würde.
Eine kleine Stimme sagte ihr, dass sie immer noch umkehren konnte. Zu Hause in ihrem Dachzimmer wartete ein warmes Bett auf sie, und Mamm und Datt mussten ja nicht erfahren, dass sie weg gewesen war. Doch Becca wusste, dass es zu Hause andere Dinge gab, schlimme Dinge, die ihr seit ihrem dritten Lebensjahr passierten, als ihr Bruder seine Hand in ihren Schlüpfer geschoben und gesagt hatte, sie solle ja nicht schreien.
Becca wusste, dass das, was sie vorhatte, eine Sünde war. Doch sie wusste auch, dass Gott ihr vergeben würde. Dass er sie mit offenen Armen im Himmel empfangen und bis in alle Ewigkeit bedingungslos lieben würde. Wie also konnte es dann verkehrt sein?
Sie stand auf und sah sich um. Die Uferbäume waren kaum noch zu erkennen. Nicht weit vor ihr schimmerten die Umrisse einer Eisfischerhütte wie eine Fata Morgana aus schwindendem Licht. Sie klopfte den Schnee von ihrem Mantel und ging auf das Häuschen zu. Es war aus Holz, mit einem Fenster und einem Blechrohr als Schornstein und erinnerte sie an eine hohe, schmale Hundehütte. Sie wusste, dass die englischen Fischer manchmal hier draußen übernachteten. Aber in der hier leuchtete kein verräterisches Laternenlicht, und kein Rauch stieg aus dem Schornstein auf. Da war niemand drin. Mehr wollte sie gar nicht.
Becca kämpfte sich durch eine tiefe Schneewehe zur Tür. Am Riegel hing ein offenes Vorhängeschloss. Zitternd vor Kälte, zog sie die Tür auf. Drinnen war es dunkel und still; die Luft roch nach Petroleum und Fisch. Außer dem Wind war nur noch das Knacken des Eises unter ihren Füßen zu hören. Weiße Atemwölkchen schwebten vor ihrem Gesicht, als sie die mitgebrachte Kerze und die Streichhölzer aus der Tasche holte und den Docht anzündete. Im Schein des Lichtes sah sie Sperrholzwände, eine kleine Sitzbank und ein mit Fischblut und silbernen Fischschuppen bedecktes Regal mit einer Laterne drauf. An der Wand hing ein aufgewickeltes Seil.
Becca ging zum Regal, stellte die Kerze neben die Laterne, drehte sich um und betrachtete den Fußboden. Das Loch zum Fischen war mit einer Sperrholzplatte abgedeckt. Sie beugte sich und zog das Holz weg. Das Loch war ungefähr einen halben Meter groß und mit einer frischen Eisschicht überzogen.
Sie blickte sich nach etwas um, womit sie das Eis aufbrechen könnte, sah zunächst nur einen kaputten Ziegelblock, eine Plastikbox mit Fischhaken und leere Bierdosen. Doch dann fiel ihr Blick auf den Handschneckenbohrer. Sie kniete neben dem Loch und durchbrach damit die dünne Eisschicht.
Als das Loch ganz frei war, ging Becca zu der Bank und nahm das Seil vom Haken. Es war ungefähr dreieinhalb Meter lang und an beiden Enden ausgefranst. Mit zitternden Händen band sie sich das eine Ende um die Taille und verbot sich jeden weiteren Gedanken, als sie das andere am Betonblock befestigte.
Wieder kniete sie neben dem Loch im Eis, senkte den Kopf und sprach leise das Vaterunser. Sie bat Gott, sich um ihre Mamm und ihren Datt zu kümmern, dass er ihren Kummer in den folgenden Tagen lindern möge. Sie bat Ihn, ihrem Bruder all das zu vergeben, was er ihr fast das ganze Leben lang angetan hatte. Und schließlich bat sie Gott um die Vergebung der Sünde, die sie gleich begehen würde. Sie schloss die Augen und betete so inbrünstig wie nie zuvor in ihrem Leben, hoffte, es würde genügen.
Schließlich erhob Becca sich, nahm das Seil und ließ den Ziegelblock hinab ins Wasser, sah zu, wie er in den schwarzen Tiefen verschwand. Sie dachte an die Reise, die vor ihr lag, und ihre Brust schwoll an, nicht aus Angst, sondern aus der Gewissheit heraus, dass bald alles in Ordnung sein würde.
Sie schloss die Augen, trat einen Schritt nach vorn und ließ sich ins Wasser fallen.
1.Kapitel
Manche Orte sind einfach zu schön, als dass dort schlimme Dinge passieren könnten, hatte meine Mamm einmal gesagt. Als Kind glaubte ich an diese Worte aus tiefstem Herzen. Ich lebte in ahnungsloser Glückseligkeit, wusste nichts von dem Bösen, das wie ein Raubtier mit Schaum vor dem Mund vor den unsichtbaren Toren unserer kleinen Amisch-Gemeinde lauerte. Die Welt der Englischen mit ihren Rätseln und verbotenen Reizen schien Millionen Meilen weit weg von unserem perfekten Fleckchen Erde. Ich konnte nicht wissen, dass manche Feinde auch von innen herauskommen und dass Schönheit die Menschen nicht daran hindert, Verbrechen zu begehen.
Das Amisch-Land in Ohio gleicht einem Mosaik aus malerischen Farmen und sanft geschwungenen Hügeln, durchzogen von Feldern mit kerzengeraden Maisreihen, üppigen Laubwäldern und Weiden so grün, dass man schwören könnte, in eine Fotografie von Bill Coleman getreten zu sein. An diesem Morgen, während die Sonne sich durch die letzten Nebelfetzen kämpft und der Tau wie Quecksilber am hohen Wiesengras glitzert, muss ich an die Worte meiner Mamm denken und verstehe, warum sie das geglaubt hatte.
Doch ich bin jetzt Polizistin und nicht mehr so leicht durch Äußerlichkeiten zu beeindrucken, auch wenn sie noch so bestechen. Mein Name ist Kate Burkholder, und ich bin seit circa drei Jahren Polizeichefin von Painters Mill, einer kleinen Stadt im Nordosten Ohios. Als Tochter amischer Eltern wuchs ich hier in einem einhundertundsechzig Jahre alten Farmhaus auf, inmitten von sechzig Morgen Land aus fruchtbarem Gletscherboden, das uns gehörte. Wir folgten den Regeln des schlichten Lebens, lebten also ohne Elektrizität und motorisierte Fahrzeuge. Bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr war ich ein typisches amisches Mädchen – arglos und erfüllt von der Liebe zu Gott, auf eine Weise zufrieden, wie es die meisten amischen Kinder sind. Meine Zukunft, ja mein Schicksal, war durch mein Geschlecht und die Religion meiner Eltern vorherbestimmt. Doch all das änderte sich an einem Sommertag – die Sonne schien so schön wie heute –, als das Schicksal mich mit der dunklen Seite der menschlichen Natur bekannt machte. In einem Alter, das prägend für das ganze Leben ist, lernte ich, dass selbst an wunderbar sonnigen Tagen schlimme Dinge passieren können.
Ich bemühe mich, meine Weltsicht nicht in meine Arbeit fließen zu lassen, was die meiste Zeit auch gelingt. Allerdings gewinnt manchmal der Zynismus Oberhand und trübt – vielleicht zu Unrecht – meine Wahrnehmung. Doch ziemlich oft fahre ich mit meinem generellen Misstrauen gegenüber dem Menschengeschlecht ganz gut.
Bei offenem Fenster und einem Coffee-to-go zwischen den Knien fahre ich gerade in meinem Dienstwagen, einem Ford Explorer, gemütlich die Hogpath Road entlang. Ich habe für einen meiner Officer, der seine Familie in Michigan besuchen wollte, die Nachtschicht übernommen und bin müde. Aber es ist eine angenehme Müdigkeit am Ende von ereignislos verstrichenen Stunden ohne Raser, häusliche Auseinandersetzungen und frei umherlaufendes Vieh, das Chaos auf dem Highway anrichtet. In meinem Beruf lernt man die kleinen Freuden zu schätzen.
Ich träume gerade von einer heißen Dusche und acht Stunden ungestörtem Schlaf, als das Funkgerät knistert. »Chief? Sind Sie da?«
Ich drücke aufs Mikro. »Was gibt’s, Mona?«
Mona Kurtz arbeitet in der Telefonzentrale unseres kleinen Polizeireviers. Von Natur aus ist sie eine Nachteule und passt trotz ihrer Lady-Gaga-Outfits und dem kaum polizeigerechten Verhalten gut dazu. Wenn nicht viel los ist – was oft passiert –, unterhält sie die anderen, aber wenn es die Situation verlangt, agiert sie professionell und ist ein echter Gewinn für die Abteilung.
»Ich hab gerade einen Notruf wegen Ruhestörung bekommen«, sagt sie.
»Wo soll das denn sein?«
»Bei der überdachten Brücke.«
Bilder von betrunkenen, randalierenden Teenagern gehen mir durch den Kopf, und ich stöhne innerlich. Die Tuscarawas Bridge ist bei den einheimischen Jugendlichen ein beliebter Ort zum »Chillen«, wobei es in letzter Zeit immer mal wieder zu unschönen Auswüchsen kam, wie betrunkene Minderjährige, Schlägereien und Drogenkonsum – und das ist sicher nur die Spitze des Eisbergs. Erst vor einer Woche hat einer meiner Officer den siebzehnjährigen Sohn des Bürgermeisters mit dreißig Gramm Marihuana und einer Meth-Pfeife erwischt. Bisher hat sich der Bürgermeister noch nicht bei mir gemeldet, doch ich bin sicher, dass mir eine Unterhaltung noch bevorsteht. Dabei wird er wahrscheinlich mit einer Bitte an mich herantreten, die ich ihm nicht erfüllen kann.
Beim Blick auf die Uhr im Armaturenbrett unterdrücke ich ein Stöhnen. Es ist gerade mal acht Uhr. »Die fangen aber wirklich früh an.«
»Oder bleiben lange auf.«
»Wer hat angerufen?«
»Randy Trask. Er war auf dem Weg zur Arbeit und meinte, es hätte nach Krawall ausgesehen.«
Ich fluche leise, schwenke nach rechts, drehe mitten auf der Straße und trete aufs Gas. »Ist Trask noch vor Ort?«
»Nein, schon weg, Chief. Musste zur Arbeit.«
Auch gut. »Bin auf dem Weg.«
»Verstanden.«
Die Tuscarawas Covered Bridge ist ein Wahrzeichen von Painters Mill und ein bedeutendes historisches Bauwerk. 1868 gebaut, war sie während der Depression dem Verfall preisgegeben und wurde 1981 auf Kosten des Steuerzahlers und mit einer Spende des Heimat- und Geschichtsvereins von Painters Mill restauriert. Die in typischem Scheunenrot gestrichene Holzbrücke überspannt den achtunddreißig Meter breiten Painters Creek, ist eine Touristenattraktion und war schon oft Thema bei Stadtverordnetenversammlungen, weil ein paar einheimische Graffitikünstler – von denen wir bis jetzt noch keinen einzigen erwischt haben – sie als öffentliche Leinwand betrachten. Die Straße selbst ist wenig befahren, führt durch die Flussniederung und ist im Frühjahr oft überschwemmt. In den umliegenden Wäldern stehen jahrhundertealte Laubbäume, die im Sommer zusammen mit dem Unterholz den perfekten Ort für so manche illegale Aktivitäten bieten.
Nach nur fünf Minuten sehe ich die Brücke und drossele das Tempo, als ich mich ihrem klaffenden roten Maul nähere. Zu meiner Rechten führt ein Trampelpfad in den Wald, den sicher schon viele Menschen benutzt haben, um unten am Fluss zu fischen, zu schwimmen, oder was immer sie sonst da unten so alles tun.
Auf dem Schotterplatz neben der Straße steht ein aufgebockter Chevy Nova mit breiten Reifen und Heckspoiler, dessen oxidierte Farbe matt in der Morgensonne glänzt. Der uralte Bonneville daneben erinnert mit seinem Spachtelmasse-Patchwork am vorderen Kotflügel an einen gepanzerten Dinosaurier. Aus der offenen Fahrertür dröhnt so lauter, harter Techno, dass meine Autofenster vibrieren. Auf der anderen Seite der Brücke stehen noch zwei Autos. Weiter vorn, unter dem Dach der Brücke, sehe ich etwa zwei Dutzend Leute, die einen engen Kreis bilden.
Ich lasse meine Sirene ein paarmal aufheulen, um auf mich aufmerksam zu machen. Einige blicken in meine Richtung, andere sind so fixiert auf das, was da vor sich geht, dass sie nichts mitbekommen. Oder vielleicht ist es ihnen auch nur egal.
Ich parke hinter dem Nova, stelle den Motor aus und funke Mona an. »Bin vor Ort.«
»Was geht da draußen ab, Chief?«
»Ich tippe auf Schlägerei.« Als ich die Tür aufstoße, ertönt von der Brücke her ein Schrei. »Mist«, murmele ich. »Ist Glock schon da?«
»Grade reingekommen.«
»Schicken Sie ihn her, okay?«
»Wird gemacht.«
Ich stecke das Funkgerät in die Halterung, steige aus dem Wagen und sprinte los. Mehrere Jugendliche laufen weg, als ich näher komme. Ich sehe zwei Gestalten am Boden liegen, die miteinander kämpfen. Die aufgeheizte Meute drum herum stachelt sie grölend an, als hätten sie ihre gesamten Ersparnisse auf den blutigen Kampf zweier Hunde gewettet.
»Polizei!«, schreie ich. Meine Stiefel knallen auf die Holzplanken. »Sofort aufhören! Zurücktreten, alle! Sofort!«
Gesichter wenden sich mir zu, ein paar erkenne ich, die meisten nicht. In den jungen Augen blitzt Überraschung auf, gepaart mit etwas, das ein bisschen sehr nach Blutdurst aussieht. Grausamkeit in ihrer primitivsten Form. Rudelmentalität, denke ich, und das beunruhigt mich fast so sehr wie der Kampf selbst.
Ich dränge mich dazwischen, schiebe die Leute beiseite. »Macht Platz, sofort!«
Ein Teenager mit hängenden Schultern und sprießender Akne sieht mich an und tritt einen Schritt zurück. Ein anderer Junge, der so vom Kampfgeschehen absorbiert ist, dass er mich nicht bemerkt, stößt immer wieder die Faust in die Luft und ruft: »Gib’s dem Miststück!« Ein schwarzhaariges Mädchen in einem viel zu kleinen Top versetzt einer Kämpferin einen Tritt. »Schlag das Gesicht der Nutte zu Brei!«
Ich schiebe mich an zwei Jungen vorbei, die kaum größer sind als ich, und bekomme zum ersten Mal einen freien Blick auf das Geschehen in der Mitte. Zwei Mädchen prügeln hemmungslos wie altgediente Kneipenschläger aufeinander ein, zerren sich an Kleidern und Haaren, graben sich gegenseitig die Nägel ins Gesicht. Ich höre animalische Laute, Stoff reißt, und Fäuste klatschen auf nacktes Fleisch.
»Runter von mir, du Schlampe!«
Ich beuge mich vor und packe das obere Mädchen an der Schulter. »Polizei«, sage ich. »Hört auf damit.«
Sie ist stämmig und bestimmt zwanzig Pfund schwerer als ich. Sie festzuhalten gleicht dem Versuch, einen hungrigen Löwen von seiner frischen Beute loszureißen. Als sie nicht reagiert, packe ich sie an beiden Schultern und ziehe sie zurück. »Es reicht, Schluss jetzt!«
»Lass mich los!« Blind vor Wut versucht das Mädchen, meine Hände abzuschütteln. »Ich bring die Schlampe um!«
»Nicht, wenn ich dabei bin.« Mit ganzer Kraft zerre ich sie hoch. Ihr Shirt zerreißt unter meinen Händen, sie taumelt rückwärts und landet vor mir auf dem Hintern, versucht aufzustehen, doch ich drücke sie runter.
»Beruhig dich.« Ich schüttele sie, damit ihr klar wird, dass ich es ernst meine.
Sie ignoriert mich, rutscht zur Seite und tritt nach dem anderen Mädchen, will ihm erneut einen Stoß versetzen. Ich packe ihre Oberarme und ziehe sie einen Meter weit weg. »Hör auf damit!«
»Die hat angefangen!«, schreit das Mädchen.
Besorgt, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte, zeige ich auf den nächstbesten Zuschauer, der einigermaßen vernünftig aussieht, einen dünnen Jungen im Led-Zeppelin-T-Shirt. »Du da.«
Er sieht mich an. »Ich?«
»Wer sonst? Dein unsichtbarer Freund?« Ich zeige auf das zweite Mädchen, das jetzt breitbeinig auf dem Boden sitzt, die Haare vorm Gesicht. »Bring sie auf die andere Seite der Brücke und warte da auf mich.«
Er rührt sich nicht, und ich bin kurz davor, ihn anzuschreien, als ein Mädchen mit gepiercten Augenbrauen aus der Gruppe tritt. »Ich mach’s.« Sie beugt sich vor, legt die Hand auf die Schulter der anderen, sagt: »He, komm mit.«
Ich widme mich wieder dem Mädchen vor mir. Sie schnauft, als hätte sie gerade einen Triathlon hinter sich, und starrt mich streitlustig an. An ihrer Nasenspitze hängt ein mascaraschwarzer Schweißtropfen, und ihre Wangen glänzen wie von einem Sonnenbrand. Kurz hoffe ich, dass sie auf mich losgeht, damit ich ihr die schlechten Manieren austreiben kann. Doch dann sage ich mir, dass Teenager als Einzige in der Bevölkerung ein Recht auf temporäre Hirnlosigkeit haben.
»An deiner Stelle«, sage ich ruhig, »würde ich mir sehr genau überlegen, was ich als Nächstes tue.«
Mein Blick wandert zu den Schaulustigen, die mir ein bisschen zu nahe stehen, um mein Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen, schon allein wegen des zahlenmäßigen Missverhältnisses von zwanzig zu eins. Meine Hand liegt weiter auf der Schulter des Mädchens, und ich sehe einigen gezielt in die Augen. »Ihr habt jetzt genau dreißig Sekunden, um zu verschwinden, danach verhafte ich euch und informiere eure Eltern.«
Als sie sich langsam in alle Richtungen zerstreuen, sehe ich das Mädchen an. Sie wirft ihren Freunden stechende Blicke zu, gestikuliert, schickt ihnen nonverbale Messages, wie Teenager das gern tun. Und mir wird klar, dass sie ihre fünfzehn Minuten Ruhm genießt.
»Wie heißt du?«, frage ich.
Sie bedenkt mich mit einem Friss-Scheiße-Blick, ist aber klug genug, um zu wissen, dass sie dieses Gefecht nicht gewinnen kann. »Angi McClanahan.«
»Hast du einen Ausweis dabei?«
»Nein.«
Ich halte dem Mädchen die Hand hin, um ihm aufzuhelfen, doch es ignoriert sie und springt auf die Füße wie eine gefallene Eiskunstläuferin, die noch immer die Goldmedaille im Visier hat. Angi ist hübsch, etwa sechzehn Jahre alt, mit blonden Haaren, blauen Augen und Sommersprossen auf der Stupsnase. Sie hat ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen, aber die sind gut verteilt, wie so oft bei jungen Mädchen. Der Ärmel ihres T-Shirts baumelt von der Schulter. Sie hat Kratzspuren an Kehle und Armen, Blut an den Jeans, doch ich sehe keine Wunde.
»Bist du verletzt?«, frage ich. »Brauchst du einen Arzt?«
Sie wirft mir einen vernichtenden Blick zu. »Alles gut.«
»Was ist passiert?«
Sie zeigt mit dem Finger auf das andere Mädchen und verzieht den Mund. »Ich hab hier bloß abgehängt, und diese verdammte blöde Schlampe hat sich auf mich geworfen.«
Ihre Worte bestürzen mich, doch wirklich zu schaffen macht mir der mitschwingende Hass. Wann hat das angefangen, dass Kinder so reden? Ich finde es unerträglich. Dabei bin ich wirklich nicht naiv und habe im Laufe meines Lebens schon Schlimmeres gehört, und oft genug war es persönlich gemeint. Doch solche Worte aus dem Mund eines hübschen jungen Mädchens schockieren mich einfach.
Ich ziehe die Handschellen aus der Gürteltasche. »Dreh dich um.«
»He, was soll das?« Ihr Blick fliegt zu den Handschellen, und sie hebt die Hände. »Ich hab nix gemacht!«
»Hände auf den Rücken.« Ich packe sie am Oberarm, drehe sie um, lasse die Handschelle um das rechte Handgelenk zuschnappen und drehe ihr den Arm auf den Rücken. »Die andere Hand. Sofort.«
»Bitte nicht …« Sie ist jetzt beunruhigt, den Tränen nahe, sie zittert.
Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ich greife nach dem linken Handgelenk und lege ihr die zweite Handschelle an, wobei mir der süßliche Duft von Billigparfüm vermischt mit dem Gestank von Zigaretten entgegenschlägt. Ich drehe Angi zu mir um, halte ihr meinen Finger dicht vors Gesicht. »Du bewegst dich nicht vom Fleck«, sage ich. »Du sprichst mit niemandem. Hast du mich verstanden?«
Mit zusammengepressten Lippen verweigert sie eine Antwort und wendet den Kopf ab.
Als ich mich umdrehe, murmelt sie »Schlampe«. Ich lasse es gut sein und gehe zu den wenigen anderen, die sich, wohl in Erwartung weiterer Explosionen, noch nicht verdünnisiert haben.
In dem Moment höre ich Autoreifen knirschen, drehe mich um und sehe den Streifenwagen unseres Polizeireviers hinter dem Explorer halten. Erleichtert beobachte ich, wie Rupert »Glock« Maddox, einer meiner besten Officer, aussteigt. Ich bin jedes Mal froh, ihn zu sehen, aber ganz besonders dann, wenn meine Gegenüber in der Mehrzahl sind, seien es Teenager oder Kühe.
Als er die Brücke betritt, treten die verbliebenen Jugendlichen bereitwillig zur Seite. Er hat diese Wirkung auf Menschen, was ihm allerdings nicht bewusst zu sein scheint. »Was geht ab, Chief?«
»Ein paar von den Einsteins hier fanden es lustig, sich im Dreck zu wälzen und aufeinander einzuprügeln.«
Er blickt an mir vorbei zu Angi McClanahan. »Mädchen?«
»Ist wohl gerade angesagt.«
»Also da läuft wirklich was schief.« Er wirft mir kopfschüttelnd einen deprimierten Blick zu. »Als ich noch jung war, haben Mädchen sich nicht geprügelt.«
»Gleichberechtigung scheint auch Dummheit für alle zu bedeuten.« Ich zeige auf Angi und senke die Stimme. »Hören Sie sich ihre Geschichte an, und wenn sie Ihnen irgendwelchen Mist auftischt: gleich verhaften.«
Er klopft auf seine Glock-Pistole im Gürtelholster. »He, ich bin voll für Gleichberechtigung.«
Ich unterdrücke ein Lächeln. »Okay. Ich unterhalte mich jetzt mit unserem Muhammad Ali da drüben.«
Die zweite Kämpferin steht auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke neben dem Mädchen mit den gepiercten Augenbrauen. Beide haben mir den Rücken zugewandt, starren aus dem Brückenfenster und rauchen Nelkenzigaretten.
»Macht die Glimmstängel aus«, sage ich und bleibe dicht hinter ihnen stehen.
Das Mädchen mit dem Augenbrauenring drückt rasch die Zigarette auf der Fensterbank aus, wirft ihre Kippe auf den Boden und wendet sich mir zu. Das andere Mädchen schnipst die Zigarette aus dem Fenster in den Fluss und dreht sich dann auch um. Zum ersten Mal sehe ich ihr direkt ins Gesicht – und erschrecke: Ich kenne sie, oder zumindest kannte ich sie früher einmal. Sie ist amisch, da bin ich mir sicher. Einen Moment lang sitzt der Schreck so tief, dass mir ihr Name nicht einfällt.
»Hi, Katie«, sagt sie zuckersüß.
Ich durchforste mein Gedächtnis, doch ohne Erfolg. Sie ist etwa fünfzehn Jahre alt, hat schlaksige Arme und Beine, und ihr dünner Hintern steckt in einer Jeans, die mindestens zwei Nummern zu klein ist. Neben der schönen Haut hat sie auch große, haselnussbraune Augen und schulterlanges braunes Haar, das von der Sonne blond gesträhnt ist. Unter ihrem linken Auge blüht ein Veilchen, sie hat also mindestens einen Schlag ins Gesicht abgekriegt.
Ein verschmitztes Grinsen huscht über ihr Gesicht. »Erinnerst du dich an mich?«
Mein Hirn stößt auf einen Namen, doch ich weiß nicht, ob es der richtige ist. »Sadie? Sadie Miller?«
Das strahlende Lächeln, das sie mir nun schenkt, ist viel zu schön für ein Mädchen, das sich noch vor wenigen Minuten prügelnd am Boden gewälzt hat. Sie ist die Nichte meines Schwagers, und ich kann kaum glauben, was ich da sehe. Als wir uns das letzte Mal begegneten, vor etwas über drei Jahren bei der Beerdigung meiner Mutter, war Sadie zwölf Jahre alt, ein süßer Wildfang mit blauem Kleid und weißer Kapp; ihre Knie waren mit Schorf bedeckt, und zwischen ihren Vorderzähnen prangte eine Lücke. Ich erinnere mich so gut, weil sie herzlich, kontaktfreudig und neugierig war, was mir trotz meiner Trauer gefallen hatte. Sie war eines der wenigen amischen Mädchen, das sich gegenüber Jungs behaupten konnte und keine Skrupel hatte, den Erwachsenen zu sagen, was sie dachte. An dem Tag habe ich viel Zeit mit ihr verbracht, hauptsächlich deshalb, weil die meisten Amischen es ablehnten, sich mit mir zu unterhalten.
Die junge Frau hier hat nichts mehr gemein mit dem süßen kleinen Amisch-Mädchen. Sie ist groß und schön und dünn wie ein Model, und die Wildheit in ihren Augen gibt ihrem – zumindest nach amischen Maßstäben – gewagten Äußeren zusätzlich etwas Ruheloses, Verwegenes. Augenscheinlich hat ihre damalige Auflehnung gegen die strengen Vorschriften inzwischen noch wesentlich härtere Formen angenommen.
»Brauchst du einen Arzt?«, frage ich auch sie.
Sie lacht. »Ich denke, ich werd’s überleben.«
Ich mustere sie eingehend. Ihre Fingernägel sind blau lackiert, das Make-up ist trotz des zu dicken Eyeliners gut gemacht. Sie trägt ein seidiges schwarzes Tanktop mit auffallenden weißen Nähten. Der Stoff ist so dünn, dass ihre Brustwarzen durchscheinen. »Wissen deine Eltern, dass du hier bist?«
»Das geht sie nichts an.« Sie schnippt sich das Haar von der Schulter. »Ich bin in der Rumspringa.« Rumspringa ist die Zeit, in der amische Jugendliche Lebenserfahrung sammeln können, ohne sich an die Einschränkungen der Ordnung halten zu müssen, und die Erwachsenen sehen weg. Die meisten Teenager trinken Alkohol und hören Musik – kleine, in der Regel harmlose Verstöße. Ich frage mich, ob dieses Mädchen hier zu den achtzig Prozent gehören wird, die sich am Ende dieser Zeit taufen lassen.
Ich starre sie an, versuche, die junge Frau vor mir mit dem süßen kleinen Mädchen von vor drei Jahren in Einklang zu bringen. »Bist du nicht ein bisschen jung für die Rumspringa?«
»Falls du es noch nicht gemerkt hast, ich bin kein Kind mehr.«
»Besonders erwachsen hast du bei der Schlägerei eben aber auch nicht ausgesehen.«
»Ich bin fünfzehn.« Sie blickt weg. »Alt genug, um zu wissen, was ich will.«
»Die Hälfte aller Erwachsenen auf der Welt weiß nicht, was sie will«, bemerke ich trocken.
Sie lacht unbefangen. »Genau das mag ich an dir, Katie.«
»Du kennst mich doch gar nicht.«
»Ich weiß, dass du die Regeln brichst.«
»Tja, aber die Regeln zu brechen ist auch nicht so befriedigend, wie man sich das gemeinhin vorstellt.«
»Ach so, und deshalb bist du weggegangen«, sagt sie mit unverhohlenem Sarkasmus.
»Das tut hier nichts zur Sache«, warne ich sie.
»Ich werde wahrscheinlich das schlichte Leben aufgeben«, platzt sie heraus. Da ich die Letzte bin, die mit einem amischen Mädchen so eine Unterhaltung führen sollte, ziehe ich bewusst langsam meinen Notizblock aus der Tasche. »Was sagen denn deine Eltern dazu?«
»Die denken, der Teufel hat mich in seinen Fängen.« Sie wirft lachend den Kopf zurück. »Und damit könnten sie sogar recht haben.«
Ich verkneife mir eine Antwort und wende mich dem anderen Mädchen zu. »Wie heißt du?«
»Lori Westfall.«
Ich notiere den Namen im Block. »Du kannst gehen.«
Sie blickt Sadie kurz an. »Aber … ich bin ihre Fahrerin.«
»Jetzt nicht mehr.« Ich deute zum Brückenaufgang. »Geh.«
Sie seufzt tief auf, dreht sich um und macht sich auf den Weg.
»Dann sind also all die Geschichten über dich wahr«, sagt Sadie.
»Ich werde dazu nichts sagen, Sadie, also spar dir deine Worte.«
Sie ignoriert meinen Kommentar. »Es heißt, du bist knallhart.«
»Glaub nicht alles, was du hörst.«
»Ich bin froh, dass du diesem Miststück Handschellen angelegt hast.«
»An deiner Stelle würde ich das alles hier wesentlich ernster nehmen.«
Meine Worte scheinen sie zu ernüchtern, doch das Lächeln bleibt in ihren Augen.
»Wer hat die Prügelei angefangen?«, frage ich.
Sie zuckt die Schultern, fühlt sich immer noch viel zu behaglich in der Situation. »Ich hab ihr den ersten Schlag versetzt.«
»Worum ging es bei eurem Streit?«, will ich wissen. Hoffentlich hatte es nichts mit Drogen zu tun.
»Ihr Freund steht mehr auf mich als auf sie, und da ist sie eben eifersüchtig.«
»Wer ist zuerst handgreiflich geworden?«
»Sie hat mich gestoßen.« Sie blickt nach unten, zupft am Nagellack ihres Daumens. »Da hab ich ihr eine geschmiert.«
»Hat sie zurückgeschlagen?«
Sie zeigt auf ihr Auge. »Hallo?«
Ich runzele die Stirn. »Werd nicht frech, Sadie. Dass du zur Familie gehörst, wird mich nicht daran hindern, dich ins Gefängnis zu stecken. Hast du das verstanden?«
»Klar doch.« Doch sie grinst mich verschmitzt an. »Angi McClanahan ist ’ne verdammte Nutte.«
Ich bin entsetzt, denn die Sprache passt überhaupt nicht zu dem Mädchen vor mir. »Hör auf damit«, fahre ich sie an. »Du bist zu hübsch, um so zu reden.«
»Aber alle reden so.« Sie betrachtet mich neugierig, sie testet. »Selbst du.«
»Hier geht’s nicht um mich.«
»Die alten Frauen reden immer noch über dich, Katie. Dass du mal ’ne Amische warst und das einfache Leben aufgegeben hast, um in die große, böse Stadt zu gehen.« Sadie sieht mich an, als wäre das, was ich getan habe, irgendwie bewundernswert. »Laut Fannie Raber hast du dem Bischof damals gesagt, er solle sich zum Teufel scheren.«
»Das ist nichts, worauf man stolz sein sollte.«
Sie zuckt die Schultern. »Ich hab all die Vorschriften so satt.«
Dass ich noch mal den Drang verspüren würde, die amische Lebensweise zu verteidigen, überrascht mich selbst. Doch da sich das aus meinem Mund heuchlerisch anhören würde, verkneife ich mir jeden Kommentar. »Das solltest du mit deinen Eltern diskutieren!«
»Als ob die das verstehen würden.«
»Dann vielleicht der Bischof –«
Sie lacht schallend. »Bischof Troyer ist so was von hirnlos!«
»Sich zu prügeln ist hirnlos. Sieh dich doch an. Wie kannst du dich nur so gehenlassen? Dein Auge wird ja schon blau.«
Von meinen Worten gänzlich unbeeindruckt, sagt Sadie mit leiser Stimme: »Es ist mir ernst mit dem Weggehen, Katie.«
Plötzlich habe ich das Gefühl, auf Zehenspitzen durch ein Minenfeld zu gehen und nicht zu wissen, wo ich hintreten soll. »Ich bin nicht die Richtige, mit der du dieses Thema diskutieren solltest.«
»Warum? Weil du selbst weggegangen bist?«
»Weil ich Polizistin bin – und das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Verstanden?«
Sie hält meinem Blick stand. »Ich denke schon lange darüber nach.« Wieder senkt sie die Stimme. »Ich passe nicht dazu. Mir gefallen all die Dinge, die mir nicht gefallen dürften. Musik und … Kunst. Ich will Bücher lesen und Filme gucken und an Orte reisen, die ich noch nie gesehen habe. Ich will aufs College gehen und …«
»Das kannst du alles machen, auch ohne dass du dich prügelst und in Schwierigkeiten gerätst«, sage ich.
»Aber nicht, wenn ich amisch bleibe.«
»Du bist zu jung, um so eine wichtige Entscheidung treffen zu können.«
»Ich hasse es, amisch zu sein.«
»Du weißt nicht, was du willst.«
»Ich weiß genau, was ich will!«, kontert sie. »Ich will Kleider entwerfen, englische Kleider für Frauen. Und ja, es klingt wie ein dummes Hirngespinst, oder wie Datt gerne sagt: Teufelszeug«, wobei sie den Ton ihres Vaters ziemlich gut trifft. »Er versteht mich nicht, Katie. Ich kann so gut nähen, frag meine Mamm. Sie weiß genau, dass ich erfolgreich sein könnte, aber sie will es nicht zugeben.«
Sie zeigt auf das Tanktop, das sie trägt. »Das hab ich selbst genäht! Sieh’s dir an, es ist wirklich schön. Aber Mamm erlaubt mir nicht, es zu tragen. Ich darf es nicht mal im Carriage Stop verkaufen. Sie sagt, es schmücke zu sehr und sei somit ein Ausdruck von Stolz.«
Die Worte sprudeln nur so aus ihr heraus, stolpern und fallen übereinander, als wäre der unsichtbare innere Damm, der sie die ganze Zeit in Schach gehalten hatte, gebrochen. Vage erinnere ich mich, dass meine Schwester Sarah mir vor Monaten einmal von Sadies Nähkünsten erzählt hat. Damals interessierte mich das wenig, weil meine Schwester und ich unsere eigenen Probleme haben. Doch jetzt fällt mir wieder ein, wie Sarah geschwärmt hat, dass Sadie schon ein Dutzend Quilts in einem der Touristenläden der Stadt verkauft hatte und die Nachfrage offensichtlich groß ist. Ich finde es sträflich, so eine Passion nicht zu fördern, denn viel zu viele Menschen gehen ohne jede Leidenschaft durchs Leben. Doch diese Sichtweise ist bei den Amischen natürlich nicht willkommen.
»Und, verfrachtest du mich jetzt ins Gefängnis?«, fragt sie, wobei ihr die Aussicht ein bisschen zu sehr zu gefallen scheint.
»Ich verfrachte dich nach Hause.«
Seufzend, als wäre ihr das Gefängnis lieber gewesen, greift Sadie in die Tasche, zieht ein Päckchen Zigaretten heraus und zündet sich eine an. Doch die Art und Weise, wie sie es tut, verrät, dass sie nur Gelegenheitsraucherin ist.
»Mach sie aus«, sage ich ihr.
»Warum, Katie? Du rauchst doch selber, ich hab’s gesehen. Auf dem Graebhoff. Warum darf ich dann nicht auch?«
»Weil du fünfzehn bist und es illegal ist.« Ich nehme ihr die Zigarette ab und werfe sie ins Wasser.
Dem Blick ihrer hellen Augen, die mich jetzt fixieren, scheint nichts zu entgehen. Ich weiß nicht, warum, doch es verunsichert mich, dass dieses Mädchen offenbar zu mir aufsieht. Sie kommt mit Dingen in Berührung, von denen sie besser nichts wissen sollte, und hat Wünsche, die sich, wenn sie amisch bleibt, niemals erfüllen werden. Ihr Kummer ist vorprogrammiert, und ich will nichts damit zu tun haben.
»Ich will nicht nach Hause«, erklärt sie mir.
»Dann habe ich jetzt eine Neuigkeit für dich, Sadie: Man kriegt nicht immer, was man will.« Ich werfe einen Blick zurück über die Schulter. Bis auf zwei Jugendliche sind alle gegangen. Glock spricht noch mit Angi McClanahan. Sie flirtet mit ihm, will wahrscheinlich, dass er ihr die Handschellen abnimmt, aber er schreibt sichtlich ungerührt etwas auf seinen Block.
»Bleib hier stehen«, sage ich zu Sadie, »ich bin gleich zurück.«
Ich mache mich auf zu Glock, der hochschaut und mir entgegenkommt, so dass wir uns in der Mitte der Brücke treffen, wo uns keines der beiden Mädchen hören kann. »Und, was glauben Sie?«, frage ich.
Glock schüttelt den Kopf. »Waren wir als Teenager auch so bescheuert?«
»Wahrscheinlich.«
Er blickt auf seinen Notizblock. »Anscheinend haben sich die beiden Mädchen wegen eines Typen geprügelt. Der erste Körperkontakt ging von McClanahan aus, das andere Mädchen hat den ersten Schlag gelandet.«
»Ich bin so froh, kein Teenager mehr zu sein.«
»Wohingegen ich gern der Typ wäre, um den sie sich geprügelt haben.«
Wir grinsen uns an.
»Und wen stecken wir jetzt ins Gefängnis?«, fragt er.
»Diesmal lasse ich beide mit einer Verwarnung laufen und unterhalte mich mit den Eltern.«
»Gute Entscheidung.« Er nickt zustimmend. »So hält sich auch die Berichteschreiberei in Grenzen.«
»Fahren Sie Angi McClanahan nach Hause? Und reden mit ihren Eltern?«
»Mach ich.«
Ich sehe zu Sadie Miller und seufze. Sie lehnt mit dem Rücken an der Fensterbank, einen Fuß hinten an der Wand, raucht eine Nelkenzigarette und beobachtet mich. »Kaum zu fassen, dass Jugendliche noch immer dieses Zeug rauchen«, murmele ich.
Glock nickt. »Die Dinger bringen einen um, so viel ist mal sicher.«
Ich gehe zurück zu Sadie und denke, dass Glock und ich ziemlich genau wissen, dass jungen Menschen heutzutage viel Gefährlicheres droht. Und dass die meisten von uns nicht die geringste Ahnung haben, wie man sie davor schützen kann.
2.Kapitel
Fünfundvierzig Minuten später bin ich auf dem Rückweg von der Miller-Farm, wo Sadie mit ihren Eltern und vier Geschwistern lebt. Ich kann ganz gut die Gedanken von Leuten lesen und bin ziemlich sicher, dass sie dachten, ich hätte Sadie das blaue Auge verpasst. Gerechtfertigt oder nicht, habe ich das wohl meinem Ruf bei den Amischen zu verdanken.
Ich hatte mir Mühe gegeben, den Vorfall so objektiv wie möglich darzustellen. Esther und Roy Miller hörten aufmerksam zu, doch das Misstrauen – oder war es sogar Argwohn? – in ihren Augen war nicht zu übersehen. Es gab mehr Schweigen als Fragen. Als ich schließlich ging, hatte ich starke Zweifel, ob sie mir überhaupt etwas von meiner Schilderung geglaubt haben.
Wäre es keine amische Familie gewesen, hätte ich mir anhören müssen, wie die Eltern ihr Kind verteidigten oder mit billigen Angriffen auf mich und mein Polizeirevier den Vorfall zu relativieren versuchten. Doch nicht so die Amischen. Bei ihnen gibt es keine Schuldzuweisungen, absurde Rationalisierungen oder den Versuch, einem anderen etwas in die Schuhe zu schieben. Amische Eltern sind generell streng zu ihren Kindern; Gehorsam wird schon in jungen Jahren eingeschliffen und nötigenfalls mit »einer Tracht Prügel« durchgesetzt.
Sadie ist über das Alter hinaus, in dem Prügel noch etwas bewirken. Doch ich zweifele nicht daran, dass sie für ihren Ungehorsam bestraft wird und wahrscheinlich unangenehme Hausarbeiten verrichten muss. Ich frage mich, ob das genügt.
Müde und mit den Gedanken noch immer bei Sadie, bin ich auf dem Weg zum Polizeirevier, um meinen abschließenden Tagesbericht zu schreiben, als sich das Mobiltelefon meldet. Mein leichter Missmut verwandelt sich umgehend in Freude, als ich Tomasettis Name auf dem Display sehe, und ich setze das Headset auf. »Guten Morgen, Agent.«
»Ich hab vorhin schon mal angerufen und da war nur die Mailbox dran. Ist alles in Ordnung?«
»Tut mir leid, ich war bei einem Einsatz.«
»Kühe einfangen?«
»Schlimmer«, sage ich. »Teenager.«
»Das ist schlimmer.«
»Bei Kühen weiß man wenigstens, wo man dran ist.«
»Und sie machen weniger Mist.«
John Tomasetti ist Agent im Bureau of Criminal Identification and Investigation – BCI – in Cleveland, Ohio. Wir haben uns vor eineinhalb Jahren kennengelernt, als er uns bei den Ermittlungen der Schlächter-Morde unterstützte. Es war eine turbulente Zeit für uns beide, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Seine Frau und zwei Kinder waren erst neun Monate zuvor ermordet worden, was ihn fast umbrachte. Er nahm starke Medikamente, und gleichzeitig trank er viel. Diese Form der Krisenbewältigung führte dazu, dass seine Karriere den Bach runterging und sein Leben außer Kontrolle geriet. Vermutlich spielten sich auch noch andere Dinge ab, aber darüber hat er nie etwas verlauten lassen. Nun ja, viele Menschen haben ihre Geheimnisse, die sie nie preisgeben würden.
Es war mein erster großer Fall als Polizeichefin gewesen, wobei sich die Ermittlungen wegen eines viele Jahre zurückliegenden persönlichen Erlebnisses als sehr stressig erwiesen. Zudem waren die Morde äußerst brutal und schockierend – Albtraumnahrung. Doch irgendwie wurden Tomasetti und ich inmitten all des Grauens und Blutvergießens zuerst Verbündete, dann Freunde – und später ein Liebespaar. Am Ende hatten wir den verdammten Fall gemeinsam geknackt.
»Hast du überhaupt geschlafen?« Er weiß, dass ich die Nachtschicht hatte.
»Ich schreibe jetzt noch meinen Bericht und fahre dann nach Hause.« Im Stillen frage ich mich, ob er vielleicht kommen will – ob er das Wochenende frei hat und es mit mir zu verbringen gedenkt. Es ist schon einen Monat her, dass wir uns gesehen haben, und die Vorstellung lässt mein Herz höher schlagen. Doch ich ziehe sofort die Bremse, habe noch immer Probleme, einem Gefühl zu trauen, das einen mit solcher Kraft packt und so leicht daherkommt.
»Ich hab gerade einen neuen Fall auf dem Tisch«, sagt er, »und mich gefragt, ob du Interesse hast, in beratender Funktion daran mitzuarbeiten.«
Einen Moment lang bin ich zu überrascht, um zu antworten. Diese Anfrage ist mehr als ungewöhnlich. Ich bin Polizeichefin einer kleinen Stadt und verbringe normalerweise meine Tage damit, häusliche Auseinandersetzungen zu schlichten, bei Schlägereien einzuschreiten und gelegentlich einen Einbruch zu untersuchen. Also Kleinstadtkriminalität. Warum sollte er mich brauchen, wo ihm beim BCI viele erfahrene Mitarbeiter zur Verfügung stehen? »Es geht aber nicht um Kühe, oder?«, frage ich.
Er lacht. »Zwei vermisste Personen, aber das scheint mir noch nicht das Ende.«
»Das ist nicht gerade mein Spezialgebiet.«
»Wenn es um Amische geht, schon.«
Das macht mich neugierig. »Ich bin ganz Ohr.«
»Zwei Teenager werden vermisst, aus zwei verschiedenen Städten in einem Radius von hundert Meilen. Wir stellen gerade die Fakten zusammen, und ich fahre so schnell es geht hin, um die Familien zu befragen. Ich dachte, du könntest mir vielleicht dabei helfen.«
Die Kluft zwischen den Amischen und den Englischen ist größer als man denkt, dessen bin ich mir bewusst. Eine Kluft, die noch tiefer wird, wenn Polizei oder eine übergeordnete Behörde wie das BCI involviert sind. Meine persönlichen Kenntnisse der Amischen sowie die Tatsache, dass ich fließend Pennsylvaniadeutsch spreche, können dazu beitragen, diese Gräben zu überbrücken und es ihnen leichter machen, offen zu sprechen.
Ich halte vor der Butterhorn Bakery an, um mich ganz auf das Gespräch zu konzentrieren. »Wo genau sind die Mädchen verschwunden?«
»Die letzte Vermisstenanzeige kam aus Rocky Fork, einer kleinen Stadt zirka fünfzig Meilen von Cleveland entfernt.«
Ich atme tief durch, will mich nicht allzu geschmeichelt fühlen. »Macht mich neugierig.«
»Neugierig genug, um herzukommen?«
»Jetzt gleich?«
»Die Zeit läuft uns davon. Am besten wär’s, wenn wir uns in Richfield treffen und gleich den bürokratischen Kram erledigen. Ich stelle dich den Anzugträgern vor, es gibt ein kurzes formelles Briefing, du musst ein paar Formulare unterzeichnen und bekommst einen befristeten BCI-Ausweis. Was hältst du davon?«
Auf einmal bin ich ganz aufgeregt. »Ich muss hier noch schnell ein paar Sachen regeln. Wann ist das Briefing?«
»Sobald du hier bist. Ruf mich an.«
Ich will ihm gerade eine ungefähre Zeit nennen, da hat er schon aufgelegt. So sitze ich ein paar Sekunden einfach nur da, dümmlich lächelnd und mit frischer Energie dank der Aussicht, für so eine angesehene Behörde zu arbeiten. Doch in Wirklichkeit hat mein Gefühl mehr mit John Tomasetti zu tun als mit dem BCI. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, nur dass es ehrlich ist, und ich beschließe, es nicht weiter zu analysieren.
Stattdessen überlege ich, was vor meiner Abfahrt noch alles zu erledigen ist. Ich muss mit dem Bürgermeister reden, mein Team informieren und dafür sorgen, dass jemand meine Schichten übernimmt. Was nicht einfach wird, da wir in Painters Mill chronisch unterbesetzt sind. Aber Skid – für den ich letzte Nacht eingesprungen bin – kommt heute zurück, und ich hätte laut Plan das Wochenende frei. Es kann also funktionieren.
An Schlafen ist natürlich nicht zu denken, und so aktiviere ich das Funkgerät. Mona meldet sich mit einem munteren: »Painters Mill Polizeirevier!«
»Hallo, ich bin’s.«
»Was gibt’s, Chief?«
»Ich möchte, dass Sie unsere Herren zu einem kurzen Briefing einbestellen.«
»Heute Morgen? Ist was passiert?«
Ich erzähle ihr von meiner Unterhaltung mit Tomasetti. »Nach Möglichkeit sollten alle in der nächsten Stunde eintreffen. Ich fahre kurz nach Hause, dusche und packe ein paar Sachen.«
Ich brauche eine Stunde, um zu duschen und genug Kleidung für ein paar Tage einzupacken. Ich bin wirklich kein Modefreak, muss aber ziemlich lange überlegen, was ich mitnehmen soll. Normalerweise trage ich mein Standardoutfit: die gute alte Polizeiuniform in schlichtem Blau und ein ledernes Schulterholster. Ohne jeden Schnickschnack. Nach drei Jahren als Polizeichefin identifiziere ich mich damit, zumindest was den Stil betrifft. Doch dieser Beraterjob entfernt mich Lichtjahre von meiner heimischen Wohlfühlzone. Und nicht zu vergessen John Tomasetti. Auch wenn ich mit Mode nicht viel am Hut habe, bin ich doch eine Frau und trotz meiner amischen Herkunft ein wenig eitel.
Ich entscheide mich für ein legeres Businessoutfit: khakifarbene Hose, schwarze Hose und Jeans, zwei Blazer, zwei Jacken, eine Bluse und ein paar schöne T-Shirts. Ich ärgere mich über mich selbst, weil ich so lange gebraucht habe, wo ich doch noch hundert Meilen fahren muss, verzichte deshalb auf Schmuck, werfe meine Toilettenartikel in die Tasche und eile zur Tür.
Auf dem Weg zum Revier rufe ich Bürgermeister Auggie Brock an, um ihm die Neuigkeiten zu unterbreiten. Natürlich nicht ohne hervorzuheben, wie sehr unsere Beziehung zu einer wichtigen überregionalen Polizeibehörde davon profitieren wird.
»Wie lange sind Sie weg?«, lautet erwartungsgemäß seine erste Frage.
»Ich bin nicht sicher«, antworte ich. »Zwei, drei Tage.«
Der Laut am anderen Ende zeigt mir, dass er nicht begeistert ist. Aber ihm ist klar, dass er nicht nein sagen kann, denn seit drei Jahren habe ich keinen Urlaub genommen und in den meisten Wochen auf meinen freien Tag verzichtet. Im Notfall habe ich also ein paar gute Argumente, dass er mich gehen lässt.
»Das ist dann aber Ihre Privatsache«, sagt er. »Sie müssen Ihren Urlaub dafür verwenden. Und natürlich können wir Ihnen keine Reisekosten erstatten, unser Budget ist sehr begrenzt.«
»Das BCI zahlt ein Tagegeld und die Auslagen.«
»Das ist gut.« Ich kann fast hören, wie er das Für und Wider abwägt und sich ein Worst-Case-Szenario vorzustellen versucht.
Eine unbehagliche Stille tritt ein. Ich überlege gerade, wie ich das Gespräch elegant beenden kann, als er das eine Thema anspricht, das ich gern vermieden hätte. »Vor Ihrer Abreise«, sagt er schließlich, »also, ich wollte Sie schon die ganze Zeit wegen Bradford anrufen. Wegen der Anklage.«
»Auggie –«
»Er ist minderjährig … ein gutes Kind, das noch das ganze Leben vor sich hat.«
»Wir haben schon alles dem Bezirksstaatsanwalt übergeben, das wissen Sie doch.«
»Sie könnten … die Klage zurückziehen.«
»Die Klage zurückziehen?«, wiederhole ich ungläubig seine Worte. Ich bin einiges von Auggie gewöhnt, aber das ist echt unverschämt. »Wir haben ihn mit Drogenbesteck und dreißig Gramm Marihuana erwischt. Er hat auf einen meiner Officer eingeprügelt, T. J. musste genäht werden, Auggie. Das kann man nicht ungeschehen machen.«
»Aber Sie müssen doch mildernde Umstände gelten lassen. Bradford war völlig durcheinander wegen –«
Ich kenne Bradford Brock nicht persönlich, habe aber den Polizeibericht gelesen. Der sogenannte »gute Junge« hatte genug Marihuana dabei, um damit sämtliche Highschool-Kiffer einen Monat lang zu versorgen. Und laut Bluttest war er randvoll mit Methamphetamin.
»Stress wegen einer Highschoolprüfung ist kein mildernder Umstand«, sage ich ihm.
»Hören Sie, ich kann nur schwer glauben, dass mein Sohn dreißig Gramm Marihuana bei sich gehabt haben soll. Vielleicht hat T. J. … überreagiert. Vielleicht könnten Sie seinen Bericht … korrigieren. Zumindest hinsichtlich der Menge.«
Das Gespräch hat eine Richtung eingeschlagen, die mir äußerst unangenehm ist und die ich nicht weitergehen will. »Ich finde, wir sollten diese Unterhaltung jetzt beenden.«
»Das kann ich nicht. Er ist mein Sohn.« Auggie stößt einen Seufzer aus. »Kommen Sie, Kate. Seien Sie kooperativ.«
»Was genau erwarten Sie von mir?«
»Nichts, was nicht auch sonst tagtäglich passiert.« Er hält inne. »Berichte gehen verloren, Beweismittel verschwinden, das passiert doch ständig. Es würde mir und meiner Frau ungeheuer viel bedeuten, wenn sich die ganze Sache in Luft auflöst.«
»Sie verlangen von mir, eine Grenze zu überschreiten, Auggie.«
»Kate, ich bin verzweifelt. Die ganze Angelegenheit ist ein einziger Albtraum. Wenn Bradford nicht als Minderjähriger, sondern als Erwachsener angeklagt und verurteilt wird, ist sein ganzes Leben ruiniert. Er gilt dann als vorbestraft.«
In dem Moment wird mir klar, dass ich diese Auseinandersetzung nicht gewinnen kann. Auggie Brock ist, zumindest indirekt, mein Boss. Doch er ist auch ein Vater, und ich weiß, dass Blut schwerer wiegt als Gesetzestreue.
»Herrgott nochmal, Kate! Catherine ist am Rand eines Nervenzusammenbruchs. Sie hätten mich anrufen sollen, anstatt ihn zu verhaften! Warum haben Sie die ganze Sache nicht mir überlassen?«
»Ihnen überlassen?« Ich atme tief durch, schließe kurz die Augen, um mir bewusst zu machen, dass Auggie ein guter Mensch ist, der von jemandem, den er liebt, in eine grässliche Situation gebracht wurde. »Ich werde so tun, als hätte dieses Gespräch nie stattgefunden.«
Die Leitung ist tot, bevor ich fertig bin.
Kopfschüttelnd werfe ich das Handy in die Konsole. Ich fühle mit Auggie und seiner Frau, aber ich werde auf keinen Fall einen Polizeibericht fälschen oder Beweismittel »verlieren«, damit sein großmäuliger Sohn ungeschoren davonkommt. Meiner Meinung nach könnte ein kurzer Aufenthalt in der Jugendstrafanstalt genau der Tritt in den Hintern sein, den der Junge braucht, um wieder auf die rechte Bahn zu kommen.
Ein paar Minuten später parke ich auf meinem Platz vorm Polizeirevier, einem hundert Jahre alten Backsteingebäude mit zugigen Fenstern, hämmernden Rohrleitungen und einer Reihe unerklärlicher, meist unangenehmer Gerüche. Mona und Lois haben an strategisch ausgewählten Stellen Lufterfrischer platziert, doch der Eingangsbereich riecht immer nach alten Rigipsplatten, morschem Holz und wahrscheinlich ein oder zwei toten Mäusen. Die Einrichtung erinnert an eine der frühen TV-Krimiserien, und ich meine nicht im Sinne von retro-cool, sondern von potthässlich. Vor ein paar Monaten hatte der Stadtrat zwar einen neuen Schreibtisch und Computer für die Telefonzentrale bewilligt, aber nur, weil der alte Computer buchstäblich in Flammen aufgegangen war.
Beim Betreten des Reviers nagt das Gespräch mit Auggie noch an mir. Mona Kurtz sitzt am Schreibtisch mit der Telefonanlage und starrt auf den Bildschirm, auf dem Kopf das Headset mit zur Seite gedrehtem Mundstück. Mit einer Hand steckt sie sich Weintrauben aus einem Plastikbeutel in den Mund, mit der anderen schiebt sie die Computermaus herum. Wie immer ist ihr Radio ein bisschen zu laut aufgedreht, und ihr Fuß wippt im Takt eines funkigen Stücks von Linking Park.
Ich steuere geradewegs auf sie zu, als sie den Kopf hebt. Sie schenkt mir ein kurzes Lächeln, schaltet das Radio aus und holt ein Bündel rosa Telefonmessages aus meinem Nachrichtenfach. »Sie sind heute Morgen eine gefragte Frau, Chief.«
»Und es ist noch nicht einmal zehn Uhr.«
»Schon mal überlegt, sich klonen zu lassen?«
»Irgendwie habe ich das Gefühl, die Welt braucht mich nicht in doppelter Ausführung«, erwidere ich.
Ein burgunderroter Streifen links vom Scheitel kontrastiert ihr – heute – rabenschwarzes Haar. Sie trägt hautenge schwarze Hosen, ein knappes T-Shirt und einen blauen Schal, der wie eine Schlinge um den Hals liegt. Ihre Schuhe kann ich von meinem Platz aus glücklicherweise nicht sehen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: