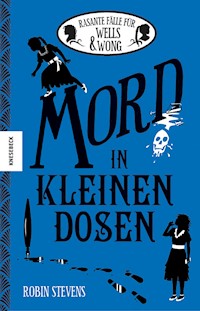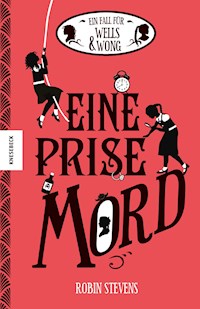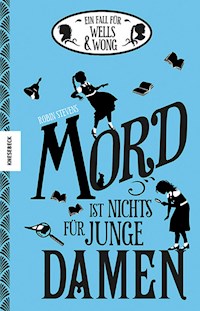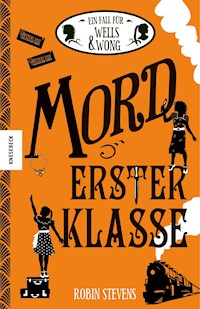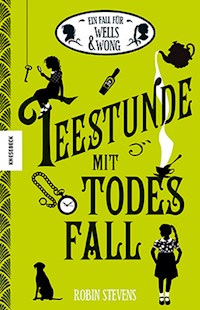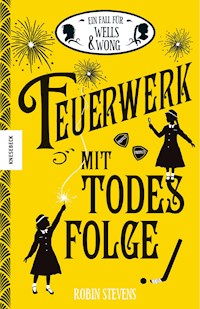13,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knesebeck Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Abteilung für undamenhafte Aktivitäten
- Sprache: Deutsch
Der zweite Fall für die Spione der Abteilung für undamenhafte Aktivitäten März 1941. Großbritannien befindet sich noch immer im Krieg und ein geheimes Ministerium der britischen Regierung, die Abteilung für undamenhafte Aktivitäten, bildet Kinder als Spione aus - weil diese von Erwachsenen häufig unterschätzt und übersehen werden. May, Eric und Nuala sind mutig und clever und die neuesten Mitarbeiter des Ministeriums. Nachdem May und ihre Freunde ihre Spionagekünste bereits einmal erfolgreich unter Beweis gestellt haben, bringt Mays große Schwester Hazel die drei in einer ruhigen Straße nahe des Ministeriums unter. Doch im Keller eines ausgebombten Hauses am Ende der Straße entdecken die drei Nachwuchsspione etwas, das nach dem letzten Luftangriff noch nicht dort war und wohl erst später dort versteckt wurde … eine Leiche! Könnte es sich dabei um den vermissten Spion des Ministeriums handeln, den Daisy Wells in einer gefährlichen Mission in Frankreich finden soll? Oder könnte es jemand anderes sein - jemand, den ein Anwohner der Straße zum Schweigen bringen wollte? Wer steckt hinter dem Mord? Und was sind die Motive? Bei ihren Nachforschungen stoßen May, Eric und Nuala auf eine gefährliche Spur. Spannung garantiert mit Spionage, Schmuggel und Schwarzmarktgeschäften! Ein rasanter Krimi und das perfekte Lesefutter für Jungs und Mädchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Robin Stevens
Tote spionieren nicht
Für Nat und Harriet:
Detektivgesellschaft für immer
STRENG GEHEIM
Aus den Fallakten
des Ministeriums
für undamenhafte
Aktivitäten
April 1941
TEIL EINS Unsere neuen Abenteuer beginnen
1
Aus dem Bericht von Fionnuala O’Malley, Geheimagentin des Ministeriums für undamenhafte Aktivitäten 23. April 1941
Dies ist mein Bericht über die verschwundene Spionin und den Mord in Hogarth Mews. Er handelt von der Zeit, als Eric, May und ich eine Leiche entdeckten und jede Menge Geheimnisse und als beinah – na, ihr werdet schon sehen. Ich will noch nicht gleich alles verraten.
Ich kann kaum glauben, dass ausgerechnet ich diesmal die offizielle Dokumentation schreibe, die Hazel dann ins Archiv des Ministeriums stellen wird. Das macht diesen Bericht tatsächlich wichtig. Und geheim. Wir dürfen niemandem irgendetwas über diesen Fall erzählen und auch nicht darüber reden, was wir für das Ministerium so tun. Das haben wir unterschrieben.
Ich habe May gefragt, ob sie mir helfen will, denn beim letzten Mal hat sie den Bericht geschrieben, aber sie sagte, das habe ihr gereicht, vielen Dank. Dann fragte ich Hazel, was ich schreiben soll, und sie meinte, am besten sei es, von Anfang an zu berichten und erst mal zu erzählen, was seit unserem letzten Fall alles passiert ist. So jedenfalls würde sie das immer machen.
Meine Gedanken ins letzte Jahr zurückzuspulen, fühlt sich komisch an, aber natürlich werde ich es tun. Ich bin seit Januar auf der Deepdean Schule, in die auch May geht. Früher habe ich ihr nie so richtig geglaubt, wenn sie erzählte, dass sie die Schule nicht ausstehen kann – wie ist es möglich, dass jemand nicht gern lernt? Aber es stimmt. May ist eine schreckliche Schülerin. Wirklich, es ist komisch. Sie kann einfach nicht still sitzen oder Regeln einhalten, und sie ist unbeliebt bei den meisten Mädchen und allen Mistresses (so nennen wir die Lehrerinnen; es gibt an der Deepdean eine Menge alberner Wörter).
Eine Weile habe ich überlegt, ob ich die Schule auch hassen soll, aber ich konnte einfach nicht. Es macht Spaß an der Deepdean, auch wenn man sich oft verstellen muss, um hier reinzupassen. Und zusätzlich muss ich auch noch so tun, als sei ich eine normale Schülerin und nicht eine … Geheimagentin.
Aber ich bin wirklich eine Spionin genau wie May! Wir gehören dem Ministerium für undamenhafte Aktivitäten an und helfen der britischen Regierung, den Krieg zu gewinnen – obwohl ich erst elfeinhalb Jahre bin und May noch nicht einmal elf ist. Das hört sich seltsam an, aber so ist es.
Ich erkläre es mal.
Unsere erste Mission hatten wir letzten November in Elysium Hall, dem Wohnsitz meiner Familie. Damals hielt ich May für meine Feindin. Komisch, daran zu denken. May und Eric, unser Freund, waren als neu Evakuierte bei uns aufgetaucht, benahmen sich aber so verdächtig, dass ich dachte, sie spionierten für die andere Seite. Das taten sie natürlich nicht. (Offiziell spionierten sie aber auch nicht für unsere Seite. Das Ministerium hatte sie als Geheimagenten nämlich abgewiesen, weil sie noch Kinder waren, und deshalb arbeiteten sie auf eigene Faust. Sie wollten beweisen, dass sie das Zeug hatten, um angenommen zu werden. May erinnert sich nicht gern an diese Zeit.) Als sie dahinterkamen, dass jemand aus Elysium Hall auf der Seite der Nazis stand, versuchten sie, herauszufinden wer. Und dann wurde eines Tages mein Onkel Sidney ermordet.
Ja, im Ernst, er ist ermordet worden! Mich überläuft es immer noch kalt, wenn ich daran denke. Ihr könnt das alles in den Unterlagen des Ministeriums nachlesen. Mays große Schwester Hazel fügte meine Tagebucheinträge von damals in Mays Berichte ein und brachte alles in die richtige Reihenfolge. Ich habe es gesehen. Es sieht richtig amtlich aus in dem schönen roten Einband.
Kurz, ich habe May und Eric geholfen, den Nazi-Spion und den Mörder zu entlarven, und auch wenn damit das Ende von Elysium Hall eingeläutet wurde – es war die Sache wert. Irgendwie habe ich dieses Haus sowieso nie gemocht.
Inzwischen ist Elysium Hall von der Armee requiriert worden, dafür hat meine Familie ein kleines Haus im Dorf bekommen. Eigentlich soll ich während der Schulferien auch dort wohnen. Ich bin aber im Moment doch nicht dort, weil Hazel gegen Ende des Frühlingstrimesters an mich und May geschrieben hat.
Der Brief war an mich adressiert, was durchaus seinen Sinn hatte, weil May immer alles verliert. Sie geht wirklich schlampig mit ihren Sachen um, auch mit solchen, die ihr etwas bedeuten. Gewöhnlich vergisst sie sie im selben Moment, in dem sie sie aus der Hand legt. Als sie aber die geschwungene Schrift auf dem Brief in meinem Fach sah: Für Fionnuala, wurde sie fast böse.
»Warum schreibt sie an dich?«, fragte sie. »Sie ist meine Schwester!«
Ich drehte den Briefumschlag um. Eigentlich hatte ich auf einen Brief von meiner Mam gehofft und war deshalb fast ein bisschen enttäuscht.
Auch für May bestimmt, stand auf der Rückseite.
Wir lachten beide, und die Spannung zwischen uns wich für einen Augenblick – wäre May eine andere, hätte sie vielleicht eher betreten dreingeschaut. Weil sie aber May ist, sagte sie nur: »Siehst du?«
Dann öffnete ich den Brief und das Lachen verging mir.
Ich erschrak, allerdings nicht aus dem naheliegenden Grund. »Notfall in der Familie« war nur der vereinbarte Code für »Wichtige Ministerium-Angelegenheit«. Es ging hier also um eine Spionagesache.
May packte mich am Arm.
»Das ist es!«, zischelte sie. »Sie brauchen uns! Wir können endlich hier weg!«
»Aber das Trimester dauert doch noch Wochen!«, wandte ich ein. Ich wollte die Schule jetzt nicht verlassen. Ich fühlte mich wohl, ich kam gut zurecht, und ein paar der Mädchen in unserem Schlafsaal konnten mich sogar leiden.
»Na und?«, rief May gereizt. Sie war mir gegenüber schon die ganze letzte Zeit so schnippisch gewesen, und ich hatte keine Ahnung warum. »Schule ist Zeitverschwendung. Ich bin schon mal weggerannt. Und sollten sie versuchen, uns aufzuhalten, schaffe ich das auch noch mal.«
»Nur dass sie diesmal bestimmt besser auf dich aufpassen werden«, sagte ich. »Du stehst auf ihrer Liste.«
»Nuala, die brauchen uns«, sagte May. »Und wenn das Ministerium uns braucht …«
Ich warf einen Blick durch den Flur in Richtung Schlafsaal, wo Eloise Barnes und Mariella Semple an diesem Abend eine Mitternachtsparty steigen lassen wollten. Dann schaute ich wieder auf den Brief, auf den May und ich so gewartet hatten. Ich überlegte noch hin und her – da rief May laut: »MISTRESS!«
Die Internatsleiterin streckte den Kopf aus ihrem Zimmer. May sah mich scharf an, und ich gab mir Mühe, ein Seufzen zu unterdrücken.
»Es geht um meine Tante«, sagte ich, zerknüllte dabei das Blatt Papier in meiner Hand, damit sie es nicht sehen konnte, und verzog schmerzlich mein Gesicht. Ich habe gar keine Tante, aber das weiß hier niemand. »Es ist etwas Schlimmes passiert, ich muss sie sofort anrufen.«
Die Internatsleiterin baute sich neben mir auf, während ich wählte, und auch May rückte mir nicht von der Pelle und atmete geräuschvoll in meinen Nacken. Alles, was sie tut, ist laut, sogar ihr Atmen.
»Hallo?«, sagte eine Frauenstimme am anderen Ende der Leitung.
»Hallo«, antwortete ich mit meiner vornehmen Fiona-Stimme für den Fall, dass jemand mithörte. »Tantchen? Ich bin’s. Es tut mir so leid – ich habe deinen Brief gekriegt, und ich komme mir total gemein vor, dass ich mich hier so pudelwohl fühle, wo du gerade so krank bist.«
»Nuala, Liebe! Du hast also mein Schreiben bekommen.«
Es ist nämlich so, Pudel ist mein Codename, und deshalb wusste die Telefondame im Ministerium, Miss Lessing, sofort, wer ich war.
»Ja, heute Morgen. Ist es schlimmer geworden?«, fragte ich und gab meiner Stimme einen besorgten Klang. »Wirklich? Wie schrecklich.«
»Ich habe Probleme«, sagte Miss Lessing. »Ich brauche euch dringend in London. Ihr müsst sofort packen – alle beide.«
»Oh nein, das tut mir furchtbar leid! Wirklich so dringend?«
»Ich denke, ihr schafft den Zug am Samstag. Ich überweise euch telegrafisch Geld. Fahrkartenpreise grenzen zurzeit an Piraterie.«
Mein Herz machte einen Hüpfer. Pirat ist Mays Codename – und Samstag, das war schon morgen. Nach dem, was wir zuletzt aus dem Ministerium gehört hatten, waren wir davon ausgegangen, dass wir vielleicht um Ostern herum zu einer intensiveren Ausbildung nach London kommen könnten. Das eben Gehörte war also ganz und gar neu und aufregend für uns.
»Wir kommen«, sagte ich, insgeheim begeistert.
»Hör mit dem Geschwätz auf – lass mich mit ihr reden«, sagte die Internatsleiterin ungeduldig. Sie nahm mir den Hörer aus der Hand und blaffte: »Hallo?«
May kniff mich mit ihren spitzen kleinen Fingern in den Arm.
»Ja?«, sagte die Leiterin. »Wer ist … oh. Ja. Hallo. Wie … wie furchtbar. Ja, ich verstehe. Und … wirklich alle beide? Hat Mr Mountfitchet das gesagt?«
Sie bedachte May und mich mit einem misstrauischen Blick. »Da sind Sie ganz sicher? Oh … tja … morgen?«
Und so kam es, dass May und ich an einem Samstagnachmittag zu Beginn des Frühjahrs in London eintrafen. Normalerweise hätten wir jetzt zugesehen, wie das Team von Deepdean das von St Chator wieder im Hockey besiegt, stattdessen waren wir kurz davor, richtige Spioninnen zu werden.
An dieser Stelle fängt diese Geschichte überhaupt erst an. Der folgende Bericht besteht aus meinen Tagebucheinträgen aus dieser Zeit, aus Notizen, die ich gemacht habe, bevor ich alle Zusammenhänge durchschaut hatte. Die Nuala auf diesen Seiten weiß noch nicht, was ich jetzt weiß. Manchmal irrt sie sich. Manchmal verhält sie sich falsch. Und manchmal …
… aber ich will euch die Geschichte nicht verderben.
Ihr werdet es sowieso bald verstehen.
2
Aus dem Tagebuch von Fionnuala O’Malley
Samstag, 22. März
Diese Zeilen schreibe ich in der bläulichen Beleuchtung des Zugs nach London, der quietschend und mit halber Geschwindigkeit dahinrumpelt. Ich war seit Ende letzten Jahres nicht in London, liebes Tagebuch, und bin ein bisschen aufgeregt, wieder hier zu sein.
Im letzten Dezember gab es einen großen Fliegerangriff auf London, während wir dort im Ministerium waren. Danach hatte man uns sofort wieder weggebracht, und zwar nach Fallingford House, dem Hauptsitz des Ministeriums außerhalb Londons. Ich hatte in dieser Nacht das Gefühl, als steckte ich in einem Backofen, der Himmel dröhnte vom Prasseln der Feuer, und noch am nächsten Tag hing die Luft voll Staub und zermahlener Asche. Es war der erste Luftangriff, den ich erlebt habe, außer dem im November auf Coventry. Beide machen mir seitdem Albträume.
Inzwischen ist mir klar, dass es nirgendwo hundertprozentige Sicherheit gibt. Aber wir müssen so tun, als ob, sonst würden wir nämlich gar nichts mehr tun. Trotzdem macht es mir heute Angst, in eine große Stadt zu fahren. Auch, bei der Spionage-Ausbildung mitzumachen. Ich habe zurzeit vor vielen Dingen Angst.
Gut nur, dass May und ich unterschiedliche Ängste haben. Würde ihr zum Beispiel Herrn Hitler begegnen, ich glaube, sie würde ihn glatt … beißen. Sie fürchtet sich vor nichts, höchstens vor engen Räumen, aber das sagt sie natürlich keinem. Ich dagegen mache mir Sorgen wegen der Luftangriffe und darüber, wie London inzwischen aussehen wird und wie es im Ministerium sein wird und ob sie vielleicht schon bereuen, dass sie uns als Spione aufgenommen haben, und ob sie uns wieder rausschmeißen werden und ob ich dann wieder in das kleine Haus im Dorf zurückmuss. Aber als ich May das alles sagte, nahm sie meine Hand und erklärte: »Hör mit dem Gerede auf, sonst kommt mir gleich alles hoch!«
May wird nämlich schlecht in Zügen, obwohl die zurzeit wegen des Krieges nur langsam fahren.
»Ich weiß nicht, ob ich das kann«, sagte ich zu ihr. »Ich zerbreche mir doch schon dauernd den Kopf, was ich dir zur Ablenkung erzählen könnte.« Es ist komisch, wieder mit ihr allein zu sein. In der Schule müssen wir – um nicht unser Geheimnis aufzudecken – immer so tun, als wären wir keine guten Freundinnen.
»Schön, wenn du versprichst, kein dummes Zeug zu reden, kannst du erzählen«, sagte May. »Hier, lies mir was aus der Zeitung vor. Ich hab sie dieser alten Frau auf dem Bahnsteig geklaut.«
»MAY!«
»Sie hat sie nicht gebraucht«, sagte May mit zusammengebissenen Zähnen. »Und wenn du mit mir streiten willst, muss ich wirklich gleich kotzen. Lies einfach die besten Artikel.«
Also las ich. Ich las über eine Leiche, die man in einer ausgebombten Kirche gefunden hatte, und über Diebe, die Gemälde aus einem vornehmen Herrensitz gestohlen hatten, und über ein neues Theaterstück …
»Das Theaterstück ist nicht wichtig!«, sagte May.
»Für mich aber schon!«, rief ich. Wie du weißt, liebes Tagebuch, hatte mein Dad eine Theatertruppe, als ich klein war. Während meiner Kindheit war ich mit ihm, Mam und dem Rest der Truppe oft auf Reisen durch die ganze Welt. Aber dann starb mein Dad, und Mam und ich reisten nach England – weshalb wir in Elysium Hall bei meinen englischen Verwandten gelandet sind. So kam es, dass ich May kennenlernte und heute in einem überfüllten dahinschleichenden Zug nach London sitze und ihr aus der Zeitung vorlese, während die Gasmaskentasche einer Frau gegen meinen Kopf drückt und eine Gruppe Soldaten auf dem Gang singt. Ich will damit nur sagen, dass ich an Theaterstücken ebenso interessiert bin, wie May es an Mordfällen ist.
Natürlich nehme auch ich einen Mord ernst, keine Frage. Letztes Jahr habe ich mit May und Eric einen aufgeklärt, ich bin also genauso Detektivin wie Spionin. Aber das ist ein Geheimnis, liebes Tagebuch, von dem niemand wissen soll.
Diesmal aber ist meine Rolle als Detektivin nicht wichtig: Wir sind unterwegs nach London, um bei einem Spionageeinsatz zu helfen.
Diesmal erwarten uns keine Mordfälle.
Auf dem Bahnhof wurden wir von Mays großer Schwester Hazel abgeholt.
Sie sieht May sehr ähnlich, ist aber ruhiger und ausgeglichener und trägt nicht vor Empörung dauernd ihre Stacheln zur Schau. Sie ist dick, hat ein nettes Lächeln in ihrem hübschen runden Gesicht, und ihr langes dunkles Haar trägt sie hochgesteckt. Sie stand Arm in Arm mit einem großen blonden Mann, der mich irgendwie an diese vor Energie sprühenden blonden Hunde erinnerte, die Stöckchen apportieren. Er trug eine Marineuniform und hatte in einer der Taschen einen zerlesenen Krimi stecken.
»Ich bin Alexander«, sagte er und schüttelte begeistert meine Hand. Ich zuckte ein wenig zurück. Es überrascht mich immer, wenn jemand so schnell so freundlich ist, solange ich selbst noch nicht recht weiß, was ich von ihm halten soll. Alexander nahm unsere Taschen auf, als wären sie nichts. »Du musst Fionnuala sein. Die kleine May kenne ich schon.« Sein Akzent wechselte zwischen amerikanischem und britischem Englisch hin und her, was sich anhörte wie ein Radio, das zwischen den Sendern hin und her springt. So ähnlich spreche ich auch, wenn ich mich nicht konzentriere. Meinen Namen aber hatte er richtig ausgesprochen, Fin –noo-la. Ich war beeindruckt.
»Ich bin nicht klein!«, schnappte May sofort. »Ich bin fast elf! Red kein dummes Zeug, Alexander.«
Er grinste sie nur an und ging durch die Bahnhofshalle voraus.
»Alexander ist mein … Freund. Er ist auf Urlaub«, sagte Hazel zu mir und schob uns hinter ihm her. »Er wollte euch mit abholen.«
»Will er dich etwa heiraten?«, fragte May. »Hast du Vater erzählt, dass du einen gweilo heiratest?«
Hazel bekam rote Wangen. »May!«, sagte sie. »Sei nicht so vorlaut!«
»Bin ich gar nicht! Übrigens lässt Rose dich grüßen«, fuhr May fort. »Und hast du was von Vater gehört? Er hat uns nicht einen Brief geschrieben, und ich finde, das ist das wenigste, was er tun könnte, nachdem er uns während eines Krieges in England zurückgelassen hat.« Ihre Stimme war höher geworden.
»May!« In Hazels freundlichem Gesicht flackerte etwas auf und fiel wieder in sich zusammen. »Du weißt, er hat viel zu tun in Hongkong. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist. Er ist jedenfalls bei Teddy – willst du denn nicht, dass er für Teddys Sicherheit sorgt?«
»Ich will, dass er für unsere Sicherheit sorgt!«
Und dann fingen sie und May an, sehr schnell auf Kantonesisch zu sprechen, und sahen sich dabei noch ähnlicher als sonst. Manchmal wünschte ich, ich hätte Geschwister. Es muss schön sein, jemanden zu haben, der einen so gut kennt und einen annimmt, wie man ist, ohne dass man ihm etwas vormachen muss. Ich warf einen Blick durch die Bahnhofshalle. Sie war erfüllt von Lärm und Helligkeit – es war ein strahlender Nachmittag, und durch die Fensterscheiben und die Lücken, in denen das Glas fehlte, fiel Sonnenlicht.
Als wir aus dem Bahnhof traten, fanden wir uns im wirklichen London wieder.
Ich bin vor dem Kurzaufenthalt im letzten Dezember schon einmal hier gewesen, mit Dad und der Schauspieltruppe, aber da war ich noch sehr klein und kann mich kaum daran erinnern. Wenn man klein ist, sieht alles viel größer aus, klar, man weiß noch nicht, wie alles zusammenhängt, weil man sich nur nach den Erwachsenen richtet. In diesem Frühjahr aber kam mir London wie eine unfertige Theaterkulisse vor: Gebäude, so scharf durchtrennt wie geschnittenes Papier, offene Türen, die für immer darauf zu warten schienen, dass jemand eintritt, Bilder, schief an geborstenen, nutzlos gewordenen Wänden. Auf den Straßen Menschen in Uniform mit müden, doch entschlossenen Gesichtern, und über allem Staub, sodass nichts ganz real wirkte.
Andererseits schien das Leben zurzeit ohnehin nicht ganz real zu sein.
Ich hatte gedacht, wir würden in Hazels und Daisys gemeinsamer Wohnung in Bloomsbury wohnen, aber so war es nicht.
»Warum nicht?«, wollte May wissen.
»Das Baby der Mountfitchets«, sagte Hazel kurz. »Sie wohnen direkt unter uns, und die Kleine ist … laut.« Nach einer Pause setzte Hazel hinzu: »Und Daisy wird bald zurück sein. Jedenfalls – Zosia hat gerade ein freies Zimmer, da könnt ihr wohnen.« Wir schoben uns durch die grauen aufgerissenen Straßen, drückten uns an Uniformierten vorbei und an Kindern, die sich gegen Karren voll Altmetall stemmten, wir wichen Rettungswagen aus und Zeitungsverkäufern und Frauen mit Einkäufen und einem Mann mit den Streifen eines Feldwebels auf der Schulter, der an Krücken ging, ein Hosenbein leer und hochgeschlagen.
»Wo ist Daisy?«, fragte ich. Ich finde es irritierend, wenn Leute, die man kennt, von Leuten reden, die man nicht kennt. Das kommt mir immer vor, als wäre ich versehentlich im falschen Zimmer. Ich muss dann einfach so tun, als wäre ich eine ganz andere Person – die fröhliche englische Fiona, die Art von Mädchen, die perfekt in die Deepdean-Schule passt. So kam es, dass ich bei der Frage nach Daisy einen so übertrieben britischen Radiotonfall anschlug, wie ich nur konnte. Daisy kenne ich wenigstens. Sie hat May, Eric und mir bei unserem letzten Fall geholfen, und genau genommen war sie es, die all die Hinweise, die wir herausgefunden hatten, zusammensetzen und den Mörder entlarven konnte. Darüber ärgert sich May heute noch.
Obwohl ich ganz sicher freundlich gefragt hatte, verdüsterte sich Hazels Gesichtsausdruck von neuem, und ihre Finger krampften sich nervös um ihre Handtasche.
»Sie ist auf Geschäftsreise«, sagte sie kurz.
Ich verstand, was sie meinte. Geschäftsreise stand für Einsatz. Daisy ist nämlich eine Spionin wie Hazel.
»Wohin?«, trompetete May. »Geht’s um was Wichtiges? Wann kommt sie zurück? Was …«
»May! Leiser! Du weißt genau, dass ich hier nicht reden kann. Also halte deine Zunge im Zaum!«
Dann scheuchte uns Hazel durch einen Park, vorbei an kleinen Läden und großen weißen Marmorgebäuden und weiter über belebte schmutzige Straßen bis zu dem Haus, in dem wir wohnen sollten und in dem unser Freund Eric auf uns wartete.
3
Ich habe in diesem neuen Tagebuch noch nicht viel über Eric gesagt, oder? Das geht natürlich gar nicht, denn Eric ist sehr wichtig. Er ist der Dritte in unserer Detektivgesellschaft und außerdem der Netteste. Das ist keine Übertreibung. Er ist viel netter als May und ganz bestimmt netter als ich. Er nimmt die Menschen für sich ein, ohne sich besonders darum zu bemühen. Immer findet er die richtigen Worte. Er ist sehr sensibel und geradlinig auf eine Art, wie sie von allen geschätzt wird – von Menschen wie von Tieren.
Er ist rundlich, hat dunkle Haut, kurzes krauses Haar und schleppt ständig irgendein Tier mit sich herum. In Elysium Hall war das Emil, der Igel, aber als wir dann alle weggehen mussten, setzte er Emil wieder in seinem Feld aus. Schade, dass er – weil er ein Junge ist – nicht mit May und mir auf die Deepdean gehen kann, denn es würde ihm gefallen, und wir hätten ihn gern bei uns. So kommt es, dass er auf eine Schule namens Weston geht. Er hat ein Stipendium bekommen, weil seine Familie nicht reich ist, anders als meine englische Familie und ganz sicher sehr viel anders als die von May. May kommt aus Kreisen, in denen man nicht nur ein Haus besitzt, sondern mehrere und außerdem ein Boot und Bedienstete. Sie ist reich. Als sie vor ein paar Monaten wie nebenbei erwähnte, dass ihr Vater ein Boot in Hongkong hat, habe ich gemerkt, dass sie nicht die leiseste Ahnung hat, wie abgehoben das ist.
Eric ist mit seinen Eltern und seiner Zwillingsschwester Lottie aus Deutschland nach London gekommen, so wie ich aus Amerika kam, und damit haben wir etwas gemeinsam. Seine Eltern waren in Deutschland berühmte Musiker, aber jetzt ist sein Papa im Gefängnis, weil die britische Regierung befürchtet, er könnte ein Nazi sein – was er ganz sicher nicht ist. Erics Schwester Lottie geht auf die Deepdean, sie ist im Jahrgang über mir und May, und seine Mama betreibt in London einen Nachtklub. Manche Leute finden das unpassend, sagt Eric. Ich verstehe nicht warum. Ein Nachtklub ist wie ein Theater, nur dass da Musik gespielt wird und dort Theaterstücke. Es macht mir Eric noch sympathischer, dass seine und meine Eltern so ähnliche Interessen haben – oder besser gesagt hatten.
So viel zu Eric. Hazel hat uns gesagt, dass auch er aus der Schule geholt worden war und dass er in derselben Straße untergebracht würde wie wir: Hogarth Mews.
Ich sollte wahrscheinlich erklären, was eine »Mews« ist, für den Fall, dass es euch so geht wie mir und ihr noch nie von einer gehört habt. Aber das ist es eben mit Engländern: Wenn sie etwas sagen, ist das jedes Mal ein Test. Versteht man, was sie meinen, gehört man dazu, versteht man es nicht, wird man nie dazugehören.
Als ich Hazel von »Hogarth Mews« reden hörte, war ich erst mal total verwirrt. Erst dachte ich, dass sie zu Erics großer orangefarbener Katze namens Pfote, die im Ministerium lebt, offenbar eine zweite aufgenommen hatte, eine namens Hogarth.
Aber eine Mews hat überhaupt nichts mit dem Miauen einer Katze zu tun. Es ist eine Sackgasse mit schnuckeligen kleinen Häusern. Früher, in der viktorianischen Zeit, waren diese Häuser Garagen oder Pferdeställe – damals hatten selbst Ställe zwei Etagen.
Der Durchgang zur Hogarth Mews liegt versteckt an einer breiten Straße nahe der Oxford Street und dem Britischen Museum. Man taucht sozusagen zwischen zwei großen, vom Londoner Qualm geschwärzten Häusern in die etwas abschüssige Straße hinein. Es ist, als wäre man in einer gepflasterten Spielzeugstraße: dunkle kleine Puppenhäuser mit weiß gestrichenen Fensterrahmen und glänzend schwarzen Stalltüren an beiden Seiten.
Zumindest links sind es einzelne Häuser. Rechts hat man die Häuser in Wohnungen unterteilt. Sie werden »Hogarth-Mews-Villen« genannt. Aber wie vieles in England halten sie nicht, was ihr Name verspricht. In jeder der Wohnungen gibt es zwei Schlafzimmer, eine winzige Küche und ein größeres Wohnzimmer. May und ich teilen uns ein Zimmer in Wohnung Nummer zwei im ersten Stock, und Eric wohnt direkt unter uns in Wohnung Nummer eins – aber dazu werde ich gleich noch etwas sagen.
Am hinteren Ende der Hogarth Mews gibt es keinen Durchgang, man muss die Straße also auf demselben Weg verlassen, auf dem man sie betreten hat. Die Häuser in der Mews sehen echt klein aus, weil hinter ihnen die üblichen Londoner Häuser zu beiden Seiten wie Klippen in die Höhe ragen. Es ist in der schmalen Straße immer ein wenig dunkler als draußen, doch wegen dem ausgebombten Haus vorn am Durchgang ist es wahrscheinlich nicht ganz so düster ist wie gewöhnlich.
Ich habe geschrieben, dass man, sobald man die Straße betritt, zwei kleine Häuserreihen vor sich sieht. Das stimmt nicht ganz, denn eigentlich ist das Erste, was man sieht, der Trümmerhaufen auf der linken Seite: Das erste Haus dort ist von einer Bombe getroffen worden. Es sieht aus, als hätte jemand eine Scheibe aus einem Kastenbrot herausgeschnitten. Ein paar Mauerbrocken stehen noch auf jeder Seite, und man erkennt Risse, die sich bis in das zweite Haus ziehen. Auch dieses zweite Haus sieht nicht so aus, als könnte noch jemand darin wohnen.
Ich habe inzwischen begriffen, dass man am besten nicht nachfragt, wenn es um ausgebombte Häuser geht – ich meine, was mit den Menschen darin passiert ist. Meistens möchte man die Antwort lieber nicht wissen. Aber als wir an diesem Nachmittag in die Mews kamen, zeigte Alexander auf das zerstörte Haus und sagte: »Das ist letztes Jahr passiert, bevor George und ich herkamen. Zum Glück ist die Familie nicht hier gewesen. Sie hielten sich in ihrem Haus auf dem Land auf. Und die Frau, die früher nebenan in Nummer zwei gewohnt hat, ist auch woanders hingegangen. Ihr müsst euch also keine Gedanken machen.«
»Warum sollte ich mir darüber Gedanken machen?«, fragte May, die nach ihrer Auseinandersetzung mit Hazel immer noch in widerborstiger Stimmung war.
Alexander sah mich an und lächelte.
»Danke«, sagte ich zu ihm.
Eric sollte in Alexanders Zimmer wohnen und Alexanders Freund George in dem anderen. Als ich fragte, wo denn Alexander bleiben würde, wenn Eric sein Zimmer übernahm, wurden Hazel und Alexander beide rot, und Hazel sagte: »Oh, Alexander nimmt einstweilen Daisys Zimmer in unserer Wohnung, solange sie weg ist.«
Das könnte etwas zu bedeuten haben, und ich merkte, dass auch May etwas gewittert hatte. Sie hatte dieses Kleine-Schwester-Glitzern in ihren Augen, das sie immer bekommt, wenn in der Schule ihre Schwester Rose in der Nähe ist.
»Hazel …«, setzte sie an, aber da gingen wir gerade am dritten Haus links vorbei, und ein Hund fing an zu kläffen. Als ich den Kopf drehte, sah ich ihn hinter dem Fenster auf und ab springen. Er war dick, schwarz und hatte krauses Fell auf dem Kopf und lange Schlappohren. Ein kleines Mädchen, vielleicht vier Jahre, saß neben ihm am Fenster und streckte mir die Zunge heraus. Die Stimme einer erwachsenen Person brüllte den Hund an, und ein Arm griff nach ihm, während er hochsprang. Dann fing irgendwo in der oberen Etage ein Baby an zu schreien.
»Babys!«, rief May und verzog das Gesicht. »Denen entkommen wir einfach nirgendwo!«
»Es ist das Haus der Mortensens«, sagte Alexander mit gedämpfter Stimme.
»Mrs Mortensen, ihre Schwiegertochter Colette und deren zwei Kinder, Margot und Olivier. Mrs Mortensen wohnt schon seit Jahren hier. Colette und die Kinder sind letzten Sommer aus Frankreich rübergekommen. Das sind echt nette Leute, nur der Hund regt sich immer furchtbar auf und fängt an zu bellen, wenn jemand vorbeigeht. Neben ihnen wohnen die Goodchilds. Die sind toll. Mr Goodchild arbeitet im Britischen Museum. Ihr Sohn Cecil ist nur ein paar Jahre älter als ihr, und dann Anna … Oh, hey!«
Ich sah ihn an und wunderte mich, was ihn zu der plötzlichen Unterbrechung veranlasst hatte. Mir war längst aufgefallen, dass er zu jenen Menschen gehörte, die Hinz und Kunz großartig und toll nennen, selbst wenn sie es vielleicht gar nicht sind.
Er winkte quer über die Straße zwei Leuten auf der anderen Seite zu, die gerade aus dem Eingang zu den Wohnungen am unteren Ende gekommen waren. Der eine war ein Mann mit brauner Haut, glattem dunklen Haar und einer Augenklappe. Sein Hosenbein war bis zum Knie hochgeschlagen wie bei dem Feldwebel, den wir vorhin gesehen hatten. Viele Soldaten kommen derzeit so zurück, aber ich hatte noch keinen gesehen, der mit seiner Verletzung so sportlich umging. Er hätte der Hauptdarsteller in jedem Schauspiel sein können.
Er winkte Alexander forsch mit einer seiner Krücken, dann nickte er zu May und mir herüber. Ich fühlte mich fast ein bisschen überwältigt.
»Nuala, das ist unser Freund George«, sagte Hazel.
»Weiß ich!«, sagte May.
»Ist mir klar, dass du das weißt! Sei still, May!«
Neben George stand Eric. Er wirkte größer, als ich ihn in Erinnerung hatte, war aber immer noch kleiner als ich. Ein Lächeln überzog sein rundliches Gesicht, als er uns beiden winkte.
May rannte natürlich sofort los und fiel ihm um den Hals. Ich war da etwas zurückhaltender. Wenn ich jemanden nach längerer Zeit wiedersehe, habe ich immer die Sorge, dass er mich inzwischen vergessen haben könnte. Normalerweise ist das so. Es ist schwer, Freunde zu finden, und noch schwerer ist es, sie zu behalten. Vielleicht war ich nicht ganz sicher, ob wir wirklich noch immer Freunde waren.
Aber da wurde Erics Grinsen noch breiter, er streckte seinen freien Arm aus, und am Ende fiel auch ich ihm um den Hals.
»Ich habe dich vermisst!«, sagte er zu mir.
»Oh! Ich dich auch!«
»Wir sind wieder alle beisammen!«, sagte Eric strahlend. »Ich bin so froh.«
»Ähh, ja!«, rief May, während sie Eric immer noch an sich drückte. »Also ich werde von uns dreien am besten spionieren – ihr werdet sehen!«
»Also erstens«, sagte George und beugte sich dicht über uns, »sagt so was nie außerhalb des Ministeriums. Das ist wichtig. Besonders hier – man kann hier den Nachbarn nicht entkommen. Und zweitens: May und Nuala, ihr beeilt euch und stellt eure Sachen in Zosias Zimmer ab. Ihr sollt noch heute Nachmittag Anweisungen bekommen.«
Zosia, wer immer sie sein mochte, war nicht in ihrer Wohnung. Hazel öffnete mit einem Zweitschlüssel, und May und ich stellten unsere Taschen auf das Bett in dem freien Zimmer und legten unsere Lebensmittelkarten auf den Tisch. Essen ist immer wichtig in einem Krieg, und es ist nicht höflich, bei jemandem einzuziehen, ohne ihn die eigenen Lebensmittelkarten mitbenutzen zu lassen.
»Ich nehme das Bett, und du schläfst auf dem Boden«, bestimmte May.
»Ich nehme das Bett!«, sagte ich. »Das ist nicht fair!«
Wir funkelten einander an.
»Die eine schläft am oberen Ende, die andere am unteren«, sagte Hazel. »Regt euch ab. So, und jetzt schnell.«
Dass uns gesagt wurde, wir sollten uns abregen, machte uns natürlich noch wütender, aber die anderen warteten draußen auf uns. Wir eilten also wieder hinaus auf die Straße, wobei ich mir die Haare richtete und May einen ihrer Socken hochzog, der ihr auf dem Weg vom Bahnhof runtergerutscht war.
Draußen stellte ich fest, wie recht George gehabt hatte. Gegenüber bellte immer noch der Hund, das kleine Mädchen drückte sich gegen das Fenster, und in dem Haus direkt neben unserem ging ein Fenster auf, und eine füllige Frau mit einem freundlichen Gesicht und einem lockeren grauen Haarknoten im Nacken beugte sich heraus, um ihre Fensterkästen zu wässern, die mit wunderschönen Frühlingsblumen bepflanzt waren.
»Hallo, George!«, rief sie. »Sind das deine neuen Untermieter?«
»Ja, Mrs Goodchild«, rief George zurück. »Hazels Schwester May und ihre zwei Freunde. Ihre Schulen sind ausgebombt worden, deshalb nehmen Zosia und ich sie für ein paar Wochen auf.«
»Nett von euch«, sagte Mrs Goodchild. »Kinder, wenn ihr mal Kuchen wollt, ich hab meistens einen frisch gebacken da. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen, wenn euch Samuels Gerede über Kunst nicht auf den Wecker geht.«
»Seht ihr? Ich habe euch gesagt, dass sie nett sind«, sagte Alexander zu uns, während wir zusammen die Sackgasse verließen. »Und auch der Kuchen ist toll. So, Hazel, ich denke, hier trennen sich unsere Wege.«
»Wirst du klarkommen?«, fragte Hazel. »Tut mir leid, dass ich an einem Samstag arbeiten muss.«
»Oh, mach dir keine Sorgen. Großmutter möchte mich zum Tee treffen, du verpasst also nicht viel.«
Er wandte sich nach links, und wir anderen bogen nach rechts in Richtung Museum und zum Hauptsitz des Ministeriums, wo man uns erklären würde, was wir eigentlich in London sollten.
4
Mittwoch, 26. März
Ich habe in der vergangenen Woche nicht viel Zeit gehabt, zu schreiben, liebes Tagebuch. Tut mir leid. Ich werde das wohl näher erklären müssen. Was anderes habe ich sowieso nicht zu tun, bevor dieser Angriff vorüber ist. Ich höre immer wieder, wir hätten das Schlimmste hinter uns, aber dann kommen die Flugzeuge doch wieder und wieder zurück. Letzte Woche, kurz bevor wir in London angekommen waren, gab es einen gewaltigen Angriff, der die ganze Nacht anhielt. Die Leute reden immer noch davon. Es macht mir Angst, weil wir nie wissen, was als Nächstes passieren wird. Ich werde also, um mich abzulenken, von dem erzählen, was uns Hazel und George erklärt haben, nachdem wir heil im Ministerium angekommen waren und die rote Tür hinter uns geschlossen hatten.
Als wir letztes Jahr nach Beendigung des Falles in Elysium Hall mit unserer Ausbildung anfingen, rechnete niemand von uns ernsthaft damit, dass diese Spionageangelegenheit einmal dringend sein könnte. Wir waren wirklich noch zu jung (haben jedenfalls alle gesagt), und so dachten wir, es würde sicher noch Jahre dauern, bevor man uns für unseren ersten Spionageeinsatz anfordern würde.
Aber in den letzten Monaten hat sich im Ministerium viel verändert. Der Krieg ist gefährlicher geworden, und es kommt immer häufiger vor, dass Agenten nicht aus ihren Einsatzorten zurückkehren. Sie bleiben verschollen. Das lässt mich schaudern, denn es bedeutet, dass sie entweder gefangen oder tot sind – und das wiederum bedeutet, dass dem Ministerium in London Geheimagenten fehlen und Leute, die Nachrichten verschlüsseln können. Deshalb hat Mrs Mountfitchet angeordnet, dass jeder, der für mögliche Einsätze in Frage kommt, gründlich weitergebildet werden soll für den Fall, dass man ihn braucht – und damit sind auch wir gemeint. Das ist der Grund, weshalb wir hier sind.
Es ist, als wären wir wieder in der Schule, nur dass hier der Unterricht viel kniffliger ist als normaler Schulunterricht. Ich bin es gewohnt, mit meinen Aufgaben für die Schule immer schnell fertigzuwerden, hier aber tut sich jeder schwer – sogar Eric, der sich schon seit Jahren mit dem Chiffrieren von Texten befasst. Er ist May und mir weit voraus, obwohl ich in den Monaten auf der Deepdean geübt habe. Eric kann achtzehn Wörter pro Minute in Morseschrift übertragen, und fast genauso schnell kann er das auch umgekehrt mit verschlüsselten Wörtern.
Unterrichtsstunden im Codieren haben wir immer bei Hazel in einem kleinen Raum im Erdgeschoss des Ministeriums. Ich mag diese Stunden, aber May lässt sich immer schnell entmutigen. Sie kritzelt ihren Notizblock von oben bis unten voll, macht ihre Buchstaben größer und größer, bis sie schließlich über die ganze Seite quellen und Hazel ihr sagt, sie solle noch mal anfangen. Dann sitzt sie da voll unterdrückter Wut, schnauft durch die Nase, lässt die Zunge aus dem Mundwinkel hängen und grummelt vor sich hin.
»Ist das unbedingt NOTWENDIG?«, fragte sie Hazel heute Morgen.
»Allerdings«, sagte Hazel gelassen. »Ich hab’s dir gesagt. Wir sind Codierer, und es wird in diesem Frühjahr großen Druck geben. Ihr seid unentbehrlich. Versuch’s noch mal. Ich weiß, dass du das kannst, wenn du ordentlich zuhörst.«
»Verflixt!«, rief May und fuhr sich übers Gesicht. »Ich kann so nicht DENKEN!«
Sie stand von ihrem Stuhl auf und fing an, wie eine fauchende Katze herumzutigern.
»Setz dich hin!«, sagte Hazel. »Wirklich, May, wenn du dich nur konzentrieren würdest …«
Ich legte meinen Stift weg und betrachtete die beiden. Eric saß still in der Ecke und arbeitete unbeirrt an der zwölften Seite einer Entschlüsselung. »Ich finde Codes sehr logisch«, hatte er gestern zu mir gesagt. »Sie sind so eindeutig. Ich kann manchmal sogar in Morsezeichen denken, so ähnlich, wie ich auch englisch und deutsch denken kann. Ich höre das Piepen, ich finde es schön.« Für mich hörte sich das wie Zauberei an. Aber manchmal kann ich – also, es ist schwer zu erklären –, manchmal kann ich den ungefähren Inhalt eines noch halb verschlüsselten Satzes erahnen, so ähnlich, als würde ich jemanden einen Text rezitieren hören, den ich aus einem Theaterstück kenne.
Und manchmal, noch interessanter, sehe ich, wo in einem Text der Fehler steckt. Meiner Meinung nach ist das Beste an Codes – auch wenn Eric das anders sieht –, dass sie von Menschen ausgetüftelt und deshalb nie perfekt sind. Ich zum Beispiel schreibe immer das Wort Chef falsch, und sobald ich dieses Wort verschlüsseln soll, schreibe ich die verschlüsselten Buchstaben genauso falsch. Wenn ich mir also einen chiffrierten Text anschaue und er für mich keinen Sinn ergibt, stelle ich mir die Person vor, die ihn vielleicht geschrieben hat, und dann kann ich mich in ihre möglichen Fehler hineindenken, so wie ich mich auch in verschiedene Rollen hineindenken kann.
Ich will damit sagen, dass die Art und Weise, wie jemand einen Code schreibt oder knackt, so unterschiedlich ist wie die Menschen selbst. Mir kam deshalb der Gedanke, dass die Art, wie May sich abmühte, Texte zu entschlüsseln, einfach nicht die ihre war.
»Darf sie umherlaufen, während sie arbeitet?«, fragte ich.
»Nein, sie muss sich setzen …«, fing Hazel an. Sie sah erst May, dann mich an. »Aber vielleicht gar keine schlechte Idee, Nuala«, sagte sie. »Lauf also herum, May, und bleib nicht stehen, bevor du sechs Wörter entschlüsselt hast.«
»TOLL!«, strahlte May, griff nach Stift und Papier und lief leise summend zwischen den Stühlen im Raum herum. »Sonntag dreißigster März«, sagte sie nach zwei Minuten. »Gepäck am … äh … am gewohnten Platz.«
»MAY!«, rief Hazel. »Das stimmt! Du hast es rausgekriegt!«
»Gut gemacht, May«, ließ sich Eric hören.
»Das war doch ganz leicht«, sagte May überrascht. Ihre Wangen waren rot geworden. »Danke, Nuala.«
Ich freute mich. Sicher, ich kenne May jetzt fast sechs Monate. Wir schlafen im selben Schlafsaal in Deepdean, und da ist es kaum möglich, einen Menschen nicht zu kennen. Aber May ist immer so leicht eingeschnappt – ich bin mir manchmal nicht sicher, wie es mit unserer Freundschaft gerade steht, selbst jetzt, außerhalb der Schule. Es war nicht einfach auf der Deepdean. Ich meine, sich dort anzupassen und gleichzeitig mit May befreundet zu sein, und ich fürchte, dass sie das nicht versteht.
Der Unterricht im Codieren dauert immer eine Stunde und endet damit, dass wir Hazel unsere verschlüsselten Gedichtzeilen vortragen. Jeder von uns musste ein Gedicht oder einen Ausschnitt aus einem Theaterstück wählen und auswendig lernen. Das geschieht aber nicht zum Spaß oder um uns zu beschäftigen. Der Sinn ist, dass wir diese Texte in unseren Verschlüsselungen anwenden können, und das ist entscheidend, wenn man uns tatsächlich in einen Einsatz schickt.
Bevor ich Spionin wurde, also damals, als ich nur in Büchern über Spione gelesen hatte, dachte ich immer, Codieren heißt, dass man eben normale Wörter in eine Geheimsprache setzt. Es ist aber so, dass Spione im Lauf der Zeit immer gewitzter werden mussten. Einfache Geheimsprachen kennen inzwischen die meisten Menschen – das Morsealphabet oder Spielsprachen wie Pig-Latin und ähnliche –, deshalb müssen echte Spione mehr für die Sicherheit ihrer Nachrichten tun, als sie nur auf so simple Weise zu verschlüsseln. Und hier kommen Geheimschlüssel, die sich auf ein Gedicht beziehen, ins Spiel.
Ich habe mir Calibans Rede aus Shakespeares Der Sturm ausgesucht: Sei nicht furchtsam, die Insel ist voll von Geräuschen. Eric wählte ein Gedicht über einen Tiger, und May nahm einen scheußlichen kleinen Vers über einen Mann auf der Treppe, der gar nicht da war.
Wollen wir eine codierte Nachricht senden, wählen wir fünf Wörter aus unserem jeweiligen Gedicht und benutzen sie als Schlüssel, um einen völlig neuen Code zu schaffen, der nur zu entschlüsseln ist, wenn der Nachrichtenempfänger unser Gedicht kennt. (Oder falls er herausfinden kann, welches Gedicht wir benutzt haben.)
Wir lernen auch Sprachen. Gegen die Deutschen zu kämpfen, heißt ja auch, dass man Deutsch lesen können muss, auch Französisch, Polnisch und die Sprachen der anderen Länder, die sie überfallen haben. Voll ausgebildete Spione, denen man zutraut, an die Front zu gehen, müssen Sprachen so perfekt beherrschen, dass sie sich während ihrer Einsätze ausschließlich damit verständigen können. Wenn ich daran denke, dass mir das eines Tages passieren könnte, zieht sich mir das Herz in der Brust zusammen. Es ist etwas so Großes und Furchteinflößendes, und trotzdem will ich es wirklich tun.
Den Sprachunterricht gibt George. Ich finde, er ist eine der interessantesten Personen im Ministerium. Er sieht total gut aus, aber es ist nicht nur sein Äußeres, das ihn so attraktiv macht. Es ist auch die Art, wie er sich bewegt – er konzentriert sich voll auf seinen Körper, immer darum bemüht, die Kontrolle zu behalten. Die wenigsten Schauspieler beherrschen das so wie er. Und irgendwie bringt er es noch fertig, seine Luftwaffen-Uniform so zu tragen, als sei sie der letzte Modeschrei.
Auch wenn er die Uniform noch trägt, bei der Luftwaffe ist er nicht mehr. Er hat uns erzählt, dass er bei der Luftschlacht um England dabei war. Er war ein Fliegerass, hat zehn deutsche Flugzeuge abgeschossen, aber dann wurde sein Flugzeug selbst getroffen, und als es zerschellte, verfing sich sein Bein in – ich weiß nicht mehr, in welchem Teil. Sie haben ihn herausgeschnitten, bevor sich das Feuer in der Maschine ausbreiten konnte, aber das Bein war nicht zu retten. Solange er auf die Anfertigung seiner Beinprothese wartet, geht er an Krücken, und über dem linken Auge trägt er eine Augenklappe. Das Ministerium hat ihn sofort eingestellt.
Er ist witzig, alle im Ministerium bewundern ihn, aber gestern, als wir an unserer Übersetzung arbeiten sollten, habe ich gesehen, wie er seinen Stift umklammerte, als wäre es sein einziger Halt. Ich glaube, seine ständige Körperkontrolle hängt zum Teil damit zusammen, dass er Angst hat, was geschehen würde, wenn er sich nur eine Sekunde lang nicht in der Gewalt hat. Ich sehe ihm an, dass ihn sein Bein immer noch schmerzt.
Er und Eric streiten oft wegen Pfote. Sie ist Erics Katze, er hat sie letztes Jahr aufgelesen und im Ministerium untergebracht, und jetzt kommt sie jedes Mal hereingerannt, wenn sich Eric hinsetzt, und rekelt sich – groß, flauschig und orangefarben, wie sie ist – auf seinem Schoß. George findet, dass sie ihn ablenkt, aber dann zuckt Eric nur mit den Schultern und sagt: »Ich kann ihr nicht vorschreiben, was sie tun soll. Sie macht, was sie will.« Er hat Zeit für solche Diskussionen, weil er schon Deutsch und Französisch kann. Ich bin da längst noch nicht so weit. Ich kann ein paar Sätze Irisch und ein paar Japanisch, ich kann in zehn Sprachen grüßen, mich bedanken und fragen, wo es zum Theater geht, aber das ist nicht wirklich das, was vom Ministerium gefordert wird.
George gibt mir Anfängerunterricht in Französisch und Polnisch. Zosia, die Frau, bei der wir wohnen, arbeitet auch im Ministerium. Sie ist halb Polin, halb Serbin, deshalb hilft sie mir bei den Übungen im Polnischen. Nicht, dass sie eine große Hilfe wäre – Zosia gehört zu den Menschen, bei denen man das aufbrausende Temperament sozusagen spüren kann, selbst wenn sie scheinbar still sind. Sie ist sehr hübsch, klein und kurvig, hat tolles dunkelbraunes Haar und immer knallrot geschminkte Lippen, doch irgendwie ist es eine einschüchternde Art von Schönheit. May und ich halten uns an den Abenden lieber von ihr fern und verbringen so viel Zeit wie möglich unten in Erics Wohnung.
May ist im Sprachunterricht noch schlechter als ich – nicht etwa weil sie nicht sprachbegabt wäre (zwei Sprachen kann sie ja schon fließend), sondern weil es sie ärgert, dass Kantonesisch im Ministerium keine Rolle spielt.
»Es ist total nützlich!«, sagte sie zu George.
»Natürlich, May«, sagte er, »aber nicht hier.«
»Doch, genau hier! Unsere Texte ließen sich unmöglich entziffern, wenn die andere Seite nicht jemanden hat, der Chinesisch lesen kann!«
»Woher willst du wissen, dass sie nicht so jemanden haben?«
»Haben sie eben nicht. Ich weiß es. Ich schicke Hazel jetzt eine Nachricht auf Chinesisch! Sie kann es lesen!«
»May, das ist … Kannst du nicht einfach mit dem Deutschlernen weitermachen?«
Man kann sagen, dass sich May bei den Unterrichtsstunden im Ministerium genauso unmöglich benimmt wie an der Deepdean. Das Einzige, was sie wirklich gut findet, ist unsere Ausbildung in Kampftechniken. Auch mir gefallen diese Stunden, wenn ich ehrlich bin. Eric ist sich noch nicht im Klaren darüber.
Das Kampftraining findet nicht im Ministeriumsgebäude statt. Wir gehen dazu in den Keller und von da durch einen langen Gang bis ins Britische Museum. Das ist zurzeit meistens geschlossen, nur ein paar Leute wie Mr Goodchild arbeiten dort. Aber sie halten sich in entfernten Büroräumen auf und dürfen keinesfalls wissen, dass wir das Museum benutzen. Die Ausstellungssäle sind ziemlich leer geräumt, abgesehen von den großen ägyptischen Statuen, die zu schwer sind, um sie zu bewegen – man hat sie rundum mit Sandsäcken geschützt für den Fall von Bombenangriffen. Wir haben also große hallende Räume für unser Training zur Verfügung. Es ist unglaublich.
Eine Frau namens Bridget unterrichtet uns. Bridget ist ebenso unglaublich. Sie ist irischer Abstammung wie mein Dad, und sie ist unerschütterlich. Sie beherrscht Jiu-Jitsu, kann auf beunruhigende Weise mit einem Messer umgehen und zielsicher schießen. Eric weigert sich, auf irgendetwas zu schießen, er sagt, er wird eben ein pazifistischer Spion. Als Bridget wissen wollte, was er tun würde, wenn er Deutschen begegnete, die ihn töten wollen, erklärte er: »Verstecken. Und May mitnehmen.« Eine gute Strategie, finde ich.
Ich bin eine leidlich gute Schützin, aber beim Umgang mit Messern wird mir jedes Mal flau im Magen – ich muss dann instinktiv an dieses Messer im Mondlicht denken, an diese Nacht in Elysium Hall. Über May kann man jedoch nur staunen. Sie ist normalerweise ein solches Energiebündel, kann einfach nie still stehen, doch sobald sie ein Ziel anvisiert, wird sie völlig konzentriert und ruhig. Sie schießt nie daneben.
An den Nachmittagen haben wir dann noch Spezialunterricht in Sabotage, und zwar bei – ich werde sie die Köchin nennen. Sie ist dürr, schweigsam, und ihr Äußeres macht nicht viel her, aber so ist es eben mit den Menschen: Man kann nie vom Äußeren auf ihr Inneres schließen. Sie ist jedenfalls Österreicherin und weiß unheimlich viel über Gifte und Sprengstoffe. Gifte, erklärte sie uns, können in Textilien verborgen sein, in Sprühflaschen und Schreibstiften, es gibt Gifte, die man essen oder trinken kann, an denen man lecken oder riechen kann. Manche sind so tödlich, dass schon eine leichte Berührung genügt. Danach zeigte sie uns einen Riegel Schokolade und ein Plätzchen, die explodierten (das Gebäck der Köchin ist, soweit es nicht explodiert, sehr lecker). Zuletzt bekamen wir noch einen Teddybären zu sehen, der explodierte.
»Den fasse ich lieber nicht an«, sagte ich ängstlich.
»Oh, ich schon!«, rief May. »Er geht doch nur in die Luft, wenn man auf seinen Fuß drückt, Nuala, hast du nicht aufgepasst?«
Das hatte ich sehr wohl, aber trotzdem gefiel mir die Vorstellung nicht.
So sind unsere ersten Tage in London verflogen mit so viel Arbeit und Lernen, dass ich immer schnell einschlafe, wenn es möglich ist. (Bei einem Luftangriff wie jetzt ist es allerdings nicht möglich.) Doch ich habe ein komisches Gefühl. Die Ausbildung im Ministerium macht viel Spaß, ist aufregend und arbeitsintensiv, aber wenn ich daran denke, wie George seinen Stift umklammert hat, könnte ich mir vorstellen, dass manches nur noch Fassade ist. Eric, May und ich sind nur deshalb hier, weil Spione, die eigentlich da sein sollten, nicht da sind. Daisy ist nicht da. Alle rennen umher und versuchen, uns möglichst schnell möglichst viel beizubringen, weil es sonst zu spät sein könnte.
Und nicht nur das. Da ist immer dieses Gefühl, als würde gleich was passieren.
Aber ich habe keine Ahnung, was das sein könnte.
5
Donnerstag, 27. März
Ich hatte recht, liebes Tagebuch. Es ist etwas passiert – aber nicht im Ministerium. In unserer Straße. Etwas ganz und gar Unglaubliches. Nur dass ich es irgendwie eben doch glauben kann. Ich will es nur nicht.
Es geschah am Nachmittag, als der Unterricht im Ministerium zu Ende war und wir nach Hause gingen. Mrs Goodchild hatte uns zu Tee und Kuchen eingeladen, und in einem Krieg sagt man nicht nein zu Kuchen und ganz besonders nicht zu Mrs Goodchilds Victoria-Biskuitkuchen.
Eric kam ordentlich angezogen aus seiner Wohnung – lange Hosen, sauberes weißes Hemd. Auch ich hatte mich bemüht, etwas Hübsches auszusuchen, um Mrs Goodchild zu beeindrucken. Nicht dass meine Sachen besonders schön sind. Es ist nur das Zeug aus der Garderobe des Theaters, auch ein paar von Mams alten Kleidern sind dabei und manches, das wir in Coventry gekauft haben und mir noch nicht zu klein ist. Es wird zurzeit immer schwerer, allein mit Bezugsscheinen an neue Kleidung zu kommen, und die Sachen, die in Geschäften angeboten werden, passen irgendwie nicht zu mir. An diesem Nachmittag jedenfalls zog ich ein violettes, lose fallendes Kleid und Dads alte Weste an, und mein Haar flocht ich auf dem Rücken zu einem Zopf. May dagegen war in Shorts und Pullover. Seit wir in London sind, trägt sie immer öfter Shorts. Sie leiht sich welche von Eric, den Bund hält sie mit einer Schnur zusammen. Sie passen ihr hinten und vorn nicht, es ist zum Totlachen.
»Ich sehe so richtig undamenhaft aus!«, prahlte sie und drehte sich entzückt vor dem Spiegel in unserem Zimmer. Ich sagte nichts. Wahrscheinlich brauchen wir alle irgendeine Art von Verkleidung. Damals, in Elysium Hall, hätte ich mich über sie geärgert. Ich hätte gedacht, dass es ihr Spaß machte, mich auf die Palme zu bringen. Aber inzwischen weiß ich, dass May anders tickt. Sie bemüht sich nur um Dinge, die ihr wirklich sehr wichtig sind.
May war also in Shorts und hatte dreckige Knie – sie sah kein bisschen aus wie jemand, der sich für eine nette Teestunde zurechtgemacht hat. Aber Mrs Goodchild sah nicht mal hin, während sie uns große Stücke von ihrem cremigen Biskuitkuchen servierte. Mrs Goodchilds Kuchen sind wirklich fantastisch. Man käme gar nicht auf den Gedanken, dass Eier, Zucker und Butter zurzeit rationiert sind.
Wir sagten die üblichen Höflichkeiten über das Wetter, über Mr Goodchilds selbstgemalte Bilder, die an allen Wänden hingen, und über seine Arbeit im Museum – er hat im Moment richtig viel zu tun, irgendwas im Zusammenhang mit Kunst und dem Krieg. Zwischendurch kam Cecil, der Sohn der Goodchilds, hereingeschlurft, nickte uns flüchtig zu, nahm sich ein Stück Kuchen und ging wieder nach oben.
Cecil scheint ein paar Jahre älter zu sein als May, Eric und ich, einer dieser großen Jungen, in deren Nähe ich nie recht weiß, wie ich mich verhalten soll. Noch unsicherer macht mich, dass er so fein geschwungene Augenbrauen hat und ein Gesicht, das bei Bühnenbeleuchtung großartig aussehen müsste. Seine Kleidung ist immer ein bisschen abgerissen und schmuddelig, aber es sind gute Sachen. An seinem rechten Ohr klemmt ein Gerät, von dem sich ein Kabel bis in seine große Armeejacke schlängelt. Ich würde gern wissen, was das ist, aber fragen will ich nicht.
May dagegen legte unbekümmert los und wollte alles über das ausgebombte Haus am Ende der Straße wissen.
»Wann ist das passiert?«, fragte sie. »Haben Sie es gesehen? War es sehr schlimm? Waren es Brandbomben? Haben Sie schon mal Brandbomben gelöscht? Stimmt es, dass man die einfach mit seinem Mantel ersticken kann?«
»Im letzten November war das«, sagte Mrs Goodchild seufzend. »Zum Glück waren die Lowndes damals nicht hier. Sie hielten sich in ihrem Haus auf dem Land auf. Als es letztes Jahr mit den Bomben so schlimm wurde, haben viele Leute London verlassen, auch Mr Harris, der Anwalt aus Nummer sechs, und die meisten von denen aus den Wohnungen gegenüber. Aber Samuel und ich beschlossen hierzubleiben. Wir hatten wirklich Glück – wir haben Glück. Und Brandbomben löschen, also das darfst du nie versuchen, meine Liebe. Die werden neuerdings mit Sprengstoff gefüllt. Du könntest dich leicht verletzen.«
»Ihr Kuchen ist echt gut«, sagte Eric.
»Oh, es freut mich, dass er euch schmeckt«, sagte Mrs Goodchild mit einem verhaltenen Lächeln. »Unsere Tochter liebte diesen Kuchen – es ist nicht mehr das Gleiche, seit …«
An dieser Stelle fing der Hund nebenan wieder zu bellen an.
»Dieser Hund!«, sagte Mrs Goodchild. »Wer ist denn jetzt wieder draußen? Ach, es ist Primrose, sie kommt von der Arbeit. Das bedeutet, dass auch Samuel bald zu Hause sein wird.«
»Der arme General Charles de Gaulle!«, sagte Eric. »Alles regt ihn auf.«
»Was ist ihm denn in die Quere gekommen?«, fragte ich verwirrt. General Charles de Gaulle ist der Anführer der Bewegung Freies Frankreich. Daran beteiligen sich viele, die die Nazis hassen und empört sind, dass sie Frankreich überfallen und im letzten Sommer die Macht übernommen haben. De Gaulle sammelt jetzt seine Truppen in England und Afrika und arbeitet an Plänen, Frankreich zurückzuerobern und die grässliche Scheinregierung loszuwerden, die mit den Nazis gemeinsame Sache macht.
»Oh, er meint nicht den wirklichen General. Mit dem ist alles in Ordnung, soviel ich weiß«, sagte Mrs Goodchild. »Nein, der Hund heißt so. Colette von nebenan unterstützt die französische Freiheitsbewegung, und wahrscheinlich kam sie sich besonders patriotisch vor, als sie ihm den Namen General Charles de Gaulle gab. Er gerät jedes Mal außer sich, wenn jemand vorbeigeht. Jetzt, da die kleinen Kinder im Haus sind, bekommt er sicher nicht viel Aufmerksamkeit.«
»Er freut sich bestimmt, wenn ihn mal jemand besucht«, sagte Eric strahlend. »Ich fand, er sah gestern ziemlich einsam aus.«
Mrs Goodchild lachte. »Na, dann ab mit euch«, sagte sie. »Gegen einen Hund komme ich ja wohl kaum an. Aber nehmt euch noch ein Stück Kuchen, bevor ihr geht.«
Eric sprang auf, und May schob unter Gepolter ihren Stuhl zurück. Ich wickelte mein Kuchenstück in mein Taschentuch und folgte ihnen.
Es war ein strahlender Tag im zeitigen Frühjahr, helle Wolken trieben über uns dahin, die Luft roch nach Staub und Qualm, aber auch nach den Blumen in den Fensterkästen der Goodchilds. Nicht leicht, an einem Tag wie diesem an den Krieg zu denken. Alles scheint so normal, so hoffnungsvoll – und dann sieht man plötzlich etwas wie dieses zerbombte Haus.
Eric klopfte an die Haustür der Mortensens in Nummer drei, und kaum wurde sie geöffnet, flitzte der Hund zu Eric hin und leckte ihm übers Gesicht. Dieser »General« – vielleicht sollte ich ihn bei seinem Namen nennen, jetzt, wo ich ihn kenne – ist also ein großer schwarzer Pudel, und natürlich liebt er Eric. Ich