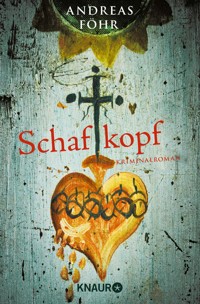Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wallner & Kreuthner Krimi
- Sprache: Deutsch
Der fünfte Band der Krimi-Reihe von Bestseller-Autor Andreas Föhr geht zurück zu den Anfängen des beliebten Ermittler-Duos Wallner & Kreuthner aus Bayern – und erzählt parallel ein packendes Kriegsdrama, als NS-Verbrecher noch am Tegernsee wüteten. Es ist ihr erster gemeinsamer Fall: Bei einer Feier auf einer Berghütte am Tegernsee im Herbst 1992 geraten der frischgebackene Kommissar Clemens Wallner und sein junger Kollege Leonhardt Kreuthner in ein Geiseldrama. Als der Geiselnehmer unter dramatischen Umständen zu Tode kommt, gibt er mit seinen letzten Worten Rätsel auf: In der Gruft von Sankt Veit in Dürnbach sollen die Gebeine einer vor vielen Jahren ermordeten Frau liegen. In einem edelsteinbesetzten Sarg. Doch warum musste sie in den letzten Tagen vor Kriegsende sterben, warum scheint sie in dem Ort am Tegernsee niemand zu kennen und warum wurde ein so aufwendiges Grab für sie geschaffen? Es beginnt eine spannende Ermittlungsarbeit, innerhalb derer das bayerische Duo ein ungesühntes Kriegsdrama vom Tegernsee aufspürt und so manch anderes Geheimnis ans Licht kommt: warum Wallner immer friert und Kreuthner alleine mit seinem Großvater zusammenwohnt. Ein ungewöhnlicher Krimi – äußerst wendungsreich und mit einem überraschenden Ende. Und mit Blick auf das Kriegsdrama nicht zuletzt ein Stück Regionalgeschichte vom Tegernsee. Die Romane um die Truppe aus dem Tegernsee-Tal sind alle auch für sich verständlich, gut lesbar und immer wieder enorm spannend. Krimi-couch.de [...] Der beste Band der Reihe. Ein spannender Fall mit komplexem Hintergrund, kombiniert mit fantastischen Figuren und trockenem Humor, die perfekte Krimilektüre! leser-welt.de Wer die Gegend um den Tegernsee etwas oder auch sehr gut kennt, wird viele Orte der Handlung wiedererkennen. Auf-den-berg.de Die Wallner & Kreuthner-Krimis: Band 1: Prinzessinnenmörder Band 2: Schafkopf Band 3: Karwoche Band 4: Schwarze Piste Band 5: Totensonntag Band 6: Wolfsschlucht Band 7: Schwarzwasser Band 8: Tote Hand
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Andreas Föhr
Totensonntag
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
TOTENSONNTAGerzählt Kommissar Wallners allerersten Fall: Im Herbst 1992 ist Clemens Wallner frischgebackener Kriminalkommissar. Bei einem Besäufnis auf einer Berghütte am Tegernsee, zu dem Kreuthner ihn mitgenommen hatte, geraten Wallner und Kreuthner in eine Geiselnahme. Vom Geiselnehmer erfährt Wallner von einer dramatischen Geschichte, die sich in den letzten Tagen des zweiten Weltkriegs ereignet hat und die Kreuthner alias »Leichen-Leo« den Hinweis zur Entdeckung seiner ersten Toten liefert. Es handelt sich um ein Skelett in einem edelsteinbesetzten Sarg mit einer Kugel im Schädel …
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
Danksagung
Für Leon und Mali
1
1. Mai 1945
Keiner hatte etwas Ähnliches je gehört. Sie saßen in der Stube beim Schein einer Glühbirne und lauschten dem Rumpeln, das von draußen hereindrang. Der Russe, der seit kurzem mit am Tisch sitzen durfte, hatte es zuerst gehört, hatte gemeint, es habe Ähnlichkeit mit dem Geräusch herannahender Panzer. Aber das konnte nicht sein. Die Amerikaner waren noch hinter Tölz. So schnell ging das nicht. Das Geräusch wurde lauter, kam näher. Schließlich stand der Bauer auf, verfolgt von ängstlichen Blicken, ging vor die Tür und schaltete die Leuchte über der Tür an. Nichts war zu sehen. Nur Schneegestöber. Es schneite so gottserbärmlich, wie es noch nie geschneit hatte an einem ersten Mai. Das Rumpeln wurde lauter, dann wieder leiser, je nachdem, wie sich der Wind drehte. Kam er aus Westen, hörte man es ganz deutlich. War das der Untergang, den sie alle erwarteten?
Eine Gestalt im Feldmantel kam hinter der Scheune hervor und ging auf das Haupthaus zu. Es war ein SS-Mann. Den Dienstgrad konnte der Bauer nicht erkennen. Auf den Schulterstücken und Kragenspiegeln hatte sich Schnee angesammelt und machte eine genauere Identifizierung schwer. Der Mann kam wortlos näher und stellte sich vor den Hofbesitzer. Die Männer waren etwa gleich groß. Dennoch kam sich der Bauer sehr viel kleiner vor. Und das lag nicht nur an den Stiefelabsätzen des anderen. Der SS-Hauptscharführer (jetzt, aus der Nähe, konnte der Bauer sehen, dass die Schulterstücke goldumrandet waren) deutete auf den Heustadel. »Den brauchen wir«, sagte er. »Und Essen.«
Der Bauer nickte dienstfertig. »Für wie viele?«
»Achtzig.« Der Bauer wurde bleich. »So viel essen die nicht«, sagte der SS-Mann leise.
Die ganze Familie stand in der Tür. Nur der Russe hielt sich im Hintergrund, er ging uniformierten Deutschen aus dem Weg. Hinter der Scheune war ein weiterer SS-Mann aufgetaucht. Er schwenkte eine Taschenlampe und rief einen Befehl in die Nacht. Das Rumpeln, das kurzzeitig ausgesetzt hatte, begann von neuem. Dann kamen die Ersten um die Scheune. Die meisten waren bis auf die Knochen abgemagert und steckten in gestreiften Häftlingsanzügen. Die Augen lagen tief in den Höhlen. Ob es Männer oder Frauen waren, konnte man in diesem Zustand schwer erkennen. An den Füßen hatten sie Holzpantinen.
Schnee wehte Frieda ins Gesicht, während sie versuchte, sich aufrecht zu halten. Sie standen vor der Scheune. Abendappell. Der Wind biss durch die dünne Jacke, schlimmer noch als beim Marschieren. Wenn man sich bewegte, war es nicht ganz so kalt.
Viel war der SS nicht geblieben. Ihre Gewehre und ihre scharfen Hunde. Und der Appell. Der Westwind trieb hin und wieder den Donner eines amerikanischen Geschützes von weit herüber. Dann schoss ihr Hoffnung ins Herz, die paar Tage zu überleben, bis sie da waren. Es konnte nicht sein, dass sie nach sechs Jahren jetzt schlappmachte. Zwanzig Kilometer vor den Amerikanern, fünf Kilometer bis nach Hause.
Hauptscharführer Kieling betrachtete die achtzig Gestalten, die er aus Gründen, die nicht einmal er selbst kannte, immer noch bewachte und durch das bayerische Voralpenland trieb. Sie stammten aus Nebenlagern des KZ Dachau. Kieling hatte keine Eile. Er war keiner von den Lauten. Keiner, der die Häftlinge zusammenbrüllte und vor versammelter Mannschaft verprügelte oder erschoss. Er sagte wenig. Und was er sagte, war leise. Er sagte »mitkommen« so, dass man es kaum verstehen konnte. Und dann ging er mit einem Häftling hinters Haus oder irgendwohin, wo man ihn nicht sehen konnte. Ein Schuss – und Kieling kam zurück. Allein.
Frieda wusste nicht, ob Kieling sie erkannt hatte. Selbst wenn, hätte er vermutlich nichts gesagt. Sie waren sich sechs Jahre nicht begegnet, und so, wie sie aussah, hätte ihre Mutter sie nicht erkannt. Vor vier Tagen war er plötzlich aufgetaucht, beim Abmarsch aus Allach. Sie waren einige Tausend gewesen und Hunderte von Bewachern. Er war immer in ihrer Nähe geblieben. Das mochte Zufall sein oder weil er für ihren Abschnitt zuständig war. Als sie die russischen Häftlinge zurückgelassen hatten, war er immer noch dageblieben. Und als die anderen beschlossen, vor Waakirchen im Wald zu übernachten, hatte er sich mit seinem Vorgesetzten gestritten und war mit achtzig Frauen weitermarschiert. Sie sollten nach Tirol, hatte einer gesagt. Wozu? Keiner wusste es. Es war auch nicht klar, ob die SS es wusste. Niemand schien in diesen Tagen irgendetwas zu wissen. Das hielt aber niemanden davon ab zu töten. Das war zur Routine geworden und ging wie von selbst immer weiter.
Schneeflocken fielen Frieda in den Kragen und schmolzen. Es war unangenehm, aber nicht zu vermeiden. Denn sie hielt den Kopf gesenkt wie alle. Hoffte wie alle, dass Kieling zu niemandem »mitkommen« sagen würde. Und wenn doch, dass er es zu einer anderen sagte.
Es war still. Nur der Schnee knirschte, als die schwarzen Stiefel kamen. Spät sah Frieda sie, denn sie hatte den Blick auf den Boden geheftet. Einen guten Meter vor ihr blieben sie stehen. Und dann geschah nichts. Die Stiefel waren einfach da, standen im Schnee und warfen Schatten in die Nacht. Frieda spürte, dass er sie ansah. Kieling nahm sich Zeit. Das tat er immer, als denke er sorgfältig über den nächsten Schritt nach. Das konnte eine Exekution sein, oder er verhängte eine mildere Strafe über einen Häftling. Oder es geschah gar nichts und Kieling ging wieder. Er war wie alle SS-Leute unberechenbar. Das gehörte zum System.
Zeit verging, Schneeflocken sanken zu Boden. Niemand rührte sich. Auch Kieling nicht. Es war, als würde er diese stillen Momente genießen. Mit einem Mal tippte die Spitze seiner Reitgerte auf Friedas Schulter. Jetzt musste sie ihn ansehen. Oberscharführer Lohmeier trat neben Kieling und leuchtete mit seiner Taschenlampe in Friedas Gesicht. Sie selbst konnte Kielings Gesicht im Halbschatten nur erahnen, denn die Lampe blendete sie. Die zwei hellen Flecken hinter dem Lichtstrahl mussten seine Augen sein. Es kam ihr vor, als blinzelten sie nicht. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Das würde Kieling nicht entgehen, und vielleicht war es gerade dieser Anblick, der ihn so lange hinsehen ließ. So schnell, wie er gekommen war, schwenkte der Lichtkegel wieder von Frieda weg. Die Spitze der Reitgerte kam erneut auf sie zu, bewegte sich über ihre eingefallene Brust bis hinauf unter das Kinn. Sie spürte einen leichten Druck, die Gerte bog sich nach oben durch. Da war keine Gewalt dabei. Die Berührung hatte den Charakter eines sachten Hinweises. Nachdem sie beide eine Weile in dieser Stellung verharrt waren, drehte sich Kieling weg und murmelte: »Das machen wir morgen.«
Eine Stunde ließ er sie in der kalten Mainacht warten, stand vor ihnen, zupfte an der Spitze seiner Reitgerte und schien nachzudenken. Immer wieder spürte Frieda seinen Blick. Er dachte über sie nach. Wenn er sie erkannte, daran hatte Frieda nicht den geringsten Zweifel, würde er sie erschießen. Am nächsten Tag, so hoffte sie, würden die Amerikaner hier sein.
2
47 Jahre später, Herbst 1992
Der Föhn blies an diesem Novemberabend, der warm war und hell, denn der Vollmond schien durch die dünne, immer wieder aufreißende Wolkendecke auf den See. Polizeiobermeister Georg Stangel und sein junger Kollege Leonhardt Kreuthner stellten ihr Dienstfahrzeug auf dem Parkplatz vor der Polizeiinspektion Bad Wiessee ab und gingen in das Bürogebäude, um den Wagen an die Kollegen der nächsten Schicht zu übergeben. Sie hatten Feierabend, und Kreuthner war aufgekratzt. An diesem Abend hatte er etwas Besonderes vor, etwas, das es nur alle paar Jahre gab. Wenn überhaupt.
»Und – gehst noch rauf auf’n Berg?«, fragte Stangel den jungen Kollegen, als sie sich umzogen.
»Logisch«, sagte Kreuthner und lächelte mit einem nachgerade verklärten Gesichtsausdruck. Von draußen hörte man Lärm. Irgendetwas war los in den um diese Zeit sonst ruhigen Diensträumen. Ein Mann schrie. Der Schrei klang erbost und nach Schmerzen. »Wen ham s’ denn da erwischt?«
Stangel zuckte mit den Schultern. Auch Kreuthner war nicht wirklich interessiert. Vielleicht wäre er es an einem normalen Abend gewesen. Heute hatte er es eilig, wegzukommen. Als Kreuthner gerade seine Uniformhose ausziehen wollte, betrat der Dienststellenleiter die Umkleide. »Kannst gleich anlassen«, sagte er zu Kreuthner. Der blickte seinen Chef verständnislos an. »Du machst heute Nachtschicht.«
»Ich mach was?«
»Geht net anders. Der Sennleitner ist krank.«
»Aber ich … ich kann heut net. Auf gar keinen Fall. Ich … ich hab an wichtigen Termin.«
»Du bist der Jüngste und ohne Familie. Die trifft’s halt immer. Sorry.«
»Jetzt wart halt mal!« Kreuthner machte den Reißverschluss seiner Hose zu und ging dem Dienststellenleiter nach, der wieder auf dem Weg ins Büro war. »Wieso muss denn heute jemand in der Station sein?«
»Wir haben sonst nicht genug Leute hier. Und er ist ja auch noch da.« Kreuthners Vorgesetzter deutete auf einen etwa sechzigjährigen hochgewachsenen, hageren Mann mit Parka und Jeans, der auf einem Stuhl an der Wand saß. Er trug eine aus der Mode geratene Brille mit dicken Gläsern, einer seiner Knöchel war bandagiert, eine Krücke lehnte neben ihm an der Wand. »Ist in Gmund in den Kiosk eingebrochen.«
»Wieder Zigaretten und Schnaps?«
»Und zwanzig Packungen Erdnüsse. Auf der Flucht hat er sich den Knöchel verstaucht.«
»He Dammerl, du Lusche!«, rief Kreuthner dem Mann zu. »Hast es immer noch net raus, wie’s geht?«
»Du-du-du«, der Mann stotterte vor Erregung. »Du kannst mir mal an Sch-sch-schuah aufblasen!«
Thomas »Dammerl« Nissl war ein der Polizei leidlich bekannter Mann. Er hatte nur unregelmäßig Arbeit und keinen festen Wohnsitz. Die wärmere Zeit des Jahres verbrachte er draußen, oder er stieg in Bootshäuser ein. Im Herbst und Winter residierte er in aufgebrochenen Almhütten oder, wenn er es hineinschaffte, auch gern in einem der großen Landhäuser um den Tegernsee, von denen einige monatelang leer standen. Man musste Nissl zugutehalten, dass er seine Häuser – wenn man von den aufgebrochenen Schlössern absah – stets in tadellosem Zustand hinterließ und gelegentlich sogar kleinere Reparaturen ausführte. Trotzdem war es illegal und für die Polizei nicht immer leicht, darüber hinwegzusehen. Aber sie tat es. Anders war es mit den Einbruchdiebstählen. Der Schaden war jedes Mal gering. Aber Nissl hörte nicht auf damit und war bereits fünf Mal zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Jetzt würde er ins Gefängnis gehen. Das jedenfalls hatte ihm die Richterin bei der letzten Urteilsverkündung angedroht. Und deswegen hatten sie bei der Polizei die Anweisung, Nissl beim nächsten Diebstahl festzusetzen. Der Mann hatte auch keine Familie. Es bestand daher nach den allgemeinen Kriterien Fluchtgefahr. Hier im Tal wusste jeder, dass Nissl nicht fliehen würde. Wohin denn? Aber Anweisung war Anweisung.
»Der Nissl bleibt über Nacht in der Arrestzelle«, sagte der Dienststellenleiter.
»Die Zelle kann man doch abschließen. Wozu muss denn einer hierbleiben?«
»Weil der Bursche gegrillt wird, wenn sonst keiner da ist und’s Haus abbrennt. Herrschaftszeiten, du kennst die Vorschriften. Was hast denn so Wichtiges vor?«
In Kreuthners Gesicht stand die blanke Verzweiflung. »Heut ist das Austrinken vom Hirschberghaus«, sagte er mit belegter Stimme und sah seinen Chef an, als müsste der nach dieser Offenbarung erschrocken Abbitte tun für das absurde Ansinnen, Kreuthner hierzubehalten. Der Mann aber schien die Tragweite von Kreuthners Worten überhaupt nicht zu erfassen.
»Was ist das denn?«, fragte er.
»Die machen diesen Winter ausnahmsweise zu. Zum Renovieren. Und damit sie nicht die ganzen Getränke nach unten schaffen müssen, ist heute großes Austrinken. Da zahlt jeder zehn Mark …«
»… und besäuft sich, bis er umfällt? Sei froh, dass dir das erspart bleibt.« Er klopfte Kreuthner väterlich auf die Schulter. »Nicht dass es wieder endet wie bei deinem letzten Rausch.«
»Ich bitte dich!«, winselte Kreuthner. »So eine Gelegenheit kommt vielleicht in zwanzig Jahren wieder. Das kannst mir net antun! Das geht net!«
Doch. Das ging.
Kreuthner saß misslaunig auf einem Bürosessel und sah Nissl dabei zu, wie der die siebte Tasse Kaffee trank. Kaffee bekam er nicht so oft. Die Tür zur Arrestzelle stand offen. Nissl hatte darum gebeten, und mit dem gestauchten Knöchel konnte er sowieso nicht weglaufen. Kreuthner dachte an Sennleitner, den er noch aus der Schule kannte. Und dass auch der das Pech hatte, nicht beim Austrinken dabei zu sein, weil er ausgerechnet heute krank war. Andererseits – wenn er nicht erkrankt wäre, hätte er Dienst schieben müssen. Kreuthner stutzte. Richtig – dann hätte er Dienst gehabt … Ein finsterer Gedanke bohrte sich in Kreuthners Kopf. Nein, das konnte nicht sein. Oder doch? Zu wie viel Schlechtigkeit war ein Mensch fähig? Kreuthner wollte es wissen und griff zum Telefon.
3
Es ging bereits hoch her auf dem Hirschberghaus, obwohl es erst sechs Uhr war und man für das Austrinken der Getränkevorräte die ganze Nacht angesetzt hatte. Der junge Kriminalkommissar Wallner, erst seit wenigen Monaten bei der Kripo Miesbach, saß mit einer jungen Frau namens Claudia Lukas an einem Tisch mit den Burschen von der Bergwacht. Und zwar deshalb, weil Günther Simoni mit Wallner auf die Schule gegangen war und hier bei seinen Bergwachtkameraden gesessen hatte, als sie hereingekommen waren, und ein »He Clemens, oide Fischhaut! Hock di hera!« gegrölt hatte. Da war Günthers Stimme schon recht ramponiert gewesen, und die Backen hatten ihm geglüht. Jetzt, eine Stunde später, brachte er keinen Ton mehr heraus und konzentrierte sich auf das, weswegen sie hergekommen waren: Alkohol trinken. Einer hatte eine Gitarre dabei, und es wurden alte Fahrtenlieder gesungen, in denen man im Mehltau zu Berge zog (wer Frühtau sang, musste einen Obstler trinken) oder Wildgänse durch die Nacht rauschten. Das Witzerepertoire war gediegen und überschaubar. So wurde etwa die Erweiterung des bekannten Gedichts vom Emir und dem Scheich um die Zeilen »Da sprach der Abdul Hamid, ’s Tischtuch nehma a mit« mehrfach bemüht, was dem Erfolg der Darbietung aber keinen Abbruch tat. Ein blonder, äußerlich an Rudi Völler erinnernder Kamerad mit Schnauzer lachte sich gerade das dritte Mal unter den Tisch. Dann stießen wieder alle miteinander an, und Claudia rief am lautesten Prost und dass sie die Bergwachtjungs super fände, was allgemein goutiert wurde und Claudia die vielfach geäußerte Versicherung eintrug, ein super Hase zu sein, und dann wurde Claudias Heimat zu Ehren (eigentlich kam sie aus Bad Homburg, doch das war bei dem Lärm falsch verstanden worden) das Lied vom Hamborger Veermaster angestimmt, und bei to my hoo day, hoo day mussten alle zwei Mal aufstehen und ihre Bierkrüge aneinanderstoßen.
Nachdem Wallner das dritte Mal mit Bier bespritzt wurde, weil er sitzen geblieben war, verließ er den Tisch und sah sich das närrische Treiben vom Tresen aus an. Er war dreiundzwanzig Jahre alt, groß, schlank, trug Brille und kurzes, dunkles Haar und hatte eine Daunenjacke an, die er als Zugeständnis an die schwüle Hitze im Raum offen trug. Wallner war fast immer kalt. Er trug seine Daunenjacke von September bis in den Mai hinein, dazu dicke Wollschals, damit es nicht von oben hineinzog in die Daunen.
Wallner ließ die Wirtshausszenerie auf sich wirken. Um nichts auf der Welt hätte er aus eigenem Antrieb dieses Irrenhaus aufgesucht. Der Grund, warum er es dennoch getan hatte, war Claudia, die Tochter von Erich Lukas, dem Leiter der Kriminalpolizei Miesbach. Claudia war dreiunddreißig und Staatsanwältin am Landgericht München II und in dieser Eigenschaft seit neuestem auch für den Landkreis Miesbach zuständig. Erich Lukas hatte Wallner gebeten, Claudia durchs Haus zu führen. Dabei waren sie Kreuthner begegnet, dem Claudia gefiel. Und der hatte gesagt, sie müssten heute unbedingt aufs Hirschberghaus kommen. Dort finde die Party des Jahres statt. Das dürfe Claudia unmöglich versäumen. Claudia versäumte – im Gegensatz zu Wallner – ungern Partys. Vor allem keine Party-des-Jahres-Partys. Der exotische Reiz der Veranstaltung lag auch darin, dass man eineinhalb Stunden zu Fuß gehen musste, um an den Ort der Festlichkeit zu gelangen. Wallner fühlte sich irgendwie verpflichtet, sich um Claudia zu kümmern, und versprach mitzukommen.
Auf dem Hirschberghaus fanden sie über fünfzig trinkfeste, zumeist, aber nicht ausschließlich männliche Gäste vor, viele davon Mitglieder der Bergwacht oder des Alpenvereins. Das »Austrinken« war nicht offiziell annonciert worden, eher ein Tipp für Eingeweihte.
Neben Wallner klingelte ein Telefon. Das Hirschberghaus verfügte über einen Festnetzanschluss. Der Wirt spülte gerade Gläser und bat Wallner, den Anruf anzunehmen. »Hirschberghaus, wir haben heute eigentlich geschlossen«, meldete sich Wallner.
»Clemens? Bist du des?«, sagte Kreuthners Stimme aus dem Hörer.
»Wo steckst du denn? Wir warten auf dich!«
»Is a längere G’schicht. Is der Sennleitner zufällig da?«
Wallner blickte sich im Raum um. Es gab noch fünf weitere Tische neben dem, an dem Claudia saß. Die anderen Tische hatten in den Shanty eingestimmt und sich den Brauch zu eigen gemacht, bei to my hoo day aufzustehen und anzustoßen. Sennleitner, wie er allgemein und unvermeidlich ohne Vornamen genannt wurde, stand mit puterrotem Kopf und Maßkrug auf einer Bank und grölte weit neben der Melodie, aber lautstark den Refrain. »Ja, der steht auf der Bank und singt Shantys.«
»Die Sau!«
»Was ist los? Und wieso bist du noch nicht da?«
»Der Sennleitner ist echt bei euch auf der Hütte?« Kreuthners Stimme bebte vor Zorn.
»Ja. Kommst jetzt endlich?«
»Bin unterwegs.«
4
Kreuthner schwenkte den Schlüssel zur Arrestzelle. »Auf geht’s, Dammerl. Zeit zum Schlafen.«
»Hast net noch a Bier? Ich schlaf schlecht ohne.«
»Hier ist die Polizei. Hier gibt’s kein Bier. Verzupf dich in die Zelle.«
»Du willst aber net absperren, oder?«
»Quatsch keine Opern und geh rein.«
Zögernd und den Blick besorgt auf den Schlüssel gerichtet, schlurfte Nissl in die Arrestzelle. Kreuthner sagte »Gute Nacht«, steckte den Schlüssel ins Schloss und sperrte ab. Im gleichen Moment kam Nissl an das kleine Sichtfenster in der Tür und schrie Kreuthner mit schreckgeweiteten Augen an. »Du verdammtes Arschloch!«, kam es gedämpft durch die Tür. »Du hast gesagt, du sperrst net ab. Mach die Tür auf!«
»Ich hab gar nichts gesagt. Leg dich hin und gib a Ruah! Ich muss mal kurz weg.«
»Nein!!!« Nissl schlug mit den Fäusten gegen die Stahltür. »Du kannst mich net allein lassen. Kreuthner!!! Bleib da, verflucht!«
Kreuthner beschloss, den Wahnsinnigen zu ignorieren, und machte sich auf den Weg nach draußen. Da hörte er, wie etwas gegen die Zellentür krachte. Es war der Stuhl der Zelleneinrichtung. Als Kreuthner durch das Sichtfenster sehen wollte, verdunkelte es sich. Es polterte gewaltig. Dieses Mal war es der Tisch. »He! Spinn dich aus!«, schrie Kreuthner durch die Tür. »Sonst kriegst Handschellen.«
»Versuch’s doch! Ich … ich häng dich hin. Ich sag’s deinem Chef, dass du weg warst. Die feuern dich.« Nissl schleuderte die Reste des Zellenstuhls gegen die Tür. »Mach endlich auf!«
Kreuthner sah ein, dass er es so nicht angehen konnte. Wenn Nissl ihn verriet, gab es Ärger. Viel Ärger. Denn Kreuthner hatte in den letzten vier Jahren bereits einiges an Missetaten auf seinem Konto angesammelt. Er schloss die Zelle auf. Schwitzend und mit zitternden Knien stand Nissl in der Tür. »Geh Dammerl, was regst dich denn so auf? Ich muss a paar Stund weg. Was ist denn dabei?«
Nissl hatte noch ein Stuhlbein in der Hand und den Mund offen, in seinem Gesicht lag ein Ausdruck, als habe er dem Tod ins Auge gesehen. Er schlotterte am ganzen Körper.
»Ich hol dir zwei Bier, okay?«
»Du kannst mich net einsperren und weggehen. Das geht net.«
»Wieso? Wennst a Bier hast?«
»Ich halt das net aus«, sagte Nissl, wischte sich den Schweiß von der Stirn und sah Kreuthner an, als habe er ihm gerade das wichtigste Geheimnis seines Lebens verraten.
Na ja, dachte Kreuthner. Wenn du all die Jahre im Freien lebst, vielleicht wirst du dann so. Aber es gab ihm doch ein Rätsel auf, weshalb Nissl so ausgerastet war. Gleichzeitig war klar, dass er den Mann hier nicht einfach einsperren und weggehen konnte.
»Hast Lust auf an Ausflug? Gibt auch was zu trinken.«
Ein Schatten bewegte sich in dieser föhnigen Novembernacht durch den Bergwald, den gemächlich ansteigenden Forstweg hinauf, der bis zur Talstation der Materialseilbahn führte. Den Vögeln in den Baumkronen mag ein silbern-metallisches Blitzen aufgefallen sein, das ab und an von dem Schatten ausging. Genauer besehen waren das die Speichen eines Rollstuhls, die das Mondlicht reflektierten, manchmal auch der Aluminiumschaft einer Krücke.
Kreuthner schwitzte und fluchte atemlos, schob aber unverdrossen den Rollstuhl den Forstweg hinauf. Zwei Stunden würden sie brauchen, bis sie an der Seilbahn waren. Als glückliche Fügung für Kreuthners Vorhaben erwies sich immerhin, dass bis dort oben kein Schnee lag, was für die Jahreszeit nicht selbstverständlich war.
Da Nissl einem guten Trunk nicht abgeneigt war, hatte es keiner großen Überredung seitens Kreuthner bedurft. Hinderlich war allenfalls Nissls schlechter Zustand, namentlich sein verstauchter Knöchel. Zum Glück fiel Kreuthner der Rollstuhl ein, der seit Jahren im Sanitätsraum der Polizeiinspektion verstaubte. Lediglich beim Bierholen für Betriebsfeiern war er bislang zum Einsatz gekommen.
»Au! Pass a bissl auf die Steine auf«, beschwerte sich Nissl. »Das gibt jedes Mal an Stich im Knöchel.«
»Es ist dunkel, du Hirn. Ich seh keine Steine.« Kreuthner hielt kurz an und verschnaufte. Ein bisschen packte ihn die Angst, dass die da oben schon alles ausgetrunken hätten, wenn sie ankamen. Adrenalin schoss bei diesem Gedanken in seine Adern, und weiter ging es. Jede Minute zählte.
Das letzte Stück zum Hirschberghaus war ein enger und steiler Bergpfad und für Rollstühle vollkommen ungeeignet. Hier, am Ende der Forststraße, befand sich die Talstation einer kleinen Materialseilbahn, deren Benutzung, wie der Name nahelegte, für den Personentransport strengstens verboten war. Kreuthner hievte Nissl in den Transportbehälter und warf ihm die Krücke hinterher. Dann setzte er sich selbst dazu. Es war ziemlich eng, aber es ging. Den Schlüssel zur Seilbahn hatte Kreuthner vor zwei Jahren bekommen, als er bei der Vorbereitung des jährlichen Berggottesdienstes auf dem Hirschberg mithalf. Da mussten Tausende Gläubige verköstigt werden. Vor der Rückgabe hatte er sich einen Nachschlüssel machen lassen, in der Vorahnung, der könne ihm mal gute Dienste leisten.
Still schwebten sie durch die Nacht, über sich den Sternenhimmel, unten die Lichter um den Tegernsee. Ein warmer Wind kam von Süden, und die Gondel schwankte sanft über dem Abgrund. Kurz bevor das Hirschberghaus hinter der Bergkuppe auftauchte, hörten sie es: diffuse Stimmen, gedämpft, singend, eine Gitarre dazwischen, dann eine vielstimmige Melodie. Aus der Ferne klang das viel sauberer und schöner, als wenn man jetzt da oben in der Gaststube mittendrin säße, musste Kreuthner denken.
»Die Luft filtert alles Hässliche raus«, sagte Nissl, als habe er Kreuthners Gedanken gelesen.
»Ja«, sagte Kreuthner. »Aber ich hab mich immer gefragt, wieso.«
»Weil die Luft rein ist. Deswegen bleibt der Schmutz drin hängen.« Nissl nickte, zufrieden, dass er Kreuthner was hatte erklären können, und deutete mit der Krücke nach oben. »Die Luft ist so rein, dass du die Sterne siehst. Die sind Milliarden Lichtjahre weg. Aber du siehst sie trotzdem. So sauber ist die Luft.«
»Nicht in München.«
»Das stimmt. Wegen dem vielen Lärm.«
Dem war nichts hinzuzufügen. Den Rest der Fahrt ließen sie sich die laue Brise um die Ohren wehen und hingen ihren eigenen Gedanken nach.
5
Der Feuerschein flackerte über das lange Gesicht. Nissl nahm einen Schluck Bier und spürte dem Geschmack nach, als sei es feiner Bordeaux, sein enormes Kinn kreiste, der Mund öffnete sich ein wenig und entließ ein dezentes Schmatzen. Ein Holzfeuer brannte in einer Zinnwanne. Darum herum Nissl, Wallner und Claudia. Sie saßen auf der Terrasse des Hirschberghauses und lauschten dem Lärm aus der Gaststube. Man hörte einen Teil der Gäste singen, den anderen lautstark diskutieren. Zwischendurch immer wieder Kreuthners Stimme, alkoholselig und phasenweise euphorisch. Bei der Ankunft hatte er seinen Kollegen Sennleitner zusammengeschissen, weil der ihm fast den Abend vermasselt hätte. Der war reumütig und schwor, er habe nicht geahnt, dass es ausgerechnet Kreuthner treffen würde, ihn zu ersetzen. Aber was hätte er machen sollen? Der Dienststellenleiter wollte ihm an dem Abend nicht freigeben.
Kreuthner musste zugeben, dass er es, wenn man’s genau besah und ehrlich war, nicht anders gehalten hätte. Natürlich nicht. Wie auch? Was soll man machen, wenn einem das Schicksal so hinterkünftig mitspielte. Jetzt war alles im Lot, und Kreuthner und Sennleitner leerten zusammen Bierkrug um Bierkrug, und manchmal sangen sie die Bergkameraden mit und mehrfach das Lied, in dem jemand seine Alte in einer Gletscherspalte findet und sich beides wunderbar reimt, und bei sie hielt den Pickel in der Hand schwenkte Sennleitner jedes Mal den alten Eispickel, der seinen Platz eigentlich an der Wand der Gaststube hatte, und es war abzusehen, dass irgendwann jemand dadurch zu Schaden kommen würde, wenn Sennleitner nicht aufhörte zu trinken, womit keinesfalls zu rechnen war.
»Wie lange hast du schon keine Wohnung mehr?«, fragte Claudia und betrachtete den sanften Riesen mit dem großen Kinn. Ein Geheimnis umgab ihn. Vielleicht viele Geheimnisse. Nie hatte Claudia einen Menschen wie Nissl getroffen, einen der vollkommen frei war von irdischem Besitz und anscheinend auch von Begierden, wenn man vom Alkohol absah. Er hatte auf das Du bestanden, weil jeder ihn duzte. Es war Claudia schwergefallen. Denn Nissl war dreißig Jahre älter und trotz seines heruntergekommenen Äußeren eine Erscheinung, die den Menschen Ehrfurcht einflößte.
»Seit zweiundsiebzig. Da haben sie mir mein letztes Haus gepfändet.«
»Du hast Häuser gehabt?«
»Ja freilich. In Miesbach haben mir viele Häuser gehört.«
Claudia staunte und blickte zu Wallner. Dessen Miene gab ihr zu verstehen, dass sie nicht alles für bare Münze nehmen sollte, was Nissl erzählte. »Was ist mit den Häusern passiert?«
»Die hab ich alle verloren. Eins nach dem anderen. Aber ich hab a gute Zeit gehabt. Mir ham vielleicht gefeiert damals. Sex and Drugs and Rock ’n’ Roll, verstehst? Solche Joints ham mir gebaut.« Er hielt die Hände Schulterbreit auseinander, und seine Augen leuchteten, dass man es ihm fast glauben mochte. Wallner lächelte, als Claudia ihn ansah.
»Und was machst du so?«, wollte Nissl von Claudia wissen.
Die bot ihm eine Zigarette an, die er gerne nahm, und gab ihm und sich selbst Feuer. »Ich bin Staatsanwältin«, sagte sie und blies den Zigarettenrauch ins Feuer.
»Ah geh!« Nissl hauchte den Rauch mit spitzem Mund in die föhnige Nachtluft, als genieße er eine exquisite Havanna. »Machst du auch Mord?«
»Bis jetzt hatte ich erst einen. Aber – ja, mach ich.«
»Magst noch an zweiten Mord haben?«
»Wieso? Willst du heute Abend Ärger machen?«
Nissl dachte ein paar Sekunden über Claudias Bemerkung nach, dann prustete er los wie ein kleines Mädchen. »Haha, der war gut.« Nissl kriegte sich kaum ein und musste schließlich husten und sich die Lachtränen aus den Augen wischen. »Ob ich Ärger machen will! Haha. Nein, nein. Ich hab was anderes gemeint.«
»Was denn?«
»Kennt’s ihr die Leiche in dem Glassarg?«
»Schneewittchen?«
»Nein, die andere. Die in Dürnbach.«
»Ich kenn sie nicht. Hast du davon gehört?« Sie sah Wallner an. Der zuckte nur mit den Schultern.
»Die wo in Dürnbach liegt, die hat natürlich nichts mit Schneewittchen zu tun. Die gibt’s ja nur im Märchen. Aber der Sarg schaut so aus. Gläsern eben, aus lauter Edelsteinen.«
»Wo soll das denn sein? Die haben doch gar keinen Friedhof in Dürnbach?«
»Doch. Den Soldatenfriedhof von die Amerikaner. Aber das Grab ist auch net am Friedhof.«
»Sondern?«
»Unter einer Kirch. Ich hab da mal übernachtet. Und da bin ich zufällig draufgestoßen.«
»In dem Edelsteinsarg war tatsächlich eine Leiche?« Claudia zog den Kragen ihrer Jacke über die Ohren und fröstelte.
»Aber ja. Die war mausetot.«
»Na ja«, sagte Wallner. »Unter Kirchen sind ja öfter Gräber.«
»Aber das war geheim. Das hat keiner gekannt. Ich hab herumgefragt. Da hat keiner was gewusst davon. Auch der Gmunder Pfarrer nicht. Und der hätt’s wissen müssen, weil die Kirche zu ihm dazugehört.«
»Hast du das Grab der Polizei gemeldet?«
»Polizei? Nein. Bestimmt net.«
»Warum nicht?«
»Ich hab’s net so mit der Polizei.« Nissl warf seine Kippe ins Feuer. »Nix gegen euch beide. Gott bewahre. Aber so allgemein. Mir halten a bissl Abstand – die Polizei und ich.«
»Du weißt also nur, dass da irgendwo unter einer Kirche eine Leiche liegt. Aber du weißt nicht, wer das ist?«
»Doch. Frieda hat sie geheißen. Und noch irgendwie. Aber das hab ich vergessen. Wenn’s euch interessiert, zeig ich sie euch.«
»Klar«, sagte Wallner. »Wenn wir wieder unten sind, fahren wir mal hin.«
»So machen wir’s«, sagte Nissl und verabschiedete sich auf die Toilette.
»Glaubst du, da liegt wirklich eine Leiche im Glassarg?«, fragte Claudia.
»Ganz bestimmt nicht«, sagte Wallner, lachte und rückte näher ans Feuer, denn ihm war kalt.
6
2. Mai 1945
Sie hatte die Nacht wach gelegen und die SS-Leute beobachtet. Zu Beginn war es finster gewesen in der Scheune. Schneewolken hatten den Himmel verdeckt. Dann war die Wolkendecke aufgerissen, und durch die Spalten in der Holzverkleidung war Licht hereingedrungen. Das Licht einer hellen Frühlingsnacht. Erst fünf Tage war es her seit Vollmond. Die Scheune lebte und war voller Geräusche. Achtzig Frauen, die sich im Schlaf umdrehten, schnarchten und mit erstickten Schreien hochschreckten. Die SS-Leute hatten sich vom Bauern Schnaps geben lassen und waren im Rausch eingeschlafen. Auch die beiden Wachen, die am Scheunentor auf Stühlen saßen. Die Köpfe waren ihnen auf die Brust gefallen. Beinahe entspannt sahen sie aus. Nur ihre Sturmgewehre ließen sie auch im Schlaf nicht los.
Frieda hatte Angst zu sterben. Die Todesangst war an sich nichts Besonderes mehr, sie begleitete Frieda seit Jahren. Aber heute Nacht war die Todesangst anders als sonst. War sie die letzten Jahren dumpf und zur Gewohnheit geworden, immer öfter begleitet von dem Gedanken, es sei vielleicht besser, wenn endlich Schluss wäre, so war mit einem Mal die Hoffnung zurückgekehrt.
Vor ein paar Tagen hatte sie das erste Mal Geschützlärm gehört und eine Viertelstunde geweint vor Glück. Amerikanische Panzer rückten von Westen heran und würden sie befreien – wenn sie rechtzeitig kämen. Würde Kieling sie töten, noch bevor dieser Krieg zu Ende war? Sie musste den nächsten Tag überleben. Irgendwie. Sie wog ihre Möglichkeiten ab. Floh sie und wurde gefasst, würde sie erschossen. Wenn sie blieb – würde Kieling Rache nehmen? Bleiben oder Flucht – welches Risiko war größer? Sie sah zu den Wachen am Scheunentor. Sie schliefen. Auch die SS-Leute waren von Dachau bis hierher zu Fuß gegangen. Bei besserer Verpflegung und mit wärmerer Kleidung. Dennoch – es hatte sie erschöpft.
Draußen begann es zu dämmern. Es musste kurz nach fünf sein. Ihr blieb nicht mehr viel Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Frieda sah sich vorsichtig um. Neben ihr Greta, eine Frau aus dem jüdischen Teil der Gefangenengruppe. Daneben Sarah, Gretas Tochter, fünfzehn Jahre alt. Nachdem sie noch nicht vollkommen abgemagert waren, konnten sie noch nicht so lange im Lager sein. In Ravensbrück hatte Frieda Greta nicht gesehen. Aber das hatte nichts zu bedeuten. Es waren Tausende in den Lagern und auf den Transporten, die durchs Reich geschickt wurden. Jemand hatte gesagt, Greta und ihre Tochter hätten sich lange auf einem Dachboden versteckt gehalten und seien erst entdeckt worden, als das Haus, in dem sie lebten, von einer Bombe getroffen wurde.
Ein paar Mal hatten sie kurz geredet, nichts von Belang. Ohnehin gab es kaum Gelegenheit zu reden. Immer noch wurde auf die Trennung zwischen »Politischen« und »Juden« geachtet.
Frieda setzte sich vorsichtig auf. In dem Konzert aus Schnarchen und Rascheln im Heu blieb sie unbemerkt. Sie schlang die dünne Wolldecke um sich und nahm ihre Holzschuhe in die Hand. Die würde sie erst draußen anziehen, hier auf dem Holzboden der Scheune waren sie zu laut. Behutsam setzte Frieda Fuß vor Fuß. Die Wachen atmeten gleichmäßig und gaben ab und zu grunzende Laute von sich.
Da hörte Frieda ein Geräusch hinter sich. Es war anders als die Geräusche, die die Schlafenden verursachten. Erschrocken drehte sie sich um. Zwei Augen starrten aus dem Heuhaufen. Es war Greta. Sie hatte Angst. Wenn die SS-Leute jetzt erwachten, konnte das für alle den Tod bedeuten. Und was die Zurückgebliebenen erwartete, wenn morgen beim Appell eine fehlte, war nicht auszudenken. Greta zitterte am ganzen Leib und war unfähig, sich zu rühren.
In der Hoffnung, dass Greta stillhalten würde, ging Frieda weiter. Als sie an der Wache rechts vom Tor vorbeikam, löste sich einer ihrer Fußlappen. Sie bückte sich, um das lose Ende festzustecken. Als sie sich wieder aufrichtete, geriet sie mit den Holzschuhen an ihr Knie. Einer der Schuhe löste sich aus ihrer Hand und fiel hinunter.
Er fiel unnatürlich langsam, die Zeit schien stehenzubleiben. Reflexartig streckte Frieda einen Fuß zu der Stelle, wo der Schuh am Boden aufkommen würde. Er berührte ihren Fuß, wurde kurz gebremst, um dann auf die Holzbretter des Scheunenbodens zu kollern. Frieda hielt den Atem an. Die Wache, vor der sie stand, hob langsam den Kopf. Eine ganze Weile sah der Mann die Frau, die im gestreiften Häftlingsanzug und mit Wolldecke vor ihm stand und nicht atmete, aus halbgeschlossenen Augen an. Dann sagte er mit fränkischer Färbung: »Mudda – zieh die Schürzna aa!«, und ließ den Kopf langsam wieder auf sein Kinn sinken. Frieda wartete zehn Sekunden. Dann wagte sie wieder zu atmen und ihren Holzschuh aufzuheben.
Schritt für Schritt schlich sie weiter in Richtung Tor. Dort angekommen warf sie einen Blick zurück. Aus dem Heu sahen ihr hundert sehnsuchtsvolle Augen zu, wie sie den Eisenstift aus der schlichten Torverriegelung zog, Millimeter für Millimeter, fast lautlos, den Stift schließlich mit beiden Händen vorsichtig auf den Boden legte, in ihre Schuhe schlüpfte und das Tor langsam aufzog. Ein paar Zentimeter, und sie würde, abgemagert wie sie war, hindurchpassen.
Das Tor bewegte sich. Doch plötzlich spürte Frieda einen Widerstand. Das leise Geräusch, das damit einherging, zeigte an, dass der Widerstand von den rostigen Angeln rührte, die lange nicht geschmiert worden waren. Es würde quietschen und knirschen. Konzentriert zog sie das Tor weiter auf, bereit, beim ersten winzigen Geräusch innezuhalten. Schweiß lief ihr die Schläfen hinab, trotz der kalten Morgenluft, die durch den Spalt hereindrang. Draußen lag Schnee auf den blühenden Büschen. Aber es taute.
Ein winziges Stück noch, und sie könnte durch den Spalt schlüpfen. Friedas Atem ging flach, ihr Herz schlug bis zum Hals. Sie spürte einen erneuten Widerstand, dann knirschte es. Sofort hörte sie auf, am Tor zu ziehen, und drehte ihren Kopf langsam zu den Wachen. Sie schienen zu schlafen. Frieda schob ihr rechtes Bein durch den Spalt, dann den Arm und den Oberkörper, machte sich noch dünner, als sie ohnehin war. Ihr mittlerweile dickstes Körperteil, stellte Frieda fest, war ihr Kopf. Zwei Zentimeter fehlten wohl noch. Nicht mehr. Zwei gottverdammte Zentimeter, die sie daran hinderten, frei zu sein.
Sosehr sie sich auch mühte – das Tor war durch sanfte Gewalt nicht dazu zu bewegen, sie hinauszulassen. Tränen der Wut traten ihr in die Augen. Es half nichts. Sie musste dem Tor einen Ruck geben, und das würde man hören. Vielleicht würden die Wachen von dem kurzen Geräusch nicht aus dem Schlaf gerissen. Vielleicht. Vielleicht aber doch. Noch konnte sie zurück ins Heu und abwarten, ob der kommende Tag sie am Leben lassen würde. Aber sie wollte nicht mehr warten. Etwas hatte sich in ihr verändert, seit sie die ersten amerikanischen Kanonen gehört hatte. Nach über zweitausend Tagen der Demütigung und Angst war es ihr mit einem Mal nicht mehr vorstellbar, noch einen weiteren zu überstehen. Frieda drückte ihren knochigen Körper gegen das Tor. Ein Quietschen zerriss die Stille, laut wie ein Schuss, so schien es Frieda und offenbar auch den Mitgefangenen, die atemlos Anteil an ihrem Fluchtversuch nahmen und entsetzt auf die Wachleute starrten. Einer der Männer rührte sich, und das Sturmgewehr fiel ihm aus der Hand. Das Geräusch der zu Boden fallenden Waffe weckte ihn endgültig. Frieda zog den Kopf durch die Tür nach draußen. Das Letzte, was sie sah, war, dass der SS-Mann aufstand.
7
Herbst 1992
Wallners Blick blieb an Claudias rotlackierten Fingernägeln hängen, die eine Bierflasche vor der gestreiften Bluse umfassten. Claudias Jacke war offen, denn das Feuer in der Zinkwanne strahlte eine angenehme Hitze ab. An der Knopfleiste war die Bluse aufgeworfen, und man konnte hineinsehen auf eine Brust von angenehmen Ausmaßen.
Claudias Gesicht war rund, sinnlich, um das Kinn herum sehr weich, von schwarzen, halblangen Haaren umrahmt, mit großen Augen und einer etwas hervorstehenden Unterlippe. Das schwere Parfüm, nach dem sie roch, fügte sich in den Gesamteindruck. Wallner mochte keine Parfüms. Schwere schon gar nicht. Er hatte eine empfindliche Nase, und viele Düfte kratzten ihn im Hals oder verursachten Kopfschmerzen. Claudias Parfüm freilich war anders. Zwar war es mächtig, fast aufdringlich, aber es weckte warme Erinnerungen. Wallner konnte nicht sagen, woran, aber die Erinnerungen waren angenehm, sinnlich. Das Geruchsgedächtnis speicherte Düfte ein Leben lang. Die zugehörigen Bilder mochten im Lauf der Jahre verlorengehen. Aber die Erinnerung an den Geruch blieb.
Sie hatten eine Weile nicht geredet. Claudia sah zum Nachthimmel empor, der Föhn zupfte an ihren schwarzen Haaren. »Schön hier draußen«, sagte sie. »Nur Sterne, Berge und der Wind.«
»Ja, hat was.« Wallner blickte zum Wirtshaus, in dem unvermindert getrunken und gefeiert wurde. »Du kannst gerne wieder reingehen. Ich meine – da drin ist die Party. Und deswegen bist du ja gekommen.«
»Ist nicht so dein Ding, oder?«
»Grölen und Alkohol trinken, bis man keine Stimme mehr hat und in die Ecke kotzt?« Wallner schien einen Augenblick angestrengt nachzudenken. »Stimmt, ist nicht wirklich mein Ding. Ich bin sicher, jede Neandertalerparty war zivilisierter.«
»Oh ja. Den Neandertalern wird oft unrecht getan.« Claudia drehte sich zum lärmenden Wirtshaus. »Es ist wirklich abstoßend, was da drin abgeht. Aber es macht Spaß. Cheers!« Sie blickte Wallner lachend an und hielt ihm ihre Bierflasche hin. Wallner lächelte höflich zurück und stieß mit ihr an.
»Natürlich macht es Spaß«, sagte er. »Sonst würden es nicht so viele Leute tun. Vielleicht komm ich ja noch dahinter.«
Sie setzte die Flasche ab, leckte über ihre Lippen und sagte: »War ich sehr laut … vorhin?«
»Nun – du warst sicher … eine der tragenden Stimmungssäulen, wenn ich das mal so sagen darf.«
»Tut mir leid. Das muss sehr irritierend für dich sein. Und dabei warst du so nett, mich herzubringen, obwohl du gar nichts mit dem Besäufnis anfangen kannst.«
»Ich hab meinen Spaß. Es ist schön hier oben auf dem Berg.« Er streckte seine Nase in den Wind. »Ich glaube, der Föhn lässt nach. Wir kriegen bald Schnee.« Er wandte sich wieder Claudia zu. »Aber geh ruhig rein. Okay?«
»Warum? Es ist nett mit dir.« Claudia legte ihre Hand kurz auf die von Wallner. Ihre Hand war weich und warm, mit langen, schön geformten Fingern. »Wohnst du noch bei deinen Eltern?«
Wallner zögerte kurz. »Ich seh so aus, oder wie?«
»Nein, nein. So war das doch nicht gemeint … ach Mist. Streich die Frage einfach.«
»Ich lebe nicht bei meinen Eltern.«
»Ah! Du hast ein schickes Single-Apartment!«
»Ich wohne bei meinen Großeltern.«
Claudia brauchte ein bisschen, um abzuschätzen, ob Wallner sie auf den Arm nahm. »Echt?«
»Echt.«
»Ist doch okay.«
»Danke. Da fällt mir ein Stein vom Herzen.«
Claudia suchte Wallners Blick. Wallner sah ihr kurz in die Augen, wandte sich schnell ab, schien dann zu überlegen, ob er sich damit eine Blöße gegeben hatte, und sah Claudia wieder an. Sie versuchte, versöhnlich zu lächeln. »Ich weiß. Es gibt Menschen, die fühlen sich durch meine Art ein bisschen in die Enge getrieben. Ich will das gar nicht. Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, okay?«
»Warum nicht? Du machst das gut.«
Sie nahm seine Hand fest in die ihre und sah ihn ernst an. »Ich finde dich einfach nett. Und ausgesprochen süß mit deiner Brille und so korrekt und ein bisschen steif.«
»Wow«, sagte Wallner. »Jetzt ist alle Verlegenheit wie durch einen Zauber von mir abgefallen.«
Sie stieß ihm die Faust gegen die Schulter, dass Wallner fast mit seinem Stuhl umkippte. »Jetzt ist aber Schluss mit dem Mädchengetue. Du wirst dich schon noch an mich gewöhnen. Wir müssen in Zukunft zusammenarbeiten.«
Wallner lachte plötzlich. Er hatte Probleme mit Frauen, die derart dominant auftraten wie Claudia. Frauen, die laut waren und extrovertiert. Es irritierte ihn, vor allem aber beraubte es ihn der Kontrolle über die Situation, und das war ihm zuwider. Claudia aber hatte etwas an sich, das ihn anzog, etwas, das es ihm ermöglichte, ihr die vielen Regelverstöße zu verzeihen. War es ihr Parfüm? War es das Lächeln in ihren dunklen Augen?
»Okay«, sagte Wallner. »Ich versuche es. Unter einer Voraussetzung.«
»Und die wäre?«
»Erwarte nie von mir, locker zu sein.«
»Das kommt auch noch«, sagte Claudia und tätschelte Wallners Knie.
Kreuthner kam auf die Terrasse. »Was geht denn hier ab? Habt’s ihr zwei was am Laufen?«
»Äh, nein«, beeilte sich Wallner zu sagen. »Wir haben uns sehr nett mit Herrn Nissl unterhalten.«
»Hat er wieder Geschichten erzählt?«
»Er hat einen Schneewittchensarg gesehen«, sagte Claudia. »In einem geheimen Grab, von dem niemand was weiß.«
»Die Geschichte kenn ich noch gar nicht.« Kreuthner sog mit Inbrunst an der Bierflasche, die er mit auf die Terrasse gebracht hatte, und spähte in die laue Nacht hinaus. »Und?«, sagte er schließlich. »Hab ich zu viel versprochen?« Die Frage war an Claudia gerichtet.
»Toller Abend. Supernette Jungs da drin. Und der Blick hier oben auf dem Berg. War eine super Idee.« Sie hielt Kreuthner ihre Bierflasche zum Anstoßen hin. »Thomas Nissl erzählt viel Unsinn, oder?«
»Ziemlich viel.« Sie stießen an.
»Er hat erzählt, dass er früher viele Häuser hatte.« Claudia lachte.
»Das stimmt sogar.«
»Echt? Wie ist er an die gekommen?«
»Geerbt. Irgend a reicher Miesbacher hat sie ihm vermacht. Warum, weiß kein Mensch.«
»Und wieso hat er die Häuser nicht mehr?«
»Das war vor meiner Zeit. Aber was man so hört, hat er’s recht krachen lassen. Und dann gab’s a paar Spezln von ihm, die ham ihm die Häuser abgeschwatzt. Der hat die praktisch verschenkt.«
»Wieso macht der so was?«
Kreuthner zuckte mit den Schultern. »Er wollt halt auch mal Freunde haben.«
Nissl kam aus dem Haus zurückgehumpelt.
»Na, Dammerl?« Kreuthner nahm sich jetzt auch einen Stuhl und rückte ihn ans Feuer. »Letzter Abend in Freiheit. Könnt schlimmer sein, oder?«
»Du hast nette Freunde«, sagte Nissl. »Ich hab ihnen ein Geheimnis verraten.«
»Das mit dem Grab?«
»Da müsst’s ihr mal nachschauen. Sauber ist das nicht.«
»Jaja. Wenn mir wieder unten sind. Magst noch a Bier?« Kreuthner deutete an, dass er ins Haus gehen würde.
»Äh …«, Nissl sah Kreuthner an, als würde er angestrengt überlegen, was er auf die Frage antworten sollte. »Sag amal, das mit dem letzten Abend und so … Die sperren mich doch net ein, oder?«
»Hat des die Richterin net g’sagt letztes Mal?«
»Ja, aber …« Nissl sah verständnisheischend zu Kreuthner. »Doch net für a paar Zigaretten.«
»Die können dich net immer wieder auf Bewährung rauslassen. Hast dich halt net bewährt. Frag die Claudia.«
»Wie oft bist du denn schon auf Bewährung verurteilt worden?«
Nissl zählte an den Fingern ab. »Drei Mal.«
»Fünf Mal«, korrigierte Kreuthner.
Claudia verzog das Gesicht. »Dann wird’s schwierig. Das kann eigentlich kein Richter mehr begründen.«
»Nein!«, sagte Nissl mit aller Entschiedenheit und laut. »Das geht net. Die können mich net wegen a paar Zigaretten … Das hat’s noch nie geben. Die spinnen doch!« Er blickte Kreuthner nahezu erschrocken an.
»Komm, reg dich ab, okay?«
Nissl schwieg und sah sich hektisch um, musterte Claudia und Wallner, dann Kreuthner, die Terrasse, ein Blick zum Haus, aus dem dumpf Gesang dröhnte. »He, bleib ruhig, Alter.« Kreuthner berührte Nissl vorsichtig am Arm. »Du kannst net abhauen. Net mit dem Hax’n. Da kommst net weit.«
»Stimmt. Da komm ich net weit. Magst a Bier?« Nissl lächelte und schien mit einem Mal nüchtern und gefasst. Eine Spur zu nüchtern kam er allen dreien vor, als sie Nissl nachblickten, wie er mit seiner Krücke durch die Tür zur Gastwirtschaft hinkte.
»Wieso hast du den eigentlich mitgebracht?«, fragte Wallner schließlich.
»Dass er auch mal was Schönes erlebt«, sagte Kreuthner und fragte sich insgeheim, ob Nissl ihm wirklich ein Bier mitbringen würde. Schreie aus dem Gastraum rissen ihn aus seinen Gedanken. Andere Schreie als vorher, keine Schreie von betrunkenen Frauen. Schreie des Entsetzens. Auch das Rumpeln von Stühlen war zu hören. Schließlich – ein Schuss …
8
Es war totenstill. Vorsichtig betraten Kreuthner und Wallner den Gastraum. Eine Fensterscheibe war gesplittert. Alle Anwesenden hatten sich in einer Ecke des Raumes versammelt und starrten geschockt in die Richtung der beiden Polizisten. Die drehten sich langsam um. Wie ein Riese aus einer fremden Welt stand er hinter der Tür, eine Jagdbüchse in der Hand. Nissls blaue Augen waren kalt geworden.
»Rüber!«, sagte er in einem Ton, den Kreuthner noch nie bei ihm gehört hatte.
»Dammerl! Mach kein Scheiß. Was soll denn das werden?«
»Rü-rüber. Zu die a-a-anderen.« Nissl stieß Kreuthner mit der Spitze des Gewehrlaufs an. Kreuthner zuckte zurück und hob beschwichtigend die Hände. »Keep cool. Das kriegen mir alles geregelt, okay?«
»Komm!« Wallner zog Kreuthner von Nissl weg. Draußen, vor der Tür zum Gang, stand Claudia und sah Wallner ängstlich an. Er hatte ihr gesagt, sie solle draußen bleiben. Wallner hatte die Verantwortung für sie und keine Lust, seinem Chef erklären zu müssen, warum sich seine Tochter eine Kugel gefangen hatte. Er stieß die Tür mit dem Fuß zu und ging mit Kreuthner zu den anderen.
Nissl trat jetzt ein paar Schritte auf seine Geiseln zu, dabei behielt er den Raum im Auge, ob sich irgendwo etwas rührte. Alles blieb ruhig. Der Wirt stand, zitternd und bleich, mit allen anderen in der Ecke und wartete, was als Nächstes passieren würde. Aber es passierte nichts, außer dass Nissl sie wütend anfunkelte. Er war ganz offensichtlich aufs Äußerste erregt.
»Wollen wir mal weitermachen?«, sagte Wallner nach einiger Zeit des Schweigens.
»Ha-hal-hal …« Nissl brachte kein zusammenhängendes Wort hervor. Er war mindestens so aufgeregt wie die, die er in seiner Gewalt hatte.
»Ich soll den Mund halten?«, fragte Wallner.
Nissl nickte.
»Hör zu, ich will nur versuchen, die Dinge hier für alle zu einem guten Ende zu bringen. Und dazu musst du mir sagen, was du willst. Sonst geht hier nichts weiter.«
Nissl atmete schwer, schien zu überlegen, öffnete den Mund. Aber es wollte nichts herauskommen.
»Jetzt gebt’s ihm halt an Obstler«, schlug Kreuthner vor.
Nissl nickte in Richtung Wirt, der sich hinter den Tresen begab und eine Flasche Schnaps aus der Kühlung holte. Zusammen mit einem Schnapsglas stellte er sie auf ein kleines Tablett, das er Nissl hinschob. Der ignorierte das Glas, setzte die Flasche an und trank in großen Zügen. Sichtlich gestärkt wandte er sich wieder Wallner zu.
»Ich will an Fluchtwagen. Der Leo soll mit seinem Chef telefonieren.«
»Wo soll der Fluchtwagen hin?«, fragte Kreuthner. Nissl schwieg, von der Frage offenbar überrascht. »Hier hochfahren kann er ja net.«
»Der soll zum Lift kommen.«
»Kannst du überhaupt Auto fahren?«
Wieder nahm sich Nissl eine Denkpause. Dann verkündete er: »Du fährst.«
»Ich?« Kreuthner lachte ängstlich auf. »Ich bin gar nimmer fahrtüchtig. Was glaubst, was ich intus hab?«
»Aber du bist der Einzige, wo in dem Zustand noch fahren kann«, meldete sich Sennleitner von ganz hinten. Kreuthner hätte ihm gerne eine reingehauen.
»Ruf endlich an!«, sagte Nissl und richtete den Gewehrlauf auf das Telefon hinter dem Tresen.
»In Wiessee is keiner mehr. Das weißt ja selber.« Kreuthner ging um den Tresen herum und nahm den Hörer ab.
»Ruf in Miesbach an«, sagte Wallner. »Da ist um die Zeit noch jemand.«
Kreuthner wusste die Nummer auswendig und tippte sie ein. Kurz darauf meldete sich die Zentrale der Polizeistation. Kreuthner fragte nach dem ranghöchsten im Haus anwesenden Beamten. Das war Lukas. Als Wallner den Namen hörte, rutschte ihm das Herz in die Hose.
9
Kreuthner?«, fragte Lukas am anderen Ende der Leitung. »Was gibt’s denn so spät?«
»Ich ruf vom Hirschberghaus an. Und neben mir steht der Herr Nissl. Der hätt ein Anliegen.«
»Nissl? Habt ihr den nicht heute verhaftet?«
»Auch. Ja. Aber jetzt ist er hier und möchte ein Auto.«
»Aufs Hirschberghaus?«
»An die Talstation von der Seilbahn. Da, wo der Forstweg aufhört.«
»Kreuthner …« Lukas klang verärgert. »Haben Sie was getrunken?«
»Nein. Das ist alles wahr, was ich sag.«
»Warum verhaften Sie den Mann dann nicht auf der Stelle?«
»Er hat a Gewehr in der Hand.«
»Herrgott, Kreuthner!« Lukas sprang aus seinem Bürosessel. »Sagen Sie mir endlich, was da los ist. Ist das eine Geiselnahme oder was?!«
»Jetzt tun S’ Ihnen nicht beunruhigen. Mir ham alles unter Kontrolle.«
»Du hast gar nix unter Kontrolle«, schrie der Wirt und stürzte zu Kreuthner, um ihm den Hörer aus der Hand zu reißen.
Ein Schuss krachte durch den Raum, gefolgt von einem vielstimmigen Aufschrei, dann Nissls rauhe Stimme: »Weg von dem Telefon!«