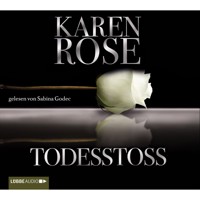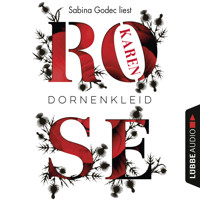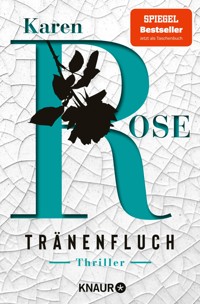
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Sacramento-Reihe
- Sprache: Deutsch
Was tust du, wenn dein schlimmster Alptraum kommt, um dich zu holen? Im Thriller »Tränenfluch«, dem 2. Band derSacramento-Reihe von Bestseller-Autorin Karen Rose, muss sich die junge Mercy Callahan ihrer dunklen Vergangenheit bei der brutalen Sekte »The Church of Second Eden« stellen. 13 Jahre lebte Mercy Callahan in dem Glauben, sie sei endlich in Sicherheit. Doch seit ihr Bruder, FBI-Agent Gideon Reynolds, gegen die im Untergrund agierende Sekte »The Church of Second Eden« ermittelt, ist nichts mehr wie zuvor. Denn jetzt weiß der Sektenführer Ephraim Burton, mit dem Mercy als Kind zwangsverheiratet wurde, dass sie noch lebt. Und er hat mehr als einen guten Grund, das zu ändern. Burtons erste Attacke auf Mercy kann Gideons bester Freund Detective Rafe Sokolov gerade eben so verhindern. Mit seiner Hilfe beschließt Mercy, sich ihrem Peiniger endlich zu stellen. Denn wenn es ihnen nicht gelingt, »The Church of Second Eden« aufzuspüren und ein für alle Mal auszuschalten, werden sie und Gideon niemals wirklich sicher sein. Weder Mercy noch Rafe ahnen, was Burton und die Sekte zu tun bereit sind, um ihre Geheimnisse zu wahren … Romantic Suspense mit der perfekten Mischung aus Hochspannung, Romantik und Action Mit »Tränenfluch« präsentiert die amerikanische Bestseller-Autorin Karen Rose eine furiose Fortsetzung ihres ersten Sacramento-Thrillers »Tränennacht«: leidenschaftliche Hochspannung mit Pageturner-Garantie! Alle Bände der romantic Thrill-Reihe von Karen Rose - Tränennacht - Tränenfluch - Tränenschwur Lust auf noch mehr von Karen Rose? Dann entdecken Sie die Dornen-Thriller oder die Baltimore-Reihe!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1088
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Karen Rose
Tränenfluch
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Brandl
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Dreizehn Jahre lebte Mercy in dem Glauben, sie sei endlich in Sicherheit. Doch seit ihr Bruder, FBI-Agent Gideon Reynolds, gegen die im Untergrund agierende Sekte »Church of Second Eden« ermittelt, ist nichts mehr wie zuvor. Denn jetzt weiß der Sektenführer Ephraim Burton, mit dem Mercy als Kind zwangsverheiratet wurde, dass sie noch lebt.
Seine erste Attacke auf Mercy kann Gideons bester Freund Detective Rafe Sokolov gerade so verhindern. Mercy beschließt, den Kampf gegen Eden aufzunehmen. Doch weder Mercy, Gideon noch Rafe ahnen, was die Sekte zu tun bereit ist, um ihre Geheimnisse zu wahren …
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Epilog
Dank
Karen Rose bei Knaur
Eine Liste aller Karen-Rose-Romanein chronologischer Reihenfolge:
Verzeichnis der auftretenden Figuren in den Romanen von Karen Rose
Für Farrah. Wenn ich deine Bücher lese, wird mir warm ums Herz, und ich wünschte, ich hätte einen Platz am Küchentisch deiner Figuren. Deine Großzügigkeit ist eine Inspiration, und dein Lächeln erhellt den Raum. Ich hoffe, du findest Mercys Farrah genauso mutig, intelligent, einfühlsam und großartig, wie du im wahren Leben bist.
Für Deb. Ich werde jetzt nicht sagen, dass mich deine Tapferkeit demütig macht (auch wenn es so ist), weil ich weiß, dass du jeden Tag auf die dir bestmögliche Art und Weise durchstehst. Stattdessen sage ich, dass ich unendlich froh bin, dich zu kennen, und es kaum erwarten kann, mit dir diesen Tee zu trinken.
Und, wie immer, für Martin. Ich liebe dich.
Prolog
Redding, Kalifornien
Dreizehn Jahre zuvor
Dienstag, 18. Mai, 04.30 Uhr
Sie würde sterben. Rhoda wusste es. Brother DJ würde sie auf keinen Fall zurück nach Eden mitnehmen, aber selbst wenn er es täte, würde es nichts ändern. Sie wollte nicht zurück. Niemals.
Vielmehr verfluchte sie den Tag vor all den Jahren, als sie auf die Ladefläche seines Lasters gestiegen war. Wie lange war das jetzt her? Sie wusste es nicht mehr genau. DJs Vater Waylon hatte an jenem Abend hinter dem Steuer gesessen, als sie ihre Kinder zu sich auf den Schoß gezogen und ihnen versprochen hatte, dass alles gut werden würde. Dass sie in ein neues Zuhause fahren würden, wo alles wunderbar sei und es Spielsachen, genug zu essen und ein warmes Bett für sie gebe.
Wie konnte ich nur so dumm sein? Naiv und dumm.
Mercy war gerade mal ein Jahr alt gewesen und hatte daher nichts von den schlimmen Zeiten mitbekommen, als nicht jeden Abend ein warmes Essen auf dem Tisch stand, weil Rhoda nicht genug Kunden gemacht hatte. Gideon hingegen hatte mehr als einmal gesehen, wie sie nach einer Nacht auf den Straßen San Franciscos mit einem Veilchen, aber ohne Frühstück für ihre Kinder nach Hause gekommen war, weil irgendein Freier wieder mal nicht hatte zahlen wollen. Deshalb hatte er ihr Versprechen auf ein besseres Leben geglaubt und war nur allzu bereitwillig, ja, sogar voller Eifer auf den Laster geklettert, der sie ins Paradies bringen würde. Nach Eden.
Eden. Am liebsten würde sie vor Abscheu ausspucken, doch ihr Mund war zu trocken. Eden war nicht das Paradies gewesen. Sondern die Hölle.
Damals war Gideon erst fünf Jahre alt gewesen, ein cleveres Kerlchen und ein echter Schatz. Reif für sein Alter. Mein wunderschöner Sohn. Mittlerweile war er siebzehn. An der Schwelle zum Mann. Sie hoffte es. Betete.
Gideon. Mein wunderschöner Sohn. Sie würde ihn niemals wiedersehen, sondern konnte nur hoffen, dass es ihm gut ging, dass er überlebt hatte. Nacht für Nacht hatte sie sich in den vergangenen vier Jahren dafür verflucht, ihn an seinem dreizehnten Geburtstag allein gelassen zu haben, so schwer verletzt, dass er womöglich umgekommen war. Sie hatte mit angesehen, wie Waylon ihn hinter eine Mülltonne warf, und versucht, noch einen letzten Blick auf seine leblos daliegende Gestalt zu erhaschen, ehe Waylon ihr die Hände auf dem Rücken gefesselt und sie mit dem Gesicht voran auf die Ladefläche des Lasters gedrückt hatte, um sich seinen Lohn für Gideons Flucht zu nehmen, so brutal, dass sie völlig zerfetzt und blutend zurückgeblieben war … dies war der schlimmste Tag ihres Lebens gewesen.
Bis sie ein drittes Mal auf seinen Laster geklettert war, diesmal mit ihrer Tochter in den Armen und Waylons Sohn DJ am Steuer, der den Wagen nach dem Tod des Vaters geerbt hatte. DJs Preis war derselbe wie damals, als sein Vater sie mit dem schwer verletzten Gideon in den Armen zum selben Busbahnhof gebracht hatte.
Und obwohl sie beide Male mit jeweils einem anderen Mann verheiratet gewesen war, hatte sie sich gefügt. Vor Eden hatte sie ihren Körper für sehr viel weniger verkauft. Was bedeuteten schon ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen, wenn das Leben der eigenen Kinder auf dem Spiel stand? Gar nichts. Deshalb hatte sie klaglos bezahlt.
Am Tag von Gideons Flucht hatte Brother Waylon sie nach Eden zurückgebracht, damit sie für ihr Verbrechen bestraft wurde, doch sie hatte das dumpfe Gefühl, dass es heute mit DJ anders enden würde.
Sie blickte auf die zitternde Gestalt in ihren Armen. Mercy glühte vor Fieber. Die Heilerin hatte ihr nicht helfen können, was kein Wunder war. Sister Coleens Fähigkeiten beschränkten sich auf die Behandlung von Erkältungen und kleinen Schnittverletzungen.
Mercy hingegen litt unter einer Infektion. Und zwar einer sehr schweren und weit fortgeschrittenen, wie allein der Gestank verriet, und Coleen verfügte schlicht nicht über die Mittel, um mit so etwas fertigzuwerden.
Deshalb hatte Rhoda sich zu diesem drastischen Schritt entschlossen. Ihr eigenes Leben im Austausch dafür, Mercy fortzubringen, hoffentlich irgendwohin, wo sie in Sicherheit wäre. Wobei so ziemlich jeder Ort besser wäre als der, der hinter ihnen lag.
Eden. Rhoda unterdrückte ein bitteres Lachen. Ohne ihr kleines Mädchen auf dem Schoß hätte sie den Tod mit offenen Armen willkommen geheißen. Liebevoll strich sie Mercy eine Strähne aus der schweißnassen Stirn. Wie sehr habe ich mir gewünscht, dich aufwachsen zu sehen!
Und nun war Mercy schon viel zu erwachsen. Fast ein Jahr war seit ihrem zwölften Geburtstag vergangen. Rhoda erinnerte sich noch, wie sie selbst zwölf geworden war, an ihre Freundinnen, mit denen sie damals gespielt hatte. Der Unterschied zu Mercys Geburtstag hätte nicht dramatischer sein können.
Tränen und Schmerz hatten ihn bestimmt. Und Angst. So große Angst. Es ist alles meine Schuld. Ich war diejenige, die nach Eden wollte. Und die ihre Kinder mitgenommen hat, ohne sich vorher darüber Gedanken zu machen. Ich habe einem Wildfremden vertraut. Der ihr eine Unterkunft, etwas zu essen und einen Ort versprochen hatte, an dem sie ihre Kinder in Ruhe und Sicherheit großziehen konnte. Rhoda hatte ihm geglaubt, mit dem Ergebnis, dass ihre Kinder den Preis für ihre Dummheit bezahlen mussten.
»Es tut mir so leid«, flüsterte sie. »So unendlich leid.«
Mercys Lider flatterten. Ihre Augen unter den dichten Wimpern waren genauso leuchtend grün wie die ihres Bruders. »Mama?«, flüsterte sie heiser. »Es tut so weh.«
»Ich weiß, Baby. Bald wird es besser.« Rhoda hatte keine Ahnung, ob das stimmte, doch die Worte schienen ihre wunderbare Tochter zu beruhigen, sodass sie die Augen wieder schloss. Rhoda hoffte, dass sie eingeschlafen war.
Oder das Bewusstsein verloren hatte.
Letzteres wäre ihr sogar lieber. Sie hoffte, dass Mercy nicht mitbekommen hatte, wie DJ Belmont nach etwa einer Fahrtstunde das erste und eine Stunde später ein zweites Mal angehalten hatte. Und eine Stunde später noch einmal, um seine Bezahlung zu kassieren.
Doch Rhoda würde alles auf sich nehmen, um Mercy aus Eden wegzubringen.
Inzwischen hatten sie ihr Ziel fast erreicht, den Busbahnhof, wo sie Gideon vier Jahre zuvor zurückgelassen hatte. Sie beugte sich vor. »Mercy, Schatz. Bist du wach?« Mercy nickte wortlos.
»Du musst mir genau zuhören. Was ich dir jetzt sage, ist sehr wichtig. Finde Gideon. Er wird dir helfen.«
Mercy riss entsetzt die Augen auf. »Aber er ist doch tot.«
»Nein, Schatz, er ist nicht tot.« Bitte, lieber Gott, mach, dass es wahr ist. »Er ist geflohen. Ich habe ihn in jener Nacht rausgeschmuggelt, so wie ich es jetzt mit dir tue. Er lebt, und du musst ihn finden.«
Erschütterung zeichnete sich auf Mercys Zügen ab. »Er lebt? Aber du hast doch gesagt –«
»Ich weiß, was ich gesagt habe«, zischte Rhoda. Es war kein Wunder, dass Mercy ihr nicht glaubte. Ich habe meine Rolle als trauernde Mutter gut gespielt. Dabei hatte sie keineswegs Gideons Tod betrauert, sondern die Tatsache, dass sie durch ihren Entschluss, nach Eden zu gehen, ihre beiden Kinder in Gefahr gebracht hatte. Sie hatte betrauert, dass sie ihn ganz allein, blutend und voller Schmerzen, an diesem Busbahnhof zurückgelassen hatte. »Aber du musst mir jetzt glauben. Er lebt. Und er wird dir helfen. Finde ihn, Mercy.«
Mercys Nasenlöcher blähten sich. »Nein«, stieß sie mit zusammengekniffenen Augen hervor.
Die Bösartigkeit ihres Tonfalls ließ Rhoda zusammenzucken. »Was? Warum nicht?«
»Er ist ein Egoist, ich will ihn nie wiedersehen. Er ist abgehauen. Er hatte ein Leben … während wir …« Tränen stiegen Mercy in die Augen. »Während wir gelitten haben. Wir mussten leiden, weil er egoistisch war.«
»Nein, Mercy. Das war er nicht. Niemals.«
»Ich komme auch ohne ihn zurecht. Wir schaffen das schon, du und ich.«
Nun füllten sich Rhodas Augen mit Tränen. Nicht wir, meine Süße. Nur du allein. Man würde ihr ganz bestimmt nicht erlauben, mit ihrer Tochter zu gehen. »Mercy, mein Schatz. Es gibt etwas, das du über Gideon wissen musst.«
Mercy wandte den Kopf ab und kniff die Augen zusammen. »Nein.«
»Es gab einen Grund für seine Flucht.« Sogar einen guten Grund. Einen so guten, dass sie beschlossen hatte, ihr Kind gehen zu lassen. Ihren einzigen Sohn. Sie hatte ihn zurückgelassen, in der Hoffnung, dass jemand ihn finden und ihm helfen würde.
»Ich weiß. Er wollte seine Lehre nicht machen. Und nicht arbeiten. Er war faul und selbstsüchtig.« Mercy spie ihr die Worte entgegen, die die Gemeinschaft ihr gnadenlos eingeimpft hatte, allen voran Mercys eigener »Ehemann«.
Worte, die Rhoda aus Angst nicht als das zu bezeichnen gewagt hatte, was sie waren: gemeine Lügen. Und nun würde sie ihre beiden Kinder verlieren, weil sie nach dieser jüngsten Demonstration ihres Ungehorsams jede Chance verwirkt hatte, noch länger am Leben zu bleiben.
Wie hatte sie das nur zulassen können? Wie hatte es so weit kommen können?
»Nein, Mercy.« Rhoda schüttelte den Kopf. »Er war nicht faul und auch nicht selbstsüchtig.« Sondern man ist auf ihn losgegangen. Hat ihn geschlagen. Halb totgeprügelt. »Er war …«
Der Laster kam abrupt zum Stehen. Wieder verfluchte Rhoda sich, diesmal, weil sie so lange mit der Wahrheit gezögert hatte. Es war zu spät. Sie hatte Mercy noch so viel zu sagen, doch ihr blieben nur wenige Sekunden.
»Mercedes«, flüsterte sie. »Du bist Mercedes Reynolds.«
Verwirrt riss Mercy die Augen auf. »Was?«
Die Fahrertür wurde geöffnet. DJ. Sekunden. Dir bleiben nur Sekunden. Wähle deine Worte mit Bedacht.
»Dein Name ist Mercedes Reynolds. Nicht Terrill.«
Mercy runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht …«
»Meine Eltern heißen Derrick und Ronnie Reynolds. Sie leben in Houston. Geh zu ihnen. Sie kümmern sich um dich.«
»Mama?« Mercy krallte die Finger in Rhodas selbst genähte Jacke. »Was redest du da?«
Zum ersten Mal, seit Rhoda einem Wildfremden die Lüge vom Paradies geglaubt hatte, sah sie klar. Sie machte es wieder gut. Nein, das konnte sie nicht. Dafür war es zu spät. Aber sie konnte zumindest die Wahrheit sagen.
»Dein Bruder heißt Gideon Reynolds. Du musst ihn finden. Sag ihm, dass es mir leidtut. Und dass ich ihn liebe.« Ihre Augen füllten sich erneut mit Tränen, die sie wegzublinzeln versuchte. »Und dich liebe ich auch. Für immer und ewig.«
Mercys Lippen bebten. »Mama?
»Selena. Ich heiße Selena Reynolds.« Sie gab einen zischenden Laut von sich, als DJs Handrücken gegen ihren Kiefer klatschte.
»Ruhig jetzt!«, schnauzte er.
Mercy kniff die Augen zusammen und wappnete sich ebenfalls gegen einen Schlag, der jedoch nicht kam, denn Mercy war nicht diejenige, gegen die sich DJs Zorn richtete.
Vorsichtig fuhr sich Rhoda mit der Zunge über ihre blutende Lippe und sah DJ in die Augen. Schweigend. Wie man es ihr beigebracht hatte.
DJ warf ihr einen warnenden Blick zu. »Schluss mit deinen Lügen, Rhoda. Du hast heute schon genug Ärger gemacht.«
Rhoda blickte auf das verängstigte Mädchen in ihren Armen. Sie ist noch ein Kind. Die Gemeinschaft mochte Mercy als erwachsene Frau betrachten, doch das war sie nicht. Rhodas Tochter war ein Mädchen von knapp dreizehn Jahren, halb verrückt vor Angst, doch zu unterdrückt und gezüchtigt, um sich zur Wehr zu setzen, sowohl emotional als auch körperlich. Mercys Ehemann hatte sie geschlagen und so brutal genommen, dass sie geblutet hatte. Wieder und wieder.
Meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte ihn daran hindern müssen.
Aber das war unmöglich. Schon die Gewalt dieses Mannes ihr selbst gegenüber hatte sie nicht abwehren können, von der gegen Mercy ganz zu schweigen.
Sie waren Besitz. Mehr nicht.
»Hältst du dich an deinen Teil der Vereinbarung?«, fragte sie.
DJ nickte knapp und streckte mit finsterer Miene die Arme aus.
Rhoda drückte Mercy noch enger an sich. »Ich trage sie«, erklärte sie und unterdrückte einen Aufschrei, als DJ ihr einen weiteren Hieb verpasste.
»Hör endlich auf, Ärger zu machen, Rhoda«, knurrte er und riss ihr Mercy aus den Armen.
Rhoda krabbelte zum Ende der Ladefläche und hatte gerade einen Fuß auf den Boden gesetzt, als DJ sich umdrehte und sie grob zurückstieß.
»Du bleibst hier«, bellte er.
Sie rutschte an die Seite des Lasters, um über die Kante zu spähen. Mercy lag zusammengerollt wie ein Säugling und am ganzen Leib zitternd auf dem Asphalt. Was hatte er ihr angetan?
»Mercy?« Sie hörte die Angst in ihrer Stimme. »Mercy …«
Doch Rhodas Rufe erstarben abrupt, als DJ die Kette um ihren Hals packte, mit einem Ruck zurückriss und ihr damit die Luft abschnürte. Reflexartig packte sie das Medaillon und zerrte daran, doch DJ zog nur noch fester. Verzweifelt öffnete sie den Mund, um Atem zu schöpfen.
Sie hasste diese Kette. Das Medaillon, das daran befestigt war. Hasste die Art, wie der Mann, dem sie gehörte, sie benutzte, so wie DJ es jetzt tat. Um sie zu kontrollieren, ihr zu zeigen, wem eben diese Atemzüge gehörten, um die sie rang. Nicht mir. Seit zwölf endlosen Jahren gehörte ihr nicht einmal mehr ihr eigener Atem.
Die Kette war keineswegs ein Schmuckstück, sondern das Halsband einer Sklavin, das sie viel zu lange schon trug.
Etwas Scharfes bohrte sich in ihre Haut und glitt an ihrem Nacken nach oben, direkt unter die Kette, die sich tiefer in ihre Haut grub. Schwarze Punkte begannen vor ihren Augen zu tanzen.
Das war’s also? So wird er mich töten?
Unvermittelt ertönte ein lautes Knirschen direkt neben ihrem Ohr, und die Kette wurde schlaff. Die Atemzüge brannten sengend in ihrer Lunge, als sie gierig die Luft einsog, eine Hand um ihren Hals gelegt, während sie mit der anderen immer noch das verhasste Medaillon umkrallte.
Bis es ihr aus der Hand gerissen wurde.
»Du bleibst hier«, knurrte er. »Ich mein’s ernst, Rhoda.«
Doch Rhoda hörte nicht länger auf ihn, sondern kroch zur Ladeklappe und ließ sich über die Kante gleiten, um auf unsicheren Beinen zu ihrer Tochter zu taumeln.
DJ hockte neben Mercy, hatte mit einer Hand auch ihre Kette gepackt und durchtrennte sie mit einem Bolzenschneider, nur dass Mercy nicht um Atem rang, sondern leblos wie eine Gliederpuppe in DJs unsanftem Griff hing.
DJ richtete sich auf. In der Hand hielt er beide Ketten. Rhoda ging davon aus, dass er sie in den Laster werfen würde, doch stattdessen betrat er einen schmalen Rasenstreifen am Straßenrand und grub mit dem Bolzenschneider ein flaches Loch, in das er die beiden Medaillons warf. Er häufte die Erde darauf und drückte das herausgerissene Gras fest, bis alles aussah wie zuvor.
Taumelnd kam Rhoda neben Mercy zum Stehen und sank auf die Knie. »Mercy? Sag doch etwas. Bitte!«
Doch Mercy blieb zusammengerollt auf dem Boden liegen. Hektisch sah Rhoda sich auf dem Parkplatz um, auf dem weit und breit keine Menschenseele zu sehen war. Niemand, der hätte helfen können.
DJs Miene war unheilvoll, als er zurückkam.
»Was hast du mit ihr gemacht?«, herrschte Rhoda ihn an, ohne sich darum zu scheren, dass er ihr den Mund verboten hatte. Sie hatte nur einen Gedanken: ihre Tochter, die sie in jeder Hinsicht im Stich gelassen hatte.
DJ verzog das Gesicht zu einem Grinsen, das ihr einen eiskalten Schauder über den Rücken jagte. »Ich habe ihr gesagt, dass Brother Ephraim schon unterwegs ist.«
Das mulmige Gefühl schlug in lähmende Furcht um. »Und stimmt das?«
DJs Grinsen wurde noch breiter. In diesem Moment zog er eine Waffe unter seiner Jacke hervor.
Rhodas Herzschlag setzte aus. Das war’s also. Jetzt würde er sie töten. »Nein. Nicht vor ihr. Bitte.«
DJ lachte nur. »Du wolltest diesen Handel abschließen, Rhoda. Ich habe meinen Teil eingehalten. Ihr seid beide hier. Weg aus Eden.« Er hob die Waffe, richtete sie jedoch zu Rhodas Entsetzen auf Mercy.
Rhoda warf sich über ihr Kind. »Nein! Du hast es versprochen!«
»Ich habe versprochen, euch rauszubringen. Aber nicht, dass ich dich am Leben lassen würde.« Er beugte sich vor und zog Rhoda von Mercy weg, als wäre sie ein Fliegengewicht.
Rhoda hatte einen ohrenbetäubenden Knall erwartet, doch stattdessen hörte sie nur ein leises Ploppen.
Schalldämpfer, dachte sie. Er hat das alles geplant. Es war nie seine Absicht, uns laufen zu lassen.
Mercys Körper wurde hochgerissen. Ein leuchtend roter Fleck breitete sich vorn auf ihrem Kleid aus.
»Nein.« Nein, nein, nein. Schluchzend streckte Rhoda die Hände nach ihrer Tochter aus, doch DJ hinderte sie daran, zu ihr zu gelangen. »Mercy! Bitte! Mercy! Mach die Augen auf. Bitte.«
Flatternd hoben sich Mercys Lider. Mama, formten ihre Lippen ohne einen Laut.
»Sag Mama schön ›Auf Wiedersehen‹«, höhnte DJ und drückte Rhoda den Pistolenlauf in den Magen.
Auch Rhodas Körper bäumte sich unter dem Schuss auf. Sie schrie, als der sengende Schmerz in ihren Eingeweiden explodierte. Wie war es möglich, dass kein Laut über Mercys Lippen drang?
Doch Mercy lag nur reglos da und sah sie an. Zumindest atmete sie. Sie lebt noch.
»Mercedes«, presste Rhoda hervor. »Finde Gideon. Gideon Reynolds.«
Mercy starrte sie nur weiter mit einer Mischung aus Verwirrung, Schmerz und stummem Entsetzen an.
»Halt den Mund, Rhoda«, schnauzte DJ. »Sie findet überhaupt niemanden. Weil sie hier sterben wird. So wie Gideon. Und wie du.«
Rhoda schüttelte entschieden den Kopf. »Selena. Ich heiße Selena. Nicht Rhoda. Nie wieder Rhoda.«
DJ zuckte die Achseln. »Von mir aus.« Er wollte sie hochreißen, doch ihre Knie gaben unter ihr nach.
»Dafür wird Ephraim dich umbringen«, krächzte sie.
DJ lachte nur. »Nein, das wird er nicht. Das tut er nie. Weil er es nämlich nicht kann.«
Das ergab keinerlei Sinn, doch Rhodas Verstand gehorchte ihr nicht länger, konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. »Wieso tust du das?«
»Weil ich es kann.« Er verstärkte den Griff um Rhodas Arm und schleifte sie zum Laster, wo er sie hochzerrte und zu sich heranzog. »Sieh her, Mercy.«
Er drückte den Lauf gegen ihre Schläfe. Der Moment war gekommen.
»Und jetzt sag du schön ›Auf Wiedersehen‹, Rhoda«, befahl er höhnisch.
»Selena«, presste sie hervor. »Wenn du mich schon tötest, hab wenigstens den Mumm, meinen Namen zu sagen. Selena Reynolds.«
Wieder lachte er nur. »Auf Wiedersehen, Rhoda.«
Sieh her, Mercy. Brother DJ hatte es von ihr verlangt, also hatte Mercy gehorcht, so wie man es ihr beigebracht hatte. Mama! Der Schrei war ihr im Hals stecken geblieben. Und ihre Mutter hatte nichts erwidert, weil sie tot war.
Tot.
Sie war neben dem Laster zusammengebrochen, mit einem klaffenden Loch in der Schläfe. Einen Moment lang hatte sie Mercy noch aus weit aufgerissenen Augen angesehen.
Tot.
Brother DJ hatte den Leichnam hochgehoben und über die Seitenwand auf die Ladefläche des Lasters geworfen – jener Ladefläche, auf der er ihre Mutter dreimal genommen hatte, seit sie in Eden aufgebrochen waren.
Eden, dem einzigen Zuhause, das Mercy kannte.
Ihre Mutter hatte noch nicht einmal protestiert. Es war die Bezahlung dafür, dass DJ sie fortgebracht hatte, so viel wusste Mercy. Ihre Mutter hatte es ihr nach jedem Halt gesagt. Am liebsten hätte Mercy erwidert, dass sie – ihre Tochter – es doch gar nicht wert sei, doch kein Laut war ihr über die Lippen gekommen.
DJ war nicht gerade sanft mit ihnen umgesprungen, aber immer noch besser als … er. Brother Ephraim.
Mein Ehemann. Allein das Wort ließ sie erschaudern. Und er war bereits auf dem Weg hierher. Das hatte Brother DJ behauptet. Umbringen würde er sie wahrscheinlich nicht, wenn er sie hier fand, doch sie würde sich wünschen, er täte es.
Sie wünschte sich ständig, dass er sie töten möge, doch er tat es nicht.
Brother DJ wischte sich die blutigen Hände an der Hose ab und trat auf sie zu. »Los, komm schon, Mercy.«
Sie sah ihn nur an, bekam keinen Ton heraus.
DJ packte ihren Arm und zog sie auf die Füße, doch ihre Knie waren schlaff wie verkochte Nudeln. Ihr ganzer Körper schien ein einziger Schmerz zu sein. Am schlimmsten war das Brennen in der Magengegend. Sie presste sich die Hand auf den Bauch, löste sie wieder und musterte sie wie betäubt. Sie war voller Blut. Ich blute. Weil er auf mich geschossen hat. Es war wie ein Traum. Nicht real. Aber genau so war es. Ihre Mutter war tot. Und ich blute.
»Fuck, jetzt du auch noch!«, stöhnte er.
Noch immer starrte sie ihn an. Sie hatte zwar das »F-Wort« aus Ephraims Mund gehört, doch er benutzte es nur, wenn er sehr wütend war. Niemals in so einem beiläufigen Tonfall wie Brother DJ.
Er begann, sie zum Laster zu zerren, und sie begriff, was er vorhatte.
Er wird auch mich töten. Er hatte nie die Absicht, uns laufen zu lassen.
Aber wieso hatte er sie dann den ganzen Weg hergefahren? Wo auch immer sie sein mochten. Redding Busbahnhof stand auf dem Schild. Sie wusste zwar, was ein Bus war, doch obwohl sie die Worte lesen konnte, ergaben sie keinen Sinn für sie.
Die Fahrt hatte sich über Stunden hingezogen. Wieso der ganze Aufwand, nur um uns am Ende beide zu töten? Er hätte jederzeit anhalten und sie einfach am Straßenrand abknallen können.
Er hat mit uns gespielt. Er hatte ihre Mutter glauben lassen, Mercy käme frei. Ihre Mutter war so voller Hoffnung gewesen … und nun war sie tot.
Mercy kniff die Augen zusammen, als gleißendes Licht sie blendete. Ein Wagen. Ein weiteres Auto befand sich auf dem Parkplatz, dessen Scheinwerfer nun direkt auf sie gerichtet waren.
»Fuck!«, fluchte Brother DJ noch einmal, hob die Waffe und zielte auf das Auto. Er gab einen Schuss ab und ließ Mercys Arm los, als Blaulicht auf dem Dach des Wagens zu rotieren begann. »Cops.«
Er fuhr herum und rannte zum Laster, wobei er einen weiteren Schuss auf Mercy abgab. Sämtliche Nervenenden in ihrem Bein schienen zu explodieren, als die Kugel in ihre Wade drang. Sie riss den Mund zum Schrei auf, doch auch jetzt drang kein Laut heraus.
Brother DJ sprang in den Laster und raste davon, mit einem letzten Schuss auf sie, der sie jedoch verfehlte und stattdessen in den Asphalt neben ihrem Kopf einschlug. Winzige Fetzen des Belags flogen wild umher und bohrten sich wie Nadelstiche in ihre Wange.
Und dann war es still, bis auf den Motor des Wagens, dessen Anblick Brother DJ in die Flucht geschlagen hatte.
Cops. Das bedeutete Polizeibeamte.
Polizisten waren etwas Schlimmes. Sie würden ihr wehtun, sie schlagen, ins Gefängnis stecken. Dafür sorgen, dass sie nie wieder die Sonne sah. Sollten sie dich jemals schnappen, sag kein Wort. Gib nichts zu. Erzähl keinem von der Gemeinschaft. Sprich den Namen »Eden« niemals laut aus.
Die Drohungen, die ihr die Lehrer in der Gemeinschaft so oft eingebläut hatten, wirbelten durch ihren Kopf wie ein Tornado, pumpten Adrenalin durch ihren Körper. Du musst abhauen. Sie musste weg von hier.
Sie stützte sich auf Hände und Knie und kroch los, aus dem Lichtkegel der Scheinwerfer heraus. In Richtung Grasnarbe. Zu den Medaillons, die DJ dort vergraben hatte.
Sie hasste das Medaillon. Doch sie brauchte es. Ohne fühlte sie sich … falsch. Und sie hasste die Erkenntnis, dass es so war.
Mama. Auch ihr Medaillon war in dem kleinen Erdloch vergraben.
Das Medaillon ihrer Mutter, deren Leiche auf der Ladefläche von DJs Laster lag.
Mama, die sie gerettet hatte.
Der Wagen hinter ihr stand bloß da. Niemand stieg aus. Niemand drohte ihr. Niemand versuchte, sie aufzuhalten. Also kroch sie weiter.
Endlich spürte sie Gras unter den Knien. Am liebsten hätte sie geweint. Sie hatte Schmerzen. Schlimme Schmerzen. Alles begann sich zu drehen, trotzdem kroch sie weiter.
Nur noch ein Stück. Ein kleines Stück. Und dann sah sie es, das kleine Rasenstück, das DJ herausgerissen hatte. Sie ließ sich fallen und wühlte mit bloßen Händen in der Erde, bis sich ihre Finger um das Medaillon schlossen, das Ephraim so oft als Waffe gegen sie eingesetzt hatte.
Sie zog es heraus, wühlte weiter, bis sie auch die zweite Kette gefunden hatte. Erde bedeckte die Medaillons, deshalb war die Gravur – zwei im Gebet kniende Kinder unter einem Olivenbaum, darüber die gespannten Flügel des Erzengels Uriel – nicht zu erkennen. Doch das war auch nicht nötig, denn das Bild war für immer in ihre Netzhaut eingebrannt. Genauso wie die Namensgravuren auf der Rückseite.
Miriam. Rhoda. Die Namen, die man ihnen in Eden gegeben hatte. Miriam war so gebräuchlich, dass ihre Mutter ihr einen Spitznamen gegeben hatte, Mercy, das Wort für Gnade. Im vergangenen Jahr war es ihr wie ein grausamer Scherz vorgekommen, denn die Gemeinschaft hatte keine Gnade gezeigt, weder ihr noch ihrer Mutter gegenüber. Doch nun ergab er einen Sinn. Weil ich Mercedes heiße.
Nicht Miriam. Sondern Mercedes. Und ihre Mutter hieß Selena.
Nur dass sie keine Mutter mehr hatte.
Tränen stiegen ihr in die Augen. Mama.
Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie tränenüberströmt dort gelegen hatte, doch als das Heulen der Sirene die Luft zerriss, war sie zu erschöpft, um sich zu bewegen.
Die Polizei kam, und sie konnte sich nicht bewegen.
»Miss?«
Mercy lag auf der Seite und versuchte, die Augen zu öffnen, doch sie war so müde, so unendlich müde. Ich muss schlafen.
Sie spürte, wie Hände sie berührten, sie auf den Rücken drehten. Lauf, schrie ihr Verstand, doch sie sah sich nicht imstande, aufzustehen. So müde. Lasst mich. Ich muss schlafen.
»Mist«, sagte ein Mann. »Sie wurde angeschossen. Eine Schusswunde im unteren Bauchraum. Eine zweite in der Wade.«
»Der Puls ist schwach.« Eine Frauenstimme. »Der Blutdruck sinkt. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen.« Eine Hand strich ihr übers Gesicht. »Es wird alles wieder gut, Schätzchen. Wir helfen dir.«
Mercy wollte ihnen so gern glauben. So sehr. Doch hier draußen halfen einem die Leute nicht, sondern logen und wollten einen dazu bringen, unvorsichtig zu werden. Und dann taten sie einem weh.
Aber Ephraim hat dir auch wehgetan. Und DJ genauso. Obwohl sie zur Gemeinschaft gehörten und sich eigentlich um sie kümmern sollten.
Was auch immer diese Leute mit ihr anstellten, es konnte nicht schlimmer sein als das, was ihr Ehemann ihr angetan hatte.
Und wenn sie sie töteten?
Sie hoffte es beinahe. Es wäre eine Erleichterung.
1. Kapitel
Sacramento, Kalifornien
Samstag, 15. April, 16.45 Uhr
Ich bin zurück. O Gott, ich bin wieder hier. Mercy Callahan holte tief Luft, in der Hoffnung, mit der Yoga-Atmung ihren Puls zu beruhigen. Wie konnte ich glauben, dass das eine gute Idee ist? Nein, es ist eine Schwachsinnsidee. Ich mache damit alles nur noch viel schlimmer.
»Hast du auf dem Flug auch nur eine Sekunde geschlafen?«
Die Stimme ihrer besten Freundin riss sie aus ihren Gedanken. Sie gingen die Fluggastbrücke entlang ins Terminal, wo es von Menschen nur so wimmelte. Zu viele Menschen. Mercy kämpfte gegen den Drang an, wegzulaufen. Zurück nach New Orleans zu flüchten. Wieder.
»Nein. Ich bin viel zu …« Aufgeregt. Verängstigt. Angespannter als eine Springfeder. »… einfach alles.«
Farrah gab einen mitfühlenden Laut von sich. »Ich weiß, Süße. Aber es wird alles gut gehen. Und falls nicht, bin immer noch ich da. Ich lasse dich nicht im Stich, und wenn es nötig ist, bringe ich dich zurück nach Hause.«
Nach Hause. Genau das war New Orleans für sie geworden. Ihr Zuhause. Wo die Menschen sie liebten. Sie respektierten. Und sie nicht bemitleideten. Zumindest bis vor sechs Wochen. Doch prangte das eigene Gesicht erst einmal auf den Titelblättern sämtlicher Zeitungen im Land, änderte sich alles schlagartig, und man stand im Mittelpunkt der allgemeinen Öffentlichkeit. Und schrie darüber hinaus die Schlagzeile auch noch lauthals AUS DEN FÄNGEN EINES SERIENMÖRDERS BEFREIT, spiegelte sich in den Blicken der Menschen eine Mischung aus Mutmaßung und Entsetzen wider, gepaart mit einer körperlichen Distanz, die, wie Mercy wusste, lediglich von der Angst herrührte, das Falsche zu sagen. Trotzdem blieb Distanz nun einmal Distanz.
Doch auch damit war sie klargekommen. Bis zu diesem verdammten CNN-Interview vor fünf Tagen. Eine der beiden anderen Überlebenden hatte sich in aller Ausgiebigkeit über das grauenvolle Erlebnis ausgelassen und sorgsam alle anderen Opfer erwähnt, damit deren Namen bloß nicht in Vergessenheit gerieten. Als könnte ich sie jemals vergessen. Natürlich hatte die Frau auch Mercy erwähnt, und natürlich hatte Mercy sich der Qual ausgesetzt und das Interview verfolgt.
Der Beitrag selbst war eigentlich nicht schlimm, sondern durchaus respektvoll gewesen, doch ihr Gesicht im Fernsehen zu sehen, kreidebleich und voller Angst … danach hatte sie kein Auge mehr zugetan, weder in dieser noch in den darauffolgenden Nächten. Sie fühlte sich, als wäre die ganze Welt ringsum auf sie eingestürzt. Alles war anders.
Und natürlich hatten ihre Kollegen das Interview gesehen, jeder Einzelne von ihnen. Sie hatten es ihr noch nicht einmal sagen müssen. Mercy hatte es an ihren Gesichtern abgelesen, und das Wissen hatte sie bis ins Mark erschüttert.
Sie war sich wie eine Fremde vorgekommen, dabei war New Orleans der erste Ort, der sich wie ein Zuhause angefühlt hatte. Was vor allem Farrah zu verdanken war, und ihre Freundin nun an ihrer Seite zu wissen, war das schönste Geschenk, das Mercy je bekommen hatte. Sollte sie sich entschließen, zurückzuflüchten, würde Farrah es ihr niemals vorhalten.
»Danke«, flüsterte sie.
Farrah stieß sie liebevoll mit der Schulter an. »Ein Schritt nach dem anderen, Liebes. Du weißt doch, wie es geht.«
Stimmt, das wusste sie. Damals, mit achtzehn Jahren, als sie Farrah kennengelernt und darum gekämpft hatte, sich ein eigenes Leben aufzubauen, war sie von der Vorstellung, einen ganzen Tag am Stück vor sich zu haben, hoffnungslos überfordert gewesen. Doch dann hatte sie gelernt, in kleinen Schritten zu denken, einen Atemzug nach dem anderen zu machen, immer weiter. Das war ihr Mantra geworden, das sie bis zum heutigen Tag brauchte, um bei klarem Verstand zu bleiben, vor allem nachts, wenn die Erinnerungen umherschlichen wie streunende Wölfe auf der Suche nach hilfloser Beute.
Oder auf Flügen zurück nach Sacramento. Dann lieber die Wölfe. Diese Stadt, dieser Bundesstaat, sie beide spielten häufig die Hauptrollen in ihren Albträumen.
»Ich weiß. Ein Schritt nach dem anderen.« Mercy rang sich ein Lächeln ab. »Du hast es mir gezeigt. Du und Mama Ro.«
Farrah Romeros Mutter war unglaublich. Eine Frau mit einem warmen, freundlichen Lächeln, die sich von keinem ins Bockshorn jagen ließ. Mercy wünschte, ihre eigene Mutter wäre ein wenig mehr wie Mama Ro gewesen. Gleichzeitig schämte sie sich zutiefst für diese Gedanken.
Mercys Mutter war auf ihre Art ebenfalls mutig gewesen, hatte – buchstäblich – ihr Leben für sie geopfert. Diese Albträume waren die allerschlimmsten.
»Holen wir zuerst dein Gepäck«, meinte Farrah, »dann den Mietwagen. Wenn wir etwas gegessen haben, richtest du dich erst mal ein, danach fahren wir zu deinem Bruder.«
Mercy musste gegen die Galle anschlucken, die in ihrer Kehle aufstieg, wann immer sie an ihren Bruder dachte. Gideon. Mit welcher Inbrunst sie ihn all die Jahre gehasst hatte.
Und wie falsch sie gelegen hatte. O Gott, ich bin so ein grauenhafter Mensch. Er würde sie hassen, und sollte er es nicht tun, konnte sie ihm nur dazu raten. Ihm und seinem besten Freund Rafe.
Sie hatte ihnen beiden schweres Unrecht getan. Schwindel erfasste sie, und ihr wurde bewusst, dass sie die ganze Zeit den Atem angehalten hatte. Und dass sie mitten im Terminal stehen geblieben war und andere Passagiere damit zwang, um sie herumzunavigieren, was sie missmutig taten. Und unhöflich bin ich auch noch. »Gott«, stöhnte sie, als zahllose kleine schwarze Punkte vor ihren Augen tanzten. Das hier war völliger Schwachsinn, doch sie sah sich außerstande, dem ein Ende zu bereiten.
»Es ist alles in Ordnung.« Mercy spürte Farrahs Hand auf ihrem Rücken, die beruhigende kleine Kreise beschrieb. Farrah ließ sich von den missbilligenden Blicken der anderen Reisenden nicht irritieren, sondern konzentrierte sich einzig und allein auf Mercy. »So ist es gut. Das ist eine Panikattacke. Du weißt, was du zu tun hast. Atmen ist gut. Ein und aus.«
Mercy blinzelte und rückte den Riemen der Katzentransporttasche gerade, der sich in ihre Schulter grub. Doch Mercy war dankbar dafür, denn der Schmerz half ihr, ihre Mitte wiederzufinden. Aber das würde sie keinem auf die Nase binden. Als sie das letzte Mal zugegeben hatte, dass Schmerz ihr half, sich zu konzentrieren, war sie prompt für zweiundsiebzig Stunden zur Beobachtung in der Psychiatrie gelandet. Was verdammt übel gewesen war. »Es ist okay. Es geht mir gut.«
Farrah lächelte – sie hatte das breiteste, strahlendste Lächeln, das man sich nur vorstellen konnte und das in Mercy unweigerlich den Wunsch weckte, es zu erwidern. Ihr Lächeln war Farrahs Superkraft. »Natürlich ist es okay«, meinte sie und tätschelte ihr ein letztes Mal den Rücken. »Also, gehen wir, damit wir etwas in den Magen kriegen.«
Mercy befahl ihren Füßen, sich in Bewegung zu setzen. Ein Schritt nach dem anderen. Zum Glück gehorchten sie, und so näherten sie und Farrah sich allmählich der Gepäckausgabe. »Als Erstes müssen wir uns um die Katzen kümmern. Ich fahre zur nächsten Zoohandlung und besorge Katzentoiletten. Und Futter.« Beim Wort »Futter« miaute Rory kläglich in der Tragetasche. »Still, du Bestie. Du wirst es schon noch eine Weile aushalten«, meinte Mercy und tätschelte die Außenseite der Tasche.
Farrah schnaubte. »Deine beiden können wohl ausnahmsweise eine Mahlzeit ausfallen lassen. Oder zehn.« Sie hob eine zweite Transporttasche, die sie in der Hand hielt, hoch. »Jack-Jack wiegt locker fünfunddreißig Kilo.«
Mercy lachte – es klang ungewohnt, aber gut. Farrah brachte sie immer wieder zum Lachen. »Nicht ganz so viel.« Ihre beiden Ragdoll-Katzen brachten jeweils gute acht Kilo auf die Waage. »Außerdem hat der Tierarzt gesagt, sie seien kerngesund. Nicht dick, sondern bloß ein wenig kernig.«
Farrah hob die Brauen. »Kernig. Das gefällt mir. Ich glaube, so bezeichne ich mich ab jetzt auch.«
Mercy runzelte die Stirn. »Hör sofort auf damit. Du bist kurvig und wunderschön. Ich wünschte, ich hätte auch solche Rundungen.« Farrah war ein sanfter Mensch, ihre gesamte Ausstrahlung lud förmlich dazu ein, sie zu umarmen. Sie bevorzugte klare, leuchtende Farben, die sich wie Edelsteine von ihrer dunklen Haut abhoben. Heute trug sie ein Outfit in strahlendem Gelb, wofür sie jede Menge anerkennende Blicke bekam.
Farrah stieß einen Seufzer aus, den sie um Mercys willen mit ein wenig zusätzlichem Drama unterlegte. »Nein, tust du nicht. Klamotten für eine weibliche Figur zu finden, ist echt schwer. Ich wünschte, ich wäre gertenschlank.«
Doch Mercy bemerkte das Funkeln in Farrahs Augen. »Nein, tust du nicht«, konterte sie. »Es gefällt dir, wie Captain Holmes deine Kurven ansieht.«
Farrah grinste. »Stimmt. Und ich entschuldige mich nicht dafür. Mein Liebster ist ganz wunderbar.«
»Das ist er, keine Frage.« Obwohl Captain André Holmes einem ziemlich den Schneid abkaufen konnte, wenn er in den Polizistenmodus verfiel, so war er ein freundlicher, witziger Typ, der Farrah wie einen kostbaren Schatz behandelte. Allein dafür hatte er Mercys volle Sympathie, obwohl sie sich in seiner Anwesenheit wie eine Zwergin vorkam. »Aber definitiv nicht mein Typ«, fügte sie hinzu, als Farrah sie belustigt ansah. »Er ist so … groß, findest du nicht?«
Farrah warf den Kopf in den Nacken und lachte schallend. »Das ist er, das stimmt allerdings. An allen relevanten Stellen … vor allem an einer.«
Mercy schoss die Röte ins Gesicht. Darauf hatte sie nicht angespielt, doch Farrah konnte durchaus ein derbes Mundwerk haben. »War er einverstanden, dass du alles stehen und liegen lässt, um mich zu begleiten?«, wechselte Mercy unvermittelt das Thema.
Sofort wurde Farrah wieder ernst und nickte. »Absolut. Du hast gesagt, dass du mich brauchst, und das hat ihm als Erklärung genügt. Dass wir im Haus eines Cops wohnen, war allerdings ein prima Zusatzargument, um ihn zu beruhigen.« Sie zuckte die Achseln. »Er macht sich nun mal Sorgen.«
Das Haus eines Cops. Beim Gedanken an besagten Cop zuckte Mercy zusammen. Detective Raphael Sokolov, Detective bei der Mordkommission und Gideons bester Freund. Ein Bruder im Herzen, wie Farrah für sie eine Schwester war.
Auch Rafe hasste sie wahrscheinlich. Und falls nicht, sollte er es tun. Oder würde es mit der Zeit tun, auch wenn sie egoistischerweise insgeheim hoffte, dass dem nicht so war. Ihre Erinnerung an ihn, als sie knapp zwei Wochen lang an seinem Bett gesessen hatte – an sein goldblondes Haar, sein lässiges Lächeln und seinen unerschütterlichen Optimismus trotz der brutalen Schmerzen –, war das einzig Positive in den sechs Wochen seit ihrer Rückkehr nach New Orleans gewesen, wenn sie sich nachts schlaflos und voller Angst im Bett herumgewälzt hatte. »Eines krankgeschriebenen Cops.« Weil er angeschossen wurde. Wegen mir. »Hast du deinem Captain das auch erzählt?«
Farrah schnitt eine Grimasse. »Na ja, nein. Aber er ist trotzdem Polizist, Mercy. Dass er sich gerade von einer Verletzung erholt, ändert nichts daran. Cop bleibt Cop. Polizisteninstinkte machen keinen Genesungsurlaub.« Sie kniff die Augen zusammen. »Er weiß doch, dass wir kommen, oder?«
Mercy öffnete den Mund und schloss ihn wieder.
Farrahs Miene verfinsterte sich. »Mercy? Er weiß, dass wir kommen, richtig?«
»Nein, er nicht, aber seine Schwester. Ich habe sie angerufen und gefragt, ob wir eine Weile bei ihr unterkommen können.«
»Okay.« Farrahs Züge glätteten sich, trotzdem blieb sie argwöhnisch. »Sasha, richtig?«
»Genau. In Rafes Haus gibt es drei Apartments. Da er die Stufen nicht hinaufkam, hat er das Erdgeschoss bewohnt, als ich zuletzt hier war.« Bevor ich wie der letzte Feigling abgehauen bin. »Die Kugel hat mehrere Muskeln in seinem Oberschenkel zerfetzt.« Allein beim Gedanken an die Schmerzen, die er erleiden musste, lief es Mercy eiskalt den Rücken hinunter, doch jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzugrübeln, sonst würden sie es nie mehr zur Gepäckausgabe schaffen. Atme. Ein und aus.Ganz ruhig und entspannt. Sie schluckte. »Das Apartment im Erdgeschoss gehört normalerweise Daisy«, fügte sie hinzu.
»Der Freundin deines Bruders«, bestätigte Farrah beiläufig, wenn auch stets mit einer gewissen Vorsicht, als hätte sie Angst, Mercy könnte bei seiner Erwähnung kehrtmachen und die Flucht ergreifen. Oder ohnmächtig zusammenbrechen.
Und gerade lag beides durchaus im Bereich des Möglichen.
»Genau. Ich mag Daisy. Sie ist so kreativ und lustig.« Doch auch sie hatte schwere Zeiten durchlebt, und Mercy empfand eine Verbundenheit mit ihr, die sie gern genauer beleuchtet hätte. Jetzt hast du die Gelegenheit dafür, Callahan. Du bist zurück. Kannst alles tun, was du vor sechs Wochen gern getan hättest.
Beispielsweise ein offenes, ehrliches Gespräch mit Gideon führen. Und ihn dabei um Verzeihung bitten.
Gideon liebt dich. Das weißt du genau. Trotzdem gab es eine Menge, was er ihr vergeben müsste. Sie würde es ihm nicht übel nehmen, wenn er sich nicht dazu durchringen könnte. Trotzdem musste sie auch in diesem Punkt Wiedergutmachung leisten.
»Daisy, das ist so ein süßer Name. Ich kann es kaum erwarten, sie persönlich kennenzulernen«, erklärte Farrah voller Wärme. »Aber wenn Rafe in Daisys Wohnung gezogen ist, wo wohnt sie dann?«
»Oben. Sie haben einfach getauscht. Rafes Schwester Sasha wohnt auf der mittleren Etage.«
»Und dort wohnen wir dann auch?«
»Ja, zumindest für ein paar Tage.« Sie tätschelte Rorys Tragetasche. »Bis ich ein Hotel finde, das Zimmer längerfristig vermietet und wo auch Katzen erlaubt sind.«
Farrah musterte sie. »Längerfristig? Wie lange ist ›längerfristig‹?«
Mercy biss sich auf die Lippe. »Das weiß ich noch nicht. Ich habe … einige Zeit frei.«
»Und wie lange genau?«
»Zwei Monate«, antwortete Mercy und wappnete sich innerlich für Farrahs Reaktion.
Farrah blieb abrupt stehen und starrte Mercy ungläubig an. »Zwei Monate? Aber wie geht denn das?« Sie nahm Mercy am Arm und zog sie beiseite, damit sie den anderen Reisenden nicht im Weg standen. »Wie hast du es geschafft, zwei Monate Urlaub zu bekommen?«
Atme. Ein und aus. Ganz locker und entspannt. »Es ist kein herkömmlicher Urlaub. Ich bin freigestellt. Aus persönlichen Gründen.« Und ich kann froh sein, dass es nur das ist, sagte sie sich zum hundertsten Mal.
»Ich erinnere mich nicht, dass du etwas von einem Antrag auf Freistellung erwähnt hast.« Besorgnis zeichnete sich in Farrahs braunen Augen ab.
»Ich habe auch keine beantragt.« Mercy ließ sich gegen die Wand sinken und schloss die Augen. »Ich habe Mist gebaut. Bei der Arbeit.«
»Ach, Süße«, murmelte Farrah. »Was ist denn passiert?«
»Es war am Montagabend nach dem CNN-Interview. Ich war mit dem Kopf nicht bei der Sache und habe zwei Proben verwechselt.«
Farrahs scharfer Atemzug sagte alles, was Mercy selbst nicht aussprach. Proben zu verwechseln, war in ihrem Job eine Katastrophe. Eine große. Sie hielt die Zukunft von Menschen in ihren Händen, denn es waren ihre DNA-Analysen, die über Schuld oder Unschuld von Verdächtigen entschieden. Ich hätte das Leben eines Unschuldigen zerstören können.
»Aber ich habe es gleich nach der zweiten Probe gemerkt und konnte die Analyse der ersten noch korrigieren, bevor der Staatsanwalt sie für die Anklageerhebung verwendet hat«, fügte sie hinzu. »Ich habe sofort meinen Vorgesetzten informiert, der mich daraufhin zu einem Gespräch mit ihm und seinem Vorgesetzten am Donnerstag gebeten hat. Ich dachte, ich werde gefeuert.«
Mercy schlug die Augen wieder auf und sah Farrahs mitfühlenden, besorgten Blick auf sich ruhen. »Ich kann von Glück sagen, dass es mein erster Fehler war und ich gleich mit der Sprache herausgerückt bin. Sie meinten, ich hätte in letzter Zeit unter großem Druck gestanden, und sie wünschten, sie hätten mich direkt nach meiner Rückkehr aus Sacramento ermutigt, eine Auszeit zu nehmen.« Als sie vor Gideon – und vor Rafe – geflohen war, um hübsch den Kopf in den Sand zu stecken. »Aber es sei nicht möglich gewesen.«
»Nur wenn eine Auswirkung auf deine Arbeit nachweisbar gewesen wäre.«
»Was dann ja passiert ist.«
»Natürlich ist es passiert«, warf Farrah mit einer Schärfe ein, die Mercy zusammenzucken ließ. »Du wurdest von einem durchgeknallten Serienmörder entführt, Mercy. Und wärst fast ums Leben gekommen.«
Die mitfühlenden Tränen in Farrahs Augen waren Grund genug für Mercy, ihr den barschen Tonfall nicht zu verübeln. »Aber dazu kam es ja nicht. Ich bin hier, und es geht mir gut.«
»Nein, es geht dir überhaupt nicht gut, du stures Ding.« Mit zitternden Fingern fuhr Farrah sich über das kurz geschnittene Haar, das ihr hübsches Gesicht perfekt umrahmte. »Nur weil du körperlich unversehrt geblieben bist, heißt das noch lange nicht, dass es dir gut geht. Außerdem wurde Detective Sokolov schwer verletzt und wäre ebenfalls beinahe umgekommen. Das Ganze war ein traumatisches Erlebnis.« Sie presste sich die Finger auf die Lippen und rang um Fassung. »Ich hätte dich fast verloren«, flüsterte sie bestürzt.
Mercy wollte nicht darüber nachdenken. Nicht jetzt. Denn wenn sie sich erlaubte, sich diese Höllenqualen ins Gedächtnis zu rufen, machte sie womöglich jetzt und hier kehrt und nahm die nächste Maschine, die sie aus Sacramento wegbrachte. »Ich dachte, wenn ich mich in die Arbeit stürze und alles so mache wie sonst, schaffe ich es irgendwie. So hat es auch schon früher funktioniert.«
»Das hat es, weil du gleichzeitig eine Therapie angefangen hast.« Farrahs Stimme war wieder ruhig und beherrscht. Beschwichtigend.
»Und das muss ich auch weiterhin tun«, gestand Mercy. »Meine Vorgesetzten meinten, niemand werfe mir meinen Fehler vor, und sie wollten unbedingt, dass ich zurückkomme, aber nur, wenn ein Therapeut offiziell meinen tadellosen Geisteszustand attestiert.«
Farrah drückte ihren Arm. »Und ist das okay für dich?«
Mercy zuckte die Achseln. »Muss es wohl. Es ist ja nur vernünftig. Außerdem liebe ich meine Arbeit, und sie waren wirklich nett zu mir. Ich glaube, ich selbst war wohl am strengsten mit mir.«
»Is nich’ wahr, oder?«, konterte Farrah mit gedehntem Südstaatenakzent.
Mercy grinste. »Isses nich’.«
»Und du bist ein verlogenes Lügengesicht, das total fies lügt.«
Mercy lachte prustend. »Du warst wieder mal Babysitten bei deinen Neffen, stimmt’s?«
»Stimmt.« Farrah stellte die Katzentransporttasche auf den Boden und schloss Mercy fest in die Arme. »Das hat dich ziemlich aufgerüttelt, was?«
Und wie. Mercy nickte niedergeschlagen. »Ja. Mir ist klar geworden, dass ich damit einen unschuldigen Mann ins Gefängnis hätte bringen können, und … ich hatte mich einfach nicht mehr im Griff und musste mit der Sprache rausrücken.«
»Natürlich. Du bist ein sehr anständiger Mensch, Mercy Callahan.«
In dem Punkt war Mercy sich nicht ganz so sicher. Sie hatte einige ziemlich schlimme Dinge getan. Aber jetzt bist du hier, um dich zu entschuldigen und Wiedergutmachung zu leisten, dachte sie. Deshalb widersprach sie auch nicht. »Als meine Chefs mich für zwei Monate freigestellt haben, habe ich den Entschluss gefasst, mich endlich dem zu stellen, was in Kalifornien passiert ist.«
Farrah löste sich von ihr und sah sie argwöhnisch an. »In Kalifornien? Du meinst, hier in Sacramento? Oder …«
Farrah wusste von Mercys Vergangenheit in Kalifornien – sowohl von dem lebensgefährlichen Vorfall in Sacramento im Februar als auch von ihrer Kindheit, die sie im nördlichsten Zipfel des Bundesstaats zugebracht hatte. Farrah war die Einzige, die Mercys Lebensgeschichte kannte, mit Ausnahme des jüngsten Details, das Mercy völlig aus der Bahn geworfen und veranlasst hatte, zurück nach New Orleans zu fliehen, nach Hause. Dieses Detail hatte Mercy bisher niemandem erzählt, und wenn sie ehrlich zu sich war, hatte sie es selbst noch nicht richtig verarbeitet.
Es gibt etwas, das du über Gideon wissen musst.
O Mama, warum hast du nicht schneller gesprochen? Wieso hast du es mir nicht gesagt, bevor es zu spät war? Denn mittlerweile kannte Mercy die Wahrheit, und diese Wahrheit hatte alles auf den Kopf gestellt, was sie bis dahin zu wissen geglaubt hatte.
»Oder …«, flüsterte Mercy. Sie wollte – konnte – den Namen nicht laut aussprechen, der sie Tag und Nacht verfolgte, ihr schlimmster Albtraum.
Eden. Die Sekte, in der DJ Belmont aufgewachsen war, der Mörder ihrer Mutter. Die Sekte, in der Ephraim Burton als großer Held gegolten hatte, der Mann … der mir wehgetan hat. Wieder und wieder und wieder.
Farrah war schmerzlich bewusst, was Mercy nicht laut ausgesprochen hatte. Mit hängenden Schultern stand sie da. »Oh, Süße. Aber warum gerade jetzt, nach all den Jahren? Was hat sich geändert?«
Das war die große Frage. Dreizehn Jahre waren seit ihrer Flucht aus Eden vergangen. Jahre, in denen sie mithilfe einer Therapie die grauenhaften Erlebnisse zu vergessen versucht hatte. Nun ja, nicht vergessen. Niemand konnte sexuellen Missbrauch vollständig vergessen. Zumindest hatte sie gelernt, mit ihren Erinnerungen zu leben und sie in einen angemessenen Winkel in ihrem Gedächtnis zu verbannen. All das war ihr gut gelungen.
Bis sie nach Sacramento gereist war. Bis sie Gideon wiedergesehen und die Wahrheit erfahren hatte.
»Gideon«, murmelte sie. »Er hat alles verändert. Ich muss ihn sehen, muss ihm sagen, dass es mir leidtut.«
Farrah runzelte die Stirn. »Was leidtut?«
»Dass ich ihn all die Jahre so sehr gehasst habe.«
»Aber Mercy, Schatz, darüber haben wir doch so oft gesprochen. Er hat dich an diesem grauenvollen Ort zurückgelassen. Er hat seinen Lehrherrn getötet und ist abgehauen, weil er nicht arbeiten wollte. Und du und deine Mutter, ihr seid geblieben und musstet die Konsequenzen seines Verhaltens tragen, die brutal waren. Es ist doch völlig normal, dass du eine Abneigung gegen ihn hegst.«
Das Problem war nur, dass nichts davon stimmte. Stattdessen war es eine infame Lüge, verbreitet von Männern, die sie all die Jahre als ihren Besitz betrachtet hatten. Warum habe ich nie etwas hinterfragt? Sondern diese lächerliche Geschichte einfach geglaubt? Wieso hat Mama zugelassen, dass ich das tue? Ein Schluchzen stieg in ihrer Kehle auf, das sie rasch unterdrückte. »Er war doch erst dreizehn.«
Farrah legte die Hand um Mercys Wange. »Ich weiß. Er war ein Junge und hatte Angst. Wahrscheinlich war ihm nicht klar, welchen Qualen du und deine Mutter ausgesetzt sein würdet.«
Mercy schüttelte den Kopf. »Nein, du verstehst nicht. Ich habe bei meinem letzten Besuch etwas herausgefunden. Warum Gideon geflohen ist. Er ist nicht einfach bloß weggelaufen.«
Farrahs Augen weiteten sich. »Was? Und wie ist ihm die Flucht gelungen?«
Mercy dachte an ihre Mutter, an jene letzten Minuten ihres Lebens. »Mama hat gesagt, ich soll ihn suchen. Direkt bevor sie …« Ermordet wurde. Auch diese Worte wollten nicht über Mercys Lippen kommen. Weil es meine Schuld war. Ihre Mutter hatte sich geopfert. Für mich. »Im ersten Moment war ich schockiert, weil ich die ganze Zeit dachte, er sei tot. Nur dann hat Mama gesagt, er sei geflüchtet und noch am Leben. Und dass er mir helfen würde. Aber ich bin wütend geworden und habe ihr widersprochen, er sei selbstsüchtig und faul gewesen. ›Es gibt etwas, das du über Gideon wissen musst‹, hatte sie gesagt. Und jetzt weiß ich, was es war.«
Farrah wartete geduldig, als stünden sie nicht gerade mitten in einem überfüllten Flughafenterminal.
Wieder schluckte Mercy. »Sie haben ihm wehgetan. Haben ihn geschlagen und beinahe getötet.«
»O Gott«, flüsterte Farrah entsetzt. »Aber warum denn? Weil er seinen Lehrherrn getötet hat?«
»Das hat er getan, aber nur aus Notwehr, als einer der Männer versucht hat …« Sag es. Hör endlich auf, so ein Feigling zu sein. Sag. Es. »Er hat versucht, ihn zu vergewaltigen. Gideon hat ihn in Notwehr getötet, und die anderen Männer aus der Gemeinschaft haben ihn deswegen halb totgeprügelt. Er konnte nicht mehr gehen, nichts mehr sehen, war kaum noch bei Bewusstsein.«
Farrah starrte sie erschüttert an. »Und wie ist er entkommen?«
»Mama.«
»Oh«, hauchte Farrah. »Jetzt begreife ich. Deine Mutter hat ihn rausgeschmuggelt, ja? So wie dich später.«
Mercy nickte. »Aber sie hat ihn an einem Busbahnhof zurückgelassen, mutterseelenallein, in der Hoffnung, dass jemand ihn findet. Sie musste es tun, musste … dorthin zurück …« Nach Eden. »Wegen mir.«
»Um dich zu beschützen. Oh, Mercy, es tut mir so leid.«
Mercy blinzelte hektisch. Nein, sie würde nicht weinen. Nicht hier. »Ich wusste es ja nicht, sondern habe ihn all die Jahre gehasst. Für etwas, das er gar nicht getan hat.«
»Er wird dir vergeben. Das weiß ich.«
»Das hat er schon.« Zumindest in diesem Punkt. »Ich fürchte, ich selbst habe mir nur noch nicht vergeben.«
»Nein, is nich’ wahr, oder?« Wieder schlug Farrah den gedehnten Südstaatenakzent an.
Zu ihrer eigenen Verblüffung entfuhr Mercy ein leises Lachen. »Doch, isses. Das isses.«
Farrah zog sie abermals in eine feste Umarmung. »Wir kriegen das hin. Du und ich gemeinsam. Ich lasse dich nicht allein.«
Mercy bekam beinahe keine Luft mehr, trotzdem wollte sie sich nicht von ihr lösen. So fühlte sich Liebe an, Sicherheit. Akzeptiert zu werden. »Du bleibst also die vollen zwei Monate?«, fragte sie leichthin, hielt Farrah jedoch weiter fest umklammert.
»Ich bleibe, bis ich sicher bin, dass es dir gut geht. Ich habe ein bisschen Zeit und muss nicht gleich an die Uni zurück, und wenn ich Sehnsucht nach meinem Captain kriege, kann er sich ja in ein Flugzeug schwingen, verdammt noch mal. Du hast es verdient, Mercy.«
»Ich liebe dich, Ro«, platzte Mercy heraus und erschrak im selben Moment. Sie hatte diese Worte so oft aus Farrahs Mund gehört, war selbst jedoch nie imstande gewesen, sie auszusprechen. »Das hätte ich dir schon vor Jahren sagen sollen. Du bist die Schwester, die ich nie hatte, und deine Familie ist meine Familie.«
Überrascht blinzelnd löste Farrah sich, ehe sich ihre Augen neuerlich mit Tränen füllten, nur dass es diesmal Tränen der Rührung und der Freude waren. »Oh, Süße, ich liebe dich auch.« Sie straffte die Schultern und schnappte sich die Katzentasche. »Und jetzt lass uns das Gepäck holen, bevor sich meine Wimperntusche vollends verabschiedet.«
Mercy zwang sich, ihre Füße in Bewegung zu setzen. Ein Schritt nach dem anderen. Ein Atemzug nach dem anderen. Du schaffst das. Sei tapfer. Wenigstens blieben ihr noch ein paar Stunden, um sich zu fangen und zu stabilisieren, ehe sie ihrem Bruder oder einem der Sokolovs begegnete.
»Sieh doch!« Farrah deutete auf die Leute, die am Ende der Rolltreppe bei der Gepäckausgabe warteten. Leute mit Schildern.
Genauer gesagt Sasha Sokolov, die ein Schild mit dem Namen CALLAHAN in der Hand hielt, jeder Buchstabe in einer anderen Farbe. Typisch Sasha.
Sie war groß wie ihr Bruder, blond wie ihr Bruder, mit dunkelbraunen Augen, in denen dieselbe tiefe innere Freude glomm, um die Mercy sie beneidete. Genau wie bei ihrem Bruder.
»Das ist Sasha, nehme ich an?«, fragte Farrah.
Nervös ließ Mercy den Blick über die Menge schweifen, doch Rafe begleitete seine Schwester offenbar nicht. Trotz der Enttäuschung, die ihr wie ein Bleigewicht im Magen lag, war ihr gleichzeitig beinahe schwindlig vor Erleichterung. Weshalb sollte er sie auch abholen kommen? Schließlich war sie ohne ein Wort des Abschieds abgehauen. »Stimmt. Ich … ich wusste nicht, dass sie uns abholt. Ich habe ihr noch nicht mal die Flugnummer durchgegeben.«
Weil sie nicht gewollt hatte, dass Sasha zum Flughafen kam. Sie hatte niemanden sehen wollen, weil sie Zeit brauchte, um sich innerlich auf die schwierigen Gespräche vorzubereiten, die ihr bevorstanden.
»Mercy!«, rief Sasha und schwenkte ihr Regenbogenschild. »Hier drüben!« In ihrer gewohnten Ungeduld stürmte Sasha los, wobei sie um die ankommenden Reisenden herumnavigierte wie ein Footballspieler auf dem Weg zum gegnerischen Tor.
Farrah lachte. »Ich sehe schon, das wird ein Riesenspaß.«
Mercy hatte sich gerade für den Aufprall gewappnet, als Sasha sie auch schon in eine stürmische Umarmung riss und vom Boden hob. »Ich freue mich ja so, dich zu sehen«, raunte sie Mercy ins Ohr, ehe sie von ihr abließ und Farrah die Hand hinstreckte. »Ich bin Sasha.«
Ohne die Hand zu beachten, zog Farrah sie in ihre Arme und drückte sie fest an sich, was Sasha mit einem beglückten Glucksen quittierte. »Ich bin Farrah. Danke fürs Abholen.«
Sasha löste sich und warf Mercy einen gespielt finsteren Blick zu. »Einfach war es nicht. Ich bin schon seit Stunden hier und passe jede Maschine ab, die direkt oder mit Zwischenstopp aus New Orleans angekommen sein könnte.«
»Tut mir leid«, murmelte Mercy.
Sasha winkte ab. »Schon gut. Aber jetzt stell uns doch bitte anständig vor, Mercy.«
»Sasha, das ist meine beste Freundin, Dr. Farrah Romero. Farrah, Sasha Sokolov.«
Sasha zog ihre perfekt gezupften Brauen hoch. »Doktor?«
»Ich bin Biophysikerin«, erklärte Farrah. »An der Uni.«
Sasha nickte. »Cool. Meine kleine Schwester Zoya würde sich bestimmt gern mit dir unterhalten, wenn das okay ist. Sie will Ärztin werden. Na ja, sie ist erst siebzehn, aber …«
Farrah lächelte. »Gern.«
»Wunderbar.« Sasha schüttelte den Kopf. »Aber wo bleiben nur meine Manieren?« Sie nahm eine Katzentasche in jede Hand und stieß einen leisen Pfiff aus. »Heiliger Strohsack, Mercy, wie viele Stubentiger hast du denn da drin? Oder sitzen sie auf Ziegelsteinen?«
Farrah nickte. »Genau. Das sind echte Ungeheuer.«
Mercy zwang sich zu einem Lächeln, denn sie spürte bereits, wie die Angst wieder in ihr hochkroch. Viel zu viele Leute hier. Und viel zu laut.
»Hey«, murmelte Farrah, die ihre Anspannung spürte. »Wieso setzt du dich nicht einfach irgendwo hin, während ich unser Gepäck hole?«
Mercy schüttelte den Kopf. »Nein, ich besorge solange den Mietwagen. Wir treffen uns dann draußen.«
»Ihr braucht keinen Mietwagen«, warf Sasha ein. »Ich bin mit dem SUV meines Vaters hier, den ihr haben könnt, solange ihr hier seid. Seit er seinen Tesla hat, fährt er nicht mehr damit.«
Einen Tesla?, formte Farrah lautlos mit dem Mund.
»Karl ist Inhaber einer erfolgreichen Marketingagentur«, erklärte Mercy, ehe sie sich wieder an Sasha wandte. »Aber das ist wirklich nicht nötig.«
Sasha bedachte sie mit einem sehr langen Blick. »Doch, ist es. Gideon gehört zur Familie. Du bist Gideons Schwester. Also gehörst du auch zur Familie, und in unserer Familie fährt der Besuch keinen Mietwagen.«
»Ich werde aber eine ganze Weile hier sein«, sagte Mercy im verzweifelten Versuch, dem Tsunami namens Sasha Sokolov irgendetwas entgegenzusetzen.
»Noch besser«, entgegnete Sasha. »Außerdem war ich heute Morgen in der Zoohandlung und habe Katzenfutter, Streu und eine Katzentoilette besorgt. Sogar ein paar Spielsachen. Sobald wir euer Gepäck haben, können wir direkt zu mir fahren, und du kannst dich ein bisschen ausruhen.« Und damit machte sie kehrt und stapfte in Richtung Gepäckband, mit den beiden Transporttaschen in den Händen, als wären sie federleicht.
»Wow«, stieß Farrah bewundernd hervor. »Ich bin schwer beeindruckt. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, so über dich herzufallen, und sie hat es schon nach wenigen Wochen drauf. Sind die hier alle so?«
Mercy seufzte. »Ja, und die Familie ist wirklich groß.« Eine große, ausgelassene, aufdringliche, ungestüme Bande, die einander alle heiß und innig liebten. Und Gideon ebenfalls. »Es sind acht Kinder, und Mrs Sokolov ist genauso eine Naturgewalt wie Mama Ro.«
Auch Irina Sokolov hatte Mercys Schutzwälle einfach niedergemäht und sie bemuttert, als wäre sie eine von ihnen. Im ersten Moment hatte Mercy sich dagegen gesträubt und lieber ganz allein an Rafes Krankenbett gesessen, doch das hatte Irina nicht zugelassen. Ohne beiderseitiges Zutun hatte sich eine Bindung zwischen ihnen entwickelt, und am Ende ihres Aufenthalts hatte Mercy die ältere Frau ins Herz geschlossen und vermisste ihre klugen Ratschläge, seit sie zurück nach New Orleans geflüchtet war. Ich freue mich, sie wiederzusehen.
»Und Sashas Bruder?«, fragte Farrah mit scheinbarer Arglosigkeit. »Ist er auch so eine Naturgewalt?«
Mercy ging nicht auf die Anspielung ein, sondern erwog die Frage ernsthaft. »Nein. Rafe hat eine innere Ruhe, die der restlichen Familie allem Anschein nach fehlt.« Anfangs hatte sie geglaubt, es liege daran, dass er verletzt war und Schmerzen hatte, doch sie hatte sehr schnell gemerkt, dass diese Ruhe tief aus seinem Inneren zu kommen schien, er sie jedoch vor seiner Familie verbarg. Sie hatte ihn nie nach den Gründen gefragt und war nicht sicher, ob sie sie wirklich erfahren wollte, weil es die Nähe zwischen ihnen untermauern würde, die Rafe sich gewünscht, sie selbst jedoch in panische Angst versetzt hatte. »Zumindest habe ich es in den zwei Wochen, die ich hier war, nicht erlebt.«
»Ich kann es kaum erwarten, sie alle kennenzulernen«, sagte Farrah. »Ich helfe Sasha mit dem Gepäck. Wieso gehst du nicht in den Waschraum und machst dich frisch? Dort ist es ein bisschen ruhiger. Wir warten da drüben an der Tür auf dich.«
Mercy nickte dankbar. »Mache ich. Danke.« Sie hielt inne und sah zu, wie Farrah und Sasha am Gepäckband standen. Farrah sagte irgendetwas, woraufhin Sasha den Kopf in den Nacken warf und lauthals lachte – dabei sah sie ihrem Bruder so unglaublich ähnlich, dass sich Mercys Herz zusammenzog.
Auch Rafe hatte so gelacht. Nicht oft – die Schmerzen waren zu schlimm gewesen –, doch ein- oder zweimal war er auf eine ironische Bemerkung von ihr in haltloses Gelächter ausgebrochen, fröhlich und unbeschwert. Golden. Wunderschön. Und tabu für jemanden wie mich.
Doch an ihrem letzten Tag war er plötzlich ernst geworden und hatte sie gemustert, als sehe er sie zum ersten Mal. Bleib, hatte er gesagt. Lass uns herausfinden, wie es weitergeht. Bitte. Und dann hatte er sie geküsst und mit diesem Kuss alles zerstört, was sie all die Jahre über sich und ihre Wünsche zu wissen glaubte.
Das war der Grund, weshalb sie die Flucht ergriffen hatte … der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Dieser Furcht einflößende, wunderschöne, unglaubliche Kuss. Rafe dürfte stocksauer auf mich sein. Bestimmt will er mich noch nicht einmal wiedersehen. Vielleicht sollte sie sich lieber gleich ein Hotel suchen, jetzt sofort.
Vielleicht sollte sie aber auch endlich erwachsen werden und aufhören, sich wie ein verängstigtes Kind zu benehmen. Sie wandte sich um und steuerte den nächsten Waschraum an, wobei sie darum rang, die Schmetterlinge in ihrem Bauch zu besänftigen, die sich in einen Schwarm zorniger Bienen verwandelt hatten.
Sacramento, Kalifornien
Samstag, 15. April, 17.00 Uhr
Endlich