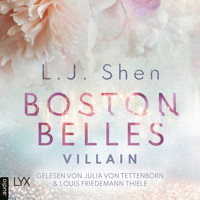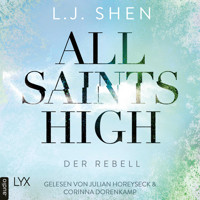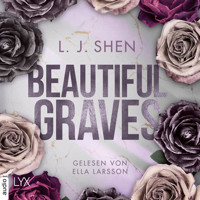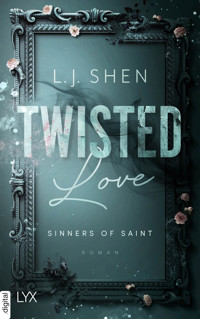
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sinners of Saint
- Sprache: Deutsch
Vor elf Jahren brach Dean Rosie das Herz. Doch für eine zweite Chance ist es jetzt vielleicht zu spät ...
Rosie LeBlanc war ein Teenager, als sie Dean Cole zum ersten Mal begegnete. Es war Liebe auf den ersten Blick. Doch Dean brach ihr Herz, als er sich nicht für sie, sondern für eine andere entschied. Nach elf Jahren stehen sich die beiden nun erneut gegenüber. So viel hat sich verändert zwischen ihnen, so viel ist geschehen. Doch ein Blick in Deans Augen genügt, und die Sehnsucht und das Verlangen sind wieder da, viel stärker noch als damals. Dean ist fest entschlossen, Rosie davon zu überzeugen, dass er seinen Fehler bereut und dass sie zu ihm gehört - für immer. Was er nicht weiß: Rosie ist krank. Sehr krank. Und für eine zweite Chance könnte es schon zu spät sein ...
Band 2 der Spiegel-Bestseller-Reihe!
"Wenn ihr Vicious geliebt habt, wird Dean Cole euch zerstören - und ihr werdet jede Minute davon genießen!" Chatterbooks Book Blog
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Soundtrack
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von L. J. Shen bei LYX
Impressum
L. J. SHEN
TWISTED LOVE
Sinners of Saint
Roman
Ins Deutsche übertragen vonPatricia Woitynek
ZU DIESEM BUCH
Rosie LeBlanc war ein Teenager, als sie Dean Cole zum ersten Mal begegnete. Es war Liebe auf den ersten Blick. Doch Dean brach ihr Herz, als er sich nicht für sie, sondern für ihre große Schwester Emilia entschied. Seitdem hat Rosie ihn aus ihren Gedanken verbannt … bis jetzt. Denn als Emilia und Deans bester Freund Vicious sich verloben, kann Rosie Dean nicht länger ignorieren – genauso wenig wie das Verlangen, das seine Gegenwart auch elf Jahre später noch in ihr hervorruft. Nach außen hin ist Dean der perfekte Geschäftsmann, der perfekte Liebhaber, der perfekte Sohn. Doch Rosie spürt, dass er tief in seinem Inneren mit Dämonen kämpft, von denen niemand etwas ahnt. Je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto stärker gerät ihr Entschluss ins Wanken, niemals etwas mit Dean anzufangen. Dabei gibt es genug Gründe, die dagegen sprechen: Nicht nur ist er der Exfreund ihrer Schwester. Eine Beziehung ist auch das Letzte, was Rosie jetzt gebrauchen kann. Denn sie ist krank. Schwer krank. Und auch, wenn Dean fest entschlossen ist, sie davon zu überzeugen, dass er seinen Fehler von damals bereut und sie zu ihm gehört – für eine zweite Chance könnte es bereits zu spät sein …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Für Kristina Lindsey und Sher Mason
SOUNDTRACK
»Hold Me Down« – Halsey
»Guys My Age« – Hey Violet
»Drops of Jupiter« – Train
»Immortals« – Fall Out Boy
»Mad About You« – Hooverphonic
»Breathe Me« – Sia
PROLOG
ROSIE
Bevor ich beginne, sollte ich vermutlich eines klarstellen: Meine Geschichte nimmt kein glückliches Ende. Sie kann und wird keines haben. Ganz egal, wie stattlich und attraktiv oder reich und faszinierend mein Märchenprinz auch sein mag.
Und er besaß alle diese Eigenschaften. Oh ja, und noch so viele mehr.
Das Problem war nur, dass er nicht wirklich der meine war. Er gehörte meiner Schwester. Allerdings gibt es da etwas, das ihr wissen solltet, bevor ihr mich verurteilt.
Ich habe ihn als Erste gesehen. Ihn als Erste begehrt. Ihn als Erste geliebt.
Das alles spielte keine Rolle, als Dean »Ruckus« Cole meine Schwester an dem Tag, an dem Vicious ihren Spind aufbrach, vor meinen Augen küsste.
Das Dumme an solchen Situationen ist, dass man nie wissen kann, ob sie einen Anfang oder ein Ende symbolisieren. Der Fluss des Lebens gerät ins Stocken, und man ist gezwungen, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Und die Realität ist zum Kotzen. Glaubt mir, das weiß ich aus eigener bitterer Erfahrung.
Das Leben ist nun mal nicht fair.
Das erklärte mein Vater ohne Umschweife, als ich nach meinem sechzehnten Geburtstag anfangen wollte, mit Jungs auszugehen. »Kommt gar nicht infrage!«, lautete seine entschiedene Antwort.
»Warum nicht?« Mein Augenlid zuckte, so verärgert war ich. »Millie durfte das auch ab sechzehn.« Es war die Wahrheit. Als wir noch in Virginia lebten, hatte sie vier Dates mit Eric, dem Sohn unseres Postboten, gehabt. Mein Vater stieß ein Schnauben aus und drohte mir mit dem Finger. Netter Versuch.
»Du bist nicht wie deine Schwester.«
»Was soll das heißen?«
»Das weißt du ganz genau.«
»Nein, weiß ich nicht.« Klar wusste ich es.
»Das heißt, dass du etwas an dir hast, das ihr fehlt. Das ist nicht gerecht, aber das Leben ist nun mal nicht fair.«
Es gab da noch etwas, das ich nicht widerlegen konnte. Mein Vater sagte, ich zöge die falsche Art von Jungen an, aber das war, als würde man einen mit Nägeln gespickten Erdklumpen mit Zuckerguss überziehen. Ich verstand, was er mir untergründig zum Vorwurf machte, vor allem, da ich immer seine kleine Prinzessin gewesen war. Sein Rosie-Mäuschen. Sein Augenstern.
Ich zog die Blicke auf mich. Wenn auch nicht vorsätzlich. Manchmal war das sogar eher eine Belastung. Ich hatte dichte Wimpern, wallendes karamellfarbenes Haar, lange, alabasterfarbene Beine und volle, sinnliche Lippen. Alles andere an mir war zierlich und kurvig zugleich – verziert mit einer roten Satinschleife und mit einem sirenenhaften Gesichtsausdruck, den ich nicht ablegen konnte, egal wie sehr ich mich bemühte.
Ich erregte Aufsehen. Der guten Art. Der schlimmsten Art. Verdammt, jeder Art.
Es kämen noch andere Jungs, versuchte ich mir einzureden, als Deans und Emilias Lippen sich trafen und mein Herz in meiner Brust verdorrte. Aber ich hatte nur diese eine Schwester.
Abgesehen davon verdiente sie es. Sie verdiente ihn. Meine Eltern schenkten mir jeden Tag Aufmerksamkeit. Ich hatte viele Freunde in der Schule und haufenweise Verehrer. Alle beachteten mich, während niemand Millie eines Blickes würdigte.
Das war nicht meine Schuld, trotzdem hatte ich ein schlechtes Gewissen. Meine ältere Schwester musste sowohl mit meiner Krankheit klarkommen als auch mit meiner Beliebtheit. Sie war eine einzelgängerische Jugendliche, die sich hinter ihren Leinwänden und Farben versteckte. Immerzu still und verschlossen, übermittelte sie ihre Botschaft durch ihre merkwürdigen, exzentrischen Klamotten.
Bei genauerem Nachdenken war es so das Beste. An dem Tag, als ich Dean Cole zwischen Trigonometrie und englischer Literatur das erste Mal im Schulflur bemerkte, wusste ich sofort, dass er mehr für mich war als nur ein Highschool-Schwarm. Wenn ich mit ihm zusammenkäme, würde ich ihn nicht mehr loslassen. Und das allein war schon ein gefährlicher Gedanke, mit dem ich nicht spielen durfte.
Weil meine Zeit schneller ablief. Ich war von Geburt an nicht so wie die anderen.
Ich hatte eine Krankheit.
Manchmal hatte ich sie im Griff.
Und manchmal sie mich.
Jedermanns Lieblingsrose welkt dahin, aber keine Blume möchte vor aller Augen vergehen.
Ja, es ist besser so, entschied ich, als ihre Lippen auf seinen lagen, wobei er mich ansah und die Realität ein kompliziertes, schmerzhaftes Etwas wurde, vor dem ich verzweifelt davonrennen wollte.
Und so schaute ich von meinem Logenplatz aus zu, wie meine Schwester und der einzige Junge, der meinen Puls in die Höhe schnellen ließ, sich ineinander verliebten.
Meine Blütenblätter fielen eines nach dem anderen von mir ab.
Doch obwohl ich wusste, dass meine Geschichte nicht mit »Sie lebten vergnügt bis an ihr seliges Ende« schließen würde, konnte ich nicht umhin, mich zu fragen, ob wir hätten glücklich werden können … sei es auch nur für eine Weile.
DEAN
Der Sommer, in dem ich siebzehn wurde, war übel, aber nichts bereitete mich auf sein verficktes großes Finale vor.
Das Unheil war vorprogrammiert. Alle Zeichen standen auf Sturm. Ich konnte nicht eingrenzen, aus welcher Richtung er kommen würde, aber so, wie ich mein Leben kannte, rechnete ich mit einem Tiefschlag, der mich direkt in die Hölle katapultierte. Am Ende lief alles auf einen einzigen unbesonnenen Filmklischee-Moment hinaus. Ein paar Bud Lights und schludrig gedrehte Joints einige Wochen vor Ende des Schuljahrs. Wir lagen an Vicious’ nierenförmigem Pool und tranken das schale Bier seines Vaters, weil wir wussten, dass wir uns unter Baron Spencer seniors Dach alles erlauben durften. Um uns herum tummelten sich Mädchen. Sie waren high. So kurz vor den Sommerferien gab es nicht viel, was man in Todos Santos, Kalifornien, anstellen konnte. Es war glühend heiß, die Luft drückend, die Sonne grell, das Gras gelb und die Jugend gelangweilt von ihrer problem- und bedeutungslosen Existenz. Wir waren zu träge, um uns auf die Jagd nach einem billigen Nervenkitzel zu machen, darum hielten wir passiv danach Ausschau, während wir auf Luftmatratzen in Form von Donuts und Flamingos faul im Pool trieben oder auf aus Italien importierten Sonnenliegen lümmelten.
Vicious’ Eltern waren nicht zu Hause – waren sie das je? –, und alle zählten darauf, dass ich Stoff dabeihatte. Auf mich war wie immer Verlass: Ich hatte Haschisch und pulverisiertes Ecstasy mitgebracht, das sie gierig inhalierten, ohne sich auch nur zu bedanken, geschweige denn, mich zu bezahlen. Sie hielten mich für einen reichen Kiffer, der Geld in etwa so dringend brauchte wie Pamela Anderson eine größere Oberweite, womit sie nicht ganz unrecht hatten. Und da ich mich mit Kleingeld sowieso nicht herumplagte, ließ ich es ihnen durchgehen.
Eins der Mädchen, eine Blondine namens Georgia, gab mit ihrer neuen Sofortbildkamera an, die ihr Vater ihr während ihres letzten Urlaubs in Palm Springs gekauft hatte. Sie stellte ihre Reize in einem winzigen roten Bikini zur Schau, während sie Fotos von uns Jungs – Jaime, Vicious, Trent und mir – knipste, die sie sich anschließend druckfrisch zwischen die Zähne klemmte und uns von Mund zu Mund überreichte. Ihre Brüste quollen aus ihrem Bikinioberteil wie Zahnpasta aus einer vollen Tube. Ich wollte meinen Schwanz zwischen ihnen reiben und wusste mit hundertprozentiger Sicherheit, dass ich es spätestens bis zum Abend getan haben würde.
»Krass, das hier wird echt guuuut.« Georgia betonte das letzte Wort, indem sie eine unbestimmte Anzahl u einfügte. »Du siehst hypersexy aus, Cole«, schnurrte sie, als sie mich dabei fotografierte, wie ich mit einem Joint zwischen den Fingern den letzten Rest meines Biers kippte und die Dose anschließend auf meinen Schenkel knallte.
Klick.
Der Beweis für meine Verfehlung glitt mit einem provozierenden Fauchen aus der Kamera. Georgia schnappte sich das Foto mit ihren glänzenden Lippen und beugte sich zu mir, um es mir zu reichen. Ich nahm es mit den Zähnen entgegen und stopfte es in meine Badehose. Ihre Augen folgten meiner Hand, als ich den Gummizug nach unten schob und den blonden Haarstreifen unterhalb meines Bauchnabels entblößte, der sie zu einer ganz anderen Party einlud. Sie schluckte sichtlich. Unsere Blicke trafen sich und vereinbarten stillschweigend Zeit und Ort. Dann machte jemand eine Arschbombe in den Pool und spritzte sie nass, woraufhin sie mit einem atemlosen Kichern den Kopf schüttelte und sich ihrem nächsten Kunstprojekt zuwendete, meinem besten Kumpel Trent Rexroth.
Ich hatte fest vorgehabt, das Foto vor meiner Heimfahrt zu vernichten. Das verdammte Ecstasy war wohl Schuld daran, dass ich es vergaß. Schließlich entdeckte meine Mutter es. Zu guter Letzt hielt mein Vater mir einen seiner ruhigen Vorträge, die meine Eingeweide wie Gift zu zersetzen schienen. Und ganz am Ende? Zwangen sie mich, die Sommerferien bei meinem bescheuerten Onkel zu verbringen, den ich auf den Tod nicht ausstehen konnte.
Ich hütete mich, dagegen aufzubegehren. Das Letzte, was ich brauchte, war Zoff mit ihnen, der ein Jahr vor meinem Schulabschluss mein Harvard-Studium gefährden könnte. Ich hatte mich für dieses zukünftige Leben hart ins Zeug gelegt. Es war in greifbarer Nähe, mitsamt seiner ganzen abgefuckten Herrlichkeit, die Reichtum, Privilegien, Privatjets, Time-Sharing und alljährliche Urlaube in den Hamptons beinhaltete. So läuft das nun mal im Leben. Wenn dir etwas Gutes in die Hände fällt, hältst du dich nicht einfach nur daran fest, sondern umklammerst es mit aller Kraft, bis es fast zerbricht.
Nur eine weitere Lektion, die ich viel zu spät gelernt habe.
Jedenfalls war das der Grund, warum ich am Ende nach Alabama flog und vor meinem Abschlussjahr zwei Monate auf einer beschissenen Farm die Zeit totschlug.
Trent, Jaime und Vicious verbrachten die Sommerferien trinkend, kiffend und fickend zu Hause. Ich dagegen kehrte mit einem Veilchen zurück, welches mir Mr Donald Whittaker, auch bekannt als Eule, nach der Nacht, die mich für immer verändern sollte, verehrt hatte.
»Mit dem Leben ist es wie mit der Justiz«, hatte mein Vater-Schrägstrich-Anwalt zu mir gesagt, bevor ich in den Flieger nach Birmingham stieg. »Es ist nicht immer fair.«
Wenn das nicht mal den Nagel auf den Kopf traf.
In diesem Sommer nötigte man mich, die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen. Eule erklärte meinen Eltern, er sei ein wiedergeborener Christ, der sich intensiv mit dem Studium der Heiligen Schrift befasse. Er verlieh dem Nachdruck, indem er mich zwang, während unserer Mittagspausen darin zu lesen. Schinken auf Roggenbrot und das Alte Testament waren seine Version von Nettigkeit, weil er die übrige Zeit nämlich ziemlich arschig zu mir war.
Whittaker war Landwirt. Vorausgesetzt, er war nüchtern genug, um überhaupt zu irgendetwas nütze zu sein. Er machte mich zu seinem Knecht. Ich ließ mich darauf ein, wenn auch hauptsächlich deshalb, weil ich so am Ende jedes Tages die Tochter seines Nachbarn befingern konnte.
Sie hielt mich für eine Art Promi, und das nur, weil ich keinen Südstaatenakzent hatte und ein Auto besaß. Nie im Leben wäre mir eingefallen, ihre Illusion zu zerstören, zumal sie mit Feuereifer an meinem Sexualkundeunterricht teilnahm.
Ich ließ Eules Bibelstunden geduldig über mich ergehen, weil die Alternative darin bestanden hätte, mich im Heu mit ihm zu prügeln, bis einer von uns beiden k. o. gegangen wäre. Wahrscheinlich wollten meine Eltern mich daran erinnern, dass sich das Leben nicht einzig und allein um teure Schlitten und Skiurlaube drehte. Eule und seine Frau gehörten den unteren Einkommensschichten an. Was waren also schon zwei Monate verglichen mit meinem ganzen verfickten Leben?
In der Bibel gibt es jede Menge durchgeknallte Geschichten – über Inzest, Vorhaut-Sammlungen, den Ringkampf zwischen Jakob und einem Engel –, deren Höhepunkt meiner Überzeugung nach schon im zweiten Kapitel überschritten ist, aber eine hat sich mir eingeprägt, und das, obwohl ich Rosie LeBlanc zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte.
Genesis 27. Jakob flüchtete zu seinem Onkel Laban und verliebte sich in Rachel, die jüngere der beiden Töchter des Laban. Rachel war höllisch scharf, wild und bildschön, kurzum eine echte Sexbombe (so deutet es die Bibel an, wenn auch mit anderen Worten).
Laban und Jakob schlossen einen Handel: Wenn Jakob sieben Jahre lang für Laban arbeitete, würde der ihm seine Tochter zur Frau geben. Jakob hielt sich an seinen Teil der Abmachung, indem er sich tagein, tagaus den Arsch abrackerte. Sobald die sieben Jahre vorbei waren, ging Laban zu Jakob und sagte ihm, dass er seine Tochter nun heiraten dürfe.
Aber die Sache hatte einen Haken: Es war nicht Rachels Hand, die er ihm versprochen hatte. Sondern die ihrer älteren Schwester Leah.
Leah war eine gute Frau, das wusste Jakob.
Sie war nett. Verständig. Mildtätig. Sie hatte einen hübschen Hintern und sanfte Augen (auch hier umschreibe ich wieder. Außer den Teil mit den Augen – der Stuss steht tatsächlich in der Bibel).
Aber sie war eben nicht Rachel.
Sie war nicht Rachel, und er wollte keine andere als sie. Es war ihm immer nur um die verflixte Rachel gegangen.
Jakob stritt und debattierte mit seinem Onkel, in der Hoffnung, ihn umzustimmen, doch am Ende zog er den Kürzeren. Schon damals war das Leben vergleichbar mit der Justiz. Sprich, alles andere als fair.
»Diene mir sieben weitere Jahre«, schlug Laban vor, »und ich lasse dich auch noch Rachel heiraten.«
Also wartete Jakob.
Und lauerte.
Und schmachtete.
Was, wie jeder halbwegs vernunftbegabte Mensch weiß, das Verlangen nach dem Objekt der Begierde nur befeuert.
Die Jahre vergingen. Schleppend. Qualvoll. Wie in Trance.
In der Zwischenzeit teilte er das Lager mit Leah.
Er litt nicht. Nicht per se. Leah war gut zu ihm. Eine sichere Bank. Sie konnte ihm Kinder schenken – womit Rachel, wie er später noch herausfinden sollte, so ihre Schwierigkeiten hatte.
Jakob wusste, was er wollte. Leah mochte aussehen wie ihre Schwester, riechen wie sie und sich vielleicht sogar anfühlen wie sie, aber sie war nicht sie.
Es kostete ihn vierzehn Jahre, doch am Ende bekam er Rachel auf ehrliche und anständige Weise.
Rachel mochte nicht von Gott gesegnet sein. Das war Leah.
Aber die Sache war die, dass Rachel Gottes Segen nicht brauchte.
Weil sie geliebt wurde.
Und im Gegensatz zur Justiz und dem Leben ist die Liebe fair.
Soll ich euch noch was sagen? Am Ende war die Liebe genug.
Sie bedeutete verdammt noch mal alles.
Sieben Wochen nach Beginn meines letzten Schuljahrs wartete das Schicksal auf spektakuläre Weise mit einem weiteren Knalleffekt auf. Ihr Name war Rosie LeBlanc, und ihre Augen glichen zwei eisbedeckten alaskischen Seen. Dieses Blau meine ich.
Das Überraschungsmoment packte mich an den Eiern und drückte zu, sowie sie die Tür der Dienstbotenwohnung auf dem Anwesen der Spencers öffnete. Es war nämlich nicht Millie. Sie sah ihr durchaus ähnlich – gewissermaßen –, nur war sie kleiner und zierlicher, hatte vollere Lippen, höhere Wangenknochen und kleine spitze Ohren wie eine verschmitzte Elfe. Und sie kleidete sich nicht so verrückt wie Emilia. Sie trug mit Seesternen bedruckte Flip-Flops, enge schwarze Jeans mit breiten Rissen an den Knien und ein verschlissenes schwarzes Kapuzenshirt, auf dem in weißer Schrift der Name einer mir unbekannten Band prangte. Durch ihr Outfit wollte sie sich äußerlich anpassen, stattdessen stach sie wie ein heller Stern aus der Masse heraus.
Als unsere Blicke sich trafen, färbten sich ihre Wangen und ihr Hals flammend rot, und das verriet mir alles, was ich wissen musste. Sie war ein unbeschriebenes Blatt für mich, wohingegen sie mein Gesicht offensichtlich kannte. Sie betrachtete es, tastete es mit den Augen ab. Unerbittlich direkt.
Sie berappelte sich schnell. »Soll das hier ein Anstarr-Wettbewerb werden?« Ihre Stimme klang irgendwie fast unnatürlich. Zu zart. Zu heiser. Zu einzigartig. »Weil ich nämlich vor geschlagenen dreiundzwanzig Sekunden die Tür aufgemacht habe und du dich noch immer nicht vorgestellt hast. Im Übrigen hast du zweimal geblinzelt.«
Ursprünglich war ich hergekommen, um Emilia LeBlanc um ein Date zu bitten. Sie weigerte sich, mir ihre Handynummer zu geben. Als geborener Jäger war ich ausreichend geduldig, um abzuwarten, bis sie nahe genug wäre, um zuzuschlagen, trotzdem schadete es nicht, hin und wieder nach meiner Beute zu sehen. Aber um ehrlich zu sein, ging es mir bei meiner Pirsch nicht wirklich um Emilia. Der Nervenkitzel der Jagd bescherte mir immer ein Kribbeln in den Eiern, und Emilia stellte für mich eine Herausforderung dar, die ich bei anderen Mädchen vergeblich suchte. Sie war Frischfleisch und ich ein unersättliches Raubtier. Aber auf das hier war ich nicht gefasst gewesen.
Das hier änderte alles.
Stumm wie ein Fisch stand ich da und setzte ein Megawattgrinsen auf, um sie zu triezen, weil sie dasselbe mit mir tat. Und plötzlich dämmerte mir, dass womöglich nicht ich der Jäger war. Für den Bruchteil einer Sekunde war ich Elmer Fudd, der mit einer Flinte ohne Munition im Wald auf eine angriffslustige Tigerin trifft.
»Kann es nicht sprechen?« Die Tigerin zog ihre hellen Augenbrauen zusammen, dann beugte sie sich vor und pikte mich mit ihrer winzigen Pranke in die Brust. Sie hatte mich es genannt.
Um mich zu verspotten. Zu demütigen. An meinem Ego zu kratzen.
Ich stellte meine unschuldigste Miene zur Schau (was an sich schon eine große Herausforderung darstellte, weil die Unschuld in mir erloschen war, kaum dass man meine Nabelschnur durchtrennt hatte), biss die Zähne aufeinander und schüttelte den Kopf.
»Du kannst nicht sprechen?« Mit skeptisch erhobenen Brauen verschränkte sie die Arme und lehnte sich gegen den Türrahmen.
Ich nickte und verbiss mir ein Feixen.
»Blödsinn. Ich habe dich in der Schule gesehen. Du bist Dean Cole. Spitzname Ruckus. Du kannst nicht nur sprechen, sondern scheinst die meiste Zeit die Klappe nicht halten zu können.«
Nur zu, kleine Elfe. Konserviere deinen Ärger für den Tag, an dem wir uns zwischen meinen Laken wälzen.
Um zu verstehen, wieso ich derart überrumpelt war, muss man wissen, dass noch nie ein Mädchen so mit mir geredet hatte. Nicht einmal Millie, obwohl sie die einzige Schülerin zu sein schien, die gegen meinen typisch amerikanischen, unwiderstehlichen Sonnyboy-Charme immun war. Genau deswegen war sie mir überhaupt erst aufgefallen.
Aber wie schon gesagt, können sich Pläne bisweilen ändern. Abgesehen davon hatten wir bisher noch nicht mal ein Date gehabt. Ich stellte Millie seit ein paar Wochen in der Schule nach, noch unentschlossen, ob sich die Mühe lohnte, doch als ich jetzt sah, was mir bisher entgangen war – diese heiße Braut –, wurde es Zeit, mich an ihrem wilden Feuer zu wärmen.
Ich bedachte sie mit einem weiteren anzüglichen Grinsen. Diese spezielle Art zu grinsen hatte mir an der All Saints High vor zwei Jahren den Namen Ruckus eingebracht. Weil ich nun mal ein Unruhestifter war. Wo immer ich auftauchte, brauten sich Chaos und Anarchie zusammen. Jeder wusste das. Die Lehrer, die Schüler, Rektorin Followhill und sogar unser Sheriff.
Wenn man Drogen brauchte, kam man zu mir. Wenn man Bock auf eine geile Party hatte, kam man zu mir. Wenn man scharf war auf einen fantastischen Fick, kam man zu mir – und mit mir. Die Botschaft, die mein Grinsen – welches ich seit meinem fünften Lebensjahr trainiert hatte – der Welt verkündete, lautete folgendermaßen:
Wenn es amüsant, schmutzig und verdorben ist, bin ich jederzeit dafür zu haben.
Und dieses Mädchen zu verderben versprach jede Menge Spaß.
Ihr Blick haftete an meinen Lippen. Gebannt. Begehrlich. Berauscht. Es war leicht, ihn zu entschlüsseln. Highschool-Mädchen eben. Auch wenn dieses nicht so süß lächelte wie der Rest von ihnen. Sie lud mich auch nicht unterschwellig dazu ein, mit ihr zu flirten.
»Du kannst sprechen«, beharrte sie in vorwurfsvollem Ton. Ich zog die Unterlippe zwischen die Zähne, ließ sie wieder los. Bedächtig. Kalkuliert. Neckisch.
»Vielleicht kenne ich tatsächlich ein paar Wörter«, räumte ich ein. »Möchtest du die interessanten hören?« Meine Augen bettelten darum, über ihren Körper wandern zu dürfen, aber mein Verstand riet mir zu warten. Ich beschloss, auf ihn zu hören.
Ich war entspannt.
Ich war listig.
Aber zum ersten Mal seit Jahren hatte ich keinen blassen Schimmer, was da gerade geschah.
Sie quittierte meine Antwort mit einem schiefen Grinsen, bei dem es mir die Sprache verschlug. Weil sie so viele Worte darin verpackte. Sie drückte damit aus, dass mein Versuch, sie um den Finger zu wickeln, ganz und gar keinen Eindruck auf sie machte. Dass sie mich bemerkt hatte und sympathisch fand, ich jedoch mehr zustande bringen musste als einen beiläufigen, halbherzigen Flirt, um ans Ziel zu gelangen. Wo immer diese Reise hinführen mochte, ich war bereit.
»Hm, möchte ich das?« Sie schäkerte mit mir, wenn auch unwissentlich. Mit gesenktem Kopf beugte ich mich vor. Ich war ein großer, dominanter, selbstbewusster Kerl. Der immer für Ärger gut war. Bestimmt kannte sie all diese Geschichten, und falls nicht, würde sie sie bald erfahren.
»Ich denke schon«, erwiderte ich.
Noch vor zwei Minuten hatte ich vorgehabt, mit ihrer Schwester auszugehen – ihrer älteren Schwester, nahm ich an, denn diese Kleine sah nicht nur jünger aus, sondern wäre mir auch aufgefallen, wenn sie in der Zwölften gewesen wäre –, aber das Schicksal wollte, dass ausgerechnet sie die Tür öffnete und meine Pläne sich änderten.
Baby LeBlanc forderte mich mit einem seltsamen Blick auf weiterzusprechen. Als ich gerade fortfahren wollte, kam Millie aus dem kleinen, muffigen Wohnzimmer gestürzt, als flüchtete sie aus einem Kriegsgebiet. Ihre Augen waren rot und verquollen, und sie drückte ein Schulbuch an ihre Brust. Sie starrte mir direkt ins Gesicht, und eine Sekunde lang dachte ich, sie würde mir den zwei Kilo schweren Wälzer in die Visage knallen.
Rückblickend wünschte ich, sie hätte es getan. Es wäre wesentlich besser gewesen als das, wozu sie sich stattdessen hinreißen ließ.
Ohne wirklich Notiz von ihr zu nehmen, schubste Millie die kleine Elfe beiseite, um mir ungewohnt hingebungsvoll um den Hals zu fallen und ihre Lippen wie besessen auf meine zu drücken.
Scheiße. Das war übel.
Nicht der Kuss. Der war vermutlich okay. Ich hatte keine Zeit, ihn zu beurteilen, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, fassungslos nach der spitzohrigen Elfe zu schielen, die uns mit einem Ausdruck des Entsetzens in ihren kornblumenblauen Augen musterte, ihre Schlüsse zog und eine Entscheidung traf, die zu akzeptieren ich nicht bereit war.
Zur Hölle, was war bloß in Millie gefahren? Noch vor wenigen Stunden hatte sie mich im Schulflur keines Blickes gewürdigt, hatte Zeit geschunden, Abstand gehalten, Gleichgültigkeit vorgeheuchelt. Und jetzt fiel sie über mich her wie ein Hautausschlag nach einem riskanten One-Night-Stand.
Behutsam löste ich mich von ihr und nahm ihr Gesicht in beide Hände, damit sie sich nicht zurückgewiesen fühlte, wobei ich sicherstellte, dass noch genug Platz blieb für die kleine Elfe. Emilias Annäherungsversuch war mir lästig, was in Bezug auf ein hübsches Mädchen ein echtes Novum für mich war.
»Hey«, sagte ich. Selbst in meinen Ohren klang der Ton meiner Stimme nicht so flapsig wie sonst. Das hier sah Millie nicht ähnlich. Etwas war vorgefallen, und ich konnte mir schon denken, auf wessen Konto dieser kleine Auftritt ging. Mein Blut fing an zu kochen. Ich atmete gleichmäßig durch die Nase, fest entschlossen, nicht die Beherrschung zu verlieren. »Was ist passiert, Mil?«
Die Leere in ihren Augen verursachte mir Übelkeit. Fast konnte ich hören, wie ihr Herz in tausend Stücke brach. Ich riskierte einen weiteren Blick zu Baby LeBlanc, während ich mir den Kopf zermarterte, wie zur Hölle ich aus dieser Nummer herauskommen sollte. Ohne die Augen von dem Häuflein Elend abzuwenden, das noch immer versuchte, mich zu umarmen, wich sie einen Schritt zurück. Millie war fix und fertig. Ich konnte sie nicht kalt auflaufen lassen. Nicht in diesem Zustand.
»Vicious«, schniefte die ältere der beiden Schwestern. »Vicious ist passiert.«
Sie zeigte auf das Mathebuch, als wäre es ein Beweisstück.
Widerstrebend richtete ich den Blick wieder auf Emilia »Millie« LeBlanc.
»Was hat der Wichser getan?« Ich nahm es ihr aus der Hand und blätterte durch die Seiten, suchte nach fiesen Bemerkungen oder vulgären Zeichnungen.
»Er hat meinen Spind aufgebrochen und es geklaut«, sagte sie und schniefte wieder. »Danach hat er ihn mit Kondomverpackungen und Müll vollgestopft.« Sie wischte sich mit dem Ärmel die Nase ab.
Dieser gottverfluchte Idiot. Das war der andere Grund, warum ich Millie daten wollte. Schon seit meiner Kindheit hatte ich gegenüber den Schwachen einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Hat was mit einem weichen Kern und solchem Scheiß zu tun. Ich war weder durch und durch schlecht, so wie Vicious, noch durch und durch gut, so wie Jaime. Ich hatte meine eigene moralische Richtschnur, und bei Mobbing verlief für mich eine lange, mit Blut gezogene Grenze.
Was Millie betraf, so war sie das Paradebeispiel eines unterprivilegierten Mädchens, das dringend einen Beschützer brauchte. Sie wurde in der Schule gemobbt und von einem meiner besten Freunde terrorisiert. Ich musste das Richtige tun. Ich musste, aber ich wollte ums Verrecken nicht.
»Ich knöpfe ihn mir vor.« Ich hatte Mühe, die Worte nicht zu fauchen. »Geh wieder hinein.«
Und lass mich mit deiner Schwester allein.
»Das brauchst du nicht. Ich bin froh, dass du hier bist.«
Ich warf einen heimlichen Blick auf das Mädchen, das dazu ausersehen war, meine Rachel zu werden, einen sehnsuchtsvollen dieses Mal, weil ich wusste, dass meine Chance bei ihr im selben Augenblick vertan war, als ihre Schwester mich küsste, um dem verdammten Vicious eins auszuwischen.
»Ich habe übrigens darüber nachgedacht.« Millie blinzelte hektisch, von ihren eigenen Problemen zu sehr vereinnahmt, um zu realisieren, dass ich sie seit ihrem Auftauchen kaum angesehen hatte. Oder dass ihre Schwester direkt neben uns stand. »Und bin zu dem Schluss gelangt, warum eigentlich nicht? Ich hätte sehr gern ein Date mit dir.«
Das stimmte nicht. Sie wollte mich nur als ihren Beschützer.
Millie brauchte jemanden, der auf sie aufpasste.
Und ich brauchte einen Joint.
Seufzend zog ich sie in meine Arme, legte die Hand auf ihren Hinterkopf und vergrub die Finger in ihren hellbraunen Haaren. Meine Augen verharrten noch immer auf Baby LeBlanc. Meiner kleinen Rachel.
Ich bringe das in Ordnung, versicherten sie ihr. Sie waren eindeutig optimistischer als ich.
»Du musst mich nicht daten. Ich kann dein Leben auch als Kumpel leichter für dich machen. Du brauchst es nur zu sagen, und ich trete ihm in den Arsch«, raunte ich in Millies perfekt geformtes Ohr, während meine Aufmerksamkeit auf Rosie gerichtet war.
Millie schüttelte den Kopf, schmiegte ihn enger an meine Schulter. »Nein, Dean. Ich möchte ein Date mit dir. Du bist nett und lustig und mitfühlend.«
Und total verrückt nach deiner Schwester.
»Ich habe da so meine Zweifel, Millie. Du hast mich wochenlang abblitzen lassen. Es geht hier um Vic, das wissen wir beide. Trink ein Glas Wasser. Denk noch mal gründlich nach. Ich werde ihn mir morgen beim Training zur Brust nehmen.«
»Bitte, Dean.« Das Zittern verschwand aus ihrer Stimme, als sie mich an meinem Designer-T-Shirt näher zu sich heranzog, wodurch sie mich gleichzeitig von meinem strahlenden neuen Fantasiebild weglotste. »Ich bin ein großes Mädchen. Ich weiß, was ich tue. Lass uns gehen, jetzt gleich.«
»Ja, tut das«, bekräftigte Baby LeBlanc und gab uns mit der Hand ein Zeichen. »Ich muss sowieso lernen, und ihr zwei würdet mich nur ablenken. Sollte ich Vicious im Pool sehen, werde ich ihn ertränken, Millie«, witzelte sie und tat so, als würde sie die Muskeln in ihren dünnen Armen anspannen.
Rosie war eine miserable Schülerin, die eine Vier minus nach der anderen kassierte, doch das wusste ich damals nicht. Sie wollte nicht studieren. Sie wollte, dass jemand ihre Schwester rettete.
Ich führte Millie zum Eisessen aus, ohne einen Blick zurückzuwerfen.
Ich führte sie aus, obwohl ich mich für Rosie hätte entscheiden sollen.
Ich wählte Millie, und ich würde Vicious den Hals umdrehen.
KAPITEL 1
ROSIE
Die Gegenwart
Was gibt dir das Gefühl, lebendig zu sein?
Meinen Atem sehen zu können. Weil es mir beweist, dass ich noch immer Luft bekomme.
Das dürfte wohl in die Kategorie Selbstgespräch fallen, aber dazu hatte ich schon immer geneigt. Die Stimme, die mich ständig mit dieser schwer greifbaren Frage konfrontierte, schien in mein Gehirn implantiert zu sein, und es war nicht meine. Sondern die eines Mannes. Keines mir bekannten, jedenfalls glaubte ich das. Sie erinnerte mich fortwährend daran, dass ich noch atmete, was ich keineswegs als selbstverständlich ansah. Dieses Mal wirbelte die Antwort in mir auf wie eine Blase, die kurz davor war zu platzen. Ich presste die Nase an den Spiegel im Aufzug des prunkvollen Wolkenkratzers, in dem ich wohnte, und stieß den Atem in einer dichten weißen Nebelwolke aus. Ich trat zurück und betrachtete mein Werk.
Durch die Tatsache, dass ich noch atmete, zeigte ich meiner Krankheit den Stinkefinger.
Mukoviszidose. Wann immer jemand fragte, vermied ich es, ins Detail zu gehen. Die Leute mussten nicht mehr wissen, als dass man die Krankheit in meinem dritten Lebensjahr bei mir diagnostiziert hatte, nachdem meine Schwester Millie mein Gesicht geküsst und gemeint hatte, dass ich »furchtbar salzig« schmecke. Das war ein klassisches Warnsignal, darum ließen meine Eltern mich testen. Die Ergebnisse waren positiv. Mukoviszidose ist eine Lungenerkrankung. Und ja, sie ist therapierbar. Nein, eine Heilung gibt es nicht. Ja, sie beeinträchtigt mein Leben erheblich. Ich muss ständig Tabletten schlucken, gehe dreimal pro Woche zur Physiotherapie, nenne unzählige Nebulisatoren mein Eigen und werde voraussichtlich in den nächsten fünfzehn Jahren sterben. Nein, ich brauche kein Mitleid, darum spart euch diese Blicke.
Noch immer mit meinem grünen Kittel bekleidet, meine Haare ein wirres Durcheinander, meine Augen glasig vom Schlafmangel betete ich stumm darum, dass sich die Kabine endlich schließen und mich zu meinem Apartment in der zehnten Etage befördern möge. Ich wollte ein heißes Bad nehmen, ins Bett schlüpfen und einen Portlandia-Marathon starten. Und nicht an meinen Exfreund Darren denken.
Tatsächlich war das das Letzte, was ich wollte.
Wie aus dem Nichts ertönte das laute Klackern hoher Absätze und steigerte sich mit jeder Sekunde. Ich wandte den Kopf zur Lobby und unterdrückte ein Husten. Die Fahrstuhltür schloss sich bereits, als sich im letzten Moment eine weibliche Hand mit rot lackierten Fingernägeln dazwischen schob und sie daran hinderte. Die Frau ließ ein schrilles Lachen ertönen.
Ich runzelte die Stirn.
Nicht er schon wieder.
Aber natürlich war er es. Umhüllt von Alkoholdunst, der vermutlich einen ausgewachsenen Elefanten umgehauen hätte, zwängte er sich in den Aufzug, in seinem Schlepptau zwei Frauen vom Typ Desperate Housewives. Bei der ersten handelte es sich um die Intelligenzbestie, die ihren Arm riskiert hatte, um die Tür aufzuhalten – eine Tussi mit feurig-roten Haaren à la Jessica Rabbit und einem Dekolleté, das nichts der Fantasie überließ, selbst wenn man davon jede Menge besaß. Die zweite war zierlich und brünett und wartete mit dem rundesten Hintern auf, den ich je bei einem Menschen gesehen hatte, und dazu einem dermaßen kurzen Kleid, dass man sie vermutlich gynäkologisch hätte untersuchen können, ohne sie entkleiden zu müssen.
Oh, und dann war da noch Dean »Ruckus« Cole.
Ein Hüne – die perfekte Größe für einen Filmstar – mit jadegrünen Augen von fast radioaktivem Strahlen und unergründlicher Tiefe, verstrubbelten dunkelbraunen Haaren und einem Körper, der sogar Brock O’Hurns in den Schatten stellte. So sündhaft sexy, dass einem nichts anderes übrigblieb, als wegzusehen. Ganz im Ernst, der Mann war derart heiß, dass er in ultrareligiösen Ländern vermutlich Einreiseverbot hatte. Zu meinem Glück kannte ich Mr Cole zufällig gut genug, um zu wissen, dass er ein Riesenarschloch war, darum übte sein Charme kaum Wirkung auf mich aus.
Mit der Betonung auf kaum.
Er sah umwerfend aus, aber er war gleichzeitig ein Mistkerl epischen Ausmaßes. Kennt ihr diese Frauen, die auf attraktive, verkorkste, labile Männer stehen und sich einbilden, ihnen ihre Dämonen austreiben zu können? Dean Cole wäre ihr wahr gewordener Traum. Weil mit diesem Kerl definitiv etwas nicht stimmte. Es machte mich traurig, dass die Menschen in seinem direkten Umfeld die blinkenden Warnlichter nicht sahen – sein Trinken, sein exzessiver Pot-Konsum, sein unwiderstehliches Verlangen nach allem, was lasterhafte Vergnügungen versprach. Gleichzeitig war mir bewusst, dass Dean Cole mich nichts anging. Abgesehen davon hatte ich meine eigenen Probleme.
Er drückte gefühlte fünfhundert Mal auf den Knopf zu seinem Penthouse, während er hicksend in der engen Kabine schwankte, die wir vier uns teilten. Ein fiebriger Ausdruck stand in seinen Augen, und seine Haut war von einem dünnen Schweißfilm bedeckt, der nach purem Brandy roch. Ich hatte das Gefühl, als zöge sich ein dicker, rostiger Draht um mein Herz zusammen.
Sein Lächeln wirkte nicht glücklich.
»Baby LeBlanc.« Deans träger Tonfall drang direkt in meinen Unterleib, und ich wurde regungslos. Er fasste mich an der Schulter und drehte mich zu sich herum. Seine Begleiterinnen beäugten mich, als hätte ich die Pest. Ich legte die Hände auf seine stählerne Brust und stieß ihn weg.
»Bleib mir von der Pelle. Du riechst, als hätte Jack Daniel in deinen Mund ejakuliert«, sagte ich mit ausdruckslosem Gesicht. Er warf den Kopf zurück und lachte herzhaft, offensichtlich genoss er unseren bizarren Schlagabtausch.
»Dieses Mädchen …« Er legte mir den Arm um die Schultern und drückte mich an sich, dann zeigte er mit seiner Bierflasche auf mich und bedachte die beiden Frauen mit einem beduselten Grinsen. »Sie ist nicht nur verflucht sexy, sondern hat auch noch mehr Köpfchen und Witz als Winston Churchill zu seinen besten Zeiten«, nuschelte er. Die beiden hielten Winston Churchill vermutlich für eine Zeichentrickfigur. Dean sah wieder zu mir, und plötzlich erschien eine steile Falte zwischen seinen Augenbrauen. »Dadurch läuft sie eigentlich Gefahr, eine eingebildete Zicke zu sein, aber das ist sie nicht. Sie ist auch noch verdammt nett. Darum ist sie auch Krankenschwester. Jammerschade, dass du deinen süßen Arsch unter einem Kittel versteckst, LeBlanc.«
»Da muss ich dich leider enttäuschen, Schnapsdrossel. Ich mache das ehrenamtlich. In Wirklichkeit arbeite ich als Barista«, korrigierte ich ihn, während ich besagten Kittel glattstrich und mich gleichzeitig mit einem freundlichen Lächeln in Richtung der Mädchen seinem Griff entwand. Ich jobbte dreimal pro Woche unentgeltlich auf einer NeugeborenenIntensivstation, überwachte dort Brutkästen und wechselte Windeln. Ich war weder künstlerisch begabt wie Millie noch erfolgreich wie die HotHoles, aber ich hatte meine eigenen Passionen – Menschen und Musik –, und ich schätzte meine Jobs nicht geringer ein als das, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienten. Dean hatte in Harvard seinen MBA gemacht und die NewYorkTimes abonniert, aber machte ihn das zu etwas Besserem, als ich es war? Ganz sicher nicht. Ich arbeitete in einem kleinen, zwischen der First Avenue und der Avenue A gelegenen Café namens The Black Hole. Die Bezahlung war mies, aber der Laden war gut. Meiner Ansicht nach war das Leben zu kurz, um es mit etwas zu verschwenden, das man nicht leidenschaftlich gern tat. Für mich galt das inbesonderemMaße.
Jessica Rabbit verdrehte die Augen. Die zierliche Brünette zuckte mit einer nackten Schulter, dann kehrte sie uns den Rücken zu und hantierte mit ihrem Handy. Sie hielten mich für eine Giftspritze. Und sie hatten recht. Allerdings ahnten sie noch nicht, dass es für sie ein böses Erwachen geben würde. Ich kannte das Ritual meines Nachbarn, auch bekannt als der Exfreund meiner Schwester, inzwischen in- und auswendig. Am Morgen würde er ihnen ein Taxi rufen und noch nicht einmal so tun, als würde er ihre Nummern speichern.
Morgen früh wird er ihnen das Gefühl geben, als wären sie Müll, den es loszuwerden gilt. Er wird dann nüchtern, verkatert und undankbar sein.
Weil er nun mal ein HotHole – ein heißes Arschloch – war.
Ein privilegierter, seelisch instabiler Egomane aus Todos Santos, der glaubte, sich alles nehmen zu können, ohne je etwas dafür zurückzugeben.
Komm schon, Aufzug. Wieso brauchst du so lange?
»LeBlanc.« Dean lehnte sich gegen die verspiegelte Wand und reichte die Flasche einer der Frauen, bevor er einen Joint hinter seinem Ohr hervorzog und sein Feuerzeug aus seiner dunklen, perfekt sitzenden Jeans kramte. Dazu trug er ein Designer-T-Shirt mit V-Ausschnitt – in Limettengrün, was die Farbe seiner Augen unterstrich und ihn noch braun gebrannter wirken ließ –, Hightop-Sneakers und ein aufgeknöpftes schwarzes Sakko. Er weckte törichte Wünsche in mir. Nach Dingen, die ich nie von irgendjemandem gewollt hatte, erst recht nicht von einem, der acht Monate lang mit meiner Schwester liiert gewesen war. Darum unterdrückte ich meine Sehnsüchte und bemühte mich, gemein zu ihm zu sein. Dean war wie Batman. Stark genug, um es auszuhalten.
»Du und ich, wir genehmigen uns morgen einen Sonntagsbrunch. Ein Wort genügt, und ich vernasche mehr als nur das Frühstück.« Er senkte den Kopf und sah mich mit einem unheilverkündenden Ausdruck in seinen smaragdgrünen Augen an. Subtilität war ein Fremdwort für diesen Kerl. Verzogener Rotzlöffel, dachte ich verbittert. In wenigen Minuten wird er einen flotten Dreier haben, trotzdem steht er jetzt hier und baggert die Schwester seiner Exfreundin an. Und die beiden hören alles mit. Wieso sind sie überhaupt noch hier?
Ich ging nicht auf seine unverblümte Anmache ein, sondern wechselte das Thema, indem ich eine Warnung aussprach. »Falls du dieses Ding hier im Aufzug anzündest …« Ich zeigte auf seinen Joint. »Dann schwöre ich, dass ich mich heute Nacht in deine Wohnung schleiche und dir heißes Wachs in den Schritt gieße.«
Jessica Rabbit schnappte nach Luft. Die zierliche Brünette stieß ein Quieken aus. Immerhin würden sie im Zentrum des Geschehens sein, sollte ich meine Drohung wahrmachen.
»Lieber Himmel, krieg dich wieder ein.« Die Brünette wedelte mit der Hand in meine Richtung. Vermutlich platzte ihr gleich der Kragen.
Ich schenkte der kunstvoll geschminkten Frau keine Beachtung. Stattdessen starrte ich unverwandt zu den roten Zahlen über der Fahrstuhltür, die anzeigten, dass ich Badewanne, Wein und Portlandia immer näher rückte.
»Antworte mir.« Dean ignorierte seine beiden Betthäschen und richtete seine glasigen Augen wieder auf mich. »Brunch?« Er hickste. »Oder können wir den Schwachsinn überspringen und einfach ficken?«
Hoffnungslos romantisch, klar. Trotzdem blieb es für mich bedauerlicherweise beim Nein.
Offen gestanden törnte es mich nicht nur ab, wie er versuchte, mich ins Bett zu kriegen, auch der Zeitpunkt war völlig daneben. Es war drei Wochen her, seit Darren seinen Kram gepackt und aus der Wohnung ausgezogen war, in der wir ein halbes Jahr zusammen gelebt hatten. Insgesamt waren wir neun Monate ein Paar gewesen, nach meiner kurzen Affäre mit einem speckigen, ganzkörperbehaarten Heavy-Metal-Fan namens Hal. Dean hatte keine Zeit verloren, sich als Ersatzmann anzubieten und sich an mich ranzumachen. Der Umstand, dass er eigentlich mein Vermieter war und ich nur hundert Dollar im Monat zahlte – und selbst diese lediglich aus rechtlichen Gründen –, erleichterte es nicht gerade, ihn zurückzuweisen. Mein Apartment gehörte ihm, zusammen mit Vicious, Jaime und Trent, und obwohl ich wusste, dass er mich nicht rauswerfen konnte – Vicious würde das niemals zulassen –, musste ich trotzdem höflich zu ihm sein.
Aber die Vorstellung, dass ich mir bei ihm jede auf WebMD gelistete sexuell übertragbare Krankheit einfangen könnte, machte es mir erheblich leichter, ihn abblitzen zu lassen.
Die roten Ziffern auf dem Display krochen höher.
Drei.
Vier.
Fünf.
Komm schon, komm schon, komm schon.
»Nein«, sagte ich in flachem Ton, als mir bewusst wurde, dass er mich noch immer anstarrte und auf Antwort wartete.
»Warum nicht?« Ein weiteres Hicksen.
»Weil wir keine Freunde sind und ich dich nicht mag.«
»Wie kommt das?«, bedrängte er mich und grinste schief.
Du hast mir das Herz gebrochen, und ich habe es ganz verkehrt und krumm wieder zusammengesetzt.
»Du bist ein hoffnungsloser Weiberheld.« Damit nannte ich ihm den zweiten Grund auf meiner »Wieso ich Dean hasse«-Liste. Und die war wirklich lang.
Anstatt verlegen oder entmutigt zu reagieren, beugte er sich mit kühler, gefasster Miene wieder zu mir und strich mit dem Zeigefinger der Hand, in der er den nicht angezündeten Joint hielt, über meine Wange. Dann zeigte er mir die geschwungene Wimper, die er von meinem Gesicht gepflückt hatte, indem er den Finger dicht vor meine Lippen hielt.
»Wünsch dir was.« Seine Stimme legte sich wie ein Seidenschal um meinen Hals und drückte sanft zu.
Ich biss mir auf die Unterlippe und schloss die Augen. Als ich sie wieder öffnete, blies ich auf die Wimper und beobachtete, wie sie gleich einer Feder zu Boden schwebte.
»Willst du nicht wissen, was ich mir gewünscht habe?« Meine Stimme klang heiser. Er lehnte sich vor und küsste mich auf die Wange.
»Das spielt keine Rolle«, nuschelte er. »Das Einzige, worauf es ankommt, ist, was du brauchst. Ich habe es, Rosie. Und eines Tages – das wissen wir beide – werde ich es dir geben. Im Übermaß.«
Ich hatte gerade sechs Stunden ehrenamtlicher Arbeit in einer Kinderklinik in der Innenstadt hinter mir, wohin ich gleich nach meiner Schicht im Café gehetzt war. Ich war müde, hungrig und hatte Blasen von der Größe meiner Nase an den Füßen. In meiner Brust sollten sich nicht Tausende kleine Schmetterlinge tummeln, aber sie taten es. Und dafür hasste ich sie.
»Brunch«, raunte er mir zu, wobei sein heißer, übel riechender Atem über mein Gesicht strich. »Du wohnst jetzt seit über einem Jahr in meinem Apartment. Es wird Zeit, deine Miete neu zu verhandeln. In meinem Penthouse. Morgen Vormittag. Wann immer es dir passt, aber ich rate dir zu erscheinen. Verstanden?«
Ich schluckte und senkte den Blick. Als ich ihn wieder hob, glitten die Fahrstuhltüren auf. Ich sprintete aus der Kabine und den Flur entlang, dabei kramte ich den Schlüssel aus meinem Rucksack.
Ich brauchte Luft. Jede Menge davon. Jetzt sofort.
Sein Lachen schallte noch vom zwanzigsten Stockwerk bis zu meiner Tür, als er sein Penthouse erreichte, wo er die Nacht mit den zwei Grazien verbringen würde.
Nach meinem Bad schenkte ich mir ein Glas Wein ein und genehmigte mir ein gesundes, ausgewogenes Abendessen, bestehend aus Maischips und einem orangefarbenen Dip unbekannter Herkunft, den ich ganz hinten in meinem Kühlschrank gefunden hatte. Anschließend lümmelte ich mich auf die Couch und zappte durch die Fernsehkanäle. Obwohl ich eigentlich Portlandia gucken wollte, um mich etwas kultivierter zu fühlen, als mein Abendessen nahelegte, blieb ich aus unerfindlichen Gründen bei Was passiert, wenn’s passiert ist hängen.
Grauenvoll, und das nicht nur, weil der Film bei Rotten Tomatoes ein 22-Prozent-Rating erhalten hatte.
Sondern weil er meine Gedanken auf Darren lenkte.
Und ich, wenn ich an ihn dachte, ihn anrufen und mich ein weiteres Mal bei ihm entschuldigen wollte.
Hin- und hergerissen starrte ich zum Telefon und malte mir das Szenario in meinem heillos übermüdeten Hirn aus.
Er wird drangehen.
Und mich zu überzeugen versuchen, dass ich einen schrecklichen Fehler gemacht habe.
Was ihm aber egal sei. Weil er mich immer noch wolle.
Nur ist es ihm nicht egal. Es schmerzt ihn sehr.
Ich bin nicht gut genug.
Nicht für jemanden wie ihn.
Eine Sache sollte ich wohl erwähnen: Ungeachtet meiner sarkastischen Art und meines vorlauten Mundwerks war ich ein Hund, der zwar bellte, aber nicht biss. Ich hatte kein Interesse daran, Leben zu zerstören. Viel lieber wollte ich sie retten. Das war der Grund, warum ich Darren aufgegeben hatte.
Darren verdiente eine normale Existenz mit einer normalen Frau und ausreichend vielen Kindern, um ein Footballteam auf die Beine zu stellen. Er verdiente ausgedehnte Urlaube und Aktivitäten im Freien, außerhalb des Krankenhauses. Zumindest wenn er nicht gerade dort arbeitete. Kurz gesagt, er verdiente mehr, als ich ihm jemals geben könnte.
Ich verzog mich ins Bett und lehnte mich mit dem Rücken ans Kopfteil, dann starrte ich zur Tür und wünschte mir, sie würde aufgestoßen von einem hinreißenden Mann, der mich die Nacht über wärmen würde.
Dean Cole.
Gott, wie ich ihn verabscheute. Jetzt mehr denn je. Er wollte meine Miete neu verhandeln. Das konnte er nicht tun. Ich war arm wie eine Kirchenmaus. Erst recht nach den in Manhattan geltenden Standards. Außerdem verdiente er an einem Tag so viel wie ich in zwei Jahren. War das wirklich notwendig, oder wollte er sich nur dafür rächen, dass ich nicht auf seine Avancen einging?
Mit geschlossenen Augen stellte ich mir vor, wie dieser Wichser Jessica Rabbit leckte, die auf seinem perfekten, kantigen Gesicht saß, während ihm die zierliche Brünette einen blies. Schauernd und mit gefurchter Stirn schob ich die Hand in meinen bereits feuchten Slip. Mir entschlüpfte ein Stöhnen.
Bestimmt war Dean Cole einer von der versauten Sorte. Sowie Jessica Rabbit ihren Höhepunkt erreichte, würde er sie auf den Bauch werfen und sie von hinten nehmen, während er sie an ihren scharlachroten Haaren gepackt hielt.
Ich drang mit dem Zeigefinger in mich ein, dann ließ ich den Mittelfinger folgen und tastete nach dem Lustpunkt.
Angewidert malte ich mir aus, wie er die zierliche Brünette am Hals fasste und sie rücklings in Position brachte, sobald er mit JR fertig wäre. Jetzt vögelte er sie ebenfalls, wobei er sie fest in die Brustwarzen kniff.
Ich bog den Rücken durch, bäumte mich auf.
Ich stöhnte, voll Abscheu.
Dann kam ich in heftigen Zuckungen, von Ekel erfüllt.
Ich hasste alles an Dean Cole.
Einfach alles … außer ihn.
KAPITEL 2
DEAN
S-E-X.
Darauf läuft es am Ende immer hinaus.
Die ganze Welt basiert auf einem einzigen animalischen Bedürfnis. Unser Bestreben, besser auszusehen, härter zu trainieren, reicher zu werden und Dingen nachzujagen, die wir überhaupt nicht brauchen – ein besseres Auto, straffere Muskeln, eine Beförderung, eine neue Frisur, der ganze Mist, den sie uns in der Werbung anzudrehen versuchen.
Alles. Wegen. Sex.
Jedes Mal, wenn eine Frau ein Parfum oder ein Pflegeprodukt oder ein verficktes Kleid kauft.
Jedes Mal, wenn ein Mann sich zum Sklaven absurd hoher Raten für einen Sportwagen macht, der nicht halb so komfortabel ist wie die geräumige koreanische Karre, die er noch vor einer Woche fuhr, oder er sich in der Umkleide eines muffigen Fitnesscenters Steroide injiziert … Tun sie das nur, um flachgelegt zu werden.
Auch wenn ihnen das nicht bewusst ist. Sie das nicht einmal befürworten. Du kaufst die neue Bluse und den Jeep und die neue Nase, um begehrenswerter zu sein. Wissenschaftlich erwiesen, Baby. Dem ist nichts entgegenzusetzen.
Dasselbe gilt für Kunst. Ein paar von Sex handelnde Songs wurden zu meinen Lieblingsliedern, noch ehe ich wusste, dass ich mit meinem Schwanz noch etwas anderes tun konnte, als meinen Namen in den Schnee zu pinkeln.
»Summer of ’69«? Bryan Adams war damals neun. Trotzdem singt er eindeutig von seiner Lieblingsstellung. »I Just Died in Your Arms« von Cutting Crew? Handelt von Orgasmen. »Ticket to Ride« von den Beatles? Von Prostituierten. »Come On Eileen«? Dieser beschwingte Popsong, zu dem bei Hochzeiten alle tanzen? Von sexueller Nötigung.
Sex ist omnipräsent. Und warum auch nicht? Er ist absolut fantastisch. Ich jedenfalls bekam nicht genug davon. Und ich war gut darin. Sagte ich gut? Streicht das. Perfekt ist das treffendere Wort. Übung macht nun mal den Meister.
Und Übung hatte ich weiß Gott genug.
Was mich daran gemahnte, dass ich mir eine neue Packung Kondome bestellen musste. Sie wurden von einer Firma namens SagEsMitEinemGummi extra für mich gefertigt. Ich entwarf nicht nur die Verpackungen mit meinem Namen darauf – manche Mädels wollten sie gern als Souvenir behalten, und wieso sollte ich es ihnen verweigern? – und legte die Farben fest (ich mochte Rot und Lila. Gelb ließ meine Hoden ein bisschen fahl wirken. Die Farbe war nichts für mich …), sondern bestimmte auch die Art des Gummifilms, seine Stärke – 0,0015 mm, falls es euch interessiert – und die Reizempfindlichkeit.
»Guten Morgen«, krächzte eine meiner Gespielinnen, die gerade aufgewacht war. Sie hauchte einen Kuss auf meinen Nacken. Ich brauchte immer ein paar Sekunden, bis ich mich wieder daran erinnerte, mit wem ich die Nacht verbracht hatte, doch an diesem Morgen war es noch schlimmer, nachdem ich es mir gestern zur Mission gemacht hatte, meine Leber in Rum zu verflüssigen.
»Hast du gut geschlafen?«, flötete die zweite Puppe.
Ich lag auf der Seite, mit dem Gesicht zum Nachttisch, und scrollte durch eine ellenlange SMS, die mir mein Freund und Geschäftspartner Vicious geschrieben hatte. Die meisten Menschen brachten das, was sie zu sagen hatten, in kurzen Sätzen auf den Punkt. Wohingegen dieser Mistkerl Siri missbrauchte und mir die ganze verfluchte Bibel schickte. Beim Aufwachen eine Nachricht von ihm vorzufinden, war, als bekäme man von einem Hai einen geblasen. Sein Text lautete folgendermaßen:
Liebes Schwanzgesicht,
meine Verlobte hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Nervensäge von einer Schwester es wahrscheinlich nicht zu unserem Probe-Abendessen nächsten Samstag schaffen wird, weil sie, nur um ein paar Dollar zu sparen, mit zweimal Umsteigen nach Todos Santos fliegen wird.
Sie ist Emilias Brautjungfer, folglich ist ihre Anwesenheit keine freiwillige Entscheidung, sondern zwingend notwendig. Falls ich sie selbst abholen kommen muss, werde ich dies notfalls tun, würde es aber lieber vermeiden. Du weißt, was ich von Kalifornien halte. New York ist hart für den Körper. Los Angeles ist hart für die Seele.
Ich habe keine Seele.
Ich bitte dich als dein Freund, an Rosies Tür zu klopfen und ihr ein neues Ticket in die Hand zu drücken. Lass ihr von Sue einen Platz in der ersten Klasse, gleich neben deinem, buchen, und stell sicher, dass sie am Freitag zusammen mit dir in diesen Flieger steigt. Kette sie an ihrem Sitz fest, wenn es sein muss.
Dies ist vermutlich die Stelle, wo du dich fragst, wieso um alles in der Welt du mir einen Gefallen tun solltest. Betrachte es als einen Gefallen für Millie, nicht für mich.
Sie steht unter Stress.
Sie macht sich Sorgen.
Und sie hat diesen Scheiß nicht verdient.
Falls Ems kleine Schwester sich einbildet, sie könne tun, was sie will, dann ist sie auf dem Holzweg.
Mach ihr das begreiflich, denn jedes Mal, wenn sie die verantwortungsvolle, genügsame Heilige mimt, verletzt sie damit meine zukünftige Frau.
Und wir wissen alle, wie ich reagiere, wenn etwas, das mir gehört, Schaden erleidet.
Friede sei mit dir, Sackgesicht.
V.
Nicht gerade blumige Prosa, aber so war Baron Spencer nun mal.
Ich streckte mich und spürte, wie ein warmer Körper mit den Wogen aus dunkelblauen, nahtlosen Seidenlaken kämpfte, um mich zu besteigen. Ich war umgeben von weichem Stoff, heißem Fleisch und samtigen Kurven. Die Sonne schien durch das deckenhohe Fenster und auf meine hundert Quadratmeter große Dachterrasse mit ihrem Meer aus frisch gemähtem Gras, das mit der Skyline Manhattans zu verschmelzen schien. Warme Strahlen leckten über meine Haut. Meine Bar rief nach mir, damit ich mir eine Bloody Mary mixte. Bequeme graue und marineblaue Sitzmöbel flehten mich an, die Mädchen auf ihnen zu reiten und das ganze verfluchte New York zusehen und zuhören zu lassen.
Kurz gesagt: Der Morgen rockte.
Was man von Vicious nicht behaupten konnte.
Infolgedessen gab ich mich diesen beiden Frauen – Natasha und Kennedy – hin und tat, wozu Gott oder die Natur, wahlweise beide, mich aufforderten, indem ich es ihnen gründlich besorgte.
Während der bezaubernde Rotschopf – Kennedy, wie mir nun wieder einfiel – sich küssend den Weg von meinem Hals zu meiner Morgenlatte bahnte und Natasha – die rassige, zartgliedrige Yoga-Lehrerin – sich gierig über meinen Mund hermachte, versuchte mein von einem wohlverdienten Kater hämmerndes Gehirn, die neuen Informationen zu verarbeiten.
Millie LeBlanc war also gestresst wegen des Probe-Abendessens. Kein Wunder. Sie war schon immer ein Musterkind gewesen, das alles perfekt haben wollte und hart dafür arbeitete. Ein krasser Gegensatz zu dem Mann, den sie heiraten würde und der Spaß daran hatte, mit seinem trockenen Witz und haarsträubenden Benehmen so viele Menschen wie möglich vor den Kopf zu stoßen.
Sie war die süßeste Person, die ich kannte – was nicht zwingend als Kompliment gemeint war –, und er die mit Abstand gemeinste.
Wahrscheinlich sollte ich über das Was-wäre-wenn nachdenken, immerhin war Millie meine Exfreundin. Weil das menschliche Gehirn nun mal dafür ausgelegt ist, die Lücken zu füllen, ich inzwischen neunundzwanzig und Millie meine einzige ernsthafte Beziehung gewesen war, nahmen die Leute womöglich an, ich hätte mit ihr eine große Liebe verloren.
Wie so oft war die Wahrheit enttäuschend und wenig schmeichelhaft.
Millie war nie meine große Liebe gewesen. Ich mochte sie, aber meine Gefühle für sie waren nicht leidenschaftlich, verzweifelt oder verrückt. Sie lag mir am Herzen, und ich wollte sie beschützen, wenngleich nie auf eine Weise, die mich buchstäblich um den Verstand brachte, wie es bei Vicious der Fall war.
Die Tatsache, dass ich sie immer noch mochte, obwohl sie mich mit ein paar schnöden Abschiedszeilen in den Wind geschossen hatte, bewies, dass wir nicht wirklich füreinander bestimmt waren. Zwar war ich von ihr fasziniert gewesen … doch das hatte sich dann gelegt.
Manchmal denke ich, dass ich einfach in das Bild, das ich mir von ihr gemacht hatte, verliebt gewesen war, oder vielleicht noch nicht einmal das. Aber eines ist unbestritten – solange wir zusammen waren, war ich gut zu ihr. Loyal. Respektvoll. Als Dank dafür hatte sie mich abserviert.
Bis heute habe ich das Gefühl, meine einzige Exfreundin nie richtig gekannt zu haben. Klar, ich kannte ihre Wesensmerkmale, die trockenen Fakten, die man in seinem Profil auf einer Dating-Website angeben würde. Sie war künstlerisch veranlagt, schüchtern und wohlerzogen. Doch ich hatte keine Ahnung, was ihre Ängste, ihre Geheimnisse betraf. Was ihr nachts den Schlaf raubte, was ihr Blut zum Kochen und ihren Körper zum Pulsieren brachte.
Der andere Teil meiner hässlichen Wahrheit war, dass ich all diese Dinge über niemand anderen als Rosie LeBlanc wissen wollte. Aber Rosie hasste mich. Darum blieb ich Single. Eines Tages würde sie ihre Meinung ändern. Sie musste.
Apropos Rosie. Sie nahm nie Geld von Vicious oder Millie an, es sei denn, es war unumgänglich. Das war allgemein bekannt, und sie hatte diesen Standpunkt vergangenes Jahr untermauert, indem sie meine 2,3 Millionen Dollar teure New Yorker Eigentumswohnung mit Second-Hand-Möbeln einrichtete, die insgesamt keine zweihundert Mäuse kosteten. Ich bezweifelte, dass sie sich würde umstimmen lassen, aber einen Versuch war es immerhin wert.
Doch jetzt zurück zu den wichtigen Themen – Sex.
Kennedy besorgte es mir gerade mit dem Mund – wobei sie einiges Talent unter Beweis stellte –, als es an der Tür klopfte. Da niemand ohne einen Code ins Gebäude gelangte und mich in letzter Zeit niemand um einen solchen gebeten hatte, schlussfolgerte ich, dass es Miss LeBlanc höchstpersönlich sein musste.
»Dean!« Ihre raue Stimme sickerte vom Etagenflur aus in jede Faser meines Körpers, und ich wurde augenblicklich noch härter. Was Kennedy offensichtlich nicht entging, denn sie ließ von mir ab und atmete heftig gegen meinen Schenkel. Natasha unterbrach ihr Zungenspiel. Beide erstarrten. Es klopfte noch dreimal. »Mach auf!«
»Ist das wieder dieses seltsame Mädchen?«, fragte Natasha. Sie runzelte die Stirn und zog eine Schnute.
»Darauf kannst du Gift nehmen.«
»Sie ist gruselig«, bemerkte Kennedy.
»Komplett irre«, pflichtete Natasha ihr bei. Als würde ihre Meinung zählen. Für mich. Für Rosie.
Ich setzte mich auf und zog mir eine schwarze Sporthose über. Es tat mir nicht leid um den unterbrochenen Fick. Viel mehr reizte es mich, die kleine Elfe zu sehen und herauszufinden, was sie zu mir führte. Ich stand auf, rieb mir den Schlaf aus den Augen und verstrubbelte extra meine Haare. »Es war mir ein Vergnügen.« Ich gab beiden einen Handkuss, bevor ich mit entschlossenen Schritten zur Tür steuerte. »Wir sollten das bei Gelegenheit wiederholen.«
Es würde keine Wiederholung geben. Dies war ein endgültiger Abschied, und beide wussten das. Es war bereits klar gewesen, als ich sie vergangene Nacht in einer angesagten Bar in Manhattan aufgegabelt hatte, die ich immer dann frequentierte, wenn ich meine individuell gefertigten Kondome zum Einsatz bringen wollte. Die beiden hatten an einem Tisch gesessen und Kokain im Wert von grob einem Riesen geschnupft, als wäre es Puderzucker. Ich hatte vom Tresen aus per Blickkontakt mit ihnen geflirtet und dem Barkeeper signalisiert, ihnen ein paar Drinks zu servieren. Sie hatten mich eingeladen, mich zu ihnen zu gesellen und ein paar Shots mit ihnen zu trinken. Ich lud sie ein, sich auf mein Gesicht zu setzen. Aus einem Drink wurden sieben. Das alte Lied.
»Alter, du bist echt das Letzte.« Kennedy stieg als Erste aus dem Bett. Ich sah zu, wie sie ihr Kleid derart abrupt vom Boden hochriss, als hätte es ihr irgendetwas Böses angetan.
Ach wirklich?, dachte ich. Bevor ich das Taxi herangewinkt hatte, das uns zu mir nach Hause brachte, hatte ich ihnen unmissverständlich klargemacht, dass es nur ein One-Night-Stand war. Wie konnten sie denn glauben, es würde mehr daraus, nachdem ich sie in einer Bar aufgerissen und mit ihnen über Pornofilme geplaudert hatte?
Zum Trost zwinkerte ich ihnen zu, bevor ich in die riesige, in hellen Champagnertönen gehaltene und mit einem cremefarbenen Marmorfußboden ausgestattete Diele schwankte, wo mich von allen Seiten Schwarz-Weiß-Porträts meiner Angehörigen anstarrten, deren breites Lächeln ihre weißen Zähne sehen ließ.
»Äh, Entschuldigung, du Arsch. Wir waren gerade mittendrin!«, schallte Natashas schrille Stimme mir hinterher. Als würde ich magnetisch von der Quelle meiner Libido angezogen, durchquerte ich die Diele und riss die Tür auf. Es war Baby LeBlanc. Meine wunderschöne, verrückte kleine Elfe.
Sie trug ein Paar Jeans ohne Risse und eine schlichte weiße Bluse – ihre Version eines schicken Damenkostüms. Hoch auf ihrem Hinterkopf thronte ein unordentlicher Knoten, und der Ausdruck in ihren großen Augen verriet mir, dass sie nicht erfreut war. Ich lehnte mich mit der Schulter gegen die Tür und grinste.
»Hast du dir das mit dem Brunch anders überlegt?«
»Nur weil du mich mit deiner Drohung, die Miete zu erhöhen, dazu zwingst.« Ihre Augen wanderten kurz zu meinen Brustmuskeln, bevor sie sich wieder auf mein Gesicht hefteten und schmal wurden.
Scheiße, sie hatte recht. Meine Erinnerung an letzte Nacht war vernebelt von Alkohol, Gras und Sex.
»Komm rein.« Ich gab den Weg frei, und sie trat ein.
»Ich dachte, du bietest mir wenigstens einen Kaffee an, bevor du mich in Sachen Miete fickst. So viel zu Gastfreundschaft«, bemerkte sie, während sie sich mit staunendem Blick in meiner Wohnung umsah.
Mir meines gut gebauten Körpers voll bewusst verschränkte ich die Arme vor der Brust und leckte mit der Zunge über meine Unterlippe.
»Du erwartest Gastfreundschaft? Ich kann dir unten in der Bäckerei ein Frühstück besorgen und dir als Dessert ein paar Orgasmen verschaffen«, konterte ich. »Und ficken könnte ich dich auch im Bett, wenn du das vorziehst.«
»Du musst aufhören, mich anzubaggern«, sagte sie mit frustrierend emotionsloser Stimme, während sie an der massiven, weiß-grauen Kochinsel in der Mitte meiner glänzenden Edelstahlküche vorbeiging. Sie pflanzte sich auf einen Barhocker und starrte die leere Kaffeekanne neben der Spüle dermaßen vorwurfsvoll an, als hätte diese ein Hassverbrechen begangen.
»Wieso denn?«, stichelte ich und schaltete die Kaffeemaschine an. Aus welchem Grund musste ich aufhören, sie anzubaggern? Rosie LeBlanc war jetzt Single, nachdem sie ihrem langweiligen Arzt den Laufpass gegeben hatte. Sie war Freiwild, und ich würde ihr nachstellen, bis sie Verbrennungen dritten Grades vom Sex auf dem Teppich hätte.
Tatsächlich war das mein erster Gedanke gewesen, als ich mitbekam, wie dieser Vollpfosten seinen Krempel aus Rosies Wohnung schaffte. Meiner Wohnung.
Ich werde deine Exfreundin vernaschen, noch ehe die Tränen auf ihrem Kissen getrocknet sind. Und es wird ihr so sehr gefallen, dass sie zu mir zurückgekrochen kommt und um mehr fleht.
Im wahren Leben nahm Rosie unterdessen den dampfenden Kaffeebecher, den ich ihr anbot, begierig an und trank einen Schluck. Sie schloss stöhnend die Augen. Jawohl, sie stöhnte