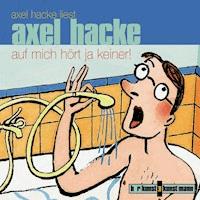Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte E-Book
Axel Hacke
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Plädoyer gegen das Verzagen und für die Heiterkeit »Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst«, schrieb Friedrich Schiller. Doch was ist Heiterkeit eigentlich? Und wie bekommen wir sie in unser ernstes Leben zurück? In Zeiten, in denen uns im Angesicht globaler Krisen intuitiv erst einmal anders zumute ist, macht sich Axel Hacke auf die Suche nach einem fast vergessenen Gemütszustand, nach einer Haltung dem Leben gegenüber, in der wir seltsam ungeübt geworden sind. Unterhaltsam, klug und persönlich erforscht er die Ursprünge des Begriffs, erklärt, was die Heiterkeit vom Witz und von der Fröhlichkeit unterscheidet und warum sie ohne den Ernst des Lebens nicht zu haben ist. »Ein heiterer Mensch zu sein, bedeutet nicht, das Schwere zu ignorieren, sondern es in etwas Leichtes zu verwandeln.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
»Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst«, schrieb Friedrich Schiller. Doch was ist Heiterkeit eigentlich? Und wie bekommen wir sie in unser ernstes Leben zurück? In Zeiten, in denen uns im Angesicht globaler Krisen intuitiv erst einmal anders zumute ist, macht sich Axel Hacke auf die Suche nach einem fast vergessenen Gemütszustand, nach einer Haltung dem Leben gegenüber, in der wir seltsam ungeübt geworden sind. Unterhaltsam, klug und persönlich erforscht er die Ursprünge des Begriffs, erklärt, was die Heiterkeit vom Witz und von der Fröhlichkeit unterscheidet und warum sie ohne den Ernst des Lebens nicht zu haben ist.
»Ein heiterer Mensch zu sein, bedeutet nicht, das Schwere zu ignorieren, sondern es in etwas Leichtes zu verwandeln.«
© Matthias Ziegler
Axel Hacke lebt als Schriftsteller und Kolumnist des Süddeutsche Zeitung Magazins in München. Er gehört zu den bekanntesten Autoren Deutschlands, seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Für seine Arbeit wurde er u.a. mit dem Joseph-Roth-Preis, zwei Egon-Erwin-Kisch-Preisen, dem Theodor-Wolff-Preis und zuletzt dem Ben-Witter-Preis 2019 ausgezeichnet. Weitere Lebensläufe unter www.axelhacke.de
Axel Hacke
Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte
E-Book 2023
© 2023 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-6070-8
www.dumont-buchverlag.de
Für Ursula
1
Es ist damals etwas Seltsames passiert.
Ich ging morgens die vier Treppen in mein Büro hinauf, wo ich einen Artikel beginnen wollte, nahm also die erste Treppe, bog ein in die Kurve zur zweiten – da fiel mir plötzlich auf, dass mir etwas nicht mehr einfiel.
Worum es in diesem Artikel gehen sollte nämlich.
Das ist ja Wahnsinn, dachte ich, was ist mit mir los? Schlaganfall, Spontandemenz oder … Dings … Alzheimer? Ich murmelte meinen Namen vor mich hin, mein Geburtsdatum, die Lieblingsspeise meines Vaters, den Kilometerstand meines Autos, den Tabellenstand meines Fußballvereins. Alles da.
Nur …
Nein.
Ein alter Freund und Kollege hatte einige Wochen zuvor angerufen, mit sehr vertrauter Stimme, in der ich sofort das Freundliche und das Bittende erkannte, das gut Vorbereitete und das Anregende, weiterhin das Nervöse, aber auch das subtil Drängende und deshalb schwer Abzulehnende dessen, der mich gleich nach einem längeren, von mir noch zu verfassenden Text fragen würde, also: ob ich den schreiben könne.
Wahrscheinlich hätte ich wieder keine Zeit, sagte der Freund, der für eine sehr gute Zeitschrift arbeitet. Vermutlich würde ich es nicht machen. Er kenne mich lange und gut genug, um zu wissen, was in mir jetzt vorgehe: die Angst, mir zusätzliche, kaum zu schaffende Arbeit aufzuhalsen; die Furcht, dem Thema nicht gewachsen zu sein; meine Unfähigkeit, Nein zu sagen. Mit der er natürlich, ehrlich gesagt, ein bisschen kalkuliere, als Redakteur. Aber nicht als Freund.
Jedenfalls: Das Thema wolle er mir doch kurz erläutern.
Das tat er.
Und ich hatte zugesagt, schnell und aus einem plötzlichen Gefühl heraus, jenem nämlich, dass dieses Thema mehr mit mir zu tun hatte, als mir im Moment klar war. Und dass ich mich damit unbedingt beschäftigen sollte.
Es war ein Begriff, dachte ich, weiter die Treppe emporsteigend, ein bestimmtes Wort. Aber da, wo sich dieses Wort in meinem Bewusstsein befinden sollte, war einfach ein Loch. Und je länger und angestrengter ich versuchte, dieses Loch zu füllen, je mehr an Anstrengung und Energie ich hineinschaufelte, desto größer wurde es. Es nahm kraterhafte Ausmaße an, und in mir machte sich die Angst breit, nicht nur dieses Wort sei im Krater verschwunden, sondern nach und nach könnte mein ganzes Leben in diesen Schlund rutschen.
Ich nahm die dritte Treppe und die vierte, schloss mein Büro auf, ging zum Schreibtisch, klappte mein großes Notizbuch auf, in dem ich während der vergangenen Tage meine Gedanken zu dem Thema, das mir nicht mehr einfiel, notiert hatte.
Da lachte mir mein Begriff entgegen. Das Wort. Und wie schön es war!
Heiterkeit.
Ich dachte darüber nach, was mit mir los war. Ich hatte zwei mühsame Jahre hinter mir, Krankheiten und Unglücksfälle in der Familie, zwei Angehörige waren gestorben, ein Familienmitglied bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Pandemie und alle damit verbundenen Probleme. In kürzester Zeit hatte ich zwei Bücher und jede Woche eine Kolumne geschrieben, ein Dreivierteljahr ohne Urlaub und freie Wochenenden gearbeitet. Dann wieder viel unterwegs gewesen. Sorgen gemacht.
Mir schwirrte der Kopf.
Und jetzt sollte dieser Aufsatz kommen, dessen Thema nur oberflächlich betrachtet leicht und schwebend anmutete, in Wahrheit aber ein Grundthema meines Lebens und meiner Arbeit umfasste, die Lektüre einer Menge philosophischer Werke erforderte – und …
Der Stress blockiert dein Hirn, dachte ich. Die Angst.
Du solltest es nicht so wichtig nehmen, dachte ich weiter, schraub die Sache nach unten. Es ist nur ein Artikel, und wenn es nicht dein bester wird, auch egal. Das Leben besteht nicht aus den besten Artikeln.
Ich schloss mein Büro ab und machte einen Spaziergang auf dem Alten Südlichen Friedhof. Betrachtete die efeuumrankten, nur selten gut gepflegten, manchmal stark verwitterten, teilweise stark beschädigten Grabsteine all der Professoren und Brauereibesitzerwitwen, der Kolonialwarenhändlertöchter und Kunstmaler, der Kurzschrifterfinder und Oberbergräte, alles Menschen, die ihr Leben im 19.Jahrhundert geführt hatten, als dies der Zentralfriedhof meiner Stadt war.
Ich freute mich, dass es einmal einen bayerischen Regimentskommandeur der Infanterie gab, der tatsächlich Angstwurm hieß, Theodor Ritter von Angstwurm.
Ich setzte mich auf eine Bank und sagte mir, dass alles nicht so wichtig sei, nicht so wichtig, nicht so wichtig. Insbesondere der zu schreibende Text, sagte ich mir, sei nicht so wichtig.
Ich werde mich froh an die Spitze der mir zur Verfügung stehenden Wörter und Gedanken setzen, dachte ich weiter, und sie ins Feld führen wie einst Angstwurm seine Soldaten ins Gefecht …
Nein, nein, eben nicht!
Ich werde einfach schreiben.
Also ging ich wieder in mein Büro und arbeitete. Es ging plötzlich wieder. Ich schrieb den Artikel. Als er fertig war, arbeitete ich weiter und weiter, denn, wie gesagt, das Thema schien mir wichtig, für mein ganzes eigenes Leben, vielleicht sogar für das Leben vieler anderer und auch für die Zeit, die wir gerade alle zusammen hier verbringen.
Wenn ich das Wort heiter höre, denke ich immer zuerst daran, wie gerne ich ein heiterer Mensch wäre, gelassen, entspannt, leicht durch die Tage schwebend. Ich denke an den Neid, den ich empfinde, wenn ich Menschen begegne, die sich so im Leben bewegen.
Zweitens aber fällt mir stets eine Fernsehsendung ein, die in meiner Kindheit überaus beliebt war. Sie hieß Was bin ich? Ein heiteres Beruferaten.
Es handelte sich um ein Quiz. Vor einem Rateteam aus vier Leuten erschienen nacheinander drei Menschen, deren Berufe es herauszufinden galt. Die Gäste wurden von Robert Lembke, dem Moderator, begrüßt. Sie schrieben jeweils ihren Namen auf eine Tafel, kreuzten an, ob sie selbstständig oder angestellt waren, setzten sich. Lembke schlug einen Gong, woraufhin kurz der Beruf des jeweiligen Besuchers (sichtbar aber nur fürs Fernsehpublikum) eingeblendet wurde. Das ging von Friseur über Hausfrau bis zu einer seltsamen Tätigkeit, die, wenn ich mich recht entsinne, Bananenschnüffler hieß – ein Mann, der am Geruch den Reifegrad von Bananen erkennen konnte und auch musste, denn von seinem Wissen hingen große Bananenlieferungen ab. Es folgte eine für den Beruf typische, aber nicht wirklich verräterische Handbewegung.
Wie oft habe ich überlegt, welche die für meinen Beruf typische Handbewegung sein könnte! Ich bin zum Ergebnis gekommen, dass es jener hoffnungsvolle Move sein müsste, mit dem ich beide Hände hinter dem Kopf verschränke, um dann an die Decke zu starren.
Wo sich gelegentlich, wie durch ein Wunder, Gedanken offenbaren.
Oft aber auch nicht.
Lembke fragte die Gäste: Welches Schweinderl hätten S’ denn gern? Sie suchten sich eines der verfügbaren Sparschweine aus. Und es begann die Fragerunde, meistens mit Sätzen wie: Sind Sie mit der Herstellung oder Verteilung einer Ware beschäftigt? Könnte auch ich zu Ihnen kommen? Könnten Sie diesen Dienst an mir vollbringen?
Lautete die Antwort Ja, durfte der Fragende weitermachen, kam ein Nein, ging das Fragerecht an den Nächsten weiter. Lembke warf dann klappernd ein Fünf-Mark-Stück ins Schweinderl und klappte ein Nummernschild um, auf dem die Zahl der Neins verzeichnet war. Nach zehn Neins war Schluss – oder eben vorher, wenn der Beruf erraten war. Dies alles in großer Ruhe und ohne jedes künstliche Drama.
So ging das. Am Schluss setzten die Ratenden Masken auf, die ihre Augen verbanden. Ein Prominenter erschien, es ging beim Raten nun um seinen Namen. Er durfte kein Wort sprechen, denn mancher hätte ihn ja schon an der Stimme erkannt. Er nickte also nur dem Moderator zu. Oder schüttelte eben den Kopf.
In den besten Jahren lag die Einschaltquote bei 75Prozent.
Es war heiter. Ich komme darauf zurück. Es ist ja dieser Begriff, um den es mir geht und der mich so interessiert.
Ich möchte ein heiterer Mensch sein. Manchmal gelingt mir das. Oft nicht. Es gibt Tage, an denen mir die Dinge leichtfallen und das Leben etwas Schwebendes hat. Es gibt andere Tage. Mit Sicherheit ist ihre Zahl größer. Und sind es nicht in den vergangenen Jahren mehr geworden?
Schade. Ich hätte es gern anders.
Das ist banal. Es geht vermutlich jedem so. Man möchte das Leben nicht als Last empfinden, natürlich nicht. Es ist aber nun mal oft schwer: Freunde werden krank, Angehörige sterben, man hat Geldsorgen und fürchtet sich. Die Pandemie und ihre Begleiterscheinungen haben bei vielen von uns ihre Spuren hinterlassen. Die zunehmende Hitze und Dürre der Sommer unserer vergangenen Jahre, dann wieder die Starkregenfälle waren furchterregend. Der Krieg.
Was soll nur werden?
Trotzdem möchte ich ein heiterer Mensch sein. Deswegen ja.
Was heißt das genau: ein heiterer Mensch? Was bedeutet es für uns alle? Und was für mich? Wie wird man so? Kann man überhaupt etwas dafür tun? Und wenn ja, was? Warum schreibe ich überhaupt man?
Was kann ich tun?
Wo sind die Hindernisse?
Und was habe ich vielleicht schon längst getan?
Heiterkeit ist mir ja nicht fremd. Ich kenne sie, in vielen Momenten, auch übrigens, was – nebenbei erwähnt – lustig ist, aus meinen eigenen Texten und meiner eigenen Arbeit.
Apropos.
Das Ehepaar K. schreibt mir, es habe 1995 im Standesamt etwas warten müssen, als das Aufgebot bestellt werden sollte. Um sich die Zeit zu vertreiben, hätten sie meine Kolumne im Süddeutsche Zeitung Magazin gelesen, die an diesem Tag eine interessante Überschrift trug.
Wir lernen heute: Heiraten.
Sie hätten, schrieben sie, mir das immer schon erzählen wollen, weil es so ein unglaublicher Zufall gewesen sei. Aber nun sei etwas anderes geschehen: Ihre Spülmaschine sei kaputtgegangen – und worum sei es an exakt diesem Tag in meiner Kolumne gegangen? Genau: um den defekten Spülapparat in meinem Haushalt.
Das könne kein Zufall sein. »Zwischen Ihren Kolumnen und unserem Leben ist ein mystischer Faden gespannt.« Das habe sie sehr erheitert.
Leser K. schreibt, er lese den Brief aus dem Büro, den ich einmal im Monat kostenlos an Abonnenten verschicke, »fast ausnahmslos mit Heiterkeit und entsprechendem Gewinn«. Leser L. dankt »für Ihre immer wieder aufmunternden Texte«. Frau F. meldet sich mit Dank, »dass Sie so viele Menschen zum Nicken, Schmunzeln, Glucksen oder auch Laut-Loslachen bringen und so das Leben definitiv heiterer und ein bisschen glücklicher machen!«
Und hat nicht nach einer Lesung in Leipzig eine junge Frau erzählt, in der Corona-Zeit habe sie im winzigen Zimmer eines Studentenwohnheims gelebt? Nebenan habe ihre Freundin gewohnt, die eines Tages an Corona erkrankt und nun eingesperrt gewesen sei auf etwa neun Quadratmetern zwischen Tisch, Stuhl, Schrank und Bett. Durch die dünnen Wände habe sie eines Abends die Freundin weinen gehört, es sei kaum zu ertragen gewesen, und so habe sie mein Buch Ein Bär namens Sonntag genommen, sich auf dem Flur vors Zimmer der Freundin gesetzt und ihr durch die geschlossene Tür das Buch vorgelesen.
Nach zwei, drei Seiten habe das Weinen aufgehört.
Wie ist es möglich, dass ich seit Jahrzehnten Geschichten schreibe, die andere Menschen erheitern – ohne selbst ein heiterer Mensch zu sein? Wie funktioniert das, was ich da mache?
Das interessiert mich. Natürlich interessiert es mich. Sehr sogar.
Genau betrachtet, ist das ein undeutlicher Begriff, nicht wahr? Heiter.
Seltsam ist, wie das Wort Heiterkeit auf verschiedenste Lebenslagen verwendet worden ist. Hat es aus diesem Grund so an Kraft verloren und ist – mit Bedeutungen überladen – geradezu bedeutungslos geworden?
Heiter kann der Alkoholisierte ebenso sein wie eine südliche Landschaft. Der Witze-Erzähler wird ebenso als heiter durchgehen wie ein Gedicht von Robert Gernhardt oder eine Zeichnung von Sempé. Heiter ist der Clown, heiter die Kunst, heiter ist im Fachterminus der Meteorologen der zu weniger als einem Viertel mit Wolken bedeckte Himmel, heiter scheint der Lachende, heiter ist ein wie auch immer geartetes Gutdraufsein. Als heiter galt, was eine Mitschülerin in mein Poesiealbum schrieb:
Mach es wie die Sonnenuhr
Zähl die heitren Stunden nur.
Aber haben wir nicht auch Putin schon in heiterer Verfassung gesehen, den Killer, Massenmörder, den verkniffenen kleinen Spießer, im herzlichen Zusammensein mit Gerhard Schröder? Und ging nicht selbst Görings feistes Grinsen einst als heiter durch, war der Inbegriff einer fetten Leutseligkeit, die im Handumdrehen zu vernichtender Grausamkeit werden kann?
»Fahr hin, jovialer Mordwanst!«, schrieb Thomas Mann nach dessen Suizid. Übrigens gilt Mann als einer der heitersten deutschen Autoren, zu denen man natürlich auch Goethe zählen würde. Schiller sowieso, aus dessen Wallenstein schließlich der Satz Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst stammt. Auch Kleist, der seinem Leben selbst ein Ende setzte, haben Germanisten einen Autor der Heiterkeit genannt, Nietzsche war es ohnehin. Davon später mehr.
Großes Thema, wer hätte das gedacht?
Fangen wir noch mal klein an, bei mir und bei diesem Wort. Denn wenn man sich so sehr wünscht, ein heiterer Mensch zu sein, dann muss man es zurückholen aus der Beliebigkeit und dem Ungefähren, muss verstehen, was es heißt. Heißen könnte.
Dieses Beruferaten damals … Warum nannte man es heiter? Warum empfanden wir es auch so?
Es wurde viel gelacht in der Sendung. Die Ratenden begaben sich auf Irrwege, sie hielten den Menschen, der vor ihnen saß, für etwas, das er nicht war. Und da wir, vor dem Fernseher sitzend, dank der erwähnten Einblendung die Wahrheit kannten, wussten wir um die Irrtümer. Das war an sich schon lustig und wurde noch lustiger durch kuriose, schlaue, witzige Fragestellungen und die Kommentare des Moderators Robert Lembke. Am Ende, als alles aufgeklärt war, wurde über den Beruf des Gastes geplaudert, man sah vielleicht einen Film aus seinem Alltag, lachte viel, und schließlich durfte er das Schweinderl mit heimnehmen.
Das Lachen, das Lustige gehörten zum Heiteren des Abends. Doch das zentrale Zeichen der Sendung war ein anderes. Es hieß: Das hier ist alles nicht so wichtig. Es ist ein kleines, entspanntes Spiel, keine große Show. Niemand wird mit Getöse vorgestellt, nie ist es laut in der entspannten Runde im unspektakulär eingerichteten Studio, in dem Lembkes Foxterrier Struppi (nach dessen Tod Nachfolger Jacky) das Geld bewacht, das es zu gewinnen gilt. Es geht nicht um Millionen, nur um maximal zehn Fünf-Mark-Stücke. Es geht um ganz normale Menschen und ihre manchmal überaus interessante Arbeit. Niemand will wirklich etwas: Das Publikum soll nicht zu brüllendem Lachen gebracht werden. Die Ratenden müssen auch nicht unbedingt erfolgreich sein, im Gegenteil: Wenn sie es nicht sind, ist es viel schöner.
Es geht um Freundlichkeit, Wohlwollen, um tatsächliches Interesse an der Arbeit von Leuten, die sonst nie im Fernsehen sind.
Es geht um Lächeln, Leichtigkeit, Nonchalance.
Um Heiterkeit.
2
Jetzt aber – bevor wir dem Begriff noch näher zu Leibe rücken – erst einmal folgende Frage: Welches Recht haben wir, uns in Zeiten wie diesen überhaupt mit einem solchen Thema zu beschäftigen: Heiterkeit? Gab es denn jemals eine Epoche, in der sich die Menschheit ernsteren Forderungen gegenübergesehen hätte, fürchterlicheren Bedrohungen, schlimmeren Aussichten? Allem voran dem grundsätzlichen Wandel des Klimas auf der Erde, der alles infrage stellt, was bisher unser Leben ausgemacht hat? Gleichzeitig dem Wahnsinn des Krieges und seiner Folgen mitten in Europa? Der Angst vor der Zerbrechlichkeit vieler Demokratien, die wir gesichert glaubten?
Schreit diese Zeit nicht zuallererst nach Ernst, noch mal Ernst und dann wieder: nach tiefstem Ernst? Ganz und gar nicht nach Heiterkeit? Darf man sich jetzt mit einer solchen Sehnsucht beschäftigen? Sollte man es? Kann man es überhaupt, an die Wand gedrückt von Krisen, Katastrophen und all dem Kummer, der damit zusammenhängt? Von den persönlichen Problemen vieler unter uns, die manchmal aus den gesellschaftlichen folgen und sich dann noch zu ihnen addieren? Und: Heißt es nicht, diesen Ernst zu leugnen, wenn wir uns ausgerechnet jetzt die Frage nach unserer Heiterkeit stellen?
Im Antiquariat finde ich ein Büchlein, Heilkraft des Humors von Michael Titze. Darin steht: »… leben wir gegenwärtig in einer Zeit, die von Katastrophenstimmung und Zukunftsängsten erfüllt ist. Angesichts sterbender Wälder, steigender Arbeitslosenzahlen und ganzer Legionen von Atomraketen scheint der Gegenwartsmensch tatsächlich nichts mehr zu lachen zu haben.«
Erscheinungsjahr war 1985.
Ich krame, mit diesen Fragen beschäftigt, ein wenig im Internet herum und entdecke einen Text des Philosophen Wilhelm Schmid, in dem er den Begriff, um den es hier geht, näher betrachtet. Das Manuskript, für das Radio geschrieben, beginnt: »Ist dies eine Zeit, in der die Heiterkeit am Platz ist? Das würden wohl die meisten Menschen verneinen. Zu viele schlimme Nachrichten stürmen auf uns ein, und bei manchen gibt es Gründe, der Verzweiflung näher zu sein als der Heiterkeit.«
Das stammt vom Mai 2001, also aus der Zeit vor den Attentaten vom 11.September. Nicht, dass dies leichte Jahre gewesen wären, aber von den Zuspitzungen unserer Tage waren wir, vorsichtig ausgedrückt, etwas entfernt. Dennoch stellte sich dieselbe Frage: Darf man …?
Wir könnten weiter zurückgehen, den Menschheitsängsten auf der Spur.
Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen
Und sehen auf die großen Himmelszeichen,
Wo die Kometen mit den Feuernasen
Um die gezackten Türme drohend schleichen.
So beginnt ein berühmtes Gedicht von Georg Heym von 1912 über die auch in seiner Zeit verbreiteten Weltende-Befürchtungen, und übrigens konnte er die Verse nicht mehr mit einem Titel versehen, weil er nämlich vorher, mit 24Jahren, beim Schlittschuhlaufen in der Havel ertrank, als er einem ins Eis eingebrochenen Freund helfen wollte.
Woraus wir lernen …
Nein, wir lernen gar nichts daraus.
Oder doch?
Jakob van Hoddis, der als Hans Davidsohn 1887 zur Welt kam und vermutlich 1942 im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurde, veröffentlichte 1911 ein dann berühmt gewordenes expressionistisches Gedicht.
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,
In allen Lüften hallt es wie Geschrei.
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei
Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
Das war aber schon als Karikatur auf die Bürger gemeint, die in jedem Missgeschick des Tages (der Hut fliegt weg, es plagt ein Schnupfen) das Weltende sahen: Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Karl Kraus schrieb wenig später sein Riesenwerk Die letzten Tage der Menschheit. Eine Anthologie expressionistischer Dichtungen von Kurt Pinthus hieß Menschheitsdämmerung. Kandinsky, Poelzig, Dix, Beckmann malten Bilder der Apokalypse.
Der Komet Halley, der 1910 wiederkehrte und vor dem sich die Menschen zu allen Zeiten fürchteten, hatte grundsätzliche Ängste verschärft und ihnen einen konkreten Bezugspunkt verliehen. Der Weltkrieg gab den Rest dazu.
Der sich anschließende Gedanke ist: Gab es, so betrachtet, überhaupt je eine Zeit, in der Heiterkeit am Platze war? Waren die Jahre nicht immer viel zu übel?
Wenn das aber so wäre, was hätte es für Folgen für unseren Umgang mit diesem offenbar doch grundsätzlichen Ernst der Zeiten? Und weil wir schon mal dabei sind, hier gleich das leise Antippen einer viel größeren Frage: Könnte es sein, dass hinter unserer Furcht, die Dürren und Hochwasser, die Eisschmelzen und Starkregen könnten Vorboten des allgemeinen Untergangs sein, unsere jeweils ganz private Todesangst lauert, das Bangen vor der Individual-Apokalypse?
Vor einer Weile befasste ich mich einmal ausführlich mit dem Werk der Wiener Kolumnistin Doris Knecht, was eine Freude war, denn es handelt sich um eine tolle Autorin. Sie bekam in der Schweiz einen Preis verliehen, ich hielt die Lobrede, deshalb las ich vieles von dem noch einmal, was sie geschrieben hatte.
In einem Text aus dem Jahr 2022 berichtete Knecht, eine Leserin habe sich beschwert: Sie, Knecht, hatte etwas über ihre Lieblingsspeisen geschrieben. Die Leserin hatte einen Fluchthintergrund und half nun selbst und selbstlos anderen Geflüchteten. Sie fand es lächerlich und oberflächlich, angesichts der damals aktuellen Situation (vor allem des Krieges in der Ukraine) etwas über Essensvorlieben lesen zu müssen.
Knecht schrieb die klaren und eleganten Sätze: »Natürlich hat sie recht. Aber ich finde, sie hat auch ein bisschen nicht recht.«
Sie schrieb weiter: »Wir haben diesen Krieg nicht angefangen, keiner von uns wollte ihn, alle sind entsetzt. Ich finde nicht, dass wir uns Tag und Nacht dafür schuldig fühlen sollten, dass wir weiter das tun, was auch die Menschen in der Ukraine taten und weiter tun wollten: ganz normal in Frieden leben.« Dieser Krieg höre nicht auf, wenn wir aufhörten, uns zu freuen an unseren Kindern, an einem guten Essen, an Kunst. Den Menschen in der Ukraine und den Flüchtenden gehe es nicht besser, wenn wir den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen hätten wegen unserer Ohnmacht. »Was stattdessen passiert: Wir lassen Putin auch Krieg führen gegen uns«, schrieb sie. Dann gewinne Putin. Dann bestimme Putin auch über unser Leben und nehme auch uns die Freiheit. »Helfen wir den Menschen in der Ukraine und auf der Flucht, wie und wo wir können, aber lassen wir Putin nicht bestimmen: wie wir leben wollen, woran wir uns freuen und was wir schreiben.«
Ist es nicht so auch mit unserem Thema? Wäre es nicht Unsinn, die Heiterkeit aus unserem Lebensplan zu streichen, weil die Umstände und Aussichten gerade enorm unheiter sind? Würden wir uns nicht gerade das nehmen lassen oder selbst nehmen, dessentwegen wir an diesem Leben hängen? Sollten wir nicht sogar gerade dann heiter sein, wenn die Zeiten es nicht sind?
Ich denke an die Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich, vor der – sie war da schon 91 – einmal ein mittelalter Mann in einem Frankfurter Hörsaal ein längeres Statement über die düstere Lage der Nation abgab, vom allgemeinen Werteverfall bis zur Unfähigkeit der Politiker. Vom Untergang der Welt war seine Klage wohl nicht weit entfernt.
Mitscherlich lächelte nur und sagte: »Das ist mir alles viel zu wehleidig, junger Mann. Sie sind ja nur am Jammern. Lassen Sie es mich so sagen: Jedes Leben hat seine Erschütterung, jede Zeit auch. Diese Selbstverständlichkeit zu beklagen – da machen Sie es sich sehr einfach.«
Noch einmal also die Frage: Was kann uns das, was wir Heiterkeit nennen, in Zeiten bedeuten, in denen der Weltuntergang bevorzustehen scheint? Oder müssten wir nicht besser fragen, was dieser Begriff uns seit eh und je zu bedeuten hat?
Ein Abend im Spätsommer 2021.
Ich liege nach dem Abendessen auf der Couch und sehe im Fernsehen wieder mal die Corona-News. Das ist schlimm genug. Aber nun flackern über den Bildschirm auch noch Flammen brennender Wälder auf der griechischen Insel Euböa. Wochen zuvor habe ich Häuser im Ahrtal in wilden Fluten versinken gesehen und verzweifelte Menschen gehört, die ihren Besitz verloren hatten. In einer Fernsehreportage sagte damals ein Mann aus einem der zerstörten Orte, das sei »irgendwie wie eine Apokalypse« gewesen, er habe plötzlich gedacht, die Welt gehe unter.
Dann kommt die Nachricht, es sei mittelhoch wahrscheinlich, dass der Golfstrom zusammenbreche – und das kann einem den Rest geben, obwohl ich, wie gesagt, auf der Chaiselongue liege, mit einem Bier in der Hand, und durchs offene Fenster die Leute in den Straßenlokalen lachen höre. Sofa hin, Bier her: Wie soll man das aushalten, diese Intensität der Information über alles und jedes in der Welt, dieses Dauerfeuer der Unterrichtung, kombiniert mit der Machtlosigkeit all dem gegenüber?
Ich mache den Fernseher aus, weil ich Musik hören will, passend zum Thema.
Johnny Cash. The Man Comes Around.
Diese brüchige Stimme des alten Mannes, der erst einmal gar nicht singt, sondern diese Verse spricht.
And I heard, as it were, the noise of thunder
One of the four beasts saying,
›Come and see.‹ And I saw, and behold a white horse.
Zitiert wird hier (und auch im Weiteren) die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse also, an dieser Stelle 6,1 und 6,2. Da heißt es nämlich:
Dann sah ich: Das Lamm öffnete das erste der sieben Siegel; und ich hörte das erste der vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: Komm! Da sah ich und siehe, ein weißes Pferd …
The hairs on your arm will stand up, sang Cash.
Es ist einer seiner letzten Songs und für mich einer seiner besten. Ich bekomme wirklich eine Gänsehaut, als ich ihn höre, ja, sogar heute, da ich mich an den Moment erinnere, stellen sich mir die Haare auf den Unterarmen wieder senkrecht, einmal, weil er so eindringlich ist, und natürlich auch, weil der Weltuntergang geschildert wird, den ich im Fernsehen gerade in echt auf mich hatte zukommen sehen.
And I heard a voice in the midst of the four beasts
And I looked, and behold a pale horse
And his name that sat on him was death, and hell followed with him.
Wieder die Apokalypse, das letzte Buch des Neuen Testaments.
Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Lebewesens rufen: Komm! Da sah ich und siehe, ein fahles Pferd; und der auf ihm saß, heißt ›der Tod‹; und die Unterwelt zog hinter ihm her. Und ihnen wurde die Macht gegeben über ein Viertel der Erde, Macht, zu töten durch Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde.
So geht es mir abends auf der Couch.
Donnerstimmen. Fahle Pferde.
Wie oft habe ich in den vergangenen Jahren den Weltuntergang kommen sehen!? Wie viel Zeit habe ich mit der Beschwörung des Schlimmsten verbracht!?
Einmal, 2017 – ich erinnere mich genau, weil ich dann, am Tag darauf, eine meiner Kolumnen darüber geschrieben habe – machte ich den Fehler, vorm Einschlafen eine Spiegel