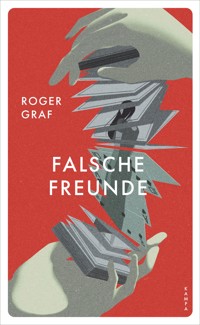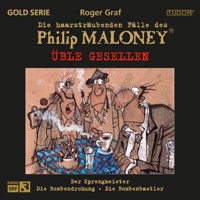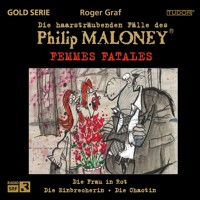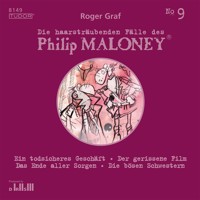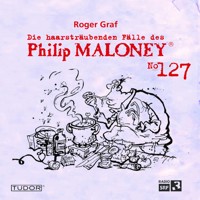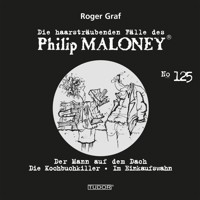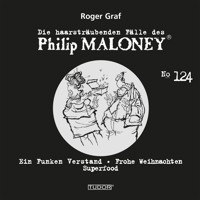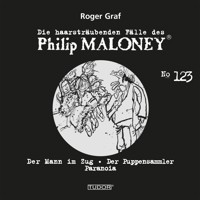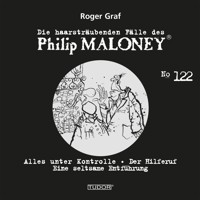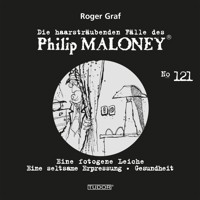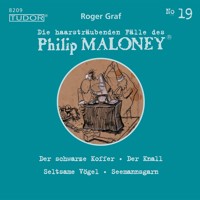Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sein bester Freund ist Whisky, er schläft am liebsten auf dem Boden unter dem Schreibtisch in seinem schäbigen Büro. Der kauzige Privatdetektiv begeistert seit über dreißig Jahren zahllose Krimifans, und das nicht nur in der Schweiz. Auch in Deutschland ist Philip Maloney längst Kult, und seine haarsträubenden Fälle machen süchtig. Der vorlaute Schnüffler mit zweifelhaftem Charakter und ständigen Geldsorgen hat immer einen frechen Spruch auf den Lippen und hangelt sich geschickt von Fall zu Fall und von Leiche zu Leiche. Nur die Frauen hemmen mitunter seine Zielstrebigkeit - und die Ermittlungen. Und noch einen Störfaktor gibt es: Hugentobler, seines Zeichens Kripobeamter, der sehr viele Makel hat, was Maloney so auf den Punkt bringt: »Dümmer als Topflappen.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roger Graf
Üble Sache, Maloney!
Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney
atlantis
Der große Schlaf
Es war eine dieser putzigen Villen, in denen ein Ehepaar problemlos zusammenleben kann, weil es sich oft wochenlang nicht begegnet. Ich ging durch das alte schmiedeeiserne Tor und klingelte. Ein Gong dröhnte durch das Haus. Ich zündete mir eine Zigarette an und wartete. Es dauerte eine Ewigkeit und drei Zigaretten, bis endlich jemand öffnete. Sie sah aus wie die Mädchen in den Heften, die wir uns als Jungs unter der Schulbank weiterreichten. Ich beschloss, vorsichtig zu sein.
»Ich bin Philip Maloney. Frau Winter erwartet mich.«
»Ich bin Frau Winter.«
»Hab ich mir beinahe gedacht.«
»Wie meinen Sie das?«
Ich ging nicht weiter darauf ein. Frau Winter führte mich in den Salon. Ein kleines, hübsches Zimmer, in dem man alle Obdachlosen der Stadt problemlos hätte unterbringen können. In einer Ecke stand ein Stuhl. Frau Winter schenkte sich einen Martini ein. Ich lehnte dankend ab. Morgens trinke ich nur Whisky. Dann kam sie zur Sache.
»Sie wissen, wer mein Mann ist?«
»Vermutlich Herr Winter.«
»Genau. Max Winter, einer der führenden Forscher auf dem Gebiet der Milchschokolade. Es ist ihm gelungen, eine schmelzsichere Schokolade zu entwickeln. Die Araber würden Millionen für die Formel springen lassen. Stellen sie sich einmal vor: Sie spazieren durch die Sahara und sind im Besitz von schmelzsicherer Schokolade!«
»Phänomenal. Darauf hat die Menschheit Jahrtausende gewartet. Und was soll ich jetzt tun?«
»Die Formel finden.«
»Tut mir leid. Ich mache mir nichts aus Zahlen, außer sie stehen auf einem gedeckten Check.«
»Sie werden auf Ihre Rechnung kommen. Gestern Abend wurde bei uns eingebrochen. Die Diebe wussten genau, was sie suchten. Stellen Sie sich einmal vor, die Formel gerät in die falschen Hände – nicht auszudenken.«
Sie blickte entsetzt auf den Kronleuchter, der über uns hing. Dann trank sie noch einen Martini. Ich blieb trocken. Martini schlägt bei mir auf die Blase, und ich hatte Angst, mich auf dem Weg zur Toilette zu verirren und Wochen später in irgendeiner Abstellkammer durch üblen Verwesungsgeruch unangenehm aufzufallen. Ich fragte Frau Winter noch nach einigen Einzelheiten.
»Lieben Sie es auch, nackt vor dem Fernseher zu sitzen?«
»Bitte?«
»War nur so eine Idee. Vielleicht wäre es gut, wenn ich noch mit Ihrem Mann sprechen würde. Möglicherweise hat er irgendeinen Verdacht.«
»Tut mir leid. Mein Mann schläft.«
Ich schlug vor, ihn zu wecken. Frau Winter schüttelte nur den Kopf und begann zu weinen. Ihr Mann war nach dem Einbruch so außer Fassung geraten, dass er in einen Tiefschlaf versank, aus dem er nicht mehr erwachte.
»Haben Sie es schon mit Wasser versucht?«
»Wasser, Martini, Milch, Kaffee – es hilft alles nichts.«
Ich verabschiedete mich und ging in mein Büro. Ich blätterte ein wenig in der neuesten Ausgabe des Telefonbuches. Es ist ganz erstaunlich, was sich die Autoren Jahr für Jahr neu ausdenken. Dann klopfte es an meiner Tür. Die gesamte Kosmetikabteilung eines Warenhauses schob sich elegant in mein Büro. Sie war einfach umwerfend.
»Sie dürfen ruhig wieder aufstehen, Maloney.«
»Aus welchem Strumpfhosen-Werbespot sind Sie denn entstiegen?«
»Ich bin die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, Maloney.«
»Ich stehe mehr auf Salzgebäck.«
»Vielleicht möchten Sie einige Details über Frau Winter erfahren, Maloney?«
»Details?«
»Nicht was Sie meinen, Maloney. Ist es nicht verblüffend, dass Frau Winter noch erstaunlich jung aussieht für ihre 79 Jahre?«
»Donnerwetter. Ich habe sie höchstens für 75 gehalten. Kennen Sie etwa ihr Geheimnis für ewig junge Haut? Dann raus mit der Sprache!«
»Was würden Sie sagen, wenn Frau Winter gar nicht Frau Winter ist?«
»Was sind schon Namen? Ich zum Beispiel hieß früher mal Hippokrates Aristoteles Mahagony.«
»Die Frau, die sich als Frau Winter ausgibt, heißt in Wirklichkeit Vontoblerone und ist eine Agentin des Schweizer Geheimdienstes. Sie soll das Rezept für schmelzsichere Schokolade auf ein Schweizer Nummernkonto transferieren und es dort einfrieren.«
»Ist ja toll. Wissen Sie zufällig auch noch die Hauptstadt von Ruanda?«
»Kigali – warum?«
Es war höchste Zeit, mich mit den Fakten meines Falles zu befassen. Ich ging in ein Spezialitätengeschäft. Die Verkäuferin war gerade damit beschäftigt, aus Streichhölzern einen Turm zu bauen. Ich verlangte nach Schokolade.
»Das ist eine dunkle mit Pfefferminz gefüllte Schokoladenspezialität.«
»Ich dachte, die esse man erst nach acht. Schmeckt ja grauenhaft. Kein Wunder, dass sich außer den Engländern niemand für dieses Rezept interessiert.«
»Und hier ein besonderer Leckerbissen: Schokoladehasen, gefüllt mit Grand Marnier …«
»Pfui Deibel. Zergeht einem ja schon in den Händen. Haben Sie nicht was Haltbareres? Schmelzsicher und so?«
»Sie sind heute schon der Zweite, der danach fragt. Ist es denn seit neuestem Mode, Schokolade in die Sauna mitzunehmen?«
»Ich bitte Sie, ich gehe nie in eine Sauna. Dafür wasche ich täglich meine Socken. Könnten Sie mir den Mann beschreiben, der nach schmelzsicherer Schokolade fragte?«
»Blond, blauäugig, 1,74, 65 Kilo schwer, Tätowierung auf der Brust.«
»Donnerwetter. Werden Sie mich auch so gut in Erinnerung behalten?«
»Wer weiß?«
Es war nicht die Zeit für einen Flirt. Ich ging in eine Bar und trank einen Kaffee. Dabei wurde mir hundeelend. Ich begann zu jaulen und zu apportieren. Schließlich ging der Barkeeper mit mir Gassi. Danach fühlte ich mich wieder stark genug, um einen Baum auszureißen. Es gibt Leute, die mich dafür verantwortlich machen wollen, dass der Wald stirbt. Blödsinn, ich schieße nie auf Bäume. Plötzlich kam mir eine Idee. Ich ging noch einmal ins Spezialitätengeschäft. Und tatsächlich, die Verkäuferin legte gerade den Hörer auf. Als sie mich sah, bekam sie einen roten Kopf. Der Streichholzturm war etwas größer geworden. Ich zückte drohend mein Taschentuch.
»Bitte, bitte, nicht niesen! Das ist ein Geschenk für meinen drei Jahre alten Sohn.«
»Mit wem haben Sie gerade telefoniert?«
»Das war eine Kundin. Sie wollte …«
Ich rümpfte die Nase und setzte zum Niesen an.
»Nein! Ich … Ich habe mit meinem Mann telefoniert … Aber es war wirklich nur ein ganz, ganz kurzer Anruf!«
»Das ewige Telefonieren ist schon ganz anderen Frauen zum Verhängnis geworden. Der Blonde mit tätowierter Brust ist Ihr Mann?«
»Noch nicht, aber vielleicht bald. Wir möchten zusammen in Rimini eine Eisdiele eröffnen.«
»Geniale Idee. Wo finde ich den Kerl?«
»Bitte lassen Sie ihn in Ruhe, er ist ja so nett.«
Ich flatterte noch einige Male drohend mit meinen Nasenwänden, dann gab sie auf. Ich notierte mir die Adresse des Mannes. Dann ging ich in mein Büro und rief meine Klientin an. Ein alter Bekannter war am Draht.
»Ja, hallo, wer spricht da?«
Hugentoblers Stimme war leicht säuerlich, so, wie sie es immer ist, wenn er gerade vor einem unlösbaren Problem steht.
»Hier ist Hippokrates Aristoteles Mahagony.«
»Sieh an, Maloney! An Ihnen kommt wohl keine Leiche lebend vorbei.«
»Sagen Sie bloß, dass der große Schläfer von dannen sei.«
»Nein, nein, der schnarcht noch immer. Die Leiche ist eine junge Frau, die hat jemand einfach eingefroren.«
»Auf einem Nummernkonto?«
»Nein, nein, eine ganz gewöhnliche Tiefkühltruhe. Kannten Sie die Frau?«
Polizisten wären ideale Quizmaster für niveaulose Unterhaltungssendungen. Niemand sonst kann so professionell dumm fragen.
Tja, was macht ein Privatdetektiv, wenn ihm seine Klientin wegfriert? Erraten, er besucht die Leiche. Es war ein kühles Rendez-vous.
»Sieht ein bisschen unterkühlt aus, die Dame.«
»Nach unseren Ermittlungen kann sie noch nicht lange da drin liegen.«
»Sonst noch was gefunden?«
»Nur eine Unmenge von Eis am Stiel.«
»Und der Mann mit dem großen Schlaf?«
»Hilft alles nichts. Habe ihn eine Stunde lang an den Füßen gekitzelt.«
»Und?«
»Mein Finger ist eingeschlafen.«
Ich verließ die Leiche und den Siebenschläfer. In meinem Büro suchte ich mein Taschentuch. Und tatsächlich, es war ein Knoten darin. Doch was wollte mir dieser Knoten sagen? Ich griff zum Telefonhörer. Eine freundliche Stimme empfing meinen Anruf.
»Auskunft, Sie wünschen?«
»Was hat ein Knoten in einem Taschentuch zu bedeuten?«
Die Frau konnte mir auch nicht weiterhelfen. Und so was nennt sich Auskunft. Ich kratzte mich am linken Fuß, da fiel es mir wieder ein. Tatsächlich fand ich in der rechten Socke die Adresse des Mannes, der sich im Spezialitätenladen nach schmelzsicherer Schokolade erkundigt hatte. Ich legte mich zuerst ein paar Stunden hin und trieb dann noch etwas Sport, um fit zu bleiben. Ich stemmte meine Zigaretten dreimal in die Höhe, ehe ich mir eine anzündete. Als das erledigt war, ging ich zu dem blonden Mann mit der tätowierten Brust. Er wohnte in einer Bruchbude direkt neben der Schnellbahn. Ich gehöre nicht zu der Sorte, die alles in vollen Zügen genießen. Im Gegenteil: Ich hasse diese ratternden Ungetüme.
»Nett haben Sie es hier.«
»Was wollen Sie von mir?«
»Sie haben mit Ihrer haarigen Brust einer Verkäuferin den Kopf verdreht. Das läuft unter schwerer Körperverletzung.«
»Sie können ihr den Kopf ja wieder gerade drehen, wenn Sie Lust dazu haben.«
»Dazu fehlt mir das richtige Rezept.«
»Und da soll ich Ihnen aushelfen?«
»Die Frau könnte dringend ein schmelzsicheres Herz gebrauchen.«
»Das habe ich mir beinahe gedacht. Einen Schnüffler riecht man von Weitem.«
Ich schnupperte unter meiner Achselhöhle. Es roch nach Arbeit und 40-Stunden-Tag. Aber ich wusste jetzt, dass dieser Tag bald ein Ende nehmen würde. Der Blondschopf ging zum Bett und griff unter das Kopfkissen. Ich zückte meine Waffe.
»Du kannst dir deine Kondome an den Hut stecken. Das Schlimmste werde ich verhüten.«
»Ich wollte nicht, dass diese Agentin kaltgestellt wird. Ich will nur meine Eisdiele auf Rimini.«
»Und wozu brauchen Sie dann das Rezept für schmelzsichere Schokolade?«
»Ich wollte es auf Softeis anwenden. Stellen Sie sich vor: Am heißen Strand von Rimini eine einzige Eisdiele mit Softeis, das nicht schmilzt.«
Meine Ahnung bestätigte sich, es ging wieder einmal um Geld, Ruhm und andere Leckereien. Fehlte nur noch die Frau. Sie fehlte nicht lange. Plötzlich stand sie neben uns. Sie hatte sich ganz gut erhalten für ihre 79 Jahre. Ich wusste sofort, dass die richtige Frau Winter vor mir stand.
»Mein Mann ist ein alter Trottel. Er hat nur noch Formeln und andere Zahlen im Kopf. Die Idee, das Rezept auf Softeis anzuwenden, habe ich von ihm. Er wollte das Rezept vernichten, weil er befürchtete, dass das Rezept in falsche Hände geraten und damit eine Katastrophe auslösen könnte.«
»Dass die ganze Menschheit mit schmelzsicherer Schokolade überschwemmt wird?«
»Eis, Herr Maloney, Eis. Mein Mann hat erkannt, dass, wenn das Rezept auch bei Eis funktioniert, ganze Kontinente mit schmelzsicherem Natureis zugedeckt werden könnten. Dieser Dummkopf wollte das Rezept tatsächlich vernichten, um die Menschheit zu retten.«
»Und da haben Sie ihn eingeschläfert.«
»Es ging alles gut, bis dann plötzlich diese Schweizer Agentin auftauchte.«
»Und die haben Sie dann kaltgestellt. Ganz schön unverfroren.«
»Was werden Sie jetzt mit uns tun?«
»Es ist an der Zeit, dass Sie endlich singen.«
»Aber wir haben doch schon alles zugegeben.«
Ich packte den Blondschopf an seinen drei Brusthaaren und stand gleichzeitig Frau Winter auf den Hallux am linken Fuß. Sie schrien beide. Dann endlich war es so weit. Sie sangen beide. Es klang grauenhaft.
»Schluss jetzt!«
Ich fand das Rezept unter der Matratze. Ich ließ die beiden liegen und ging dann zum Haus der Familie Winter. Vertraute Klänge erwarteten mich. Herr Winter schnarchte noch immer.
»So, Herr Winter, und wer zahlt jetzt meine Spesen?«
Es half nichts. Der große Schlaf nahm kein Ende. Ich setzte mich in einen Stuhl und dachte über die wirklich wichtigen Dinge im Leben nach. Es fiel mir nichts ein. Scheiße, dachte ich, und ging auf die Toilette.
Die letzte Fahrt
Ich stand am Fenster meines Büros. Der Verkehr draußen interessierte mich nicht sonderlich. Es hat schon sein Gutes, wenn man im ersten Stock wohnt und arbeitet, vor allem dann, wenn man diesen ersten Stock durch das Fenster verlässt. Mein letzter Fall hätte beinahe mit meinem Ableben geendet, so aber brach ich mir nur alle zehn Finger beim Versuch, den Aufprall auf dem Asphalt mit einer eleganten Liegestütze zu bremsen. Die Vorsehung hatte es wieder einmal gut mit mir gemeint. Denn als Konzertpianist wäre ich danach ziemlich aufgeschmissen gewesen. Als Privatdetektiv hat man immerhin noch seinen Kopf und zwei müde Beine. Diese führten mich zu einer Dame namens Frieda Engel. Sie wohnte in einer dieser schmucken Villen, bei denen der Zufahrtsweg länger ist als der langweiligste Sonntagsspaziergang. Ich klingelte. Eine junge Frau erschien.
»Sind Sie Frau Frieda Engel?«
»Ich nix verstehn. Ich nix kaufen. Ich nix wollen Asyl.«
»Seh ich denn etwa aus wie der Flüchtlingsdelegierte?«
»Ich nix gestohlen. Ich nix nehmen Drogen. Ich nix haben gegen Armee.«
»Ist ja schon gut. Ich komme nicht von der Einbürgerungsbehörde. Mein Name ist Philip Maloney. Ich bin Privatdetektiv.«
»Ich nix untreu. Ich nix haben ermordet. Ich nix wollen gestehen.«
»Und ich nix wollen von dir. Verstanden?«
»Und weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Glauben Sie etwa, ich hätte nichts anderes zu tun, als hier blöd herumzustehen und mir Ihre Gipshände anzusehen?«
Das hat man davon, wenn man versucht, auf andere Menschen einzugehen. Hätte ich meine Finger zur Verfügung gehabt und die Waffe gezogen, wäre alles viel schneller gegangen. Das Dienstmädchen tat seinen Dienst und holte Frau Frieda Engel. Ihre Stimme war wie die Ankündigung eines bevorstehenden Tiefdruckgebietes. Sie verzichtete darauf, mir den Gips zu schütteln.
»Seit wann dürfen Invalide Privatdetektiv werden?«
»Sie werden doch wohl nichts gegen Randgruppen haben? Sie gehören schließlich auch zu einer.«
»Ich muss doch sehr bitten. Ich bin keine Randgruppe.«
»Sie gehören zur Spezies der Schwerreichen, und die leben immer am Rand der Städte, dort, wo die Luft noch sauber ist und pro Person zwei Toiletten und drei Badezimmer vorhanden sind.«
»Ich habe Sie nicht hierherbestellt, um mich von Ihnen beleidigen zu lassen.«
»Pech für Sie.«
»Weshalb?«
»Meine Beleidigungen sind gratis, der Rest kostet Sie eine schöne Stange Geld.«
»Mein Chauffeur ist heute nicht erschienen.«
»Kann ich gut verstehen, Frau Engel. Vermutlich ist er zum Teufel gegangen.«
»Ich bin sicher, dass er abgehauen ist. Zusammen mit meiner Stradivari.«
»Sie haben eine Tochter?«
»Eine Stradivari ist eine Violine, gebaut vom berühmten Maestro Antonio Stradivari. Sie ist ein Vermögen wert.«
Das war’s also. Die Trauer über den Verlust des Chauffeurs hielt sich in Grenzen, entscheidend war die Geige. Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich hätte noch nie etwas von Stradivari gehört. Schließlich hat auch unsereins schon aus Langeweile in einem Lexikon geblättert. Aber ich kenne Frauen wie diese Frieda Engel. Sie stellen sich Privatdetektive als ungebildete und ungehobelte Schläger vor, die trinkfest und mit verbeultem Trenchcoat in der schmutzigen Wäsche der anderen herumstöbern und die eigene monatelang nicht wechseln.
Frau Engel führte mich in den Salon und stellte mir eine Whiskyflasche vor die Nase.
»Greifen Sie ruhig zu, ich habe noch zwei in Reserve.«
»Von Greifen kann leider keine Rede sein.«
»Mein Dienstmädchen kann Ihnen behilflich sein.«
»Danke. Aber ein Strohhalm würde es auch tun.«
Sie läutete einen Strohhalm herbei. Ich saugte die Flasche halb leer. Frau Engel strahlte. Ich war jetzt in ihren Augen ein richtiger Schnüffler. Sie engagierte mich.
»Geld spielt keine Rolle.«
»Das habe ich mir beinahe gedacht. Können Sie mir Ihren Chauffeur beschreiben?«
»Ja. Er hat schwarze Haare, zwei Zentimeter über dem Kragen geschnitten. Und er hat Schuppen.«
»Wissen Sie vielleicht auch noch die Länge seiner Wimpern?«
»Ich bitte Sie. Ich sitze im Wagen nie neben dem Chauffeur.«
Ich verabschiedete mich und wollte das Dienstmädchen noch etwas fragen. Aber sie verstand wieder mal nix. Ich ging in mein Büro. Auf dem Bücherregal fand ich, was mir so lange gefehlt hatte. Die Zigaretten lagen in Mundhöhe. Neben meinem Schreibtisch stand die ein Meter große Kerze, die angeblich tausend Stunden brennen sollte. Zehn gebrochene Finger sind noch lange kein Grund, mit allen Lastern aufzuhören.
Als ich den Stummel ins Spülbecken fallen ließ, hörte ich ein Geräusch im Nebenraum. Ein junger Mann stöhnte.
»Helfen Sie mir, Maloney.«
»Soweit ich sehe, sind Sie schon so gut wie tot.«
»Das haben Sie gut beobachtet.«
Der Mann fiel um. Eine Schusswunde klaffte in seinem Rücken. Etwas oberhalb davon lagen eine Menge Schuppen. Noch weiter oben entdeckte ich seine schwarzen Haare. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue: Gipsabdrücke vermeiden.
Es dauerte nicht lange, bis Hugentobler in meinem Büro stand und unangenehme Fragen stellte.
»Haben Sie eine Ahnung, weshalb der Mann ausgerechnet Ihr Büro als letzten Aufenthaltsort gewählt hat?«
»Nicht die Bohne. Bei mir kommt eine Unmenge Gesindel vorbei. Steuerfahnder, Polizisten, Politiker und manchmal auch eine Leiche. Nur eine Putzfrau lässt sich nie bei mir blicken.«
»An welchem Fall arbeiten Sie gerade, Maloney?«
»Dümmer als diese Frage ist nur noch Ihr Gesicht und das hat eine fatale Ähnlichkeit mit gewissen Missbildungen, die normalerweise nur bei Eidechsen vorkommen.«
»Nun mal halblang, Maloney. Sie wollen doch nicht, dass ich Sie wegen Beamtenbeleidigung einbuchte?«
»Die meisten Beamten sind eine Beleidigung für das Auge. Leider ist das nicht strafbar, sonst wären die Gefängnisse voll von Polizisten und anderen Staatsangestellten.«
»Zur Sache, Maloney. Die Leiche hieß Fritz Wunder und war Chauffeur bei einer gewissen Frau Engel. Sagt Ihnen das etwas?«
»Warten Sie mal. Gab’s da nicht mal einen Engel, der an Wunder glaubte? Kann mich aber nicht daran erinnern, dass diese Wunder Fritz hießen. Muss wohl eines dieser bescheuerten Märchenbücher gewesen sein.«
»Sie werden noch von mir hören, Maloney.«
Er ging, wie Polizisten immer gehen: in Uniform. Zurück ließ er einen schlechten Eindruck und ein paar Informationen. Fritz Wunder starb an inneren Blutungen, es musste schon ein paar Stunden her sein, seit auf ihn geschossen wurde. Weiß der Teufel, weshalb er in seinem Wagen als Schwerverletzter ausgerechnet zu mir fuhr. Von einer Stradivari erwähnte der Polizist nichts. Nun hatte ich also einen Fall und eine Leiche, aber keine Anhaltspunkte. Ich tat, was ich in solchen Fällen immer tue: in meiner Lieblingsbar einen heben. Sam, mein Lieblingsbarkeeper war nicht da, dafür ein junger Schnösel, der sich nach meinen Wünschen erkundigte.
»Sam hat mir viel von Ihnen erzählt, Maloney. Sie sollen ja ein ganz toller Bursche sein. Soll ich Ihnen einen Strohhalm bringen?«
»Damit würden Sie meiner Leber keinen und meinen Händen einen doppelten Gefallen tun.«
»Üble Sache. Schlägerei?«
»Ja, vier Typen, alle mit Eisenketten bewaffnet.«
»Und die haben ausgerechnet auf Ihre Hände gezielt?«
»Na klar. Schließlich nennt man mich nicht umsonst die Eisenklaue.«
»Donnerwetter.«
»Ja, und das nur, weil ich in meiner Jugend einmal zwei Kilo Eisen klaute.«
»Darf ich Sie vielleicht um ein Autogramm bitten?«
»Ich finde das nicht komisch, mein Junge.«
»Eingebildeter Affe!«
Ich knallte ihm meine rechte Gipshand unter das Kinn. Es tat höllisch weh. Er verschwand hinter der Theke und gab einige Laute von sich, die mich an Mozarts Requiem erinnerten. Ich schaute mich um und nahm befriedigt zur Kenntnis, dass einige Leute leise tuschelten. So bleibt man im Gespräch, und die Jugend bewahrt ihren Respekt vor dem Alter. Dann ging ich wieder in mein Büro und zum Bücherregal. Ich rauchte. Das Telefon klingelte. Ich stieß den Hörer von der Gabel und legte mich daneben. Der Engel war am Draht.
»Die Polizei war eben bei mir. Was soll ich jetzt tun?«
»Am besten geben Sie eine Annonce auf. Engel sucht Chauffeur ohne Schuppen.«
»Das meine ich nicht, Maloney. Die Stradivari!«
»Weshalb kaufen Sie sich nicht einfach eine Compact-Disc?«
»Soll ich Ihnen mal sagen, was Sie sind?«
Ich bat Sie darum, es nicht zu tun. Sie tat es trotzdem. Manchmal wundere ich mich, woher diese Leute all die schmutzigen Wörter kennen. Vermutlich ist daran das Fernsehen schuld, das durch diese miesen Serien den Wortschatz der besseren Gesellschaft mit einigen Wörtern aus der Anatomie bereichert. Das Ganze dauerte etwa eine Viertelstunde. Ich hörte ein wenig gelangweilt zu. Unsereins kennt da noch viel bessere Ausdrücke. Ich beendete ihr Gefluche mit einem verbalen Frontalangriff.
»Sie können ja nicht mal einen Kandinsky von einer geblümten Tapete unterscheiden, Frau Engel.«
»Sie kennen Kandinsky?«
»Und wie. Ich war ihm in Paris behilflich, als er seinen Verstand verlor. Hat drei Wochen intensivste Nachforschungen gebraucht, um ihn wieder zu finden.«
»Ich hoffe, dass Sie mir auch helfen können.«
»Wird nicht leicht sein. Ihr Verstand ist wesentlich kleiner als der von Kandinsky es war.«
»Ich meine natürlich meine Stradivari.«
»Keine Angst, ich habe da schon eine heiße Spur.«
»Da ist noch etwas. Gülgün ist auch verschwunden.«
»Was denn? Die berühmte Standpauke?«
»Gülgün ist mein Dienstmädchen.«
»Darf ich raten?«
»Bitte schön.«
»Gülgün war die Geliebte Ihres Chauffeurs.«
»Woher wissen Sie das?«
Das genügte fürs Erste. Ich legte auf. Dann saß ich ein wenig herum und überlegte, wo sich ein türkisches Dienstmädchen, das gerade seinen Geliebten erschossen hatte, wohl verstecken würde. Ich suchte zuerst im Kühlschrank und dann in der zweitobersten Schreibtischschublade. Dort fand ich einen verschimmelten Apfel und eine Eintrittskarte für die Fußballweltmeisterschaft in Mexiko, 1968. Dann öffnete ich den Schrank. Ich hatte keine Ahnung, wer die Frau war. Sie saß einfach nur da und gähnte. Es gibt Frauen, die wird man einfach nicht mehr los. Ich beschloss, demnächst eine Ladung Mottenkugeln zu kaufen. Ich wollte ja nicht schuld daran sein, wenn die Gute eines Tages ein mottenzerfressenes Bild des Jammers abgegeben hätte.
Danach kümmerte ich mich wieder um wichtigere Dinge. Bei Sam stand noch immer der junge Schnösel hinter der Theke.
»Sie wollen sich doch nicht etwa bei mir entschuldigen, Maloney?«
»Wo denkst du hin? Eine Tracht Prügel hat noch nie jemandem geschadet. Schau nur mich an. Tausendmal berührt, und tausendmal ist nix passiert.«
»Ach, hören Sie mir mit dem verdammten ›nix‹ auf. Sie hätten wohl leichtes Spiel bei ihr gehabt.«
»Bei wem?«
»Na, bei der schönen Türkin, die eben hier war. Hab versucht, sie anzumachen. Hab ihr gesagt, dass ich gerne mal mit ihr in einem türkischen Bad schwitzen möchte.«
»Und was hat sie geantwortet?«
»Ich nix baden. Ich nix wollen schwitzen. Ich nix haben Deodorant.«
Ich ließ meinen Drink stehen und begann sie zu suchen. Nach zwei Stunden traf ich sie in einem Park. Sie fütterte die Enten.
»Ich hoffe bloß, dass Sie nicht auf die Tierchen schießen, Gülgün. Der Tierschutzverein ist schlimmer als die Polizei und Amnesty International zusammen.«
»Ich nix verstehen. Ich nix … Ach Sie sind es, Maloney. Ich wusste, dass Sie mich finden würden.«
»Wenn Sie es kurz machen, kann ich mir nachher noch die Gutenachtgeschichte im Fernsehen anschauen.«
»Ich wollte ihn nicht erschießen.«
»Tatsache ist, dass Fritz Wunder sein blaues Wunder in Form einer blauen Bohne erlebt hat.«
»Wir wollten weg aus der Stadt. Uns eine eigene Existenz aufbauen. Ich sagte ihm, dass ich nur mitkomme, wenn er die Stradivari mitlaufen lasse. Als Startkapital.«
»Der Traum von Glück und Reichtum. Eigentlich wäre Frau Engel ein sehr guter Anschauungsunterricht gewesen im Fach ›Geld muss nicht glücklich machen‹.«
»Ich bin lieber unglücklich am Swimmingpool als unglücklich neben Putzlappen und Desinfektionsmitteln.«
»Gehe ich recht in der Annahme, dass Ihr Freund da ein wenig anderer Meinung war?«
»Wir trafen uns, kurz nachdem Sie bei Frau Engel gewesen waren. Er sagte, er mache sich nichts aus Geld. Zu viel Geld bringe Unglück. Er habe die Stradivari deshalb verschenkt. Es ist nicht zu fassen. Wir hätten endlich eine Chance gehabt! Und er verschenkt unser Glück.«
»Und da haben Sie abgedrückt.«
»Ich wollte es nicht! Ich hatte die Waffe bei Frau Engel gefunden. Ich wollte Fritz drohen, damit er mir sagte, wo die Geige war. Er ging weg zu seinem Wagen. Ich rannte hinterher, stolperte, und da löste sich ein Schuss.«
Ich glaubte ihr und ließ sie bei den Enten. Wenn sie Glück hatte, würde die Polizei nicht auf ihre Spur kommen. Sie brauchte bloß Glück und einen Engel. Und dieser Engel brauchte bloß eine Stradivari, um wieder einigermaßen zufrieden zu sein. Wenn man den Normalzustand von Frau Engel mit zufrieden überhaupt umschreiben kann.
Ich ging in eine Telefonzelle und blätterte im Telefonbuch. Dieser Fritz Wunder schien ein guter Junge gewesen zu sein. Und gute Jungs haben meist auch noch guten Kontakt zu ihrer Familie.
Familie Wunder lebte in einer kleinen Wohnung im schmutzigeren Teil der Stadt. Vater Wunder ließ mich ein.
»Wissen Sie, Herr Maloney, aus dem Jungen hätte etwas werden können. Aber er machte sich nichts aus Geld. Er wollte bloß genug Geld zum Leben. Da rackert sich unsereins ein Leben lang ab, damit die Kinder mal was werden, und die pfeifen dann einfach auf alles.«
»Haben Sie ihn vor seinem Tod noch gesehen?«
»Ja, er war noch da. Typisch Fritz. Brachte für seine kleine Schwester ein Geschenk mit. Eine Geige! Weiß der Teufel, was da wieder in ihn gefahren war. Dabei ist sie gut in der Schule. Vielleicht wird sie es einmal schaffen, vielleicht erfüllt sie sich einmal unseren Traum vom Reichtum.«
»Kann ich die Geige mal sehen?«
»Tut mir leid. Hab sie auf den Müll geschmissen. Die Kleine soll wichtigere Dinge lernen. Musik! Wer wird schon reich als Geigerin? Nein, nein, das war wieder so eine idiotische Idee von dem Fritz. Er ruhe in Frieden.«
Ich ging und suchte draußen den Müll ab. In einem Hinterhof vernahm ich das Zupfen einiger Saiten. Ich schaute nach und fand ein Mädchen, das dem toten Fritz ähnlich sah. Sie strahlte. Ich ließ sie weiter zupfen. Dann gab ich ihr noch den Rat, die Geige vor ihren Eltern zu verstecken.
Ich weiß nicht, ob sie mit ihrer Stradivari glücklich wurde. Ich weiß nur, dass ich damals eine Nacht bei Frau Engel verbrachte. Sie fluchte stundenlang, und ich trank noch etwas länger. Am nächsten Morgen hatte sie ihre Stradivari vergessen, und mir brummte der Schädel. So kriegt jeder das, was er verdient.
Der Blockwart
Es war an einem sonnigen Frühlingsvormittag. Draußen hämmerte ein Pressluftbohrer, und in der Wohnung über mir war jemand am Staubsaugen. Ich nahm die Wattepfropfen aus meinen Ohren und hörte ein wenig zu. Ich stellte mir das Ganze als Klanggemälde eines modernen Komponisten vor und versuchte dem Lärm ein wenig Kultur abzugewinnen. Es half nichts. Ich stellte das Radio an, es klang auch nicht viel besser. Plötzlich hörte der Staubsauger auf zu saugen. Dafür klopfte es. Sie sah aus wie die Titelseite einer Fernseh-Illustrierten.
»Philip Maloney?«
»Aber ja doch. Und Sie sind sicherlich meine neue Klientin.«
»Schon möglich. Es geht um meinen Mann.«
»Nicht schon wieder!«
»Sie kennen meinen Mann?«
»Nein. Ich kenne ja nicht mal Sie.«
»Mein Name ist Lilian Marti. Ich bin die Moderatorin einer Talkshow im Fernsehen.«
Sie saß aufrecht in ihrem Stuhl, ihre Beine hatte sie übereinandergeschlagen. Ich schätzte sie so um die 40, vielleicht knapp darüber. Ihre Augen waren kühl berechnend. Sie war der Typ Frau, der einem an Seminaren von allem möglichen überzeugen konnte, sogar davon, dass sie Humor hatte. Und irgendwo steckte in ihr auch noch die Klassenkämpferin, die vor langer Zeit in Sandalen den Ho-Chi-Minh-Pfad erkundete und sich dabei einige Blasen an den Füßen holte. Solche Frauen mögen es, wenn man es ihnen nicht allzu leicht macht.
»Ach, wissen Sie, ich mache mir nichts aus Diskussionssendungen. Es wird ja doch nur geredet.«
»Das ist auch der Sinn der Sache.«
»Ich bevorzuge realistische Sendungen. Wo wird denn heutzutage noch diskutiert? Doch nur noch im Fernsehen. Es kommt ja kein Mensch mehr zum Diskutieren, weil sich alle ständig diese Diskussionssendungen anschauen. Eine realistische Sendung wäre doch die, dass man zwei Leuten zuschaut, die sich gerade eine Diskussionssendung anschauen. Aber so was gibt’s nicht im Fernsehen.«
»Ich bin eigentlich nicht hier, um mit Ihnen über das Fernsehen zu sprechen.«
»Sehen Sie, auch Sie verweigern die Diskussion.«
»Wollen Sie diskutieren oder Geld verdienen?«
»Also, wenn Sie mich so direkt fragen – nun ja, diskutieren können wir auch ein anderes Mal. 500 am Tag plus Spesen.«
»Es geht, wie gesagt, um meinen Mann, Stefan Marti.«
»Schon wieder ein untreuer Ehegatte. Langsam werde auch ich noch zum Moralisten, nur damit ich mich nicht andauernd mit Seitensprüngen abgeben muss.«
»Mein Mann wird verdächtigt, einen anderen Mann ermordet zu haben.«
»Das hört sich schon wesentlich erfreulicher an.«
»Für Sie vielleicht.«
»Allen kann man es nie recht machen. Das sollten gerade Sie vom Fernsehen doch wissen. Wen soll er denn ermordet haben?«
»Einen Nachbarn. Jemand hat ihn gesehen, wie er dessen Wohnung verließ. Kurz darauf wurde die Leiche des Mannes gefunden. Von meinem Mann fehlt seither jede Spur.«
»Er ist verschwunden?«
»Ja. Trotzdem kann ich nicht glauben, dass er es gewesen ist. Die Polizei ist da allerdings anderer Ansicht.«
Ich versuchte, meine Freude nicht allzu deutlich auf meinem Gesicht aufscheinen zu lassen. Schließlich sah die Frau ein wenig mitgenommen aus. Endlich wieder ein Fall, der mit einer Leiche beginnt. Da weiß man wenigstens, was man hat. Nicht dass Sie jetzt glauben, unsereins bade täglich in Zynismus. Ich ziehe es vor zu duschen. Frau Marti gab mir einen Vorschuss und einige weitere Informationen. Dann ging sie. Ich schaute mir das Bündel Hunderter etwas genauer an. Danach machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Hugentobler, der Mann mit der niedrigsten Aufklärungsrate der Stadt, kam gerade aus einer Besprechung.
»Sieh an, Maloney, der Schrecken aller Witwen und Waisen. Haben Sie in Ihrer Schreibtischschublade eine Leiche entdeckt?«
»Keine Angst. Aber wenn ich Sie anschaue, wird mir ganz mulmig zumute. Sie sehen aus wie eine Karteileiche. Ein wenig vergilbt und vollgekleckert.«
»Ist das eigentlich ein Hobby von Ihnen, Polizisten zu beleidigen? Wir tun schließlich auch nur unsere Pflicht.«
»Sie tun Ihre Pflicht und unsereins übernimmt die Kür. Das nennt man Gewaltentrennung.«
»Na, dann rücken Sie mal raus mit der Sprache, Maloney. Hinter welchem Fall sind Sie heute her?«
»Sie verdächtigen Stefan Marti des Mordes.«
»Gratuliere. Das war ein lupenreiner Wesfall.«
»Das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie wieder einmal einen Unschuldigen verdächtigen.«
»Unschuldig? Das ist ja direkt zum Lachen, Maloney.«
»Nur zu. Lachen Sie.«
Er lachte tatsächlich. Es klang grauenhaft. Ich wartete ein Weile, um die Peinlichkeit noch ein wenig zu vergrößern. Hugentobler räusperte sich, dann hob ich abwehrend meine Hand.
»Danke. Das genügt. Haben Sie eigentlich auch irgendwelche Talente? So ganz im Verborgenen?«
»Machen Sie sich nur lustig über mich. Aber diesen Stefan Marti kriegen wir schon. Klarer Fall, Maloney. Motiv, Spuren, Zeugen – alles da.«
»Was denn? Und das haben Sie ganz alleine herausgefunden?«
»Nicht ganz, Maloney. Wir sind ja ein Team hier bei der Polizei. Bei der Firmenmeisterschaft im Fußball sind wir immer ganz vorne dabei. Also, nur damit Sie sich wieder beruhigt unter den Schreibtisch legen können: Stefan Marti wurde gesehen, wie er die Wohnung des Ermordeten verließ. Unsere Spurensicherung hat einige Fingerabdrücke von ihm in der Wohnung sichergestellt. Und der Mann hat ein einwandfreies Motiv.«
»Da bin ich aber gespannt.«
»Zu Recht, Maloney, zu Recht. Der Ermordete hatte ein etwas seltsames Hobby. Er hat sich nämlich Karteien von seinen Nachbarn angelegt. Auf denen hat er alles Mögliche über die Leute notiert. Da kam eine ganze Menge zusammen in all den Jahren.«
»Was denn? Der Kerl hat im Privatleben seiner Nachbarn rumgeschnüffelt?«
»Gut zugehört, Maloney, gratuliere.«
»Und dann hat er darüber eine Kartei geführt? Ist der Kerl etwa ein pensionierter Politiker? Oder etwa dieser, wie hieß er gleich …?«
»Nur keine falschen Verdächtigungen, Maloney. Kann Sie teuer zu stehen kommen. Der Mann, der ermordet wurde, war ein pensionierter Beamter. Hat die Kartei wohl nur so zum Spaß angelegt. Sie kennen das ja, es gibt Pensionierte, die auf Baustellen herumlungern, und andere, die sich sinnvollere Hobbys zulegen.«
»Und in der Kartei sind alle Nachbarn?«
»Genau. Bis auf einen. Es gibt keine Karteikarte über Stefan Marti. Oder besser: Als wir kamen, gab es keine mehr.«
»Sie glauben also, dass Stefan Marti diesen Kerl umgelegt hat, um an seine Karteikarte zu kommen?«
»Klingt doch plausibel, oder, Maloney?«
Zugegeben, der Fall war relativ hoffnungslos. Aber schließlich hat auch unsereins ein Gewissen. Nicht gerade das Reinste, aber für unseren Berufsstand reicht es allemal. Ich beschloss also, für Frau Martis Geld noch ein wenig herumzuschnüffeln. Das Haus, in dem der Mord geschah, war ein älteres Mietshaus, in dem zehn Parteien wohnten. Es lag an einer dieser Straßen, die von der Stadt durch Blumentöpfe und andere Verkehrshindernisse beruhigt wurden. Ich klingelte aufs Geratewohl. Eine Frau öffnete. Sie sah aus wie eine Frau, der man in der Waschküche am liebsten aus dem Weg gehen würde. Sie sah aber auch aus wie eine Frau, an der man nicht vorbeikommt.
»Sind Sie von der Polizei? Ich habe nämlich gleich gedacht, dass das die Polizei ist, als es klingelte. Wissen Sie, dieser Mord hier in unserem Haus lässt mir einfach keine Ruhe. Vor allem, weil der Mörder ja noch frei herumläuft. Er läuft doch noch frei herum, oder? Auf jeden Fall stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Schließlich ist das doch meine Pflicht, nicht wahr?«
»Darf ich vielleicht auch mal etwas sagen?«
»Aber natürlich. Also, ich habe mich schon immer darüber gewundert, dass dieser Herr Stoller ständig mit einem Notizblock herumgelaufen ist. Wissen Sie, hier im Haus haben eigentlich alle vermutet, dass er herumspioniert. Vielleicht war er ja ein Agent oder so etwas Ähnliches. Die sehen ja in Wirklichkeit auch aus wie dieser Herr Stoller.«
»Und wie sah dieser Herr Stoller aus?«
»Na eben, wie ein Agent halt so aussieht. Er hat zum Beispiel einen blauen Morgenrock getragen. Das ist mir aufgefallen. Möchten Sie vielleicht hereinkommen und einen Kaffee trinken? Ich trinke immer um diese Zeit einen Kaffee. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Vermutlich steht das auch in diesen Karteikarten von dem Stoller. Trinkt nachmittags gerne einen Kaffee. Also, wenn Sie mich fragen, war dieser Stoller verrückt. Nur Verrückte tun solche Dinge. Ich hatte da mal einen Onkel, aber das interessiert Sie wahrscheinlich nicht.«
»Da haben Sie recht.«
»Wie bitte? Also, kommen Sie mir ja nicht so! Eine Frechheit, da will man der Polizei helfen, und dann das!«
Sie knallte mir die Türe vor der Nase zu. Ich blieb noch eine Weile stehen und rauchte einige Zigaretten. Dann ging ich zurück in mein Büro. Der Presslufthammer klang jetzt schon viel freundlicher. Alles war auf einmal viel freundlicher. Auch der Herr, der vor meinem Büro wartete, war freundlich. Er war so freundlich wie ein Geldeintreiber bei seiner ersten Visite. Ich ließ ihn trotzdem herein.
»Ich habe gehört, dass Sie im Mordfall Stoller ermitteln.«
»Ihr Gehör möchte ich haben, guter Mann. Unsereins hört manchmal kaum seine eigene Stimme.«
»Ich möchte, dass Sie das, was ich Ihnen sage, streng vertraulich behandeln.«
»Vielleicht könnten Sie mir streng vertraulich mitteilen, mit welchem Namen Sie bei Ihrer Geburt bestraft wurden.«
»Mein Name tut nichts zur Sache. Der Fall Stoller ist eine, nun, wie soll ich sagen, eine etwas delikate Angelegenheit.«
»Delikat für wen?«
»Nun, es werden dabei auch Dinge berührt, die von staatspolitischer Bedeutung sind.«
»Von welchem Staat reden Sie? Von Ihrem oder von meinem?«
»Stoller hat früher einmal für uns gearbeitet.«
»Stasi? Haben Sie etwa bei uns politisches Asyl beantragt oder sind Sie auf Stellensuche?«
»Ich bitte Sie. Bei uns heißt das Staatsschutz. Stoller war inoffiziell bei uns als Beamter tätig. Er hat Daten gesammelt und registriert. Aber er wurde schon vor Jahren pensioniert. Niemand hat gewusst, dass er privat weitermachte. Und wir möchten auch nicht, dass das an die große Glocke gehängt wird.«
»Keine Angst. An der großen Glocke hängen bei uns nur kleine Fische.«
»Wir legen Wert darauf, dass der Mordfall Stoller möglichst rasch aufgeklärt wird. Sie verstehen?«
»Na klar. Sie wollen nicht, dass da eventuell noch andere Dinge ins Spiel kommen. Mit anderen Worten, Sie möchten, dass ich den Fall abschließe und die Polizei Stefan Marti einlocht. Mit noch anderen Worten: Wie viel?«
»Nun, wir werden uns sicher einigen. Ganz sicher.«
Ich sah mir den Kerl etwas genauer an. Er sah aus wie diese Typen, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Fahrkartenkontrolle machen: auffällig unauffällig. Ich schmiss den Kerl raus. Nachdem mich die Nachbarin schon beinahe dazu gebracht hatte, den Fall hinzuschmeißen, hatte dieser Kerl genau das Gegenteil bewirkt. Es roch nach Korruption, Skandal und Lügen. Kurz gesagt: Es roch nach Politik. Ich war je länger je mehr davon überzeugt, dass dieser Stefan Marti unschuldig war. Ich lauschte dem Klang des Presslufthammers, bis er verstummte. Danach lauschte ich dem Klang von Lilian Martis Stimme. Sie kam in mein Büro, setzte sich und weinte.
»Mein Mann … Er …«
»Er ist unschuldig, ich weiß.«
»Eben nicht.«
»Was soll denn das wieder heißen?«
»Er hat mich angerufen. Vor etwa zwei Stunden. Und er hat mir gestanden, dass er diesen Stoller umgebracht hat.«
»Schade. Damit ist der Fall wohl abgeschlossen.«
»Er hat auch noch gesagt, dass er Angst habe.«
»Verständlich. Die meisten Mörder haben Angst, dass sie geschnappt werden.«
»Ich glaube nicht, dass er vor der Polizei Angst hat.«
Das Telefon unterbrach uns. Hugentobler war dran.
»Ich habe da eine Neuigkeit für Sie, Maloney.«
»Darf ich raten? Ihre Frau ist mit einem einäugigen Schimpansen durchgebrannt.«
»Falsch, Maloney. Wir haben Stefan Marti gefunden.«
»Na, dann ist ja alles bestens.«
»Nicht ganz. Marti lebt nicht mehr. Er ist ermordet worden.«
»Sind Sie eigentlich in der Schule auch immer zu spät gekommen?«
»Unterlassen Sie die Scherze, Maloney. Ich nehme an, Sie ermitteln weiter?«
Ich schwieg und verabschiedete mich. Lilian Marti heulte noch immer. Ich stopfte mir die Ohrenpfropfen rein. Dann erzählte ich ihr, dass ihr Mann tot war. Ich sah, wie sie ihren Mund aufriss und wieder zuklappte. Danach kullerten wieder Tränen über ihre Wangen.