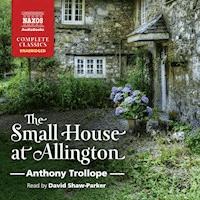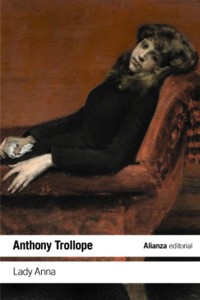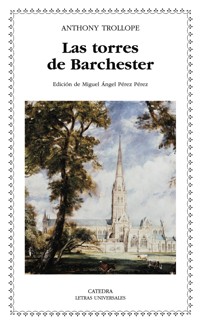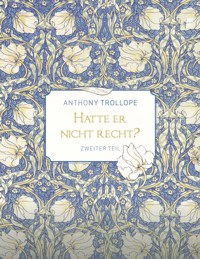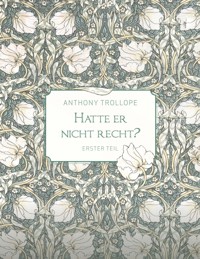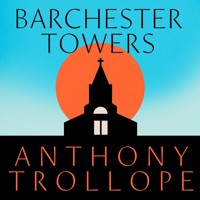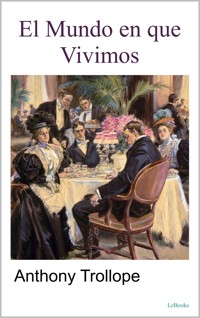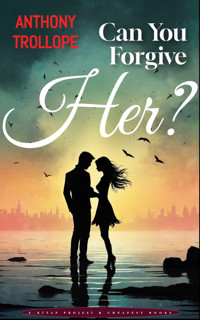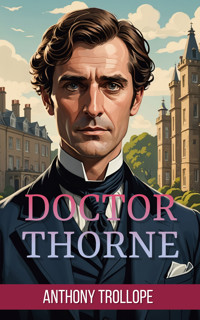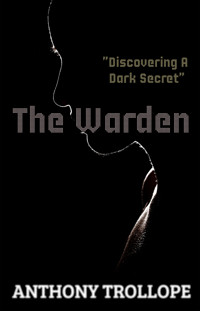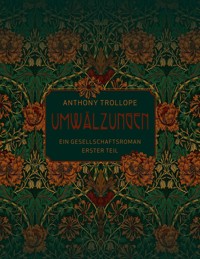
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Umwälzungen
- Sprache: Deutsch
The Way We Live Now / Umwälzungen Erster Teil von Trollopes Gesellschaftsroman London 1870. In der Metropole stoßen Gegensätze aufeinander. Verarmende Adelige sehen sich mit aufstrebenden Geschäftsleuten konfrontiert. Skrupellose Emporkömmlinge konkurrieren gegen honorige Kaufleute. Die Männerwelt wird durch selbstbewusste Frauen aufgeschreckt. Mit Witz und Einfühlungsvermögen schildert Anthony Trollope das Aufeinandertreffen zahlreicher Figuren und deren Konflikte und illustriert damit die Gesellschaft seiner Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 882
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Anthony Trollope (1815-1882), einer der erfolgreichsten englischen Schriftsteller, setzte sich in seinen Romanen mit den Umbrüchen seiner Zeit auseinander und entwarf ein differenziertes und hellsichtiges Bild des gesellschaftlichen Lebens in London genauso wie in der Provinz. Seine besten Romane zeichnen sich durch subtile Ironie und unterhaltsame Milieuschilderung aus.
The Way We Live Now / Umwälzungen
London 1870. In der Metropole stoßen Gegensätze aufeinander. Verarmende Adelige sehen sich mit aufstrebenden Geschäftsleuten konfrontiert. Skrupellose Emporkömmlinge konkurrieren gegen honorige Kaufleute. Die Männerwelt wird durch selbstbewusste Frauen aufgeschreckt. Mit Witz und Einfühlungsvermögen schildert Anthony Trollope das Aufeinandertreffen zahlreicher Figuren und deren Konflikte und illustriert damit die Gesellschaft seiner Zeit.
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
KAPITEL I
KAPITEL II
KAPITEL III
KAPITEL IV
KAPITEL V
KAPITEL VI
KAPITEL VII
KAPITEL VIII
KAPITEL IX
KAPITEL X
KAPITEL XI
KAPITEL XII
KAPITEL XIII
KAPITEL XIV
KAPITEL XV
KAPITEL XVI
KAPITEL XVII
KAPITEL XVIII
KAPITEL XIX
KAPITEL XX
KAPITEL XXI
KAPITEL XXII
KAPITEL XXIII
KAPITEL XXIV
KAPITEL XXV
KAPITEL XXVI
KAPITEL XXVII
KAPITEL XXVIII
KAPITEL XXIX
KAPITEL XXX
KAPITEL XXXI
KAPITEL XXXII
KAPITEL XXXIII
KAPITEL XXXIV
KAPITEL XXXV
KAPITEL XXXVI
KAPITEL XXXVII
KAPITEL XXXVIII
KAPITEL XXXIX
KAPITEL XL
KAPITEL XLI
KAPITEL XLII
KAPITEL XLIII
KAPITEL XLIV
KAPITEL XLV
KAPITEL XLVI
KAPITEL XLVII
KAPITEL XLVIII
KAPITEL XLIX
KAPITEL L
ERSTER TEIL
KAPITEL I
Die drei Herausgeber
Der Leser stelle sich Lady Carbury vor, wie sie an ihrem Schreibtisch in ihrem Zimmer in ihrem Haus in der Welbeck Street sitzt und mit ihrem Charakter und Verhalten in hohem Maße das bestimmt, was auf den folgenden Seiten von Interesse sein mag. Lady Carbury brachte viele Stunden an ihrem Schreibtisch zu und schrieb viele Briefe – und noch viel mehr als nur Briefe. Sie bezeichnete sich zu dieser Zeit als eine Frau, die sich der Literatur verschrieben habe, wobei sie für dieses Wort stets Großbuchstaben verwendete. Welcher Art diese ihre Hingabe war, mag man der Lektüre dreier Briefe entnehmen, die sie an diesem Morgen mit flinker Feder zu Papier gebracht hatte. Lady Carbury war in allem, was sie tat, schnell, und nirgends so schnell wie beim Abfassen von Briefen. Hier folgt der erste Brief:
Donnerstag, Welbeck Street
Mein lieber Freund,
ich habe darauf gesorgt, dass Sie die ersten Seiten meiner zwei neuen Bände morgen oder spätestens am Sonnabend erhalten, sodass Sie, wenn Ihnen der Sinn danach steht, einer bedauernswerten Frau wie mir, die sich nach Kräften abmüht, nächste Woche in Ihrer Zeitung etwas unter die Arme greifen können. Bitte gewähren Sie einer bedauernswerten, sich abmühenden Frau Ihre Unterstützung. So viele Gemeinsamkeiten verbinden uns beide, und ich war so frei, mir damit zu schmeicheln, dass wir Freunde sind! Ich schmeichle Ihnen nicht, wenn ich sage, dass Ihre Hilfe mich nicht nur mehr als Hilfe von anderer Seite unterstützen würde, sondern auch, dass Anerkennung von Ihnen meiner Eitelkeit mehr schmeicheln würde als Lob von anderer Seite. Ich bin mir fast sicher, dass Sie meine Verbrecherinnen auf dem Thron mögen werden. Das Porträt von Semiramis ist zumindest geistreich, obwohl ich die Tatsachen etwas verdrehen musste, um sie als schuldig hinzustellen. Kleopatra habe ich natürlich Shakespeare entnommen. Was für ein Frauenzimmer! Julia konnte ich nicht als echte Königin darstellen; andererseits war es nicht möglich, eine so reizvolle Figur zu übergehen. Sie werden an den zwei oder drei Damen aus dem antiken Rom erkennen, wie getreu ich meinen Gibbon studiert habe. Der arme liebe alte Belisar!
Mit Johanna habe ich mich nach Kräften abgemüht, ich bin aber nicht warmgeworden mit ihr. Heutzutage hätte man sie schlicht in eine Anstalt wie Broadmoor eingewiesen. Hoffentlich finden Sie meine Darstellung von Heinrich VIII. und seiner sündigen, jedoch bedauernswerten Catherine Howard nicht zu drastisch. Anne Boleyn hat mich völlig kaltgelassen. Ich befürchte, dass ich mich bei Katharina von Medici zu übertriebener Ausführlichkeit habe hinreißen lassen; aber sie ist wirklich meine Lieblingskönigin. Was für eine Frau! Was für eine Teufelin! Schade, dass kein zweiter Dante für sie eine eigene Hölle erschaffen konnte. Wie gut kann man doch im Leben unserer schottischen Maria die Spuren ihrer Erziehung erkennen. Ich vertraue darauf, dass Sie hinsichtlich der Königin der Schotten einer Meinung mit mir sind. Schuldig! und wie schuldig! Ehebruch, Mord, Hochverrat und dergleichen. Andererseits neigten einige zur Milde, nur weil sie einem Königshaus angehörte. Aber eine Königin von Geburt und Erziehung, und auch noch vermählt mit einem König, umgeben von solchen Königinnen – wie hätte sie dem Schuldspruch entgehen können? Marie Antoinette habe ich nicht völlig freigesprochen. Es wäre belanglos – möglicherweise sogar unzutreffend. Ich habe sie hingebungsvoll angeklagt und gleichzeitig gelobt und getadelt. Ich hoffe, dass das britische Lesepublikum nicht ungehalten wird, weil ich Caroline, die Frau von König Georg IV., nicht von Schuld reingewaschen habe, zumal ich die Meinung derjenigen teile, die behaupten, sie habe ihren Ehemann hintergangen.
Ich darf Ihre Zeit jedoch nicht mit einem weiteren Werk beanspruchen, obwohl mir der Gedanke behagt, dass ich gerade etwas schreibe, das ausschließlich Sie lesen werden. Tun Sie es, seien Sie so gut, und seien Sie großzügig und lassen Sie Gnade walten. Oder vielmehr, da Sie ja ein Freund sind, erweisen Sie sich als Freund.
Mit dankbaren und aufrichtigen Grüßen
Matilda Carbury
P.S. Wie wenige Frauen es doch gibt, die über dem Chaos stehen, das wir als Liebe bezeichnen, und die zu allem bereit sind, nur nicht dazu, Männern als Gespielinnen zu dienen. Bei nahezu allen dieser genusssüchtigen königlichen Sünderinnen bestand die größte Sünde darin, dass sie irgendwann einmal in ihrem Leben einwilligten, Gespielinnen zu sein und nicht Ehefrauen. Ich habe mich so sehr um Anstand bemüht; aber wenn schon junge Mädchen alles Mögliche lesen, warum sollte eine alte Frau dann nicht auch alles schreiben dürfen?
Dieser Brief war an Mr. Nicholas Broune gerichtet, den Herausgeber des Morning Breakfast Table, einer Tageszeitung hohen Anspruchs; und da er der längste war, galt er Lady Carbury als wichtigster der drei Briefe. Mr. Broune war einflussreich in seinem Beruf – und er mochte die Damenwelt. Lady Carbury hatte sich in ihrem Brief als alte Frau bezeichnet, sie war sich dabei jedoch sehr sicher, dass niemand sonst sie als solche betrachtete. Ihr Alter soll für den Leser kein Geheimnis sein, obwohl es ihren engsten Freunden, nicht einmal Mr. Broune, nie enthüllt worden war. Sie war dreiundvierzig, trug ihre Jahre aber so leicht und war von der Natur derart mit guten Gaben bedacht worden, dass es unmöglich war, ihre Schönheit in Abrede zu stellen. Und sie nutzte ihre Schönheit nicht nur, um ihren Einfluss zu mehren, wie es in der Natur von Frauen liegt, die in dieser Hinsicht begünstigt sind, sondern auch aus der wohlüberlegten Kalkulation, dass sie durch klugen Einsatz der Segnungen, mit denen die Vorsehung sie ausgestattet hatte, die für sie dringend benötigte gewichtige Unterstützung bei der Beschaffung von Brot und Käse erhalten konnte. Sie verliebte sich nicht, sie legte es nicht auf einen Flirt an, sie verpflichtete sich zu nichts, aber sie lächelte und tauschte flüsternd Vertraulichkeiten aus und sah mit großen Augen in die der Männer, als könne es eine geheimnisvolle Verbindung zwischen ihr und ihnen geben – wenn die geheimnisvollen Umstände es nur erlauben würden. Doch der Zweck von alledem war es, jemanden dazu zu bringen, etwas zu unternehmen, das einen Verleger dazu veranlassen würde, sie für anspruchslose Texte gut zu bezahlen, oder einen Herausgeber zur Nachsicht zu verleiten, wenn rein fachlich gesehen Strenge angebracht gewesen wäre. Unter all ihren Freunden in der literarischen Welt war Mr. Broune derjenige, dem sie am meisten vertraute, und Mr. Broune mochte attraktive Frauen. Vielleicht ist es angebracht, dem Leser kurz eine Szene zu schildern, die sich zwischen Lady Carbury und ihrem Freund ungefähr einen Monat vor der Abfassung des hier wiedergegebenen Briefs abgespielt hatte. Sie hatte ihm für den Morning Breakfast Table eine Reihe von Texten für ein Honorar der höchsten Kategorie angetragen, obwohl sie den Verdacht hegte, dass er eher skeptisch bezüglich ihrer Qualität war, und wusste, dass sie ohne besondere Gefälligkeit seinerseits nicht auf eine Vergütung oberhalb Kategorie 2 oder womöglich sogar Kategorie 3 hoffen konnte. Also hatte sie ihm tief in die Augen geblickt und ihre samtweiche Hand einen Augenblick lang in seiner belassen. In einer solchen Lage ist ein Mann häufig peinlich berührt und weiß überhaupt nicht genau, was er wann tun soll! Mr. Broune hatte in einer Aufwallung von spontaner Zuneigung den Arm um Lady Carburys Taille gelegt und sie geküsst. Es würde ihrem Charakter nicht gerecht zu behaupten, dass Lady Carbury empört war, so wie die meisten Frauen empört wären, wenn man so mit ihnen umginge. Es war ein kleiner Zwischenfall, der keinerlei Schaden anrichtete, es sei denn, es wäre zu einem Bruch zwischen ihr und einem wertvollen Verbündeten gekommen. Es waren keine Gefühle verletzt worden. Was also machte es schon aus? Eine unverzeihliche Beleidigung war nicht ausgesprochen worden, Schaden war nicht entstanden, nur musste dem lieben, gefühlsduseligen alten Narren auf der Stelle deutlich gemacht werden, dass es so nicht weitergehen konnte.
Ohne zusammenzuzucken oder zu erröten machte sie sich von ihm los und hielt ihm dann eine gelungene kurze Predigt. »Mr. Broune, wie kann man nur so töricht sein, so danebenliegen und sich so irren! So ist es doch? Sie wollen doch sicher nicht unsere Freundschaft beenden!«
»Unsere Freundschaft beenden, Lady Carbury! O nein, ganz sicher nicht.«
»Warum sie dann durch so etwas aufs Spiel setzen? Denken Sie an meinen Sohn und meine Tochter – beide erwachsen. Bedenken Sie, was ich in meinem Leben alles erduldet habe – was ich alles erlitten habe, und das meiste davon unverdient. Niemand weiß das alles so gut wie Sie. Denken Sie an meinen Ruf, ich bin so häufig verleumdet worden, nie jedoch entehrt. Sagen Sie, dass es Ihnen leidtut, und dann vergessen wir es.«
Wenn ein Mann eine Frau geküsst hat, geht es ihm gegen den Strich, sich gleich darauf dafür zu entschuldigen. Es läuft beinahe darauf hinaus zu behaupten, dass der Kuss den Ansprüchen nicht genügt habe. Mr. Broune konnte das nicht tun, und vielleicht erwartete Lady Carbury es auch nicht unbedingt. »Sie wissen, dass ich Sie um keinen Preis der Welt kränken möchte«, sagte er. Das genügte. Lady Carbury sah ihm nochmals tief in die Augen, und es erging das Versprechen, dass die Artikel gedruckt würden – und zwar gegen großzügige Vergütung.
Nach dem Gespräch betrachtete Lady Carbury es durchaus als Erfolg. Natürlich gibt es kleine Zwischenfälle, wenn man sich anstrengen und fleißig arbeiten muss. Die Dame, die eine Mietdroschke nimmt, muss mit Matsch und Staub rechnen, denen ihre reichere Nachbarin aus dem Weg gehen kann, weil sie eine Kutsche ihr eigen nennt. Sie hätte es vorgezogen, wenn der Kuss unterblieben wäre – aber was machte er schon aus? Für Mr. Broune war die Angelegenheit gravierender. »Zum Teufel mit ihnen allen«, sagte er zu sich, als er das Haus verließ, »ein Mann kann noch so viel Erfahrung haben, er wird sich trotzdem nicht mit ihnen auskennen.« Unterwegs kam ihm vage der Gedanke, Lady Carbury habe eigentlich einen weiteren Kuss von ihm erwartet, und er war fast böse auf sich, weil er ihn unterlassen hatte. Er hatte sie seitdem drei- oder viermal besucht, die Untat jedoch nicht erneut begangen.
Wenden wir uns nun den anderen Briefen zu, die beide an die Herausgeber weiterer Zeitungen adressiert waren. Der zweite richtete sich an Mr. Booker von der Literary Chronicle. Mr. Booker war aufrichtig bemühter und bekennender Literaturliebhaber, keineswegs ohne Talent, keineswegs ohne Einfluss, und keineswegs ohne Gewissen. Aber aufgrund der Art der Kämpfe, die er ausgefochten hatte, durch Kompromisse, die ihm nach und nach aufgezwungen worden waren durch die Konkurrenz von weiteren Autoren auf der einen Seite und auf der anderen durch die Forderungen von Miteignern der Zeitung, die lediglich auf ihren Gewinn achteten, war er in seiner Tätigkeit in eine Routine verfallen, in der es sehr schwer war, gewissenhaft zu sein, und nahezu unmöglich, auf die Empfindsamkeit seines Gewissens der Literatur gegenüber Rücksicht zu nehmen. Er war inzwischen ein kahlköpfiger alter Mann von sechzig Jahren und hatte ein Schar von Töchtern, von denen eine als Witwe mit zwei kleinen Kindern auf ihn angewiesen war. Er verdiente fünfhundert Pfund pro Jahr als Herausgeber der Literary Chronicle, die durch seinen Einsatz ein gewinnbringendes Unternehmen geworden war. Er schrieb für Magazine und publizierte so gut wie jedes Jahr ein eigenes Werk. Er hielt den Kopf über Wasser und galt bei denen, die ihn zwar nicht persönlich kannten, aber von ihm gehört hatten, als erfolgreich. Er war stets guter Dinge und wusste sich in literarischen Kreisen zu behaupten. Durch den Druck der Umstände war er jedoch gezwungen, sich Chancen zu Nutze zu machen, wann immer sie ihm unterkamen, und konnte es sich nicht leisten, unabhängig zu bleiben. Zugegebenermaßen waren Skrupel bezüglich literarischer Qualität in seinem Denken seit langem nicht mehr präsent. Der zweite Brief lautete wie folgt:
An
Mr. Alfred Booker
Literary Chronicle
Redaktion
Strand
Welbeck Street, 25. Februar 187 –
Sehr geehrter Mr. Booker!
Ich habe Mr. Leadham (Mr. Leadham war der ältere Partner in dem Verlagsunternehmen Leadham and Loiter) angewiesen, Ihnen eine frühe Fassung meiner Verbrecherinnen auf dem Thron zuzusenden. Ich habe mit meinem Freund Mr. Broune bereits verabredet, dass ich Ihr Neues Märchen von einer Tonne im Breakfast Table abhandeln werde. Ich bin derzeit damit beschäftigt und mache mir sehr viel Mühe damit. Falls es etwas gibt, das ausdrücklich darin enthalten sein soll in Bezug auf Ihre Ansichten über den Protestantismus jener Zeit, so bitte ich um Mitteilung. Ich würde Sie bitten, mich zu informieren, ob die historischen Details in meinem Buch korrekt sind, wozu Sie, wie ich weiß, sehr wohl in der Lage sind. Zögern Sie nicht zu lange damit, der Verkauf hängt ja so sehr von frühzeitigen Kritiken ab. Ich erhalte lediglich Tantiemen, die erst nach dem Verkauf von vierhundert Exemplaren einsetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Matilda Carbury
Nichts von alledem schockierte Mr. Booker. Er lachte leise und amüsiert in sich hinein, als er sich vorstellte, wie Lady Carbury mit seinen Ansichten über den Protestantismus verfahren würde, und er dachte auch an die zahlreichen historischen Fehler, die dieser cleveren Dame unausweichlich unterlaufen würden, wenn sie über Dinge schrieb, von denen sie seiner Ansicht nach nichts verstand. Allerdings war er sich durchaus bewusst, dass eine wohlwollende Rezension seines gedankenreichen Werks mit dem Titel Das neue Märchen von einer Tonne im Breakfast Table ihm gute Dienste leisten würde, selbst wenn sie aus der Feder einer literarischen Wichtigtuerin stammte, und er würde sich ohne Gewissensbisse mit einem überschwänglichen Lob in der Literary Chronicle revanchieren. Er würde das Buch wohl nicht als historisch korrekt bezeichnen, könnte es jedoch als sehr angenehme Lektüre ankündigen, in der die Charaktereigenschaften der Königinnen mit Meisterhand erfasst worden seien, und bemerken, dass das Werk mit Sicherheit seinen Weg in alle Salons finden werde. In solchen Dingen war er ausgesprochen bewandert und wusste sehr wohl, wie man ein Buch wie Lady Carburys Verbrecherinnen auf dem Thron rezensierte, ohne allzu viel Mühe auf die Lektüre zu verwenden. Er brachte das sogar beinahe fertig, ohne das Buch überhaupt aufzuschneiden, sodass er es weiterverkaufen konnte, ohne dass es an Wert einbüßte. Und dennoch war Mr. Booker ein ehrlicher Mann und hatte sich hartnäckig vielen missbräuchlichen Praktiken im literarischen Bereich entgegengestemmt. Große Schrift, verkürzte Zeilen und die französische Angewohnheit, ausschweifend eine ganze Seite zu bestreiten, ohne viel zu sagen, waren von ihm gewissenhaft getadelt worden. Er stand unter Rezensenten in dem Ruf, eher ein Aristides zu sein. Doch bei seinen finanziellen Verhältnissen konnte er sich nicht völlig gegen die Gepflogenheiten der Zeit stellen. »Schlimm, natürlich ist es schlimm«, sagte er zu einem jungen Freund, mit dem zusammen er seine Zeitung herausgab. »Wer zweifelt daran? Es gibt viele schlimme Dinge, die wir trotzdem tun! Aber wenn wir versuchen sollten, all unsere schlechten Angewohnheiten schlagartig aufzugeben, würden wir nie etwas Gutes bewirken. Ich bin nicht stark genug, die Welt zu verbessern, und ich habe meine Zweifel, ob Sie es sind.« Soweit zu Mr. Booker.
Dann gab es noch den dritten Brief, an Mr. Ferdinand Alf. Mr. Alf leitete die Evening Pulpit und war, wie man allgemein annahm, wohl auch deren Haupteigentümer; diese hatte sich innerhalb der letzten zwei Jahre zu einem »ansehnlichen Unternehmen« gemausert, wie man es in Pressekreisen gewöhnlich ausdrückte. Die Evening Pulpit stand in dem Ruf, ihre Leser täglich über alles zu informieren, was bis zwei Uhr mittags von den führenden Persönlichkeiten in der Hauptstadt gesagt und getan worden war, und mit grandioser Präzision zu prophezeien, was in den zwölf folgenden Stunden gesagt und getan werde. Dies wurde mit dem Anschein grandioser Allwissenheit zuwege gebracht und nicht selten mit einer Ignoranz, die nur knapp von ihrer Arroganz übertroffen wurde. Die Artikel waren jedoch intelligent geschrieben. Die Fakten waren, sofern nicht zutreffend, so doch gut erfunden; die Argumentation war, sofern nicht logisch, so doch überzeugend.
Der federführende Kopf des Blattes hatte jedenfalls die Gabe zu wissen, was die Menschen, an die er sich richtete, gern lesen würden, und wie er seine Themen präsentieren musste, damit die Lektüre als angenehm empfunden wurde. Mr. Bookers Literary Chronicle gab nicht vor, bestimmte politische Ansichten zu vertreten. Der Breakfast Table war dezidiert liberal. Die Evening Pulpit widmete sich intensiv der Politik, hielt sich aber strikt an ihr Motto: »Nullius addictus jurare in verba magistri« und genoss folglich stets das unschätzbare Privileg, scharf zu tadeln, was immer getan wurde, ob von der einen Seite oder von der anderen. Eine Zeitung, die erfolgreich sein möchte, sollte ihre Spalten nie darauf vergeuden, allem und jedem zuzustimmen und ihre Leser dadurch zu ermüden. Elogen sind ausnahmslos öde – eine Tatsache, die Mr. Alf entdeckt und sich zunutze gemacht hatte.
Außerdem hatte Mr. Alf noch etwas anderes entdeckt. Kritik aus dem Mund derer, die gelegentlich Lob äußern, wird als Beleidigung empfunden, und wer beleidigt, wird mitunter zu einem Außenseiter, den die Welt fallen lässt. Hingegen wird Tadel von jenen, die immer etwas auszusetzen haben, als solche Selbstverständlichkeit betrachtet, dass schließlich keine Einwände mehr dagegen erhoben werden. Der Karikaturist, der nur Karikaturen zeichnet, muss sich nicht rechtfertigen, welche Freiheiten er sich auch mit dem Gesicht und der Gestalt eines Menschen nimmt. Es ist sein Beruf, und es ist seine Aufgabe, alles, was er anfasst, durch den Schmutz zu ziehen. Doch wenn ein Künstler mehrere Porträts malt und dabei zwei der Porträtierten entstellt wiedergibt, dann macht er sich mit Sicherheit zwei Feinde, wenn nicht mehr. Mr. Alf machte sich nie Feinde, denn er sprach nie Lob aus, und soweit es seine Zeitung zu erkennen gab, war er nie mit etwas zufrieden.
Mr. Alf war eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Niemand wusste etwas über seine Herkunft oder Vergangenheit. Man munkelte, er sei deutschstämmiger Jude, und es gab Damen, die behaupteten, sie könnten in seiner Aussprache den Hauch eines fremdländischen Akzents hören. Trotzdem gestand man ihm zu, England zu kennen, wie nur ein Engländer es kennen kann. In letzter Zeit hatte er »einen Aufstieg hingelegt«, wie man so sagt, und das sehr gründlich. Mehrere Klubs hatten ihm die Mitgliedschaft verweigert, bei zwei oder drei anderen hatte er hingegen Zutritt erlangt, und er hatte sich angewöhnt, über die, die ihn abgewiesen hatten, in einer Weise zu reden, die bei seinen Zuhörern die Überzeugung vermitteln sollte, sie seien altmodisch, schwachsinnig und dem Untergang geweiht. Er wurde nie müde zu signalisieren, man lebe hinter dem Mond, wenn man Mr. Alf nicht kenne, nicht auf gutem Fuß mit ihm stehe und nicht begreife, dass mit Mr. Alf bekannt zu sein, woher auch immer er stammte, stets als erstrebenswert betrachtet werden müsse. Und was er so ausdauernd behauptete oder andeutete, fand schließlich Glauben bei den Menschen in seiner Umgebung – und Mr. Alf wurde zu einer anerkannten Größe in den unterschiedlichen Sphären von Politik, Wissenschaft und gesellschaftlichem Leben.
Er sah gut aus, war etwa vierzig Jahre alt, gab sich aber den Anschein, als wäre er viel jünger, war schlank, nicht ganz mittelgroß, hatte dunkelbraunes Haar, das ohne die Kunstfertigkeit seines Frisörs einen Hauch von Grau gezeigt hätte, gut geschnittene Züge und ein ständiges mildes Lächeln um seine Lippen, das immer im Widerspruch stand zur Schärfe und Strenge seines Blicks. Er kleidete sich außerordentlich schlicht, aber auch außerordentlich sorgfältig. Er war nicht verheiratet, besaß ein kleines Haus nahe dem Berkeley Square, in dem er bemerkenswerte Abendgesellschaften gab, hielt vier oder fünf Jagdpferde in Northamptonshire und verdiente dem Vernehmen nach 6000 Pfund im Jahr mit der Evening Pulpit, wovon er etwa die Hälfte ausgab. Er stand auf seine Art auf vertrautem Fuß mit Lady Carbury, die es nie an Sorgfalt bei der Anbahnung und Pflege nützlicher Freundschaften hatte mangeln lassen. Ihr Brief an Mr. Alf lautete wie folgt:
Sehr geehrter Mr. Alf!
Lassen Sie mich doch unbedingt wissen, von wem der Verriss von Fitzgerald Barkers letztem Gedicht stammt. Nur weiß ich schon jetzt, dass Sie das nicht tun werden. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals eine so treffende Kritik gelesen zu haben. Ich nehme an, der Arme wird sich bis zum Herbst kaum mehr irgendwo blicken lassen können. Er hat es freilich vollkommen verdient. Ich habe keinerlei Geduld mit Möchtegern-Dichtern, die es unbedingt durch Speichelleckerei und Intrigen bewerkstelligen wollen, dass ihre Bücher auf jedem Salontisch zu finden sind. Ich kenne niemanden, den die Welt in dieser Hinsicht so gutmütig behandelt hat wie Fitzgerald Barker, jedoch kenne ich auch niemanden, den diese Gutmütigkeit dazu veranlasst hätte, dessen Gedichte auch noch zu lesen.
Ist es nicht höchst erstaunlich, wie sich manche Männer immer wieder den Ruf verschaffen, populäre Schriftsteller zu sein, ohne auch nur ein Wort zur Literatur ihres Landes beizutragen, das der Beachtung wert wäre? Das gelingt ihnen, indem sie sich mit unermüdlichem Eifer konsequent aufplustern. Sich aufzuplustern und andere dazu zu bringen, ins gleiche Horn zu stoßen, sind zwei Tätigkeitsfelder eines ganz neuen Berufs geworden. Ich Arme dagegen! Ich wünschte, es gäbe eine Schule und jemand würde mir, einer armen blutigen Anfängerin, Unterricht erteilen. So sehr ich diese Sache aus tiefstem Herzen verabscheue und so sehr ich die Pulpit für ihre Ausdauer in ihrem Kampf dagegen bewundere, bin ich doch so sehr auf Unterstützung für meine eigenen bescheidenen Bemühungen angewiesen und kämpfe, ehrlich gesagt, so sehr um Lohn für meine Arbeit, dass ich wohl, falls sich mir die Gelegenheit böte, meine Ehre vergessen, den hohen Anspruch verdrängen würde, der mir sagt, dass Erfolg weder durch Geld noch durch Freundschaft erkauft werden sollte, und mich auf ein bescheideneres Niveau hinabbegeben würde, damit ich eines Tages voller Stolz feststellen könnte, durch meine Arbeit erfolgreich für die Bedürfnisse meiner Kinder gesorgt zu haben.
Diesen Abstieg habe ich indes noch nicht angetreten, und daher bin ich immer noch so kühn, Ihnen zu sagen, dass ich alles – nicht mit Sorge, sondern mit großem Interesse – zur Kenntnis nehmen werde, das eventuell in der Pulpit über meine Verbrecherinnen auf dem Thron erscheint. Ich erkühne mich zu glauben, dass das Werk, obwohl es aus meiner Feder stammt, sein ganz eigenes Gewicht hat, das ihm zu einiger Beachtung verhelfen wird. Dass meine Ungenauigkeit entlarvt und meine Anmaßung kritisiert werden wird, daran zweifle ich nicht im geringsten, doch Ihr Rezensent wird bestimmt bestätigen können, dass die Anekdoten dem Leben nachempfunden und die Porträts sorgfältig ausgeführt sind. Sie werden es jedenfalls nicht tolerieren, dass man mir sagt, ich hätte eigentlich zuhause bleiben und meine Strümpfe stopfen sollen, wie Sie es neulich über die arme, vom Pech verfolgte Mrs. Effington Stubbs geäußert haben.
Ich habe Sie seit drei Wochen nicht gesehen. Jeden Dienstagabend lade ich einige Freunde ein – kommen Sie doch nächste oder übernächste Woche. Und bitte nehmen Sie mir ab, dass keine noch so große Strenge von Ihnen als Herausgeber oder Rezensent mich dazu bringen wird, Sie anders als mit einem Lächeln zu begrüßen.
Mit den allerherzlichsten Grüßen
Matilda Carbury
Nachdem Lady Carbury diesen ihren dritten Brief beendet hatte, lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück und schloss kurz die Augen, als ob sie sich ausruhen wollte. Doch bald schon fiel ihr wieder ein, dass ihr umtriebiges Leben sich nicht mit solcher Ruhe vertrug. Also griff sie zur Feder und kritzelte weitere Notizen.
KAPITEL II
Die Carburys
Einiges über Lady Carbury und ihre Lebensumstände hat der Leser in den im vorigen Kapitel enthaltenen Briefen bereits erfahren, Weiteres muss freilich noch folgen. Sie erwähnte, sie sei verleumdet worden, sie zeigte jedoch auch, dass ihren Worten über ihre eigene Person nicht mit allzu viel Vertrauen begegnet werden kann. Falls sich dies dem Leser nicht mittels ihrer Briefe an die drei Herausgeber erschlossen hat, wurden sie vergeblich geschrieben. Sie hatte sich zu der Aussage veranlasst gefühlt, Ziel ihrer Arbeit sei es, für die Bedürfnisse ihrer Kinder zu sorgen, und mit dieser edlen Absicht vor Augen kämpfe sie darum, sich in der Welt der Literatur Erfolg zu verschaffen. So verabscheuungswürdig verlogen ihre Briefe an die Herausgeber gewesen waren, so ganz und gar verwerflich die Taktik war, mit der sie Erfolg zu haben versuchte, so sehr sie von Ehrbarkeit und Ehrlichkeit abgekommen war, indem sie sich bereitwillig den schmutzigen Praktiken unterworfen hatte, denen sie in der letzten Zeit ausgesetzt worden war, so waren ihre Behauptungen über sich selbst im Wesentlichen dennoch zutreffend. Ihr war übel mitgespielt worden. Sie war verleumdet worden. Sie war ihren Kindern aufrichtig zugetan – besonders einem der beiden – und bereit, sich die Finger wund zu schreiben, falls sie dadurch ihre Interessen befördern konnte.
Sie war die Witwe eines gewissen Sir Patrick Carbury, der vor vielen Jahren als Soldat in Indien Großes geleistet hatte und daraufhin zum Baronet aufstieg. Er hatte in fortgeschrittenem Alter eine junge Frau geheiratet und sie, nachdem er seinen Fehler zu spät erkannt hatte, bisweilen verwöhnt und dann wieder übelst tyrannisiert. Beides hatte er im Übermaß betrieben. Unter Lady Carburys Fehlern war nie der einer auch nur ansatzweisen Untreue – nicht einmal der rein gefühlsmäßigen – gegenüber ihrem Mann. Als sie, ein hübsches, aber mittelloses Mädchen von 18 Jahren, in die Ehe mit einem Vierundvierzigjährigen einwilligte, der über Einkünfte aus einem großen Vermögen verfügte, hatte sie beschlossen, alle Hoffnung auf jene Art von Liebe aufzugeben, die die Dichter beschreiben und die junge Menschen im Allgemeinen erleben wollen. Bei seiner Eheschließung war Sir Patrick rotglänzend im Gesicht, untersetzt, glatzköpfig, sehr cholerisch, in Gelddingen großzügig, von Natur aus misstrauisch und intelligent. Er verstand es, über Menschen zu herrschen. Er war belesen. Es war keine Spur von Niedertracht in ihm. Er hatte durchaus attraktive Eigenschaften. Er war ein Mann, den man durchaus lieben konnte – hingegen keiner, der seinerseits jemanden lieben konnte. Die junge Lady Carbury hatte ihre Funktion erkannt und entschieden, ihre Pflicht zu tun. Vor dem Gang zum Altar hatte sie beschlossen, sich nie einen Flirt zu erlauben, und sie hatte auch nie mit jemandem geflirtet. Fünfzehn Jahre lang waren die Dinge einigermaßen erträglich für sie verlaufen – die Wortwahl soll dem Leser vermitteln, dass sie sich so abgespielt hatten, dass sie mit knapper Not ertragen werden konnten. Sie hatten etwa drei Jahre zuhause in England gelebt, und dann war Sir Patrick mit einer neuen und wichtigeren Aufgabe zurückgekehrt. Fünfzehn Jahre lang war er leicht erregbar, herrschsüchtig und häufig brutal gewesen, aber nie eifersüchtig. Ein Junge und ein Mädchen waren auf die Welt gekommen, die Vater wie Mutter überaus verwöhnten; die Mutter jedoch war bestrebt, eine Lehre aus der Vergangenheit zu ziehen, als sie ihrer Aufgabe als Mutter nachkam. Praktisch von Beginn ihres Lebens an hatte man ihr beigebracht zu lügen, und ihre Ehe hatte ihr offenbar gezeigt, dass Lügen unvermeidlich waren. Ihre Mutter war vor ihrem Vater geflohen, und sie selbst fand sich in den Händen wechselnder Erzieherinnen, sodass sie bisweilen in Gefahr war, sich an den erstbesten Menschen zu klammern, wenn er sich nur aufrichtig um sie kümmerte; und am Ende hatten ihre schwierigen Lebensumstände sie aggressiv, misstrauisch und verlogen gemacht. Doch war sie klug und hatte sich trotz ihrer schweren Kindheit Bildung und gute Manieren angeeignet – und sie war eine Schönheit. Es war immer ihr Ehrgeiz gewesen, zu heiraten und über Geld zu verfügen, pflichtbewusst ihre Aufgaben zu erledigen, in einem großen Haus zu wohnen und respektiert zu werden – und während der ersten fünfzehn Jahre ihrer Ehe war ihr das trotz großer Schwierigkeiten gelungen. War man grob zu ihr gewesen, so lächelte sie binnen fünf Minuten schon wieder. Ihr Mann schlug sie sogar – und ihre allererste Sorge war, dies vor dem Rest der Welt geheim zu halten. Später trank er zu viel, und sie bemühte sich zunächst, dieses Problem zu bekämpfen, und dann, die schlimmen Auswirkungen dieses Problems zu bekämpfen und geheim zu halten. Dabei jedoch heckte sie intrigante Pläne aus, erzählte Lügen und führte ein Leben voller taktischer Manöver. Schließlich, als sie spürte, dass sie keine ganz junge Frau mehr war, erlaubte sie sich, eigene Freundschaften zu schließen, und unter diesen ihren Freunden war auch jemand vom anderen Geschlecht. Lady Carbury war nicht untreu, falls die Treue einer Frau grundsätzlich mit einer solchen Freundschaft vereinbar ist, falls der Status der Ehe es nicht von einer Frau verlangt, auf jeglichen freundschaftlichen Verkehr mit einem anderen Mann als ihrem Ehemann zu verzichten. Doch Sir Carbury wurde dennoch eifersüchtig, äußerte Worte, die nicht einmal sie ertragen konnte, tat Dinge, die selbst für sie über die Grenzen ihrer taktischen Besonnenheit hinausgingen – und sie verließ ihn. Selbst dabei ging sie freilich so vorsichtig vor, dass sie bei jedem ihrer Schritte ihre Schuldlosigkeit unter Beweis stellen konnte. Diese Phase ihres Lebens ist von geringer Bedeutung für unsere Geschichte, außer dass der Leser wissen sollte, worauf genau sich die Verleumdung bezog. Einen oder zwei Monate lang hörte sie Vorwürfe von den Freunden ihres Mannes und sogar von Sir Patrick selbst. Nach und nach jedoch kam die Wahrheit ans Licht, und nach einem Jahr der Trennung fanden sie wieder zusammen und sie blieb bis zu seinem Tod die Dame des Hauses. Sie begleitete ihn zurück nach England, aber während der kurzen Zeit, die ihm in seiner alten Heimat noch blieb, war er ausgelaugt und sterbenskrank. Allerdings wurde sie unglücklicherweise von Gerüchten über einen angeblichen Skandal verfolgt, und es gab Leute, die nie müde wurden, anderen ins Gedächtnis zu rufen, dass Lady Carbury während ihrer Ehe ihren Mann verlassen hatte und von diesem herzensguten alten Herrn wieder aufgenommen worden war.
Sir Patrick hatte ein durchschnittliches Vermögen hinterlassen, nicht unbedingt große Reichtümer. Seinem Sohn, jetzt Sir Felix Carbury, hatte er 1000 Pfund im Jahr vererbt, und seiner Witwe genauso viel, mit der Klausel, dass diese Summe nach ihrem Tod zwischen seinem Sohn und seiner Tochter aufgeteilt werden solle. Dadurch geschah es, dass der junge Mann, der schon in die Armee eingetreten war, als sein Vater starb, der unter keinem Zwang stand, einen eigenen Hausstand zu gründen, sondern vielmehr zumeist im Haus seiner Mutter wohnte, über ein ebenso hohes Einkommen verfügte wie seine Mutter und seine Schwester, die mit dieser Summe ein Dach über ihrem Kopf finanzieren mussten. Lady Carbury freilich dachte nicht im Traum daran, als sie im Alter von vierzig aus ihrer Knechtschaft befreit wurde, ihr zukünftiges Leben mit den für eine Witwe üblichen Bußtaten zu verbringen. Sie war bislang bestrebt gewesen, ihre Pflicht zu tun, in dem Bewusstsein, dass sie mit ihrer Stellung als Ehefrau mit deren Vorzügen auch deren Nachteile akzeptieren musste. Es waren ihr bis dahin zweifellos viele Nachteile beschieden gewesen. Von einem cholerischen alten Mann beschimpft, überwacht, geschlagen und verflucht zu werden, schließlich durch die Gewalttätigkeit seiner Übergriffe aus ihrem Haus vertrieben zu werden, aus Gefälligkeit wieder aufgenommen zu werden in der Gewissheit, dass ihr Ruf für den Rest ihres Lebens zu Unrecht befleckt war, sich ihre Flucht unablässig vorwerfen lassen zu müssen, und dann schließlich etwa zwei Jahre lang die Krankenpflegerin eines dahinsiechenden Wüstlings zu werden – all das war ein hoher Preis für die Vorzüge, die sie bis dahin genossen hatte. Jetzt endlich war ihr eine Zeit der Entspannung vergönnt – ihr Lohn, ihre Freiheit, ihre Chance auf Glück. Sie dachte viel über sich nach und fasste Vorsätze. Die Zeit für eine Liebesbeziehung war vorüber, und sie würde damit nichts mehr zu tun haben wollen. Erst recht würde sie nie wieder eine Ehe aus rein praktischen Erwägungen eingehen. Aber sie würde Freunde haben, echte Freunde, Freunde, die ihr beistehen würden und denen sie ihrerseits beistehen könnte. Sie würde irgendeiner Tätigkeit nachgehen, sodass ihr Leben für sie auch seine interessanten Seiten hätte. Sie würde in London leben und auf jeden Fall eine Rolle in der Gesellschaft spielen. Eher zufällig als gezielt war sie mit literarischen Kreisen in Kontakt gekommen, doch dieser Umstand war in den letzten beiden Jahren zunehmend wichtiger geworden, als der Wunsch in ihr aufkam, Geld zu verdienen. Von Anfang an war ihr klar gewesen, dass sie sparsam sein musste, nicht in erster Linie oder vielleicht auch gar nicht aus dem Gefühl heraus, dass sie und ihre Tochter mit 1000 Pfund im Jahr nicht gut auskommen konnten, sondern wegen ihres Sohnes. Sie wollte keinen Luxus außer einem Haus, dessen Lage der Gesellschaft den Eindruck vermittelte, dass sie in einem tonangebenden Viertel wohnte. Von der Umsicht ihrer Tochter war sie genauso überzeugt wie von ihrer eigenen. Sie konnte Henrietta in allem vertrauen. Ihr Sohn, Sir Felix, war hingegen nicht sonderlich vertrauenswürdig. Und trotzdem stand Sir Felix ihrem Herzen am nächsten.
Zu dem Zeitpunkt, als sie die drei Briefe schrieb und unsere Geschichte beginnen soll, brauchte sie dringend Geld. Sir Felix war nun fünfundzwanzig, hatte vier Jahre in einem angesagten Regiment gedient, hatte bereits seinen Dienst quittiert, und, um sogleich mit der vollen Wahrheit herauszurücken, das Vermögen, das sein Vater ihm hinterlassen hatte, vollständig verschleudert. So viel war seiner Mutter bekannt – und sie wusste daher, dass sie mit ihren begrenzten Einkünften nicht nur für sich selbst und ihre Tochter, sondern auch für den Baronet aufkommen musste. Sie wusste jedoch nicht, wie hoch der Baronet verschuldet war; allerdings wusste auch er es nicht und auch sonst niemand. Ein Baronet, der Gardesoldat in der britischen Armee war und bekannt dafür, dass ihm von seinem Vater ein Vermögen hinterlassen wurde, kann sich sehr tief in Schulden stürzen, und Sir Felix hatte regen Gebrauch von diesem Privileg gemacht. Das Leben, das er führte, war in jeder Hinsicht liederlich gewesen. Er war eine so schwere Belastung für seine Mutter – und auch seine Schwester – geworden, dass deren Leben zwangsläufig eine einzige Peinlichkeit geworden war. Trotzdem hatten die beiden keinen Augenblick lang jemals mit ihm gestritten. Henrietta hatte durch das Verhalten von Vater und Mutter gelernt, dass man Männern und Söhnen jegliches Laster verzieh, während man von Frauen und Töchtern ausschließlich Tugendhaftigkeit erwartete. Diese Lektion war ihr so früh im Leben erteilt worden, dass sie sie verinnerlicht hatte, ohne eine Spur von Groll zu empfinden. Sie beklagte das schändliche Verhalten ihres Bruders insofern, als es ihn selbst betraf, sie entschuldigte es indessen völlig, soweit es sie betraf. Dass all ihre eigenen Interessen den seinen untergeordnet werden mussten, war für sie vollkommen selbstverständlich; und als sie merkte, dass kleine Annehmlichkeiten ausblieben und ihre bescheidenen Ausgaben gekürzt wurden, weil er, nachdem er alles ihm Gehörende aufgebraucht hatte, jetzt auch all das aufbrauchte, was seiner Mutter gehörte, beklagte sie sich nie. Henrietta hatte gelernt, dass Männer aus der gesellschaftlichen Schicht, in die sie hineingeboren worden war, immer alles für sich aufbrauchten.
Die Gefühle der Mutter waren weniger edel, oder, besser gesagt, vielleicht etwas kritischer. Ihr Sohn war durch sein himmlisches Aussehen immer ihr Augenstern gewesen, das, worauf ihr Herz sich stets gerichtet hatte. Selbst als er eine Torheit nach der anderen beging, hatte sie es kaum jemals gewagt, ihm auf seinem Weg in den Ruin Einhalt zu gebieten. Sie hatte ihn als Jungen rundum verwöhnt, und als Mann verwöhnte sie ihn immer noch. Sie war nahezu stolz auf seine Laster und hatte mit Entzücken von Taten gehört, die, wenn nicht lasterhaft, so doch verheerend waren in ihrer Maßlosigkeit. Sie war ihm gegenüber so nachgiebig gewesen, dass er sich nicht einmal in ihrer Gegenwart für seine Selbstsucht schämte und sich offenbar auch nicht bewusst war, wie ungerecht er sich anderen gegenüber verhielt.
Aus alledem hatte sich ergeben, dass ihr Dilettieren in der Literatur, mit dem sie begonnen hatte, teils weil ihr die Sache Spaß machte, teils weil sie sich davon eine Eintrittskarte in die gute Gesellschaft erhoffte, sich in anstrengende Arbeit verwandelt hatte, mit der sich im günstigsten Fall Geld verdienen ließ. Lady Carbury sagte also die Wahrheit, als sie in den Briefen an ihre Freunde, die Herausgeber, ihre Kämpfe beschrieb. Sie hatte davon gehört, es gebe Männer, die im Bereich der Literatur Erfolg hätten, und – was sie noch mehr beeindruckte – Frauen, die damit Geld verdienten. Und es war ihr so vorgekommen, als ob sie, innerhalb bescheidener Grenzen, ihren Hoffnungen breiten Raum zugestehen konnte. Warum sollte sie ihren Einkünften nicht eintausend Pfund pro Jahr hinzufügen, sodass Felix wieder das Leben eines Gentleman führen und die Erbin heiraten könnte, die in Lady Carburys Bild von der Zukunft alles zu einem guten Ende bringen sollte! Wer sah schon so gut aus wie ihr Sohn? Wer hatte ein angenehmeres Wesen? Wer besaß mehr von dem Wagemut, der unbedingt nötig ist, wenn man Erbinnen zur Ehefrau gewinnen will? Außerdem konnte er seine Frau zur neuen Lady Carbury machen. Alles konnte gut werden, wenn nur genügend Geld hereinkäme, um die gegenwärtige missliche Lage zu überbrücken.
Das gravierendste Hindernis für eine Chance auf Erfolg bei alledem dürfte Lady Carburys Überzeugung gewesen sein, dass sie nicht zum Ziel käme, indem sie gute Bücher verfasste, sondern indem sie gewisse Menschen dazu brachte zu behaupten, ihre Bücher seien gut. Sie arbeitete fleißig an dem, was sie schrieb, jedenfalls so fleißig, dass ihre Seiten sich schnell füllten, und war von Natur aus eine kluge Frau. Sie besaß einen flüssigen, lesbaren, munteren Stil und hatte bereits den Trick erlernt, alles ihr Bekannte so sehr auszuwalzen, dass es viele Seiten füllte. Sie hatte nicht den Ehrgeiz, ein gutes Buch zu schreiben, war aber nach Kräften bemüht, ein Buch zu schreiben, das die Rezensenten für gut befinden würden. Hätte Mr. Broune ihr im stillen Kämmerlein gesagt, ihr Buch sei völliger Schund, es jedoch gleichzeitig fertiggebracht, dass es im Breakfast Table in den höchsten Tönen gepriesen würde, so ist es sehr fraglich, ob die wahre Meinung des Rezensenten auch nur im geringsten ihre Eitelkeit verletzt hätte. Diese Frau war von Kopf bis Fuß verlogen, aber sie hatte auch ihre guten Seiten, obwohl sie verlogen war.
Ob Sir Felix, ihr Sohn, nur durch falsche Erziehung zu dem geworden war, der er war, oder ob er mit einem schlechten Charakter zur Welt gekommen war, wer kann das schon sagen? Es ist kaum vorstellbar, dass er sich nicht besser entwickelt hätte, wenn er bereits als Kind unter dem moralischen Einfluss moralischer Autoritäten gestanden hätte. Andererseits war es kaum vorstellbar, dass eine Erziehung welcher Art auch immer oder auch deren Mangel zu einem Charakter wie dem seinen geführt hätte, der so vollkommen unfähig war, für andere Menschen Gefühle zu empfinden. Er konnte nicht einmal ein Empfinden für eigenes Missgeschick aufbringen, es sei denn, es betraf die äußerlichen Annehmlichkeiten des jeweiligen Augenblicks. Offenbar fehlte es ihm an genügend Vorstellungskraft, künftiges Ungemach zu erahnen, selbst wenn die Zukunft, um die es ging, von der Gegenwart nur durch einen einzigen Monat, eine einzige Woche – ja sogar durch eine einzige Nacht – getrennt war. Er ließ sich gern freundlich umsorgen, loben, verwöhnen und gut verpflegen, und er verlangte liebevolle Beachtung; wer so mit ihm umging, gehörte zu seinen auserwählten Freunden. In dieser Hinsicht hatte er die Instinkte eines Pferdes und kam nicht an das tiefer reichende Einfühlungsvermögen eines Hundes heran. Es kann ihm nicht nachgesagt werden, dass er jemals jemanden so liebte, dass er sich um dieses geliebten Menschen willen auch nur einen flüchtigen Genuss versagt hätte. Sein Herz war aus Stein. Aber er war attraktiv, schlagfertig und intelligent. Er war der eher dunkle Typ, mit dem leicht olivfarbenen Teint, den man bei jungen Männern gern mit einer aristokratischen Herkunft verbindet. Sein Haar, das er nie zu lang wachsen ließ, war fast schwarz und seidenweich ohne den öligen Schimmer, den man bei den auserkorenen Liebsten mit dem seidigen Haar so häufig antrifft. Er hatte schmale braune Augen, deren Attraktivität durch den perfekten Bogen perfekter Augenbrauen zustande kam. Doch vielleicht verdankte sich die Herrlichkeit seines Antlitzes auch mehr der feinen Form und perfekten Symmetrie der Nase und des Mundes als seinen anderen Gesichtszügen. Über seiner schmalen Oberlippe trug er ein Bärtchen, das so perfekt geformt war wie seine Augenbrauen, darüber hinaus trug er jedoch kein Barthaar. Auch die Form seines Kinns war vollendet, doch war es ein wenig zu kantig, und es fehlte ihm auch ein Grübchen, das auf ein weiches Herz hätte schließen lassen. Er war fast sechs Fuß groß, und seine Gestalt war ebenso vollkommen wie sein Antlitz. Männer räumten es ein und Frauen behaupteten felsenfest, es habe noch nie einen attraktiveren Mann als Felix Carbury gegeben, und es wurde ihm auch zugestanden, er habe sich nie anmerken lassen, dass er um seine Attraktivität wusste. Er hatte sich auf vieles etwas eingebildet – auf sein Geld, der arme Tor, solange es da war, auf seinen Titel, auf seinen Rang in der Armee, bis er ihn verlor, und besonders auf seinen überragenden Geschmack. Aber er war klug genug gewesen, sich immer schlicht zu kleiden und den Eindruck zu vermeiden, er denke nur an sein Äußeres. Bis jetzt hatte die kleine Welt um ihn herum noch kaum herausgefunden, wie gefühlskalt er war beziehungsweise wie vollkommen bar jeden Gefühls er war. Sein Gebaren und seine Erscheinung hatten ihn zusammen mit einer gewissen Schläue sogar unbescholten durch seine Gemeinheiten getragen. In einem Fall hatte er allerdings seinen Namen befleckt, und durch einen einzigen Augenblick der Schwäche hatte er bei seinen Freunden mehr Zweifel an seinem Charakter gesät als durch sein törichtes Verhalten über Jahre hinweg. Es hatte einen Streit zwischen ihm und einem anderen Offizier gegeben, der von ihm ausgegangen war, und als der Augenblick kam, in dem das Gefühl eines Mannes sich eigentlich im Verhalten eines Mannes niederschlagen sollte, hatte er zuerst eine Drohung ausgestoßen und dann die weiße Fahne gehisst. Das war nun ein Jahr her, und er hatte den Lapsus einigermaßen überlebt – doch so mancher Mann erinnerte sich noch daran, dass Felix Carbury sich hatte einschüchtern lassen und sich geschlagen geben musste.
Jetzt oblag es ihm, eine reiche Erbin zu heiraten. Das war ihm sehr wohl bewusst, und er war durchaus bereit, seinem Schicksal ins Auge zu blicken. Doch die Kunst, eine Frau zu umwerben, ging ihm ab. Er war attraktiv, hatte die Umgangsformen eines Gentleman, war redegewandt, war nicht ohne Draufgängertum und scheute nicht davor zurück, einer Leidenschaft Ausdruck zu verleihen, die er nicht empfand. Freilich verstand er so wenig von dieser Leidenschaft, dass er nicht einmal ein junges Mädchen dazu bringen konnte, ihm dieses Gefühl abzunehmen. Wenn er von Liebe sprach, dachte er nicht nur, dass er Unsinn redete, sondern zeigte es auch. Aufgrund dieses Mankos war er nicht nur bei einer jungen Dame mit angeblich 40000 Pfund gescheitert, die ihn ablehnte, weil es ihm, wie sie es in aller Unschuld ausdrückte, »nicht wirklich ernst war«. »Wie kann ich besser zeigen, dass es mir ernst ist, als Ihnen einen Antrag zu machen?«, hatte er gefragt. »Ich weiß nicht, wie Sie das können, aber trotzdem ist es Ihnen nicht ernst damit«, gab sie zurück. Und so ging diese junge Dame nicht in die Falle. Nun gab es da noch eine weitere junge Dame, die dem Leser beizeiten vorgestellt werden wird und der Sir Felix mit beharrlicher Aufmerksamkeit nachstellen sollte. Ihr Vermögen war nicht konkret beziffert, wie es bei den 40000 Pfund ihrer Vorgängerin gewesen war, doch galt es als sehr viel größer. Ja, man ging davon aus, es sei unbegrenzt, unermesslich, unerschöpflich. Es hieß, dass hinsichtlich alltäglicher Ausgaben, also Geld für die Häuser, die Dienstboten, die Pferde, den Schmuck und dergleichen, die Höhe der Ausgaben keinerlei Rolle für den Vater dieser jungen Dame spiele. Er war mit großen Finanzgeschäften befasst – Geschäften, die so groß waren, dass es für ihn einerlei war, ob er für eine Banalität zehn- oder zwanzigtausend Pfund bezahlte, so wie es gutsituierten Männern wenig ausmacht, ob sie für ihre Hammelkoteletts sechs oder neun Pence ausgeben. Ein solcher Mann kann jederzeit bankrottgehen, und dennoch gab es keinen Zweifel, dass er jedem, der seine Tochter in der gegenwärtigen Phase seines ungeheuren Reichtums heiratete, ein immenses Vermögen überlassen konnte. Lady Carbury, die die Klippen kannte, an denen ihr Sohn einmal Schiffbruch erlitten hatte, war es sehr darum zu tun, dass Sir Felix sogleich angemessenen Gebrauch von dem vertrauten Umgang machen würde, den er im Haus dieses neuzeitlichen Krösus pflegte.
Und nun müssen noch einige Worte über Henrietta Carbury gesagt werden. Selbstverständlich war sie unendlich weniger bedeutend als ihr Bruder, der Baronet, das Oberhaupt dieses Zweigs der Carburys und der Liebling ihrer Mutter, und daher sollten einige wenige Worte genügen. Sie war ebenfalls sehr attraktiv und sah ihrem Bruder ähnlich, aber sie war nicht ganz der dunklere Typ und hatte nicht ganz so ebenmäßige Züge. Doch schien ihr so liebevoller Blick nahezulegen, dass die Rücksichtnahme auf das eigene Ich der Rücksichtnahme auf andere untergeordnet war. Dieser liebevolle Blick ging ihrem Bruder völlig ab. Und ihr Blick spiegelte ihren Charakter wahrheitsgemäß wider. Einmal mehr fragt man sich, warum Bruder und Schwester sich so auseinanderentwickelt hatten, ob sie sich auch so unterschieden hätten, hätte man sie als kleine Kinder der Erziehung durch Vater und Mutter entzogen, oder ob die Tugenden des Mädchens sich gänzlich dem geringeren Stellenwert verdankten, den sie im Herzen ihrer Eltern einnahm?
Sie jedenfalls war nicht durch einen Titel, durch eigenes Vermögen und durch die Versuchungen durch einen zu frühen Kontakt mit der Welt verdorben worden. Gegenwärtig war sie gerade einmal einundzwanzig Jahre alt und hatte noch nicht viel von der Londoner Gesellschaft gesehen. Ihre Mutter besuchte keine Bälle, und während der vergangenen zwei Jahre war ihnen ein Zwang zur Sparsamkeit aufgenötigt worden, der sich schlecht mit einer Vielzahl von Handschuhen und kostspieligen Kleidern vertrug. Sir Felix ging selbstverständlich aus, Hetta Carbury jedoch verbrachte die meiste Zeit mit ihrer Mutter zuhause in der Welbeck Street. Gelegentlich bekam die Gesellschaft sie zu Gesicht, und wenn die Gesellschaft sie einmal zu Gesicht bekam, erklärte die Gesellschaft, dass sie ein reizendes Mädchen war. Die Gesellschaft lag damit richtig.
Doch im Leben von Henrietta Carbury hatte die Romantik bereits Einzug gehalten. Es gab einen weiteren Zweig der Familie Carbury, den Hauptzweig, dem gegenwärtig ein gewisser Roger Carbury von Carbury Hall vorstand. Roger Carbury war ein Gentleman, über den noch viel zu berichten sein wird, doch jetzt, in diesem Augenblick, genügt es zu sagen, dass er sich leidenschaftlich in seine Kusine Henrietta verliebt hatte. Er war allerdings schon fast vierzig, und es gab da auch einen gewissen Paul Montague, den Henrietta kennengelernt hatte.
KAPITEL III
Der Beargarden
Lady Carburys Haus in der Welbeck Street war eher bescheiden – ein Haus, das sich nicht anmaßte, herrschaftlich zu wirken, und nicht einmal den Anspruch erhob, als echtes Domizil zu gelten; da Lady Carbury jedoch, als sie es erwarb, über etwas Geld verfügte, hatte sie es hübsch und geschmackvoll hergerichtet und war immer noch stolz darauf, trotz ihrer schwierigen Lage ein angenehmes Zuhause ihr eigen zu nennen, wenn ihre literarisch interessierten Freunde sie an ihren Dienstagabenden besuchten. Hier wohnte sie jetzt mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Der hintere Teil des Salons war vom vorderen Bereich durch Türen abgetrennt, die auf Dauer geschlossen waren, und hier arbeitete sie an ihrem großen Werk. Hier schrieb sie ihre Bücher und ersann ihre Strategie, wie sie die Herausgeber und Kritiker um den Finger wickeln konnte. Hier wurde sie nur selten von ihrer Tochter gestört und empfing keine Besucher außer von Herausgebern und Kritikern. Aber für ihren Sohn galten keine häuslichen Regeln, und er missachtete ihre Privatsphäre ohne Gewissensbisse. Kaum hatte sie nach ihrem Brief an Mr. Ferdinand Alf noch zwei kurze Mitteilungen verfasst, da betrat Felix mit einer Zigarre im Mund den Raum und ließ sich auf das Sofa fallen.
»Mein lieber Junge«, sagte sie, »bitte lass deinen Tabak draußen, wenn du hier hereinkommst.«
»Was für ein Getue, Mutter«, gab er zurück, warf aber dennoch die zur Hälfte gerauchte Zigarre in den offenen Kamin. »Manche Frauen beteuern, dass sie Zigarrenrauch mögen, andere sagen, dass sie ihn auf den Tod nicht ausstehen können. Es hängt immer davon ab, ob sie einem Mann schmeicheln oder ihm eins auswischen wollen.«
»Du nimmst doch nicht an, dass ich dir eins auswischen will?«
»Ich weiß es wirklich nicht. Kannst du mir wohl zwanzig Pfund geben?«
»Aber mein lieber Felix!«
»Ganz der deine, Mutter – aber was ist jetzt mit den zwanzig Pfund?«
»Wofür willst du sie, Felix?«
»Also – um die Wahrheit zu sagen, damit das Leben erst einmal weitergeht. Ein Mann ohne Bargeld ist ein Nichts. Ich komme mit genauso wenig aus wie die meisten Männer. Ich bezahle nur für etwas, wenn es unbedingt sein muss. Ich lasse mir sogar die Haare auf Kredit schneiden, und solange es möglich war, hatte ich einen Einspänner, um Fahrten mit Droschken einzusparen.«
»Wohin soll das noch führen, Felix?«
»Ich konnte noch nie sehen, wohin irgendetwas führen soll. Ich konnte noch nie auf ein Pferd setzen, wenn die Hunde für mich eine sichere Wette waren. Der Spatz in der Hand war mir immer lieber als die Taube auf dem Dach. Was soll das also?« Der junge Mann sagte nicht »carpe diem«, doch war das die Philosophie, die er zu predigen beabsichtigte.
»Warst du heute schon bei den Melmottes?« Es war fünf Uhr an einem Nachmittag im Winter, eine Stunde, zu der Damen ihren Tee einnehmen und Männer ohne berufliche Pflichten Whist in den Klubs spielen – zu der junge Männer ohne berufliche Pflichten bisweilen flirten dürfen und, so dachte Lady Carbury, ihr Sohn hoffentlich Marie Melmotte, der reichen Erbin, den Hof gemacht hatte.
»Ich komme gerade von dort.«
»Und was hältst du von ihr?«
»Ehrlich gesagt, Mutter, habe ich mir keine großen Gedanken über sie gemacht. Sie ist weder hübsch noch hässlich, sie ist weder klug noch dumm, sie ist weder eine Heilige noch eine Sünderin.«
»Desto eher wird sie wahrscheinlich eine gute Ehefrau abgeben.«
»Vielleicht. Ich bin jedenfalls durchaus gewillt zu glauben, dass sie als Ehefrau für mich taugen würde.«
»Wie schätzt du die Mutter ein?«
»Die Mutter ist mit Vorsicht zu behandeln. Mir drängt sich die Frage auf, ob ich, falls ich die Tochter heirate, jemals herausfinden kann, woher die Mutter stammt. Dolly Longestaffe sagt, dass jemand behauptet, sie sei eine Jüdin aus Böhmen, aber meiner Meinung nach ist sie zu dick dafür.«
»Was macht es schon aus, Felix?«
»Überhaupt nichts.«
»Ist sie höflich zu dir?«
»Ja, durchaus.«
»Und der Vater?«
»Nun ja, er wirft mich nicht aus dem Haus oder etwas in der Art. Natürlich ist ungefähr ein halbes Dutzend hinter ihr her, und ich glaube, dass der Alte etwas ratlos ist bei dem Andrang. Ihm geht es mehr darum, Herzöge dazu zu bringen, mit ihm zu speisen, als um die Bewerber um seine Tochter. Jeder beliebige Kandidat, der ihr zufällig Eindruck macht, könnte sie sich schnappen.«
»Und warum dann nicht du?«
»Warum nicht ich, Mutter? Ich tue mein Bestes, und es hat keinen Sinn, auf einen braven Gaul einzuprügeln. Kann ich das Geld von dir haben?«
»Ach Felix, ich glaube, du hast keine Ahnung, wie arm wir sind. Du hast immer noch deine Reitpferde!«
»Ich habe zwei Pferde, wenn du das meinst, und ich habe seit Beginn der Saison keinen Shilling für ihren Unterhalt bezahlt. Schau, Mutter, ich gebe zu, dass es ein risikoreiches Spiel ist, aber ich spiele es auf deinen Rat hin. Wenn es mir gelingt, Miss Melmotte zu heiraten, ist sicher alles in Ordnung. Ich glaube freilich nicht, dass ich sie bekomme, indem ich alles schlagartig aufgebe und aller Welt verkünde, dass ich keinen roten Heller besitze. Bei so etwas muss man schon den Erwartungen entsprechen. Ich habe meine Jagdaktivitäten auf ein Minimum reduziert, aber wenn ich sie völlig aufgäbe, würde es am Grosvenor Square die Runde machen, warum ich das getan habe.«
Dieses Argument schien so einleuchtend, dass die arme Frau ihm nichts entgegnen konnte. Noch vor dem Ende der Unterredung hatte er das Geld, obwohl es zu dieser Zeit nur schwer entbehrt werden konnte, und der junge Mann ging offenbar unbeschwert seines Wegs, wobei er kaum auf die flehentlichen Bitten seiner Mutter hörte, die Sache mit Marie Melmotte möglichst schnell zu einem guten Ende zu bringen.
Als Felix seine Mutter verließ, ging er in den einzigen Klub, dem er gegenwärtig noch angehörte. Klubs sind angenehme Aufenthaltsorte in jeder Hinsicht außer einer. Man braucht für sie nämlich Bargeld, oder, wenn es um einen Jahresbeitrag geht, noch Schlimmeres als das – nämlich Geld im Voraus, und der junge Baronet war gezwungen gewesen, sich massiv einzuschränken. Natürlich wählte er von den Klubs, zu denen er Zutritt hatte, den schlimmsten. Er hieß »Beargarden« und war erst vor kurzem eröffnet worden mit dem ausdrücklichen Ansinnen, Geiz mit Verschwendung zu kombinieren. Klubs gingen bankrott, so sagte sich so mancher junge geizige Verschwender, weil sie alten Trotteln Komfort boten, die wenig oder nichts außer ihren Beiträgen bezahlten und allein durch ihre Anwesenheit den Klub dreimal soviel kosteten, wie sie dort ausgaben. Dieser Klub sollte daher nicht vor drei Uhr nachmittags öffnen; denn zuvor, so meinten die Initiatoren des Beargarden, sei es unwahrscheinlich, dass sie und ihre Kumpane einen Klub benötigten. Es sollte keine Morgenzeitungen geben, keine Bibliothek, keinen Frühstücksraum. Speisesalons, Billardzimmer und Spielsalons würden für den Beargarden genügen. Alles sollte über einen Lieferanten bezogen werden, sodass der Klub wenigstens nur von einem einzigen Mann übers Ohr gehauen würde. Alles sollte luxuriös sein, doch der Luxus sollte so wenig wie möglich kosten. Das war ein glorreicher Einfall, und es hieß, der Klub floriere. Herr Vossner, der Lieferant, war ein Juwel und führte die Geschäfte so, dass es keinerlei Probleme gab. Er war sogar behilflich bei kleinen Problemen wie der Begleichung von Spielschulden und hatte sich all jenen gegenüber, deren Schecks von Banken unfreundlich als »nicht gedeckt« bezeichnet worden waren, sehr zartfühlend verhalten. Herr Vossner war ein Juwel, und der Beargarden war ein Erfolg. Und es dürfte in der ganzen Stadt keinen jungen Mann gegeben haben, der so viel Vergnügen am Beargarden hatte wie Sir Felix Carbury. Der Klub befand sich in einer kleinen Nebenstraße der St. James’s Street in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen Klubs und hielt sich viel zugute auf seine Unauffälligkeit und Seriosität nach außen hin. Warum sollte man in Steinmetzarbeit investieren, nur damit andere Leute sie betrachten konnten, warum sollte man Geld ausgeben für marmorne Säulen und Verzierungen, wo doch klar war, dass man solche Dinge weder essen noch trinken konnte noch auf sie wetten? Dafür hatte der Beargarden die besten Weine – oder war jedenfalls dieser Ansicht – und die bequemsten Sessel und zwei Billardtische, die alles an Perfektion übertrafen, was jemals auf Tischbeine gestellt worden war. Hierher begab sich Sir Felix an jenem Januarnachmittag, sobald er den Scheck seiner Mutter über die 20 Pfund in der Tasche hatte.
Dort traf er seinen Busenfreund Dolly Longestaffe an, der mit einer Zigarre im Mund auf der Treppe stand und leeren Blicks auf das langweilige Backsteinhaus gegenüber starrte. »Hast du vor, hier zu essen?« fragte Sir Felix.
»Ich glaube schon, denn es ist so lästig, woanders hinzugehen. Ich bin irgendwo verabredet, ich weiß, aber ich bin nicht in Stimmung, nach Hause zu gehen und mich umzuziehen. Du lieber Himmel! Ich weiß nicht, wie die Leute so etwas überhaupt hinkriegen. Ich kann es nicht.«
»Gehst du morgen auf die Jagd?«
»Eigentlich schon, aber ich glaube, ich lasse es bleiben. Ich wollte eigentlich letzte Woche jeden Tag auf die Jagd gehen, aber mein Bursche hat es nie fertigbekommen, mich rechtzeitig zu wecken. Ich habe keine Ahnung, warum man so etwas zu so unchristlicher Zeit macht. Warum kann man mit der Jagd nicht um zwei oder drei anfangen, damit man nicht mitten in der Nacht aufzustehen braucht?«
»Weil man nicht bis in die Nacht reiten kann, Dolly.«
»Um drei Uhr ist noch nicht Nacht. Ich schaffe es ja nicht einmal vor neun bis zum Euston Square. Ich glaube, mein Bursche steht auch nicht gern auf. Er sagt zwar, er kommt in mein Zimmer und weckt mich, ich kann mich aber nie daran erinnern.«
»Wie viele Pferde hast du in Leighton stehen, Dolly?«
»Wie viele? Es waren einmal fünf, aber ich glaube, dass der Verwalter dort eines verkauft hat, aber dann wohl wieder ein anderes gekauft hat. Irgendetwas hat er jedenfalls getan.«
»Wer reitet sie?«
»Ich nehme an er. Das heißt, ich reite sie natürlich selbst, nur komme ich so selten dort hin. Jemand hat mir erzählt, dass Grasslough letzte Woche zwei von ihnen geritten hat. Ich glaube nicht, dass ich ihm das jemals erlaubt habe. Ich glaube, dass er den Pferdeknecht dort dafür bezahlt hat, und ich finde das niederträchtig. Ich würde ihn ja fragen, nur weiß ich, dass er dann sagen würde, ich hätte sie ihm geliehen. Vielleicht habe ich das ja sogar getan, als ich betrunken war.«
»Ihr seid doch nie enge Freunde gewesen, du und Grasslough.«
»Ich kann ihn nicht ausstehen. Er spielt sich auf, als wäre er etwas Besonderes, weil er Lord ist, und ist von Grund auf boshaft. Ich weiß nicht, warum er meine Pferde reiten will.«
»Um seine zu schonen.«
»Er ist nicht knapp bei Kasse. Warum hat er keine eigenen Pferde? Ich sage dir was, Carbury, ich habe mich entschieden, und, Himmel nochmal, ich werde dabei bleiben. Ich werde nie wieder jemandem ein Pferd leihen. Wenn jemand Pferde braucht, soll er sich welche kaufen.«
»Manche haben eben kein Geld, Dolly.«
»Dann sollen sie es auf Pump machen. Ich glaube nicht, dass ich für eines von denen, die ich diese Saison gekauft habe, tatsächlich bezahlt habe. Gestern war jemand hier –«
»Was! Hier im Klub?«
»Ja, er ist mir hierher gefolgt, um mir zu sagen, dass er für etwas bezahlt werden wollte! Ich glaube, es ging um Pferde, nach der Hose zu urteilen, die er anhatte.«
»Was hast du ihm gesagt?«
»Ich? Oh, ich habe nichts gesagt.«
»Und wie ging es weiter?«
»Als er fertig war, habe ich ihm eine Zigarre angeboten, und während er das Ende davon abgebissen hat, bin ich nach oben. Vermutlich ist er gegangen, als ihm das Warten zu lang wurde.«
»Ich sage dir was, Dolly. Ich wünschte, du würdest mir zwei von deinen ein paar Tage zum Reiten überlassen – selbstverständlich nur, falls du sie nicht selbst brauchst. Du jedenfalls bist im Moment nicht knapp bei Kasse.«
»Nein, das bin ich nicht«, stimmte Dolly ihm ein wenig melancholisch zu.
»Selbstverständlich würde ich von dir keine Pferde leihen wollen, ohne dass du dich hinterher daran erinnern kannst. Niemand weiß so gut wie du, wie schlimm meine Lage gerade ist. Ich werde es irgendwie schaffen, aber bis dahin wird es entsetzlich eng für mich. Es gibt niemanden außer dir, den ich um einen solchen Gefallen bitten würde.«
»In Ordnung, du kannst sie haben, aber nur für zwei Tage. Ich weiß nicht, ob der Pferdeknecht dort dir glauben wird. Er wollte Grasslough nicht glauben und hat ihm das auch gesagt. Aber Grasslough hat sie einfach aus dem Stall geholt. Jedenfalls hat mir das jemand erzählt.«
»Du kannst dem Pferdeknecht eine Zeile schreiben.«
»Mein Lieber, das ist mir viel zu lästig, ich glaube nicht, dass ich das könnte. Dir wird mein Knecht glauben, weil wir Kumpel sind. Ich glaube, mir ist jetzt nach einem kleinen Curaçao vor dem Abendessen. Komm mit und nimm auch einen. Er wird uns Appetit machen.«
Es war unterdessen beinahe sieben Uhr geworden. Neun Stunden später erhoben sich dieselben beiden Männer sowie zwei weitere, unter ihnen der junge Lord Grasslough, Dolly Longestaffes Intimfeind, von einem Spieltisch in einem der oberen Räume des Klubs. Es galt nämlich als Selbstverständlichkeit, dass der Beargarden zwar nicht vor drei Uhr nachmittags öffnete, die Leistungen, die er tagsüber vorenthielt, jedoch während der Nacht großzügig erbrachte. Niemand konnte im Beargarden ein Frühstück erhalten, Abendmahlzeiten um drei Uhr morgens waren aber durchaus an der Tagesordnung. Ein solches Abendessen, oder vielmehr eine Reihe