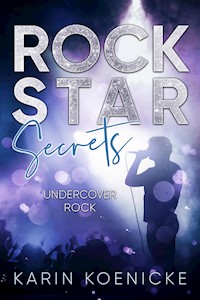
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist heiß, er rockt die Bühne - und er ist ihr Hauptverdächtiger!
Privatdetektivin Tess erhält endlich einen lukrativen Auftrag. Ausgerechnet bei einer Rockband soll sie ermitteln! Verdächtig ist der heiße Frontman Joaquin, denn mit dem stimmt etwas nicht, das verrät ihr ihre Spürnase deutlich. Nur dumm, dass sie den sexy Sänger so verdammt anziehend findet. Doch Joaquin ist viel mehr als nur Musiker – nämlich ein tougher Cop im Undercovereinsatz. Außerdem Einzelgänger, ein harter Knochen und kein Kerl, der mit Gefühlen irgendwas anfangen kann. Außerdem wäre eine kleine Schnüfflerin die Allerletzte, auf die er sich einlassen würde! Die stört doch nur seine Mission. Aber so einfach ist das alles nicht.
**Eine actionreiche Lovestory mit Humor, Musik und großen Gefühlen**
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
UNDERCOVER ROCK
Rockstar Secrets 2
ein Liebesroman von
Karin Koenicke
Für eine Übersicht meiner Bücher, Rezepte und mehr schau doch mal auf meiner Homepage vorbei!
Hol dir dort gleich drei kostenlose Kurzromane, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest!
www.karinkoenicke.com
Inhalt
1. Razzia
2. Zitronenhuhn und Papagei
3. Mit Putzeimer bewaffnet
4. Der Senator
5. Neuer Look
6. Unter Verdacht
7. Rehab
8. Der neue Sharp
9. Der geheimnisvolle Rucksack
10. Chill-out in der Bar
11. Ukulele im Mondschein
12. Bos Geheimnis
13. Shrimp Gumbo
14. Satchmos Song
15. Tassen hoch bei Dwayne
16. Salomé im Glück
17. More than words
18. Rührei zum Frühstück
19. Der Keller
20. Nachtzug
21. Lachnummer
22. Gilbert wächst über sich hinaus
23. Das letzte Konzert
24. Küchengeflüster
25. Nacht in New Orleans
26. Rezepte
27. Millionaire`s Rock
28. Pretty Womanizer
29. New York Lovestorys
30. Impressum
1. Razzia
Joe
Die ehemalige Fabrikhalle, vor der gerade sechs Einsatzwagen des Boston Police Departments parkten, wirkte schäbig. Wie die anderen Cops auch war ich ausgestiegen und blickte mich um. Für mich war alles hier unbekannt, ich war erst vor ein paar Wochen in den Norden versetzt worden. Die Betonwände hatten Flecken, leere Bierdosen und Zigarettenstummel lagen auf dem Gehweg. Jemand hatte eine Ausgabe der Boston New Gazette weggeworfen und nun blätterte der Nachtwind ihre Seiten um, als wolle er sich über die Wettertrends der Ostküste informieren. Weder Sirenen noch Lichter der Polizeiwagen waren eingeschaltet, wir wollten schließlich niemanden vorwarnen. Aus dem Inneren der Halle, in der gerade eine Punk-Band ihr Unwesen trieb, drang nicht nur laute Musik, sondern auch das Gejohle der begeisterten Zuhörerschaft. Dass sich hier draußen gerade eine kleine Armee aus Uniformierten für den Einsatz bereitmachte, bekam das aufgeheizte Partyvolk garantiert nicht mit. Auf die verwunderten Gesichter der Leute freute ich mich jetzt schon.
Die Band war bei der Zugabe angekommen, sie verschwand sicher bald von der Bühne. Dann wurde es Zeit für uns. Meine Muskeln waren angespannt. Ich entsicherte meine Waffe.
„Auf mein Kommando gehen wir rein!“, schepperte durchs Funkgerät.
Wie auch meine Kollegen war ich hoch konzentriert und behielt nicht nur die Vordertür im Auge, sondern dazu den seitlichen Eingang. Diese Razzia war längst überfällig, denn nicht nur wir Detectives von der Drogenfahndung wussten, dass bei Konzerten allerlei Stoff verhökert wurde.
„Drei …“, zählte der Einsatzleiter vor.
Ich hasste es, wenn mir jemand Kommandos gab. Bei der Army würde ich kläglich versagen. Es war ein verdammtes Glück, dass ich bei der Polizei hatte Karriere machen können, wenngleich eine holprige. Richtig gut war ich nämlich nur als Einzelkämpfer.
„Zwei …“
Holy Shit, die beiden Milchgesichter neben mir sahen sich an, als suchten sie jemanden zum Händchenhalten! Schon klar, wir Spezialisten von der Drogenfahndung konnten das Ding nicht alleine schaukeln, deshalb hatte man uns für die Razzia eine Meute von Streifenbullen zugeteilt, aber mussten es unbedingt welche sein, deren Hände so zitterten? Auf ängstliche Warmduscher wie die beiden konnte man sich nicht verlassen. Und in diesem Punkt war ich echt empfindlich, nicht ohne Grund.
„Eins – Zugriff!“
Bevor die Milchbubis reagieren konnten, drückte ich schon die Eingangstür auf und stürmte nach drinnen. Es ging los! Vom Seiteneingang her kamen weitere Polizisten. Wir riegelten sofort die Ausgänge ab. Aufgeregte Schreie verrieten, dass die Leute in der Halle jetzt mitbekamen, was hier ablief. Die Schreie wurden schriller, einzelne Gestalten forderten ihr Glück heraus und rannten im Affenzahn auf die Ausgänge zu. Natürlich vergeblich. Glaubten die ernsthaft, sie kamen hier noch raus? Ich musste grinsen.
Wer jetzt versuchte, zu entwischen, zählte natürlich zu den Verdächtigen. Rund um die Bostoner Musikszene gab es ein ernsthaftes Drogenproblem, das sich immer mehr zuspitzte. Und dabei ging es nicht um Lappalien wie Gras, nein, irgendwer brachte immer größere Mengen von dieser neuen Scheiß-Designerdroge namens Stardust unters Volk. Gegen dieses Zeug war Koks ein kindisches Brausepulver. Und das Schlimmste war: Sie verkauften Stardust an die Kids, die jungen Musikfans – und machten damit Teenies zu Junkies. Das nahm ich diesen Verbrechern besonders übel, deshalb wollte ich diesen Mistkerlen unbedingt das Handwerk legen!
„Hiergeblieben, Bürschchen!“ Ich erwischte einen der Flitzer am Kragen und drehte ihm den Arm auf den Rücken, sodass er keuchte. Mehr aus Frust als vor Schmerz, ich wusste nämlich genau, dass ich ihn nicht allzu hart anpacken durfte. Ein verdrehter Arm konnte eine Verhaftung ruinieren, denn ein findiger Anwalt zauberte daraus gern einen polizeilichen Übergriff und schon stand man selbst in der Schusslinie und nicht der Drogendealer. Alles schon vorgekommen. Ich klopfte den Kerl mit der Rastafrisur ab und fand glatt ein Päckchen in seiner Hosentasche. Ein paar bunte Ecstasy-Pillen, dazu ein wenig Gras. Enttäuscht schnaubte ich.
„Bringt ihn aufs Revier.“ Ich übergab ihn an einen der jungen Bullen. Drehte mich um. Sah aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Da rannte jemand weg, wollte wohl besonders schlau sein und nicht dem Herdentrieb zum Ausgang folgen. Nicht mit mir, Bürschchen!
Ich sprintete ihm hinterher, was nicht so einfach war, weil ich mich durch die aufgescheuchte Meute kämpfen musste. Der Kerl kletterte an einer Säule neben der Bühne nach oben zu den Scheinwerfern. Fuck, konnte man von dort aufs Dach gelangen? Schon jagte ich ihm nach, drängte mich zwischen den Menschen durch. Ich musste zu dieser Säule!
„Überlass ihn mir, Joe, ich krieg ihn!“, rief mir mein Kollege Tyler zu. Er war näher dran, kletterte schon hoch, dem Flüchtigen hinterher.
Auch wenn ich Tyler mochte – ich nahm die Dinge gern selbst in die Hand. Also steuerte ich die zweite Säule auf der anderen Seite der Bühne an, steckte meine Waffe zurück ins Holster, weil ich beide Hände brauchte. Meine Finger fanden die schmale Leiter, krallten sich in das kalte Eisen. Ich zog mich hoch. Ein Fuß nach dem anderen, immer schneller, nur nicht in die Tiefe blicken, denn sonst wäre es aus mit mir. Ich hatte seit jeher mit Höhenangst zu kämpfen. Alles, was mehr als zwei Meter über dem Boden war, bescherte mir weiche Knie, deshalb durfte ich keinesfalls hinunterschauen. Ich konzentrierte mich auf den Flüchtigen, der schon oben war und auf der über der Bühne eingezogenen Zwischendecke entlanglief. Dort oben war tatsächlich ein Fenster, durch das er entkommen konnte! Verflucht, ich musste ihn kriegen! Einem Joe Calinger entwischte man nicht!
Dummerweise war der Scheißkerl flink wie ein Eichhörnchen im Boston Common Park. Ich hatte erst die Hälfte der Säule erklommen, da rannte er schon oben entlang, direkt auf das Fenster zu. Tyler war ihm auf den Fersen, hatte aber Probleme mit all den Scheinwerferkabeln, die dort herumlagen, strauchelte. Endlich war auch ich oben. Ich stürmte dem Dealer hinterher, den Blick starr auf ihn gerichtet.
„Ich hab ihn gleich!“ Tyler hatte sich aufgerappelt und machte eine abweisende Armbewegung in meine Richtung. „Geh du runter, sie brauchen dich!“
Ich wollte mich lieber selbst davon überzeugen, dass er ihn kriegte, da war ich stur. Also lief ich weiter – bis ein gähnender Abgrund mich stoppte. Die Zwischendecke war kein durchgängiger Boden, eher ein Laufsteg zur Scheinwerferanlage, sodass vor mir ein breiter Spalt aufklaffte. Shit! Das Bürschchen quetschte sich auf der anderen Seite dieses verfluchten Spalts gerade durch das Fenster! Tyler kam an ihn heran, kassierte allerdings eine Rechte an sein Kinn, sodass er nach hinten kippte. Verdammt, der Spalt war viel zu breit, um ihn mit einem Sprung zu überwinden. Wenn ich es trotzdem wagte, hatte ich gute Chancen, mit zerschmetterten Knochen fünf Meter tiefer zu landen. Aber Tyler rappelte sich nur im Schneckentempo auf und dieser Typ war schon zur Hälfte durchs Fenster gestiegen!
Ich holte tief Luft und – sprang.
Landete haarscharf an der gegenüberliegenden Kante und musste erst mal mit rudernden Armen um das Gleichgewicht kämpfen, um nicht rückwärts in die Tiefe zu kippen. Als ich sicher stand, sah ich, wie der Flüchtige mich entsetzt anstarrte, und stürzte auch schon auf ihn zu. Tja, damit hatte er wohl nicht gerechnet! Ich packte ihn, er zappelte, es krachte …
Bloody hell!
Mich durchzuckte ein heftiger Schmerz an meiner linken Seite, als wir eine Etage tiefer aufprallten. Mitten auf einem Sofa in der Band-Garderobe. Eine gut gepolsterte Landung, da hatte ich echt Schwein gehabt! Ich hustete. Es staubte höllisch, weil ein Teil der Decke heruntergekommen war. Schnell rappelte ich mich von der Armlehne auf, auf der ich aufgeschlagen war. Mein Puls raste, mein Atem ging schnell, aber es war keine Zeit zum Ausruhen. Wo zum Henker war der Verdächtige?
Da – zwischen den Staubwolken sah ich ihn, er war zur Hälfte auf einem Musiker gelandet, sortierte seine Gliedmaßen und krabbelte in Richtung Tür.
„Make my day, du Idiot“, zischte ich und zog meine Waffe. Natürlich würde ich ihn mit dem Schießeisen nur erschrecken oder ihm allerhöchstens eine Kugel ins Bein jagen, falls er davonlief.
Blöderweise stolperte gerade Brown herein, der Einsatzleiter. Der Mann hatte keinen Funken Humor und konnte solche Sprüche eher weniger leiden.
„Sie heißen Calinger und nicht Callahan“, blaffte er mich an. „Wenn Sie Dirty Harry spielen wollen, dann machen Sie das in Ihrer Freizeit. Hier hab ich das Kommando und Sie halten sich gefälligst an die Regeln. Stecken Sie die Waffe weg und durchsuchen Sie den Mann.“
Murrend fügte ich mich. Konnte mir aber ein leicht triumphales Grinsen nicht verkneifen, als ich in den Taschen des Verhafteten eine ganze Menge sternchen-förmiger Pillen fand. Das war Stardust, keine Frage. Vielen Fragen jedoch würde sich dieser Kerl stellen müssen, wenn ich ihn erst im Verhörraum hatte und in die Mangel nahm.
„Sieht nach vollem Erfolg aus, Chief“, sagte ich zu Brown, als wir nach draußen gingen, wo einige Kollegen zappelnde Langhaarige, lamentierende Punks und fluchende Tätowierte abführten.
Ich hatte zwar Prellungen abbekommen, denn die Armlehne war nicht wirklich gut gepolstert gewesen, aber ein paar alberne blaue Flecke machten mir nichts aus. Wichtig war doch nur, dass uns einige der Typen ins Netz gegangen waren, die mit diesem Dreckszeug zu tun hatten. Das entschädigte für jedes Wehwehchen, dafür schlug man sich auch gern die halbe Nacht um die Ohren.
Gut gelaunt kämpfte ich mich durch die Menge an Konzertbesuchern, die immer noch herumstanden. Dann fiel mir das Siegerlächeln aus dem Gesicht. Ein blasses Mädchen – kaum älter als sechzehn, vermutete ich – stützte ihre noch blassere Freundin. Der knickten plötzlich die Beine weg, sie fiel vor mir auf den Boden, krümmte sich zusammen und zuckte. Sofort kniete ich mich neben sie, rief gleichzeitig mit lauter Stimme die Sanitäter herbei. Ihre Stirn war schweißnass, der Atem flach, sie zitterte am ganzen Körper. Ihre Freundin sah nicht viel besser aus. Auch sie hatte die charakteristischen, roten Flecken am Hals.
„Ihr habt Stardust genommen, stimmt‘s?“ Sie nickte. Ihre Hände bebten.
Das Zeug mit dem harmlosen Namen kam als verdammt geile Partydroge daher, billig, niedlich, Himmel-auf-Erden-eröffnend. Aber es machte in null komma nix abhängig. Und dann kamen die Horrortrips, so wie hier.
„Verflucht, wo bleiben die Sanitäter?“, schrie ich, denn die Kleine atmete immer flacher. Ihre blonden Haare, in die sie sich türkisfarbene Strähnen gefärbt hatte, klebten an ihrem Kopf. Sie war fast noch ein Kind. Ein Kind, dessen Unerfahrenheit und Naivität von skrupellosen Drogendealern ausgenutzt wurde, die sich einen Dreck darum scherten, dass sie ein so junges Leben riskierten und ruinierten. Finsterer Zorn packte mich auf diese Schweine, die offenbar hier in Bostons Musikszene zu suchen waren.
Endlich rauschten die Sanis an, schoben mich zur Seite, beugten sich über das Mädchen.
Einen Moment lang blieb ich stehen, die Augen auf die Szene vor mir gerichtet, die Hände zu Fäusten geballt. Bei der Kleinen hier war ich jetzt überflüssig, aber ich wusste, was ich zu tun hatte: Ich würde diese verdammte Droge und ihre Profiteure bekämpfen – mit aller Kraft und allen Mitteln, die mir zur Verfügung standen.
2. Zitronenhuhn und Papagei
Tess
Rauch, der aus einer Backofentür kam, verhieß nichts Gutes, oder? Okay, ich hatte mich ziemlich lange geduscht, während ich das Abendessen für Dexter und mich im Ofen vor sich hinbraten ließ. Aber dass dieses dämliche Zitronenhuhn nun Dexters Designerküche vollqualmte wie das Zelt eines indianischen Medizinmannes, bereitete mir jetzt ein wenig Sorge. Immerhin war ich so geistesgegenwärtig, den Bademantel gut zuzuknoten und ein Geschirrtuch in die Hand zu nehmen, bevor ich das Backrohr öffnete. Eine dicke Rauchwolke kam mir entgegen, dazu texanische Hitze, und obendrein wirkte der Gockel eher zusammengeschrumpelt als appetitlich.
Seufzend nahm ich ihn heraus und stellte ihn auf das Ceranfeld. Als Privatdetektivin war ich unschlagbar, was man von mir als Köchin leider nicht behaupten konnte. Ob ich das verbrannte Äußere absäbeln sollte? Vielleicht kam innen ganz zartes Fleisch zum Vorschein? Ich nahm ein Messer in die Hand und versuchte mein Glück. Gerade, als ich lautstark fluchte, weil auch das nicht klappte, klingelte mein Handy. Es war Dexter.
„Sweetheart, ich hänge noch 'ne Stunde an. Du weißt ja, der Malone-Auftrag. Aber ich freue mich, dass du heute mal für uns kochst!“
„Malone? Ich dachte, den hättest du schon abgeschlossen?“ Verwundert drückte ich das Telefon an mein Ohr. Dieser Fall war längst vom Tisch, soweit ich wusste. Ich hatte doch den Ordner abgelegt und der Sekretärin die Anweisung gegeben, die Rechnung zu tippen. Sehr seltsam.
„Na ja, sind einfach noch ein paar Dinge zu klären. Bis später.“ Er legte auf. Meine Nase juckte. Das war schon immer ein Zeichen gewesen, dass irgendetwas nicht stimmte.
Dexter war mein Boss. Also nicht irgendein Boss, nein, er war der Dexter Fox, Inhaber der renommiertesten Privatdetektei von ganz Boston, wenn nicht der ganzen Ostküste. Dass ich ausgerechnet bei ihm einen Job gefunden hatte, war ein echter Jackpot. Dass ich auch noch das Bett mit ihm teilte, ebenso. Er war rund fünfzehn Jahre älter als ich, aber mit Mitte vierzig super in Form. Mir gefielen sogar die vereinzelten grauen Haare an seinen Schläfen, die verliehen ihm noch mehr Charisma, als er eh schon hatte. Und ein genialer Kopf war er sowieso. Okay, vielleicht hätte er sich mit ein bisschen mehr Herzblut um mich kümmern können, aber man konnte schließlich nicht alles haben. Außerdem war ich ja auch ehrgeizig und schuftete hart dafür, seine Firma zur erfolgreichsten Detektei von ganz Massachusetts zu machen. Wir zogen da wirklich an einem Strang.
In der Küche hingegen waren meine Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt. Das geplante Dinner mit dem Huhn in Zitronensoße konnte ich mir wohl abschminken. Dabei war es angeblich ein „idiotensicheres Rezept“, so hatte es zumindest meine Freundin Salomé genannt. Sie kam aus Montreal und kochte gern Französisch. Die Anleitung für das Hähnchen stammte aus einem europäischen Kochbuch, in dem die Temperatur in Grad Celsius angegeben war. Und ich Dumpfbacke hatte mich offenbar bei der Umrechnung in Fahrenheit ziemlich vertan.
Sei’s drum. Ich hatte andere Qualitäten, mit denen ich Dexter vom verbrannten Dinner ablenken konnte. Entschlossen marschierte ich zurück ins Badezimmer, um mir die Haare zu machen und mich zu schminken. Früher war ich gern in zerrissenen Jeans und ohne Farbe im Gesicht herumgelaufen. Seit ich vor zwei Jahren bei Dexter angefangen hatte, legte ich schweren Herzens ein dezentes Tages-Make-up auf, weil ich dann nach Dexters Meinung seriöser wirkte. Jetzt hingegen durfte es richtig sexy sein, also schminkte ich mir smokey eyes, die gut zu meinen schwarzen Haaren passten, und griff zum dunkelroten Lippenstift. Dessous in der gleichen Farbe hatte er mir zum Geburtstag geschenkt, völlig uneigennützig natürlich. Ich zog sie an, nickte meinem aufreizenden Spiegelbild zufrieden zu und wartete, bis Dexter heimkam.
Es dauerte.
Als ich endlich den Schlüssel in der Tür hörte, sprang ich vom Sofa hoch, auf dem ich herumgelungert hatte, schlüpfte eilig in die mörderischen High-Heels und ging mit sexy Hüftschwung in den Flur.
„Was riecht hier so?“ Er schob seinen bulligen Körper durch die Tür und schnupperte.
„Ich trage Versace, den Duft hast du mir mitgebracht, Dex.“ Ich lächelte in der Hoffnung, dass es verführerisch rüberkäme und das meine üppige Parfumwolke den Brandgeruch überdeckte.
„Hast du irgendwas abgefackelt?“
Allright, nun war es an der Zeit, den dünnen Morgenmantel wie zufällig auseinanderklaffen zu lassen. Dexters Blick glitt über meine größtenteils nackte Haut – und dann wieder aus dem Morgenmantel hinaus und weiter zur Garderobe, an die er anschließend sein Sakko hängte. Was war los mit ihm? Meine Nase juckte schon wieder so komisch, das musste am Geruch des verbrannten Hähnchens liegen.
„Weißt du, mit dem Dinner ist ein bisschen was schief gelaufen“, schnurrte ich. „Aber vielleicht hast du ja Appetit auf etwas anderes?“
Ich ließ den Morgenmantel von meinen Schultern gleiten, während ich zwei geschmeidige Schritte auf ihn zu machte. Jetzt würde er gleich alles andere vergessen und mich ins Schlafzimmer zerren, wo er sich die Kleider vom Leib reißen und mir zeigen würde, dass Essen doch wirklich völlig unwichtig …
„Na gut, dann bestellen wir eben was bei Luigi“, erwiderte er, ohne mich wirklich anzusehen.
Wie bitte? Schon wieder kribbelte es an meinem Nasenflügel. Ich nahm Dexter genau unter die Lupe. War er vielleicht gestresst? Hatte er einfach zu viel gearbeitet in der letzten Zeit? Sein Gesicht wirkte allerdings eher rötlich-erhitzt als grau-erschöpft. Außerdem saß sein Kragen schief. Und – da war etwas! Ich hielt die Luft an. Mit spitzen Fingern fasste ich an den obersten Knopf seines Hemdes und entfernte ein eindeutig fuchsrotes Haar. Genau die Haarfarbe von Natasha, seiner Sekretärin, sie trug ihre Locken neuerdings in diesem penetranten Rotton. Jetzt war es an mir, zu schnuppern. Allerdings nicht am verschmorten Coque au citron, sondern an seinem Hals. Obwohl er schnell einen Schritt nach hinten machte, hatte ich es gerochen: An ihm klebte der süße, schwere Duft von Opium, einem Parfum, in dem Natasha jeden Morgen zu baden schien.
„Du machst mit deiner Sekretärin rum?“, zischte ich.
Er hob abwehrend die Hände. „Unsinn. Du bildest dir da nur was ein. Da ist absolut nichts.“
„Warum riechst du dann nach ihrem Duftwässerchen und hast ein rotes Haar am Kragen?“ Er hatte mich schließlich nicht in seine Detektei aufgenommen, weil ich ein blindes Dummchen war, das nicht eins und eins zusammenzählen konnte. Das musste ihm doch klar sein! Und auch, dass der abgeschlossene Malone-Fall keine gute Ausrede war.
„Herrgott, Teresa, jetzt mach keinen Aufstand! Du benimmst dich wie eine eifersüchtige Ehefrau. Dabei sind wir nicht mal verheiratet. Jetzt krieg dich mal wieder ein, das ist doch lächerlich.“ Er verschränkte die Arme vor der Brust. Eine Geste, die mir bei unserem Kennenlernen gut gefallen hatte, weil Dexter durchaus etwas Imposantes an sich hatte. Menschen zu beeindrucken fiel ihm nicht schwer, ich war da keine Ausnahme gewesen. Aber jetzt? Wo er hier stand und offensichtliche Beweise einfach herunterspielte?
„Der einzig Lächerliche bist du!“, konterte ich. Hitze wallte in mir auf, ich bebte heftig, meine Stimme wurde laut und schrill. „Ich habe Augen im Kopf. Normalerweise kannst du mich gar nicht schnell genug aus den teuren Dessous schälen, aber heute schaust du mich nicht mal richtig an. Weil du Natasha gerade erst über deinen Mahagonischreibtisch gelegt und durchgevögelt hast, stimmt’s?“
„Ach, denk doch, was du willst.“ Er schob mich grob zur Seite, um sich an mir vorbeizudrängen. „Ich brauche jetzt erst mal eine Dusche, es war ein langer Arbeitstag. Vielleicht hast du dich danach beruhigt. Und bestell was zu essen.“
Er wies mich allen Ernstes an, mich um sein Abendessen zu kümmern? Hatte der einen kompletten Knall?
„Sag doch Natasha, sie soll dir ein paar Eier braten!“, brüllte ich. „Am besten deine eigenen!“
Ungerührt verschwand er im Badezimmer. Und ich in unserem gemeinsamen Schlafzimmer, wo ich eilig ein paar Sachen aus dem Schrank riss und in eine Tasche stopfte. Wenn Mister Superstar dachte, ich würde wie ein reuiges Kätzchen heute Nacht unter seine Decke schlüpfen und ihm zuschnurren, dass ich ihm natürlich glaubte und eh alles verzeihen würde, hatte er sich getäuscht. So etwas ließ ich mir garantiert nicht gefallen!
Ich schlüpfte in mein Business-Kostüm, das noch herumlag, hängte mir die Tasche um und stürmte nach draußen. Sollte er doch nach mir suchen und sich Sorgen machen, der Mistkerl. Ich würde mein Handy abstellen und nicht zu erreichen sein. Damit verpasste ich ihm garantiert einen ordentlichen Denkzettel.
Zwanzig Minuten später läutete ich Sturm bei Salomé. Hoffentlich zerwühlte sie nicht gerade die Laken mit einem ihrer zahlreichen Liebhaber oder war mit einem unterwegs. Mir fiel nämlich sonst niemand ein, bei dem ich für eine Nacht unterkriechen konnte. Doch ich hatte Glück, sie öffnete.
„Mon Dieu, wie siehst du denn aus?“, begrüßte sie mich und gab den Weg in ihre gemütliche Wohnung frei.
„Mon Dieu, mon Dieu!“, krakelte es wie ein buntes Echo aus der Wohnzimmerecke. Dort thronte nämlich Gilbert in seinem Käfig, wetzte seinen Schnabel an einer Messingstange und kommentierte wie immer das Geschehen um ihn herum. Er selbst nannte sich „Schilbääär“ und fühlte sich offenbar ebenso Französisch wie seine Besitzerin.
„Dieser Cock mit Zitrone ging total daneben“, sagte ich und merkte erst jetzt, dass meine Stimme belegt klang.
„Cock?“, wiederholte sie und riss die Augen auf. „Was genau hast du denn beim Metzger …? Ach so, das Hähnchen. Und das war so schlimm, dass dir die Tränen gekommen sind?“
Ich betastete meine Wangen. Sie waren trocken. „Ich weine doch gar nicht!“, stellte ich klar.
„Du siehst aber so aus, als würde nicht viel fehlen. Setz dich hin und erzähl mir alles. Ich koche uns eine heiße Chocolat. Das wird dir helfen.“
So klein und zierlich Salomé auch war – sie schaffte es spielend, mir die Tasche aus der Hand zu nehmen und mich auf ihr Sofa zu drücken. Dann verschwand sie in der Küche. Ich kannte niemanden sonst, der sich selbst in häuslichen Plüschpantoffeln mit der Anmut einer Balletttänzerin bewegte. Sie trug einen karierten, knielangen Rock, dazu eine dunkelrote Strumpfhose plus blaues Twinset, und sah auf eine elegante Art immens sexy aus. Das lag nicht nur an ihrem blassen Gesicht und dem akkuraten Bobschnitt ihrer braunen Haare. Sie hatte dieses französische Flair. Wäre ich ein Mann oder auch nur ein klein wenig bisexuell veranlagt, würde ich mich auf der Stelle in sie verlieben.
„Magst du ein Roquefort-Baguette dazu?“ Sie kam mit einem Teller aus der Küche.
Okay, ich würde mir das noch mal überlegen mit dem Verlieben, denn der Käse stank selbst aus einiger Entfernung bestialisch. „Zur heißen Schokolade?“, fragte ich entsetzt.
„In Montreal isst man das so“, behauptete sie und sprach den Namen wie immer Französisch aus.
„Bien sur!“, unterstrich Gilbert die Aussage, während er auf und nieder wippte.
Ich glaubte den beiden kein Wort, nahm ihr aber dankbar die Tasse ab, die sie ebenfalls hereingetragen hatte.
„Dex betrügt mich mit dieser aufgetakelten Natasha aus dem Büro“, erzählte ich, trank zur Stärkung einen Schluck des süßen Gebräus und berichtete dann in ein paar Sätzen, was passiert war.
Nachdenklich strich Salomé ihren Rock glatt. „Vielleicht ist es ganz gut so“, sagte sie schließlich.
Ich riss die Augen auf. „Was soll gut daran sein, wenn er mit seiner Sekretärin poppt?“
Sie neigte den Kopf zur Seite. „Sag mal ganz ehrlich – liebst du ihn? So richtig aus tiefstem Herzen, so, dass du alles für ihn tun würdest, dass jedes chanson d’amour im Radio ausschließlich für euch beide geschrieben wurde, und du ohne ihn nicht leben willst?“
„Ach, die Liebe.“ Das war doch alles nur romanhaft aufgebauschtes Getue. Ich hielt nicht so wirklich viel davon. „Ich bin doch keine dreizehn mehr und träume von einem berittenen Prinzen, der mich auf Händen trägt. Das ist alles reine Illusion mit der großen Liebe, die gibt es doch bloß in Hollywoodfilmen, das hat nichts mit dem wahren Leben zu tun. Jeder Mensch kann bestens ohne den anderen leben.“ Schnell trank ich noch einen Schluck. Der dickflüssige Kakao tat gut. Wer brauchte schon einen Mann, wenn man Zucker und Fett haben konnte? Warm war das Getränk auch. Und es verlangte nicht, dass man etwas in den Ofen schob oder sich die Beine rasierte. Ja, ich fand, Chocolat war eine prima Alternative zu einer Beziehung.
„Du hast nur Angst, mal jemanden nah an dich heranzulassen“, kam sie nun wieder mit ihrer üblichen Predigt an. Die hörte ich schon, seit wir uns kannten. Ich sei keine In-den-See-Springerin, sagte sie mir immer, ich ließe mich nicht vollständig auf Gefühle ein, ich wolle immer die Kontrolle behalten. Vielleicht hatte sie recht, es war im Moment sowieso egal.
„Auf jeden Fall lasse ich nicht an mich heran, dass er mich behandelt wie ein Hausmädchen! Ich lebe doch nicht mit ihm zusammen, damit er mit einer anderen rummacht!“
„Du bist gekränkt, ma chère. Das ist verständlich. Aber nimm es als Chance, klarzustellen, wo ihr beide überhaupt in eurer Beziehung steht.“
Wo wir standen? Nun, er war ein erfolgreicher Geschäftsmann, bot mir viele Chancen. Der Sex war okay, in der Regel kamen wir gut miteinander aus, und er ging mir nicht übermäßig auf die Nerven, wenn wir am Wochenende etwas gemeinsam unternahmen. Passte doch alles!
„Da gibt es nicht viel zu klären.“ Ich duckte mich, weil Gilbert über mich hinwegflatterte und es sich nun auf der Vitrine gemütlich machte, wo er einen besseren Blick auf uns hatte. „Dexter hat die erfolgreichste Detektei der Stadt, und ich liebe meine Arbeit dort. Das will ich um keinen Preis aufgeben. Nicht mal für diese dämliche Sekretärin. Er weiß doch, was er an mir hat. Bestimmt war das nur ein Ausrutscher, und er kriegt sich wieder ein. Ja genau, morgen früh wird ein riesiger Strauß roter Rosen auf meinem Schreibtisch stehen, da bin ich mir sicher. Ich schick dir dann ein Foto.“
Der Kakao beruhigte mich. Und dieser Gedanke auch. Salomés skeptischen Blick zu ignorieren, fiel mir nicht schwer. Klar, sie sang stets ein Hohelied auf l’amour und fand auch immer wieder Männer, mit denen sie sich kopfüber in leidenschaftliche Affären stürzte. Doch ich war nun mal ein anderer Typ. Kopflastiger, kontrollierter, realistischer. Das war auch gut so.
„Ich sehe es doch bei dir und deinen Kerlen“, setzte ich nach. „Erst ist da immer das hell lodernde Feuer der Leidenschaft, aber nach ein paar Wochen oder Monaten bleibt nur noch schwach glimmende Asche übrig. Oder ihr streitet euch, dass die Fetzen fliegen. Nein, mit diesem ganzen extremen Liebeszeug brauchst du mir nicht zu kommen. Ich fühl mich wohl bei Dexter. Er wird sich entschuldigen, Natasha rauswerfen, und wir lösen den nächsten Fall gemeinsam. Alles okay!“
„Bonjour!“, krähte der Papagei fröhlich.
Salomé hingegen seufzte. „Du bist ein hoffnungsloser Fall. Also gut, dann arrangier dich halt wieder mit ihm. Ich richte dir aber trotzdem hier ein Bett her, oder? Du willst ihn doch sicher diese Nacht schmoren lassen?“
„Oh ja, genau so wie das Zitronenhähnchen!“ Nun musste ich sogar kichern. Womöglich hatte Salomé Schnaps in die Chocolat gerührt? Ich war nämlich mit einem Mal hundemüde. „Super von dir, dass ich bei dir schlafen kann“, gähnte ich.
„Immer doch, ich habe genügend Platz.“ Sie stand auf und ging ins Gästezimmer, wo eine Schlafcouch stand. Auf diese sank ich kurz darauf, grübelte noch ein bisschen herum, sagte mir aber immerzu, dass doch im Grunde nichts Schlimmes passiert war. Alles würde sich einrenken, denn es lief ja gut zwischen Dex und mir. Irgendwann kam es mir vor, als würde die Wanduhr immer langsamer ticken, und ich schlief schließlich ein.
Am nächsten Morgen verfluchte ich meinen überstürzten Aufbruch, denn ich hatte nur unnützes Zeug in meine Tasche geworfen. Immerhin eine frische Bluse war dabei, aber ich musste den Rock und Blazer anziehen, den ich gestern schon getragen hatte. Na ja, war halb so wild. Klar hätte ich auf dem Weg zur Arbeit noch einen Abstecher in Dexters Wohnung machen und mir neue Klamotten holen können, aber dann wäre ich zu spät ins Büro gekommen. Salomé genoss noch ihren Schönheitsschlaf, als ich die Tür leise hinter mir zuzog und mich auf den Weg zur Detektei machte. Am Personaleingang, der sich an der Seite des Gebäudes befand, blieb ich stehen und klappte das Kästchen nach oben, um meinen Zugangscode einzugeben.
Nichts passierte.
Allright, offenbar hatte ich mich vertippt. Also das Ganze noch einmal.
Erneut blinkte das rote Lämpchen, nicht – wie seit zwei Jahren üblich – das grüne.
Gab es eine Fehlfunktion?
Ich rieb mit der Hand über meinen Nasenflügel. Irgendwas in meinem Nacken kribbelte unangenehm, als ich um die Hausecke bog und am Vordereingang klingelte. Wir begannen unseren Dienst immer eine halbe Stunde vor den offiziellen Bürozeiten, deshalb musste ich warten, bis jemand auf den Öffner drückte. Nach unendlich langen Sekunden summte es.
Ich trat ein. Sah mich um. Hatte mit einem Mal so ein dumpfes Gefühl, dass vielleicht doch kein gigantischer Strauß aus langstieligen roten Rosen auf meinem Schreibtisch wartete. Außerdem war heute Donnerstag, der siebte, und dieser Tag hatte mir noch nie Glück gebracht. Obwohl ich ansonsten ein durch und durch vernünftiger Mensch war, gab es einige Dinge zwischen Himmel und Erde, an die ich glaubte, auch wenn ich das natürlich meist für mich behielt.
Dex kam mir entgegen.
„Wir müssen den Türöffner am Personaleingang reparieren lassen“, begann ich mit fester Stimme. „Der funktioniert nicht richtig.“
„Oh doch, der funktioniert tadellos.“ Sein Tonfall war ebenso kalt wie seine Augen. „Ich habe beschlossen, dass es besser ist, wir beide gehen getrennte Wege. Privat und beruflich. Ich habe heute Abend einen Kliententermin, du kannst in dieser Zeit deine Sachen aus meiner Wohnung räumen. Gib bei Gelegenheit Bescheid, an welche Adresse ich dir dein Zeugnis schicken soll.“
„Sag mal, hast du einen totalen Vogel?“ Nein, eher einen Papagei von Gilbertschen Ausmaßen, mindestens! „Du kannst mich nicht einfach aus der Detektei werfen! Ich schufte seit zwei Jahren für dich. Und zwar richtig gut! Ich habe eine Menge Kunden, die zufrieden sind, ich kenne mich aus, ich bin dein bestes Pferd im Stall!“
Okay, das war etwas übertrieben, bis zur Araberstute hatte ich es womöglich noch gar nicht gebracht, aber ich rackerte auf jeden Fall wie ein Ackergaul. Ich stemmte meine Hände in die Hüften und funkelte ihn an.
Leider erfolglos. Er wirkte völlig unbeeindruckt.
„Red keinen Unsinn. So ein Gezicke wie gestern Abend kostet mich zu viele Nerven, das kann ich nicht gebrauchen. Du bist ersetzbar. Hier im Büro genauso wie in meinem Bett.“
„Du beschissenes, gottverdammtes Arschloch!“, zischte ich ihn an.
Was umgehend dazu führte, dass er ein herablassendes Grinsen aufsetzte und leicht den Kopf schüttelte.
„Ich hätte es wissen müssen, dass sich deine Herkunft nicht auf Dauer verleugnen lässt. Die Gosse kommt eben immer durch.“
Dieser verfluchte Hurensohn, ich würde ihm jetzt …
Bevor meine geballten Fäuste etwas tun konnten, was mir ein paar Jahre Kittchen einbringen würde, drehte er sich einfach um und ging. Ließ mich hier stehen wie ein dummes Schulmädchen, wutschäumend, zugleich mit wachsender Verzweiflung. Ja, ich kam aus einfachen Verhältnissen und ja, ich hatte ihm eine Szene gemacht. Aber zurecht! Er war der Schuldige, nicht ich. Und nun nahm er mir einfach die Wohnung weg, dazu den Job, was deutlich schlimmer war. Fuck, was zum Teufel sollte ich jetzt anfangen?
Ich hatte keine Ahnung, aber eine Sache war mir völlig klar: Dexter Fox würde mich nicht kleinkriegen, mich nicht!
3. Mit Putzeimer bewaffnet
Joe
Die Kneipenszene in Boston war mir noch ebenso unbekannt wie die angesagten Musik-Acts der Stadt. Ich war erst vor ein paar Wochen hierhergezogen und somit neu in der City, was für Ermittlungen echt Scheiße war. Ich kannte weder die einschlägigen Verdächtigen noch die Clubs, in denen zwielichtige Geschäfte jeder Art durchgezogen wurden. Und meine Kollegen waren auch nicht gerade scharf darauf, einen wie mich in ihre Geheimnisse einzuweihen. Nicht nach der Sache, die in New Orleans passiert war. So etwas sprach sich schnell rum, es klebte an mir wie ein verdammter Kaugummi an meiner Schuhsohle.
Also lungerte ich eben in meiner Freizeit in irgendwelchen Bars herum, um was zu trinken und meine Nase tiefer in die Bostoner Szene zu stecken. Heute Abend war da keine Ausnahme. Die Tür zu Jimmy‘s Musicbar knarzte unfreundlich, als ich sie aufdrückte. Innen erwartete mich die übliche versiffte Musikkneipe, davon hatte ich schon eine Menge gesehen. Nur dass diese hier rammelvoll war, was offenbar an der Band lag, die heute Abend hier spielte. Zumindest rannte ein ganzes Rudel von Zuschauern mit T-Shirts herum, auf denen Evil Medicine aufgedruckt war und ein Foto der fünf Typen plus ihren Instrumenten. Na ja, wer‘s brauchte.
Ich quetschte mich an die Bar und bestellte ein Bier. Immerhin sahen die Gestalten, die sich neben mir an ihren Gläsern festhielten, nicht ganz so schnöselig aus wie der Rest der Ostküsten-Boys. Wie nicht anders zu erwarten, hielten sich viele in dieser Stadt für was Besseres. Man hatte ja schließlich Harvard, dazu eine wichtige Rolle in der Geschichte dieses Landes zu bieten und angeblich eine bessere Aussprache als wir aus dem Süden. Arrogante Snobs! Vielleicht war es die falsche Entscheidung gewesen, mich ausgerechnet in den Norden versetzen zu lassen. Erst seit ich hier war, merkte ich, wieviel Heart of Dixie doch in mir steckte. Egal. Ich war nun in Massachusetts und würde den Schnöseln hier beweisen, dass auch ein Mann aus dem Süden verdammt gute Arbeit abliefern konnte.
Mit dieser Bar lag ich gar nicht so falsch, vermutete ich, denn es hingen einige Gestalten herum, denen ich durchaus zutraute, sich auch mal illegale Substanzen einzuwerfen. Wobei mir der Stoff für ein paar Joints egal war, der hier ziemlich sicher auch den Besitzer wechselte, ich war hinter Stardust her. Im Idealfall würden mir Leute auffallen, die das Dreckszeug konsumierten. Die würde ich dann heimlich beschatten und auf diese Weise schließlich die Hintermänner zu fassen kriegen. Aber so leicht war das natürlich nicht.
Während ich mich umsah, nahm ich noch einen Schluck aus meinem Bierglas. Die Barfrau, eine dralle, nicht ganz taufrische Blondine mit einem Faible für zu eng anliegende Oberteile, hatte die Theke trotz aller Hektik gut im Griff. Ein paar Bedienungen wuselten herum. Bevor ich die Gäste genauer unter die Lupe nehmen konnte, johlte der ganze Laden los, denn die Band latschte auf die Bühne.
Okay, Rock war angesagt. Als die Jungs den ersten Song spielten, fiel mir auf, dass ich diese Nummer neulich im Radio gehört hatte. War als brandneu vorgestellt worden. Na ja, der Sound war in Ordnung, bodenständig, derb, hart. So was mochte ich. Mit dem verkünstelten Zeug im Radio, das nach Weichspüler-Reklame klang, konnte ich wenig anfangen. Meine musikalischen Wurzeln lagen zwar ganz woanders, aber wenn ich meine Boxen mal lauter drehte, dann nur bei kernigem Rock.
„Hey, Suzie, deine Jungs werden ja immer besser“, rief der Typ neben mir der Bedienung zu.
„Haben die denn was mit der Bar hier zu tun?“, fragte ich ihn.
Er nickte, bevor er seinen Whisky hinter die Binde kippte. „Hatten hier ihre ersten Auftritte. Deshalb kommen sie immer noch regelmäßig her. Ich glaub, die proben sogar oft hier. Stimmt‘s, Chefin?“
Suzie drehte sich zu uns. „Jeden Freitagnachmittag“, bestätigte sie. „Und ich bin echt stolz auf meine Babys!“ Sie grinste breit und holte eine Zigarre raus, die sie sich in aller Seelenruhe anzündete. Ich hatte nicht vor, mich als Arm des Gesetzes zu outen und ihr den Glimmstängel zu verbieten. Das wäre wohl eher kontraproduktiv gewesen. Allerdings stank das Kraut bestialisch, das war wohl irgendeine dieser neumodischen Mischungen, denn da schwang `ne grässlich süße Note mit.
Die Band war inzwischen bei der vierten oder fünften Nummer angekommen. Ich drehte mich auf dem Barhocker herum und beobachtete die Combo. Sah nicht so aus, als herrschte bei denen gute Stimmung. Der Sänger machte ein Gesicht, als würde er lieber in der Küche den Abwasch erledigen statt auf der Bühne zu stehen. Die anderen wirkten auch irgendwie genervt. Am schlimmsten aber fand ich den Gitarristen, einen schmalen, ausgezehrten Typ mit glasigem Blick, der griff nämlich mehrmals daneben. Hatte er was getrunken? Oder vielleicht sogar …?
Ich legte ein paar Scheine auf den Tresen und quetschte mich nach vorne durch. Vor der Bühne hatte ich einen besseren Blick auf den Kerl. Auch wenn ich hier an der Ostküste vorläufig nur ein neuer Cop und somit eine kleine Nummer war – auf die Calinger-Spürnase war Verlass. Und die sagte mir, dass ich den Gitarristen näher unter die Lupe nehmen sollte. Ich schob ein paar kreischende Fangirls zur Seite und ließ den Musiker nicht aus den Augen. Er kam auf meine Seite der Bühne, während er schrille Töne aus seiner Fender jagte.
Und da sah ich es. Er hatte die typischen roten Flecken am Hals. Klar, es konnten auch Knutschflecken von der letzten Nacht mit vier Groupies sein, aber das glaubte ich nicht. Dieser Evil Medicine-Musiker hatte Stardust eingeworfen. Zufrieden grinste ich. Gleich morgen würde ich alles ausgraben, was sich über ihn finden ließ. Vielleicht war er ein regelmäßiger Kunde. Falls das so war, würde er etwas Neues am Hals haben, nicht nur die Flecken: nämlich mich.
*
Am nächsten Tag saß ich in einem schmucklosen Büro des Dezernats meinem Boss gegenüber und war kurz davor, ihm eine reinzuhauen.
„Eine verdeckte Ermittlung kommt nicht infrage“, schnarrte Brown und schob den Ordner mit den von mir aufbereiteten Unterlagen zurück in meine Richtung.
Holy shit, was zickte der jetzt so rum?
„Wie soll es anders funktionieren?“, gab ich zurück. „Ich habe genügend Hinweise gesammelt. Dieser Sharp, der Sänger von Evil Medicine, ist schon mehrfach aufgefallen wegen Drogenproblemen. Sogar auf der Bühne hat er manchmal Aussetzer. Der wirft sich Stardust ein, das weiß ich hundertpro!“
„Dann laden Sie ihn vor und nehmen ihn zusammen mit einem Kollegen in die Mangel.“
„Das ist doch Unsinn!“ Ich hatte schwer damit zu kämpfen, halbwegs Ruhe zu bewahren. „Der wird seinen Anwalt mitbringen und jede Aussage verweigern. Über so einen Weg kommen wir niemals weiter.“
Browns Augen blieben hart, seine Miene total abweisend. „Sie können die Band mit Tyler zusammen beschatten. Gehen Sie abends zu den Auftritten, befragen Sie gemeinsam ein paar verdächtige Zuhörer.“
Verflucht noch mal, so würden wir doch nie im Leben die Leute in den Knast kriegen, die hinter der ganzen Stardust-Sache steckten!
„Ich will mich ins Umfeld der Band einschleusen, nur so gehen uns am Ende die dicken Fische ins Netz!“, platzte es aus mir heraus.
„Und ich will, dass sie keine Alleingänge machen, Calinger!“ Brown verschränkte die Arme vor der Brust.
Das war also der wahre Grund!
Wut kochte in mir hoch, ließ mich schneller atmen und meine Hände zu Fäusten ballen.
„Es geht also um den Vorfall in New Orleans“, zischte ich. „Was hat man Ihnen erzählt? Dass ich leichtfertig Kollegen gefährdet habe und durch meine Schuld drei Menschen gestorben sind, davon ein unschuldiger junger Mann?“
„So etwas in der Art“, gab er zu.
„Dann sollten Sie vielleicht mal den offiziellen Bericht lesen!“
Wobei – auch das würde nicht viel helfen. Ich hatte damals nicht die volle Wahrheit zu Protokoll gegeben. Die hätte doch sowieso niemandem genutzt. Fakt war, ich hatte versagt. Ich hätte den ganzen Einsatz damals anders angehen müssen, mich selbst um alles kümmern. Hätte Shaun niemals mit einem Auftrag betrauen dürfen, dem er nicht gewachsen war. Als alles vorbei war, da hatte ich ihn nicht bloßstellen wollen und es als meine Pflicht angesehen, die ganze Schuld auf mich selbst zu nehmen. Wem hätte die Wahrheit geholfen? Seiner Witwe ganz sicher nicht. Es war für sie leichter gewesen, ihn als Helden zu beerdigen und mich zu hassen, als die wahren Gründe für seinen Tod zu kennen. Ich hatte ein dickes Fell, ich konnte damit leben, dass alle mich für einen Dreckskerl hielten. Meistens zumindest.
„Hören Sie, Brown …“ Ich beugte mich ihm entgegen und bemühte mich um eine ruhige Stimme. „Sie vertrauen mir nicht, das kann ich verstehen. Sie sehen nur den Cop, der ein paar Menschenleben auf dem Gewissen hat. Und den wollen Sie am liebsten ständig in der Überwachung haben. Aber im Ernst – lesen Sie meine Personalakte. Ich mach den Job nicht erst seit gestern. Ich hab mir vorher nie was zu Schulden kommen lassen. Und jetzt bitte ich Sie um die Chance, Ihnen zu beweisen, dass ich kein Totalausfall bin.“
Ich sah ihm direkt in die Augen. Er hielt meinem Blick stand. Lange. Länger als die meisten Menschen.
Schließlich holte er tief Luft.
„Okay, Calinger. Sie haben genau vier Wochen. Versuchen Sie es. Aber ich möchte alle drei Tage einen Bericht auf den Tisch. Und bei dem ersten Anzeichen von irgendwelchen Extratouren sind sie raus aus der Undercover-Nummer und tragen künftig Tyler seine Lunchbox hinterher. Ist das klar?“
Erleichtert lehnte ich mich wieder an den Stuhl. „Absolut klar, Chief.“
„Gut. Dann ab mit Ihnen, ich hab noch was anderes zu tun.“
Ich stand auf, tippte mir an einen nicht vorhandenen Hut und verließ sein Büro. Der alte Brown war vielleicht doch nicht so klein kariert, wie ich anfangs gedacht hatte. Jetzt ging es ans Eingemachte. Ich würde alles vorbereiten und morgen versuchen, in den Dunstkreis der Band zu gelangen. Sie probten nachmittags in Jimmy‘s Bar, das war ein guter Anfang. Irgendwie würde ich mich dort schon auf die eine oder andere Art einschleusen, war ja schließlich nicht mein erster Undercover-Einsatz.
*
Mit ein paar Scheinchen in der Hosentasche, einer Mütze über meinen dunklen Haaren und einer Brille ohne Sehstärke auf der Nase machte ich mich am Freitagnachmittag auf den Weg zu Jimmy‘s Musicbar. Ich stiefelte gerade die Straße entlang, da klingelte mein Handy. Die Nummer kannte ich nicht, dafür aber die tiefe Brummstimme, die sich meldete.
„Father Augustine!“, rief ich überrascht und blieb stehen. „Das ist ja ein Hammer. Ich habe ewig nichts mehr von Ihnen gehört!“
„War auch gar nicht so leicht, an deine Nummer zu kommen. Aber mit Gottes Hilfe und ein paar guten Kontakten hat es am Ende geklappt. Wenn ich es recht verstehe, hat es dich nach Boston verschlagen?“
„So ist es.“ In meiner Brust wurde es mit einem Mal ganz warm. Der alte Priester hatte mich in meiner Jugendzeit unter seine Fittiche genommen. Ja, mehr sogar, ohne ihn wäre ich sicher als eines der zahlreichen Bandenopfer blutend auf der Straße verendet. Stattdessen hatte er mich als 12-Jährigen in seine Kirche gezerrt und in den Gospelchor gesteckt, den er leitete. Selbst wenn ich ihn nur reden hörte, hatte ich sofort seinen abgefahrenen Bass im Ohr, der Nobody knows the trouble I‘ve seen anstimmte.
„Ich werde für zwei Wochen in der Stadt sein. Erst ein Treffen mit anderen Schulleitern, anschließend möchte ich mir noch ein paar Einrichtungen bei euch im Norden anschauen. Es wäre schön, wenn wir uns sehen könnten, Joe. Ich bin gespannt, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Singst du denn noch?“
„Höchstens unter der Dusche. Ich versuche eher, andere zum Singen zu bringen, allerdings eher im Verhörraum als in der Kirche. Bin ja immer noch bei der Polizei.“
„Das weiß ich doch.“ Er lachte sein Bärenlachen, das mir schon als Kind ein wohliges Gefühl gegeben hatte. „Ich habe deinen Werdegang stets verfolgt. Aber üb schon mal ein bisschen, denn ich habe natürlich meine Ukulele im Gepäck, wenn ich dich besuchen komme.“
„Darauf freue ich mich sehr, Father. Also auf den Besuch. Aufs Singen nicht, da bin ich völlig eingerostet.“
„Ach was, das ist wie Fahrradfahren. Ich melde mich die nächsten Tage bei dir, in Ordnung?“
„Sehr gern!“
„Dann pass inzwischen auf dich auf, mein Junge.“
Er legte auf und ließ mich mit einem freudigen Grinsen im Gesicht zurück. Father Augustine wiederzusehen brachte einen Lichtstrahl in mein Alltagsgrau, es ließ diese Stadt, in der ich mich nicht zu Hause fühlte, mit einem Mal freundlicher wirken. Und vielleicht war es sogar ein gutes Zeichen. Ich war zwar absolut nicht abergläubisch, doch ein bisschen Glück hätte ich verdient nach all dem Scheiß in den letzten Jahren, fand ich.
Als ich die Bar erreichte und gegen die Eingangstür drückte, gab diese nach. Sie war nicht verschlossen, was mich wunderte. War das die Auswirkung meines kurzen Telefonats mit dem Priester, der offenbar eine gute Leitung nach oben hatte?
Nein, es war eher die Schuld des Hausmeisterdienstes, dessen Wagen vor dem Eingang parkte. Ein junger Kerl telefonierte gerade aufgeregt. „Ich hab nicht genug Leute“, sprach er in sein Handy. „Keine Ahnung, wie ich die Bar hier und noch die drei anderen Aufträge hinkriegen soll. Joaquin ist heute krank und Sid schickt mir keinen Ersatz. Wie stellt der sich das vor?“
Okay, es gab also doch schicksalhafte Fügungen! Oder einen Helferengel im Putzeinsatz.
Ich klopfte an die Scheibe. „Sid schickt mich“, log ich. „Ich soll Jimmy‘s Bar übernehmen. Ist halt mein erstes Mal und so.“
Der Typ beendete das Gespräch und sah mich an. „Er hat dich hierher geschickt?“, fragte er ungläubig.
Zum Glück trug er, obwohl er offenbar sowas wie ein Vorarbeiter war, einen Blaumann. Mit Namensschild. „Er hat gesagt, ich soll mich bei Lenny melden. Das bist du doch, oder?“
Er nickte.
Zehn Minuten später trug ich einen blauen Overall mit dem Namenszug Joaquin. Das passte ja irgendwie zu Joe und auch zu meiner Herkunft, denn mein Dad war Mexikaner gewesen. Von ihm hatte ich die dunklen Haare geerbt, von meiner Südstaaten-Mom die hellen Augen, was sie immer sehr gefreut hatte. Einen Putzeimer mit ein paar Utensilien bekam ich auch noch ausgehändigt, anschließend betrat ich die Bar. Ein Mexikaner im Arbeitsanzug, der den Saal sauber machte, würde sicher keine große Aufmerksamkeit erregen. Das war perfekt für meinen Einsatz.
Die Band hatte sich auf der Bühne versammelt und stritt. Offenbar gab es massive Probleme mit dem Sänger, der keine Lust mehr hatte. Vor allem dieser Sharp, der Typ mit dem akuten Drogenproblem, hackte auf ihn ein. Ich spitzte die Ohren, verstand aber nicht alles, weil der Drummer zwischendurch immer mal wieder auf sein Set einschlug, um etwas zu testen. Es ging um Vertragsangelegenheiten und um die Frage, wer künftig die Nummern schrieb, wobei mir da ziemlich viel Machtgehabe im Spiel zu sein schien.
Ich ließ Wasser in meinen Eimer laufen und begann, den Boden zu schrubben. Natürlich war es nicht sonderlich cool, hier als Putzmann über die Dielen zu kriechen und anderer Leute Dreck wegzumachen. Aber ich durfte nicht wählerisch sein, wenn ich die Verantwortlichen für das Teufelszeug Stardust zur Strecke bringen wollte – und Chief Brown beweisen, dass ich ein fähiger Polizist war! Also schrubbte ich los.
Soweit ich wusste, war es nichts Neues, was da vorne abging. In Bands trafen oft genug mehrere Alphatiere aufeinander. Dass die irgendwann aneinandergerieten, war keine Überraschung. Und für mich schon immer ein Grund gewesen, nie richtig in eine Band einzusteigen. Nach meiner Ausbildung im Chor, wo mir Father Augustine von Anfang an eine Stimmausbildung verpasst hatte, war ich gesanglich eher auf Solopfaden unterwegs gewesen. Mal mit einem Gitarristen ein paar Nummern zu komponieren und damit aufzutreten, mal auszuhelfen, wenn irgendwo jemand ausgefallen war – das hatte mir gereicht. Ich kannte mich zu gut, um mich auf etwas anderes einzulassen, ich war nämlich auch ein Alphatier. Und außerdem null geeignet für das ganze Gruppenharmoniegewäsch, das in so einer Band zwangsläufig immer wieder verzapft wurde, ohne dass sich jemand daran hielt.
Irgendwann einigten sich die Streithähne auf einen Waffenstillstand und bastelten an einem neuen Song herum. Ich wischte inzwischen die Tische ab und erinnerte mich an unsere Proben damals im Chor. Schon komisch, dass ich das alles noch wusste. Sogar das allererste Stück, bei dem ich ein Solo hatte singen dürfen, fiel mir noch ein. Wade in the water war es gewesen. Unwillkürlich musste ich grinsen.
„Das ist alles Schrott, was du machst!“, explodierte Sharp gerade auf der Bühne.
„Du Idiot hast doch keine Ahnung!“, brüllte der Sänger zurück. „Du bist doch eh nur noch high!“
Oha, das war spannend. Meine Spürnase hatte mich auf jeden Fall auf die richtige Fährte geführt. Ich zog meine Mütze noch tiefer in die Stirn und beobachtete den Gitarristen genau. Zittrig sah er aus. Ob sein Wutausbruch etwas mit den Drogen zu tun hatte? Brauchte er die nächste Sternchenpille? Allerdings musste ich ihm recht geben, der Frontmann sang tatsächlich ziemlichen Mist zusammen.
„Hey, Putzmann, was glotzt du so blöd?“, blaffte dieser mich an und schraubte seinen Mikroständer nach oben.
Eilig verzog ich mich hinter die Theke, um dort sauber zu machen. Nur nicht auffallen! Ich tauchte unter, weil ich mit dem Schwamm ein paar Flecken auf dem Fußboden zu Leibe rückte. Dem Drummer wurde das Ganze offenbar zu blöd, er setzte einfach mit einem Trommelwirbel ein und klopfte dann den Beat eines Songs vor sich hin. Ganz schön mitreißend, das musste ich zugeben. Sehen konnte ich von hier aus nichts, aber ich hörte, dass der Bassist dazustieß und auch die Rhythmusgitarre einsetzte. Sogar Sharp steuerte ein paar scharfe Töne bei.
Mir kam ein alter Gospel in den Sinn und ich summte beim Putzen vor mich hin. Echt coole Sache, dass Father Augustine mich besuchte. Ein wenig freute ich mich tatsächlich drauf, mit ihm zu jammen. Dass er seine uralte Ukulele sogar mit nach Boston schleppte, war typisch für den schrulligen Mann. Er war wirklich ein Original und ein echter Musikfreak.
„Bist du im Kirchenchor oder was?“, schreckte mich eine Stimme auf.
Ich fuhr hoch. Auf der anderen Seite des Tresens stand der Sänger, schenkte sich aus einer herumstehenden Wodkaflasche etwas ein und starrte mich an.
Shit, ich durfte nicht auffallen!
„Bin nur Putzmann, Sir“, stammelte ich und bemühte mich, möglichst dämlich aus der Wäsche zu schauen. Je einfacher gestrickt ich erschien, umso weniger Verdacht würde die Band schöpfen, wenn ich hier auch künftig herumwuselte.
„Aber einer, der singt. Passt doch perfekt!“ Ironie troff aus jedem Wort. „Du kannst gerne für mich übernehmen, ich will mit diesen Idioten nichts mehr zu tun haben.“
„Kommt vor bei allen Bands, dass mal Streit gibt“, imitierte ich einen spanischen Akzent und hob meinen Blick nicht vom Putzeimer. Was wollte der Kerl von mir? Er sollte mich verdammt noch mal in Ruhe lassen!
Doch er trank sein Glas leer und knallte es auf den Tisch. „Mag sein, aber ich hab keinen Bock mehr.“
Dann drehte er sich zu seinen Kollegen um. „Hey Leute, ich hab einen phantastischen Ersatz für mich gefunden!“, rief er. Ein kurzer Blick zu mir, auf meinen Blaumann, dann brüllte er weiter. „Mein Freund Joaquin hier wird euer neuer Sänger. Ich bring ihn euch auf die Bühne!“
Schon fasste er mich am Ärmel und zerrte mich durch den Zuschauerraum. Ich hasste es, angefasst zu werden, und hätte diesem Mistkerl am liebsten eine gescheuert, aber ich musste natürlich Ruhe bewahren.
„Was soll das, Brenton?“, fragte der Drummer. „Lass den armen Mann in Frieden.“
Doch der Sänger schleppte mich die Treppe zur Bühne hoch und schob mich vor das Mikro. „Ihr meckert doch die ganze Zeit an mir herum. Ich steige aus. Hab die Schnauze voll von euch. Ihr könnt ja künftig Gospel spielen, Joaquin kann zumindest den Text von Go down Moses. Ist bestimmt ‘ne Marktlücke für euch.“ Er lachte schrill. „Vielleicht ist er ja besser als ich? Probiert ihn aus.“
Verflucht, er zog mich in ihre Streitereien hinein. Nur, weil er die anderen dumm dastehen lassen wollte. Darauf war ich wirklich nicht scharf. Wie zum Teufel sollte ich jetzt noch unauffällig die Band ausspionieren, wenn dieser Idiot mich hier in den Mittelpunkt zerrte? Ich hätte dem Kerl echt eine verpassen können.
„Schlechter als du kann er ja kaum sein!“, giftete Sharp zurück, brachte seine Stratocaster in Position und schrummte zu meinem Entsetzen mit ernstem Blick zwei Akkorde.
Das war der Einstieg zu Go down Moses. Er glaubte doch wohl nicht wirklich, dass ich …?
„Los, dein Einsatz! Zwei Bier für dich, wenn du Brenton beweist, dass man ihn mit jedem dahergelaufenen Hausmeister ersetzen kann!“
Es war ein Witz, ganz klar.
Sein Blick jedoch verriet mir, dass mit ihm im Augenblick nicht zu spaßen war.





























