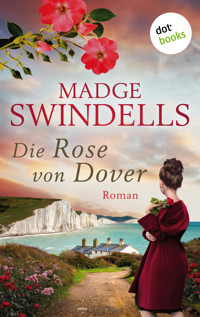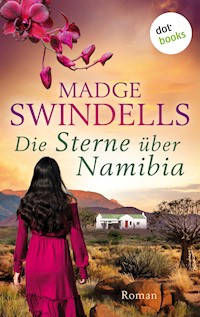4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Geheimnisse des schwarzen Kontinents: Der fesselnde Sammelband »Unter den Sternen Afrikas« von Madge Swindells als eBook bei dotbooks. Das Schicksal legt ihnen Steine in den Weg – doch diese drei Frauen sind nicht bereit, sich davon aufhalten zu lassen: Marika, die mittellos nach Namibia kommt und sich hier fern ihrer alten Heimat ein neues Leben aufbauen muss; Anna, die aus einer der angesehensten Familien Südafrikas stammt und alles riskiert, als sie ihrem Herz folgen will; Liza, die so behütet aufgewachsen ist, bis eines Tages ein böses Gerücht die Runde macht: Trotz ihrer hellen Haut ist sie eine Schwarze – und in einer Welt, die von Vorurteilen und Hass geprägt ist, muss sie von nun an doppelt so hart kämpfen, um ihr Glück zu finden … Von den Weiten der Kalahari und der üppigen Schönheit Südafrikas bis in die obersten Schichten der Gesellschaft, von den Schrecken der Vergangenheit und der Unmenschlichkeit der Apartheit in eine bessere Zukunft: Drei große Familiensagas und Schicksalsgeschichten, die Sie auf über 2.000 Seiten bewegen und begeistern werden! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Sammelband »Unter den Sternen Afrikas« vereint die drei Bestseller »Ein Sommer in Afrika«, »Die Sterne über Namibia« und »Die Löwin von Johannesburg« von Madge Swindells. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2741
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das Schicksal legt ihnen Steine in den Weg – doch diese drei Frauen sind nicht bereit, sich davon aufhalten zu lassen: Marika, die mittellos nach Namibia kommt und sich hier fern ihrer alten Heimat ein neues Leben aufbauen muss; Anna, die aus einer der angesehensten Familien Südafrikas stammt und alles riskiert, als sie ihrem Herz folgen will; Liza, die so behütet aufgewachsen ist, bis eines Tages ein böses Gerücht die Runde macht: Trotz ihrer hellen Haut ist sie eine Schwarze – und in einer Welt, die von Vorurteilen und Hass geprägt ist, muss sie von nun an doppelt so hart kämpfen, um ihr Glück zu finden …
Von den Weiten der Kalahari und der üppigen Schönheit Südafrikas bis in die obersten Schichten der Gesellschaft, von den Schrecken der Vergangenheit und der Unmenschlichkeit der Apartheit in eine bessere Zukunft: Drei große Familiensagas und Schicksalsgeschichten, die Sie auf über 2.000 Seiten bewegen und begeistern werden!
Über die Autorin:
Madge Swindells wuchs in England auf und zog für ihr Studium der Archäologie, Anthropologie und Wirtschaftswissenschaften nach Cape Town, Südafrika. Später gründete sie einen Verlag und brachte vier neue Zeitschriften heraus, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Bereits ihr erster Roman, »Ein Sommer in Afrika«, wurde ein internationaler Bestseller, dem viele weitere folgten.
Die Website der Autorin: www.madgeswindells.com
Bei dotbooks veröffentlichte Madge Swindells neben ihre großen Familien- und Schicksalsromane, die Sie in diesem Sammelband finden, auch »Eine Liebe auf Korsika«, »Die Rose von Dover«, »Liebe in Zeiten des Sturms« und »Das Geheimnis von Bourne-on-Sea« sowie ihre Spannungsromane »Zeit der Entscheidung«, »Im Schatten der Angst«, »Gegen alle Widerstände« und »Der kalte Glanz des Bösen«.
***
Sammelband-Originalausgabe Juni 2022
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Die englische Originalausgabe von »Ein Sommer in Afrika« erschien 1983 unter dem Originaltitel »Summer Harvest« bei Macdonald, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1986 unter dem Titel »Die Ernte eines Sommers« im Bastei-Lübbel-Verlag. – Copyright © der englischen Originalausgabe 1983 by Madge Swindells; Copyright © der deutschen Erstausgabe 1986 Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach; Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Die englische Originalausgabe »Die Sterne über Namibia« erschien erstmals 1985 unter dem Originaltitel »Song of the Wind« bei Macdonald, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1987 unter dem Titel »Die Zeit der Stürme« bei Bastei Lübbe. – Copyright © der englischen Originalausgabe 1985 by Madge Swindells; Copyright © der deutschen Erstausgabe 1987 Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach; Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Die englische Originalausgabe von »Die Löwin von Johannesburg« erschien erstmals 1994 unter dem Originaltitel »The Sentinel« bei Little, Brown and Company, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Die Tränen der Leopardin« bei Bastei Lübbe. – Copyright © der englischen Originalausgabe 1994 by Madge Swindells; Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach; Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/PhotoSunnyDays, Abraham Badenhorst, Dewald Kirsten, Tamara Kulikova, Vaclav Sebek, Anton Watman
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-782-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Unter den Sternen Afrikas« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Madge Swindells
UNTER DEN STERNEN AFRIKAS
Drei Romane in einem eBook
Aus dem Englischen von Werner Petrich, Wolfgang Crass und Michaela Link
dotbooks.
EIN SOMMER IN AFRIKA
Aus dem Englischen von Werner Peterich
Das Glück ist eine zarte Pflanze, von der man nie weiß, wann sie erblüht … Sie ist der Stolz ihrer Eltern, die Erbin des berühmten Landguts Fontainbleu und eine der besten Partien der südafrikanischen Kap-Provinz – doch Anna van Achternburgh hat ihren eigenen Kopf. Heiraten, um die Erwartungen anderer zu erfüllen? Auf keinen Fall! Als sie sich in den mittellosen Simon Smit verliebt, ist dies ein Skandal. Gegen alle Widerstände gelingt es Anna, seine kleine Farm mit viel Geschick und Leidenschaft in ein Paradies zu verwandeln. Doch dann ziehen dunkle Wolken über ihr auf – und Anna muss sich fragen, ob der Mann, den sie über alles liebt, wirklich der Richtige für sie ist …
Erstes Buch
Kapitel 1
Kap der Guten Hoffnung, Februar 1938
Das letzte Stück Straße zog sich gen Westen am Südrand der Lagune hin und fand irgendwo in Richtung Meer ein Ende. Dabei ging es über ein trostloses Gelände, zu steinig, es zu pflügen, zu sandig, Weizen darauf anzubauen, ein Stück Land voller Riedgras und Gestrüpp, wo man für ein Schaf fünf Morgen brauchte und allenfalls ein paar Schweine und Ziegen frei laufen lassen konnte. Hinter der Schotterstraße lag noch eine letzte Farm, Modderfontein, die im Nordosten bis an den Atlantik reichte und im Nordwesten bis ans Ende der Lagune, wo auf Sumpfgebiet Möwen nisteten. Auf der anderen Seite der Lagune konnte man die Walfangstation sehen, und bei Nordwestwind kam der Gestank von verwesendem Walspeck herüber.
Heute jedoch wehte kein Wind. Es war fast Mittag.
Die Köpfe flach auf dem Boden vorgestreckt, lagen benommen Schafe unter den Sträuchern, und sogar die Seemöwen hatten ihr Kreischen eingestellt.
Trotzdem warf die Oberfläche der Lagune kleine Wellen: Ein leeres Petroleum-Faß schoß von Norden nach Süden und von Osten nach Westen übers Wasser dahin und zog eine kleine Schaumspur mit schillernden Ölflecken hinter sich her.
Am Horizont befleckte aufwölkendes Gelb das Blau. Ein klappriger Lastwagen rollte ratternd auf jene Stelle zu, wo Lagune und Straße fast einander berührten. Dort kam er schliddernd zum Halten, der mit gelbem Staub bedeckte Fahrer kletterte aus dem Fahrerhaus, streckte sich und versuchte, sich mit dem gleichfalls schmutzigen Handrücken den Staub aus den Augen zu wischen.
Er war ein Riese von einem Mann. Er sah mit seinen vierundzwanzig Jahren älter aus als er war, mit seinem von der trockenen Hitze an Land und der bitteren Kälte der Antarktis wettergegerbten Gesicht, maß ohne Schuhe einsneunzig, hatte leuchtend rotes Haar und smaragdgrüne Augen – Augen, die lächelten, als sie jetzt das Faß vorübertreiben sahen. Drei Tage war es her, daß er den Hai harpuniert und das Seil an dem leeren Faß festgemacht hatte; bis zur Hüfte im Wasser der Lagune stehend, hatte er den Schaft geschleudert und ihn dem Hai so tief in die Flanke getrieben, daß das Tier sich nicht hatte losreißen können. Nicht mehr in der Lage zu tauchen, verhungerte es jetzt langsam im seichten Wasser.
Simon Smit war auf Modderfontein geboren und aufgewachsen, hatte die Farm geerbt, als er noch keine Zwanzig gewesen war, und führte seither eine Art Doppelexistenz: Von Mai bis November säte und erntete er kümmerlich gedeihenden Weizen auf der Nordseite der flachen Hügel, wo der Boden nicht ganz so sandig war, und nach der Ernte musterte er als Harpunist auf einem Walfänger an; Ende April kehrte er dann mit genügend Geld in der Tasche zurück, um Saatgut und Düngemittel zu kaufen. Dieses Jahr aber hatte sein Vormann ihn sitzen lassen, und Simon hatte nicht auf dem Walfänger anheuern können. Die Ernte war schlechter ausgefallen als gewöhnlich, es hatte so gut wie überhaupt nicht geregnet, und er fragte sich voller Unbehagen, wie er seine Schulden bezahlen sollte.
Modderfontein lag zehn Meilen hinter der kleinen Ortschaft Saldanha Bay, einem abgelegenen Nest auf der Südwestseite des Kaps der Guten Hoffnung, Zufluchtstätte für Ziegen und ein paar skurrile Farmer – Nachfahren von Siedlern, deren Schiffe hier einst vor der Küste gestrandet waren. Dennoch gehörte die Bucht zu den beiden natürlichen Häfen der Ersten Kategorie, die auf den Londoner Admiralitätskarten eingezeichnet waren, und hätte es nicht einfach an Trinkwasser gefehlt, so wäre sie gewiß einer der bedeutenderen Häfen des Kaplandes geworden.
Es war Ende Februar 1938, in einem Jahr folgenschwerer Ereignisse in Europa. Das Jahr, in dem Hitler in Deutschland Oberster Befehlshaber der Wehrmacht wurde und in Österreich einmarschierte, um dort ›die Ordnung wiederherzustellen‹, das Jahr des Münchner Abkommens und der Kristallnacht. Doch von den Vorbeben kommender Erschütterungen, die die westliche Welt heimsuchten, war in Saldanha Bay nichts zu spüren. Hier wurden Katastrophen nach der Höhe der Niederschläge in Zentimetern gemessen, und die Zeit bemaß sich nach den Jahreszeiten.
Simon kletterte in seinen Laster und fuhr Richtung Kapstadt weiter. Hinter ihm quiekten unter einem behelfsmäßig zusammengezimmerten Lattengestell zwei Sauen, und in der Ecke – von den Schweinen durch eine Rolle Draht getrennt – hockte ein junges Mädchen von siebzehn Jahren und hielt einen Stock in der Hand, um die Tiere abzuwehren.
Ihr Name war Sophie, und sie hatte Angst. Gezeugt auf dem Beiboot eines Walfängers im Trockendock und zur Welt gebracht in einem Graben auf Modderfontein, kannte sie weder Vater noch Mutter, aber in ihren Adern mochte das Blut von Schweden und Hottentotten, Engländern, Indern, Portugiesen, Russen und Chinesen fließen. Auf jeden Fall hatte eine buntgemischte Ahnenschaft ein Mädchen von ungewöhnlicher Schönheit hervorgebracht – einer Schönheit, die allerdings bei dem harten Leben auf der Farm kaum zur Geltung kam.
Sophie war als Findelkind von Simons Mutter großgezogen und dazu angeleitet worden, den Truthühnern übers Land zu folgen. Tagein, tagaus, jahraus, jahrein war sie hinter der Herde hergezogen, um die Eier aus den versteckten Nestern zu lesen.
Der Tod von Simons Mutter war ein entscheidender Einschnitt in Sophies Leben. Sie war damals vierzehn gewesen und hatte geweint, als die Puter verkauft worden waren.
Inzwischen waren fast drei Jahre vergangen, und vor kurzem hatte Sophie beschlossen, die Farm zu verlassen, um sich Arbeit in der Stadt zu suchen. An diesem Morgen hatte sie den Baas gebeten, sie mitzunehmen.
Ein kurzes Stück hinter Malmesbury brachte Simon den Laster unter einer Eiche zum Stehen. Er zwängte sich durch den Zaun und strebte einem kleinen Wasserlauf zu. Als er vom Wagen her einen klagenden Ruf vernahm, runzelte er die Stirn.
»Baas! Vergiß mich nicht, Baas!«
»Ich bin gleich wieder da, Sophie.« Er eilte weiter.
»Baas, ich habe Durst.« Ihr Klageruf verhallte ungehört, doch gelang es ihr, die Lattentür aufzumachen, und kurz darauf hörte er sie durch das Unterholz hinter sich her rennen.
»Verzieh dich!« knurrte er, woraufhin sie nach rechts abbog und auf ein paar Bäume zulief, die am Bachufer wuchsen.
Simon rutschte eine schlammige Böschung herunter, bis er an einer kühlen, verwunschenen Stelle stand, wo das Sonnenlicht in Kringeln durch Geäst fiel, in dem zahllose Vogelnester verborgen waren. Voller Neid stellte er fest, daß der Bach trotz des trockenen Sommers kraftvoll dahinfloß, und er fragte sich, wie der liebe Gott dazu kam, ausgerechnet ihn besonders strafen zu wollen; zwar waren die Regenfälle überall karg ausgefallen, doch nur ein Gebiet hatte überhaupt nichts abbekommen: Saldanha Bay. Während er den Kopf über das kristallklare Wasser beugte und mit großen Schlucken trank, haderte er mit Gott.
Aus seinem Zorn wurde Verbitterung, als er sich hinsetzte, auf einem Stück biltong – Trockenfleisch – herumkaute und dem vorüberströmenden Wasser zusah. Aber schlechte Laune ohne Publikum ist der Gipfel der Unzufriedenheit mit sich selbst, und so machte er sich, als er Sophie bachabwärts im Wasser planschen hörte, auf die Suche nach ihr. Sie lag in einer teichartigen Ausbuchtung, ihr Haar wogte in der Strömung, und nur ihre Nase, die großen Zehen und zwei gerundete Brüste ragten aus dem brackigen Wasser heraus. Die Brüste waren merkwürdig weiß, die braunen Brustwarzen aufgerichtet, und Simon schoß die Frage durch den Kopf, was für Vorfahren wohl eine so hellhäutige Tochter hervorgebracht haben mochten.
Sie war kein Kind mehr. Er spürte, wie heftiges Begehren sich in ihm regte. Er schämte sich, und dann wurde er wütend auf Sophie, weil sie Schuldgefühle in ihm weckte, und als er zu seinen Füßen ihre Kleidung liegen sah, schleuderte er sie ins Geäst.
Die Augen geschlossen, sang Sophie vor sich hin.
»Komm, laß uns gehen, Sophie!« rief er, zog sich ein paar Schritt zurück und setzte sich auf einen Felsen am Rand des Wassers.
Sie öffnete die Augen, setzte sich erschrocken auf und bedeckte die Brüste mit den Händen. »Himmel, hast du mir einen Schrecken eingejagt, Baas«, rief sie in ihrem wenig ansprechenden, leiernden Tonfall.
»Komm schon!« sagte er ungeduldig. »Ich muß weiter.«
»Der Baas muß wegsehen, wenn ich mich anzieh’«, sagte das Mädchen beunruhigt.
»Wer will dich schon ansehen?« hielt er ihr entgegen, und als er kurz darauf den erwarteten Verzweiflungsschrei hörte, grinste er.
»Baas, mein Zeug ist weg!«
»Kommst du nun mit, oder willst du bleiben?« Er ging bachaufwärts weiter, doch gleich darauf zog sie an seinem Arm.
»Baas kann mich nicht zurücklassen!« Sie schämte sich, war aber gleichzeitig verzweifelt; zwischen beiden Gefühlen wurde sie hin und her gerissen. Simon spürte, wie ihm das Blut zu Kopf stieg; da war etwas Verkrampftes in seiner Brust. Nie war ihm Sophie so vor Augen gekommen, immer war sie staub- und schmutzbedeckt gewesen. Jetzt sah er ihre glatte Haut, und die war weich und verlockend. Sie sieht fast so aus wie Janet Gaynor, dachte er. Den Film Der siebte Himmel hatte er im Kino gesehen.
Als das Begehren die Oberhand über das Schuldgefühl gewann, wünschte er, er hätte ihre Kleider liegengelassen. »Da sind deine Sachen«, sagte er und wies mit einem Kopfnicken auf das Astwerk des kleinen Baumes hinter ihr. »Vielleicht hat ein Vogel versucht, sie zu stehlen.«
In Sophies Augen blitzte es wütend auf, als sie sich umdrehte, doch war sie zu verängstigt, sich zu beschweren, und zu klein, um hinaufzulangen. In sich hineinglucksend, setzte Simon sich auf die Erde und ließ, während sie den Baum hinaufkletterte, ihre Hinterbacken, die Brüste und den Haarbusch zwischen ihren Beinen nicht aus den Augen. Zerkratzt und vor Demütigung schluchzend, gelang es ihr schließlich, ihre kostbare Kleidung wieder an sich zu bringen.
Simons innere Spannung war unerträglich geworden. Er meinte zu explodieren. Es ist Sünde, dachte er, aber wer ist Gott, mich zu bestrafen, wo er selbst es versäumt hat, mir Regen zu schicken ... ?
Als Sophie die Erde wieder erreichte, packte er sie am Arm, drückte sie zu Boden und warf sich auf sie.
Sie schrie auf, als sie im Schlamm landete, und dann, nach einem kurzen Augenblick der Fassungslosigkeit, wehrte sie sich wie eine Wildkatze. Simon erwischte sie bei den Handgelenken, zwang sie ihr über den Kopf und hielt sie am Boden fest, während er mit den Knien die Beine auseinanderdrängte.
Simon hatte es noch nie mit einer Jungfrau zu tun gehabt, doch hatte er genug Geschichten darüber gehört, um die Lage sofort zu erfassen. Er war erschrocken und fühlte sich von Sophie besudelt. Erschauernd stieg er rasch die Böschung hinauf. Als er sich nach ihr umsah, weinte sie immer noch und wusch sich. Einer Regung des Augenblicks nachgebend, lief er zu seinem Lastwagen und überließ Sophie den Blumen und den Blättern.
Er nahm den Fuß nicht vom Gas, aber von Zeit zu Zeit blickte er über die Schulter zurück. Nicht Sophie war es, die er fürchtete, sondern die rächende Hand Gottes. Instinktiv wußte er, daß die Saat des Bösen, ausgebracht auf den fruchtbaren Boden des Schicksals, reich aufgehen und die Ernte Unglück sein würde.
Vier Stunden später erreichte er Stellenbosch und lieferte seine Schweine ab. Obwohl sie aus einer guten Zucht stammten, war er froh, sie loszuwerden und verkaufte sie zu einem niedrigen Preis. Vor zwei Jahren hatte er trotz der Warnungen der Farmer in der Umgebung in ›Großen weißen Landschweinen‹ – mehrere Sauen und ein Eber – investiert, doch der erste Wurf war eine Katastrophe gewesen; der Verkaufserlös deckte nicht einmal die Futterkosten. Ihre Haut war sehr sonnenempfindlich, und so hatte er sie nicht einfach frei laufen und sich selbst das Futter suchen lassen können.
Nachdem er seine quiekende Fracht los war und das Geld in der Tasche spürte, war ihm wohler zumute. Er beschloß, die Farmen in der Umgebung zu besichtigen, ein Zeitvertreib, der ihn immer deprimierte.
Er konnte seinen Neid kaum bezwingen, wenn er glatte Rinder, aristokratische Pferde, üppige Weiden und die prallen Euter der Jersey-Kühe vor sich sah. Vor allem die Weingärten faszinierten ihn; das Wasser lief ihm im Mund zusammen, und er konnte sich nicht sattsehen an den schimmernden schwarzen Trauben, die saftstrot end von allen Ranken herunterhingen. Hinter den Weingärten lagen stattliche Farmhäuser mit vielen Giebeln und schönen Fensterläden, die geradezu nach Reichtum rochen, und drum herum Koppeln, Rasenflächen und eichengesäumte Zufahrtswege.
Eines Tages wird mir auch so ein Haus gehören, dachte er, und es war wie ein fester Entschluß. Doch wie kann ich dieses Ziel erreichen? Zwanzig Jahre Schinderei in der Antarktis erbringen nicht einmal den halben Preis ...
Mit dem Gefühl, betrogen zu sein, fuhr Simon in rasendem Tempo zurück. Aber ein paar Meilen vor Stellenbosch hielt er mit kreischenden Bremsen vor dem schönsten Anwesen der ganzen Gegend. Auf dem Schild stand Fontainebleu und darunter A. T. van Achtenburgh. Vornehm, gediegen und reich beherrschte diese Farm das umliegende Land. Simon seufzte und fuhr schließlich in gedämpfter Stimmung weiter.
Er parkte vor dem Café des Ortes, schob den arg mitgenommenen Schlapphut in den Nacken und suchte sich einen Fensterplatz. Kaum hatte er seine Cola ausgetrunken, hörte er Hufgetrappel, und gleich darauf sprengte eine prachtvolle, reinrassige Araberstute vorüber. Die Reiterin war ein junges Mädchen von vielleicht achtzehn Jahren in Jodhpurs und weißer Seidenbluse. Er erhaschte einen Blick auf ihr Profil und das flatternde braune Haar. Eine Katze huschte über die Straße, und die Stute scheute. Zu nervös, dachte er und überlegte ohne echte Anteilnahme, wie das Mädchen wohl die Situation meistern würde. Sie schaffte es ganz souverän, und gleich darauf entschwanden Roß und Reiterin seinem Blick.
»Nicht schlecht!« sagte er laut und pfiff durch die Zähne.
»Das Pferd oder das Mädchen?« fragte der Café-Besitzer und sah ihn augenzwinkernd an.
»Das Pferd natürlich.« Simon wunderte sich über die Frage, doch nachdem er kurz nachgedacht hatte, fand er, daß das Mädchen dem Pferd kaum nachstand ... Sie hatte etwas an sich, wofür er nur das Wort ›Klasse‹ fand. Vollblüter, alle beide!
»Wer war das denn?« fragte er wie beiläufig.
»Van Achtenburghs Tochter. Reichste Familie in der ganzen Gegend. Haben nur die eine Tochter, keine Söhne.«
»Van Achtenburgh von Fontainebleu?« Die Nackenhaare sträubten sich ihm.
»Sie kennen sie?«
»Hab’ ihnen Zuchtvieh verkauft«, log Simon.
»Wenn ich deren Geld hätte, würd’ ich was Besseres wissen, als den ganzen Tag mit Pferden rumzumachen. Für was anderes haben die überhaupt keinen Sinn – nur für Pferde«, erklärte der Café-Besitzer verächtlich.
Simon lehnte sich zurück und träumte davon, genau so ein Pferd zu besitzen, denn wenngleich seine eigene Stute, Vixen, wahrscheinlich das bestausgebildete Pferd in der ganzen Kap-Provinz war – aufregend anzusehen war sie nicht. Nach einer Weile ging es in seinem Traum auch noch um Stallungen und schließlich um das ganze Anwesen Fontainebleu. Als der Barmann ihm auf die Schulter klopfte und einen Sixpence für die Cola haben wollte, kehrte er zurück in die Wirklichkeit.
»Sind Sie Farmer hier aus der Gegend?« erkundigte sich der Café-Besitzer.
»Natürlich«, log Simon. »Stück hinter Malmesbury.«
»Wie wär’s denn, wenn Sie zusammen mit den anderen Schlange stünden und Ihr Glück bei Achtenburghs Tochter versuchten?« schlug der Mann vor und kicherte nervös.
»Für so was hab’ ich keine Zeit!« Simon war, als wäre ihm ein elektrischer Schlag das Rückgrat heruntergefahren. Bei allen ehrgeizigen Plänen, denen er nachhing, wenn er nachts wach lag – auf die Idee, reich zu heiraten, war er noch nie gekommen.
»Gibt’s denn hier so was wie ’n Reiterturnier?« fragte er, als er die Münze auf die Theke warf.
»Nächsten Monat«, gab ihm der Mann Bescheid. »Da macht sie bestimmt mit.« Wieder zwinkerte er vielsagend mit dem Auge. »Die holt sich mit schöner Regelmäßigkeit sämtliche Preise.«
Kapitel 2
Herbstzeit. Das Kap brütete schon die dritte Woche in der Hitze des Altweibersommers. Die Nächte brachten kaum Erleichterung, denn der Bergwind, der das Hex-River-Tal heruntergefegt kam, trieb nur die Hitze der Großen Karroo-Wüste heran und erfüllte die Luft mit Staub und dem beißenden Geruch von veld-Kräutern. Jetzt hatte der Wind sich zwar gelegt, aber warm war es immer noch. Eine gefährliche Nacht, die leicht berauscht und benommen machte.
Auch Simon Smit fühlte sich wie berauscht, als er durch den Zaun in den Weingarten stieg. Seine Sinne waren erregt und überwach. Die schimmernde Kugel des Mondes vor der drohenden, dunklen Silhouette der Berge schien zum Greifen nahe. Gleißend in ihrem kalkigen Licht erhob sich hinter den Rebstöcken das Herrenhaus von Fontainebleu.
Bis zu den Knöcheln versank Simon mit den nackten Füßen in dem fruchtbaren Erdreich, das ihm zwischen den Zehen hervorquoll. Sogar die Luft war hier anders. Süßer! Rosenduft wehte vom Garten herüber und vom Fluß der Rauch von Treibholzfeuern auf feuchter Erde; es duftete nach Geißblatt und dem frischgemähten Gras der ungenutzten Rasenflächen. Die Luft der Reichen. Gierig sog er sie ein, füllte die Lungen bis zum Bersten, bis er das Gefühl hatte, selbst reich zu sein.
Er pflückte eine Traube, warf sie sich in den Mund und kaute genußvoll. Der Saft lief ihm Backen und Hals herunter. Oh Gott, hatte er einen Hunger! Einen Heißhunger aufs Leben, auf die fette Erde, auf das Wasser, das nutzlos über Steine plätscherte – und einen überwältigenden Hunger auf Anna.
Er bückte sich und hob eine Handvoll Erde auf, rieb sie zwischen den Fingern. Keine Erde – Goldstaub! Das hier sollte der Unterschied sein zwischen ihnen und ihm? Waren die Achtenburghs besser? Liebten sie das Land mehr als er? Oder arbeiteten sie härter? Froren sie sich etwa vier Monate im Jahr den Arsch im ewigen Eis ab, um den Kunstdünger bezahlen zu können? Nein, weiß Gott nicht! Er hatte den Unterschied greifbar in der Hand. An diesem Boden lag es! Diesem fetten, fruchtbaren Boden. Alles, was sie hatten – hieraus kam es. Die Muttererde zerrann ihm zwischen den Fingern. Er wischte sich die Hand an der Hose ab und ging auf das Haus zu.
Als er den Garten erreichte, wandte er sich nach links zum Ostflügel, wo das Schlinggewächs bis zum Balkon hinaufwuchs. Ein vertrauter Weg.
Annas Hund kam aus seiner Hütte herausgeschossen und leckte ihm die Hand. Sie waren inzwischen alte Freunde. Annas Zimmer lag im Dunkel. Er streichelte den Hund und wartete auf der obersten Stufe. Die Vorderfront des Hauses war in strahlendes Licht getaucht, doch er mußte sich im Schatten verbergen wie ein Dieb. Er mußte das mit Anna ins reine bringen – ein für allemal! Sie behauptete, ihn zu lieben – wovor dann solche Angst?
Er bemerkte ein Stück Papier, das im Fenster festgeklemmt war. Eckige, kühne Handschrift. Doch wohl nicht Annas? Doch ... Mama, so hieß es dort, gebe einen Empfang für die Jouberts, alte Freunde der Familie. Ob er warten könne? Es tue ihr leid.
Er stieß einen Seufzer aus.
Um ein Haar hätte er aufgegeben, wäre nach Hause gefahren, doch dann wies er den Gedanken rasch von sich. Mit Wagter auf den Fersen, drückte er sich im Schatten um das Haus.
Der Patio war von imposanter Größe. Stimmen drangen aus den offenen Fenstern. Plötzlich wurde von einem Dienstmädchen in gestreiftem Kleid die nächstgelegene Glastür aufgestoßen. Simon sprang zurück, stieß gegen einen knorrigen Baumstamm und blickte nach oben. Äste, so dick wie er selbst. Der Baum mußte seit hundert Jahren oder noch länger da stehen.
Simon zog sich in die Höhe, bis er schließlich nur wenige Meter von der offenen Tür entfernt auf einem Ast lag. Ein Blick wie von einer Tribüne herab!
Das Zimmer war atemberaubend. Die Augen fielen ihm fast aus dem Kopf, als er den langen, mit Silber und Kristall überladenen Gelbholztisch sah. An den Wänden hingen dicht an dicht Porträts in schweren Goldrahmen. Rubinrot glühten Weinkaraffen.
Annas Mutter rauschte ins Zimmer. Simon hatte sie beim Turnier kennengelernt, und ihre Boshaftigkeit brannte ihm heute noch in den Ohren. Jetzt machte sie sich vor dem Spiegel zurecht. Ein eitles und schwieriges Frauenzimmer, dachte er. Gott behüte, daß Anna einmal so wird wie ihre Mutter! Immerhin, eines mußte man der Frau lassen – sie war mit ihrem hochgetürmten schwarzen Haar und den scharfen, gleichwohl ebenmäßigen Zügen immer noch sehr schön.
Das Mädchen wurde gerufen und erschien Sekunden später.
»Ist das Essen fertig?« wollte Maria van Achtenburgh wissen.
»Ja, Madame.«
Ungeduldig ließ die Hausherrin den Blick durchs Zimmer wandern und eilte hinaus.
Das Mädchen trat ans Sideboard, schenkte sich ein Glas Sherry ein, trank es aus und ließ das Glas in der Schürzentasche verschwinden.
Jetzt kam die Familie auf den Patio heraus. Mrs. van Achtenburgh war einen guten Kopf größer als ihr Tischherr – Joubert vermutlich –, ein untersetzter Mann mit kirschrotem Gesicht und kurzem weißem Haar.
»Anna ist ein so begabtes Mädchen«, hörte Simon ihre Mutter im Vorübergehen sagen.
Was soll das alles? fragte Simon sich.
Als nächstes kam Annas Vater mit einer Frau mittleren Alters, die sich an seinen Arm klammerte. Edelsteine blitzten auf jedem unverhüllten Stück Haut. »André, hast du eigentlich schon bemerkt, was für ein bezauberndes Paar sie abgeben?« flüsterte sie und warf einen Blick über die Schulter zurück.
Also versuchten sie, Anna an Piet Joubert zu verheiraten. Der hing an der Tür herum und wartete auf Anna. Selbst aus der Entfernung wirkte er noch überheblich, denn er hatte eine seltsame Art, den Kopf immer wieder wie eine Schildkröte vorzustrecken. Jämmerlich abfallende Schultern und spillerige Beine. Ein Schwächling!
Als Anna herausschoß, bekam Simon einen trockenen Mund und hätte fast das Gleichgewicht verloren. Seit sie sich vor drei Wochen auf dem Turnier begegnet waren, hatten sie sich zwar jeden Abend gesehen, doch dabei hatte sie immer nur Hosen oder Jodhpurs angehabt. Jetzt trug sie ein langes blaues, vorn tief ausgeschnittenes Seidenkleid, das anmutig ihre Knöchel umspielte. Das Kleid unterstrich jede Rundung ihres Körpers, und ihre festen Brüste waren halb entblößt. Piet konnte die Augen nicht abwenden. Simon blieb regungslos liegen und knirschte nur mit den Zähnen. Aber dieser Piet! Eine lächerliche halbe Portion! Den kann man vergessen, dachte Simon.
Feierlich begaben sie sich ins Eßzimmer. André van Achtenburgh füllte die Gläser. Dann nahm er eine Bibel vom Sideboard und trat an den Kopf des Tisches.
»Laßt uns ein kurzes Stück aus der Heiligen Schrift lesen«, sagte er und schlug das Buch auf.
Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn das ist billig. »Ehre Vater und Mutter«, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat. Auf daß es dir wohlergehe ...
Eine vertraute Stelle, die in Simon Erinnerungen an seinen Vater wachrief, der abends mit eintöniger Stimme lange Passagen aus der Bibel vorgelesen hatte, während die Familie um den rohen Holztisch saß und Simons Mutter mit angestrengten Augen bei Kerzenschein Kleider flickte.
André van Achtenburgh warf einen kurzen Blick in die Runde. Er kannte die Bibel auswendig und brauchte dem Text nicht mit den Augen zu folgen. Mit einem gewissen Unbehagen betrachtete er Anna, die in diesem Augenblick fassungslos-hingerissen zum Fenster hinausstarrte. Daß aus seinem einzigen Kind so plötzlich eine Frau geworden war, machte ihm Angst und verwirrte ihn. An Mädchenlachen, Zöpfe und adrette Schulkleider hatte er sich gewöhnt. Aber dieses Kleid war eine Katastrophe! Marias Schuld, sagte sich André, denn sie versucht, das Mädchen an ihre reichsten Freunde zu verhökern wie eine Weihnachtsgans. Darüber muß ich noch ein Wörtchen mit ihr reden. Schwachheit, dein Name ist Weib! Nie können sie in Ruhe dem Wort Gottes lauschen, immer schwirrt ihnen der Kopf vor Gedanken an neue Kleider und andere Anschaffungen. Nur Anna, meine Anna, ist anders. Eigentlich mehr wie ein Junge. Und was diesen Schlappschwanz namens Piet betrifft – nur über meine Leiche ...
Maria van Achtenburgh machte sich Gedanken über die Launenhaftigkeit und den Eigensinn ihrer Tochter, die den Gästen mit einer Kühle begegnet war, die schon an einen Affront grenzte. Sie hatte sich weiß Gott Mühe genug mit ihr gegeben, und doch erschreckte Anna sie manchmal geradezu. Sie hatte miterlebt, wie ihre Tochter – kaum elf Jahre alt – unter der heißen afrikanischen Sonne in die Pubertät gekommen war, mit knospenden Brüsten und einer praktisch-nüchternen Einstellung sexuellen Dingen gegenüber, wie Kinder, die auf einer Farm aufwachsen, sie sich schon früh zu eigen machen. Jahrelang hatte Maria darauf gewartet, daß ihr eigensinniger Wildfang reifer und weiblicher werden würde. Als das nicht geschah, hatte sie ihre Tochter schließlich im exklusivsten Pensionat der ganzen Kap-Provinz untergebracht. Inzwischen hatte Anna die Schule hinter sich und schien damit zufrieden, ihrem Vater bei der Bewirtschaftung der Farm zu helfen, Pferde zuzureiten und im Dorf Klavierstunden zu geben. Seit einiger Zeit allerdings hatte sie sich verändert, war sie immer so verträumt. Man sehe sich die dumme Göre doch nur an, wie sie da durchs Fenster hinaus den Mond anstarrt!
Leidenschaftslos beobachtete sie ihre Tochter. Anna hatte feine, ebenmäßige Züge, ähnlich wie sie selbst in diesem Alter. Dennoch war da ein Unterschied: Ihre Augen, ihre vollen Lippen und der kühne Schwung ihrer Wangen verrieten eine gewisse Sinnenfreudigkeit. Je früher sie heiraten würde, desto besser!
Von der Seite sah sie Louise Joubert an, die offenbar zustimmend nickte.
Louise betrachtete Anna bereits mit besitzergreifenden Augen. Sie war sich sehr wohl bewußt, wozu diese Dinner-Einladung dienen sollte. Von Herzen war sie mit dieser Verbindung einverstanden. Beide Frauen erhofften sie sich, wiewohl keine von beiden je laut über ihre Wünsche gesprochen hatte. Beide Familien hatten jeweils nur dieses eine Kind, und zusammen wären die beiden Anwesen ein Vermögen wert.
Simon bemerkte, daß die Gäste unruhig wurden. Wenn das so weiterging, würde Annas Pa noch den ganzen Abend vorlesen. Dabei sah man, daß er an etwas ganz anderes dachte. Wie gemein er ihn auf dem Turnier einfach hatte abblitzen lassen, als Simon Anna zu einem Hamburger hatte einladen wollen. Die beiden hatten sich sämtliche Preise geholt. Und doch, wenn er sich ihren Pa jetzt ansah – richtig unsympathisch konnte er ihn nicht finden. Simon kam zu dem Schluß, daß der Alte ein guter Kumpel beim Walfang wäre. Zäh und zuverlässig.
Endlich machte Annas Vater Schluß. Das Mädchen kam mit Hummersalat hereingetrippelt, es wurde nachgeschenkt, und die Unterhaltung plätscherte dahin, mal leiser, mal lauter.
Beim Anblick des Essens merkte Simon, wie hungrig er war. Er hatte kaum Zeit zum Schlafen gehabt, geschweige denn zum Essen. Jeden Morgen war er draußen auf den Feldern gewesen, hatte lange vor Morgengrauen den Boden beackert, um sich auf diese Weise die Stunden zu stehlen, die er brauchte, um Anna zu besuchen. Dann war er in der Nacht zurückgefahren und hatte vier Stunden später wieder von vorn angefangen. Er konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt etwas gegessen hatte. Doch Anna aß genug für zwei.
Die Teller wurden fortgenommen, die Gläser wieder gefüllt, und abermals kam das Tablett, diesmal beladen mit einem kleinen Wildschwein, im ganzen gebraten, einen Apfel in der Schnauze. Simon wäre fast von seinem Ast gefallen.
»Meine Herren, das nenne ich eine anständige Bewirtung«, rief Joubert laut. »Ich hab’ schon seit über zehn Jahren kein Wildschwein mehr gegessen. Dabei ist es das zarteste Fleisch, das es gibt.«
»Onkel Acker hat es für uns geschossen«, sagte Anna. »Wir bekommen viel Wild aus Südwest.«
»Mein Bruder züchtet Karakul-Schafe«, erklärte Maria. »Anna mag ihn sehr gern. Früher hat sie immer die Ferien bei ihm verbracht. Bei der Jagd kann niemand ihr etwas vormachen.«
Anna warf ihrer Mutter einen wütenden Blick zu. Wie peinlich ihr das war! Ihre eigene Mutter führte sie vor wie Vater einen preisverdächtigen Bullen. Verzweifelt sah sie zu André hinüber, der ihr zuzwinkerte.
Ich habe ein Recht darauf, meine Freunde selbst auszusuchen, dachte sie zornig. Wo Simon wohl jetzt war? Sie hatte sich im Weingarten mit ihm verabredet. Ihre Mutter hatte ihr erst beim Mittagessen etwas von der Dinner-Party gesagt. Eine ›Überraschung‹ sollte es sein – und war es denn auch, eine höchst unliebsame Überraschung allerdings! Anna erinnerte sich von der Schulzeit her an Piet, obwohl er vier Klassen über ihr gewesen war. In seinem letzten Jahr war er Klassensprecher gewesen, und sie hatte ihn schon damals nicht gemocht.
Piet beschloß, das peinliche Schweigen zu überbrücken. »Anna, ich brauche deine moralische Unterstützung. Dein Vater läßt sich nicht dazu bewegen, ein paar Hektar Pinot-Noir-Reben für einen trockenen Roten anzubauen. Das wird ihm noch leid tun. Er meint, es gibt keinen Markt für roten Wein, doch er irrt.«
Louise faßte ihren Sohn kritisch ins Auge. Er scheint überhaupt kein Gefühl für Frauen zu haben. Kein Wunder, daß er keine Freundinnen hatte. »Komm, Piet, was versteht eine schöne junge Frau wie Anna schon vom Wein?«
»Anna versteht genauso viel davon wie ihr Vater«, warf Maria ein.
Louise ging nicht darauf ein. »Erzähl Anna lieber von dem Swimmingpool, den wir gerade bauen.«
»Ja, Mutter«, sagte Piet mechanisch und räusperte sich verlegen. »Wir legen ihn nierenförmig an, mit einem Durchmesser von fünfzig Metern ...«
»Schwimmst du gern, Anna?« unterbrach Louise ihn.
Anna starrte wie versteinert zum Fenster hinaus und sah zu ihrem Entsetzen geradewegs in Simons Augen, die sie unverwandt anblickten. Er lachte. Eine körperlose Maske inmitten der Eichenblätter.
Sie errötete, sprang auf und stieß ihr Weinglas um. Ein roter Fleck breitete sich auf Mamas bestem Spitzentischtuch aus.
»Ach, macht nichts«, sagte Maria und kippte mit blitzenden Augen das Salzfäßchen auf dem Fleck aus.
Die Überreste des Wildschweins wurden hinausgetragen, und eine Sahnecrème trat an ihre Stelle. Willem Jouberts Lieblingsdessert. Louise schob sie sich löffelweise in den Mund und zitierte dabei aus Piets Doktorarbeit. Alle tranken sie zuviel Wein, und Piets Gesicht schwoll an, wurde aufgedunsen und häßlich. Plötzlich spürte Anna seine Hand auf ihrem Schenkel. Sie versetzte ihm einen kräftigen Tritt, und als sie aufsah, blickte sie in Simons gequälte grüne Augen. Sie setzte ein mutwilliges Lächeln auf.
»Am Sonntag wird bei uns Tennis gespielt«, sagte Louise, die sie scharf beobachtete. »Du spielst doch, oder?«
»Aber ja doch, ich komme gern«, sagte sie zur Überraschung aller. Dann legte sie Piet eine Hand auf die Schulter. »Spielst du auch, Piet? – Großartig.«
Nach dem Essen saßen sie im Patio und tranken ihren Kaffee. Die Unterhaltung drehte sich immer noch um Piets Leistungen auf der Universität. Simon hatte Schwierigkeiten, nicht einzuschlafen. Das Dienstmädchen trippelte hin und her und schenkte Kaffee nach. An der Art, wie sie ging, erkannte Simon, daß sie noch mehr Sherry getrunken hatte.
Endlich brachen die Gäste auf, wenngleich sich der Aufbruch noch ziemlich in die Länge zog. Die Eltern begaben sich allzu auffällig ins Haus zurück und ließen Piet für ein paar Minuten mit Anna allein.
»Laß dich von Mutter nicht irritieren«, sagte sie. »Im Grunde ist sie ganz in Ordnung. Ehrlich, du hast dich gewaltig gemacht.«
Piet legte ihr die Hände auf die Schultern. »Eine richtige Schönheit bist du geworden.« Er zog sie an sich, um sie zu küssen, und sprang zurück, als eine Eichel seine Backe traf. »Tja, der Herbst kommt«, sagte er und lachte verwirrt.
Noch eine Eichel traf ihn scharf am Kopf.
»Ein Pavian«, erklärte Anna ihm. »Ein Einzelgänger. Man ist hier nirgends vor ihm sicher. Vermutlich hockt er oben im Baum.«
Erschrocken blickte Piet auf.
»Paviane sind gefährlich«, sagte er ernsthaft.
»Aber ja doch«, sagte sie. »Wenn Pa ihn entdecken sollte, knallt er ihn ab.«
***
»Ich hab’ genug!« entfuhr es Simon, als Anna bald danach in den Weingarten gelaufen kam. »Genug von diesem Quatsch! Ich hab’s satt, hier rumzuhängen. Wenn du findest, ich bin nicht gut genug für dich, Anna, dann hau ab! Laß uns Schluß machen, bevor es zu spät ist.«
»Wie kannst du so was nur sagen!« erwiderte sie. »Gestern noch hast du gesagt, du liebst mich. Eine schöne Liebe ist mir das, wenn man am nächsten Tag von Schlußmachen redet.«
»Es gibt Grenzen für das, was ich ertragen kann«, erklärte er schmollend. »Wenn du mich liebst, mußt du deinen Eltern von uns erzählen.«
»Macht es denn so keinen Spaß? Wo es ganz allein unser Geheimnis ist?«
»Mir nicht. Ich bin müde und hab’ Hunger.« Mißmutig funkelte er sie an. »Außerdem kommt es mir irgendwie unrecht vor. Entweder, du sagst es ihnen, und ich kann dich offiziell besuchen, wie es sich gehört, oder es ist aus zwischen uns.«
Wie altmodisch er manchmal sein konnte. Bloß – wie sollte sie es ihren Eltern beibringen? Pa war schon beim Turnier wütend gewesen. Gleichzeitig war ihr der Gedanke, Simon zu verlieren, unerträglich. Zitternd schmiegte sie sich an ihn.
Simon schob ihr Kinn in die Höhe, drückte den Mund an ihre weiche, glatte Wange und glitt sanft über ihr Gesicht, bis seine Lippen die ihren erreichten. Rasch stieß er ihr dann die Zunge in den Mund.
Simons Männlichkeit und der Härte, die sie in dem Mann spürte, vermochte Anna nicht zu widerstehen. Er war aufregend, bezwingend und erschreckend zugleich, und sie liebte ihn.
»Wie ist es – reiten wir Samstag zusammen aus?« sagte er und drückte sie fester an sich.
»Aber die Tennis-Party ...« murmelte sie.
»Sag sie ab! Samstag oder nie!«
»Nein, nicht ausreiten«, sagte sie in dem Bemühen, die Initiative wiederzuerlangen. »Laß uns ausfahren. Du kannst mich um zwei abholen.«
Simon war immer noch erbost. Er küßte sie kurz und ging.
Lange, nachdem er gegangen war, saß Anna noch auf den Stufen vor ihrem Schlafzimmer. Die Einsamkeit und das Verlangen, mit Simon zusammen zu sein, schmerzten.
Der Bergwind lebte wieder auf, ein unruhiger, winselnder Wind, bei dem man unmöglich schlafen konnte. Die Farmarbeiter sangen noch immer, und unten am Fluß quakten die Ochsenfrösche.
Keine Nacht zum Alleinsein.
Was Anna erfüllte, war eine eigentümliche, neue Rastlosigkeit. Es war ihr unerträglich, hineinzugehen. »Simon, ach Simon«, flüsterte sie. Ob er sich genauso nach ihr sehnte wie sie sich nach ihm?
Kapitel 3
Simon hatte Sorgen. Sein alter, klappriger Laster würde am nächsten Samstag bestimmt keinen guten Eindruck machen. Er hatte sein Herz an einen bakkie gehängt, einen Kleinlastwagen aus zweiter Hand, den der Co-op im Auftrag des alten van Niekerk verkaufte, doch wollten die Burschen fünfzig Pfund dafür, nicht einen Penny weniger, und Simon hatte keine Ahnung, woher er soviel Geld nehmen sollte.
Er hatte auf der Fünf-Stunden-Fahrt zurück nach Saldanha Bay Zeit genug, darüber nachzudenken.
Die Fahrt führte durch die Stellenboscher Weingärten zur Kap-Halbinsel hinunter, es ging durch Obstplantagen und Gemüsefelder und vorüber an den prachtvollen Milchviehherden von Durbanville.
Fünf Meilen vor Kapstadt bog er nach Norden in Richtung Malmesbury ab; hier war ein guter fetter Boden für Weizenanbau und Milchwirtschaft. Wie gewöhnlich bedachte er die fruchtbaren Farmen zu beiden Seiten der Straße mit verlangenden Blicken.
Die Schafe lammten gerade. Weißes Fell schimmerte im Mondlicht. Bald würde die Saat ausgebracht werden. Im Juli würden die jungen Stengel üppig und kraftstrotzend dastehen, einer neben dem anderen, eine dichte, wogende grüne See. Der Gedanke daran machte Simon vor Neid ganz krank.
Die Farmhäuser standen jeweils ein bis zwei Meilen auseinander, sie leuchteten im Mondlicht sauber und weiß. Simon war es, als blickten sie selbstbewußt und hochmütig auf ihn und seinen Laster herab.
Am Stadtrand von Malmesbury schlug die Straße einen Bogen nach links in Richtung Saldanha Bay. Magerer Boden und ausgemergelte Schafe. Die Farmhäuser waren nicht mehr so stolz, und es lagen jetzt fünf oder mehr Meilen zwischen den Nachbarn. Simon konzentrierte sich auf die Straße vor ihm und schaute weder nach links noch nach rechts. Jetzt träumte er davon, selbst Herr von Fontainebleu zu sein. Er ging voll und ganz in seinem Traum auf und fuhr an der Walfangstation vorüber, ohne den Gestank auch nur zu bemerken. Schließlich erreichte er Modderfontein, wo fünf Generationen von Smits dem Boden und der See ihren Lebensunterhalt abgerungen hatten.
Simon hielt an, machte das Gatter auf und runzelte die Stirn.
Wenn es nicht bald Regen gab, war er gezwungen, die Schafe in die Luzerne zu treiben, und das wäre eine Katastrophe. Er fuhr auf die Kuppe des ersten Hügels hinauf. Die Armseligkeit seiner Farm ließ ihn leise fluchen.
Zwischen der See und dem beackerten Land dehnten sich Hügel voller Steine und Gestrüpp, Lebensraum von Luchsen und ganzen Pavianherden. Heute nacht kläfften die Paviane wild gegen den Wind an.
Ob es mir gelingen wird, genug zu fangen, um das Geld für den bakkie aufzubringen? fragte sich Simon. Für gewöhnlich verkaufte er sie für fünf Pfund das Stück an ein Kapstadter Labor, aber sie waren schlau, und es war ihm noch nie mehr als einer in dieselbe Falle gegangen. Voriges Jahr hatte er insgesamt überhaupt nur fünf erwischt.
Schließlich erreichte er den Hof. Er stellte den Lastwagen in der Scheune unter und sah in der Milchkammer nach. Es roch säuerlich. Morgen früh würde er als erstes Jan einen Tritt in den Hintern geben. Die Kühe waren gemolken worden und grasten in der Nähe des Damms. Er ging ins Haus, schleuderte die Stiefel von sich und warf sich der Länge nach aufs Bett.
***
Der Samstag begann wie jeder andere Tag: Die Hähne krähten vor Sonnenaufgang, und die Kühe muhten, weil sie gemolken werden wollten. Für Anna hatte jeder Laut eine besondere Bedeutung. Es war, als wären die Wurzeln ihres Daseins ein für allemal mit diesen häuslichen Geräuschen verbunden. Die flüchtige Ahnung, sie könnte eines Tages womöglich aufwachen, ohne sie zu hören, ließ sie im Bett erschauern. Das vertraute Geklapper von Floras schweren Tritten und das Klirren der Kaffeetassen halfen, die in ihr aufsteigenden Ängste zu beschwichtigen.
Der Vormittag verging zweimal so langsam wie sonst. Schließlich ging Anna hinaus, um die Rosen zurückzuschneiden, eine Arbeit, die sie seit Tagen vor sich hergeschoben hatte.
»Ich begreife nicht, warum du das unbedingt selbst tun willst.« Maria betrachtete mißbilligend Annas Hände, als sie ihre Tochter im Garten fand.
»Weil ich es so mache, wie es sich gehört«, erwiderte Anna, »und Jacob nicht.«
»Wann holt Piet dich denn ab?«
»Ma, ich gehe nicht zum Tennisspielen zu den Jouberts. Ich hab’ was vor.« Ihre Stimme klang verärgert.
Argwöhnisch sah Maria ihre Tochter an. »Ich begreife diese Geheimniskrämerei nicht. Oder schämst du dich dessen, was du tust?«
Das Blut schoß Anna in den Kopf, und sie funkelte ihre Mutter an. »Ich kenne Dutzende von Männern, die mir besser gefallen als Piet.«
»Und der, mit dem du ausgehst, ist ...?«
»Simon Smit!« Der Name war heraus. »Ich muß mich jetzt fertig machen.« Sie schämte sich ob ihrer Feigheit und eilte aufs Haus zu, während Maria sich auf die Suche nach André machte.
André ging ruhelos in seinem Büro auf und ab und überlegte, wie er sich verhalten sollte. Ich kann Anna nicht verstehen, dachte er. Sie konnte doch jeden aus der Nachbarschaft haben! Gleichzeitig räumte er ein, kaum etwas von dem Smit-Jungen zu wissen. Vielleicht ist er gar nicht so schlimm, wie ich mir einbilde. Als er Wagter mit dem Schwanz wedeln sah, preßte André ärgerlich die Lippen aufeinander. Also war Simon schon früher hier gewesen. Wann? Gelassen schritt er über den Hof und überlegte, ob er dem Jungen die Hand geben sollte, besann sich jedoch eines Besseren.
»Ah, der junge Smit, nicht wahr?« begann er.
»Wir haben uns bereits kennengelernt, Sir. Beim Turnier.«
»Es wundert mich, Sie hier zu sehen. Ich will da gar keinen Hehl draus machen. Aber da Sie nun schon einmal hier sind, möchten Sie vielleicht hereinkommen und ein Glas Apfelwein trinken. Anna ist nämlich nicht pünktlich, wissen Sie. Kommen Sie mit ins Kontor, mein Junge.«
André van Achtenburgh brauchte nur ein paar Minuten, um dahinterzukommen, daß seine Befürchtungen nur allzu berechtigt gewesen waren. Der Junge war ein Habenichts aus der verarmten weißen Unterklasse. Seine Eltern hatten ihm bei ihrem Tod nichts hinterlassen außer einer unfruchtbaren Farm, die offenbar nur ein paar Schafe ernährte und sonst kaum etwas. Der Junge schien sich mehr oder weniger ehrlich durchs Leben zu schlagen und verdingte sich jedes Jahr auf vier Monate beim Walfang, um die Farm vor dem Gerichtsvollzieher zu retten. Aber wie brachte man einem solchen Kerl bei, wie absurd es war, einer Anna van Achtenburgh den Hof zu machen? André beschloß, erst einmal mit Anna zu reden.
Mittlerweile hatte Simon jeden einzelnen Gegenstand im Büro von Annas Vater taxiert und sich sogar der Vorstellung hingegeben, wie es wohl wäre, die Farm von diesem Raum aus zu leiten. Als Anna erschien – hinreißend in den blauen Seidenhosen, der dazu passenden Bluse und mit der über die Schulter geworfenen weißen Strohtasche – strahlte Simon glücklich. Annas Vater hatte ein ungutes Gefühl, als er die Szene beobachtete. Sie war noch so jung und unerfahren. Es war vorauszusehen, daß jeder Glücksritter am Kap sich an sie heranmachen würde.
Er rief nach Flora und trug ihr auf, Maria zu holen.
»Nun, das ist ja eine schöne Bescherung«, sagte er zu seiner Frau. »Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, sie tut das nur, um dir eins auszuwischen. Schließlich hast du ja keinen Hehl aus deinen Plänen mit Piet gemacht, nicht wahr?«
Maria war außer sich. »Da du mir die Schuld an diesem Fiasko in die Schuhe schieben willst, solltest du vielleicht wissen, daß sie sich seit dem Turnier jeden Tag mit Simon im Dorf getroffen hat.«
André sah mit finsterem Gesicht zum Fenster hinaus.
»Hast du das von ihr selbst?« fragte er schließlich.
»Ich habe meine eigenen Informationsquellen.«
»So, so.« Die Stirn umwölkt, setzte sich André. »Dann muß ich wohl doch ein Wort mit diesem Smit reden, wenn sie zurückkommen. Der kommt mir nicht noch einmal ins Haus – dafür werde ich sorgen.«
***
Der Wagen schoß über den Kies. Die beiden jungen Menschen saßen stumm und verlegen da, ein jeder mit seinen eigenen Problemen beschäftigt.
Simon schäumte, weil Anna ihn nicht zu seinem neuen bakkie beglückwünscht hatte. Doch selbst Simon konnte an einem so vollkommenen Nachmittag nicht dauernd böse sein, und so vergaß er schließlich die Schafe, die er verkauft hatte, um die Anzahlung leisten zu können.
Er hatte vor, draußen in den Bergen am Ufer des Hex River zu picknicken. Er kannte die auf der Farm eines Freundes gelegene Stelle gut und hatte eine Thermoskanne mit starkem Kaffee und Obst mitgenommen.
Es war ein träger, verschlafener Nachmittag, heiß, aber noch nicht unangenehm. Sie saßen am sandigen Flußufer und lauschten dem über bemooste Felsen plätschernden Wasser, dem Gesumm der Insekten und dem Ruf des Piet-my-vrou-Vogels in einem Baum in der Nähe.
Sie hatten einander wenig zu erzählen. Aber als Simon ihr den Arm um die Schulter legte und sie an sich zog, war Anna wunschlos glücklich. Jedenfalls war sie nie zuvor glücklicher gewesen. Atemlos saß sie da und verfolgte eine Libelle, die über das Wasser dahinschwirrte.
»Dies ist der glücklichste Nachmittag meines Lebens«, sagte sie schließlich. Strahlend lächelte sie ihn an, und er war völlig verzaubert von ihr. Rauh riß er sie an sich und drückte sie an die Brust. Lange saßen sie still da, beide völlig hingerissen von der Nähe des anderen. Es wurde heißer, und das eiskalte Bergwasser gluckerte verlockend.
»Laß uns ...« begannen sie beide gleichzeitig.
»Könntest du beim Schwimmen die Augen zumachen?« murmelte sie.
»Selbstverständlich. Ich hab’ sie beim Schwimmen immer zu.« Er schloß sie fest und zog Hemd und Hose aus. Als er die Unterhose von sich schleuderte und nackt vor ihr stand, holte Anna vernehmlich Luft.
Wie groß er war, wie schön! Seine muskulöse Brust war tief gebräunt, Gesäß und Oberschenkel dagegen rein weiß. Anna verging vor Neugier. Sie hatte noch nie einen Mann nackt gesehen.
Simon machte die Augen auf und lachte träge. »Ich geh’ jetzt schwimmen. Mach du, was du willst.«
Anna trat hinter einen Felsen und überlegte. Sie spähte über den Rand des Felsblocks zum kristallklaren Wasser hinunter, in dem Simon herumplanschte. »Nein!« sagte sie entschlossen zu sich selbst, nur um dann aus einem unerfindlichen Grund doch ihre Kleider abzulegen, eines nach dem anderen. Nacktsein – eigentümliches und doch so vertrautes Gefühl. Der laue Wind umschmeichelte die Haut, die die Sonne einsog; die Naturgewalten schienen sich insgeheim verabredet zu haben, sie gemeinsam zu erregen. Sie kam sich alt vor, uralt wie das Frausein selbst. Das da war ihr Mann, sie hatte sich ihn erwählt. Das war alles.
Simon lag im seichten Wasser auf dem Rücken. Anna beugte sich über ihn und küßte ihn.
Aufseufzend schob er sie von sich. »Nicht! Bitte tu das nicht, sonst kann ich mich nicht mehr zurückhalten.« Seine Stimme klang so heiser, daß Anna sie kaum wiedererkannte.
Simon setzte sich auf und betrachtete sie. Er war erregt und alarmiert zugleich; das körperliche Verlangen schwemmte jede Vernunft fort. Einmal hatte er sich von der Leidenschaft übermannen lassen. Er zwang sich, daran zu denken, wie Sophie danach am Ufer geweint hatte, und Schuldgefühle hemmten seine Leidenschaft.
Die Reue und der Abscheu danach waren furchtbar gewesen. Außerdem hatte auch Sophie es nicht genossen. Frauen mochten Sex offensichtlich nicht. Anna mußte ihn lieben; an diesen Gedanken klammerte er sich und knirschte mit den Zähnen.
Weiße Zähne und grüne Augen. Wasser, das über Steine plätscherte ... Anna sollte diesen Nachmittag ihr Leben lang nicht vergessen. Vertrauensvoll lächelnd lag sie da, erfüllt von Geborgenheit. Es war, als sei sie schon immer mit Simon verheiratet gewesen und nur durch den Zufall der Geburt von ihm getrennt.
Der Nachmittag verging wie im Nu. Sie lagen einander in den Armen und bemerkten kaum, daß die Sonne hinter den Bergen unterging. Plötzlich war es dunkel, doch der Gedanke fortzugehen, war ihr unerträglich.
Das Schweigen, das sie auf der langen Heimfahrt umfing, war voll von unausgesprochenen Fragen und Antworten.
Es war spät, und Annas Gedanken wandten sich voller Unbehagen den Eltern zu. Sie seufzte. Simon legte den Arm um sie und zog sie eng an sich.
»Was ist los?«
»Ach, nur daß – ich weiß nicht.« Sie hätte länger als einen Nachmittag gebraucht, um zu erklären, wie ihre Eltern Simon und seine Welt sahen. Warum konnten sie nicht weitersehen als bis zu seinem roten Lastwagen und seinem schrecklichen Haarschnitt?
Sie kamen um Mitternacht nach Hause. André van Achtenburgh ging im Hof auf und ab. Simon brachte den bakkie mit kreischenden Bremsen in einer Wolke aus Staub zum Stehen. Aus den Augenwinkeln heraus bemerkte Anna, daß Simons Hals und Kinn rot gefleckt waren und daß es an seiner Backe zuckte.
»Anna, geh auf dein Zimmer!« fuhr ihr Vater sie an.
Simon ging um den bakkie herum, machte den Wagenschlag auf und half ihr herunter. »Danke für den wunderbaren Tag«, sagte sie leise. »Ich sehe dich morgen.«
Sie konnte einfach nicht glauben, daß ihr Vater in diesem Ton zu ihr sprach. Abscheu trat an die Stelle der Verlegenheit. »Himmel, Vater, man könnte ja meinen, ich wäre eine ganze Woche fortgewesen. Warum fauchst du mich so an?«
Sie hätte weiter mit ihm gestritten, doch Simon nahm sie beim Arm und flüsterte: »Keine Sorge, ich bring’ das schon in Ordnung. Ich ruf’ dich morgen früh an.«
Unentschlossen hielt Anna einen Augenblick inne, dann ging sie auf ihr Zimmer.
»Ich möchte mit Ihnen reden, junger Mann.« Steif ging André in sein Kontor voran und nahm hinter dem Schreibtisch Platz. Als er aufblickte, stand Simon in der Mitte des Raums, sehr groß und unversöhnlich.
»Setzen Sie sich, setzen Sie sich«, fuhr er Simon an. »Sie verschwenden Ihre Zeit mit meiner Tochter. Anna ist erst neunzehn. Es dauert noch vierzehn Monate, bis sie mündig ist, und ich werde dafür sorgen, daß sie Sie niemals heiratet. Jeder kann sehen, daß sie sich in Sie verknallt hat – auch wenn ich ehrlich gesagt nicht begreife, warum.«
Ohne ein Wort zu sagen, zog Simon einen Stuhl heran. Eine Weile saßen die beiden Männer einander gegenüber, ohne ein Wort zu sagen. André war der erste, der das Schweigen nicht mehr aushalten konnte. »Ich verlange Ihr Ehrenwort, daß Sie meine Tochter nie wiedersehen.«
»Nein, Sir«, sagte Simon. »Ich liebe Anna, und sie liebt mich.«
Andrés Blick wurde kälter und erbitterter, und er taxierte seinen Gegner. Er lehnte sich zurück und lachte schroff auf. »Das kann ich mir denken, daß Sie Anna gern heiraten würden. Wer wollte das nicht? Sie wird den größten Teil meines Vermögens erben. Junger Mann, lassen Sie sich von mir sagen, daß ich heute nachmittag ein paar Erkundigungen über Sie eingezogen habe. Sie besitzen kaum mehr als ein paar Sanddünen und einige halbverhungerte Schafe. Anna hingegen ist eine der begehrtesten jungen Frauen in dieser Gegend und zweifellos die schönste von allen. Sie kann sich Hoffnung auf eine glänzende Heirat und eine sorgenfreie Zukunft machen, und genau das habe ich immer für sie angestrebt.«
Simon lehnte sich zurück. Er war plötzlich ganz entspannt. Anna würde heiraten, wen immer sie wollte. Und er, Simon, hatte nicht die Absicht, sich von den Drohungen eines aufgebrachten Vaters einschüchtern zu lassen, der sich aufführte wie die Paviane, die er in seinen Fallen fing. Man mußte ihn nur eine Weile in seinem Saft schmoren lassen, dann würde er sich schon beruhigen.
Simon erhob sich. »Ich gehe jetzt«, sagte er und wandte sich zur Tür, spürte dann jedoch eine Hand auf seinem Arm, und als er sich umdrehte, blickte er in die zornfunkelnden blauen Augen seines Gegners.
Andrés Stimme war belegt, er konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. »Das lassen Sie sich von mir gesagt sein, Simon: Wenn Sie es fertigbringen, Anna zu heiraten, werde ich meine Tochter enterben. Mich hat noch nie jemand aufs Kreuz gelegt, ohne daß ich hinterher nicht doch bekommen hätte, was ich wollte. Eher fahren Sie zur Hölle, als daß Sie auch nur einen einzigen Penny von mir bekommen. Sie bilden sich ein, Sie hätten gewonnen, nicht wahr? Nun, glauben Sie mir, Sie haben verloren, denn ihr beide haltet das keine fünf Minuten auf Ihrer Drei-Groschen-Klitsche aus!« Wütend stapfte er zurück zu seinem Schreibtisch.
Simon, der sich im Charakter eines Menschen selten irrte, erkannte, daß André es mit dem, was er sagte, ernst meinte. Als er Modderfontein erreichte, war er ziemlich durcheinander.
***
Als Anna am nächsten Morgen zum Frühstück herunterkam, war von ihren Eltern nichts zu sehen. Ihre Mutter schlief immer lange, und ihr Vater war, wie sie von Flora erfuhr, in den Stallungen und kümmerte sich um ein krankes Pferd. Schließlich ging Anna zu ihm hin.
»Soll ich dir helfen?«
André nickte wortlos, und so rieben sie gemeinsam eine Salbe in die Hinterhand des lahmenden Pferdes ein.
»Pa, ich möchte über gestern abend mit dir reden«, überwand Anna sich. »Du hast mich noch nie zuvor angeschrien und dich so aufgeführt, als ob du ... ich meine, als ob ich ...« Sie lehnte sich zurück und überlegte. »Du hast dich benommen, als ob wir keine Freunde wären«, fuhr sie schließlich fort. »Ich bin kein Kind mehr, und es ist nicht so, daß ich noch nie bis Mitternacht fortgewesen wäre. Warum nur ...«
»Anna, Anna, gib’s auf«, sagte er. »Es ist nicht mehr so wie früher. Du wirst erwachsen. Eigentlich bedaure ich das. Wenn es nach mir ginge, würde alles so bleiben, wie es gewesen ist.« Er seufzte. »Du bist jetzt eine junge Frau, Anna. Eine Erbin. Du hast gewisse Verpflichtungen. Du kannst nicht mit jedem Hinz und Kunz ausgehen, bloß weil er schöne Augen hat.« Traurig sah er sie an. »Du bist immer ein heller Kopf gewesen, aber vielleicht habe ich das mit der Geborgenheit übertrieben«, sagte er und verstaute die Arznei in einer alten Holzkiste. »Aber mehr noch: Du entwikkelst dich zu einer ausgesprochenen Schönheit. Und ich glaube, du bist noch nicht reif genug, um damit allein fertigzuwerden. Als du klein warst, habe ich mich nie darum gekümmert, mit wem du spieltest; ob deine Schulkameraden arm oder reich waren – alle waren hier willkommen. Aber jetzt muß das anders werden. Ich weiß, es wird dir nicht gefallen, und deshalb ... Nun ja, ehe du dich hier in der Gegend unmöglich machst, möchte ich dich fortschicken. Was würdest du davon halten, wenn du in dieses hochfeine Internat gingest, über das du mit deiner Mutter gesprochen hast?« Er bemühte sich, ein Lächeln aufzusetzen. Sie würde ihm fehlen.
Verdrossen stand sie da und trat mit dem Fuß gegen die Mauer.
»Es ist schließlich eines der angesehensten Schweizer Pensionate, und soviel ich gehört habe, leistet man dort in der Musikerziehung Hervorragendes. Mutter hat sich erkundigt. Was hältst du davon?« André warf einen Blick auf seine Tochter und seufzte. Diesen Ausdruck kannte er: die Unterlippe zwischen den Zähnen, die Augen verengt, als gälte es, Möglichkeiten zu finden, den eigenen Willen durchzusetzen.
»Ich höre nicht auf, mich mit Simon zu treffen«, sagte sie.
»Du hast keine Wahl«, sagte er. »Tut mir leid, Anna, aber so ist das nun mal.«
Anna funkelte ihn an. »Selbstverständlich bleibt mir eine Wahl! Ich werde tun, was ich will.«
»Hör zu, Anna: Ohne mein Geld wird Simon dich nicht heiraten wollen.« Er verzog das Gesicht. »Es ist das Geld, hinter dem er her ist, darauf verwette ich mein letztes Hemd.«
»Es ist nicht das Geld«, erwiderte sie hitzig. »Simon hat eine Farm.«
Ihr Vater stieß ein verächtliches Schnauben aus. »Er würde dich nie um deine Hand bitten, wenn er auch nur eine Minute darüber nachdächte, daß er dich auch ernähren muß.«
»Wie gemein, so etwas zu sagen!« erklärte Anna und wurde immer erregter. »Und er ist nicht hier, um sich zu verteidigen.«
»Das werden wir ja sehen!« sagte er und reizte ihren Zorn noch mehr. Da standen die beiden und betrachteten einander argwöhnisch. »Ich warne dich, so wie ich ihn gewarnt habe, Anna. Und du weißt, daß ich zu meinem Wort stehe. Wenn du Simon heiratest, bekommst du keinen Penny von mir. Warten wir also ab, was er tut.«
Wie konnte Pa nur so blind sein! Sie konnte es nicht fassen. Sie war sich ganz sicher ...
Doch Simon erschien nicht. Tag für Tag wartete sie stundenlang in dem Café, in dem sie sich immer getroffen hatten. Sie bekam dunkle Ringe unter den Augen und brachte für nichts den rechten Schwung auf. Sie verbreitete eine derart niederdrückende Stimmung im Haus, daß sogar Wagter den Kopf hängenließ und mit eingezogenem Schwanz herumschlich.
Anna war in ihren Grundfesten erschüttert. Simon war ihre erste Liebe, und sie liebte leidenschaftlich. Jetzt kam sie sich wertlos vor, wie etwas, das man nicht lieben konnte.
Nach Ablauf der dritten Woche fingen Annas Eltern an, sich ernstlich Sorgen zu machen.
»Sie kommt schon drüber hinweg!« erklärte André Maria jeden Tag aufs neue.
Es war Herbst. Für Anna vergingen die Tage im Schneckentempo; der Wind war kälter denn je; ihr Leben wurde immer trostloser. Papas Angebot, in das Schweizer Pensionat zu ziehen, wurde immer verlockender. Eines Morgens suchte sie nach ihrem Vater und fand ihn am Fluß, wo er den Bau einer neuen Brücke beaufsichtigte.
»Hallo, du kommst gerade recht zum Helfen«, rief er, als er Anna erblickte.
Eine Stunde lang arbeiteten die beiden zusammen, wie sie es in der Vergangenheit so oft getan hatten. Anna war wie ein Junge erzogen worden. Sie wußte, wie man einen Schuppen reparierte, einen Weg anlegte, das Keltern des Weines beaufsichtigte und was ein Farmer sonst noch können mußte.
Auf dem Weg zurück zum Haus sagte sie: »Pa, ich komme auf dein Angebot zurück, in die Schweiz zu gehen.«
André war froh, daß sie wieder zur Vernunft gekommen war.