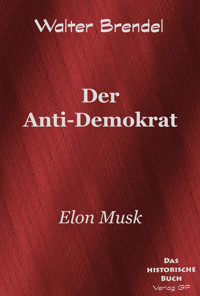5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im 1. Teil lernten wir die Kindheit des kleinen Königs, seine Eltern und den mächtigen Pagen sowie die Zeit der Fronde können. Der 2. Teil beginnt mit der königlichen Hochzeit und den Frieden zwischen Spanien und Frankreich, dem Tod des Ersten Ministers, Kardinal Mazarin, Wir lernen die Familie Ludwig XIV., die neuen Residenz in Versailles, des Königs Gehilfen und seine Mätressen kennen und erleben wichtige Ereignisse in Frankreichs Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Walter Brendel
Unter der Sonne geboren
Ludwig XIV.
2. Teil
Impressum
Cover: G. Pirntke
Gestaltung: G. Pirntke
Digitalisierung: G. Pirntke
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Inhalt
Die königliche Hochzeit
Der Tod des Paten
Der Kardinal ist tot – Es lebe der König!
Königliche Verwandtschaft
Königlicher Nachwuchs
Versailles
Die Gehilfen der Macht
Mätressenwirtschaft
Die königliche Hochzeit
Der königliche Hof brach in Richtung Lyon auf. Zugleich setzte sich in Turin die Kutschenkolonne der Madame Royale mit demselben Ziel in Bewegung. Langsam und träge bewegten sie sich aufeinander zu. Der Zweck der beiden Reisen schien der Gleiche zu sein: die Verlobung und spätere Heirat des französischen Königs mit Marguerite von Savoyen. Für die Savoyer war es eine Herzenssache, den Franzosen bedeutete es so gut wie nichts. Die wenigsten Reiseteilnehmer wussten über Mazarins wahre Beweggründe Bescheid. Trotzdem betrachteten sie die Brautschau vor allem als Gelegenheit, sich zu amüsieren.
Nicht einmal Ludwig selbst war von Mazarin eingeweiht worden. Nach seiner Genesung hatte er sich in die Vergnügungen gestürzt, die der Hof so reichlich bot. Über die bevorstehende Heirat machte er sich kaum Gedanken. Dabei gefiel ihm die Vorstellung einer hübschen, jungen Frau an seiner Seite, die seinen Status weiter anheben und den Einfluss seiner Mutter mindern würde. Die einzige Bedingung, die er stellte, war, dass ihm seine künftige Gemahlin gefallen müsse.
Die Bilder, die man ihm vorlegte, zeigten ein zartes, ängstlich blickendes Wesen mit einem wahrscheinlich dunklen Teint, hatte sich doch sogar der beflissene Hofmaler gezwungen gesehen, dieses Merkmal anzudeuten. „Sie hat schöne Augen“, erklärte Marie höflich, als ihr Ludwig das Porträt seiner möglichen Braut zeigte. Dann aber brach bei aller Selbstbeherrschung das Mancini-Temperament durch, und Marie flüsterte ärgerlich: „Schämen Sie sich nicht, dass man Ihnen eine so unschöne Braut geben will?“ Danach schwieg sie aber, denn ihr fiel ein, dass bei ausreichender Hässlichkeit der Braut die Hochzeit vielleicht nicht zustande kam und der gegenwär-tige angenehme Lebensstil nicht gestört wurde.
Immer wieder betonten Ludwig und Marie, sie seien nur Freunde. Von Liebe könne keine Rede sein. Ludwig hatte noch nie Freunde gehabt. Der Gedanke gefiel ihm, mit diesem lebhaften, geistreichen Mädchen, das vor niemandem Angst hatte, befreundet zu sein. Olympia, die ebenfalls nach Lyon mitreiste, beachtete er kaum noch. Wenn sie an ihn herantrat und ihre Grübchen spielen ließ, neigte er höflich den Kopf und wandte sich dann wieder Marie zu.
Dabei verwirklichte sich, was Catherine de Beauvais über die Frauen gesagt hatte, die er mit seiner Aufmerksamkeit ins Licht rückte. Es dauerte nicht lange, und Marie stand im Mittelpunkt der eitlen, geltungssüchtigen Hofgesellschaft, in der nur zählte, wer im Gespräch war.
Marie entsprach im Gegensatz zu ihren Schwestern und den beiden Martinozzi-Mädchen nicht dem gängigen Schönheitsideal. Sie hatte das schwärzeste Haar von allen, und dunkel wie die Nacht waren auch ihre Augen, umrandet von einem Kranz langer, schwarzer Wimpern unter einem schön geschwungenen Frauenbogen. Ihre schmale Taille sei bemerkenswert, gestand man ihr zu, und ihr Mund ganz hübsch, vor allem, weil Marie mit einem Vorzug gesegnet war, den man nicht oft antraf: schneeweißen Zähnen, die sie mit ihrem Lächeln zeigte, wenn sie etwas erreichen wollte. Die strengen Schönheitskritiker bei Hofe fanden allerdings, dass Maries Haut indiskutabel war - glatt und makellos zwar, aber dennoch der dunkle Teint einer geborenen Italienerin. Und wann hätten die Franzosen je ihre südöstlichen Nachbarn zu schätzen gewusst?
Nach Ansicht der Kenner war das Beklagenswerteste an Marie jedoch ihre knabenhafte Gestalt, für die sie sich noch dazu nicht einmal schämte. Während die anderen jungen Damen in weiten Samtröcken zur Jagd erschienen, trug Marie zu ihren Stiefeln mit Vorliebe unweibliche Reithosen, knapp sitzende Samtjäckchen mit Pelzaufschlägen an Kragen und Ärmeln und manchmal auch eine große, schwarze Seidenschleife oben an der Bluse. Monsieur de Jarze, der sich so sehr für Mode interessierte, hatte als Einziger einmal gewagt, Maries schlanke Erscheinung als „hinreißend“ zu bezeichnen. Daraufhin waren die anwesenden jungen Damen empört über ihn hergefallen. In ihrem Ärger gingen sie sogar so weit, Jarze zu verdächtigen, Marie Mancini gefalle ihm nur, weil sie so wenig weiblich wirke. „Aber sie wirkt weiblich!“, widersprach Jarze. „Aber doch nur auf eine knabenhafte Art!“, antwortete man ihm streng. Damit war das Urteil gefällt. Doch ohne Ludwigs Zustimmung. Denn Marie war im Gespräch! Hatte man bisher boshaft darauf hingewiesen, dass sie „irgendwie anders“ sei, so versuchte man nun, dieses Anderssein zu ergründen. Was ein Makel gewesen war, gewann plötzlich an Wert.
Marie Mancini sei ein Bücherwurm, hatte man gespottet. Dabei genüge es doch für eine Dame von Welt, die Nase von Zeit zu Zeit in den Katechismus zu stecken.
Wer dann noch die seelenvollen Romane des Fräuleins von Scudery las, galt bereits als hoch gebildet. Alles darüber hinaus war „preziös“, und das überließ man getrost den wenigen Damen, die zwar auch zur Aristokratie gehören mochten, ihr Leben aber lieber in elitären Salons verbrachten, in denen von vornehmen Kavalieren wie Nicolas Fouquet bis zu einem Gesindel wie dem Dichter Scarron alles zusammenkam. Marie Mancini lag wohl auf der gleichen Linie. Nur die strenge Hand ihres Onkels verhinderte, dass sie in Kreise ausschwärmte, die eine Dame von Stand und Anstand besser mied.
Die falsche Braut
Ludwig war von Maries Bildung hingerissen. Obwohl er als Kind ständig von Erziehern umgeben gewesen war, hatte er nie gelernt, sich mit Dichtung auseinanderzusetzen. Einmal erzählte er Marie, dass er das Märchen von der „Eselshaut“ geliebt hatte und dass er sich damals wünschte, ein so edler König zu werden wie jener im Märchen. Als Marie das hörte, schüttelte sie den Kopf und sagte, dieser König sei in Wahrheit gar nicht edel gewesen. Immerhin habe er die eigene Tochter bedrängt. Ludwig erschrak. Er nahm sich vor, das Märchen nach seiner Rückkehr von dieser Reise noch einmal zu überprüfen. Dabei blickte er in Maries dunkle Augen und wünschte sich, dass sie bei der Lektüre an seiner Seite säße oder an einem Sommertag neben ihm im Gras läge.
Am meisten von allem liebte Marie die heroischen Schauspiele von Corneille, besonders den „Cid“. Um Liebe und Leidenschaft ging es da, zugleich aber auch um Ehre, Ruhm, Pflichterfüllung und Verzicht. Diesen Gedankengängen folgte auch Ludwig gern. Hatte er nicht erst vor kurzem sein Hofballett veranlasst, eine Aufführung in diesem Stil zu inszenieren. So jung waren sie noch, Ludwig und Marie! Der Schmerz der Liebe erschien ihnen süß, weil sie ihn noch nie ertragen mussten. Sie spielten damit, ihn sich vorzustellen. Und immer noch sagten sie, es sei nur Freundschaft.
Für Mazarin bedeutete die Reise nach Lyon eine reine Qual. Einerseits war er sicher, dass die Katholische Majestät längst von Ludwigs Brautfahrt unterrichtet worden war, andererseits konnte er sich nicht darauf verlassen, dass Philipp den Köder auch schlucken würde. So zog er die Reise von Tag zu Tag mehr in die Länge. Die Aufenthalte in den einzelnen Städten wurden über Gebühr ausgedehnt, was vom Volk als Leutseligkeit des Monarchen ausgelegt wurde. Es sprach sich herum, dass sich der Hof verändert hatte. Viele junge Leute gebe es da nun, lustige Zeitgenossen, die sich freuten, wenn man sie mit Salutschüssen empfing und Ansprachen zu ihren Ehren hielt.
Mazarin wäre nicht er selbst gewesen, hätte er sich wegen seiner Sorgen die Gelegenheit entgehen lassen, die königliche Kasse und auch seine eigene aufzubessern. So setzte er in den größeren Städten, die sie passierten, Königliche Gerichtstage an, auf denen gleichsam im Vorübergehen den Bürgern Geld aus der Tasche gezogen wurde. Die Höflinge vergnügten sich in der Zwischenzeit auf der Jagd oder beim Kartenspiel. Man war sich einig, dass diese Brautschau die vergnüglichste Reise war, die man seit Langem erlebt hatte. Die Braut aus Savoyen? Nun ja, die gab es natürlich auch. Doch eigentlich interessierte sich niemand für sie.
In seiner langen Laufbahn hatte Mazarin viele Aufgaben übernommen, die Geschick verlangten, Diskretion und Mut. Er kannte die hohe Diplomatie, doch ebenso vertraut war er mit den heimlichen Machenschaften, dem Augenzwinkern über den Wirtshaustisch hinweg, dem ein Treffen in irgendeinem finsteren Winkel folgte, bei dem man die Hände des anderen nicht aus den Augen ließ. Den seltsamsten Menschen konnte man bei solchen Aufträgen begegnen, den vornehmsten Herren und dem schlimmsten Abschaum ... Auf eine dieser Personen wartete Mazarin; auf einen, der mehr zuhörte als redete; der zu allem zu gebrauchen war und nichts scheute.
Doch die Reise ging ihrem Ende entgegen. Lyon war nicht mehr weit. Die Boten meldeten, Madame Royale sei mit ihrem Gefolge bereits angekommen. Mazarin hatte Mühe, Königin Anna zu beruhigen. In Gesellschaft beherrschte sie sich in vorbildlicher Weise. Doch wenn sie mit Mazarin allein war, überhäufte sie ihn mit Vorwürfen. Nie - ganz bestimmt niemals! - würde sie zulassen, dass die kleine graue Maus aus Turin Ludwigs Gemahlin wurde!
Ehe das geschah, würde sie persönlich eine Revolution entfachen, gegen wen auch immer ... Anna war verzweifelt.
Auch Ludwigs Freundschaft mit Marie fing an, ihr Sorgen zu bereiten. Eines Abends in Dijon hatte sie die beiden beobachtet, wie sie allein auf einer Bank saßen und leise vor sich hin sangen. Maries schöne Stimme hatte sich jener des Königs wunderbar angepasst. Wäre der junge Mann nicht ihr Sohn gewesen, hätte der Anblick der beiden Annas Herz gerührt. Da es aber Ludwig war, der plötzlich so glücklich aussah, wurde Anna von Angst gepackt. „Alles ist misslungen!“, jammerte sie bei Mazarin. „Wir sind am Ende!“
Am Abend nach der Ankunft in Lyon traf man sich zu einem Ball. Der junge Herzog erbleichte, als ihn die Grande Mademoiselle mit ihren großen Zähnen anlächelte. Ludwig hingegen verneigte sich galant vor der kleinen Marguerite, die so schüchtern war, dass sie nicht einmal wagte, ihm ins Gesicht zu blicken. Alle Anwesenden versuchten, Ludwigs Gedanken zu erraten. Doch seine Haltung war untadelig. Königin Anna biss sich auf die Lippen, als ihr Sohn das Mädchen aus den Bergen zum Tanz führte. Marie, die zum ersten Mal seit langem keinen Kavalier zum Tanzen hatte, erhob sich und verließ den Saal.
Mazarin sah das alles. Er war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben. Da trat plötzlich Colbert, der große Gesellschaften lieber mied, in den Saal. Er stellte sich hinter Mazarin und flüsterte ihm ins Ohr, es sei so weit.
Mazarin konnte es kaum fassen. Eilig erhob er sich. Vor Aufregung verließen ihn einen Augenblick lang die Kräfte. Er hielt sich an der Tischkante fest, dann folgte er Colbert, der ihm über die Musik und das Stimmengewirr hinweg zurief, ein Fremder sei erschienen - ohne Pass und ohne große Begleitung. Er habe verlangt, sofort den Kardinal zu sprechen.
Es war wirklich ein Bote, und er kam wirklich aus Spanien! Aus Madrid. Geschickt von Seiner Katholischen Majestät persönlich, König Philipp IV. von Spanien!
„Don Antonio Pimentel!“, stellte er sich vor und schlug seine Kapuze zurück.
„Kardinal Jules Mazarin.“
Es war fast dunkel in dem kleinen Zimmer, in das Colbert die beiden Männer geführt hatte. Nur eine einzige Kerze flackerte auf dem Tisch. Die beiden verneigten sich respektvoll voreinander und warteten, bis Colbert das Zimmer verlassen hatte.
Mazarin hätte vor Erleichterung weinen mögen. Don Antonio Pimentel, der Erste Minister des spanischen Königs! Dass Philipp einen Mann dieses Ranges geschickt hatte, zeigte, welche Bedeutung er diesem Gespräch beimaß. Kein verkleideter Bettelmönch war gekommen, kein fahrender Händler oder Sterndeuter. Nein, vom er-sten Wort an, das gesprochen wurde, war man auf gleicher Ebene, ausgestattet mit höchsten Vollmachten.
Den Kardinal überkam eine große Ruhe. In diesem Augenblick erfüllte sich sein Schicksal. Millionen Menschen konnte nun der Friede gebracht werden. Mehr als zwanzig Jahre Krieg würden nur noch eine traurige Erinnerung in der Geschichte zweier Völker sein. Mazarin wusste, dass man ihn den sizilianischen Schurken nannte. Von diesem Augenblick an war er jedoch ein Mann des Friedens. Mit dem Trick eines Taschenspielers hatte er die passende Gelegenheit herbeigezaubert. Nun aber würde er mit Gottes Hilfe maßvoll und verantwortungsbewusst seine diplomatischen Talente und seine Erfahrung nutzen.
Schon einmal hatte er geglaubt, er habe nun ein Anrecht auf die Achtung der Welt: damals, als in Westfalen nach dreißig Jahren Krieg Europa endlich zur Ruhe kam. Mazarin war einer der größten Architekten dieses Friedens gewesen. Trotzdem hatte man ihn weiter beschimpft und im eigenen Land sogar einen Bürgerkrieg entfesselt. Verschlagen und habgierig nannte man ihn. Er wusste es und konnte es doch nicht ändern. Konnte sich selbst nicht ändern. Dabei wäre er so gern ein guter Mensch gewesen!
In dieser Stunde, in der kleinen Kammer in Lyon war er es: ein guter Mensch. Kardinal Jules Mazarin, Giulio Mazarini, war nicht mehr der sizilianische Schurke, sondern der Vater des Friedens. „Wir haben viel zu besprechen, Don Antonio!“, sagte er ohne lange Umschweife. Aus Höflichkeit verwendete er die spanische Sprache.
Sie setzten sich einander gegenüber auf die harten Stühle an dem kleinen Holztisch - zwei Männer, die die Mitte ihres Lebens schon überschritten hatten. Beide waren sie guten Willens und mit der Macht ausgestattet, diesen Willen auch durchzusetzen.
„Ich freue mich über diese Begegnung“, sagte der Kardinal. „Wir mussten lange darauf warten.“
Pimentel nickte. „Auch wir sind froh, dass nun eine neue Zeit beginnen kann“, antwortete er.
Über den Tisch hinweg reichten sie einander die Hände, während drüben im Ballsaal die Regentin von Savoyen daran zu zweifeln begann, dass es die Franzosen ehrlich meinten.
Auf Mazarins Rat hin regelte man die heikle Situation unter Frauen. Im Ballsaal tanzten noch die letzten Unermüdlichen, da bat Anna ihre Schwägerin um eine Unterredung. Beide waren müde von dem langen Tag und dem anstrengenden Abend. „Es ist spät, liebe Schwägerin“, sagte Madame Royale, während sie Anna gegenüber Platz nahm.
Fast noch Kinder waren sie gewesen, als sie einander zum ersten Mal trafen: Madame Royale in sicherer Position als Prinzessin von Frankreich, Anna als die fremde Braut, die nicht einmal der Sprache des Landes mächtig war, dessen Königin sie werden sollte. Es gab kaum Gemeinsamkeiten zwischen den beiden und keine Gefühle füreinander, weder im Guten noch im Schlechten. Sie waren einander ganz einfach fremd. Als Christine den Herzog von Savoyen heiratete, sah Anna sie ohne Bedauern ziehen.
Während der vielen Jahre, die seitdem vergangen waren, hatten sie einander nicht wieder getroffen. Sie hätten es niemals eingestanden, doch jede war beim Anblick der anderen erschrocken. Wie alt sie geworden ist!, dachte Anna. Sie war sicher, dass sie selbst sich kaum von jener jungen Frau unterschied, die die Liebe des englischen Botschafters gewonnen hatte.
Doch darum ging es jetzt nicht. Jetzt galt es, dieser Frau zu gestehen, dass sie und ihre Tochter belogen, benutzt und betrogen worden waren. Eine Zumutung, fand Anna, dass Mazarin diese peinliche Pflicht nicht selbst übernommen hatte.
Da ihr nichts Besseres einfiel, entschloss sich Anna zur Offenheit. Ganz überraschend habe sich ihr geliebter Bruder, die Katholische Majestät von Spanien, gemeldet. Es gehe um den Frieden, „den wir alle ersehnen“, als Unterpfand dafür jedoch auch um eine Heirat zwischen Ludwig und der Infantin.
Die wenigen Worte genügten. Madame Royale begriff. Zwar stürzte das ganze wunderbare Gebäude ihrer ehrgeizigen Hoffnungen bei dieser Erklärung in sich zusammen, doch die einstige Prinzessin von Frankreich wusste, dass ihre Schwägerin nicht anders handeln konnte. Trotzdem brach Madame Royale in Tränen aus. Sie sagte kein Wort, sondern weinte nur leise vor sich hin, ohne sich vor ihrer Schwägerin zu schämen.
„Zwei Dinge verlange ich“, sagte sie, als sie sich wieder in der Gewalt hatte. „Erstens, dass es meine Tochter ist, die erklären wird, sie habe sich gegen die Heirat mit dem König entschieden.“
Anna nickte. Jede junge Dame der hohen Gesellschaft hatte ihren Marktwert, der von vielem abhing. Eine abgewiesene Braut konnte nicht mehr viel verlangen. Zumindest musste ihre Mitgift um einiges erhöht werden, sollte sie ihren Status nicht ganz verlieren. Was es für das betroffene Mädchen aber persönlich bedeutete, zurück-gewiesen zu werden, wog noch viel schwerer. Anna wusste, was sie ihrer Schwägerin und ihrer Nichte antat. Doch allein das Wort „Staatsräson“ genügte, um jeder Rücksichtslosigkeit Absolution zu erteilen. „Und zweitens?“, fragte sie.
Madame Royale trocknete ihre Tränen mit einem Spitzentuch. „Francoise von Orleans!“, sagte sie entschlossen. „Die älteste Tochter aus der zweiten Ehe unseres Schwagers Gaston. Ich habe ihr Porträt gesehen. Sie ist bildhübsch.“ Wieder fing sie zu weinen an. „Wenn schon meine Tochter nicht glücklich sein darf, soll es wenigstens mein Sohn sein.“
Anna nickte. „Einverstanden.“
Sie erhob sich und gab damit als Ranghöhere das Zeichen zur Beendigung des Gesprächs. Dabei schoss ihr die Frage durch den Kopf, ob sie wirklich noch die Ranghöhere war. Immerhin war Madame Royale Regentin ihres Landes und sie, Anna, nur noch die Königinmutter ... Daran werde ich mich nie gewöhnen!, dachte sie erbittert und tröstete sich damit, dass sich Frankreich und Savoyen ja wohl nicht miteinander vergleichen ließen. Bei einem gleichrangigen Land hätte man sich einen Affront wie diese Reise auch nicht erlauben können. Man schenkte der verschmähten Braut prachtvolle Ohrringe aus zwei riesigen Diamanten, umschlossen von schwarzem Email. Marguerite bedankte sich artig bei ihrer Tante. Danach Verabschiedete man sich in großer Förmlichkeit. Niemandem fiel auf, dass Marguerite ihrem falschen Bräutigam noch nie ins Gesicht geblickt hatte.
Dann setzten sich die Wagenkolonnen in entgegengesetzter Richtung wieder in Bewegung. Die Stimmung der Franzosen war ausgelassener denn je, die Savoyer waren bedrückt. „Ich bin froh, wenn wir wieder in Turin sind“, sagte Madame Royale zu Marguerite. „Frankreich war meine Heimat, aber es ist mir fremd geworden.“
Sie drückte die Hand ihrer Tochter, die alles so geduldig ertragen hatte. Nun aber, in der engen Abgeschiedenheit der Kutsche fing sie an zu weinen und gestand, sie schäme sich so.
Marie war überzeugt, dass die Entscheidung gegen die savoyardische Heirat von Ludwig gekommen war, und sie wunderte sich nicht darüber. Sie hatte ihn beobachtet, wie er auf dem Ball seine künftige Braut begrüßte: ehrerbietig, galant und fürsorglich. Welch eine Erleichterung war es da für Marie gewesen, dass das junge Mädchen keine Reaktion zeigte! Wie eine wohlerzogene Puppe hatte sie ihre Rolle gespielt, bis auch Ludwigs Bemühungen immer schwächer wurden. Trotzdem hatte es Marie wehgetan, ihn mit einer anderen zu sehen, die vielleicht bald ein Anrecht auf ihn haben würde. Wir sind doch nur Freunde!, versuchte sich Marie selbst zu beruhigen. Doch die Musik erfüllte den Saal, und jeder hatte jemanden, der irgendwie zu ihm gehörte. Nur sie selbst saß allein da und wurde von niemandem beachtet. Das königliche Licht, das sie in den letzten Wochen so hell beschienen hatte, erstrahlte nicht mehr für sie. Es fiel auf eine andere, die jedoch nichts damit anzufangen wusste. Er gehört mir, dachte Marie und wunderte sich selbst über diesen Einfall. Ich will ihn nicht hergeben!
Als Ludwig noch in derselben Nacht von seiner Mutter erfuhr, dass sich der spanische König gemeldet hatte, verstand er nur eines: Die Hochzeit mit seiner Cousine aus Savoyen würde nicht stattfinden! Zugleich dachte er, dass durch diese Entscheidung zumindest vorläufig alles so bleiben konnte wie bisher. Weiterhin würde er sich mit Marie treffen. Sie würden auf die Jagd gehen, tanzen, musizieren und gemeinsam lesen. Weiterhin würde Marie manchmal ganz nahe bei ihm sitzen, dass sich ihre Arme berührten, und manchmal, wenn sie den Kopf drehte, würde ihn ihr Atem streifen. Wir sind doch nur Freunde!, dachte auch er und eilte zu den Gemächern, die sie bewohnte. Er hämmerte an die Tür, bis Madame de Venel öffnete.
„Sire!“, rief die Gouvernante vorwurfsvoll. „Es ist ungehörig ...“
Doch Ludwig unterbrach sie. „Sagen Sie Mademoiselle Mancini, die Hochzeit findet nicht statt!“ Seine Stimme überschlug sich vor Aufregung.
Madame de Venel wurde blass. „Aber Sire ...!“
„Sagen Sie es ihr!“ Danach lief er durch die winkeligen Gänge zu seinem Schlafgemach.
Zwei Mal verirrte er sich und musste nach dem Weg fragen. Man erklärte es ihm und schaute ihm verwundert nach. Er war wie betrunken und fragte sich, was mit ihm geschehen war. Dann wusste er es auf einmal: Er war glücklich! Erst jetzt begriff er, was das war: Glück! Wie oft hatte er davon gelesen und auch mit Marie darüber gesprochen. Doch erlebt hatte er es noch nie. Vielleicht, weil er noch nie geliebt hatte? Bisher!, dachte er, während er nach seinen Gemächern suchte. Nun aber war alles anders. Marie Mancini, mit der er so viele Stunden verbracht hatte, war für ihn mehr geworden als nur eine gute Freundin. Ich bin verliebt!, dachte er und hatte alle anderen vergessen, von Catherine de Beauvais angefangen bis zu Olympia. Von jetzt an sollte es nur noch eine einzige Frau für ihn geben: die aufregende kleine Marie mit ihrem pechschwarzen Haar und ihren funkelnden Augen, so dunkel wie die Nacht.
Endlich fand er doch noch zu seinem Zimmer. An La Porte vorbei stürmte er hinein und ließ sich aufs Bett fallen.
„Haben Sie noch einen Wunsch, Majestät?“, fragte La Porte besorgt.
Ludwig konnte nicht begreifen, dass es einen Menschen gab, der in diesem Augenblick so ernst sein konnte. „Tausende Wünsche, Monsieur Pierre!“, rief er. „Aber jetzt lassen Sie mich erst einmal allein!“ Als die Tür hinter La Porte zugefallen war, hämmerte Lud-wig mit den Fäusten auf das Kissen. Er wusste nicht, wohin mit all dem Glück, das ihn auf einmal erfüllte. Marie!, dachte er immer nur. Ob sie auch so fühlte wie er? Er konnte es kaum erwarten, sie am nächsten Morgen wiederzusehen, und er war viel zu aufgeregt, um einschlafen zu können.
Ein König dürfe vom Schicksal mehr erwarten als gewöhnliche Menschen, hatte man Ludwig als Kind gelehrt. Macht gehöre dazu, sie vor allem. Dazu aber auch Ehre, Ruhm und Reichtum. Von Liebe und Glück war nicht die Rede gewesen. Beides hatte Ludwig auch nie wissentlich angestrebt, obwohl er meinte, Anspruch darauf zu haben, dass man ihn verehrte. Vielleicht war Verehrung aber nur die verschleiernde Bezeichnung für ein Gefühl, das eigentlich Liebe war.
Aus eigener Erfahrung war seine Mutter überzeugt, dass ihr Sohn sein ganzes Leben lang nicht lernen würde, Menschen zu widerstehen, die ihm Liebe oder Verehrung entgegenbrachten oder vorgaukelten.
Auch jetzt wartete er darauf. Jetzt vor allem, als sein Herz klopfte, weil er kaum erwarten konnte, Marie wiederzusehen, von der er einen Abend und eine Nacht lang getrennt gewesen war - eine Ewigkeit, wie es ihm auf einmal vorkam.
Dann sah er sie. Sie stand mit Madame de Venel vor ihrer Kutsche und wartete auf das Signal zum Einsteigen. Es war ein kühler Morgen. Ein frischer Wind hob die bunten Federn auf Maries breitkrempigem Hut, der ihr Gesicht zur Hälfte verbarg. Sie schien zu frösteln in ihrem schwarzen Samtkostüm mit dem engen Mieder, das sie schon von ferne zart und schmal erscheinen ließ. Während Madame de Venel mit dem Kutscher Wegen des Gepäcks verhandelte, stand Marie schweigend da, in sich gekehrt, als wüsste sie nichts mit sich anzufangen. Dabei musste sie doch wissen, dachte Ludwig, dass sich mit dem Ende der Brautschau auch für sie alles verändert hatte. Die spanischen Pläne waren ihr sicher nicht bekannt. Noch waren sie geheim, und auch Ludwig war nicht bereit, über sie auch nur nachzudenken. Er glaubte an die Zukunft. Das Schicksal musste auf Seiten der Liebenden sein.
Ein paar Schritte von Marie entfernt blieb Ludwig stehen und wartete darauf, dass sie ihn wahrnahm. Und nun sah sie ihn auch! Sie forschte in seinem Gesicht und merkte, dass sich sein Blick im Vergleich zu früher verändert hatte. Nicht nur sein Blick - alles hatte sich verändert. Marie begriff es sofort. Auch Madame de Venel, die Marie zum Einsteigen aufforderte, hielt inne und starrte Ludwig überrascht an. Sie sank in einen tiefen Knicks und blickte zugleich misstrauisch zu ihrem Schützling hoch. Auch ein König war ein Mann, und ihre Aufgabe als Gouvernante war es, Marie vor jeglichem Schaden, den Männer verursachten, zu bewahren.
Doch Marie wollte vor gar nichts bewahrt werden. Am liebsten wäre sie zu Ludwig hingelaufen und hätte sich in seine Arme geworfen. Sie zweifelte nicht daran, dass er sie beglückt umfangen hätte. Er liebt mich!, dachte sie. Ich bin sicher, dass er mich liebt... Die Schmach des gestrigen Abends war vergessen, als sie beschämt aus dem Ballsaal geschlichen war, weil niemand von ihr Notiz genommen hatte.
Nun aber fiel das Licht wieder auf sie. Ludwig ging auf sie zu - langsam, um den kostbaren Moment nicht zu verkürzen. Sie ließen einander nicht aus den Augen. Marie knickste, wie es sich gehörte, aber sie verneigte sich nicht. Als Ludwig sie erreicht hatte, streckte er ihr die Hand entgegen, um ihr aufzuhelfen. Auch als sie bereits stand, ließ er sie nicht los.
Inzwischen waren sämtliche Reisenden bei ihren Kutschen angekommen. Alle sahen auf Ludwig und Marie, die selbst nichts wahrnahmen als einander. Keiner der beiden lächelte. Noch nie war ihnen etwas so ernst gewesen wie dieser Augenblick.
Als sie sich dann doch voneinander lösten, stieß Maries Hand schmerzhaft gegen den Knauf von Ludwigs Schwert. Sie schrie leise auf und rieb sich die betroffene Stelle. Ludwig sah ihr erschrocken zu, dann riss er das Schwert aus der Scheide und warf es weit von sich. Klirrend blieb es mitten auf der Straße liegen.
Die Zuschauer stöhnten auf und flüsterten anerkennende Kommentare über die Ritterlichkeit des Königs. Ludwig selbst verneigte sich vor Marie und nahm vorsichtig ihre Hand. Ohne jemand anderen zu beachten, führte er Marie zu seiner Kutsche.
Madame de Venel hob in hilflosem Entsetzen ihre Arme.
Dann raffte sie ihre weiten Röcke zusammen und folgte den Beiden. Als sie eingestiegen waren, bestand sie darauf, ebenfalls mitgenommen zu werden. Dass es die Kutsche des Königs war, spielte für sie keine Rolle. Ihre Pflicht bezog sich auf die Nichte des Kardinals, die sich - davon war Madame de Venel überzeugt - soeben in die größte Gefahr ihres Lebens begab. Sie jetzt nicht im Stich zu lassen, war nicht nur Christen-, sondern auch Gouvernantenpflicht. Außerdem: Der König war zwar der König, aber das Sagen hatte wohl immer noch der Kardinal, und der war ihr Auftraggeber und der Vormund des unglückseligen Mädchens, das dabei war, offenen Auges ins Verderben zu rennen.
Tage des Glücks und der Verliebtheit folgten und wurden zu Wochen und zu Monaten. Allein schon die Rückreise nach Paris war das Schönste, was Ludwig je erlebt hatte. Wie in einem Taumel vergingen die wenigen Tage, in denen der Winter näherkam und es allmählich kälter wurde. Eines Morgens fiel sogar Schnee. Die Königin und der Kardinal, Olympia und Hortense zogen sich warm verpackt in ihre Kutschen zurück, ließen jedoch zu, dass Ludwig und Marie den Schutz der Fahrzeuge verschmähten und Seite an Seite durch den kalten Tag ritten.
Manchmal hieben sie ihre Pferde zum Galopp an. Dann wieder hielten sie an einem besonders reizvollen Punkt der Landschaft inne und sahen sich um. „Das ist Ihr Land, Sire!“, sagte Marie leise. „Sie sollten es lieben.“
Ludwig nickte nachdenklich. Noch nie war er mit sich selbst so sehr im Reinen gewesen wie jetzt, und noch nie hatte er sich als Teil eines wundervollen, riesengroßen Ganzen gefühlt, das er nicht benennen konnte, das ihm aber manchmal fast die Tränen in die Augen trieb. Sie nannten einander beim Vornamen, und manchmal wagte Marie sogar, Ludwig zu duzen, als wären sie beide noch kleine Kinder, Geschwister oder Freunde, die einander gleichgestellt waren. Kein Knicks, wenn sie allein waren, nur eine sanfte, ehrerbietige Zärtlichkeit, die Ludwig niemals überschritt, weil er zutiefst daran glaubte, dass eine Liebe, wie er sie nun empfand, sogar dem strengen Schicksal genehm sein musste. Niemand konnte verlangen, dass sie sich jemals wieder trennten. Sogar der Kardinal und die standesbewusste Königin würden zugestehen müssen, dass es Gefühle gab, die alle Grenzen überschreiten durften. Auch der Hof würde es verstehen. Frankreich würde es verstehen. Die ganze Welt würde es verstehen. In alle Ewigkeit würde man den jungen König von Frankreich rühmen, weil er so sehr geliebt hatte, dass alle Schranken zusammenbrachen.
So ritten die beiden durch die winterlichen Tage. Immer wieder fiel Schnee, bis das ganze Land davon bedeckt war. Ludwig auf seinem tänzelnden Pferd beugte sich zu Marie hinüber und küsste ihre eiskalten, geröteten Wangen. „Meine Mutter hat noch nie etwas gegen uns beide gesagt!“, flüsterte er. „Ich bin sicher, sie versteht uns.“
Marie nickte lächelnd. „Mein Onkel ebenfalls“, erklärte sie. „Ich glaube, man gönnt uns unser Glück.“ Dann ritten sie weiter. Erst am Abend trafen sie in den Rastorten wieder mit ihrer Reisegesellschaft zusammen. Man aß und trank, spielte Gitarre und sang.
Die Einzige, die ihr Missfallen nicht verbergen konnte, war Madame de Venel. Doch alles, was sie von den Liebenden dafür erntete, war Lachen und Spott. Die Gouvernante konnte kaum glauben, wie kindisch fast erwachsene Menschen durch das hemmungslose Ausleben ihrer Verliebtheit werden konnten.
Einmal brachte ihr Ludwig eine wunderbar bemalte Schachtel als Geschenk mit. Zögernd nahm sie sie entgegen. „Süßigkeiten, Sire?“, erkundigte sie sich vorsichtig. Ludwig verneigte sich und Verließ den Raum. Madame de Venel öffnete die Schachtel und ließ sie gleich darauf schreiend zu Boden fallen. Anstelle der Pralinen, die sie erwartet hatte, sprangen ihr zwölf Mäuse entgegen. Madame de Venel starb fast vor Schreck. Sie war überzeugt, dass sie in ihrem Innersten nie wieder Achtung vor diesem König haben konnte.
Marie bekam andere Geschenke. Als sie wieder in Paris waren, verlangte Ludwig von Mazarin ein Präsent für seine Liebste. Mazarin zögerte. Er war nicht gegen diese offenkundig immer noch unschuldige Verbindung seines Patensohns und seiner Nichte. Sie kam ihm sogar ganz gelegen, wusste doch ganz Europa bereits davon, auch die Katholische Majestät, was Mazarin bei seinen Verhandlungen mit Pimentel zugutekam. Philipp von Spanien musste damit rechnen, dass sein Heiratsangebot abgelehnt wurde, wenn er zu viel dafür verlangte. Wenn man sich allerdings geeinigt hatte, mussten die verliebten Spielchen ein Ende haben.
„Ich bin Maries Vormund!“, beruhigte Mazarin die Königin, der alles schon viel zu weit ging und die Marie immer weniger ausstehen konnte. Trotzdem umarmte sie sie manchmal zärtlich Und nannte sie „liebes Kind“. Marie konnte nicht ahnen, wie schwankend der Boden war, auf dem sie sich bewegte.
Ludwig schenkte ihr das kostbarste Perlencollier, das es in Europa gab. Zuvor war es im Besitz der englischen Königin gewesen. Als man deren Gemahl enthauptet hatte, war Henriette nach Frankreich geflohen. Der Verkauf des Colliers bewahrte sie davor, Königin Anna wegen jeder Kleinigkeit um Unterstützung zu bitten. Siebzigtausend Livre war das Schmuckstück wert. Ein wahrhaft königliches Geschenk, das Ludwig da seiner Angebeteten um den Hals legte. Nur zähneknirschend hatte Mazarin das Geld herausgerückt. Er tröstete sich damit, dass der Besitz eines so wertvollen Schmuck-stücks seiner Nichte den unausweichlichen Abschied versüßen würde.
Vielleicht würde es bis zu diesem Abschied gar nicht mehr so lange dauern. Zwar wurde der Krieg an der Front immer noch blutig weitergeführt, doch die Verhandlungen gingen ihrem Ende entgegen. Zum ersten Mal kamen Besucher aus Spanien nach Paris.
Don Juan d'Austria, Gouverneur der Niederlande und natürlicher Sohn Philipps IV., besuchte seine Tante, Königin Anna, im Louvre und wurde liebevoll aufgenommen. Auch Don Antonio Pimentel hätte sich keinen freundlicheren Empfang wünschen können, und als der Sonderbotschafter Frankreichs, Gramont, nach Madrid reiste, wurde ihm sogar gestattet, der spanischen Königin, die allein zu speisen pflegte, bei ihrem Diner zuzuschauen. Zwei Hofdamen, ganz in Weiß gekleidet, bedienten kniend ihre Herrin, während der Botschafter das Gefühl hatte, sich auf einem anderen Stern zu befinden. Doch es war wohl eine große Ehre, die ihm da zuteilwurde, und so verbarg er sein Befremden hinter der undurchdringlichen Miene, die am spanischen Hof wohl üblich war.
Marie begriff nicht, was das Hin und Her spanischer Gäste zu bedeuten hatte. Allzu sicher fühlte sie sich durch Ludwigs Liebe, die von Tag zu Tag größer zu werden schien. Das Perlencollier, das er ihr umgelegt hatte, kam ihr wie ein heimliches Verlobungsgeschenk vor. Dass Madame de Venel Bedenken äußerte, überhörte Marie mit Bedacht.
„Man sollte keine Präsente annehmen, wenn man mit dem Betreffenden nicht verheiratet ist!“, tadelte die Gouvernante. „Habe ich Sie das nicht gelehrt, Mademoiselle?“
Marie lachte. „Sogar mein Onkel wusste davon, Madame“, widersprach sie. „Wollen Sie strenger sein als der Kardinal?“
Madame de Venel schwieg. Es stand ihr nicht zu, ihren Herrn zu kritisieren. Trotzdem fand sie, dass er diesmal, bei all seiner Güte, das Falsche getan hatte. „Noch dazu Perlen!“, fügte sie hinzu. „Wissen Sie nicht, dass Perlen Tränen bedeuten?“
Marie betrachtete sich wohlgefällig im Spiegel und fuhr lächelnd mit den Fingerspitzen über das schimmernde Collier, „Diese nicht!“, versicherte sie leise. „Glauben Sie mir, Madame! Diese nicht!“
Man verhandelte bereits über den Termin und die Modalitäten des Friedensschlusses und der Hochzeit mit der Infantin, da trat Ludwig vor seinen Paten hin und bat ihn um die Hand seiner Nichte Marie. „Ich wüsste kein besseres Mittel als diese Heirat, Sie für Ihre wertvollen, langjährigen Dienste zu entlohnen, mein lieber Pate!“, sagte er herzlich. Er zweifelte nicht daran, dass sich der Kardinal über den Antrag freuen würde.
Mazarin, dessen Gedanken in diesen Tagen nur um das Thema der Verhandlungen mit Pimentel kreisten, blickte Ludwig verblüfft an. Nicht einmal zornig wurde er. Er konnte nur nicht glauben, dass dieser junge Mensch, den er zur Vernunft erzogen hatte, ein solches Ansinnen an ihn stellte. „Als Sie ein Kind waren, Sire“, antwortete er in schleppendem Ton, „suchten wir nach einer Lektüre, die Ihren Charakter formen sollte. Sie sollten lernen, was einen guten König von einem mittelmäßigen oder einem schlechten unterscheidet.“ Seine Miene veränderte sich nicht. „Wir hatten viel Freude an Ihrer Entwicklung. Wir dachten, Sie hätten Klarheit darüber, was es bedeutet, König zu sein.“
Ludwig runzelte die Stirn. Er merkte, dass das Gespräch ganz aners verlief, als er es erwartet hatte. „Ich denke schon, dass ich das weiß, Eminenz“, antwortete er. Er war plötzlich auf der Hut, obwohl er noch vor wenigen Minuten darauf vertraut hatte, dass ihn sein Pate verstehen würde.
Mazarins Blick war hart und ohne Erbarmen. Ein Leben lang halte er um Ansehen gekämpft, um einen ehrenvollen Platz in der Geschichte. Sollte nun die Verwirrung eines Jünglings den Traum zerstören, dessen Erfüllung zum Greifen nahe war? „Wir haben Ihre Freundschaft mit meiner Nichte geduldet“, sagte er.
„Wir haben Ihnen erlaubt, ihr wertvolle Geschenke zu machen. Von einer Heirat war jedoch nie die Rede.“
„Und von Liebe?“ Schon während er es sagte, wusste Ludwig, dass Liebe für Mazarin kein Argument war. Der Kardinal sprach es nicht aus, doch Ludwig wusste, was er dachte. Ein bürgerliches Mädchen kam für einen König von Frankreich als Gemahlin nicht infrage. Frauen wie Marie Mancini heiratete ein Bourbone nicht. Er nahm sie sich höchstens als Mätresse.
„Marie ist Ihre eigene Nichte!“, beharrte Ludwig. „Missfällt Ihnen der Gedanke, eine Ihrer Verwandten könnte Königin von Frankreich werden?“
Mazarin blickte zum Fenster hinaus. Der Himmel war grau und verhangen. „Wem würde ein solcher Gedanke nicht gefallen?“, antwortete er. „Doch er ist undurchführbar. Die Folge wäre eine neue Fronde. Die Folge wäre eine Fortdauer des Krieges mit Spanien. Die Folge wäre ein Chaos und der Untergang dieser Monarchie. Mit Marie als Gemahlin wären Sie bald kein König mehr, sondern irgendwo im Ausland auf der Flucht.“
Er erhob sich und trat ans Fenster. „Dann stünden Sie im nächsten Buch über die Könige von Frankreich als >Ludwig der Törichte< oder als >Ludwig der Letztem<.“
Ludwig spürte, wie Zorn in ihm aufstieg. „Wie können Sie es wagen, so mit mir zu reden, Eminenz!“, rief er. „Vergessen Sie nicht: Ich bin einundzwanzig und ich bin der König! Ein Befehl von mir, und Sie sind heimatlos.“
Mazarin schaute immer noch zum Fenster hinaus. Der Gedanke kam ihm, dass er noch in dieser Stunde vor den Scherben seines Lebenswerks stehen konnte. Trotzdem veränderte sich der Ton seiner Stimme nicht. „Wenn es denn sein soll, Majestät“, sagte er ruhig. „Sprechen Sie diesen Befehl, wenn Sie es wünschen! Wir werden ohnedies am Ende sein, wenn Sie Ihren Willen durchsetzen.“
Ludwig war blass geworden. „Ist das Ihr letztes Wort, Eminenz?“, fragte er kalt.
Mazarin drehte sich zu ihm um und hob in einer hilflosen Geste die Arme. „Welche Wahl hätte ich denn?“, fragte er. „Ich kann Sie nur anflehen, noch einmal darüber nachzudenken. In der Zwischenzeit vertraue ich auf Ihre Vernunft und setze die Verhandlungen mit Spanien fort.“
Ludwig merkte, dass er zu weit gegangen war. „Warum sollte es nicht möglich sein, über den Frieden zu verhandeln, doch auf die Heirat mit der Infantin zu verzichten?“, lenkte er ein.
Mazarin ging zu seinem Schreibtisch zurück. Er setzte sich Und legte die Finger an die Schläfen. „Weil es dafür längst zu spät ist“, antwortete er müde. „Es wäre immer schon zu spät gewesen, Weil von Anfang an feststand, dass Sie und die Infantin füreinander bestimmt sind.“
„Sie meinen, es gibt keinen Ausweg für mich?“, Ludwig schien zu begreifen, doch er war noch weit davon entfernt, sich zu beugen.
„Es gab niemals einen Ausweg, Sire. In Wahrheit hatten Sie nie eine Wahl.“
„Hat ein Mensch nicht immer eine Wahl, mein Pate? Wären Sie hier, wo Sie sind, wenn Sie nicht immer wieder Ihre Wahl getroffen hätten?“
Mazarin schüttelte den Kopf. „Von mir ist nicht die Rede“, antwortete er. „Doch auf der Waage, die über Ihr Leben entscheidet, ist das Gewicht auf der einen Seite so schwer, dass es durch nichts aufgewogen werden kann.“
„Aber welches Gewicht wäre das?“
Mazarin zuckte die Achseln. „Die Krone natürlich!“, antworte er. Seine Stimme wurde scharf. „Vielleicht steht sogar Ihr Kopf auf dem Spiel, Sire! Denken sie an den König von England, Ihren Verwandten! Bis zum Schluss hatte er nicht die geringste Ahnung, in welcher Gefahr er schwebte.“
Ludwig suchte nach einer Antwort, doch er fand keine. Da drehte er sich um und eilte hinaus. Mazarin blieb zurück. Mit einem leisen Stöhnen strich er über seine Waden, die ihn so sehr schmerzten, dass er manchmal dachte, so müsse man sich im Fegefeuer fühlen. Für kurze Zeit schloss er die Augen. Dann seufzte er und wandte sich wieder seinem Entwurf des Friedensvertrags zu, der nach dem Wunsch der Katholischen Majestät erst nach der Hochzeit von Ludwig und Maria Theresia in Kraft treten sollte.
Politische Pläne
Es war, als hätte man eine brennende Fackel in einen ausgedörrten Heuhaufen geworfen. Geschrei und Tränen überall. Am schlimmsten gebärdete sich Königin Anna, die alle Schuld auf Marie häufte. „Ich weiß, es sind Ihre Nichten, mein Lieber!“, fiel sie über Mazarin her. „Aber das allein sagt noch nichts über ihren Charakter aus.“ Sie raufte sich buchstäblich die Haare. „Erst Olympia, die war schon schlimm genug! Aber sie spielte wenigstens nicht die kühle Preziöse. Bei ihr wusste man, woran man war. Doch Marie! Mein Gott, wer hätte gedacht, dass mein armer Ludwig auf so etwas hereinfällt!“ Sie sank auf ihr Sofa. „Wir sind alle viel zu gutmütig. Die Medici-Frauen hätten gewusst, wie man mit einem derartigen Problem fertig wird.“ Sie winkte ab. „Ja, ja, mein Freund. Ich höre schon auf. Trotzdem müssen wir der Sache ein Ende setzen. Sofort und für immer.“
Doch auch Marie entfesselte die italienische furia, für die ihre Familie berüchtigt war. „Sind Sie der König, oder nicht?“, fragte sie Ludwig und brach in Schluchzen aus. „Mein Onkel ist Ihr Minister, sonst nichts. Was Sie befehlen, hat er auszuführen. Wenn er das nicht einsieht, muss er eben gehen.“
Ludwig, um den sich alles drehte, stand zwischen den Fronten. Er warf sich seiner Mutter zu Füßen und schilderte ihr seine Liebe.
In seiner Gegenwart wagte Anna nicht, sich gegen Marie zu äußern. Sie führte ihm nur die politischen Folgen seines Handelns vor Augen. Dann brach auch sie weinend zusammen und überließ Mazarin das Schlachtfeld. Der erinnerte sich inzwischen daran, dass ihn seine Schwester immer schon vor Marie gewarnt hatte. „Sie ist als Störenfried geboren!“, sagte er zu Ludwig, der es inzwischen aufgegeben hatte, seine Tränen vor ihm zu verbergen. „Sie ist von Ehrgeiz besessen, jähzornig und ohne Rücksicht auf andere. Sie hat tausend Fehler. Mir fiele keine einzige Eigenschaft ein, die sie der Ehre Ihres Wohlwollens würdig machte, Sire!“ Danach beging er den Fehler, mit seinem Rücktritt zu drohen.
Ein gefährliches Schweigen entstand. Anna, die auf ihrem Sofa leise vor sich hin geweint hatte, horchte auf. Auch Ludwig wusste erst keine Antwort. Dann wurde er plötzlich ganz ruhig. „Machen Sie, was Sie wollen, Eminenz!“, antwortete er kühl. „Wenn Sie unsere Angelegenheiten nicht mehr führen wollen, gibt es genügend an-dere, die es gern tun werden.“ Damit verließ er den Raum. Von draußen hörte er, wie seine Mutter aufschrie und beschwörend auf den Kardinal einredete.
Zur gleichen Zeit wurden die Verhandlungen mit Spanien weiter gerührt. Auch hier ging es drunter und drüber. Man feilschte um Grenzgebiete, um Provinzen und Städte und um das Schicksal des Großen Conde, dem sich Spanien verpflichtet fühlte. Für Mazarin war er nur ein Verräter. Trotzdem würde man ihn wohl in allen Ehren wieder aufnehmen müssen. „Das alles ist zu viel für mich!“, sagte Mazarin eines Abends zu Nicolas Fouquet, der darauf drängte, den Friedensvertrag endlich zu unterzeichnen. „Wir können uns diesen Krieg nicht länger leisten, Eminenz!“, sagte er. „Meine Kreditgeber verweigern mir schon die Zusammenarbeit. Wie kommt es, dass plötzlich wir die Spanier hinhalten?“
Mazarin schilderte ihm Ludwigs leidige Liebesgeschichte. Nicolas hörte ihm kopfschüttelnd zu. „Der arme Junge!“, murmelte er. Mazarin fuhr auf. „Sie haben doch wohl nicht Verständnis für eine solche Dummheit?“, rief er. Nicolas zuckte die Achseln. „Für die Dummheit schon, Eminenz. Doch ich hätte kein Verständnis, wenn Sie sie zuließen.“ Er schüttelte den Kopf. „Diese Heirat ist unmöglich. Seine Majestät muss darauf verzichten. Trotzdem zeigt er uns mit seiner Unvernunft, dass er ein Mensch ist, der lieben kann. Wir sollten für ihn da sein.“
Mazarin starrte ihn finster an. „Sie sind mir keine Hilfe, Monseigneur!“, murrte er. „Zumindest nicht in dieser Angelegenheit.“ Dann begab er sich in Ludwigs Gemächer und teilte ihm mit, er könne nicht mit ansehen, wie Ludwig das Werk seiner Väter zer-störe. Sollte er nicht auf diese Heirat verzichten, werde er, Kardinal Jules Mazarin, mit seinen noch unverheirateten Nichten Frankreich verlassen und nach Italien ziehen. Als Maries Vormund werde er ihr eine Heirat mit dem König verbieten. Nur so sei Frankreich noch zu retten.
Ludwig hatte nächtelang nicht geschlafen. Er war erschöpft und niedergeschlagen. Wenn er Marie traf, lagen sie einander in den Armen und schworen sich ewige Liebe. Doch gleich danach überkam sie wieder die Verbitterung über den Widerstand, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Sie überboten sich in Angriffen auf die Königin und den Kardinal, bis es ihnen selbst zu viel wurde und sie anfingen, aneinander zu leiden. So gingen sie für kurze Zeit auseinander, und Ludwig begab sich wieder zum Kardinal, obwohl sich seit dem letzten Gespräch nichts geändert hatte.
Doch auch Mazarin konnte nicht mehr. „Ich schäme mich schon vor meinen spanischen Gesprächspartnern, Sire“, erklärte er müde. „Sie drängen auf Klarheit, und ich vertröste sie nur.“ Er legte die Lupe aus der Hand, die er in letzter Zeit zum Lesen benötigte. „Ich brauche eine bindende Entscheidung von Ihnen: Soll ich die Frie-densverhandlungen fortführen oder nicht? Verstehen Sie mich recht, Sire: Friedensverhandlungen bedeuten immer auch Verhandlungen über den Heiratsvertrag. Auf etwas anderes lässt sich König Philipp nicht ein.“ Er senkte den Kopf. „Es tut mir leid, mein Lieber. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich in eine solche Situation kommen könnte. Auch Ihnen hätte ich mehr Glück gewünscht.“ Er blickte Ludwig in die Augen. „Aber es geht nicht anders, verstehen Sie mich? Es geht nicht anders.“
Ludwig schwieg lange. Dann nickte er. „Machen Sie weiter wie bisher, Eminenz!“, bestimmte er. Seine Lippen zitterten.
Mazarin atmete auf. „Und Marie?“, fragte er. „Die Spanier wissen genau, dass Sie sich immer noch mit ihr treffen.“
Ludwig kämpfte mit sich. „Wir werden uns für kurze Zeit trennen“, gab er nach. „Vielleicht nicht für immer. Und wir werden uns schreiben, sooft wir wollen. Darauf bestehe ich.“ Er meinte, gleich müssten ihm wieder die Tränen kommen wie so oft in den vergangenen Tagen. Doch nichts geschah.
Er war nur müde. Entsetzlich müde und traurig. Dein Reich, o Liebe, ist ein grausames Reich!, dachte er.
Am nächsten Morgen, es war der 22. Juni 1659, führte Ludwig Marie zu ihrer Karosse. Er half ihr beim Einsteigen und blieb dann noch lange bei ihr stehen. Er blickte in ihr Gesicht, das ihm so vertraut und kostbar erschien wie kein anderes auf der Welt.
Marie schaute zu ihm hinunter. „Ach, Sire“, sagte sie leise. „Es ist eine verkehrte Welt. Sie sind der König, Sie weinen, und ich gehe.“
Der Kutscher schloss den Wagenschlag. Marie steckte ihre Hand durchs Fenster. Ludwig griff danach und hielt sie fest. Da gab Marie dem Kutscher ein Zeichen und riss sich los. „Ich bin verlassen!“, rief sie, als der Wagen davonfuhr.
Ludwig blieb zurück. Alles schien ihm verloren. Er ließ sich sein Pferd bringen und ritt stundenlang durch den Wald. Danach kehrte er zurück und schrieb den ersten von unzähligen Briefen, die Marie aus ihrer Verbannung mit Hortense und Madame de Venel alle beantwortete.
Zwei Mal trafen sie einander noch. Beim ersten Mal sagte Marie, sie müsse sich dem Willen ihres Onkels unterwerfen und bitte Ludwig, ihr nicht mehr zu schreiben und auch ihre früheren Briefe zu verbrennen. Ludwig konnte es nicht glauben. Wieder und wieder schrieb er ihr trotzdem und schickte ihr sein Schoßhündchen Friponne. Am Halsband trug es einen silbernen Anhänger mit der Inschrift „Ich gehöre Marie Mancini.“
Marie wusste trotzdem, dass sie verloren hatte. Der Kardinal teilte ihr mit, er habe einen Gemahl für sie gefunden, einen aus den allerhöchsten Kreisen: den Prinzen Lorenzo Colonna, dem seine eigenen Vorfahren einst als Kammerherrn gedient hatten.
Doch Marie hatte kein Gefühl für den Aufstieg ihrer Familie. „Ein Italiener?“, fragte sie. „Ihre Majestät sagte mir, auch Prinz Karl von Lothringen käme für mich infrage. Dann könnte ich in Frankreich bleiben.“
Mazarin schüttelte den Kopf. „Es tut mir leid, mein Kind“, antwortete er, ohne ihren Einwand zu beachten. „Die Entscheidung ist bereits gefallen.“
„Prinz Colonna also?“
Mazarin nickte. „Endgültig.“
Marie fügte sich. Auch Ludwig verbrannte nun ihre Briefe.
Seine verzweifelten Ritte durch den Wald wurden seltener, als seine Mutter anfing, Maries Ruf zu untergraben. Ständig sei das junge Mädchen auf Festen. Dem Prinzen Karl von Lothringen habe sie so offen schöne Augen gemacht, dass schon alle Welt darüber rede.
Ludwig glaubte, das Herz zerreiße ihm. „Ist das wahr, Maman?“, rief er.
Anna sah ihm tief in die Augen. „Habe ich jemals gelogen, mein Sohn?“, fragte sie. Ludwig wusste, wie streng Annas Beichtvater mit ihr war, und schenkte ihr Glauben. So kam es, dass er sich bei der zweiten Begegnung nach der Trennung nur kühl vor Marie verneigte.
Für Marie selbst hatte sich nichts verändert. „Ludwig!“, sagte sie zärtlich. „Wie geht es Ihnen?“
Der Klang ihrer Stimme traf ihn ins Herz. Trotzdem blieb seine Miene beherrscht. „Ich danke für die Nachfrage, Mademoiselle“, antwortete er abweisend. Noch einmal verneigte er sich kalt. Dann ließ er sie stehen.
Marie starrte ihm nach. Sie war nicht in der Lage, sich zu bewegen. Ihre Schwester Hortense eilte herbei und führte sie wie eine Kranke in ihre Gemächer. Ludwig aber ritt ein letztes Mal durch den Wald und nahm endgültig Abschied von seiner Liebe. Er wusste, dass er nie mehr dergleichen empfinden würde. Nie mehr würde er so glücklich sein wie mit Marie, nie mehr aber auch so verletzlich.
Als Marie nach Italien ging, um den Prinzen Colonna zu heiraten, äußerte dieser seinen Verwandten gegenüber, er sei überrascht. „Ich hätte nicht erwartet, in der Liebe von Königen Unschuld zu finden!“, stellte er fest. Trotzdem blieben die beiden einander fremd.
Die Infantin
Nicolas Fouquet und Marie Madeleine befanden sich in dem Gefolge, das den französischen König zu seiner Hochzeit mit der Infantin von Spanien begleitete. Gute vier Wochen hatte man für die Reise zur spanischen Grenze veranschlagt, wo Braut und Bräutigam einander zum ersten Mal begegnen sollten. Erst wenn ihre Trauung vollzogen war, würde der Friedensschluss zwischen den beiden Ländern auch offiziell in Kraft treten.
Im November 1659 hatten Kardinal Mazarin und Don Luis de Haro das Friedensdokument unterzeichnet. Beide erduldeten mit Gleichmut, dass ihnen die Öffentlichkeit ihrer Länder vorwarf, dem jeweiligen Kriegsgegner zu viele Vorteile eingeräumt zu haben. Doch weder der Kardinal noch Don Luis zweifelten daran, dass man sich sehr bald schon an die neuen Konstellationen gewöhnen würde und dann nur noch froh war, dass endlich die Waffen schwiegen.
So kam es auch. In einem noch nie erlebten Triumphzug bewegten sich die königlichen Karossen gegen Süden. In allen Städten und Dörfern wurden sie jubelnd empfangen.
Erst jetzt kam Ludwig zu Bewusstsein, wie sehr das Volk unter der Bürde des Krieges gelitten hatte. „Von nun an soll alles anders werden!“, sagte er zu Nicolas. Er hatte ihn zu sich in seine Kutsche befohlen, um ihn über die finanzielle Lage nach dem Krieg zu befragen. An Mazarin wollte er sich damit nicht wenden.
Er konnte sehen, dass der Kardinal gesundheitlich geschwächt war. Trotzdem gab er das Heft nicht aus der Hand. Wenn erst diese Hochzeit vollzogen war, dachte er wohl, würde man nach Paris zurückkehren, wo er sich erholen und dann endlich dem letzten Ziel zustreben würde, das er sich für sein Leben gesetzt hatte. Das höchste aller Ziele für einen Mann seines Standes: der Papsthron.
Es würde nicht leicht sein, sich diesen Traum zu erfüllen. Zu viele Hebel mussten in Bewegung gesetzt, zu viele Stimmen gewonnen werden. In Mazarins Augen war es eine Frage des Geldes und der Beziehungen. Dies war wohl auch der Grund, warum der Kardinal darauf bestanden hatte, dass Nicolas an dieser Reise teilnahm. Wenn er nicht die nötigen Mittel beschaffte, war Mazarins Traum vom Vatikan für immer ausgeträumt.
Sein eigenes Vermögen anzugreifen kam Mazarin nicht in den Sinn.
Was ihm gehörte, benötigte er als Garantie für seine eigene Sicherheit, die noch wichtiger war als jedes Amt und jede Würde.
„Es sieht nicht gut aus, Sire“, sagte Nicolas zu Ludwig, der ihm gegenübersaß. „Der Krieg hat unsere Staatskasse geleert. Unser Kredit ist erschöpft. Wenn Sie erlauben, darf ich sagen, dass ich in letzter Zeit immer öfter auf mein eigenes Vermögen zurückgreifen muss.“
Ludwig runzelte die Stirn. Es entsprach nicht seiner Vorstellung von einer Monarchie, dass die Staatskasse durch einen Privatmann vor dem Zusammenbruch bewahrt wurde. In letzter Zeit hatte sich Ludwig häufig Gedanken über die Königswürde gemacht. Oft genug hatte man ihn wegen Marie Mancini daran erinnert. Leere Kas-sen passten nicht in sein Bild von königlicher Erhabenheit. Eigentlich erschien es ihm unerträglich, dass es in seinem Reich Untertanen gab, die vermögender waren als er selbst. Ein König war das Nonplusultra in seinem Land. Es grenzte an Majestätsbeleidigung, ihn in irgendeiner Weise zu übertreffen.
Doch noch dachte er diesen Gedanken nicht zu Ende. Er blickte in das angenehme Gesicht seines Finanzministers, sah sein Lächeln und hörte seine gepflegte Stimme. Er erinnerte sich an die Perücke, die ihm Nicolas gebracht hatte, und an die vielen Bemerkungen und Gespräche, mit denen jener ihn ermutigt hatte. Ludwig gestand sich ein, dass er diesen Mann gern um sich hatte - ihn und auch seine Gemahlin mit ihren dunklen Augen und ihrem schwarzen Haar, die ihn an etwas erinnerte, das er tief in seine Erinnerung verbannt hatte und nach dem er sich wohl immer heimlich sehnen würde. Er hoffte nur, dass ihn am Ziel dieser Reise eine Frau erwartete, die es wie jene Unvergessen-Vergessene mit ihm aufnehmen konnte, die ihn mit ihrem Witz zum Lachen brachte und seine Gedanken herausforderte. Ach, Sire, es ist eine verkehrte Welt. Sie sind der König, Sie weinen, und ich gehe! Ludwig wollte nicht, dass diese Welt eine verkehrte Welt war. Oben sollte oben bleiben und unten. Da nun alles entschieden war und die Erste Prinzessin der Welt auf ihn wartete, würde er dafür sorgen, dass bald nirgendwo mehr jemand es wagte, sich ihm gleichzusetzen. Kein Regent eines anderen Landes sollte sich ihm ebenbürtig fühlen; kein ausländischer Diplomat den zuvorkommenden Gruß eines französischen erwarten, und kein Schiff auf dem Meer sollte versäumen, als Erstes zu grüßen, wenn es einem französischen Schiff begegnete.
Er hatte verzichtet und gelitten. Doch seine Tränen hatten ihn hart und klarsichtig gemacht. Er wusste nun, dass er für alle immer nur der König sein würde: Ludwig XIV. Ludwig der Mensch interessierte niemanden. Ludwig XIV. beanspruchte es als sein königliches Recht, alle zu benutzen, und wusste, dass umgekehrt alle das Gleiche bei ihm versuchen würden.
Seine künftige Gemahlin war die einzige Unbekannte in dieser Rechnung. Immer wieder betrachtete Ludwig das kleine Porträt, das man ihm von ihr geschickt hatte. Es war kein Geheimnis, dass die meisten Bilder dieser Art geschmeichelt waren. Doch auf feststehende Tatsachen, wie etwa die Haarfarbe, konnte man sich wohl verlassen. Auch den Herzog von Gramont befragte er. Gramont hatte als Sonderbotschafter dem spanischen König Ludwigs Heiratsersuchen offiziell überbracht. Bei der Audienz war er auch der Infantin begegnet. Nach spanischer Sitte durfte er, wie er Ludwig verlegen gestand, den Saum ihres Kleides küssen. „Sie ist nicht sehr groß“, berichtete er Ludwig, was dieser sofort als „ziemlich klein“ auslegte. „Sie hat ein längliches Gesicht um vollen Wangen und eine bezaubernd frische Gesichtsfarbe. Ihre Augen sind blau wie Saphire, und sie hat - wenn Majestät gestatten - einen energischen Mund.“
Ludwig wusste, was Gramont damit meinte. Die kräftige Unterlippe der Habsburger setzte sich in fast jeder Generation durch. Sie wurde schon gar nicht mehr als Schönheitsfehler angesehen, sondern vielmehr als Zeichen königlicher Abstammung. „Und Ihre Zähne?“ Unwillkürlich musste Ludwig an einen anderen Mund denken mit Zähnen so weiß, dass er manchmal gescherzt hatte, sie würden im Dunkeln leuchten.
„Verzeihung, Majestät, die Zähne habe ich nicht gesehen. Die spanischen Damen benehmen sich sehr zurückhaltend.“
Ludwig nickte, aber er war enttäuscht. Doch Gramont fiel noch etwas ein. „Ihr Haar, Majestät!“, rief er, froh, dass er doch noch etwas zu bieten hatte. „Die Infantin hat wundervolles goldblondes Haar, so dicht, dass es sich bestimmt nur mit Mühe zähmen lässt.“ Ludwig musste an seine Mutter denken. Vieles an Maria Theresia erinnerte ihn an sie. Das war wohl auch kein Wunder. Immerhin war Anna eine Tante ersten Grades ihrer künftigen Schwiegertochter, und auch davor waren die meisten Heiraten der spanischen Könige innerhalb der eigenen Familie geschlossen worden.
„Wie kleidet sie sich?“, fragte er. Er schätzte elegante Frauen. Auch bei sich selbst betrachtete er Eitelkeit als lobenswerte Eigenschaft.
Der Herzog zuckte die Achseln. „Ich fürchte, Majestät, die Spanier haben einen etwas anderen Geschmack als wir Franzosen“, antwortete er vorsichtig. „Eigentlich sind am spanischen Hof alle Damen in der gleichen Weise gekleidet. Alle in Schwarz und…..“, was er sagen wollte, war ihm sichtlich peinlich, „alle mit weiten Röcken. Sehr weiten Röcken, Sire, und sehr vielen Röcken darunter. Wenn ich so frei sein darf: Einer meiner Begleiter meinte, die spanische Mode lässt die Damen aussehen wie breite Tonnen, aus denen Pfähle emporragen.“ Er suchte verzweifelt nach einer Entschuldi-gung für die anschaulichen Worte, zu denen er sich verpflichtet gefühlt hatte.
Doch Ludwig lachte. „Das wird sich leicht ändern lassen, wenn die Infantin erst Königin von Frankreich ist, meinen Sie nicht auch, mein Freund?“
Gramont atmete auf. „Unbedingt, Sire!“, stimmte er zu. „Ihre Majestät wird mit ihrer Schönheit und Eleganz alle anderen Damen überstrahlen.“ Danach berichtete er von der hervorragenden Erziehung, die die Infantin genossen habe. Das Einzige, worauf leider verzichtet worden sei, sei die französische Sprache. „Ich nehme an, der lange Krieg war ein Grund dafür, Sire.“