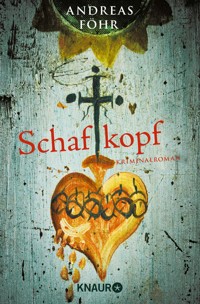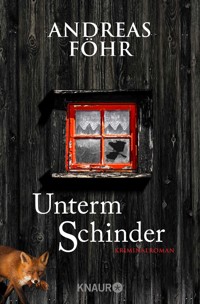
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wallner & Kreuthner Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein tödliches Geheimnis, eine ermordete Witwe und Kreuthners bewegte Vergangenheit: Teil 9 von Andreas Föhrs humorvoller Bayern-Krimi-Reihe um Wallner & Kreuthner von der Kripo Miesbach Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner hat sich etwas ganz Spezielles einfallen lassen, um eine äußerst attraktive neue Kollegin zu beeindrucken: einen nächtlichen Einbruch samt Schießerei, aus der Kreuthner die Neue heldenhaft retten wird. Das Ganze soll natürlich fingiert sein. Doch der abgelegene Hof, den er sich für seine Show ausgesucht hat, ist just in derselben Nacht Tatort eines wirklichen Verbrechens. Statt Platzpatronen fliegen dem Polizeiobermeister plötzlich echte Kugeln um die Ohren. Und dann gibt es auch noch eine Leiche in der Kühltruhe. Die Tote, Carmen Skriba, ist derweil keine Unbekannte für Kommissar Clemens Wallner: Vor zwei Jahren war sie Zeugin im Mordfall ihres Mannes. Wallner hatte damals schon das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Kann es wirklich Zufall sein, dass nun auch die Witwe ermordet wurde? Und was hat Kreuthners leiblicher Vater mit den Skribas zu schaffen? Die Krimi-Reihe aus Bayern von Bestseller-Autor Andreas Föhr begeistert mit intelligenten Fällen, schwarzem Humor und typisch bayrischem Lokalkolorit. Die Bayern-Krimis mit Wallner & Kreutner sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Prinzessinnenmörder - Schafkopf - Karwoche - Schwarze Piste - Totensonntag - Wolfsschlucht - Schwarzwasser - Tote Hand - Unterm Schinder
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Andreas Föhr
Unterm Schinder
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner hat sich etwas ganz Spezielles einfallen lassen, um eine äußerst attraktive neue Kollegin zu beeindrucken: einen nächtlichen Einbruch samt Schießerei, aus der Kreuthner die Neue heldenhaft retten wird.
Das Ganze soll natürlich fingiert sein. Doch der abgelegene Hof, den er sich für seine Show ausgesucht hat, ist just in derselben Nacht Tatort eines wirklichen Verbrechens. Statt Platzpatronen fliegen dem Polizeiobermeister plötzlich echte Kugeln um die Ohren. Und dann gibt es auch noch eine Leiche in der Kühltruhe.
Die Tote, Carmen Skriba, ist derweil keine Unbekannte für Kommissar Clemens Wallner: Vor zwei Jahren war sie Zeugin im Mordfall ihres Mannes. Wallner hatte damals schon das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Kann es wirklich Zufall sein, dass nun auch die Witwe ermordet wurde? Und was hat Kreuthners leiblicher Vater mit den Skribas zu schaffen?
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Danksagung
Prolog
Noch zeigte sich kaum Grün an den Trieben der Kastanie, und der Spitzahorn hatte Mühe, zum Leben zu erwachen. Der April war, anders als die Jahre zuvor, kalt und nass gewesen. An diesem Vormittag brannte die Sonne das erste Mal mit sommerlicher Wucht auf die Münchner Vorstadt nieder. Nick saß im Schatten des Sonnenschirms und telefonierte. Auf dem Gartentisch lag der Teil der Süddeutschen Zeitung mit den Gebrauchtwagenanzeigen. Nick wusste, welcher Wagen in welchem Zustand wie viel kosten durfte, welche Modelle gefragt waren und von welchen man besser die Finger ließ. Er war Gebrauchtwagenhändler. Allerdings nicht offiziell mit Autoplatz und Gewerbeanmeldung. Nick kaufte gebrauchte Fahrzeuge und verkaufte sie wieder – mit Gewinn, wenn es gut ging. Im Augenblick telefonierte er mit einer Frau, die den 911er ihres verstorbenen Mannes in die Zeitung gesetzt hatte. Sie wohnte in Landshut. Nick versprach, in zwei Stunden bei ihr zu sein. Die Sache war eilig, denn der Preis war günstig. Bald würden auch andere Händler Interesse zeigen. Nick hoffte, der Erste zu sein. Für solche Fälle hatte er Kaufvertragsformulare und 25.000 Mark in bar im Haus.
Langsam fuhr ein roter Wagen die stille Nebenstraße in Untermenzing entlang. Ein Transporter mit dem Logo einer Klempnerfirma. Nichts Ungewöhnliches. Dennoch verursachte der Anblick Nick ein flaues Gefühl im Magen. Der Wagen rollte jetzt fast lautlos am Haus vorbei. Ein Windstoß fuhr durch die trockenen Blätter der Buchenhecke und erzeugte ein hinterlistiges Rascheln. Geruch von Staub lag in der Luft.
»Über was denkst du nach?« Eine Hand mit türkis lackierten Fingernägeln und vielen Ringen hatte sich auf Nicks Schulter gelegt. Alina war hübsch, blond und dünn. Sie trug Jeans, die so eng waren, dass man sie nur als dünne Vierzehnjährige tragen konnte, dazu ein T-Shirt, verwaschen und grau mit verblichenem Aufdruck. Der Transporter war am Haus vorbeigefahren. Nick nahm die Hand seiner Tochter, entspannte sich wieder und überlegte, woher seine Unruhe kam. Weil er verschuldet war? Das konnte es nicht sein. Er hatte immer Schulden gehabt und lebte gut damit. Die Rollgeräusche des Wagens verstummten. Er hatte angehalten. Nick stand auf und ging zum Ende der Terrasse. Von dort aus konnte er die Straße ein paar Häuser weit einsehen. Der rote Transporter stand mit laufendem Motor vor dem übernächsten Grundstück. Ein weißes Licht leuchtete auf. Der Fahrer hatte in den Rückwärtsgang geschaltet.
»Was ist so interessant?«, fragte Alina.
»Nichts.« Nick kehrte zu seiner Tochter zurück. »Wolltest du nicht Tennis spielen?«
»Erst heute Mittag. Stör ich?«
»Nein. Überhaupt nicht.« Er nahm Alina in den Arm und hatte Angst um sie. Seit Claudias Tod vor vier Jahren kam die Angst immer öfter. Wenn er es recht bedachte, war sie seit einiger Zeit gar nicht mehr fortgegangen. Das war wohl der Grund seiner Unruhe.
»Ich hab da mal ’ne Frage«, sagte Alina, ging ins Haus und kam mit einem Paar Schuhen in der Hand wieder heraus. High Heels. Edel.
»Sind die etwa für mich?« Sie hielt ihm die Schuhe entgegen.
»Für wen sonst?«
»Du spinnst! Manolo Blahniks – die sind irrsinnig teuer.«
Nick zuckte mit den Schultern und lächelte. Alina legte ihre Arme – in jeder Hand einen Schuh – um seinen Hals.
»Danke. Die sind wirklich toll. Aber du musst das nicht machen.«
»Ich weiß.« Nick sah kurz in Richtung Straße. Es war seltsam ruhig geworden.
»Ich geh nach oben.« Alina gab ihrem Vater einen Kuss und verschwand. Nick sah ihr kurz nach, dann blickte er erneut um die Terrassenecke. Der rote Transporter hatte vor dem Haus geparkt. Nick ging nach drinnen.
Aus dem Fenster der Gästetoilette sah Nick die beiden Männer auf die Eingangstür zukommen. Sie checkten mit geübten, schnellen Blicken die Umgebung ab. Nach was? Nach versteckten Nachbarn hinter der Hecke, nach zufälligen Passanten, nach – Zeugen? In Nicks Magen verfestigte sich die Ahnung, dass etwas nicht stimmte. Normalerweise traten solche Leute auffällig in Erscheinung. Nicht mit Lieferwagen, sondern mit der schwarzen Limousine. Kein besorgter Blick nach Zeugen. Im Gegenteil – Zeugen waren erwünscht. Die Anwohner sollten sehen, wen ihr Nachbar zu Besuch hatte. Das erhöhte den Druck. Die Männer vor der Haustür trugen auch nicht die üblichen dunklen Anzüge, sondern Arbeitsoveralls, einer hatte eine Werkzeugtasche in der Hand. Ein Albino mit weißen Haaren, weißen Augenbrauen, durchsichtiger Haut und roten Augen. Alter schwer zu schätzen, um die dreißig. Nick hatte ihn noch nicht getroffen, aber von ihm gehört. Er hieß Jochen, war aber in humoriger Anspielung auf sein Äußeres als Blacky bekannt. Der andere war mittelgroß, drahtig, Mitte zwanzig, halblange braune Haare. Keine monströse Erscheinung, aber von einer aggressiven Ausstrahlung, die Mauern durchdrang.
Das Klingeln fuhr Nick wie ein Stromschlag durch die Eingeweide.
»Ja bitte?« Er betrachtete die beiden Männer vor der Haustür.
»Nick?«, sagte der mit den braunen Haaren.
»Ja …?«
»Wir kennen uns noch nicht. Aber das wird sich gleich ändern. Ich bin der Huser. So nennt man mich. Frag nicht, warum. Ist’n Spitzname. Das ist mein Partner, der Jochen. Den kennst du vielleicht schon.«
»Nicht persönlich. Aber hab von ihm gehört. Hallo, Jochen!«
Jochen nickte kurz, und der Huser sah interessiert ins Haus. »Willst du uns nicht reinbitten?«
»Äh … worum geht’s?«
»Ein gemeinsamer Freund schickt uns in einer … Angelegenheit. Aber sollen wir das wirklich an der Haustür besprechen?«
Nick zögerte, trat dann zur Seite und ließ die Besucher ein. »Geradeaus durch.« Im Wohnzimmer blieben der Huser und Jochen stehen. »Wir können auf die Terrasse gehen.«
»Ist wunderbar hier«, entschied der Huser und ließ sich auf die weiße Couch fallen. »Nicht schlecht!« Er musterte den Raum mit der neuen, sichtbar teuren Einrichtung.
»Alles nur gemietet. War möbliert.«
»Ah geh! Was zahlst du da so?«
»Im Augenblick gar nichts. Bin ein bisschen im Rückstand.«
»Hast du Geldprobleme?«
Nick zögerte. Der Huser kam ja schnell zur Sache.
»Komm, setz dich her. Ist immer so ungemütlich, wenn einer steht.« Nick setzte sich in einen Sessel. Jochen hingegen blieb an der Tür. Offenbar konnte er stehen, ohne dass es dem Huser ungemütlich wurde. Die Werkzeugtasche stand neben Jochen auf dem Boden, er selbst hatte die Arme vor der Brust verschränkt und starrte Nick an. Jochens Hände waren groß, und mehrere Ringe steckten an den Fingern. Es musste schmerzhaft sein, wenn er zuschlug. Unter dem Ärmel des Overalls war eine Tätowierung zu sehen, die vermutlich den gesamten Arm bedeckte.
»Was zu trinken?«
»Danke. Wir bleiben nicht lange.«
»Okay …« Einige Augenblicke, in denen der Huser die Örtlichkeit mit maschinenhafter Routine abscannte, wurde nichts gesprochen.
»Pass auf«, beendete der Huser das Schweigen und tat so, als suche er die rechten Worte für das, was er jetzt sagen musste, weil das nämlich nicht sehr angenehm war. »Du weißt, warum wir hier sind?«
»Du wirst es mir gleich sagen, vermute ich.«
»He komm, mach keinen Scheiß. Du weißt, warum wir … hier sind, oder? Warum sind wir hier?«
»Ich schulde jemandem Geld. Und der hat euch gebeten, dass ihr … euch drum kümmert.«
»Richtig. Und wer ist das wohl?«
»Sorry. Da kommen mehrere Leute infrage.« Nick war ziemlich sicher, dass Gerry die beiden geschickt hatte. Gerry war professioneller Geldverleiher, spezialisiert auf Wucherdarlehen für halbseidene Autodealer.
»O Scheiße!« Der Huser legte die Füße, die in schneeweißen Sneakers steckten, auf die Glasplatte des Couchtisches. »Er hat überall Schulden. Hast du das gehört?« Jochen, der angesprochen war, grunzte und schüttelte besorgt den Kopf. Der Huser wandte sich wieder Nick zu. »Ich erzähl dir mal was über unseren Auftraggeber: ein Mann, der zu ein bisschen Geld gekommen ist und es anlegen möchte, damit’s Zinsen bringt und er was fürs Alter zur Seite legen kann. Also sagt er sich: Warum geb ich’s nicht einem armen Kerl, der grad a bisschen in der Klemme steckt. Und der nur ein paar Riesen braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Und damit ist die Kohle bei dir. Und wie er dann fällig ist, der Kredit, da kriegt unser Mann zu hören: Geht grad nicht, aber in zwei Wochen, da hab ich den Schotter. Muss nur noch den Mercedes verkaufen. Und in zwei Wochen hat das mit dem Mercedes irgendwie nicht hingehauen. Aber am Monatsende, da gibt’s dann Geld. Und so weiter und so weiter. Das geht jetzt schon fast ein Jahr. Und unser Auftraggeber, was glaubst’, was der für einen Eindruck hat?«
»Ich weiß, da ist einiges schiefgelaufen, aber …«
Der Huser brachte Nick mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Ich sag’s dir: Der Mann hat den Eindruck, dass du ihn über den Leisten ziehen willst.«
»Das stimmt nicht. Ich war einfach ein bisschen klamm.«
»Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man die Bude hier sieht.« Der Huser zog eine kleine Kamera aus dem Jackett und hielt sie in die Luft. »Ich mach mal Fotos. Damit er sieht, wo sein Geld geblieben ist.«
»Das gehört mir alles nicht. Außerdem … scheißegal. Pass auf: Ihr kriegt die Kohle.«
»Richtig«, sagte der Huser. »Und zwar jetzt.«
»Natürlich jetzt.« Nick stand auf, was zu erhöhter Körperspannung bei Jochen führte. Um keine unkontrollierten Attacken auszulösen, ging Nick betont langsam zu einem antiken Sekretär und öffnete ein Geheimfach, dem er einen braunen Briefumschlag entnahm. Den Umschlag brachte er dem Huser. Der öffnete ihn und ließ den Inhalt in seine Hand gleiten. Es war ein Packen Geldscheine, den er überschlägig durchzählte und dann auf den gläsernen Couchtisch warf. »Du willst mich verarschen, oder?«
Jochen kam jetzt näher und machte einen einsatzbereiten Eindruck.
»Ich weiß, das ist nicht die ganze Kohle. Aber ich hab doch nicht fünfzig Riesen in bar im Haus. Ich besorg sie euch.«
»Das ist sehr schade. Ich hab ein bisschen mehr erwartet. Aber ich sag dir was: Das war definitv das letzte Mal, dass du nichts im Haus hast, wenn wir kommen.«
»Ihr hättet anrufen sollen. Dann hätt ich …« Der Satz erstarb im Würgegriff von Jochens Arm, der sich mit einem Mal um Nicks Hals gelegt hatte. Nick spannte seine Muskeln an, so fest er konnte, denn Jochen drückte mit einer Kraft zu, dass Nick fürchtete, er würde ihm das Genick brechen. Schweiß perlte auf seiner Stirn, und er versuchte, Jochens Arm mit den Händen vom Hals wegzudrücken. In Anbetracht der Dicke dieses Arms ein nachgerade albernes Unterfangen. Der Huser stellte sich vor Nick und sah ihm in das schmerzverzerrte, angestrengte Gesicht.
»Du bist leider der vergessliche Typ. Einer von denen, die sich fünf Minuten später schon nicht mehr erinnern, was ausgemacht war.«
»Ich vergess es nicht, ich schwör’s!«, ächzte Nick, er schwitzte am ganzen Körper vor Anstrengung und Angst.
»Nein. Natürlich vergisst du es nicht. Wir lassen dir nämlich eine – wie sagt man – Erinnerungshilfe da. Quasi einen Knoten im Taschentuch. Hast du ein Taschentuch? Ich meine, ein richtiges, aus Stoff?«
Nick schüttelte den Kopf, es war mehr ein Zittern.
»Keiner hat mehr Taschentücher heutzutage. Und weißt du, warum? Weil keiner mehr Stil hat. Es gibt keinen Stil mehr! Schade. Früher hat man noch Taschentücher gehabt. Wie unsere Mütter. Andererseits – meine Mutter hat immer draufgespuckt und mir dann irgendwas aus dem Gesicht gewischt. Boah! Das war ekelhaft. Hat das deine Mama auch gemacht?«
Nicken war nicht möglich, da Nicks Kopf fest in der Armbeuge von Jochen fixiert war.
»Also kein Taschentuch.«
Nick stöhnte und atmete schwer. Das Überleben in Jochens Arm war anstrengend.
»Du, macht nichts. Wir brauchen kein Taschentuch für deine Erinnerung. Das geht auch anders. Gib mir deine Hand.«
Der Huser hatte mit einem Mal eine Kneifzange in der Hand. Das setzte ungeahnte Kräfte in Nick frei. Er wand sich wie ein Aal, und fast wäre er Jochens Griff entkommen. Der ließ Nick tatsächlich los, jedoch nur, um ihn am Kragen zu packen und mit einer kraftvollen Bewegung auf den Boden zu schleudern, wo Nick versuchte wegzukriechen. Aber Jochen warf sich mit der gesamten Wucht seiner imposanten Erscheinung auf den Fliehenden, drückte ihn zu Boden und umfasste mit erbarmungsloser Kraft seinen linken Arm. Der Huser kniete sich neben Nick.
»Hör auf mit dem Scheiß. Ihr kriegt euer Geld. Ich schwör’s!«
»Du schwörst?«, sagte der Huser mit hörbarer Erheiterung. »Die haben dich doch mal wegen Meineid verknackt, oder hat mich da jemand veralbert?«
Der Huser ergriff jetzt Nicks linke Hand, die er zu einer Faust geballt hatte, und versuchte, einen Finger daraus zu lösen. »Jetzt stell dich nicht so an. Sonst nehmen wir die ganze Hand. Ist dir das lieber?«
»Hör auf! Du musst das nicht machen. Du kriegst die scheiß Kohle. Ich schwör’s beim Leben …«
»Welches Leben?«
Mit einem Mal ließ der Huser Nicks Hand los. Etwas war passiert, und Nick hatte das sichere Gefühl, dass der Albtraum jetzt erst begann.
»Das Leben deiner … Tochter?« Der Huser beendete die Frage mit einem spöttisch-hicksenden Lacher und stand auf.
»Wen haben wir denn da?«
In der Tür zum Wohnzimmer stand Alina. Die Augen weit aufgerissen, starrte sie auf die zwei Männer, die ihrem Vater gerade einen Finger abschneiden wollten. Der Huser gab Jochen ein Zeichen, Nick loszulassen, und half ihm beim Aufstehen.
»Du bist Alina, gell?« Der Huser klopfte Nick auf die Schulter. »Die hast du gut hingekriegt. Kompliment. Hätt ich dir gar nicht zugetraut.«
Der Huser ging zu Alina. Nick hauchte ein kaum hörbares »Lass sie.«
»Na, Alina hast du Lust auf einen Ausflug?«
Kurz bevor der Huser bei ihr angelangt war, drehte sich Alina weg und wollte zur Haustür laufen. Aber ehe sie sichs versah, hatte der Huser ihren Arm gegriffen. »Du bleibst gefälligst da, wenn ich mit dir rede, hast du verstanden?«
Nick wollte seiner Tochter zu Hilfe kommen, aber Jochen nahm ihn wieder in den Schwitzkasten. Das wiederum lenkte den Huser für einen Moment ab, den Alina nutzte, um ihn anzuspucken und ihren Arm loszureißen. Diesmal bekam der Huser ihre langen Haare zu fassen, riss sie nach hinten, gab ihr eine Ohrfeige, die Alinas Kopf mit Wucht zur Seite schleuderte. Sie stolperte, fiel und prallte im Fallen mit dem Kopf gegen das Telefontischchen. Dort blieb sie leblos liegen.
Es wurde für einen Augenblick sehr still. Nick starrte auf seine Tochter am Boden und flüsterte: »Du hast sie umgebracht …«
1
Ein Albtraum war Wirklichkeit geworden. Ein verwirrter, alter Mann hatte sich an einem kalten Herbsttag nur mit Unterhose bekleidet in das eiskalte Wasser des Schliersees gestürzt. Das war schlimm, aber noch nicht der Albtraum. Der zufällig anwesende Polizeihauptmeister Tobias Greiner hatte sich, als er der Situation gewahr wurde, ohne Zögern in den See geworfen, den panisch um sich schlagenden Greis an Land gezogen und ihm das Leben gerettet. Das war der Albtraum. Jedenfalls für Greiners Kollegen Leonhardt Kreuthner, gut fünfzehn Jahre älter, aber immer noch im niedrigeren Rang eines Polizeiobermeisters. Laut Presseberichten war der Gerettete an Land wegen Unterkühlung in die Bewusstlosigkeit gefallen, konnte im Krankenhaus aber wieder so weit hergestellt werden, dass man ihn noch am selben Tag nach Hause brachte. Greiner hingegen wurde in der Lokalzeitung und im Internet als Held vom Schliersee abgefeiert. Allein das hätte Kreuthner genügt, um ein Magengeschwür zu entwickeln. Doch es kam noch schlimmer …
»Warum halten wir?«
Kreuthner deutete mit dem Kinn durchs Wagenfenster in die Nacht hinaus. Hundert Meter entfernt stand ein Bauernhaus, beschienen vom Streulicht einer Straßenlaterne. Kein stolzes Anwesen mit geschnitzten Balkonen rundherum und Bundwerk an den Stallwänden, wie viele andere Höfe in Festenbach. Die Balkone waren größtenteils abgefallen, und der Rest sah genauso heruntergekommen aus.
»Was ist mit dem Haus?« Lisa war Polizeianwärterin und hatte seit ihrem Erscheinen in Miesbach einiges durcheinandergebracht. Vor allem die männlichen Kollegen. Ihr Mund war riesig, die halblangen Haare blond, und in ihrem Lachen lag ein über zwei Jahrzehnte gereiftes Vertrauen, dass Männer alle möglichen Torheiten begehen würden, um ihr zu gefallen.
»Der Bewohner is im Krankenhaus«, sagte Kreuthner. »Ein Herr Pirkel. Das weiß jeder hier im Ort. Mir schauen einfach, dass keiner Dummheiten macht, solange der Schuppen leer steht.«
»Woher kennst du Herrn Pirkel?«
»Ich mach den Job schon a paar Wochen. Da lernst a Menge Leut kennen.«
»Also du kennst ihn beruflich?«
Kreuthner dachte kurz nach. »Nein«, sagte er schließlich und blickte konzentriert zu dem Haus. Aber da rührte sich nichts.
»Woher kennst du ihn dann?« Lisa zog die Augenbrauen hoch. »Also, wenn’s nicht zu privat ist.«
»Kann man so oder so sehen. Es heißt, er wär mein Vater.«
Lisas großer Mund blieb kurz offen. Kreuthner sah die kleine Lücke zwischen ihren oberen Schneidezähnen und fragte sich, wieso das bei Männern bescheuert aussah und bei Lisa so unfassbar sexy.
»Es heißt? Ich meine … wer sagt das? Und was sagt Herr Pirkel dazu?«
»Meine Mutter hat des g’sagt. Und Herr Pirkel sagt, des könnt sie gar net wissen, weil meine Mutter hätt’s damals so krachen lassen, die hätt da gar keinen Überblick mehr. Is a ganz a Netter, der Herr Pirkel.«
»Hört sich so an.« Lisa sah zum Haus. »Und wieso bewachst du dann sein Haus?«
»Is mein Job.« Kreuthner zuckte, um größtmögliche Lässigkeit bemüht, mit einer Schulter.
»Aber wir müssen nicht die ganze Nacht hier stehen?«
»Nein.«
Natürlich nicht. Aber fahren konnten sie jetzt auch nicht. Kreuthner schaute unauffällig auf die Uhr. Es wurde langsam Zeit, dass sich was tat im Haus. Hatte Sennleitner die Sache verschwitzt? Konnte eigentlich nicht sein. Als sie vorgestern den Plan schmiedeten, war Sennleitner maximal bei der siebten Halben, also noch nüchtern. Hatte Kreuthner sich selber vertan? Ausgeschlossen. Es war heute ausgemacht, und Sennleitner kannte das Haus.
Kreuthner hatte ein Auge auf Lisa geworfen, auch wenn klar war, dass da wenig gehen würde. Sie war mehr als zwanzig Jahre jünger und spielte in einer anderen Liga als alle ihre Polizeikollegen. Nur hielt das niemanden davon ab, um sie herumzugockeln und sich zum Deppen zu machen. Die weiblichen Mitarbeiter sahen es mit Kopfschütteln und machten die eine oder andere spitze Bemerkung dazu. Aber das half nichts. Bei dem Wettrennen, das ausgebrochen war, hatte jetzt Greiner nach seiner Rettungstat die Poleposition ergattert. »He, du bist ja ein richtiger Held« – mit diesen Worten hatte ihn Lisa bei seiner Rückkehr in die Polizeistation begrüßt, und es lag echte Bewunderung darin. Und wie sie ihm mit der Hand halb scherzhaft, halb mit echter Fürsorge über die immer noch feuchten Haare gestrichen hatte – dieses Bild war ein glühender Dolch in Kreuthners Herz. Es musste also was passieren. Denn Greiner war nicht nur Mitbewerber um Lisas Gunst, sondern seit Jahren Kreuthners Erzfeind – und umgekehrt.
Zunächst hatte Kreuthner nachgeforscht, was bei der Rettungsaktion wirklich abgelaufen war, und was er herausfand, ließ die Angelegenheit in einem etwas anderen Licht erscheinen. So war der alte Mann bei seiner Rettung keineswegs mit einer Unter-, sondern mit einer Badehose bekleidet gewesen. Denn er hatte, wie seine Enkelin Kreuthner erzählte, seit siebenundfünfzig Jahren die Gewohnheit, jeden Tag, an dem der Schliersee nicht zugefroren war, ein Bad darin zu nehmen. Die Bewusstlosigkeit des alten Herrn kam auch nicht von einer Unterkühlung, sondern von einem großen Stein am Ufer, auf dem der Kopf aufgeschlagen war, als Greiner den sich empört Wehrenden an Land schleifte. Die Familie konnte den Geretteten gerade noch davon abbringen, Anzeige zu erstatten. Eine hübsche Geschichte, um Greiner der Lächerlichkeit preiszugeben. Leider wäre da ein arges G’schmäckle von Kollegenneid gewesen, hätte Kreuthner die Sache aufgedeckt.
Es blieb ihm nur, Greiners Heldentat mit einem eigenen Husarenstück zu übertreffen. Und das hatte Kreuthner heute Abend vor. Sein Freund und Polizeikollege Sennleitner war für fünfzig Flaschen von Kreuthners schwarz gebranntem Obstler bereit gewesen, den Schurken zu spielen. Jetzt musste er nur langsam in Erscheinung treten. Doch nichts rührte sich in dem alten Bauernhaus. Kreuthner beschloss, unter einem Vorwand den Wagen zu verlassen und Sennleitner anzurufen. Der bräuchte höchstens eine Viertelstunde, um herzukommen. In der Zwischenzeit würden sie noch eine Runde mit dem Streifenwagen drehen und wieder vorbeischauen, wenn Sennleitner Position bezogen hatte.
»Ich muss mal kurz raus.« Kreuthner deutete nach draußen in Richtung einer großen, alten Linde.
Lisa starrte zum Haus und hatte anscheinend nicht zugehört. »Da ist was«, flüsterte sie.
Tatsächlich. Ein Licht wischte an einem der Fenster vorbei. Der Strahl einer Taschenlampe. Dann wurde es wieder dunkel, und das Licht zuckte hinter einem anderen Fenster auf.
»Okay«, sagte Kreuthner.
»Okay?« Lisa sah Kreuthner erstaunt an. »Was genau heißt … okay?«
»Wir schauen uns das mal an.« Er stieg aus dem Wagen. Lisa ebenfalls. »Waffe griffbereit?« Kreuthner entsicherte seine eigene Pistole.
»Meinst du, wir brauchen die?«
»Das sehen wir dann.«
Lisa nickte besorgt, zog die Pistole aus dem Halfter und zielte mit beiden Händen in die Nacht. Kreuthner legte die Hand auf ihren Arm und drückte ihn nach unten.
»Bleib dicht hinter mir!«
Bis zum Haus waren es gut fünfzig Meter. Sie liefen auf die Südwand zu. Es war die breite Seite. Rechts befand sich der Wohntrakt, links der Stall, der zwei Drittel der Länge einnahm. Das Gebäude war alt und vernachlässigt. Der letzte Anstrich musste Jahrzehnte zurückliegen. Kreuthner bewegte sich in Richtung einer Eingangstür. Dahinter lag, wie er wusste, der Flur, der das Gebäude in seiner Breite durchschnitt. Erneut flackerte im Haus ein Licht auf.
»Sollen wir Verstärkung holen?« Lisas Stimme hörte sich wackelig an, die Aufregung war ihr in den Hals gekrochen.
»Am End is es nur der Nachbar, der nach dem Rechten schaut. Übertreiben ma’s net.« Kreuthner suchte hinter einem alten Kirschbaum Deckung und gab Lisa ein Handzeichen, sich hinter ihn zu stellen. Sie waren noch zehn Meter vom Haus entfernt. »Ich geh da jetzt rein und schau, was los ist.«
»Und ich?«
»Du bleibst draußen. Wenn ich erschossen werde, musst du den Burschen verhaften.«
Lisa sah Kreuthner mit weit aufgerissenen Augen an und brachte kein »Ja«, kein »Okay«, nicht mal ein Nicken zustande. Die Angst schien sie zu lähmen.
Kreuthner klopfte ihr, begleitet von einem warmen Blick, auf den Oberarm. »Keine Angst. So weit lass ma’s net kommen.« Dann drückte er die Pistole in ihrer zitternden Hand erneut sanft nach unten, denn diesmal zeigte sie auf seine Körpermitte. »Wär super, wennst mich net vorher erschießt.«
»Entschuldige!« Sie lachte dünn.
Auch Kreuthner lachte. Dann ließ er seine Waffe einmal um den Zeigefinger rotieren und schob sie in der Manier eines Terence Hill ins Holster zurück. Ein letztes Mal drehte er sich zu Lisa, deutete mit Zeige- und Mittelfinger auf seine Augen, anschließend nur mit dem Zeigefinger auf das Haus, was wohl bedeuten sollte, behalt alles im Auge für den Fall … Nun ja, was immer es bedeutete, es sah jedenfalls sehr cool aus. Dann machte sich Kreuthner zielstrebig, aber nicht hastig auf den Weg zur Haustür, dabei immer ein wachsames Auge auf die Umgebung werfend.
Das Einzige, was Kreuthner in diesem Moment Sorge machte, war Sennleitner. Sie hatten nicht genau durchchoreografiert, was sie da inszenieren wollten. Sennleitner hatte gemeint, das werde er schon hinbekommen. Ein paar Schüsse aus der Schreckschusspistole, Kreuthner würde zurückfeuern, und am Ende der Veranstaltung würde er sich schützend vor Lisa werfen, während Sennleitner das Weite suchte. Was aber, wenn Sennleitner es so dumm anstellte, dass sich Lisa angegriffen fühlte und auf ihn schoss? Nervös, wie sie war, würde sie sowieso nichts treffen. Aber wer weiß – ein Querschläger in Sennleitners Bein, und schon hätte man massive Probleme.
Kreuthner blickte sich zu Lisa um, als er die Klinke der Flurtür nach unten drückte. Sie war, wie er wusste, nicht abgeschlossen. Lisa schien vor Spannung den Atem anzuhalten. Er nickte ihr zu und hielt einen Daumen nach oben. Dann verschwand er im Haus.
Durch die Milchglasscheibe der Haustür drang nur das wenige Licht herein, das die Straßenlaterne spendete. Kreuthner brauchte eine Weile, bis er zumindest Umrisse erkennen konnte. Wo war jetzt Sennleitner? Er könnte sich ja mal bemerkbar machen.
»Wo steckst du denn?«, flüsterte Kreuthner ins Dunkel hinein.
Als Antwort kam ein Rumpeln hinter einer der Türen, die von den Zimmern auf den Flur gingen.
»Auf geht’s!«, rief Kreuthner tonlos zu der Tür. »Mach ma a bissl Action!« Nichts rührte sich. »Du kommst jetzt raus und haust nach hinten ab. Durch die Tür zum Hof raus. Alles klar?«
Kreuthner wartete auf Antwort. Die kam aber nicht. Zumindest nicht verbal. Stattdessen zerriss ein scharfer Knall die Stille. Sennleitner hatte aus einem der Zimmer links vom Gang geschossen, wie Kreuthner am Mündungsfeuer sehen konnte. Na endlich! Kreuthner schoss zweimal in die Decke, worauf von Sennleitner wieder ein Schuss abgegeben wurde. Sie sollten es nicht übertreiben, überlegte Kreuthner. Er musste über jede Patrone Buch führen. Falls man den Tatort hier näher durchsuchte, würde man feststellen, dass es nur Einschüsse von seiner Waffe gab. Aber dann blieb immer noch die Erklärung, der Einbrecher habe nicht mit scharfer Munition geschossen. Das ließ sich ja in dieser hektischen Situation und nachts kaum auseinanderhalten. Kreuthner hätte dann zumindest in Putativnotwehr gehandelt. Noch während ihm dieser Gedanke durch den Kopf ging, schoss Sennleitner erneut. Diesmal ging die Scheibe in der Eingangstür hinter Kreuthner zu Bruch. Kreuthner war verwirrt, vor allem aber alarmiert.
»Ja ham s’ dir ins Hirn g’schissen!«, zischelte er in Richtung des Kollegen und hoffte, dass Lisa es nicht durch die jetzt scheibenlose Tür mitbekam. »Du kannst doch net mit scharfer Munition …«
Weiter kam er nicht, der nächste Schuss zerfetzte den Stromzähler an der Wand über ihm. Kreuthner, langsam verärgert, schoss zurück, allerdings in sicherer Höhe. Kreuthner sah schemenhafte Bewegungen in der Dunkelheit und hörte dumpfe Schritte. Sennleitner rannte den Gang entlang zur Tür auf der Nordseite, die kurz darauf tatsächlich aufgerissen wurde. Kreuthner lief hinterher.
Draußen auf dem Hof sah er eine Gestalt in die Nacht laufen.
»Halt! Stehen bleiben! Polizei!« Kreuthner gab noch einen Warnschuss ab, worauf sich der Flüchtende hinter einen alten Traktor warf, der neben dem Wirtschaftsgebäude stand. Kreuthner lief ebenfalls in Richtung des Traktors. An der Ecke des Haupthauses stieß er fast mit Lisa zusammen, die ihm zu Hilfe kommen wollte.
»Obacht!« Kreuthner stellte sich vor Lisa, um sie am Weiterlaufen zu hindern. »Der Bursch is g’fährlich.«
Wie zur Bestätigung dieser Warnung wurde hinter dem Traktor ein Schuss abgegeben. Kreuthner riss Lisa zu Boden und legte sich über sie. Der nächste Schuss traf einen Fensterladen im ersten Stock, der schon vorher nur schepps an einem Scharnier gehangen hatte und nach dem Treffer endgültig der Schwerkraft nachgab. Auf dem Weg nach unten kollidierte er mit einem Balkonbalken, der – seiner Funktion beraubt, denn Brüstung und Boden waren vor Jahren abgefallen –, einsam aus der Hausmauer stak, was den Fensterladen auf eine Flugbahn umlenkte, die genau durch Kreuthners Dienstmütze führte. Es rummste dumpf und hölzern, Kreuthners Glieder wurden schlaff, und seine Wahrnehmung setzte aus.
2
Als Kreuthner die Augen wieder aufschlug, war Lisas großer Mund mit der kleinen Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen das Erste, was er sah. Dieser Augenblick hätte, wäre es nach Kreuthner gegangen, bis in alle Ewigkeit dauern können. Auch der zweite Augenblick, als Lisa »Gott sei Dank! Du lebst!« hauchte, war durchaus in Ordnung. Ab da ging es jedoch bergab mit Kreuthners Befindlichkeit. Zuerst stellten sich heftige Kopfschmerzen ein, dann der Verdacht, dass bei der ganzen Sache etwas abscheulich schiefgelaufen war.
»Ich hab Verstärkung angefordert«, sagte Lisa. »Bleib liegen, du hast wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung«, schickte sie nach, als er aufstehen wollte.
»Wo ist der Kerl?«, fragte Kreuthner.
»Na ja, ich hab ihn …« Lisa zögerte.
»Was? Erschossen?« Kreuthner schwanden fast erneut die Sinne vor Entsetzen. Gedanken jagten ihm wie Flipperkugeln durchs Gehirn: Das Mädchen hatte Sennleitner umgebracht, und er, Kreuthner, war schuld! Andererseits – Sennleitner hatte scharf geschossen. Das war so nicht verabredet gewesen. Also war eigentlich Sennleitner selber schuld. Das änderte freilich nichts daran, dass Kreuthner jetzt bis über beide Ohren in Schwierigkeiten … Mitten in dieses Synapsenfeuerwerk hörte er Lisas Stimme: »Ich hab ihn entkommen lassen. Tut mir leid.«
Kreuthner ließ sich, plötzlich unendlich erleichtert, nach hinten sinken, zuckte aber sofort wieder hoch, als sein Hinterkopf den Boden berührte.
»Der Fensterladen hat dich erwischt.«
»Fensterladen?« Kreuthner ertastete eine riesige Beule.
Lisa deutete auf ein flaches, verwittertes Stück Holz mit grünen Farbresten und einem herzförmigen Loch in der Mitte, das ein paar Meter entfernt auf dem Boden lag.
»Der ist da irgendwo runtergefallen.« Sie zeigte mit dem Daumen zur Hauswand hinter sich.
Kreuthner stand ächzend auf und wehrte Lisas Versuche ab, ihn zum Liegenbleiben zu bewegen. »Geht schon.« Er säuberte mit ein paar Handschlägen seine Uniform. »Wo ist er hin?«
Lisa deutete Richtung Wirtschaftsgebäude. Dann hielt sie Kreuthner eine durchsichtige Plastiktüte der Spurensicherung vors Gesicht. Darin befand sich etwas Zerknülltes, Schmutzig-Weißes.
»Ein Papiertaschentuch. Hat der Einbrecher wahrscheinlich auf der Flucht verloren. Ich hab’s hier im Hof liegen sehen.«
»Gut gemacht! Super!« Kreuthner rutschte das Herz in die Hose. Wenn Sennleitner da reingerotzt hatte – und was sollte er sonst mit einem Papiertaschentuch getan haben –, konnte man literweise DNA sicherstellen. Und da Sennleitners DNA wie die aller Polizisten gespeichert war, würde man ihn sofort identifizieren.
»Vielleicht ist der Kerl in einer Datenbank gespeichert.« Lisa machte große Augen. »Dann haben wir ihn.«
»Wenn das Taschentuch tatsächlich von ihm ist.« In Kreuthners schmerzendem Kopf nahm bereits ein Notfallplan Gestalt an.
»Ich glaube, hier waren in letzter Zeit nicht so viele Leute«, hielt Lisa dagegen.
»Wahrscheinlich nur wir.« Kreuthner nahm ihr die Tüte aus der Hand. »Ich hol mir was gegen die Kopfschmerzen. Du hältst die Stellung. Die Verstärkung muss ja gleich da sein.«
Im Dienstwagen schnäuzte Kreuthner zunächst einmal in ein eigenes Papiertaschentuch und steckte es in eine andere, aber identisch aussehende Spurensicherungstüte. Die von Lisa sichergestellte Originalprobe verbarg er in der Innentasche seiner Jacke, um sie später zu vernichten. Im Handschuhfach fand er eine Packung Aspirin, nahm drei Stück und kehrte zu Lisa zurück.
»Die brauchen noch. Hat einen Unfall auf der B 472 gegeben. Ich hab auch gesagt, sie sollen die Spurensicherung schicken.« Lisa steckt ihr Handy ein. »Was machen wir inzwischen?«
Kreuthner hätte die Sache am liebsten unter dem Deckel gehalten. Aber das war bei einer Schießerei schwer möglich.
»Wir schauen uns mal am Tatort um.«
»Sicher?« Lisa sah ihn skeptisch an. »Ich dachte, das müssen wir der Spurensicherung überlassen.«
»Wir müssen schon vorsichtig sein. Aber vielleicht liegt da jemand verletzt im Haus.«
Lisa hatte recht. Tatorte sollten zuerst von der Spurensicherung untersucht werden. Wer immer sonst an einem Tatort herumspazierte, lief Gefahr, Spuren zu vernichten oder zu kontaminieren. Aber Kreuthner musste sich unbedingt in dem Haus umsehen. Am Ende hatte Sennleitner noch andere Hinweise auf sich hinterlassen. So dumm, wie er sich angestellt hatte, war das sogar sehr wahrscheinlich.
Der Geruch von Schießpulver hing in der Luft, als Kreuthner und Lisa den Hausflur betraten. Kreuthner wollte das Licht einschalten. Es blieb aber dunkel. Vermutlich hatte Pirkel seine Stromrechnung nicht mehr bezahlt, nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert worden war.
»Schau mal in der Küche nach.« Kreuthner deutete auf eine Tür am Ende des Ganges. Während Lisa sich mit ihrer Taschenlampe auf den Weg machte, trat Kreuthner in das Zimmer, aus dem Sennleitner vorhin die Schießerei eröffnet hatte. Scherben knirschten unter seinen Stiefeln. Es war das Wohnzimmer. Die Einrichtung bestand aus denjenigen von Pirkels Möbeln, die nicht zum Pfänden taugten. Eine zerschlissene Stoffcouch aus den Siebziger-, wenn nicht Sechzigerjahren. Die Farbe war im Kunstlicht der Taschenlampe schwer zu erkennen. Nach Kreuthners Erinnerung war sie senfgrün. Ein kleiner Flachbildschirm mit Riss in der Scheibe stand auf einem Hocker, an dem helle Farbreste klebten. Er hatte vermutlich mal als Leiter bei Malerarbeiten gedient. Die Bodendielen waren staubig und in der Mitte des Raums mit einem Perserteppich bedeckt, der mehr kahle Stellen als Muster besaß. Auch der Rest der Einrichtung war alt und abgestoßen, und überall standen leere Bierflaschen.
»In der Küche ist nichts. Stinkt nur ziemlich.« Lisa war hinter Kreuthner getreten. »Hier ist auch niemand, oder?«
Kreuthner schwenkte die Taschenlampe und überlegte, unter welchem Vorwand er Lisa rausschicken konnte.
»Was ist das?«
Kreuthner ließ den Lichtstrahl zurückwandern. Er war über etwas Großes, Weißes geglitten – eine Tiefkühltruhe, wie sich herausstellte. Der Deckel war geschlossen, und auch sonst sah das Gerät unauffällig aus – abgesehen von dem Umstand, dass es sich in einem Wohnzimmer befand. Aber Pirkel war seit jeher als kauzig bekannt.
»Vielleicht wollte der Einbrecher eine Leiche einfrieren«, hauchte Lisa.
»Dann hätt er Pech g’habt. Der Strom is aus.«
Während Kreuthner die Kühltruhe im Licht seiner Taschenlampe betrachtete, spürte er ein Kribbeln im Bauch. Irgendetwas war mit diesem Gerät. Nein, da waren weder eine gefrorene Leiche noch Körperteile drin. Und Pirkel hatte anscheinend daran gedacht, das Teil auszuräumen, bevor er ins Krankenhaus gegangen war. Sonst hätte man das nämlich gerochen. Kreuthner ging näher an die Truhe heran und etwas nach rechts, sodass er auch die Seite sehen konnte. Und jetzt entdeckte er etwas, das sein seltsames Gefühl bestätigte. Zwischen Deckel und Korpus war ein Stück roter Stoff eingeklemmt. Der Rest des Stoffs – was immer es war – befand sich in der Tiefkühltruhe.
»Oh«, sagte Lisa.
Kreuthner zückte sein Handy und machte ein Foto, damit man hinterher genau rekonstruieren konnte, wie sie die Truhe aufgefunden hatten. Dann streifte er sich Latexhandschuhe über. Von draußen hörte man Martinshörner näher kommen.
»Sollen wir das nicht der Spurensicherung überlassen?«, gab Lisa zu bedenken.
»Wenn da wer drin is«, Kreuthner streckte beide Hände in Richtung Kühltruhe, »dann is der bis dahin erstickt.«
Lisa nickte, starrte das Stückchen Stoff an und fühlte sich anscheinend nicht wohl bei dem Gedanken, das Geheimnis der Truhe zu lüften. Kreuthner hatte auch nicht vor, sie dabei sein zu lassen.
»Geh schon mal raus und sag den andern, wo mir sind.«
Er wartete, bis sie aus der Tür war, lauschte noch kurz ihren Schritten. Dann stellte sich Kreuthner vor die Kühltruhe und nahm vorsichtig eine Ecke des Deckels zwischen zwei Finger. Inzwischen kam ihm die ganze Angelegenheit äußerst seltsam vor. War das vorhin wirklich Sennleitner gewesen? Aber wer sonst? Was hätte ein Einbrecher hier verloren gehabt? Vielleicht ein Obdachloser auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Aber Obdachlose schossen höchst selten um sich. Er lüftete den Deckel ein wenig. Der Stoff zuckte kurz, dann schlüpfte er wie ein flinkes Tier in den Innenraum der Truhe. Kreuthner stemmte den Deckel ganz auf und ließ die Taschenlampe nach unten strahlen. Wie er jetzt sehen konnte, gehörte der Stoff zu einem Schal, der unordentlich auf einem roten Pullover lag, daneben, an der weißen Plastikwand der Truhe, ruhte eine Hand mit lackierten Fingernägeln, in der Ecke blickte der dazugehörige Kopf mit offenem Mund nach oben, eine schwarze Hornbrille hing quer über dem Gesicht. Es war das Gesicht einer Frau um die vierzig, gepflegt und dezent geschminkt. Selbst mit schiefer Brille hatte sie noch Stil, und es hätte ausgesehen wie die Szenerie für eine extravagante Brillenwerbung, wäre da nicht dieses Einschussloch in der Stirn gewesen.
»Oh …«, sagte jemand, der jetzt neben Kreuthner getreten war und ebenfalls in die Truhe schaute. Es war Benedikt Schartauer, ein jüngerer Kollege von Kreuthner.
3
Wallners Großvater Manfred hatte, einer nostalgischen Lust nachgebend, Schaschlik gekocht. Etwas überwürzt, aber sonst nicht übel. Wallner erinnerte es an Kindheitstage und den Geruch, der damals in der Küche hing. In seiner Kindheit hatten sie oft Schaschlik gegessen. Heute gab es das so gut wie gar nicht mehr. Wallner tunkte gerade ein schon etwas zähes Semmelstück vom Vortag in die Soße, als ihn der Anruf erreichte.
»Jetzt noch?« Manfred ließ, offensichtlich verärgert über die Störung des besinnlich-nostalgischen Schaschlik-Events, den Löffel sinken. Wallner steckte das Telefon wieder in die Ladestation und kam aus dem Flur zurück.
»Ich find’s auch unpassend um die Uhrzeit. Aber die Verbrecher werden ja immer rücksichtsloser.« Wallner setzte sich wieder an den Tisch und aß, was auf seinem Teller war, hastig auf. »Wird spät werden.«
»Den Abend hab ich mir offen g’sagt anders vorgestellt«, maulte Manfred.
»Ob ich beim Fernsehen danebensitze oder nicht, ist doch einerlei. Du redest ja eh nichts.«
»Aber wenn ich was net richtig g’hört hab, kann ich dich fragen.«
»Dann mach den Fernseher halt lauter.«
»Kommt eh nur Schmarrn. Da muss ich mich net auch noch anschreien lassen.«
Wallner brachte seinen Teller zur Geschirrspülmaschine. »Du bist heute irgendwie nörgelig drauf, kann das sein?«
»Gar net. Ich hab mich nur drauf eingerichtet, dass mir den Abend zu zweit verbringen.«
»Es geht halt nicht. Dienst ist Dienst.«
»Du musst da gar net hin. Ihr habt’s doch an Nachtdienst.«
»Es ist immer besser, wenn man den Tatort selbst gesehen hat. Vor allem bei Mord. Und in den ersten Stunden gewinnt man auch die meisten Erkenntnisse.«
»Mach, wie du meinst. Wo is denn die Leich?«
»In Festenbach.«
»Dann kannst mich ja auf dem Weg in der Mangfallmühle vorbeibringen.«
Wallner dachte eine Sekunde lang, sich verhört zu haben.
»Mangfallmühle? Die Mangfallmühle?«
»Hast irgenda Problem damit?«
Wallner war nahezu sprachlos, dass sein Großvater dieses im ganzen Landkreis berüchtigte Lokal aufsuchen wollte. »Es … es ist halt nicht das beste Publikum da.«
»Der Kreuthner Leo is da, der Sennleitner. Alles Kollegen von dir.«
»Das widerlegt nicht unbedingt meine Bedenken. Abgesehen davon ist der Leo im Augenblick am Tatort.«
»Der kommt sicher noch vorbei. Bringst mich jetzt zur Mangfallmühle?«
Wallners Gesichtszüge verfielen in Resignation. »Nimmst du den Rollator mit?«
Es dauerte nur zehn Minuten von Miesbach bis Festenbach. Durch die zwei Kilometer Umweg über die Mangfallmühle brauchte Wallner aber zehn Minuten länger. Nachdem er Manfred dort abgeliefert hatte, musste er die B 472 Richtung Bad Tölz weiterfahren und bei einer einsam gelegenen Autowerkstatt links abbiegen. Nach einem weiteren Kilometer war Wallner in Festenbach. Er konnte die Blaulichter schon von der Werkstatt aus sehen. Es war Viertel vor acht Uhr abends, für die Jahreszeit zu warm, und zaghafter Regen fiel. Knapp hundert Meter vor dem heruntergekommenen Bauernhof, um den herum jetzt Leben tobte wie vermutlich schon lange nicht mehr, parkte Wallner. Beamte huschten im Blaulicht hin und her, uniformierte Polizisten spannten rot-weiße Flatterbänder, diskutierten mit Gaffern, die sich schon zahlreich eingefunden hatten, und aus einem Fenster des Hauses flutete ein gleißender Schein in die Oktobernacht, als hätte Maria dort soeben den Heiland geboren. Wallner vermutete einen Baustrahler der Spurensicherung hinter dem Lichtwunder.
Er parkte immer ein gutes Stück entfernt. Er musste wissen, wie es war, wenn man sich dem Tatort zu Fuß näherte, was man dabei sehen konnte, wer einen selbst dabei sehen konnte und was für einen Eindruck der Ort, an dem jemand sein Leben ausgehaucht hatte, beim Näherkommen machte.
Er kannte den Hof, der vor ihm lag. Er war im neunzehnten Jahrhundert von wohlhabenden Bauern errichtet worden und besaß eine etwas abseits gelegene eigene Kapelle. In deren Keller hatte Wallner 1992 eine Leiche entdeckt – zusammen mit Leonhardt Kreuthner. Beide waren damals Anfang zwanzig und am Beginn ihrer Polizeilaufbahn. Es war Wallners erster Mordfall gewesen.
»Mein lieber Schwan! Ganz schöne Beule!« Die Sanitäterin tupfte an Kreuthners Kopf herum. »Fensterladen oder wie?«
»Hm«, grunzte Kreuthner und versuchte, seine Gedanken zu sortieren.
»Da musst morgen zum Arzt. Der schreibt dich eine Woche krank, Minimum.«
»Hm.« Kreuthners Telefon klingelte. Es war Sennleitner.
»Du hast mich angerufen?« Sennleitners Stimme hatte etwas Dampfig-Alkoholisches. Betrunken war er nicht, aber auf dem Weg dahin. Offenbar hatte Sennleitner zwar gesehen, dass Kreuthner ihn angerufen hatte, die Box aber nicht abgehört. Sonst hätte seine Stimme schuldbewusster geklungen.
»Kann des sein, dass mir heut verabredet waren?«, flüsterte Kreuthner und sah zur Sanitäterin, die zu ihrem Wagen zurückgegangen war.
»War des heut?« Jetzt schwang so etwas wie schlechtes Gewissen in Sennleitners Obertönen.
»Ja, des war allerdings heut.«
»Verdammte Hacke! Mei … sorry, dann … dann mach ma die Show halt morgen. Wo steckst denn?«
»Da, wo mir uns verabredet ham. Ich wollt auch nur wissen, ob du tatsächlich net da warst.« Die Sanitätsfrau kam zurück.
»Des hast doch g’sehen, dass ich net da war …« Jetzt klang Sennleitner irritiert.
»Des war eben net so klar. Bei der Dunkelheit. Und so saublöd, wie der sich ang’stellt hat, des hättst fast du sein können.«
»Wer hat sich ang’stellt?«
»Obacht! Ich sprüh jetzt was auf die Wunde«, kam die Stimme der Sanitäterin von hinten. Dann ein scharfes Pfffft.
»Au!«
»Ich hab doch Obacht g’sagt.«
»Ja, ich hab’s g’hört. Es war nur – so plötzlich.«
»Was is denn da los?«, quäkte Sennleitner verzerrt aus dem Handylautsprecher.
»Also, du warst jedenfalls net da, wo … wo mir uns verabredet ham?« Kreuthner schielte zur Sanitäterin, ob die etwas argwöhnte. Die Frau war aber mit dem Auspacken eines Verbands beschäftigt, den sie wohl gleich um Kreuthners Kopf wickeln würde.
»Ja hast mich vielleicht g’sehen?«
Am Hauseingang sah Kreuthner Lisa, sie redete mit Tina von der Spurensicherung. »Muss jetzt Schluss machen. Wo bist’n?«
»In der Mangfallmühle.«
»Ich komm vielleicht nachher noch vorbei.«
Kreuthner drückte das Gespräch weg und stand auf.
»He! Da muss noch der Verband dran!«
Kreuthner ignorierte die Sanitäterin und stapfte auf Lisa zu. Dabei griff er in die Innentasche seiner Jacke. Das mit der Täter-DNA eingerotzte Papiertaschentuch war noch da und musste jetzt schleunigst wieder umgetauscht werden. An sich konnte er es gleich Tina geben. Aber dann hätte er erklären müssen, warum er es hinter Lisas Rücken gegen ein anderes ausgetauscht hatte.
»Servus Tina!« Kreuthner verzerrte sein Gesicht eine Millisekunde lang zu einem breiten Lächeln, dann wandte er sich an Lisa und nahm sie zur Seite. »Du, sag amal …« Er ging ein paar Schritte, bis sie aus Tinas Hörweite waren. »Dieses Papiertaschentuch, is des noch im Wagen?«
»Nein, das hab ich schon der Tina gegeben. Die war schwer begeistert.« Lisas Augenbrauen zuckten lustig nach oben.
»Ja, super. Wo … wo hat die Tina das Teil hingetan?«
Lisa zog die Schultern hoch.
Kreuthner nickte und ging zu Tina zurück.
»Die Asservaten san bei euch im Wagen?« Er sah zu dem alten, noch in Grün lackierten Transporter, den die Spurensicherungsleute benutzten.
»Ja, wieso?«
»Wollt nur kurz was nachschauen.«
»Wieso? Was willst denn nachschauen?« Tina kannte Kreuthner schon lange, und in diesem Moment dünstete etwas Unseriöses von ihm in die Nachtluft aus, und das sagte ihr, dass es möglicherweise keine gute Idee war, Kreuthner an die Beweisstücke zu lassen.
»He, Leo …«, sagte jemand von hinten. Es war Wallner. »Du sollst sofort wieder zur Sanitäterin gehen. Die hat nämlich keine Lust, dir mit ihrem Verband hinterherzulaufen.« Wallner warf einen Blick auf Kreuthners Hinterkopf. »Schaut ja furchtbar aus. Wie geht’s dir?«
»Is net so schlimm. Du, ich muss nur noch kurz was erledigen.« Er deutete auf den Wagen der Spurensicherung.
Wallner sah zu Tina. Von ihr kam die Andeutung eines Kopfschüttelns. Er packte Kreuthner am Arm. »Das kann warten. Du kriegst jetzt deinen Verband, und dabei können wir reden.« Er blickte zu Lisa. »Du warst auch dabei?« Lisa nickte. Wallner lud sie per Handzeichen ein mitzukommen.
Wallner, Kreuthner und Lisa saßen an einem Klapptisch im ehemaligen Heustadel des Wirtschaftsgebäudes. Heu wurde in diesem Raum nicht mehr gelagert. Dafür alle möglichen Dinge aus Metall, die Pirkel im Lauf von Jahrzehnten gesammelt hatte: Sensen, eine alte Tankstellen-Zapfsäule, mehrere Dutzend Traktorensitze, Verbrauchszähler für Wasser und Strom und tausend andere Dinge, von denen wahrscheinlich Pirkel selbst nicht mehr wusste, warum er sie behalten hatte. Einiges hatte man auf die Seite geräumt, damit die Ermittler eine Art Zentrale einrichten konnten. Im Haus selbst durfte sich im Augenblick nur die Spurensicherung bewegen.
»Hat er das Zeug damals schon gehabt?« Wallner bezog sich auf den ersten gemeinsamen Besuch, den er und Kreuthner dem Hof 1992 abgestattet hatten.
»Keine Ahnung. War seitdem nimmer da.« Kreuthner registrierte Lisas fragenden Blick. »War unsere erste Leich. In der Kapelle hinterm Haus.« Er deutete mit dem Kopf in die entsprechende Richtung.
Lisa nickte angemessen beeindruckt.
»Dein Vater ist gar nicht da?«, fuhr Wallner fort.
»Der is im Krankenhaus. Deswegen hamma ja vorbeig’schaut. Weil mir g’wusst ham, dass er länger net da is.«
»Okay. Und was ist dann passiert?«
»Na ja, die Lisa hat g’sehen, dass da a Licht is im Haus. Und ich hab g’sagt, ich schau mal nach.«
»Ohne Verstärkung?«
Kreuthner breitete die Arme aus. »Ich hab denkt, des is a Obdachloser, der was zum Übernachten sucht.«
Wallner nickte stumm.
»Na, jedenfalls bin ich dann rein, und wie ich drin bin, hör ich, wie jemand umeinandschleicht, und sag: Polizei! Was ham Sie hier zum Suchen? Und auf einmal fangt der zum Schießen an. Ich Deckung g’sucht und zurückg’schossen. Und wie er zur Tür raus is, bin ich hinterher. Draußen bei der Flucht hat er weiterg’schossen. Und dann is mir dieser Fensterladen ans Hirn g’rauscht. Mehr weiß ich nimmer.«
Kreuthner sah Lisa auffordernd an, und sie erzählte, dass Kreuthner sich schützend auf sie geworfen habe, wie es den dumpfen Schlag auf seinen Kopf getan habe, und was dann geschehen war, nämlich, dass sie noch zwei Schüsse auf den flüchtenden Mann abgegeben hatte oder zumindest in die Richtung, in die er in die Dunkelheit gelaufen war. Dann hatte sie Kreuthner in die stabile Seitenlage gebracht.
»Ach ja«, fiel es Lisa noch ein, »dann habe ich im Hof auf dem Boden was Weißes gesehen. Das ist mir verdächtig vorgekommen. Ich bin hingegangen und sehe, das ist ein benutztes Papiertaschentuch. Das hab ich dann sichergestellt.«
»Sehr gut«, lobte Wallner. »Dann haben wir wahrscheinlich die Täter-DNA.«
»Vielleicht auch nicht«, schränkte Kreuthner ein.
Wallner sah ihn fragend an.
»Na ja – es könnt sein, dass es von mir is. Des Taschentuch.«
»Du hast dich geschnäuzt?«
Kreuthner zuckte mit den Schultern.
»Mitten in einer Schießerei, die vielleicht dreißig Sekunden gedauert hat, hast du dich geschnäuzt?«
»Wenn die Nase läuft – hilft ja nix.«
»Ich meine: Du rennst dem fliehenden Täter hinterher und dabei putzt du dir die Nase?«
»Vielleicht hab ich mich schon im Haus geschnäuzt und das Tüchl dann im Hof fallen lassen.«
»Entschuldige, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man sich mitten in einer Schießerei die Nase putzt.«
»Ich sag ja nur: Es könnt eventuell sein, dass des mein Taschentuch is. Ich kann mich nimmer so genau erinnern. Blackout, verstehst?«
Wallner schien nicht zu verstehen.
»Na, der Fensterladen, wo mir aufn Kopf g’rauscht is.«
»Ach so.« Wallner sah zu Lisa.
»Das war wirklich schlimm. Ich hab gedacht, er überlebt das nicht.« Sie warf einen zärtlich-erleichterten Blick zu Kreuthner, der die Augen senkte und bescheiden lächelte.
»Was soll’s!«, sagte Wallner. »Morgen werden wir wissen, ob das Taschentuch von dir ist.«
Er blickte Richtung Haus. In diesem Augenblick wurde der Fensterladen mit einer Nummer versehen und als Beweisstück dort fotografiert, wo er nach der Kollision mit Kreuthners Hinterkopf zu liegen gekommen war.
»Du bist also Gott sei Dank wieder aufgewacht, und dann seid ihr noch mal ins Haus zurück? Wieso eigentlich? Die Spurensicherung wird nicht begeistert sein.«
»Wir wussten ja nicht«, sprang Lisa ihrem Kollegen bei, »ob nicht noch andere Personen im Haus waren, vielleicht verletzt. Am Ende verblutet noch jemand.«
»Ja gut«, konzedierte Wallner. »So gesehen. Und da habt ihr dann die Leiche entdeckt?«
»Ja, die war in der Gefriertruhe im Wohnzimmer.«
»Im Wohnzimmer?«
»Mein Vater is a schräger Vogel.«
»Scheint so. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Gefriertruhe aufzumachen? Dass da Verletzte drin sind, ist ja eher unwahrscheinlich.«
Kreuthner gab Wallner sein Handy. Auf dem Display war die Gefriertruhe vor ihrer Öffnung zu sehen. Der Schal hing noch heraus.
»Verstehe. Ihr habt beide die Leiche gesehen?«
Lisa deutete auf Kreuthner.
»Die Lisa is raus zu die Kollegen. Die sind g’rad angekommen.« Kreuthner kramte einen Moment in seinen Erinnerungen. »Des war a Frau in der Truhe, circa vierzig, gut angezogen, Brille. Einschussloch in der Stirn.«
»Kennst du die Frau? Ich meine, sie könnte zum Bekanntenkreis deines Vaters gehören.«
»Na. Solche Leut kennt der net.« Kreuthner spitzte den Mund. »Aber jetzt, wo du’s sagst: Könnt sein, dass ich des G’sicht schon mal g’sehen hab. Doch! Ich bin fast sicher, die is ausm Landkreis.«
Wallner ging zu dem Fotografen, der gerade mit dem Fensterladen fertig war.
»Servus! Gibt’s schon Fotos von der Leiche?«
Der Fotograf nickte und holte ein Bild auf das Display seiner Digitalkamera. Es zeigte die tote Frau in der Gefriertruhe. Auch Wallner kam das Gesicht vage bekannt vor. Sein Gedächtnis für Gesichter war recht leistungsfähig. Aber mit Toten war das so eine Sache. Wenn die Seele fort war, änderte sich auch der Ausdruck, gerade so, als ob man ein unter der Haut liegendes Stützgerüst aus dem Gesicht entfernt hätte.
»Kennst du die Frau?«, fragte er den Fotografen.
»Kommt mir irgendwie vor, wie wenn ich s’ schon mal g’sehen hätt.« Er starrte auf das Display. »Fällt mir aber nimmer ein. Sorry.«
Von der Straße kam jetzt eine Gestalt mit Halbschuhen und Bügelfaltenhose unter einem modisch kurzen Mantel mit zügigen Schritten auf Wallner zu.
»Wie schaust du denn aus?« Wallner musterte Mike Hanke von oben bis unten. Mike war sein Stellvertreter.
»Ich hatte gerade ein Date, als die WhatsApp kam.«
»Tut mir leid. Aber du hättest ja nicht kommen müssen. Oder war das Date nichts?«
»Ich sag mal so: Das hier wird spannender.«
Um die Uhrzeit war eigentlich der Kriminaldauerdienst zuständig. Beamte würden aus Rosenheim kommen und die Ermittlungen am nächsten Morgen an die Kollegen der Kripo Miesbach abgeben. Wallner hatte Rosenheim dahin gehend verständigt, dass alle Miesbacher Kollegen aus dem Feierabend gekommen waren und dass es reiche, wenn erst mal zwei Kollegen zur Verstärkung kämen.
»Mord?«
»Sieht so aus.« Wallner nahm dem Fotografen, der immer noch neben ihm stand, die Kamera ab und zeigte Mike das Foto der Leiche.
Mike holte eine Lesebrille aus der Innentasche des Mantels. »Wer ist das?«
»Ich hatte die zarte Hoffnung, dass du mir das sagst. Jedem kommt die Frau bekannt vor, aber keiner weiß, wer sie ist.«
»Keine Papiere dabei?«
»Anscheinend nicht.«
»Das Opfer?« Die männliche Stimme kam von hinten. Staatsanwalt Jobst Tischler spähte Mike und Wallner über die Schulter.
»Sie sind ja schnell«, sagte Wallner. Tischler arbeitete am Landgericht München II. »Machen Sie Nachtschicht?«
»Ich habe verfügt, dass ich bei Mordfällen sofort verständigt werde – egal welche Uhrzeit.« Tischler bemächtigte sich der Kamera.
»Sagen Sie nicht, dass Ihnen die Tote auch bekannt vorkommt.«
Tischler kratzte sich am Kinn. »Doch – irgendwie schon …«
4
Es erstaunte Wallner, dass sich Tischler an das Gesicht des Opfers erinnerte. Tischler konnte sich nämlich nicht einmal die Mitarbeiter der Kripo Miesbach merken, mit denen er öfter zu tun hatte.
»Ist immer schwierig, wenn man den Kontext nicht hat«, philosophierte Mike. »Ich hab mal in einem Restaurant in München jemanden getroffen, der hat mich gegrüßt. Ich grüß zurück und denk mir: Verflucht, woher kennst du den? Erst beim Rausgehen ist es mir eingefallen. Das war unser Metzger, wo ich seit zwanzig Jahren einkauf. Aber wenn er nicht hinter der Theke steht …«
»Ja, der Zusammenhang …« Wallner überlegte: Wenn Tischler die Frau kannte, dann nicht deswegen, weil sie aus dem Landkreis war. Tischler wohnte in München. Da sie ihm, Wallner, und einigen Kollegen aber auch bekannt vorkam, hatte es vermutlich etwas mit ihrer Ermittlungstätigkeit zu tun. Und bis Tischler sich ein Gesicht merkte, musste er es schon ziemlich oft gesehen haben. »Kennen Sie die Frau vielleicht als Tatverdächtige oder aus einer Gerichtsverhandlung?«
Tischler sah noch einmal auf das Kameradisplay. Dann schlug er sich gegen die Stirn. »Na klar. Die saß den ganzen Prozess lang neben mir.«
»Eine Kollegin?«
»Nein.« Er deutete auf das Foto. »Die Nebenklägerin!«
»Ach, der Prozess!« Wallner sah zu Mike, doch der schien verwirrt, weil er immer noch nicht wusste, um wen es ging. »Mann – das ist Carmen Skriba!«
Mike griff sich die Kamera. »Carmen Skriba! Stimmt! Erst ihr Mann – jetzt sie?« Er sah zwischen Wallner und Tischler hin und her. »Ja, Hund und Sau!«
Mehrere von Propangasflaschen gespeiste Heizstrahler erwärmten mittlerweile die Luft im Wirtschaftsgebäude, doch Janette fror trotzdem. Sie saß mit Mütze und Wollpullover vor einem Laptop und sog Informationen aus dem Netz und den Polizeidateien.
»So richtig warm wird das nicht«, sagte sie und blies in ihre Fäuste. »Bei den kalten Mauern dauert das Tage.«
»Wenn man nur im Pullover aus dem Haus geht, muss man sich nicht wundern. Ich weiß schon, warum ich die die ganze Zeit anhabe.« Wallner, der vier zusammengefaltete Klappstühle hereintrug, deutete mit dem Kinn auf seine voluminöse Daunenjacke, die er im Winter – und der umfasste bei ihm auch weite Teile von Frühjahr und Herbst – selten ablegte.
»Ich hab nicht so gern tote Tiere am Leib.«
»Ist alles synthetisch. Aus recycelten Plastikflaschen, die sie aus dem Meer fischen.«
Janette sah Wallner ungläubig und etwas spöttisch an.
»Für die Plastikflaschen kann ich nicht garantieren. Aber es mussten weder Gänse noch Enten dran glauben. Ich hab gelesen, dass dieses Füllmaterial fünf Prozent weniger Dämmwirkung hat als echte Daunen. Daran kannst du sehen, welche Opfer ich für den Tierschutz zu bringen bereit bin.«
Wallner war bei der gesamten Polizei Oberbayerns als verfroren bekannt. Seitdem er Chef war und die Ansagen machte, war es ihm egal, was die anderen redeten. Er ging offen und selbstbewusst mit seiner Behinderung um.
Mike und Tischler kamen herein, Mike mit einem Campingtisch, dessen Beine er jetzt ausklappte. Wallner stellte die Stühle dazu. Tischler hatte eine Thermoskanne mit Kaffee in der einen Hand, in der anderen ineinandergestapelte Kaffeebecher. Normalerweise betrachtete sich Tischler als für solche gastronomischen Tätigkeiten überhaupt nicht zuständig, aber Tina hatte ihm die Sachen einfach in die Hand gedrückt.
»Dann schauen wir mal, was wir bisher haben«, eröffnete Wallner die Sitzung. Der Kaffee war inzwischen ausgeschenkt, und alle vier saßen am Tisch. Dazu Tina als Vertreterin der Spurensicherung, die über erste Ergebnisse berichten sollte. Ihr Kollege Oliver war beim Rechtsmediziner geblieben, der gerade aus München eingetroffen war.
»Das Opfer ist Carmen Skriba, wie es aussieht.«
Tina drehte den Bildschirm ihres Laptops zu Wallner und den anderen. Eine stattliche Auswahl an Fotos war zu sehen, die der Leiche in der Gefriertruhe mehr oder weniger ähnelten: die Bildergebnisse, die Google bei Eingabe von Carmen Skriba lieferte.