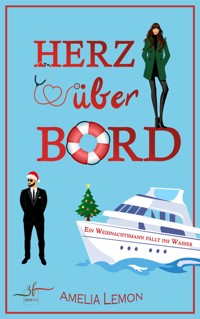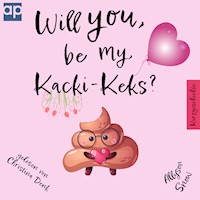4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zeilenfluss
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Verflixt und zugebissen
- Sprache: Deutsch
„Wenn eine Frau ein Küchenutensil zwischen den Fingern hat, dann hebe die Hände, gehe langsam drei Schritte zurück, dreh dich um und lauf um dein Leben!“
Wie wahr solche Sprüche sein können, darf der arrogante Vampir Jeremy nun am eigenen Leib erfahren. Linett, Zeugin eines Mordes, soll eine Aussage machen, die nicht nur dem Mörder sondern im Dominoeffekt auch der gesamten Pariser Unterwelt erhebliche Probleme bescheren könnte. Was für Jeremy als leichter Auftrag (Töte das Mädchen!) beginnt, entpuppt sich schon bald als größte Herausforderung für den erfahrenen Auftragskiller.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leserstimmen von Bookrix:
++++ herrlich, erfrischend und humorvoll .... ich kam stellenweisen nicht mehr aus dem Lachen raus, wenn ich mit die Situationen bildlich vorgestellt habe ... einfach köstlich. Ich hoffe, dass ich noch viel von Dir lesen darf. Deine Art zu schreiben ist einfach genial. Ich geh gleich morgen auch eine Pfanne kaufen... mal sehen, Vampire lauern schließlich überall ++++
++++ Oh mein Gott, so ein geiles Buch habe ich schon lang nicht mehr gelesen und der Humor ist unschlagbar, ich komme jetzt noch kaum aus dem Lachen heraus. ++++
++++ Einfach genial, danke für die vielen Lacher ++++ Super geil geschrieben! Witzig, rasant und heiß ++++
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Vampire, Pech und P(f)annen
(Verflixt und zugebissen 1)
Zeilenfluss81371 MünchenProlog
»Verschwinde, Linett!«
Das waren die letzten Worte, die sie von Tony gehört hatte. Von ihrem geliebten Tony. Ihrem besten Freund und Mitbewohner. Er war mehr als nur ihr Freund gewesen. Er war der Bruder gewesen, den sie sich ihr ganzes Leben lang gewünscht hatte.
Sie war gerade in der Küche, als sich die Männer gewaltsam Zugang in die Wohngemeinschaft der beiden verschafften. Das Knirschen und Knacken des Holzes, als jemand das Schloss der Tür aufhebelte, würde sie niemals vergessen. Eine unheilvolle Ankündigung. Starr vor Schreck lauschte sie. Mit einem ohrenbetäubenden Krachen schlug die auffliegende Tür gegen die dahinter liegende Wand. Tonys Rufe, sie solle verschwinden, ließen Linett zusammenzucken, doch sie war unfähig sich zu rühren. Alles in ihr schrie danach, seinen Worten Folge zu leisten. Oder wenigstens den Notruf zu wählen.
Sie hatte nicht, wie viele annahmen, gesehen, wie Tony starb. Sie hatte es gehört.
Nach Tonys Ruf fiel der erste Schuss. Gefolgt von lähmender Stille. Sie erinnerte sich zu gut, wie sie an der Küchentheke gestanden hatte, das Messer in der Hand leicht erhoben, wollte sie doch gerade Zucchini für das gemeinsame Abendbrot schneiden. Es sollte Gemüsepfanne geben. Oder Ratatouille, wie man in Frankreich sagte. Das Blut rauschte ihr in den Ohren. Und dann folgte ein ohrenbetäubender Schrei. Es war erstaunlich, dass ein Mensch mit einer Kugel in der Brust noch derartige Töne von sich geben konnte. Der Schrei endete durch einen zweiten Schuss. Und dann trat endgültig Ruhe ein.
Kapitel 1 – Ein vermeintlich leichtes Spiel
Gelassen näherte sich der hochgewachsene Mann seinem Wagen, um sich hinter dem Steuer niederzulassen. Er zog ein Stück Papier aus seiner Sakkotasche und faltete es auseinander. In feiner, geschwungener Handschrift war darauf eine Adresse notiert, die er nun in sein Navigationsgerät eingab.
Bei der Adresse handelte es sich um einen relativ heruntergekommenen, nichtsdestotrotz hippen und angesagten Szeneclub. Jeremy Jansen selbst konnte diesen Ruf nur wenig beurteilen. Er wurde langsam zu alt für solche Dinge.
Das Einzige, was er dazu sagen konnte, war, dass sich der Club so ziemlich am Allerwertesten von Paris befand. Also in einem Vorort, in den sich kein Bürger mit einem normalen Leben wagen würde.
Trotzdem kannte sein Navigationsgerät die Adresse und lotste ihn sicher an sein Ziel. Jeremy hielt auf dem notdürftig befestigten Parkplatz und wäre am liebsten wieder umgedreht.
Das Gebäude machte den Eindruck, als könnte man sich allein beim bloßen Anblick die Pest holen. Fehlten nur noch Drogenjunkies und -dealer. Doch zu seiner Überraschung erspähte er keinen dieser zwielichtigen Gesellen, als er sich aus dem Wagen bequemte und in die Schlange am Einlass einreihte.
Die anderen Gäste waren eindeutig der Gothic- und Heavy-Metal-Szene zuzuordnen. Ihre Gesinnung zeigten sie mit Bandshirts des entsprechenden Genres. Gepaart mit einigen Piercings und schwarz oder kunterbunt gefärbtem Haar. Die Damen waren mitunter so leichenblass geschminkt, dass er längst den Notarzt gerufen hätte, sollte seine Verabredung jemals so aussehen.
Allerdings gaben sich diese sehr viel Mühe mit ihrer Kleidung. Man(n) sah Röcke, die eher aus historischer denn aus moderner Zeit zu stammen schienen.
Warum hatte er diese Szene nicht schon vor Jahren entdeckt? Die Jagd nach hübschen, jungen Frauen schien hier noch einfacher zu sein als sonst. Zumindest bei den Damen mit den Röcken, die kaum bis über den Hintern reichten. Diese sahen nicht sonderlich prinzipienreich aus und wären ganz gewiss nicht einem gutaussehenden Mann um die Dreißig abgeneigt. Wenn sie dann erfuhren, dass sie sich auf einen Mann eingelassen hatten, der altersmäßig locker ihr Großvater sein könnte, war es bereits zu spät. Während er sich seine Gedanken machte, rückte er in der Schlange immer weiter nach vorn und landete schließlich vor einem freundlichen Türsteher. Dieser störte sich nicht an Jeremys zwar eleganten, jedoch zum Rest der Gäste eher unpassenden Kleidungsstücken und winkte ihn in das Innere des Clubs.
Der Raum war halbvoll. Wenn sich die wartende Meute vor dem Club vollständig hineingedrängt hatte, würde am Ende nur noch der Barkeeper ein wenig Armfreiheit besitzen. Bis zum Beginn der Veranstaltung waren es noch dreißig Minuten. Eine halbe Stunde, die er nutzte, um die Ausgänge zu besichtigen sowie das Alkoholangebot zu checken, welches nicht zufriedenstellend war (kein Scotch!).
Das Objekt seiner heutigen Begierde war eine junge Frau, und diese hatte heute Abend gefälligst das Zeitliche zu segnen. Linett war die Sängerin der Vorband, die das Publikum auf den eigentlichen Act des Abends einstimmte.
Wie so viele hatte das Mädchen einfach nur Pech gehabt. Sie hatte Dinge in Paris gesehen, die sie besser nicht gesehen hätte, und anstatt den Mund zu halten und sich klammheimlich davonzuschleichen und unterzutauchen, war sie geradewegs zur Polizei gelaufen.
Ihre Geschichte war so brisant, dass sie schon bald dem leider cleversten Staatsanwalt der Pariser Gerichtsbarkeit ihr Liedchen singen sollte. Was dieser mit den Informationen anstellen konnte, wollten die Mitglieder der Pariser Mafia nicht herausfinden und hatten daher Jeremys Chef beauftragt, sich des Problems anzunehmen. Und da sein Boss gut zahlte, nahm Jeremy nun sogar ein geplatztes Trommelfell in Kauf. Das Schlagzeug erzeugte einen solchen Beat, dass er glaubte, das Fiepen in seinem Ohr nie wieder loszuwerden. Doch das sollte nicht die einzige Strapaze für seine Ohren sein. Das sollte Gesang sein?! Ernsthaft? Selbst Männer waren mitunter nicht zu einem solchen Gegröle in der Lage. Egal, wie dicht sie waren. War es nötig, hier zu warten? Hätte sie Mozart gespielt, dann hätte sich Jeremy vielleicht dazu überreden lassen, dem letzten Auftritt ihres Lebens beizuwohnen. So jedoch trampelte, äh, grölte sie lediglich seine Nerven zu Tode.
Das Mädchen war noch ein Weilchen beschäftigt, und es würde einfach sein, auch nach dem Auftritt an ihr dranzubleiben. Da konnte er seine vorhandene Zeit auch anderweitig verbringen. Das Brennen in seinem Hals und das leichte Unruhegefühl waren ihm nur zu gut bekannt. Er hatte Hunger. Zwar würde Jeremy schon bald das Blut von Linett kosten, aber warum sich mit weniger zufriedengeben, wenn hier mehr als ausreichend zweibeinige Nahrung herumlief?
Durch die Menge drängte er sich nach draußen. Der Schweißgeruch wurde ohnehin langsam unerträglich und verursachte ihm gemeinsam mit den verschiedensten Gerüchen von Deo und Parfüm Übelkeit und Kopfschmerzen. Die kühle Nachtluft war ein hervorragendes Gegenmittel. Sein Blick wanderte zu der schwarzhaarigen Mittdreißigerin, die gelangweilt wie eine pubertierende Göre auf ihrem Kaugummi herumkaute und hin und wieder eine Blase damit erzeugte. Ihr entging nicht Jeremys Musterung, und ihr Blick wanderte nun ebenso prüfend über ihn.
»Hast dich wohl verlaufen, was?«, fragte sie ihn, jedoch keineswegs herablassend. Eher neugierig.
»Ich suche jemanden«, erwiderte Jeremy ruhig.
»Bist du von der Polizei?«
Ein Grinsen bildete sich auf Jeremys Zügen. Nicht, dass dieser Vergleich selten auftrat. Und doch war es der Lachhafteste, den man treffen konnte.
»Nein«, erwiderte er und die junge Frau schien erleichtert.
»Wir verticken hier nämlich keine Drogen. Gibt zwar immer welche, die uns das unterstellen, aber das ist nur, weil wir ihrer Meinung nach nicht der Norm entsprechen.«
Hörbare Verachtung schwang in ihrer Stimme mit. Das Los der verkannten Gruftis. Schon klar. Jeremy war in Wirklichkeit auch nur ein Teddybär mit zu spitz geratenen Zähnchen.
»Das hatte ich auch nicht angenommen. Gibt es hier in der Umgebung eigentlich noch mehr als diesen Schuppen?«
Nachdenklich ließ die junge Frau ihren Blick schweifen, als könnte ihr allein durch das Betrachten der Umgebung etwas einfallen. Jeremy hingegen behielt die Sicherheitsleute im Blick, deren Wachsamkeit langsam, aber sicher nachließ. Alle Besucher waren beim Konzert. Kaum einer lümmelte noch hier draußen herum, und die Security-Leute wühlten ihre ersten Zigaretten oder die Handys hervor.
»Da hinten gibt’s noch ein schwedisches Restaurant. Soll aber nicht so gut sein«, teilte ihm die Gothic-Madame mit.
»Da hinten?«, wiederholte Jeremy und zeigte natürlich erst einmal in die falsche Richtung. Passend dazu machte er noch ein paar wenige Schritte um die Ecke des Gebäudes. Gerade ausreichend, um sich nicht zu weit von der Teufelsbraut zu entfernen, aber doch weit genug, sodass sie, wenn sie ihm folgte, aus der Sichtweite der anderen verschwand.
»Nein«, erwiderte sie. Ahnungslos wie sie war, stiefelte sie dem vermeintlichen Idioten, der nicht mal die richtige Richtung peilen konnte, geradewegs hinterher. Sie hob den Arm, um in die andere Richtung zu zeigen sowie ein paar passende Worte loszuwerden, da packte Jeremy sie bereits und zog sie an sich. Er hörte ihren erschrockenen Herzschlag ansteigen. Schockerstarrt versuchte sie noch nicht einmal, zu schreien oder sich aus seinem Griff zu winden.
Innerhalb eines Wimpernschlages und ohne auch nur ansatzweise außer Atem zu sein, stoppte er mit seiner Beute einige Kilometer weiter, mitten im Wald. Er blickte hinab und starrte in zwei angstvoll aufgerissene, dunkelbraune Augen.
»Willst du versuchen, dich zu retten, oder akzeptierst du dein Schicksal?«, fragte er sie und ließ sie los.
Da er Zeit hatte, war Jeremy durchaus zu Spielen aufgelegt. Und hey, niemand sollte behaupten können, er würde keine Rücksicht auf die Wünsche Todgeweihter nehmen. Wortlos starrte sie ihn an, während sie zurückwich. Er konnte zusehen, wie sich die Rädchen in dem sonst so gelangweilten Gehirn drehten. War das Leben wohl nur noch halb so langweilig, wenn die Aussicht bestand, dass es bald vorbei war?
»Wenn du mich vergewaltigen willst, dann zieh dich schon mal warm an«, fauchte ihm sein Opfer nicht sonderlich überzeugend entgegen. Jeremy verdrehte die Augen.
»Bild dir nichts ein. Du bist zwar ganz süß, aber nicht so verführerisch, dass ich dich unbedingt haben muss. Das Einzige, was ich will, ist dein Blut. In eurer Szene sind Vampire doch nicht ganz ins Reich der Mythen verbannt, oder? Nun, du hast das Privileg, einem gegenüberzustehen.«
Von Freude oder gar Dankbarkeit über diese Ehre konnte bei der Frau jedoch keine Rede sein. Der Anblick seiner spitzen Zähne ließ sie lediglich entsetzt zurückspringen. Jeremy sah, wie sie in ihre Tasche nach ihrem Handy griff. Im nächsten Moment war er bereits bei ihr und riss es ihr aus der Hand. Ein Flug an den nächsten Baum ließ es in hunderte, unbrauchbare Einzelteile zerschellen.
»Ach ja, zu den Regeln: Hilfe holen ist nicht gestattet«, erläuterte der Vampir seelenruhig und strich ihr ein paar Haare beiseite. Sein Blick wanderte begierig über die ebenmäßige Haut, und wer genauer hinsah, konnte die Ader mit dem süßen, roten, köstlichen Saft pulsieren sehen. Jedenfalls so lange, bis sie nervös erneut von ihm wegstolperte.
»Du bist irre«, keuchte sie.
Da wandte man sich schon mal an die für Vampire aufgeschlossene Szene und erntete trotzdem nichts als Unglauben.
»Möglich. Je älter man wird und je mehr man tötet, umso abgeklärter wird man«, zuckte der Vampir die Schultern. »Wie heißt du überhaupt?«
»Warum willst du das wissen?«
»Vielleicht will ich dir ja einen Grabstein mit deinem Namen spendieren«, erklärte Jeremy leutselig. Sein freundliches Lächeln entblößte einmal mehr seine spitzen Eckzähne. Das war übrigens gelogen. Er würde dieser Frau auf keinen Fall etwas schenken. Er spielte mit ihr. Warum? Weil er es konnte.
»Lauf, kleines Häschen.«
Sie ließ sich nicht zweimal bitten. Es war lächerlich. Sie musste doch gemerkt haben, zu welchem Tempo er fähig war. Er konnte innerhalb weniger Sekunden viele Kilometer zurücklegen, und sie glaubte, sie könnte ihm zu Fuß davonlaufen? Vielleicht hätte er ihr ein Fahrrad besorgen sollen. Dann wäre diese Jagd wenigstens ein wenig aufregend. Jeremy schoss vor, packte sie und riss ihren Arm herum. Er brach wie ein trockener Zweig unter seiner Gewalt. Ihr schmerzgepeinigter Schrei hallte über die Lichtung. Schluchzend hockte sie auf dem Boden und presste den gebrochenen Arm an sich.
»Warum tust du das?«, schrie sie ihn an. Immer wieder versuchte sie, sich aufzurappeln. Erfolglos. Der Schmerz schwächte sie, während das Adrenalin in ihrem Körper jede verbleibende Kraftreserve mobilisierte. Eine interessante Mischung.
»Weil mir danach ist«, lautete die emotionslose Antwort Jeremys. »Ja, es stimmt. Ich könnte dich sofort töten und deinem Elend ein schnelles Ende bereiten. Aber das ist langweilig. Ich gebe dir eine weitere Chance.«
Die Jagd war eine dröge Angelegenheit. Ein Vampir war den Menschen in Kraft und Schnelligkeit haushoch überlegen. Selbst ein Förster hatte mehr Probleme, ein Reh aus der Ferne abzuknallen, als ein Vampir damit, einen Menschen zu töten. Die einzige Herausforderung bestand darin, sich einen Ort zu suchen, an dem man nicht gleich von hunderten Zeugen umzingelt war. Geheimhaltung war den meisten Vampiren doch heilig.
Wie ein Tiger auf dem Sprung hatte er damit begonnen, sie mit begierigem Blick zu umrunden. Das Aroma frischen, süßen Blutes umwehte sie. Ihr Herzschlag dröhnte in seinen Ohren, lieblicher als jede Musik. Das hier war eine gute Jagd.
Das menschenfreundliche Töten, vielleicht noch mit vorherigem Einschläfern, lag nicht in der Natur der Vampire. Sie waren Mörder. Und keinen Deut schlechter oder besser als die Menschen. Nur, dass sie in der Nahrungskette über den Menschen standen und darauf verzichteten, diese in großen Ställen zu halten. Die Menschen durften frei sein. So frei, wie es jedenfalls möglich war, und wenn sie Glück hatten, begegneten sie ihr Leben lang niemals einem hungrigen Vampir und starben eines friedlichen Todes.
Das unfaire Spiel zwischen Jäger und Gejagtem lag Jeremy und seinen Artgenossen ebenso im Blut wie den Menschen. Beschwerte sich das Reh, wenn es vom Jäger erschossen wurde? Hatte irgendwer Mitleid, wenn jemand ein Dutzend Rinder aus ihren Ställen holte und ihnen nacheinander das Bolzenschussgerät an die Stirn setzte? Ebenso wenig brauchte man es für unfair zu halten, dass Jeremy nun erneut seine vampirische Schnelligkeit nutzte.
Mühelos holte er die Frau ein, die es tatsächlich fünf Meter von ihm weggeschafft hatte. Endlich durchbohrten seine Zähne die weiche Haut an ihrem Hals. Ihr Winden hatte keinerlei Erfolg. Ihr Schrei verklang im Nichts, als köstliches Blut seinen Gaumen umspülte.
Nun galt es zu warten. Auf Linett. Ihren Aufenthaltsort hatte sie bisher gut verbergen können, auch mit Hilfe der Polizei, doch das hatte sich heute Abend geändert und noch etwas würde sich ändern: Linetts Gesundheitszustand.
Im Schatten der umliegenden Bäume verborgen, beobachtete Jeremy, wie Mademoiselle Roux, so hieß sein heutiges Opfer, durch den Hintereingang huschte und zielstrebig auf einen alten, verbeulten Toyota zusteuerte, sich hinter das Steuer setzte und mit einem Kavalierstart eilig davonfuhr.
Zeit, zu seinem eigenen Wagen zu eilen und sich unauffällig an die Stoßstange Linetts zu hängen.
Nun ja, das war nicht wörtlich zu nehmen. Zwischen ihnen herrschte ausreichend Abstand, sodass sie ihn auf dem engen Weg nicht sah, und in der Stadt würden genügend andere Wagen zwischen ihnen fahren. So folgte Jeremy der jungen Frau bis in ein kleines Dorf.
Er brauchte nicht viel Benzin zu verschwenden, um durch die Straßen zu patrouillieren, bis er endlich den kleinen, roten Toyota fand. Ein wenig Zeit ließ Jeremy Linett noch, bevor er schließlich den winzigen Gartenzaun überwand. Anstatt, wie üblich, den Hintereingang leise aufzubrechen (Es war gut, ein Vampir und so stark zu sein, dass man sich lediglich gegen eine abgeschlossene Tür lehnen musste, um diese ächzen und nachgeben zu lassen.), entschloss sich Jeremy zur direkten Konfrontation und klingelte an der Vordertür. Das Ergebnis sprach für die Theorie ›Frechheit siegt! ‹, denn unsicher und sogar mit einer gusseisernen Pfanne bewaffnet, äugte Linett durch einen schmalen Spalt.
Ein Spalt, der ihm ausreichte, um die Tür zu fassen und sich nachdrücklich Zugang zu ihrem Heim zu verschaffen.
Seine Hand legte sich auf ihren Mund, um die Schreie zu dämpfen, und da sie die Pfanne in der falschen Hand hielt, blockierte sie sich selbst. Hätte sie ausgeholt, hätte sie lediglich die Tür getroffen. Doch selbst die Tatsache, dass er ihr die Pfanne aus der Hand wand, schien sie nicht aufgeben zu lassen. Ihre Finger gruben sich in seine Hand. Beharrlich versuchte sie, diese von ihrem Mund zu ziehen, und zugleich wollte sie sich seinem Griff entwinden.
Konnte die Kleine nicht einfach stillhalten, bis er die Zähne in ihrem Hals und in dem köstlichen Blut versenkt hatte?
War wohl zu viel verlangt, doch der Vampir wusste sich zu helfen. Jeremy ergriff mit der freien Hand ihre Handgelenke und drückte diese vor ihrer Brust zusammen, um Linett selbst gegen seine zu pressen. Ein unüberriechbarer Hauch von Adrenalin, das ihr Herz eilig durch ihre Adern pumpte, umwehte sie.
Kurz hielt Jeremy inne. Die Hölle mochte gefrieren und selbst dann würde jeder Vampir diesem unvergleichbaren Aroma huldigen, indem er sich die paar Sekunden gönnte, dieses zu genießen. Und um sicher zu gehen, dass sie kein Eisenkraut zu sich genommen hatte. Das Teufelszeug übte auf Vampire je nach Dosis nicht nur eine betäubende bis tödliche Wirkung aus. Es war zudem, wenn es im getrunkenen Blut enthalten war, damit zu vergleichen als würde ein Mensch flüssiges Blei trinken wollen.
Jeder Mensch, der Eisenkraut zu sich nahm, war also sicher vor Vampirbissen. Aber nicht vor dem Tod.
Den winzigen Moment seines Zögerns nutzte das kleine Biest, um ihm mit aller Kraft ihrer Panik den Bleistiftabsatz ihrer Highheels in die große Zehe zu rammen. Leider waren Vampire manchmal auch nur Menschen und ebenso anfällig für Schmerzen. Und das tat, verflucht nochmal, echt weh!
Unweigerlich lockerte sich sein Griff. Die ›Belohnung‹ folgte auf dem Fuße, denn das Mädchen nutzte die Bewegungsfreiheit, um ihm auch noch ihren spitzen Ellenbogen in den Bauch zu rammen. Ein gequältes ›uff‹ war die Antwort des Vampirs darauf.
Und sein Glückstag fing gerade erst an. Kaum frei, schnappte sich das verflixte Weibsbild ihre Pfanne, nutzte den Schwung des Drehens und landete einen Volltreffer.
Benommen und mit dröhnendem Schädel sackte der Vampir auf die Knie, gleichzeitig redlich bemüht, sich am Kühlschrank festzuhalten und wieder auf die Beine zu kommen.
Klappte nur nicht so ganz.
Jeremys Blick fixierte die schwarze Haarpracht, die hektisch an ihrem Rücken auf und nieder wippte. Inzwischen sollte sie längst tot sein und nun kramte sie entspannt in einer Keksdose?! Völlig egal, ob sie nun Kekse essen wollte! Der Vampir raffte sich auf und während er auf Linett zustürzte (taumeln wäre der passendere Ausdruck), drehte sich das Mädchen mit einer 45er zu ihm herum und drückte ab.
»Verdammter Mist!«, fluchte der Blutsauger und zog sich fahrig eine Kanüle aus dem Bauch.
Dass sie wissend über Vampire und ihre Schwächen war, hatte ihm niemand gesagt! Sonst hätte er damit gerechnet, dass sie Eisenkraut im Haus hatte und zwar in Dosen, die einen Elefantenbullen niederstrecken konnten. Das typische Schwindelgefühl erfasste ihn, und das Letzte, woran er sich erinnern konnte, war, dass er sich wieder einmal auf den Knien wiederfand und Linett ihn mit großen Augen für einen Moment anstarrte, bevor sie sich scheinbar ein Herz fasste, seine Hand nahm und ihn mit sich zog. Im Nachhinein betrachtet machte das keinen Sinn.
Kapitel 2 – Des einen Glück, des anderen Pech
Aber irgendwie doch. Jeremys Verwirrung war unbeschreiblich, als er irgendwann mit einem Brummschädel erwachte, den man in der Regel nur nach dem Konsum von zehn Flaschen Absinth bekam. Er versuchte, sich das Gesicht zu reiben, um wieder ein wenig klarer zu werden, bekam jedoch lediglich eine Hand auf die erforderliche Höhe. Die andere blieb, gepaart mit einem metallischen Klirren, nur eingeschränkt nutzbar.
Im ersten Augenblick glaubte Jeremy, er wäre zu Hause und seine Geliebte würde sich erstens einen Spaß erlauben und zweitens ein erotisches Abenteuer starten wollen. Diese Illusion hielt jedoch nur so lange an, wie Jeremy brauchte, um sich zu erinnern, dass seine letzte Bettgespielin den Weg aller Sterblichen gegangen war.
Genau genommen war seine letzte Bettgespielin eine im Club aufgerissene Nymphomanin gewesen, die es eben nicht überlebt hatte, mit einem hungrigen Vampir im Bett zu landen. Aber er schweifte ab. Zudem passte die rotierende Decke überhaupt nicht zu seiner Wohnung. Diese Decke hier war nicht weiß. Sie war es vielleicht einmal gewesen, das war jedoch lange her. Sie war einfach nur schäbig. Ebenso wie der Rest der Einrichtung, wie der Vampir mit leicht schwankendem Rundblick feststellte.
Die Vorhänge waren zugezogen. Scheinbar hatte ihm ausgerechnet Linett die Qualen des Sonnenlichtes ersparen wollen, dafür hatte sie ihm aber eine ganz andere Überraschung dagelassen: Er war nackt! Bis auf die Unterhose! Ach Quatsch, selbst die hatte ihm dieses Weib nicht gelassen! Er hatte doch nicht, oder? War das Eisenkraut mit Viagra versetzt gewesen?
Unsinn, so etwas gab es nicht. Selbst wenn. Bei der Dröhnung Eisenkraut wäre er niemals lang genug bei Bewusstsein geblieben, um überhaupt zu irgendetwas brauchbar zu sein, geschweige denn zu einer erotischen Zwischeneinlage.
Der Uhrzeit nach zu urteilen, die ihm ein Wecker auf dem Nachtschränkchen anzeigte, hatte er in seinem Eisenkraut-Rausch den halben Tag verschlafen. Auch wenn der Erholungseffekt praktisch nicht vorhanden war.
Bis zur Dämmerung würden noch ungefähr vier Stunden vergehen, die er zwangsläufig abwarten musste. Die Tränke, die dafür sorgten, dass er sich unbekümmert ins Sonnenlicht begeben konnte, waren in seiner Sakkotasche. Und besagtes Sakko war weg.
Testweise riss der Vampir an der Handschelle (die Erklärung für seinen eingeschränkten Arm). Natürlich, Handschellen aus einem Hexenladen. Da Vampire jede Fessel zu sprengen wussten, gleichgültig aus welchem Material, gab es talentierte Hexen, die sich einen gewinnbringenden Spaß daraus machten, Handschellen und sonstiges mit ihren Zaubern zu ›tunen‹. Dank deren Magie war eine bloße Handschelle für einen Vampir ebenso stabil und unzerstörbar wie für einen Menschen. Und als besonderes Extra war es einem gefangenen Vampir noch nicht einmal möglich, den Einrichtungsgegenstand zu zerlegen, an dem der Rest der Handschelle befestigt war, denn dieser war durch den Zauber und die Berührung der Fessel ebenso massiv und standhaft geworden. Magie also, die das Kräfteverhältnis zwischen einem Vampir und einer Handschelle wiederherstellte, so wie es die Menschen gewohnt waren. Doch sollte man sich als Vampir besser nicht beklagen. Bisher war noch keine Hexe fähig gewesen (oder hatte es als notwendig erachtet), die Fesseln so zu verzaubern, dass sie es dem Vampir nicht nur unmöglich machte, sich zu befreien, sondern ihm auch sämtliche übermächtigen Kräfte raubte. Diese Gemeinheit war bisher allein dem Eisenkraut vorbehalten. Sich einem gefesselten Vampir zu nähern, war also nicht ratsam. Vielleicht hätte Linett ein entsprechendes Warnschild hier aufstellen sollen. Im Falle, es verirrte sich jemand hierher.
Frustriert seufzte der Vampir. Wenn nicht durch Zufall jemand vorbeikam, würde er hier elendig verhungern. In seinem ganzen Leben war ihm noch nie ein solcher Mist passiert!
Klar. Wenn man sich mit einem anderen Vampir anlegte und dieser älter und/oder besser vorbereitet war, konnte es durchaus vorkommen, dass man in kurzzeitige Bedrängnis kam. Die Tatsache, dass er lebte (was man von den anderen wiederum nicht behaupten konnte), sprach eindeutig für ihn. Aber noch nie (nie!) war er von einer schwachen Sterblichen besiegt worden! Das Mädchen wusste viel. Zu viel. Und das nicht nur über die Machenschaften der Pariser Mafia.
Bevor die deprimierenden Gedanken über seinen tagelang andauernden Hungertod überhandnehmen konnten, fiel ihm ein sachtes, metallisches Funkeln ins Auge. Hinter dem Wecker lag ein kleiner Schlüssel. Könnte passen.
Offenbar hatte Linett nicht vor, ihn verhungern zu lassen. Sie hatte sich jedoch auf diese Weise einen Tag Vorsprung gesichert.
Und hoffentlich hatte sie eine Kamera installiert, sodass wenigstens eine ihren Spaß an dem Kommenden hatte. Mit dem Arm an die rechte obere Seite des Bettes gefesselt, war es nun an ihm, an den Schlüssel zu kommen, der auf dem Nachtschränkchen auf der linken Seite des Bettes lag. Da es sich nicht um ein Bett handelte, das lediglich neunzig Zentimeter breit war, musste der Vampir nicht nur eine Gliedmaße verrenken, um an den Schlüssel zu gelangen. Das scharfkantige Metall grub sich schmerzhaft in sein Handgelenk, als er den kleinsten Millimeter Bewegungsspielraum gnadenlos ausreizen musste. Begleitet von üblen Flüchen gelang es ihm schließlich, den Schlüssel zu erwischen. Und tatsächlich: Er passte!
Sein Kreislauf war über diese sportliche Einlage nur mäßig erfreut. Jeremy musste für einen Moment still liegen bleiben, damit das Drehen in seinem Kopf wieder nachließ. Doch ihm stellte sich schnell das nächste Hindernis in den Weg. Auf dem Flur herrschte noch immer Tageslicht und das war, wie gesagt, ohne schützenden Trank brandgefährlich. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Jeremy würde Linett nicht den Gefallen tun, wie ein Berg Kohle in Flammen aufzugehen.
Da Jeremy ohnehin nichts Besseres zu tun hatte, lauschte er in die Stille des Hauses hinein. Der Vogel war, wie erwartet, ausgeflogen. Der Leere der Schränke nach zu urteilen, die der Vampir nun durchsuchte, würde sie wohl nicht zurückkehren.
Mist, verfluchter. Linett war nicht das naive, unwissende Mädchen, für das er sie gehalten hatte. Auch wenn sie eindeutig zu Übertreibungen neigte. Ihn auszuziehen und ans Bett zu fesseln, war absolut nicht nötig gewesen! Zumindest nicht, solange sie nicht vorhatte, ihn zu töten.
Damit sich die Aktion lohnte, hätte sie ihm weder einen Schlüssel dalassen, noch die Vorhänge zuziehen dürfen. Zwar war er gewiss nicht undankbar, aber ohne ihre Gutmütigkeit hätte sie nun einen Verfolger weniger an den Hacken. Nun, ihm konnte es nur recht sein. Er war es zwar nicht gewohnt, eine zweite Chance zu benötigen, aber er war auch nicht so dumm, sie nicht zu ergreifen.
Die Stunden bis zur Dämmerung zogen sich ewig hin. Gelangweilt und ungeduldig tigerte der Vampir in dem Schlafzimmer auf und ab und überlegte sich die nächsten Schritte. In diese Grübeleien versunken, vergingen auch die längsten Stunden, und so konnte er sich nach dem Sonnenuntergang endlich frei durch den Rest des Hauses bewegen. Seine Kleidung fand Jeremy im Flur des Erdgeschosses, ordentlich zusammengefaltet. Eine Irre mit Ordnungswahn? Seine Tränke und sein Handy waren ebenfalls vorhanden.
Die Jagd konnte also weitergehen.
Viele Möglichkeiten gab es für Linett nicht. Entweder sie versuchte aus der Stadt zu verschwinden oder sie blieb. Jeremy hatte sich über ihre Finanzen informiert. Die waren mehr als schlecht. Sie war mit ihrer Band zwar bekannt, der Großteil der Einnahmen schien jedoch in den Händen der Manager zu landen. Dank eines Besuchs auf dem Server des Musikproduzenten wusste er, welche Strafe Linett und ihren Jungs blühte, wenn sie einen Auftritt nicht wahrnahmen. Die zu zahlende Summe war horrend und jenseits von Gut und Böse. Glücklicherweise war dort auch eine Liste der Auftritte abgelegt. Sehr vorbildlich mit Ort und Datum. Der Auftritt am heutigen Abend in einem weiteren Club war vorerst der letzte Termin. Sehr bedauerlich für Linett, dass sie diesen nicht mehr erleben würde. Und bis es so weit war, konnte Jeremy die Zeit für einen weiteren Auftrag nutzen.
Dazu musste er in die Innenstadt. Inzwischen brach die Dunkelheit über der Stadt herein.
In seinem Wagen verschmolz Jeremy völlig mit der Umgebung, als er schließlich die Scheinwerfer ausschaltete. Es handelte sich um ein altes Fabrikgebäude und die Zentrale eines halbwegs bekannten Zeitungsverlages. Dessen Reputation ging vor einigen Tagen völlig in den Keller, als einer der Journalisten einen Artikel darüber veröffentlicht hatte, dass die Menschheit nicht die am höchsten entwickelte Spezies auf diesem Planeten war.
Selbst um diese Uhrzeit waren die meisten der Fenster beleuchtet, und auch der dicke Pförtner hockte unmotiviert in seinem kleinen Kämmerchen.
Selbstsicher spazierte der Vampir durch das Großraumbüro. Hin und wieder kreuzten leicht manisch wirkende Mitarbeiter seinen Weg, die gehetzt auswichen, um an ihm vorbei wohin auch immer zu sprinten. Andere wiederum hockten wie Affen über ihre Tastaturen gebeugt und hämmerten darauf herum als hinge ihr Leben davon ab, während die Nächsten völlig entspannt in ihren Stühlen lümmelten, telefonierten oder sich durch Bilder klickten.
Niemand schien sich daran zu stören, dass der Vampir geradewegs in das Büro des Chefredakteurs spazierte. Soweit Jeremy wusste, war dieser maßgeblich für den unglaubwürdigen, wenn auch ärgerlichen Zeitungsartikel verantwortlich.
»Wer sind Sie?«, fragte dieser und sah unwirsch von seinem Stapel Papier auf. Die Brille hatte er auf die Stirn geschoben und durch die Bewegung krachte sie ihm wieder auf die Nase zurück, was ihm ein irritiertes Blinzeln entlockte. Dick Thompsen war um die 40 Jahre alt, Engländer, von großer und sportlicher Statur und zog mit seinen grau melierten Haaren sicherlich eine Schar schwärmender Damen hinter sich her.
»Jemand, der Ihnen Grüße von Jason Harris überbringt«, erwiderte der Vampir gelassen und weidete sich an der entsetzten Reaktion seines Gegenübers.
Thompsens Augen wurden größer und traten ein wenig aus den Höhlen, während seine ganze Körperhaltung in zittrige Anspannung verfiel. In einer hektischen, unbewussten Bewegung lockerte der Mann seinen Krawattenknoten. Zu Jeremys Unmut entblößte er so ein kleines Kreuz um den Hals und zauberte nun einen nicht sehr freundlich aussehenden Pflock aus seiner Schublade hervor. Wie unangenehm. Aber auch ein wenig langweilig.
»Ich dachte, Sie wären ein Sportschütze. Warum haben Sie nur einen Pflock in Ihrer Schreibtischschublade?«, fragte Jeremy. So war es wirklich kein Wunder, dass er sich zu sehr an leichte Fälle gewöhnte. Es war doch immer interessanter, wenn das Opfer ein wenig Gegenwehr zeigte. So wie Linett. Diese Furie zu töten, würde nach deren Aktion ein hoher Genuss sein.
»Es ist unhöflich, sich nicht vorzustellen«, erwiderte Thompsen und versuchte sich darin, eine Fassade der Furchtlosigkeit aufzubauen.
»Es ist unhöflich, sich in die Angelegenheit anderer einzumischen und Fragen nicht zu beantworten«, erwiderte Jeremy gelassen und schloss die Bürotür hinter sich. Ohne Thompsen aus den Augen zu lassen, griff Jeremy nach den Bändern der Jalousien und ließ den metallenen Vorhang herunter. Es hielt nicht nur die Blicke der Neugierigen durch die transparenten Glaswände draußen. Es war eine einfache Tätigkeit, und doch wusste Jeremy um die beunruhigende Wirkung. Dem Bedeutungsschwangeren konnten sich die meisten nicht entziehen, und es machte Spaß, jemanden so einfach aus der Fassung zu bringen. Auch wenn, Respekt, Thompsen standhaft versuchte, gelassen zu scheinen. Allein seine Körperreaktionen auf Stress und das Adrenalin in seinen Adern verrieten ihn.
»Die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, dass unter ihnen Vampire leben, die regelmäßig welche von ihnen töten«, zischte der Mann nun verärgert.
Jeremy zog nur die Augenbrauen nach oben.
»Das meinte ich zwar nicht, auch wenn sich Ihre Artikel nicht gerade sonderlicher Beliebtheit unter Vampiren erfreuen.«
Jeremys Gegenüber schaute nun etwas verwirrt drein, nickte dann aber verstehend. Der Vampir hingegen befand, dass es nicht seine Aufgabe war, Menschen vor ihrem Tod die Gründe für ihr Ableben zu erklären. Glück für den Mann, dass er von selbst darauf kam.
»Und weil ich Ihrem Chef nicht nur unterstellt habe, ein Vampir zu sein, sondern auch noch seine Verbrechen aufgedeckt habe, wollen Sie mich nun töten.«
Es klang mehr wie eine Feststellung als eine Frage, und würde sich Jeremy nur einen Funken für sein Gegenüber interessieren, würde er zugeben müssen, dass der Gute auch weiterhin Courage bewies. So manch anderer wäre bereits hysterisch in Tränen ausgebrochen.
»Bilden Sie sich nicht zu viel ein. Beweise haben Sie ebenso wenig wie alle anderen«, erwiderte Jeremy gelassen und näherte sich Thompsen mit zwei kleinen Schritten. Erheitert verfolgte er, wie sich Thompsen versteifte, auch wenn er weiterhin seinen Blick fest auf Jeremy hielt.
»Ich habe die Macht der Presse. Sein Ruf ist ruiniert. Beweise werden andere finden. Und einen toten Chefredakteur wird man unweigerlich mit Ihnen in Verbindung bringen. Denn mit Verlaub, die zeitliche und räumliche Nähe ist doch frappierend«, spottete Thompsen nun.
Jeremy sah die Schweißperlen, die sich auf seiner Stirn bildeten. Da der Blutsauger sich heruntergebeugt hatte und seine Nase auf der Höhe von Thompsens hatte, konnte Jeremy in dessen schreckhaft geweiteten Pupillen das rötliche Glühen seiner eigenen Augen wie in einem Spiegel sehen.
Der Chefredakteur zog scharf die Luft ein. Jeremy zeigte dafür seine Beißerchen. Man hatte ja sonst keinen Spaß.
»Damit haben Sie nicht unrecht. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Ihr Tod ist gewiss. Natürlich. Aber vorher werden Sie uns noch einen kleinen Dienst erweisen.«
Und wieder einmal wurde Jeremy bewiesen, wie dumm Menschen im Angesicht des Todes reagierten. Thompsen zog im Drang der Verzweiflung den Pflock nach oben und stach damit nach dem Vampir. Dieser entriss ihm das Stück Holz so heftig, dass er ihm fast die Hand brach.
Das ›fast‹ in diesem Satz war im Übrigen nicht akzeptabel. Mit unnachgiebigem Griff platzierte er Thompsens Hand auf dem Schreibtisch und jagte das spitze Holz durch dessen Handfläche. Mit der nun freien Hand drückte er Thompsens Kopf gegen seine Hüfte und erstickte dessen gepeinigten Schrei, indem er ihm den Mund zuhielt. Ein Zittern ging durch den Mann, gefolgt von einem armseligen Wimmern.
»Sie haben die Wahl. Entweder Sie tun, was ich von Ihnen verlange, oder es werden noch weitere Teile von Ihrem Körper ähnliche Löcher erhalten. Ich kann Ihnen sagen, dass das ein sehr schmerzhafter Tod ist. Es ist wichtig, keine lebenswichtigen Organe oder Arterien zu treffen. Bei meiner Übung kann ich Ihren Todeskampf über mehrere Tage hinziehen«, erläuterte Jeremy dem bebenden Mann geduldig.
»Nun?«, hakte er nach, als er eine Weile keine Reaktion erhielt. Erst als er erneut nach dem Pflock griff, nickte Thompsen hektisch, und Jeremy nahm die Hand von seinem Mund.
»Im Übrigen wäre es nicht empfehlenswert zu schreien. Ich bin sowieso schneller als alle anderen«, warnte er Thompsen. Dessen Gesicht hatte die Farbe der angegrauten Tapete übernommen, und erschüttert starrte er auf seine Hand, die noch immer auf den Tisch genagelt war. Jeremy seufzte. Ach ja, das war natürlich immer das Hinderliche. Er zog erst ein Tuch aus seiner Tasche und dann den Pflock aus der Hand. Immerhin gab Thompsen nicht mehr als ein gequältes Wimmern von sich, selbst als Jeremy seine Hand nachlässig verband.
»Was soll ich tun?«, fragte Thompsen nun kaum hörbar.
Gerade rechtzeitig parkte Jeremy abrupt in einer Nebenstraße. Linett schien sich lediglich in der Öffentlichkeit und in ihrem Wagen sicher zu fühlen. Die kurze Distanz zwischen ihrem Auto und dem Eingang des Clubs versuchte sie mit einem Sprint hinter sich zu bringen. Sie lief schnell, doch nicht schnell genug für den Vampir. Dieser war mit einem kurzen Blick auf das Mädchen sicher, dass sie keine Pfanne unter dem Rock trug (sah zumindest nicht danach aus), ignorierte die noch immer leichte Dämmrigkeit in seinem Kopf (verdammtes Eisenkraut) und bewegte sich in übernatürlicher Geschwindigkeit auf Linett zu. In altbewährter Art sorgte er dafür, dass sie nicht den gesamten Club nach draußen kreischte und zog sie mit sich in eine der abgeschiedenen Nebengassen.
»Au!«, empörte sich Jeremy und verpasste Linett eine Ohrfeige.
Das Weib hatte keine Manieren, ergo brauchte sie keine von ihm zu erwarten. Außerdem schlug er nicht hart zu. Okay, okay, sie taumelte zu Boden. Wer jedoch einen Vampir in die Hand biss, musste mit dem Echo leben.
Inzwischen hatte sich ein rot glühender Schimmer in seine Augen geschlichen. Ein eindeutiges Zeichen, das bei einem Vampir entweder auf ausgeprägten Zorn oder Hunger schließen ließ. Bei ihm war eindeutig Ersteres der Fall. Dieser scharlachrote Ton entging auch Linett nicht und steigerte ihre Panik. Er konnte selbst über den Lärm der Stadt hinweg den hektischen Herzschlag hören, der das Adrenalin durch ihre Adern pumpte. Mit rücksichtslosem Griff drückte Jeremy sie gegen die kalte Hauswand. Ein Griff in ihre Jacke und ihre 45er schlitterte über den Boden unter eine Mülltonne.
»So gefällt mir das besser«, knurrte Jeremy.
Ja, er wusste es selbst: Es war schon ein wenig erbärmlich, dass er offenbar erst gegen das Mädchen ankam, wenn sie unbewaffnet und völlig verängstigt war. Er stand jedoch drüber. Es entwickelte sich langsam, aber sicher zu einer persönlichen Angelegenheit. Da sie kein Eisenkraut zu sich nahm (Warum eigentlich nicht?), wollte er ihr nicht nur das Genick brechen, sondern ihr das köstliche Blut stehlen, das durch ihre Adern floss.
»Hey, was ist hier los?«, erklang eine männliche Stimme hinter ihm.
Der Vampir war zu sehr auf Linett (die inzwischen einen leicht erstickten Eindruck machte) fixiert gewesen, um auf Schritte in seinem Rücken zu achten. Genervt gab der Vampir ein Seufzen von sich. Seine Hand war natürlich rein ›zufällig‹ zu ihrem Hals gewandert. Vielleicht, weil er eine solche Wut auf das Frauenzimmer hegte, dass der Gedanke, sie zu erwürgen ungemein befriedigend erschien.
Die Resignation in den braunen Augen Linetts wich ungläubiger Freude. Sie zögerte keinen Moment, sich nachdrücklich aus seinem inzwischen lockeren Griff zu befreien und zuzusehen, dass sie aus seiner Reichweite kam.
»Er ist nur ein Idiot, der einen lockeren Flirt zu ernst genommen hat«, erwiderte Linett die Frage, gepaart mit einem verächtlichen Blick, den Jeremy mit einem mordlüsternen beantwortete.
»Das sah mir aber nicht nur nach einem missverstandenen Flirt aus!«, murrte einer der beiden Männer, die sich anhand der Uniformen als Streifenpolizisten herausstellten und sichtlich etwas gegen Jeremys rüdes Verhalten hatten.
Nun gut, vor dem Hintergrund, dass Jeremy soeben einen Mord versucht hatte (im Übrigen wieder einmal erfolglos), konnte man das durchaus nachvollziehen. Versuchter Mord (Jeremy würde es eigentlich auch eher als Notwehr deklarieren) wurde von den wenigsten Ordnungshütern entspannt aufgenommen.
In Anbetracht der Tatsache, dass die beiden vorsichtshalber ihre Dienstwaffen gezückt hatten, hielt es Jeremy für angebrachter, sich vorerst ruhig zu verhalten und davon abzusehen, sofort die lästigen Zeugen zu beseitigen.
Erstaunlicherweise verzichtete Linett darauf zu erklären, dass er bereits zum zweiten Mal versucht hatte, sie zu töten. Was auch immer sie sich dabei dachte, sie beharrte trotz der skeptischen Nachfragen der Polizisten auf ihrer Version. Für ihn selbst immer noch ein Grund, sich zu wundern, denn gepaart mit ihrer Geschichte, was den Mord an ihrem Mitbewohner betraf, könnte sie ihm mit der Wahrheit eine ordentliche Portion Ärger bescheren. So wie der Vampir erstaunt war, waren die Polizisten im gleichen Maße unzufrieden.
»Geh nach Hause und komm morgen beim Präsidium vorbei«, rieten sie ihr nicht sonderlich überzeugt, um sich dann wesentlich unfreundlicher dem Vampir zuzuwenden.
»Und Ihnen wird eine Nacht im Knast ganz guttun, um zu lernen, wie man Damen behandelt!«, blaffte ihn der größere der beiden an, was bei Jeremy für einen spöttischen Gesichtsausdruck sorgte. Wollten sie ihn verhaften?
Doch Jeremys Aufmerksamkeit wanderte schnell wieder zu seinem abtrünnigen Opfer, und frustriert musste er mit ansehen, wie sich Linett eilig vom Ort des Geschehens entfernte. Logisch, dass sie nicht auf ihn warten wollte, um sich wieder einfangen zu lassen.
»Umdrehen!«, herrschte ihn der Polizist bereits zum zweiten Mal an und griff nach seinem Arm.
Man konnte es nicht oft genug betonen: Menschen waren dumm. Man nehme zwei Männer, die mit ihren Knarren aus sicherer Entfernung auf einen Vampir zielten, und man würde einen Vampir erhalten, der sich kooperativ verhielt. Auch wenn die Selbstheilung einiges richten konnte, standen doch die wenigsten Vampire auf Schmerzen. Und Kugeln taten von Natur aus weh! Aber was machten diese beiden erbärmlichen Wichte? Sie stapften geradewegs in Jeremys Reichweite!
Viel Zeit zum Bereuen hatte keiner von ihnen, denn der Vampir schleuderte den Ersten mit Leichtigkeit gegen seinen Kameraden, sodass beide fluchend und stöhnend ineinander verkeilt zu Fall kamen. Der kräftige Vampir verlor keine Zeit und zögerte nicht, dem Kleineren das Genick zu brechen und dem anderen die zweifelhafte Ehre zuteilwerden zu lassen, als Jeremys Snack zu enden. Betörend aromatisch hinterließ dessen Blut einen metallischen Nachgeschmack auf seiner Zunge, und viel zu schnell war dieser kurze Rausch der Glückseligkeit vorbei. Doch endlich verflüchtigten sich auch die letzten Nebenwirkungen des Eisenkrautes, und sein Kopf wurde wieder klar wie eh und je. Achtlos ließ er den erschlafften Körper auf den Boden fallen, wischte sich mit dem Daumen den letzten Rest Blut von den Lippen und sah zu, dass er zu der Straße zurückkehrte, in der Linett geparkt hatte.
Natürlich. Der Wagen war fort. Fluchend trat der Vampir gegen eine der Mülltonnen, die prompt mit einem lauten Knall umkippte und ihren stinkenden Inhalt über die Straße verteilte. Mit einem angewiderten Blick verzog sich der Vampir in eine andere Ecke, die nicht seine überempfindlichen Geruchssinne beleidigte.
Das Mädchen entwickelte sich zu einer Herausforderung. Sie hatte mehr Glück als Verstand. Was man von den beiden toten Polizisten nicht behaupten konnte.
Deren Leichen versenkte Jeremy mit einem Bündel Steine in einem offen stehenden Abwasserkanal. Wenn sie in ein paar Tagen wieder hochkamen, würde niemand an den aufgedunsenen Leichen nach einer Bisswunde suchen.
Kapitel 3 – Wenn die Maus die Katze in die Falle lockt
Es war geradezu lächerlich einfach.
Jeremy fand Linetts verbeulten Toyota am nächsten Bahnhof. Der schnelle Check von Linetts Konto über sein Smartphone (ja, ja, die Segnungen der Technik) zeigte die Abbuchung für ein Zugticket. Sogar der Zielort war bei der Buchung angegeben. Er liebte die Genauigkeit der Buchhalter.
Die klügste Idee war die Flucht nicht, doch zeigte sie, wie sehr Linett in Panik war. Sie versuchte verständlicherweise Hals über Kopf zu fliehen und dabei so wenig wie möglich von ihrem Geld auszugeben. Pech, wenn man auf der Flucht knapp bei Kasse war.
Allerdings ging es in diesem Fall sogar auf einer Fuchsjagd humaner zu. Das Versteckspiel, das sich zwischen den beiden entwickelte, war nicht mehr als feierlich zu bezeichnen. Der Vampir lenkte seinen Wagen in den Ort, bis zu welchem Linett das Ticket gelöst hatte, und kümmerte sich nicht im Geringsten um die Geschwindigkeitsbegrenzung. Doch weitere Polizistenleichen blieben vorerst aus, da ihn niemand an- oder gar aufhielt.
So verkürzte er den Vorsprung Linetts auf etwa drei Stunden. Die Straßen in Cassis, in der Nähe von Marseille, waren menschenleer. Offenbar ging man hier bereits um fünfzehn Uhr ins Bett. Nicht einmal Kleinkriminelle streiften durch die Gassen. Am Bahnhof befragte Jeremy die Angestellten und erfuhr zumindest, dass Linett beim Aussteigen gesehen worden war, jedoch nicht, dass sie in einen anderen Zug eingestiegen war.
Was wollte sie hier? Sich in der Dorfkirche verstecken? Okay, nicht die schlechteste Idee, wenn man von einem Vampir verfolgt wurde, bekam dieser doch bereits beim Betreten geweihter Räume fürchterliche Kopfschmerzen, die jeder zehnfachen Migräne alle Ehre machten. Trotzdem glaubte er nicht daran, dass sie an einem solchen Ort Zuflucht suchte. Vielmehr ging er davon aus, dass sich Linett ein Zimmer gesucht hatte. In einem Dorf wie diesem nicht sonderlich einfach. Unangemeldete Besucher wurden misstrauisch beäugt, vor allem am Abend. Strategisch arbeitete sich der Vampir durch die Pensionen und wenigen angebotenen Privatzimmer, doch nirgends hatte man Linett gesehen. Sofern sie nicht auf der Straße (oder eben in einer Kirche) schlief, konnte sie kaum unerkannt untergekommen sein, es sei denn, sie kannte hier jemanden.
Das leise Summen des Telefons störte die abendliche Stille.
»Wie sieht’s aus?«, hörte Jeremy die Stimme seines Chefs, kaum, dass er den Anruf angenommen hatte.
»Warum so eilig?«, lautete seine Gegenfrage.
»Schon vergessen, dass du noch anderes zu tun hast, als mit einer Zwanzigjährigen zu spielen? Mach kurzen Prozess!«
Ach nein, auf die Idee war Jeremy ja so gar nicht gekommen. Lautstark knirschte er mit den Zähnen.
»Sie ist entwischt, aber den Morgen wird sie nicht erleben«, versprach der Vampir unbeirrt. Für einen Moment herrschte Stille am anderen Ende der Leitung.
»Wie das?«
Jeder andere würde auf das offenkundige Versagen bei einem leichten Spiel mit Genervtheit, Zorn und mindestens einer Rüge reagieren. Nicht so sein Chef. Der klang lediglich neugierig. Jeremy lieferte ihm eine knappe Zusammenfassung, gepaart mit einigen Beschimpfungen, die sich deutlich auf Linett bezogen. Und was bekam er dafür? Schallendes Gelächter dröhnte aus dem Telefon.
»Wahnsinnig witzig«, knurrte der Blutsauger, während ihm vom anderen Ende dreimal ein gelachtes ›mit einer Pfanne, ich geh ein‹ entgegenschlug.
»Weißt du, ob sie Verwandte in Cassis hat?«, unterbrach Jeremy entnervt das Gegacker.
»Ja, einen Onkel, der gerade im Urlaub ist …«, sagte sein Chef schließlich und stellte, dem Himmel sei Dank, endlich das belustigte Prusten ein, »… ich schick dir die Adresse.«
Nur zwei Minuten nach dem Ende des Telefonats erhielt Jeremy nicht nur die Adresse von Linetts Onkel, sondern auch die Information, dass sich sein Auftrag geändert hatte. Wer hätte das heute früh für möglich gehalten?
Suchend irrte er durch die Gassen, bis er schließlich die richtige Straße fand und an deren Ende ein windschiefes Haus, das dringend eine Renovierung nötig hatte. Die Wahl ihrer Absteigen wurde zunehmend schäbiger.
Zudem schallte laute Musik aus dem Haus. Die nicht vorhandenen Nachbarn fühlten sich vielleicht davon nicht gestört, das Gedröhne erinnerte ihn jedoch an den Club. Möglich, dass es sogar die gleiche Musik war. Jedoch war sie diesmal mit sehr hohen Frequenzen gemischt, sodass der Vampir bereits die Kopfschmerzen fühlte, die sich langsam anbahnten. War das moderne Musik? Wenn ja, dann war sie zum Kotzen.
Jeremy rechnete bereits mit einem dauerhaften Tinnitus, trotzdem wagte er sich todesmutig in das Innere des Hauses.
Linett war hier. Er konnte sie riechen. Leider konnte er nichts hören, denn durch die Musik würde es ihn nicht wundern, wenn bereits Blut aus seinen Ohren lief. Es klang, als hätte jemand das Lied mithilfe von Hundepfeifen komponiert oder als würde jemand beharrlich mit den Fingernägeln über eine Tafel kratzen. Auch auf das Risiko hin, nicht mehr unbemerkt zu bleiben, marschierte Jeremy geradewegs in das Wohnzimmer und stellte das verdammte Ding aus. Herr im Himmel, gesegnet sei diese himmlische Ruhe. Lediglich ein beharrliches Fiepen blieb in Jeremys Ohr zurück, das er sich gerade rieb.
Seufzend und wahnsinnig erleichtert drehte er sich um. Die Erleichterung hielt nicht lange an. Sicher, das nervtötende Geschlatze hatte aufgehört, jedoch hatte er auch Linett gefunden. Eigentlich ein Grund zur Freude. Wenn man ignorierte, dass sie wieder einmal eine Waffe auf ihn richtete. Auch wenn ihre Hände verdächtig zitterten, so wiegte sich der Vampir nicht in falscher Sicherheit. Das Zimmer war zu klein, um ausweichen zu können. Sie bräuchte kaum die Haltung der Waffe zu verändern. Egal, in welcher Ecke des Zimmers er gerade wäre, sie würde ihn treffen, sobald sie abdrückte. Dass er sie nicht bemerkt hatte, lag daran, dass sie hinter der Tür gestanden hatte, und der Vampir empfindlich abgelenkt gewesen war.
»Schon wieder betäuben?«, fragte der Vampir mit fehlender Begeisterung, dafür mit einer gewissen Portion Resignation. Offenkundig war er viel zu durchschaubar. Das hatte man davon, wenn man sich mal der direkten und einfachen Methoden bedienen wollte, anstatt hundertfünf Fallen zu stellen. Und wie viele Waffen hatte das Weib eigentlich? Als der Vampir das letzte Mal nachgesehen hatte, lag ihre Keksdosenwaffe noch unter der Mülltonne.
»Diesmal sind es keine Kanülen«, informierte ihn Linett mit leicht überschlagender Stimme, leichenblass, aber mit einem sehr entschlossenen Zug um die Lippen.
Sein Blick wurde um einiges skeptischer. Keine Kanülen. Das ließ nicht sonderlich viel Spielraum für andere Dinge. Es waren also Kugeln. Und so wie er sie inzwischen kannte, wohl Kugeln mit Eisenkraut-Upgrade. Das könnte schmerzhaft werden. Da sie ihn bereits mit einer Pfanne verprügelt und betäubt und zudem noch hatte verhaften lassen, spekulierte er lieber nicht auf ihr weiches Herz.
Jeremy machte sich keine Illusion. Sie würde abdrücken. Sie würde ihm vielleicht keine tödlichen Schüsse verpassen, aber auch alles andere würde ausreichen, um ihm empfindlichen Schaden zuzufügen. Logisch, dass der Vampir darauf keine Lust hatte. Allerdings konnte dieser nicht verleugnen, dass die Aktion hier dem ganzen Spektakel noch einmal die Krone aufsetzte und damit auch den Wunsch seines Chefs untermauerte.