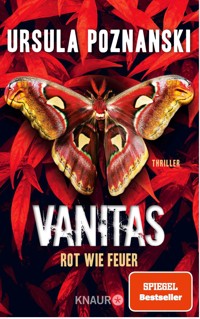
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Vanitas-Reihe
- Sprache: Deutsch
Blumig, blutig, feurig - Teil 3 der Vanitas-Serie von Bestseller-Autorin Ursula Poznanski Der Abschluss der hochspannenden Thriller-Trilogie für Erwachsene: Die geheimnisvolle Blumenhändlerin zeigt ihr wahres Gesicht! Ihre Verfolger haben sie in Wien aufgespürt. Die österreichische Polizei sucht sie in Zusammenhang mit einem Mordfall. Völlig auf sich allein gestellt tritt Blumenhändlerin Carolin die Flucht nach vorne an: Sie fährt nach Frankfurt, in die Hochburg ihrer Feinde, in die Höhle des Löwen. Für sie die gefährlichste Stadt der Welt, aber auch die, in der man sie zuletzt vermuten würde. Und gleichzeitig der einzige Ort, an dem sie die Chance sieht, ihrem Alptraum ein Ende zu setzen. Ausgerüstet mit ihrem Wissen über den russischen Karpin-Clan, über Schwächen, Gewohnheiten und alte Feindschaften ihrer Gegner, beginnt Carolin, Fallen zu stellen und ein Netz aus Intrigen zu weben. Schon bald zieht sie eine blutige Spur durch Frankfurt - nur leider scheint es, als wäre ihre Rückkehr doch nicht unentdeckt geblieben … "Am Ende des Buches baut Ursula Poznanski einen Cliffhanger ein, sodass man sehnsüchtig Band drei herbeisehnt." Wiener Zeitung zu "Vanitas - Grau wie Asche" Die weiteren Bände der Thriller-Serie: Vanitas - Schwarz wie Erde Vanitas - Grau wie Asche
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ursula Poznanski
VANITAS
Rot wie FeuerThriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ihre Verfolger haben sie in Wien aufgespürt. Die österreichische Polizei sucht sie in Zusammenhang mit einem Mordfall. Völlig auf sich allein gestellt tritt Blumenhändlerin Carolin die Flucht nach vorne an: Sie fährt nach Frankfurt, in die Hochburg ihrer Feinde, in die Höhle des Löwen. Für sie die gefährlichste Stadt der Welt, aber auch die, in der man sie zuletzt vermuten würde. Und der einzige Ort, an dem sie ihrem Alptraum ein Ende setzen kann. Ausgerüstet mit ihrem Wissen über den Karpin-Clan, über Schwächen, Gewohnheiten und alte Feindschaften ihrer Gegner, beginnt Carolin, Fallen zu stellen und ein Netz aus Intrigen zu weben. Schon bald zieht sie eine blutige Spur durch Frankfurt – nur leider scheint es, als wäre ihre Rückkehr nicht unentdeckt geblieben ...
Inhaltsübersicht
Notiz 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Notiz 2
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Notiz 3
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Notiz 4
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Notiz 5
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Notiz 6
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Notiz 7
29. Kapitel
Notiz 1
Ich war dabei, als wir den Polizisten zerstört haben. Normalerweise habe ich für diese Quälereien nichts übrig, sie sind abstoßend und entwürdigend. Vor allem für den Gequälten, aber auch für den, der die Zange, den Schneidbrenner, den Elektroschocker hält. Beide verlieren alles Menschliche.
Doch im Fall des Polizisten war es leider unausweichlich, wir mussten wissen, was er wusste, und natürlich hat er es uns gesagt. Jeder hätte das. Die Information war wertvoll, wenn auch nicht für alle von uns auf die gleiche Weise. Er erzählte uns, dass seine Abteilung ihre Konzentration in letzter Zeit stärker auf die libanesischen Clans richte als auf die russischen. Zu seinem Bedauern. Dass sie aber immer noch nichts Konkretes gegen uns in der Hand hätten, außer dieser einen Zeugin, die sie sofort aus dem Hut zaubern könnten, wenn Andrei wiederauftauchen würde.
Dass die Frau sich nach Wien abgesetzt hatte, ahnten wir bereits, nun kannten wir die Details. Das hieß, sie würde nicht mehr lange zu leben haben. Einer unserer Leute telefonierte sofort mit Andrei im Exil. Es wurde gefeiert. Danach wurden Pläne geschmiedet.
Ich feierte nicht mit, doch die Pläne überprüfte ich genau. Studierte sie geradezu. Schließlich hatte ich meine eigenen.
Wir töteten den Polizisten nicht; nicht körperlich jedenfalls. Aber er wird niemandem mehr von Nutzen sein. Abgelegt wurde er nahe dem Territorium der Libanesen – sollen die sich mit den Ermittlern herumschlagen, nachdem sie praktischerweise schon im Fokus stehen.
In dieser Nacht hielt ich meine Liebste im Arm, hielt sie fester als sonst. Sie war melancholisch und schweigsam, ganz anders als normalerweise.
»Keine Sorge«, flüsterte ich ihr ins Ohr. »Es liegen goldene Zeiten vor uns.«
1.
Der Club ist brechend voll, so wie schon in den beiden Nächten zuvor. Ein weißblondes Mädchen tanzt auf dem Podium in der Mitte, rundum bewegen sich Körper im zuckenden Licht des Stroboskops, die Stufen, die ich hinuntersteige, sind klebrig von verschütteten Drinks.
Im Vorbeigehen rempelt jemand mich an, ich halte mich am Geländer fest, und da sehe ich ihn. Zwei Abende habe ich mich umsonst hergequält, aber heute ist er gekommen. Boris lässt nur selten von lieben Gewohnheiten ab, und das Duplex war schon immer sein zweites Zuhause.
Es ist fast eineinhalb Jahre her, dass ich ihn zuletzt gesehen habe – wir also im gleichen Raum waren, die gleiche Luft geatmet haben. In meinem Kopf und meinen Albträumen war er dafür Stammgast, vielleicht liegt es daran, dass er mir kleiner scheint, als ich ihn in Erinnerung hatte.
Sein Haar ist immer noch millimeterkurz abrasiert, neu ist allerdings der Bart, den er trägt. Ein blondes Musketierbärtchen, und das bestätigt mir, dass Andrei nicht im Land sein dürfte. Er schätzt keine Gesichtsbehaarung bei seinen Leuten.
Ohnehin gibt es keinen Hinweis darauf, dass Andrei seit der Nacht in der Halle, der Nacht meines vermeintlichen Todes, wieder in Deutschland gesehen wurde. Es war zu knapp für ihn, damals, und nachdem Zweifel an meinem Ableben aufgekommen sind, wird er das Land weiterhin meiden. Wohl bis die aussagefreudige Zeugin endgültig beseitigt ist. Die Verräterin. Die Fälscherin, die vom BKA in den Karpin-Clan eingeschleust wurde.
Jetzt lacht Boris, legt den Arm um eine Frau, die ich nur von hinten sehen kann, hebt sein Bierglas an die Lippen, und plötzlich glaube ich, Benzin und verbranntes Fleisch zu riechen. Der Anblick des realen Boris ist wie Öl im Feuer meiner Erinnerungen. Sie flammen hoch und leuchten jeden Winkel aus.
Über ein Jahr lang habe ich alles versucht, um das zu vermeiden. Ich lege mir unwillkürlich die Hand an den Brustkorb. Dorthin, wo Boris’ Kugel ihn durchschlagen hat.
Later Bitches, dringt es nun ohrenbetäubend aus den monströsen Boxen an der Tanzfläche, und ich nehme das als Aufforderung zu gehen. Für den Augenblick weiß ich genug. Boris ist in der Stadt, was bedeutet, die anderen sind wohl auch hier.
Ich drehe mich um, steige langsam die Treppe nach oben. Nicht aus Angst, dass er mich erkennen könnte – ich habe mich getarnt, und er ist nicht sehr gut mit Gesichtern. Aber möglicherweise ist auch Vera im Duplex, und ihr Auge ist beängstigend scharf. Es bräuchte mehr als eine Perücke, falsche Zähne und Silikon-Hüftpolster, um sie zu täuschen. Ich bin sicher, sie war es, die mich in München enttarnt hat.
Vera ist die Erste, die ich loswerden muss.
Es ist kein Spaß, nachts in den monströsen Wohnblock zurückzukehren, in dem ich seit einer Woche ein Ein-Zimmer-Appartement gemietet habe. Ich muss durch eine schlecht beleuchtete Grünanlage und über einen großen Parkplatz, überall finden sich Ecken und Nischen, an denen man mir auflauern könnte. Aber ich hatte keine Wahl, ich musste die erste Unterkunft nehmen, die ich mir leisten konnte. Frankfurt ist keine billige Stadt, und ich habe ohnehin ständig das Gefühl, dass sie mir Böses will, egal, in welchem ihrer Winkel ich mich befinde. Die unzähligen Fenster der Wolkenkratzer sind wie Augen, die in die Nacht leuchten, alles beobachten, mich ständig im Blick behalten. Frankfurt ist Feindesland, es ist das Territorium der Karpins.
Als einzigen Vorteil an meiner Wohnung empfinde ich die Tatsache, dass sie nur fünf Minuten vom Südfriedhof entfernt liegt, dort verbringe ich jeden Tag wenigstens eine halbe Stunde und fühle mich zu Hause. Ich wandere zwischen den Gräbern umher, lese die Inschriften und frage mich, was Eileen und Matti jetzt von mir denken. Ob sie sich Sorgen machen. Ob sie Probleme bekommen haben – vielleicht sogar mit Andreis Leuten. Ich gehe jeden Tag die Nachrichten aus Österreich durch, aber zum Glück habe ich bisher nichts entdeckt, was auf Gewalttaten in einer Blumenhandlung beim Zentralfriedhof schließen lässt.
Zurück in Frankfurt zu sein fühlt sich an, als wäre ich mit knapper Not aus einem brennenden Haus entkommen und anschließend freiwillig wieder hineinspaziert. Die Entscheidung ist genauso lange genial, wie keiner aus dem Clan auf die Idee kommt, dass ich etwas so Abwegiges tun könnte. Mit ein wenig Glück suchen die Karpins mich noch in Wien und Umgebung. Damit, dass ich irre genug sein könnte, mich direkt unter ihre Nase zu setzen, rechnen sie nicht – hoffe ich. Sobald sie auch nur die kleinste Vermutung haben, bin ich verloren.
Ich fahre mit dem Aufzug in den fünften Stock und schließe die Tür auf. Achtundzwanzig Quadratmeter für fünfhundert Euro Miete – wenn ich sehr sparsam lebe, kann ich mir das zwei Monate lang leisten. Auf mein Wiener Konto darf ich nicht zugreifen, immerhin sucht die Polizei mich in Zusammenhang mit einem Mordfall. Allerdings sucht sie Carolin Bauer, und das bin ich nicht mehr. Ich habe wieder die Schachfigur gewechselt. Nach Bauer und Springer jetzt König.
Das passt, wie ich finde. Einerseits, weil ich vorhabe, im Hintergrund zu bleiben und andere die Arbeit machen zu lassen. Andererseits, weil dies nun die letzte Runde sein wird zwischen Andrei und mir. Am Ende wird einer von uns mattgesetzt sein. Entweder der weiße König fällt – oder der schwarze.
Zwei Monate, das ist nicht viel Zeit für das, was ich mir vorgenommen habe, reicht aber locker, um enttarnt und umgebracht zu werden. Doch immerhin werde ich den ersten Zug machen.
Carolin König hat alle nötigen Papiere, wenn man von einem Reisepass absieht, den ich trotz all meiner Expertise als Dokumentenfälscherin nicht anfertigen kann. Sie hat ein Konto eröffnet bei einer Bank, die ihre Geschäfte hauptsächlich übers Internet abwickelt. Sie hat das gesamte Bargeld, das sie angespart hat, dort eingezahlt. Sie hat ihre achtundzwanzig Quadratmeter Einsatzzentrale, ein Notebook und WLAN. Sie ist so gut gerüstet, wie es eben möglich ist.
Jetzt öffnet sie MyBazar, die große Online-Plattform für Käufe und Verkäufe aller Art. Wenn die Karpins ihren Modus Operandi nicht von Grund auf geändert haben, werde ich dort meinen ersten Köder auslegen können.
Zu der Zeit, als ich für den Clan aktiv war, wurde die Rubrik Briefmarken international häufig genutzt, um Geschäfte auszuhandeln. Anzeigen für Marken aus Südamerika standen für Drogendeals, sogenannte »exotische Marken« für Prostituierte, »nicht entwertet« war der Code für besonders junge Mädchen.
Ich scrolle mich durch die Annoncen, wobei mir klar ist, dass es großteils tatsächlich um Briefmarken geht, die gesucht oder angeboten werden. Ganz unten auf der ersten Seite stoße ich dann auf ein Inserat, das mich aufatmen lässt. Die Plattform wird offensichtlich noch genutzt.
I a Briefmarkensammlung!
Seltene Marken aus Brasilien, 12 Stück, für Kenner.
Preis VB32,– pro Marke, alle zusammen 370,–
Auch einzeln abzugeben. Unversicherter Versand oder Selbstabholung im Raum FFM nach Vereinbarung.
Ich bin beinahe sicher, dass das ein Karpin-Inserat ist. I a steht für das Ashes, einen Kellerclub in der Taunusstraße. Der Kilopreis für Kokain scheint derzeit bei zweiunddreißigtausend Euro zu liegen, das war schon mal mehr. Kann natürlich auch sein, dass die Qualität zu wünschen übrig lässt. Zwölf Kilo sind insgesamt zu haben, es werden aber auch kleinere Mengen verkauft. Selbstabholung bedeutet Übergabe im Ashes, unversicherter Versand heißt dunkler Parkplatz im Niemandsland, der noch ausgehandelt werden muss.
Die Idee, morgen Abend einen Abstecher in den Club zu machen, um vielleicht bekannte Gesichter zu entdecken, verwerfe ich schnell wieder. Die Taunusstraße ist an sich schon kein angenehmes Pflaster, und das Ashes setzt noch einen drauf. Ich war dort immer nur in Begleitung von mindestens zwei oder drei Karpin-Leuten und trotzdem ständig auf der Hut. Das Lokal alleine zu betreten wäre einfach nur idiotisch.
Nein. Ich werde meinen eigenen Köder auslegen, und zwar so, dass er die exakt richtige Beute anlockt. Dafür muss ich klar im Kopf sein, also verschiebe ich das Vorhaben auf morgen, wo allerdings auch schon zwei weitere Aufgaben auf ihre Erledigung warten.
Das Auto, mit dem ich aus Wien gekommen bin, habe ich ein paar Kilometer entfernt abgestellt, in der Nähe des Ostparks. Ich kann es hier nicht benutzen, die Karpins wissen, dass mein letzter Standort Wien war. Aber ich will auch nicht, dass die Besitzerin Schwierigkeiten bekommt, also muss ich es möglichst bald in die Peripherie umparken und die Nummernschilder entfernen.
Noch wichtiger ist mir aber, endlich herauszufinden, was mit Robert passiert ist. Alle meine telefonischen Kontaktversuche während der Zeit der Grabschändungen waren erfolglos, man konnte mir beim BKA nur sagen, dass Kriminalhauptkommissar Robert Lesch nicht erreichbar sei. Bis auf Weiteres. Aus gesundheitlichen Gründen. Also habe ich nach wie vor keinen Verbündeten bei der Polizei, niemanden, der meine Geschichte kennt und die Hand über mich hält.
Wiesbaden ist nur einen Katzensprung entfernt, doch ich muss mein Vorhaben geschickt anpacken. Einfach beim BKA reinspazieren ist schon deshalb unmöglich, weil ich von der Wiener Polizei gesucht werde; wahrscheinlich fahndet längst auch Interpol nach mir.
Ich hätte Tassani in Wien reinen Wein einschenken sollen, im Nachhinein betrachtet. Er ist Kriminalpolizist, aber kein klassischer Beamtentyp. Hätte ich ihm von den Karpins und meinem Versteckspiel erzählt, wäre ich nicht automatisch die Hauptverdächtige gewesen, auch wenn der Tote in meiner Wiener Wohnung gefunden wurde.
Robert endlich aufzustöbern würde so viele meiner Probleme auf einmal lösen, er könnte sich mit den österreichischen Kollegen in Verbindung setzen und mich aus der Schusslinie nehmen. Gleichzeitig wäre Einmischung von seiner Seite Gift für mein Vorhaben. Das, was ich plane, dürfte er nicht gutheißen.
Ich fahre den Computer runter und lege mich ins Bett. Morgen stelle ich die Figuren auf, die schwarzen und die weißen, und setze meinen ersten Zug. Keine schottische Eröffnung, sondern eine armenische.
Rubrik: Küchenzubehör
24 Pakete bunte Strohhalme!
Ich verkaufe auch einzeln, das Paket für 1,90 €
Alle zusammen nur 36 €. Garantierter Spaß auf eurer nächsten Party!
Selbstabholung in FFM, sonst Versand gegen Porto!
Es ist sieben Uhr morgens, ich habe mir ein MyBazar-Konto angelegt und ein Inserat geschaltet, das dem ahnungslosen Betrachter völlig hirnverbrannt vorkommen muss, denn Strohhalme bekommt man in jedem Supermarkt günstiger. Kokain allerdings nicht, und das ist der entscheidende Punkt.
Die Malakyans, ein armenischer Clan und seit jeher Andreis Lieblingsfeinde, verkaufen es in großem Stil, ebenso wie Crack und Marihuana. Strohhalm-Inserate haben sie in losem Abstand immer wieder geschaltet, früher. Das von mir verfasste verspricht ein Kilo Koks für neunzehntausend Euro, damit unterbiete ich das Karpin-Angebot bei Weitem.
Mit einer Reaktion rechne ich frühestens morgen oder übermorgen, also habe ich heute ausreichend Zeit für einen Ausflug.
Mein Haar ist zwar mausbraun und unauffällig, trotzdem verstaue ich es unter einer Baseballkappe, über die echten Schneidezähne habe ich mir falsche gesteckt, die ein wenig vorstehen, mein T-Shirt ist in der Logo-Farbe eines bekannten Paketservice gehalten. In dem Päckchen, das ich unter dem Arm trage, steckt ein Exemplar von Tolstois »Krieg und Frieden«. Sollte Robert es wirklich bekommen, versteht er vielleicht die Russland-Anspielung.
Ich habe keine Ahnung, in welchem der Gebäude sich seine Abteilung befindet, aber man würde mich ohnehin nicht hineinlassen. Ich kann also genauso gut einfach bei den Beamten an der Einfahrt mein Glück versuchen. Lächelnd steuere ich auf das dazugehörige Wachgebäude zu.
»Ich habe ein Paket für Robert Lesch.«
Die beiden Männer tauschen einen Blick. »Für wen?«, fragt der, der draußen an der Schranke steht.
»Robert Lesch.« Mit gerunzelter Stirn gebe ich vor, das Etikett zu studieren. »Buchsendung, an Herrn Robert Lesch, BKA Wiesbaden, Thaerstraße 11.« Ich sehe den im Wachgebäude eine Liste zurate ziehen und dann leicht den Kopf schütteln. Wieder ein schnell gewechselter Blick mit dem Kollegen, vielsagend diesmal. »Den finden Sie hier nicht.«
»Oh.« Ich tue verwirrt. »Aber die Adresse stimmt doch? Können Sie es nicht entgegennehmen?«
Entschiedenes Kopfschütteln von beiden Beamten. »Ist es eine Privatsendung?«, fragt der an der Schranke.
»Ich denke schon. Kommt von einer, Moment … von einer Kerstin Machek.« Ich blicke auf. »Verraten Sie mir seine neue Arbeitsstelle oder seine Adresse? Dann versuche ich, es dort zuzustellen.« Wieder lächle ich die beiden an, was bei den falschen Vorderzähnen kein schöner Anblick sein kann.
»Dazu sind wir nicht befugt«, erklärt der im Wachgebäude. »Die Absenderin dürfte Herrn Lesch auch nicht besonders gut kennen, wenn sie meint, er würde noch etwas mit einem Buch anfangen können.« Er verstummt unter dem Blick seines Kollegen und zuckt verlegen die Schultern. »Stimmt doch«, fügt er leise an.
In mir zieht sich alles zusammen, nach außen hin gebe ich mich maßvoll genervt. »Na gut, dann nehme ich es eben wieder mit.« Ich ziehe einen Stift aus meiner Jackentasche, kritzle Empfänger verzogen auf das Formular an meinem Clipboard und trete den Rückzug an. »Freund und Helfer, von wegen«, brumme ich im Gehen so laut, dass sie es hoffentlich noch hören. Motzigkeit macht unverdächtig.
Eine Stunde später bin ich zurück in meiner winzigen Wohnung. Ein schneller Blick auf MyBazar, aber bis jetzt interessiert sich noch niemand für die Strohhalme. Ich trete auf den Balkon hinaus.
Der Trip zum BKA hat mir keinen Kontakt zu Robert eingebracht, dafür aber die unschöne Gewissheit, dass etwas mit ihm sicher nicht in Ordnung ist. Er kann mit einem Buch nichts mehr anfangen, das heißt, er ist entweder tot oder liegt im Koma. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche.
Natürlich könnte es sein, dass er einen ganz gewöhnlichen Herzinfarkt oder Schlaganfall gehabt hat – er ist starker Raucher und ernährt sich fast ausschließlich von Fast Food. Aber schon, als ich versucht habe, ihn aus Wien zu kontaktieren, klang sein Vorgesetzter am Telefon so, als stecke mehr hinter Roberts Krankenstand.
Irgendwo unter mir reißt jemand ein Fenster auf, laute Hip-Hop-Musik schallt ins Freie. Ich kehre in die Wohnung zurück, setze mich noch einmal vor den Computer. Wenn meine Vermutung stimmt und jemand Robert so schlimm zugerichtet hat wie mich damals – oder noch schlimmer –, dann müsste er in einem der Frankfurter Krankenhäuser liegen. Vielleicht sogar dort, wo man mir vor eineinhalb Jahren die Kugeln aus dem Körper geholt hat.
Google spuckt mir drei vielversprechende Möglichkeiten aus. Ich setze die hässlichen Vorderzähne wieder ein, klemme mir den Tolstoi unter den Arm und mache mich auf den Weg.
Weil es näher liegt, fahre ich zuerst zum Universitätsklinikum. Die Stationen der Unfallchirurgie liegen zentral auf dem Gelände, in den Gebäuden 23 und 11A. Ich streiche mir das Haar aus der Stirn, setze einen gehetzten Gesichtsausdruck auf und tue, als würde ich Daten auf meinem Clipboard studieren. Sobald mich jemand fragt, warum ich keinen Handscanner verwende, komme ich in Erklärungsnot.
»Ich habe ein Paket für Robert Lesch«, nuschle ich am Empfang. »Können Sie es weiterleiten? Oder mir sagen, in welchem Zimmer ich ihn finde?«
Die Frau hinter der Scheibe nimmt ihre Brille ab, wendet sich dem Computerbildschirm zu, scrollt. »Lesch, sagen Sie? Der soll hier sein?«
Ich gebe vor, es noch mal zu kontrollieren. »Ja. Unfallchirurgie des Universitätsklinikums. Das ist doch hier?«
»Schon. Eigentlich.« Sie weist mit dem ausgestreckten Finger zur Tür. »Versuchen Sie es auf 11A. Hier finde ich ihn nicht.«
Ich tue, was sie vorschlägt – ohne Erfolg. Robert ist nicht hier. War wohl nie hier, denn auch unter den kürzlich Entlassenen findet die Frau am Empfang ihn nicht.
Also mache ich mich auf den Weg zur Unfallklinik Frankfurt am Main und gestehe mir jetzt erst ein, dass ich mir das gern erspart hätte. Dort hat mein Leben tagelang auf Messers Schneide gestanden, nach der fünfstündigen Operation, in der die Chirurgen alle Kugeln entfernt und den Schaden so gut wie möglich geflickt hatten.
Wie lebendig all das in mir noch ist, wird klar, als ich das Haus betrete und der Geruch mich sofort neunzehn Monate zurückkatapultiert. Ich muss mich kurz an der Wand festhalten, mich auf meinen Atem konzentrieren. Unwillkürlich fährt meine Hand zu der Narbe an der rechten Seite des Brustkorbs, und ich rufe mich zur Ordnung. Schluss jetzt. Ich straffe mich, marschiere auf den Empfang zu. Kenne ich den Portier, der dort sitzt und telefoniert? Und, noch entscheidender: Kennt er mich?
Ich warte, bis er das Gespräch beendet hat, dann räuspere ich mich. »Ich habe ein Paket für Robert Lesch. Kann ich das bei Ihnen abgeben?«
Der Mann tippt etwas in seinen Computer und schüttelt entschieden den Kopf. »Tut mir leid, da sind Sie zu spät. Der ist längst entlassen worden.«
Die Erleichterung lässt mir buchstäblich die Knie weich werden. »Ach. Das heißt also, dass … wir es an seine Privatadresse zustellen müssen?«
»Glaube nicht, den haben sie in Reha geschickt.« Er hebt die Schultern. »Wahrscheinlich nach Wiesbaden, aber nageln Sie mich nicht fest.«
»Danke.« Ich mache kehrt, mein Herz schlägt doppelt so schnell wie sonst. Wiesbaden, gibt es dort ein Rehazentrum? Ich war da jedenfalls nicht, mich hat man schnellstmöglich über die Grenze geflogen, in ein abgelegenes Rehazentrum im niederösterreichischen Waldviertel. Unter lauter Menschen, die mindestens doppelt so alt waren wie ich und ebenfalls eine halbe Stunde für die Durchquerung eines Therapieraums brauchten, habe ich mich an meinen neuen Namen gewöhnt. Carolin. Bauer. »Guten Morgen, ich bin Carolin, ich habe einen schweren Unfall gehabt.«
Zweimal hat Robert mich dort besucht. Wenn ich kann, werde ich die Geste jetzt erwidern.
Auf dem Weg zur U-Bahn-Station google ich Rehabilitation Wiesbaden und bekomme ein neurologisches Zentrum ausgespuckt. Von der Friedberger Landstraße aus brauche ich etwa eineinhalb Stunden.
Noch bevor ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe, setzen sich meine Beine bereits in Bewegung; ich habe Glück, die S-Bahn fährt sofort ein, als ich an der Station ankomme.
Zum zweiten Mal mache ich mich also heute auf den Weg nach Wiesbaden. Hat man Robert dort zur Reha gebracht, damit seine Kollegen ihn öfter besuchen können? Oder besser beschützen?
Das Päckchen mit Krieg und Frieden sieht mittlerweile ein wenig ramponiert aus, aber ich drücke es an mich wie einen Talisman. Obwohl ich Robert vielleicht besser etwas anderes mitbringen sollte. Blumen beispielsweise. Weiße Rosen für einen Neuanfang, Bambus für Langlebigkeit, Disteln für Kraft und Ginster für Zuversicht.
Unwillkürlich lache ich auf; das wäre ein eigentümlicher Blumenstrauß geworden. Eine Frau dreht sich nach mir um, schüttelt den Kopf und wendet mir wieder den Rücken zu. Ich rufe mich selbst zur Ordnung, konzentriere mich auf meine Umgebung. Es ist Feindesland hier und auffälliges Benehmen keine gute Idee.
Das neurologische Rehazentrum liegt in einer Allee, es gibt ein paar Wohnhäuser in der Nachbarschaft und sehr viel Grün. Ich bin gewappnet, mein Sprüchlein aufzusagen – Päckchen für Robert Lesch –, sehe aber, noch bevor ich das Gebäude betrete, dass viele Patienten das schöne Wetter nutzen und die Sonne im Park genießen.
Ich drehe also ebenfalls erst eine Runde durch die Anlage. Niemand hält mich auf, niemand fragt, wohin ich möchte, denn es ist Besuchszeit. Zwei ältere Damen überholen mich, eine davon trägt eine Kuchenschachtel.
Es dauert keine zehn Minuten, bis ich Robert finde, allerdings wird mir das erst weitere zehn Minuten später klar. Beim ersten Mal laufe ich an ihm vorbei, ohne ihn zu erkennen. Dass ich beim zweiten Mal stutze und innehalte, liegt nur an einer einzelnen, schmutzig blonden Haarsträhne, die der Wind ihrem Besitzer ins gesenkte Gesicht bläst.
Ich bin stehen geblieben, zuerst noch in dem Glauben, dass ich mich irre. Die dünne, gebeugte Gestalt im Rollstuhl kann nicht Robert sein, der Mann ist sicher zwanzig Jahre älter. Seine Beine stecken in Schienen, der Kopf hängt seitlich an der Schulter. Er scheint die störende Strähne gar nicht zu bemerken, streicht sie sich nicht aus dem Gesicht, also tue ich es.
Kein Blick, der meinen sucht, kein Zusammenzucken unter der Berührung. Ich lege ihm eine Hand auf die Schulter, vielleicht ist er eingenickt.
»Robert!« Meine Stimme ist merkwürdig hoch und heiser. »Ich bin’s, Carolin. Robert? Hey!«
Keine Reaktion, und natürlich weiß ich schon jetzt, was es geschlagen hat, ich will es bloß nicht wahrhaben. »Carolin Bauer! Der Name war deine Idee, weißt du noch? Bin schon richtig dran gewöhnt jetzt.« Meine eigene falsche Heiterkeit ekelt mich an, ich kann trotzdem nicht damit aufhören. Robert ist der einzige Mensch, der meine ganze Geschichte kennt, und auch wenn er mich die meiste Zeit wie ein praktisches Nutztier behandelt hat – in letzter Konsequenz verdanke ich ihm mein Leben.
Ein paar Schritte entfernt steht eine Parkbank, ich schiebe Robert dorthin und setze mich neben ihn. Auch davon scheint er nichts mitzubekommen. Falls er überhaupt etwas sieht, dann nur seine eigenen, schlaff auf den Oberschenkeln liegenden Hände.
»Ich bin wieder in Frankfurt, seit zehn Tagen. Bin weg aus Wien, nach der Sache mit den Grabschändungen. Die Karpins haben meinen Nachbarn erschossen, aber die Polizei denkt, ich war das.« Vollkommen sinnlos, mein Redeschwall, aber es tut gut, laut auszusprechen, was passiert ist. Und vielleicht, wer weiß, dringe ich irgendwie zu Robert durch, hole ihn zurück in die Welt der Worte und Zusammenhänge. »Ich habe so oft versucht, dich zu erreichen, aber ich konnte nur mit deinem Kollegen Klencke sprechen, und der wollte mir nicht sagen, was los ist. Was ist passiert? Waren das die Karpins?«
Halb und halb erwarte ich, dass der Name etwas in Robert auslösen, ihn wenigstens zucken oder blinzeln lassen wird. Aber sein Gesicht bleibt unverändert. Aus dem linken Mundwinkel läuft Speichel.
»Sie haben dich erwischt, nicht wahr?« Ich stehe auf, trete hinter ihn und finde eine rotblaue Naht am Hinterkopf, nicht weit vom rechten Ohr entfernt. Am Hals heilt etwas aus, das eine Brandwunde sein könnte.
Ich setze mich wieder, greife nach einer von Roberts Händen und halte sie zwischen meinen. Das erste Mal, dass ich ihn freiwillig berühre, glaube ich. Anders als früher sind seine Handflächen trocken und kühl. Die Nägel sind zu lang, die Finger immer noch gelblich verfärbt vom Nikotin. Von der Innenseite des Handgelenks aus zieht sich etwas unter seinen Ärmel, das ebenfalls nach Brandnarbe aussieht.
In mir wächst ein lavaheißer Klumpen, füllt jeden Winkel aus, etwas wie das Gegenteil von Angst. Ich kenne das Gefühl und weiß, wie gefährlich es ist. Es lässt mich Fehler machen, weil es meinen Verstand ausschaltet. Hass ist nur dann eine gute Waffe, wenn er mit einem kühlen Kopf gemeinsame Sache macht.
»Ich bin jetzt wieder hier«, sage ich leise. »Und ich habe ein paar gute Ideen, glaube ich wenigstens. Wahrscheinlich verzettle ich mich und bin in ein paar Tagen tot oder sitze in einem Rollstuhl neben dir. Aber ich kann das mit dem Davonlaufen nicht mehr, verstehst du? Ich kann nicht für den Rest meines Lebens in Deckung bleiben und wissen, dass die Karpins einfach weitermachen. Ich halte die Angst nicht mehr aus, verstehst du das? An jeder Ecke fürchten zu müssen, dass mich einer von ihnen erwischt.« Ich drücke Roberts Hand, er erwidert den Druck nicht. »Und jetzt kann ich es weniger denn je. Sie haben dich in eine Falle gelockt, nicht wahr? Und dich bearbeitet?« Ich schiebe die Bilder weg, die die Erinnerung mir vors innere Auge zwingen will. »Wenn du ihnen verraten hast, dass ich in Wien war, dann ist das okay. Hätte ich an deiner Stelle auch, außerdem warst du nicht der Einzige.«
Der Speichel aus seinem Mundwinkel löst sich, bildet einen Faden, der vom Kinn hängt. Ich ziehe ein Papiertaschentuch hervor und wische ihn fort. Nein, das BKA muss Robert hier nicht bewachen. Niemand wird das Risiko eingehen, in die Reha einzudringen und ihn zu beseitigen. Wozu auch, er ist schon fort. Trotzdem rede ich weiter.
»Ich gehe jetzt wieder. Aber ich komme zurück, okay? Pass auf dich auf und … gute Besserung.«
Ich lege seine Hand zurück in seinen Schoß, wo sie keinen Halt findet und seitlich heruntergleitet. Dann schiebe ich den Rollstuhl wieder dorthin, wo ich ihn gefunden habe. Ich schätze, dass die Pfleger Robert nur ein halbes Stündchen frische Luft verschaffen wollten; es wird ihn bald jemand abholen und zurück auf sein Zimmer bringen.
Ein paar Schritte gehe ich den Weg entlang, dann entdecke ich auf der Wiese verstreute weiße Flecken. Gänseblümchen. Ich pflücke drei davon, mache kehrt und lege sie Robert in die schlaffe Hand, eines nach dem anderen.
Sie stehen für Beständigkeit, für den Triumph des Kleinen über das Mächtige. Sie sind ein trotziges Symbol.
2.
Auf der Rückfahrt kann ich kaum ruhig sitzen, ich habe ständig Roberts leeres Gesicht vor Augen, und ich möchte die Fenster der S-Bahn einschlagen. Oder zumindest laut schreien, Flüche ausstoßen, gegen Wände treten. Sie haben es wieder getan, sie haben wieder einen Menschen aus meinem Leben gerissen. Eben erst Norbert, meinen freundlichen alten Nachbarn. Jetzt Robert.
Und vor allem natürlich dich. Dein Tod kommt nun regelmäßig fast jede Nacht zu mir, nur dass sich im Traum meist meine Barrett aus dem Nichts heraus materialisiert und ich den ganzen Clan niedermähe, bevor einer von ihnen sein Feuerzeug zücken kann.
Robert. Wenn er wenigstens tot wäre.
Dass sie einen hohen Beamten des BKA ins Wachkoma befördert haben, wird den Karpins das Leben allerdings nicht leichter machen. Was mich zu der Frage bringt, ob wirklich sie für seinen Zustand verantwortlich sind. Würde Boris dann so entspannt im Duplex rumhängen?
Doch da ist die Brandwunde. Sieht aus wie von einem Schneidbrenner, und die gehören zu Paschas Lieblingswerkzeugen. Nur sitzt Pascha hinter Gittern, das hat Robert mir bei seinem Besuch in Wien erzählt. Hat sich daran etwas geändert?
Unter den fassungslosen Blicken der grauhaarigen Frau auf dem Sitz gegenüber ziehe ich die falschen Schneidezähne ab und stecke sie in meinen Rucksack, sehe mich herausfordernd um. Als suchte ich jemanden, den ich zum Duell fordern kann, aber es dauert nur zwei Sekunden, bis mir klar wird, wie idiotisch ich mich benehme. Ich lehne die Stirn an das kühle Fensterglas. Mich von meiner Wut zu Dummheiten hinreißen zu lassen, würde nur den Karpins in die Hände spielen. In den letzten Monaten habe ich meine Beherrschung perfektioniert; wenn ich sie ausgerechnet jetzt und hier verliere, werden meine Pläne Geschichte sein, bevor ich überhaupt begonnen habe, sie umzusetzen.
Zu Hause schwappe ich mir kaltes Wasser ins Gesicht, dann checke ich MyBazar. Tatsächlich gibt es eine Nachricht zu meinem Strohhalm-Inserat:
Sorry, aber das meinst du nicht ernst, oder? Denkst du wirklich, jemand kauft dir das Zeug ab? Leute wie du verstopfen diese Plattform mit ihrem Schwachsinn, ihr solltet gesperrt werden!
Ich lese die Zeilen mehrmals. Nein, das kommt nicht vom Clan, das war bloß ein querulanter User mit zu viel Freizeit. Ich schenke mir ein Glas Wein ein, stelle mich auf den Balkon und starre auf die riesigen Wohnblöcke, die mir die Sicht zum Horizont versperren. Wenn die Karpins antworten, liegen meine nächsten beiden Schritte klar vor mir; wenn sie es nicht tun, muss ich neu überlegen.
Der Abend ist noch nicht weit fortgeschritten, und ich vibriere innerlich, fühle mich eingeengt, als würden die Wände der winzigen Wohnung minütlich näher rücken. Ich sollte rausgehen, sonst leere ich die Weinflasche und bin anschließend zu idiotischen Kurzschlusshandlungen fähig. Also binde ich mir die Haare hoch, setze eine Sonnenbrille auf und trotte zum Südfriedhof.
Im Unterschied zum Wiener Zentralfriedhof sperrt er seine Pforten erst um neun Uhr abends; ich habe also noch über eine Stunde, in der ich über die grasbewachsenen Wege die Grabreihen entlangspazieren kann.
Kein Beethoven hier, kein Schubert, aber die Steine sind noch warm von der Sonne, und auch hier huschen Eichhörnchen zwischen den Bäumen umher. Ich finde eine Bank mit Blick auf einen knienden Grabengel und setze mich. Atme durch. Immerhin weiß ich jetzt Bescheid, was Robert betrifft. Weiß, dass ich auf mich allein gestellt bin.
Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein.
Ich frage mich, inwieweit die Wiener Polizei mir bereits auf der Spur ist. Meinen kleinen Mazda haben sie natürlich gefunden, inklusive der Dashcam – aber wenigstens die Walther habe ich nicht zurückgelassen. Macht trotzdem keinen guten Eindruck, Verschwinden ist immer ein halbes Schuldeingeständnis. Ob Tassani mich für fähig hält, einen Mord an einem alten Mann zu begehen? Ja, wahrscheinlich, auch wenn der Gedanke mich dummerweise schmerzt. Ich mochte ihn, diesen kahlköpfigen Polizisten mit italienischen Wurzeln. Ich wünschte, ich könnte mit ihm sprechen.
Aber es gibt ja noch ein zweites Vergehen, das man mir anhängen könnte; und das leider zu Recht. Ich habe einen jungen Mann in ein Kellerversteck im Wald verschleppt und ihn bei meiner Flucht aus Wien dort zurückgelassen. Wenn es Alex gelungen ist, aus dem Keller zu entkommen, und er danach die Polizei informiert hat, sucht man mich auch wegen Entführung, Freiheitsberaubung, Misshandlung und wer weiß was allem noch. Aber bisher habe ich keine entsprechenden Nachrichten im Netz gefunden. Nichts über einen Informatik-Studenten, der sich nach wochenlanger Gefangenschaft endlich befreien konnte.
Was bedeutet, dass er es vielleicht gar nicht geschafft hat. Dann ist er jetzt wohl schon verhungert, und über diese Möglichkeit darf ich nicht genauer nachdenken. Andererseits, mit ein bisschen Mühe und Erfindungsgeist war der Handschellenschlüssel erreichbar. Viel wahrscheinlicher ist also, dass Alex freigekommen ist, aber den Weg zur Polizei lieber nicht eingeschlagen hat.
In der Baumkrone über mir zwitschert ein ungewöhnlich lauter Vogel, und ich stemme mich wieder hoch von meiner Bank. Zeit, eine Liste aufzustellen. Zeit, sich eine Reihenfolge zu überlegen für die Auftritte der wichtigsten handelnden Personen. Leichter Wind lässt die Blätter in den Buchen rascheln. Die Wut, die ich vorhin kaum zügeln konnte, hat sich gelegt; der Friedhof tut seine Wirkung. Wer weiß, vielleicht verschaffe ich ihm schon bald neue Bewohner.
Am nächsten Morgen findet sich eine weitere Nachricht auf mein Inserat. Geschrieben um zwei Uhr vierzehn in der vergangenen Nacht und schon auf den ersten Blick vielversprechend.
Hallo! Ich mache gern Party und würde dir fünf Pakete abnehmen. Du hast leider kein Foto eingestellt. Kannst du mir sagen, welche Farbe die Strohhalme haben? Sind sie weiß-blau-rot gestreift?
Bin mit Selbstabholung einverstanden, Geld bringe ich bar. Bitte um Nachricht mit Uhrzeit und Treffpunkt.
Freundliche Grüße, Mary
Nach dem dritten Mal lesen bin ich ganz sicher, sie haben angebissen. Oder genauer gesagt: Jemand hat angebissen. Ob es wirklich die Karpins sind, werde ich erst am Treffpunkt sehen, deshalb muss ich ihn sehr sorgfältig auswählen.
Die Frage nach der Farbe der Strohhalme ist in Wahrheit die nach der Nationalität des Verkäufers: Weiß, Blau und Rot stehen für die russische Nationalflagge. Ich hole mir ein Glas Wasser und setze mich vor den Rechner, ich muss mir gut überlegen, was ich antworte.
Drei schnelle Google-Abfragen zu Orten, an denen die Malakyans zu meiner Zeit gern ihre Geschäfte abgewickelt haben. Es gibt sie alle noch, und einer davon würde sich für meine Zwecke bestens eignen: ein Schlosshotel am Rand von Frankfurt, mit Luxusrestaurant und einem weitläufigen Park. Ich war nur zweimal dort. Einmal, um einige sehr betrunkene Gäste abzuholen, und ein zweites Mal eben wegen eines Deals mit den Malakyans. Ein paar von mir gefälschte Geburtsurkunden gegen ein Kilo Heroin. Grigor Malakyan persönlich war bei dem Tausch dabei; drei Monate später war er tot. Hatte Andreis Reviergrenzen einmal zu oft überschritten.
Ich denke nach, dann fange ich an zu schreiben. Ich feile über eine halbe Stunde lang, bis ich mit der Formulierung zufrieden bin.
Hallo, Mary, 5 Packungen sind reserviert, ich bringe sie in einer passenden Tasche. Treffpunkt für die Abholung: kommenden Freitag, im Park des Taunus Golf&Gourmet-Schlosses, 22 Uhr, an der Steinbrücke.
Die Strohhalme sind rot-blau-orange gestreift, sie haben beste Qualität. Wie erkenne ich dich?
Grüße, Tom
Es dauert eine knappe Stunde, bis die Antwort da ist:
Den Park kenne ich, die Brücke auch. Freitag ist in Ordnung. Wahrscheinlich wird an der Brücke nicht viel los sein, aber falls Zweifel bestehen, erkennst du mich am roten Schultertuch. Das Geld bekommst du sofort, nachdem ich mir die Strohhalme genauer angesehen habe. Das verstehst du sicher. Bist du eigentlich neu in der Stadt?
Liebe Grüße, Mary
Mein Herz hüpft beim Lesen, teils aus Nervosität, teils aus Jagdfieber. Es wirkt ganz so, als hätte ich die richtige Beute an der Angel. Mary mit dem roten Schultertuch, die gern wissen möchte, ob ich neu bin. Ob der niedrige Preis für das Koks das Einführungsangebot einer Familie ist, die ihren Geschäftsbereich auf Frankfurt ausdehnen will.
Marys Art zu schreiben kommt mir vertraut vor, ich hoffe, das ist nicht nur Wunschdenken. Auf jeden Fall verfasst sie ihre Antworten in einwandfreiem Deutsch, das ist typisch für die Karpins, Andrei hat immer großen Wert darauf gelegt, dass die geschäftliche Kommunikation einen professionellen Eindruck macht, und daher Muttersprachler damit beauftragt. Mich zum Beispiel, nicht zuletzt deshalb weiß ich, über welche Kanäle solch ein Handel abgeschlossen wird.
Eines ist jedenfalls klar: Wer sich auch hinter dem Namen Mary verbirgt, er oder sie wird nicht alleine zum Treffpunkt kommen. Sie werden mindestens zu viert sein, mit Option auf Verstärkung, die in der Nähe wartet. Sie werden Tom auf unmissverständliche Weise klarmachen, dass sie sich die Preise für Kokain auf dem Frankfurter Markt nicht ruinieren lassen.
Es sind nur noch zwei Tage bis Freitag, ich sollte alles Nötige einkaufen gehen. Das heißt, ich muss in den Elektrofachhandel, in einen Laden für Modeschmuck und in eine Tierhandlung.
Ich lebe schon einige Zeit in Frankfurt, schreibe ich zurück. Es gefällt mir wirklich gut hier.
Ich schicke die Nachricht ab, mache mich mit Perücke, Brille und Zähnen unkenntlich und verlasse die Wohnung. Die drei Leute, die mir in der Siedlung begegnen, ignorieren mich, und auch ich würdige sie keines Blickes. Den Fehler, mich mit Nachbarn anzufreunden, mache ich nie wieder.
Mein erster Weg führt mich in einen Laden für Accessoires, und zwar einen, der sich auf die Rockerszene spezialisiert hat. Lederarmbänder mit Nieten, massive Gürtelschnallen – und Totenkopfringe. So einen brauche ich, und er muss möglichst groß sein.
Vierzehn Euro zahle ich für ein wirklich hässliches Exemplar aus Edelstahl und verlasse den Laden, froh darüber, dass ich so günstig weggekommen bin. Meine Mittel sind sehr viel begrenzter, als sie es in Wien waren.
Wesentlich mehr Geld gebe ich im Elektromarkt aus, für einen klitzekleinen GPS-Sender und ein Fernglas mit Nachtsichtfunktion. Letzteres werde ich hoffentlich öfter einsetzen können, denn es reißt ein beträchtliches Loch in mein Budget.
Zuletzt steuere ich die Tierhandlung an, wo ein freundlicher junger Verkäufer mit feuerrotem Haar gerade Aquarienfische füttert. »Ich bräuchte Futter für meine Boa«, erkläre ich. »Haben Sie Tagesküken?«
Er wischt sich die Hände am Hosenboden seiner Jeans ab. »Wir haben auch lebende Mäuse, die werden von Boas normalerweise besser angenommen.«
»Von meiner nicht. Ich habe mit Küken bisher die besten Erfahrungen gemacht.«
Er zuckt mit den Schultern. »Meinetwegen. Aber sie müssen wirklich durchgetaut sein, das weißt du?«
»Klar.« Müssen sie tatsächlich, sonst kann ich nichts mit ihnen anfangen. Der Verkäufer verschwindet in einem Hinterzimmer und kommt kurz darauf mit zwei vakuumverschweißten Plastikpaketen zurück. »Zehn Stück machen zwei Euro, ein Kilo gibt’s schon für fünf.«
»Zehn Stück reichen fürs Erste«, sage ich und fische eine Münze aus meinem Portemonnaie. »Danke.«
Zu Hause schneide ich die Packung auf und lege die Küken auf den Balkon. Ich werde nur eines davon brauchen, maximal zwei, wenn ich mich beim Präparieren ungeschickt anstelle. Ein schneller Check am Computer, die Strohhalm-Anzeige hat eine neue Nachricht, in der jemand fragt, ob ich die Halme auch einzeln verkaufe, ha ha, oder eventuell sogar halbe Halme, längs aufgeschnitten.
Sonst hat sich niemand gemeldet. Es gibt keine Stornierung des morgigen Termins, also sollte ich mit meinen Vorbereitungen fortfahren.
Im Park des Golf&Gourmet-Schlosses sind mehr Spaziergänger unterwegs, als mir lieb ist, aber es ist auch erst Nachmittag. Der Parkplatz vor dem Hotel ist voll, die Tische auf der weitläufigen Terrasse sind fast alle besetzt. Ich bin den letzten Kilometer bis hierher in der prallen Sonne gelaufen, und ich würde mich gern selbst auf ein Glas eisgekühltes Wasser einladen, aber für das unmittelbare Hotelgelände bin ich falsch gekleidet. Wie eine Joggerin nämlich, mit Stirnband, großer Sonnenbrille und in nicht unbedingt ansprechenden Sportsachen.
Dafür falle ich im Park nicht auf, dort joggen einige. Ich laufe in lockerem Trab auf die Steinbrücke zu, die ein schmales Bächlein überspannt. Am Rand mache ich halt und tue so, als müsste ich nach Luft schnappen und meinen Puls kontrollieren, während ich die Umgebung nach einem idealen Versteck absuche.
Unter der Brücke wäre praktisch, aber zu naheliegend. Wenn meine Geschäftspartner sich nach dem ausbleibenden Strohhalmverkäufer umsehen, werden sie dort zuerst suchen. Außerdem würde ich von da unten die Szenerie nicht beobachten können.
Aber zehn Meter entfernt steht ein Baum mit dichtem Blattwerk und zwei relativ tief liegenden, dicken Ästen, über die ich nach oben klettern könnte.
Ich lasse die Brückenmauer los, hüpfe zweimal auf und ab und jogge auf den Baum zu, wo ich Dehnübungen mache.
Ja, da werde ich hochklettern können. Und dort oben ist eine Astgabel, in der zu sitzen einigermaßen bequem sein müsste. Am liebsten würde ich es sofort ausprobieren, aber noch wäre das zu auffällig. Halb stretchend, halb hüpfend kehre ich zum Weg zurück und laufe die Runde zu Ende. Mein Plan könnte klappen. Ich hoffe, um zehn Uhr abends ist es bereits dunkel genug.
Bei meiner Rückkehr sind die Küken aufgetaut; winzige, mitleiderregende Federbällchen, deren Gelb nicht mehr leuchtet. Ich nehme eines davon mit in die Küche, schneide ein kleines Loch in den Bauch, hole die Organe heraus und stecke den GPS-Sender hinein. Danach nähe ich den Schnitt zu. Das Küken ist jetzt schwerer als zuvor, aber das werden die Finder hoffentlich auf den Ring zurückführen, den ich nun über den kleinen Körper ziehe.
Es sieht aus, wie ich es in Erinnerung habe. Ein solches Küken mit Totenkopfring haben Boris und Pascha einmal im Mund eines von Andreis Drogenkurieren gefunden. Eine Kriegserklärung der Malakyans, angeblich ihre Methode, weiteres Unheil anzukündigen.
Ich lege das Küken in den Kühlschrank, ein zweites als Back-up daneben. Die restlichen acht bringe ich nach unten zu den Müllcontainern. Für die getigerte Katze, die gerade auf einem der Deckel balanciert, dürfte mein Geschenk der Höhepunkt der Woche sein.
Am nächsten Tag bin ich schon um fünf Uhr nachmittags im Schlosspark, eine Spaziergängerin unter vielen. Erfahrungsgemäß kommen die Karpins eher knapp, wenn nicht sogar ein paar Minuten später zu Terminen wie diesen, aber ich will kein Risiko eingehen. Wenn es losgeht, möchte ich längst in meiner Astgabel hängen, unsichtbar. Und davor das Gelände noch ein wenig genauer studieren, vor allem meinen Rückweg planen.
Der Park ist eingezäunt, am einfachsten ist er über den Haupteingang zu verlassen, aber das Nächstliegende ist meist das Gefährlichste. Dafür wurde nicht weit von der Brücke entfernt ein Baum gefällt, der Stumpf steht nah am Zaun und ist hoch genug, um als Kletterhilfe zu dienen. Das wird mein Fluchtweg werden, wenn alles vorbei ist.
Was zu klären war, ist geklärt, und nun stellt sich mit einem Schlag die Nervosität ein. Es sind noch über vier Stunden bis zum vereinbarten Treffen zu überbrücken. Sehr viel Zeit, die ich mit meinen Fantasien und Ängsten verbringen kann.
Ich drehe eine Runde nach der anderen durch den Park. Lerne ihn auswendig, zähle meine Schritte, den Blick auf den Weg gerichtet, die Daumen in die Träger des Rucksacks gehängt. Die Zeit vergeht erbärmlich langsam, aber ich weiß, dass ich untätig in meiner Wohnung sitzend noch nervöser wäre. Irgendwann finde ich eine freie Parkbank, auf der jemand eine Zeitung liegen gelassen hat. Hinter ihr verstecke ich mich die nächste Stunde über, tue, als würde ich lesen. Von der Hotelterrasse her dringt leise Musik bis zu mir, der Chopin-Walzer in Cis-Moll. Sie scheinen einen Pianisten zu haben, denn am Ende des Stücks applaudieren die Gäste.
Das Wetter ist heute nicht so strahlend wie gestern, von Westen her ziehen Wolken auf, aber im Moment sieht es noch nicht nach Regen aus. Ich klemme mir die Zeitung unter den Arm, von der ich keine einzige Zeile gelesen habe, und drehe noch eine Runde. Vielen Menschen begegne ich jetzt nicht mehr, das ist gut. Bis zu meiner Verabredung um zehn Uhr wird hier hoffentlich alles verlassen sein.
Um acht klettere ich zum ersten Mal auf den Baum. Jetzt ist es noch hell, und ich kann sehen, wohin ich greife. Der Aufstieg ist genauso unkompliziert, wie ich gehofft habe, die Astgabel leider unbequemer als gedacht, aber das ist ein Luxusproblem. Ich lehne den Oberkörper gegen den schrägen Ast, der sich unter meinem Gewicht leicht senkt, aber nicht knackt. Ausgezeichnet.
Der Blick auf die Brücke ist akzeptabel – lieber wäre mir, es würden keine Blätter in mein Sichtfeld ragen, doch daran lässt sich nichts ändern. Im Gegenzug hat es den Vorteil, dass ich besser getarnt bin.
Neun Uhr, es kommt Wind auf. Im Park habe ich seit einer halben Stunde niemanden mehr gesehen, und nun geht die Sonne unter. Zeit, meinen Köder auszulegen. Ich klettere den Baum hinunter, nehme den Rucksack ab und hole die Tupperdose mit dem toten Küken heraus. Eigentlich wollte ich es auf die breite Steinbrüstung der Brücke legen, aber der Wind macht mir Sorgen. Der Ring ist schwer, ja, aber er ist auch rund. Wenn das Präparat in den Bach rollt, ist mein Plan gescheitert.
Also platziere ich das Küken auf dem Boden, auf einem hellen Stein am Brückenfuß. Drehe es so, dass der Totenkopf nach oben schaut, und kehre zurück in die Astgabel.
Dort hole ich zuerst die Schminke, dann das Fernglas aus dem Rucksack. Ich will nicht, dass Gesicht oder Hände als helle Flecke zwischen den Blättern erkennbar sind. Den Trageriemen des Fernglases lege ich mir um den Hals, stelle auf das Küken scharf. Bestens. Ein schneller Schwenk auf den Weg rechts und links der Brücke, da ist noch niemand zu sehen. Macht nicht den Eindruck, als gäbe es eine Vorhut.
Viertel nach neun, es wird jetzt von Minute zu Minute dunkler. Und nicht nur das. Über mir höre ich einzelne Regentropfen ins Blätterdach fallen, bis zu mir nach unten schafft es keiner. Nach kurzer Zeit hört es auf zu tröpfeln, dafür frischt der Wind weiter auf.
Mein Gesicht ist schwarz, meine Hände sind es auch, die Farbe verschmiert die Griffe des Fernglases. Der Ast drückt mir mit jeder Minute schmerzhafter gegen den Bauch und die Innenseite des linken Oberschenkels. Ich verschiebe mein Gewicht um ein paar Zentimeter, der Ast schwankt sichtbar. Mit Bewegungen muss ich vorsichtig sein, umso mehr, als ich jetzt Schritte auf dem Weg höre. Stimmen. Lachen.
Wenige Sekunden später kommen eine Frau und ein Mann ins Blickfeld. Sie hat sich bei ihm untergehakt und den Kopf gegen seine Schulter gelehnt. »… ist die Crème brûlée göttlich gewesen, ich hätte am liebsten noch eine zweite Portion gegessen«, höre ich sie im Näherkommen sagen.
»Klar, warum nicht?«, brummt er. »Wollen wir dann zurückgehen?«
Ja, bitte, bitte, bitte, flehe ich stumm. Es sind nur noch zwanzig Minuten bis zur vereinbarten Zeit; das Letzte, was ich jetzt brauchen kann, sind Hotelgäste auf ihrem Verdauungsspaziergang.
»Schau mal, die Brücke!«, quietscht die Frau. »Die ist doch romantisch! Ist die nicht romantisch?« Sie zieht ihren Gefährten darauf zu. Ich umklammere verzweifelt meinen Ast. Nicht das Küken finden. Auch nicht drauftreten. Bitte.
Im Licht der Laterne, die nur zwei Schritte von meinem Köder entfernt steht, küssen die beiden sich, und ich hoffe, sie schließen dabei die Augen. Er ist es, der sich zuerst aus der Umarmung löst. »Ich glaube, es fängt wieder an zu regnen. Gehen wir zurück, okay?«
Sie ziehen ab. Durch mein Fernglas vergewissere ich mich, dass sich alles noch dort befindet, wo ich es deponiert habe; jetzt noch einmal nach unten klettern wäre höllisch riskant. Doch das Küken liegt auf seinem Stein, der stählerne Totenkopf blickt leer in den nächtlichen Himmel.
Die Ansage des Mannes eben war leider kein Vorwand, um den Spaziergang abzubrechen – es beginnt wirklich wieder zu regnen, stärker diesmal. Der Regen prasselt auf die Blätter, tropft auf mich herunter, läuft mir übers Gesicht.
Gleich ist es zweiundzwanzig Uhr, aber um mich herum rührt sich nichts. Ist es möglich, dass das schlechte Wetter »Mary« davon abhält zu kommen? Wenn ja, war es niemand von den Karpins, mit dem ich Kontakt hatte. Die würden sich ihre Konkurrenz auch während einer Feuersbrunst vorknöpfen.
Zwei nach zehn. Fünf nach zehn. Ich merke erst jetzt, wie fest ich damit gerechnet habe, dass die Gegenseite unsere Verabredung einhält. Was tue ich, wenn nicht? Wenn sie Lunte gerochen haben?
Sieben nach zehn – und Schritte auf dem Weg. Die klackernden von Frauenschuhen, die dumpfen von weicheren Sohlen.
Drei Menschen treten in mein Blickfeld, zwei davon erkenne ich sofort. Vera, in einem blauen Sommermantel, darüber das rote Schultertuch. Hohe Schuhe, das Haar jetzt blond gefärbt. Sie hält sich einen Schirm über den Kopf, blickt sich suchend um.
Neben ihr Boris, in einer seiner voluminösen Lederjacken, unter denen sich mehr als nur eine Waffe verbergen lässt. Er tritt auf die Brücke, späht hinunter, die rechte Hand ist um etwas geschlossen, das ein Teleskopschlagstock sein könnte.
Der Dritte im Bunde ist ein junger Kerl, ihn kenne ich nur flüchtig. Er ist hochgewachsen, aber schmaler als Boris. Dunkelhaarig, langbeinig. Auch er tritt kurz auf die Brücke, dreht sich dann um und hebt die Hand in die Richtung, aus der sie gekommen sind. Vollführt eine kreisende Geste.
Es sind also nicht nur die drei hier, und der Jüngste bedeutet den anderen, sich im Park umzusehen.
Ich sitze in meiner Astgabel und wage es kaum zu atmen. So lange habe ich versucht, den größtmöglichen Abstand zu den Karpins zu halten, jetzt sind wir gerade mal zehn Meter voneinander entfernt. Ich fühle, wie mir der Schweiß den Rücken hinunterläuft, mein Mund ist plötzlich staubtrocken, in meinen Ohren rauscht es. Keine Panikattacke jetzt, nicht bewegen, nicht laut atmen. Nur langsam, ganz langsam das Fernglas vors Gesicht heben.
Vera steht ruhig da, das Gesicht ist gespannte Aufmerksamkeit. Eine Hand hat sie in der Tasche ihres Mantels versenkt – sie hat eine Schwäche für kleine Pistolen und kann erschreckend gut damit umgehen.
»Er ist nicht da«, stellt Boris trocken fest.
»Oder schon wieder fort«, sagt Vera. »Wir sind spät dran, wenn wir es wirklich mit einem Anfänger zu tun haben, hat der vielleicht schon nach zwei Minuten die Nerven verloren und ist abgehauen.«
»Dann hätten wir ihn gesehen.«
Vera nickt. Ein kurzes, ruckartiges Senken des Kinns. »Mal sehen, ob Toljan und Juri noch jemanden aufspüren.«
Toljan kenne ich kaum, er wurde von Andrei in eine andere Stadt versetzt, da war ich erst seit drei Monaten in den Clan eingeschleust. Juris gab es zwei, einer davon noch sehr jung, gerade mal zwanzig.
Der Regen wird stärker, Boris blickt missmutig zum Himmel und sagt etwas auf Russisch, das ich nicht verstehe. Der, den ich nicht kenne, lacht und antwortet in derselben Sprache.
Ich kann sehen, wie sehr Vera das verstimmt, daran hat sich offensichtlich nichts geändert. Sie ist ebenso wenig Russin wie ich und versteht bestenfalls einzelne Fetzen, wenn die anderen nicht sehr langsam und deutlich sprechen.
»Geh mal unter die Brücke und sieh dort nach, statt hier sinnlos rumzustehen«, herrscht sie den Mann an. Scheint, als wäre Vera in der Hierarchie aufgestiegen.
Er brummt etwas Abfälliges, setzt sich aber in Bewegung. Kickt missmutig einen Stein in den Bach – und entdeckt im gleichen Moment das Küken. »Ey!« Er winkt Boris zu sich, doch Vera ist zuerst dort. Sie greift nach dem Köder, betrachtet ihn von allen Seiten und dreht sich dann schnell um die eigene Achse, als wolle sie sichergehen, dass sich niemand hinter ihrem Rücken versteckt. Für den Bruchteil einer Sekunde sieht sie genau zu mir her. Ihr Blick verfängt sich nicht in meinem, trotzdem setzt mein Herz einen Schlag aus.
»Scheiße!« Sie hält Boris das längst durchnässte Vögelchen hin. »Ich hab’s gesagt, oder nicht? Es sind die Malakyans!«
Boris betrachtet den Köder und bleckt die Zähne. »Glaube ich nicht. Warum sollten die den Markt kaputt machen? Drecksarmenier.«
»Logik ist nicht dein Ding, Boris, lass es besser. Es geht ihnen nicht um den Markt. Sie zielen genau auf uns ab, du weißt doch, wie lange Andrei schon darauf wartet, dass sie zum Gegenschlag ausholen. Seit der Sache mit Grigor. Sie wollen immer noch Rache, was denkst du denn?« Sie hält ihm das Küken vor die Nase. »Und das ist eine Drohung, das ist dir klar, oder? Sie haben uns bloß hergelockt, damit wir es finden.« Wieder lässt sie ihren Blick durch den nächtlichen Park streifen. Langsamer diesmal, genauer. »Ich frage mich …«, murmelt sie, der Rest des Satzes ist zu leise, als dass ich ihn verstehen würde. Dann hebt sie die Hand. »Toljan!« Sie winkt jemanden heran, der sich außerhalb meines Blickfelds befindet.
Zwei Atemzüge später tritt ein Mann mit kurz geschorenem Haar und tätowierten Händen auf sie zu. Eine Erinnerung durchfährt mich wie ein Stromschlag. Daran, wie diese Hände einen Schwingschleifer halten, mit dem man normalerweise Holzoberflächen bearbeitet. Wenn man nicht Haut damit abhobelt.
»Was ist los?«
Sie hält ihm das Küken vors Gesicht. »Malakyans. Wir haben dir gesagt, du sollst diese Frau nicht mehr treffen. Wie heißt sie? Mina?«
»Mane. Gibt keinen Kontakt mehr. Seit zwei Wochen.« Er sieht Vera nicht an, während er spricht, sondern blickt demonstrativ an ihr vorbei. Als wäre er gelangweilt.
»Aha.« Sie hält das Küken höher. »Und das hier? Wieso bekommen wir plötzlich Drohungen aus der armenischen Ecke? Kann es sein, dass du Mist gebaut hast?«
»Nein.« Der Unterton, den Toljan in dieses einzige Wort legt, lässt mich meinen Ast fester umklammern, aber Vera bleibt unbeeindruckt. »Los, zurück zum Auto. Boris, sieh gründlich nach, ob jemand dran rumgepfuscht hat. Und halte Toljan vom Wagen fern, wer weiß, auf welcher Seite er steht.«
Mit einem Fluch stapft Boris davon, gefolgt von den anderen beiden. Ich befürchte kurz, dass Vera das Küken fallen lassen oder in den Bach werfen wird, aber sie nimmt es mit. Damit behält sie den GPS-Sender bei sich, genau, wie ich erhofft habe.
Ich höre, dass ihre Schritte sich entfernen. Meine innere Anspannung lässt nach – zu früh, ich darf mich jetzt nicht in Sicherheit wiegen. Dass Toljan eine Verbindung zu den Malakyans hatte, ist unverhofftes Glück. Im Zweifel werden sie ihm anlasten, was demnächst passiert, statt nach einem anderen Verursacher zu suchen.
Immer noch regnet es, mein schwarzer Hoodie ist völlig durchnässt, und der Ast hat so gegen die Innenseite meines rechten Beins gedrückt, dass ich es nicht mehr spüre.
Ich bewege den Fuß, lasse ihn kreisen, in meinem Bein beginnt es schmerzhaft zu kribbeln. Gleichzeitig lausche ich in die Dunkelheit. Keine Schritte, keine Stimmen. Nur das Rauschen des Bächleins und das Prasseln des Regens auf Blätter, Wege, Gras.
Nach einer Viertelstunde wirkt der Park immer noch wie ausgestorben, also gehe ich das Risiko ein und hole mein Smartphone aus dem Rucksack. Das Aufleuchten des Displays in der Baumkrone würde ein wachsamer Beobachter auf dreißig oder vierzig Meter sehen können. Ich entsperre das Handy und drücke es mir sofort gegen die Brust. Halte den Atem an, aber immer noch bleibt die Umgebung ruhig.
Also wage ich es. Ich öffne die App für den GPS-Tracker, lasse mir die Position des Kükens anzeigen und höre mich selbst ausatmen, unvorsichtig laut.
Sie müssen bereits losgefahren sein. Der rote Punkt befindet sich ungefähr vier Kilometer südlich des Hotels, auf einer Landstraße mitten im Taunus. Sie sind auf dem Weg in Richtung Frankfurt.
Immer noch kein Grund für völlige Entwarnung, denn es kann sein, dass sie mit zwei Fahrzeugen gekommen sind und nur eines davon zurückfährt. Jemand könnte noch auf dem Gelände sein und die Augen etwas länger offen halten. Der Hauptausgang ist daher weiter tabu für mich, aber ich habe meine Alternative ja längst gefunden.
Zehn Minuten warte ich noch, dann packe ich Fernglas und Handy in den Rucksack und beginne, vom Baum zu steigen. Der Regen ist nicht mein Verbündeter in dieser Sache, er hat Stamm und Äste rutschig wie Seife gemacht; trotz Gummiprofilsohle finden meine Sportschuhe nirgendwo Halt. Ich arbeite mich mühsam ein Stück nach unten, die letzten zwei Meter lasse ich mich einfach fallen, lande auf beiden Füßen im Gras und bleibe dort zusammengekauert hocken.
Die Aktion war viel zu laut, vor allem der Sprung am Ende. Trotzdem schält sich niemand aus einer Hecke und stürzt auf mich zu. Vielleicht sind wirklich alle fort.
Ich husche über die Wiese, auf die Stelle zu, an der der Baumstumpf steht. Meide dabei die Lichtkegel der Parklaternen.
Nach fünf Minuten bin ich draußen auf einer kleinen Straße und wische mir im Weiterlaufen die Farbe von Händen und Gesicht. Es ist mühevoll und funktioniert nur bedingt, das Zeug verschmiert mehr, als dass es verschwindet. Aber stehen bleiben und mich in Ruhe säubern ist nicht drin; ich habe keine Zeit zu verlieren, wenn ich die letzte S-Bahn noch erwischen will.
Eine halbe Stunde später sitze ich patschnass in einem Zug, der glücklicherweise so gut wie leer ist. Drei Jugendliche unterhalten sich lautstark am anderen Ende des Waggons, sie würdigen mich keines Blickes. Mit dem Smartphone als Spiegelersatz habe ich mir das Gesicht zumindest so weit gesäubert, dass es nicht mehr aussieht, als wäre ich aus einer Kohlegrube gekrochen.
Nun tue ich, was die meisten Menschen in der S-Bahn tun: Ich starre auf mein Handy, auf dem ich die Tracking-App geöffnet habe. Der rote Punkt ändert immer noch seine Position, mittlerweile sind die Karpins im Frankfurter Stadtgebiet angekommen und befinden sich in der Nähe des Botanischen Gartens. Ich wünschte, es wäre möglich gewesen, auch noch eine Wanze in das Küken einzubauen, aber schon der Tracker war eine Herausforderung.
Irgendwann werden sie ihn entdecken; hoffentlich erst, nachdem sie am Ziel angekommen sind. Die Ortung funktioniert angeblich auf fünf Meter genau – sobald der rote Punkt für längere Zeit zur Ruhe kommt, sollte ich die Stelle markieren.
Jetzt, wo das Adrenalin in meinem System sich langsam verflüchtigt, machen sich die Anstrengungen des Tages bemerkbar. Ich könnte auf der Stelle einschlafen, fühle mich erschöpft wie lange nicht mehr. Der Zug wird erst kurz vor ein Uhr nachts meine Haltestelle erreichen, bis dahin darf ich nicht einnicken.
Meine Augen brennen, ich blinzle. Sehe den roten Punkt auch, wenn ich für Sekunden die Lider schließe. Seit einer halben Minute steht er still, das ist zu lang für eine Ampelphase. Besser, ich setze ein Fähnchen an die Stelle. Ohmstraße. Dort liegt keines der Lokale, in denen die Karpins zu meiner Zeit unterwegs waren. Aber so vieles kann sich in den letzten eineinhalb Jahren geändert haben.
Der Punkt bewegt sich wieder, was mich erleichtert im Sitz zurücksinken lässt. Wäre ja auch möglich gewesen, dass Vera den Tracker bemerkt und das Küken aus dem Auto geworfen hat. Es geht weiter Richtung Süden, sie halten auf eine der Mainbrücken zu.
Ich bin jetzt allein im Waggon, die Jugendlichen sind bei der letzten Station ausgestiegen. Die nächste ist meine, und ich stehe schon mal auf, es sind nur zwei Minuten bis dorthin. Der rote Punkt steht wieder still, ich starre ihn an, bis die Bahn hält. Noch im Aussteigen setze ich ein Fähnchen an die Stelle. Eine Wohngegend in Niederrad. Vielleicht schon die Endstation für heute.
Zu Hause streife ich mein nasses, kaltes Zeug vom Körper und stelle mich unter die Dusche. Schrubbe die Reste schwarzer Farbe von Gesicht und Händen. Zeit für ein erstes Resümee.
Vera hat Karriere gemacht, das ist nicht zu übersehen. So wie heute hätte sie früher niemals mit Boris gesprochen, ohne dafür Ohrfeigen zu kassieren, wenn nicht Schlimmeres. In München war sie sehr knapp an mir dran, ist das der Grund für ihren Aufstieg? Dass die Karpins ohne sie nicht von meinem Überleben wüssten?
Vera. Sie war an diesem letzten Tag mit dabei in der Halle – an dem Tag, an dem ich dich verloren habe. Sie hat alles mit angesehen, hat gelächelt, als Pascha mit dem Feuerzeug gekommen ist. Mit ihr solltest du an diesem Nachmittag einen Termin haben, ein kurzes Treffen. Sie beim Kauf eines Motorrads beraten.
Ich weiß nicht mehr, ob ich Vorahnungen hatte. Wahrscheinlich nicht, ich habe immer gedacht, Vera und ich säßen irgendwie im selben Boot. Dass sie mich warnen würde, wenn etwas im Busch wäre. Aber sie muss es gewesen sein, die dich in die Halle gebracht hat. Für das spektakuläre, feurige Finale.
Das heiße Wasser prasselt mir ins Gesicht, läuft mir durchs Haar, über den Körper und alle meine äußerlichen Narben. Vera selbst hat auch eine; eine Brandnarbe auf der Stirn, die sie Pascha verdankt.
Hinter den geschlossenen Lidern sehe ich die Vera von heute Nacht: gut gekleidet, selbstbewusst, als wäre sie die Leiterin der gesamten Aktion. Vielleicht war der erste ihrer Karriereschritte nicht der, mich in München zu enttarnen, vielleicht hat es schon ein Jahr früher begonnen. Mit dem Anlocken des Gefährten der Verräterin. Mit der Fahrt in eine leere Fabrikhalle außerhalb von Frankfurt.
Ich trockne mich ab, verkrieche mich unter meine Decke und checke das Handy. Immer noch befindet der rote Punkt sich in Niederrad, an der gleichen Stelle wie zuvor. Im ungünstigsten Fall hat Vera an der Stelle das Küken aus dem Autofenster geworfen. Im besten Fall wohnt sie dort.
3.
Hallo, Tom! Ich war zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Treffpunkt, aber leider habe ich dich dort nicht angetroffen. Was war los?
Mary
Das ist die erste Nachricht, die ich am nächsten Morgen bei MyBazar vorfinde. Die zweite ist ebenso interessant, aber um die kümmere ich mich später.
Es war regnerisch, nicht wahr?, schreibe ich zurück. Regen macht mich nervös. Aber ich habe dir etwas dagelassen. Hast du es nicht gesehen?
Zwei Minuten später kommt die Antwort:
Doch. Und niemand hier findet es witzig. Du solltest besser vorsichtig sein, vielleicht bewerte ich dich. Du weißt doch, negative Kritiken sind schlecht fürs Geschäft.



























