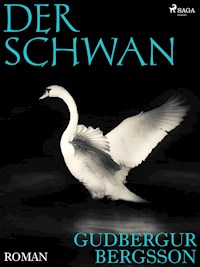Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mamas Knopfdose ist nicht nur voller Knöpfe, sondern etwas ganz besonders. Denn an jedem einzelnen Knopf hängt eine Geschichte. Gudbergur Bergsson erinnert sich in seinem Roman an seine eigene Kindheit in einem isländischen Fischerdorf. Er erinnert sich an seinen Vater, der mit seinen eigenen Händen – und nur mit seinen Händen – ein Haus baute. An seine Mutter, die mit einem Märchen im Sinn aus dem Leben schied. Daran wie es ist, jemanden zu erschrecken und selbst erschreckt zu werden. An den Duft der Sonne. An die Heimat. An das Zuhause. Dabei geht es nicht allein um die Erinnerungen des Autors, sondern vielmehr auch um allgemeine Erinnerungen, die sich mit den Kindheitserlebnissen der meisten Menschen decken. AUTORENPORTRÄT Gudbergur Bergsson wurde 1932 geboren und ist ein isländischer Lehrer und Schriftsteller. Er lebte viele Jahre in Spanien. Sein erstes Buch erschien 1966. Seitdem veröffentliche Bergsson mehr als 20 Novellen, Kinderbücher, Autobiographien und mehr. Zudem schrieb er Artikel über Literatur und Kunst für Zeitungen und Magazine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gudbergur Bergsson
Vater, Mutter und der Zauber der Kindheit
Aus dem Isländischenvon Karl-Ludwig Wetzig
Saga
Dichtung ist nicht deshalb wahr, weil sie von einem Stoff handelt, der sich in der Wirklichkeit zugetragen hat und sie seine wahrheitsgemäße Schilderung ist, oder weil sie allgemeinen Vorstellungen davon gehorcht, was es heißt, die Wahrheit zu sagen. Vielmehr liegt dann ein Funken Wahrheit in ihr, wenn sie von dem Verlangen und dem Vermögen des Autors getragen wird, aus seiner eigenen Perspektive Zeugnis von dem abzulegen, was er für wahr hält.
Biographien gibt es – strenggenommen – nicht, denn kaum etwas gerät so vollständig in Vergessenheit wie das Leben eines Menschen. Das einzige, was sich festhalten läßt, ist der Wunsch, einen geistigen Hauch von ihm in Worten aufzubewahren.
Ereignisse tragen sich nur ein einziges Mal im Leben zu; danach aber können sie sich im Gedächtnis des Betreffenden und derer, die von ihnen gehört haben, auf verschiedene Weise wieder und wieder ereignen.
Dieses Buch ist historisch unzutreffend. Ihm ist aber auch lediglich die Aufgabe beigemessen, was seinen Autor anbelangt in etwa gefühlsmäßig wahr zu sein. Es ist mithin eine dichterische Biographie.
Erster Teil
Im Elternhaus
Ich stehe nicht im Zimmer meiner Mutter, jedenfalls nicht auf die gleiche Weise wie jener Mann, der in einem Buch einmal etwas Ähnliches behauptete. Meine Mutter besaß weder Haus noch Zimmer noch sonst etwas je für sich allein. Hingegen befinde ich mich wieder in dem Haus, das einmal das gemeinsame Haus meiner Eltern war. Mir ist vollkommen klar, wie und weshalb es so gekommen ist. Es hat nichts mit Magie zu tun, weder im Traum noch in der Dichtung; vielmehr kam ich mit einer klaren Absicht und zu einem bestimmten Zweck gestern abend mit dem Bus, der früher um acht fuhr, heute aber um Viertel vor sieben.
Es begann schon dunkel zu werden. Fast im selben Moment, in dem ich die Stufen hinaufstieg und durch die Tür trat, fühlte ich, wie eine eigentümliche Ruhe und Frieden über mich kamen, zusammen mit einer gewissen Schläfrigkeit. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten und ging deshalb früh schlafen.
Die Schlafcouch stand ungefähr an der gleichen Stelle wie früher die alte Chaiselongue. Als ich mich hinlegte und die Decke über mich zog, wies mein Kopf also nach Westen, und meine Füße zeigten nach Osten, genau wie in der Kindheit, nur stand die Couch nicht unter der tapezierten Dachschräge – was mir immer ungemein beruhigend vorgekommen war. Kaum hatte ich mich hingelegt, schien es mir, als würde der Körper wieder eine längst vergessene Lage einnehmen, und beim Aufwachen am nächsten Morgen stellte ich fest, daß ich einen erholsamen Schlaf wie seit Jahren nicht genossen hatte, und ich seufzte vor Glück und Erleichterung. Daraus läßt sich ersehen, daß der Schlaf nicht etwa ein Eigenleben führt oder von einem Bündel Empfindungen in Gestalt von Träumen bestimmt wird, sondern schlicht von der Lage des Körpers, davon, in welche Richtung der Kopf oder die Füße im Bett der Kindheit zeigten.
Es wird Herbst. Diesmal bin ich gekommen, weil ich meinem Vater das Haus abgekauft habe, damit es nicht auf dem offenen Immobilienmarkt landet, in den Händen von Fremden oder gar Unbekannten. Ich wollte nicht für den Rest meines Lebens mein Gewissen damit belasten, daß die Geschichten, die mit ihm verbunden sind, nurmehr in der Erinnerung existieren. Ich bin hier, um mich in einem Buch an meine Eltern zu erinnern, und ich habe mehr als einmal gedacht: Warum sollte ich nicht versuchen, in dem kleinen Ort in mehr als einer Bedeutung zu mir selbst heimzukehren? Zum Beispiel mit dem Vorsatz – der viel schwieriger ist als alles, was mit einem Hauskauf zu tun hat –, ein Werk zu schreiben, das für sich steht und das sich als Entsprechung zum Vergangenen lesen läßt.
Zuerst hatte ich ein wenig Angst, ich würde mich im Haus nicht wohlfühlen, es könnte kein Aufenthaltsort mehr für mich sein, seitdem meine Eltern ausgezogen sind. Es ist lange her, seit ich selbst den Ort verlassen habe, so daß ich hier fast niemanden mehr kenne, und offen gesagt vermisse ich das auch nicht. So behindert mich kein Gegenüber beim Schreiben des Werks, und ich habe freiere Hände. Ich will ja nichts zurückholen, sondern eine Entsprechung schaffen. Bislang reichte es mir, die Orte meiner Kindheit undeutlich im Gedächtnis zu haben und ab und zu vorbeizuschauen, solange meine Eltern lebten und hier wohnten. Seither tat ich es nur selten, meist dann, wenn nahe Verwandte gestorben waren, um ihnen, indem ich an der Beerdigung teilnahm, meine Achtung zu erweisen. So etwas ist albern, ich weiß. Man erweist nur Lebenden Achtung, nicht Toten. Dennoch habe ich an dem Brauch festgehalten. Es ist eine reine Formsache. Statt teilnahmsvoll der Leichenpredigt des Pastors zu lauschen, habe ich mich bei Beerdigungen immer wieder damit beschäftigt, mich neugierig umzusehen, ob aus dem Profil anderer Kirchenbesucher womöglich die stillen, markanten Gesichtszüge von Menschen hervortraten, die ich von Ansehen kannte, als ich noch ein Kind war. Es ist nur selten vorgekommen, und mit bedauerndem Spott dachte ich: Fett ist wohl die Isoliermasse, die sich am gründlichsten über die Vergangenheit meines Volkes gebreitet hat.
Bevor ich zurückkehrte, hatte ich auch die Befürchtung, ich könnte in diesem Haus vielleicht keinen Schlaf finden, weil mich nicht etwa unangenehme Gedanken, sondern schlicht allzu banale Erinnerungen wachhalten könnten oder weil sich diese grundlose Schlaflosigkeit einstellen könnte, die daher rührt, daß der Mensch ein Wesen ist, das sich stets Sorgen machen muß und Angst empfindet. Derartige Schlaflosigkeit hat nichts mit Unruhe zu tun, mehr mit Grübeln, und ist vielleicht nichts anderes als das Murmeln in der Seele, das den Menschen von Beginn an begleitet, leise wallende Lebensangst. Aus ihr und der Schwermut ist das Bedürfnis nach Kunst entsprungen, diese unbegreifliche Kraft, sich aus Angst und dem, was den Geist beschwert, zur Helle des Lebens emporheben zu wollen, die man zuweilen Inspiration nennt.
So ist es aber nicht gekommen. Einfach weil ich beschlossen habe, daß es nicht so kommen sollte, und es hat sich gezeigt, daß Schlafen und Wachen ganz nach Plan verliefen, was vielleicht nicht verwundert, weil es zu Romanschriftstellern paßt, ein geordnetes Leben nach genauen Regeln und Zeitplänen führen zu wollen. Es ist für sie sogar durchaus notwendig. Das Leben ist die endlose Weite, die wir nicht überblicken; doch was wir einen Roman nennen, ist die verdichtete Weite, die der Schriftsteller in eine endliche Zahl von Seiten überführt.
Ich befinde mich jetzt in dem, was man früher »oben auf dem Dachboden« nannte. Zweigeschossige Häuser haben anfangs nur »oben« und »unten«, und in diesem Haus wurde lange Zeit nur unten gewohnt. Der Dachboden war ein offener Abstellraum. Die jetzige Wohnung auf diesem Boden ist klein und exakt da, wo ich mir mit Phantasien die Zeit vertrieb, als ich noch ein Kind war und das Haus kaum eingerichtet. Damals war es hier kalt, jetzt ist es warm, aber draußen tobt noch immer das gleiche schlechte Wetter, der Wind drischt auf das Dach ein, der Regen prasselt gegen die Scheiben, und es knarrt im Haus wie eh und je. Hier herrscht immer Sturm. Doch wenn das Wetter einmal gut ist, ist es nirgends so gut wie hier. Ich weiß es, weil ich an verschiedenen Orten der Welt zu Hause war, bei schönem Wetter auf dem Bauch lag und zwischendurch in Unwetter und zahllosen Wetterstürzen landete. Egal wohin ich reise, ich fühle mich an allen Orten zu Hause, bin aber natürlich nur an einem Ort geboren und aufgewachsen und vom Klima und den Menschen dort geprägt. Ich weiß, schönes Wetter ist hier nicht wirklich schöner, sondern nur seltener als an anderen Orten, was allerdings in Fragen des Wetters entscheidend ist. Jedesmal, wenn es einmal nicht stürmt und regnet, ist man so dankbar, daß man sogar nur halbwegs passables Wetter hier besser nutzt als richtig schönes an anderen Orten. Im übrigen hat das Klima wenig Einfluß auf mich, kaum mehr als daß ich davon Notiz nehme, wie es um mich herum weht, und mich darüber freue, daß es auf der Welt noch ungezähmtes Wetter gibt; Wetter, das noch nicht gebändigt wurde von Erwartungen der Wissenschaft und der Meteorologen darüber, wie das Klima beschaffen sein sollte, um gegebenenfalls den Charakter von Regen und Sturm korrigieren zu können. Das Wetter hat seinen Sitz großenteils in der Psyche und die Reaktionen darauf ebenfalls.
Gerade stürmt es mit heftigen Böen, und das Rütteln des Sturms am Holz gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Bei Orkanwetter wie diesem schlief ich immer am besten. Zweifellos empfand ich dann stärker die Sicherheit, die von den Eltern ausgeht, bei Sturm viel mehr als bei ruhigem Wetter. Wenn Kinder Angst bekommen, liegt es also an den Eltern und nicht am Wetter und den Unbilden der Natur. Vielleicht kam es aber auch daher, daß man bei schwerem Sturm nie auf See ging, Vater mithin zu Hause blieb, und Väter ihren Kindern Ruhe einflößen. In Dunkelheit und Traum hörte ich das Toben auf dem Dach. Dabei wurde ich unter meiner Decke ganz ruhig, und hoffentlich geht es nun genauso, wo das Leben zum größten Teil schon in Wind und Wetter verflogen ist und beide Eltern bald im Grab liegen werden.
Mutter ist seit neun Jahren unter der Erde, mein Vater lebt noch, ist aber in ein Nest auf der Halbinsel Snæfellsnes im Westen gezogen, das er, solange er hier lebte, immer seine Heimat nannte, den Ort, an dem er geboren wurde. Genaugenommen kam er etwas außerhalb jenes Orts zur Welt. Wie auch immer, er befindet sich nun in seinem Kaff und ich mich in meinem.
Seine Familie, Verwandten und Jugendfreunde sind seit langem tot; er ist also nicht zurückgegangen, um sie wiederzusehen oder weil er seine letzten Lebensjahre unter Toten verbringen möchte, obwohl er mir einmal im Vertrauen sagte:
– Seitdem ich an den Ort meiner Kindheit zurückgekehrt bin, begegnen mir Tote in meinen Träumen. Ich habe in ihnen schon mit meinem Ziehvater und mit meiner Ziehmutter gesprochen, und wir haben uns prächtig verstanden. Sie trug noch immer ihre gestreifte Schürze.
– Das ist kein Traum, sondern wache dichterische Phantasie, sagte ich.
– Nein, widersprach er. Doch je länger ich im Altenheim lebe, um so seltener kommen die Toten zu mir. Jetzt sind sie auch in meinen Träumen gestorben. Ich träume nicht mehr von ihnen, aber ich denke immer mehr an die Vergangenheit.
Ich fand das nur natürlich, denn wo die Dichtung endet, setzt das Nachdenken ein.
– Ich habe festgestellt, fuhr er fort, ohne mir zuzuhören, daß mir meine Zieheltern immer weniger gefallen.
– Ist es dann im Hinblick auf ihre guten Seiten vielleicht besser, von den Menschen zu träumen, als über sie nachzudenken? fragte ich.
– Ja, nach meiner Erfahrung schon, antwortete er.
– Dann will ich nach deinem Tod nie an dich denken, aber um so mehr über dich schreiben, sagte ich.
Mein Vater lachte. Weil er schlau ist und es ihm Spaß macht, sich in Andeutungen zu ergehen. Trotzdem habe ich den Verdacht, er ist nicht seiner Erinnerungen wegen dorthin gezogen oder um seine letzten Jahre da zu verbringen, wo sie und er zusammen aus dem Gras wuchsen. Auch nicht, um im Geiste ehemals wirklicher Erlebnisse etwas zu schreiben, denn er weiß so gut wie ich, daß Erinnerungen sterben und zwar um so schneller, je länger man nah bei seinen Ursprüngen weilt. Bei der Heimkehr flammen sie noch einmal auf, erlöschen dann aber wie ein Feuer, wenn man es nicht versteht, die Glut am Brennen zu halten – in den Erinnerungen, die selbst wie ein Feuer in einem brennen. Mein Vater ist kein Dummkopf und weiß, daß man sich zum Heraufbeschwören von Erinnerungen am besten in der Ferne aufhält und daß man sie am ehesten loswird, indem man heimkehrt. Also kehrte er nicht zu ihnen zurück, und er wollte auch nicht nachdenken. Was er wollte, war etwas anderes. Er wollte jeden Tag einen bestimmten Berg vor Augen haben: das Kirkjufell, das er so lange nur in seiner Vorstellung gesehen hatte; hier in seinem Haus.
Mein Vater muß alles mit den Händen anfassen, um seine Qualität und Stärke zu begreifen, als wäre es Holz für den Hausbau. Jahrelang war der Berg das Holz, mit dem er sich in Gedanken beschäftigte. Jetzt möchte er ihn lieber im Blick als im Kopf haben. Ich weiß es nicht mit Bestimmtheit, er selbst sicher auch nicht, aber ich meine mich zu erinnern, daß er nie lange über etwas sprach, ohne das Gespräch nach und nach auf den Berg zu bringen. Das war auch anderen wohlbekannt. Eines Tages zeigte er meinem Onkel ein Stück Holz, hielt es ihm unter die Nase und sagte:
– Riech mal daran!
Der sog tief die Luft ein, prüfte den Geruch und seufzte. Dann fragte mein Vater geheimnistuerisch:
– Was meinst du, woher der Baum kommt und wo solches Rosenholz wächst?
Mein Onkel brauchte nicht zweimal zu überlegen; er war froh, die Antwort zu kennen, die über jeden Zweifel erhaben war, da ja mein Vater die Frage gestellt hatte. Also antwortete er froh und welterfahren:
– Oh, der wird wohl aus Grundarfjörđur stammen und im Schatten des Kirkjufell gewachsen sein.
Statt sich zu freuen, meinte Vater, der Onkel sei ein Holzkopf, denn unter dem Kirkjufell wachse Thymian, aber kein Rosenholz, und der dufte besser als Holz. Mein Vater, dieser arrogante Schnösel, wußte es nicht zu würdigen, daß der Bruder meiner Mutter dem in der Diaspora Lebenden einen Gefallen tun wollte, indem er am Ort seiner Kindheit Rosenholz wachsen ließ.
Wie viele Menschen, die körperlich schwere Arbeit leisten, akzeptierte mein Vater vor allem handgreifliche Gründe und unterschied deutlich zwischen Geist und Materie. Allerdings war er auch so gestrickt, daß er ganz gut im nicht kausal Begründeten zurechtkam. Meist hielt er die beiden Bereiche gut auseinander und vermischte sie nicht, außer wenn es um seinen Glauben an die Wahrhaftigkeit der Isländersagas ging. Bei jener Gelegenheit sagte er, sollte es mein Onkel einmal fertigbringen, die Eyrbyggja saga zu lesen, dürfe man nicht viel auf sein Urteil geben, wenn er solchen Quatsch wie den mit dem Rosenholz vom Stapel lasse. Da sein Bruder nun einmal Kraftfahrer sei und alles von sich und seinem Führersitz aus beurteile, würde er es bestimmt nicht glauben, daß die Berserker in der Saga den Weg durch die sogenannte Berserkerlava lange vor der Erfindung der Planierraupe gebahnt hätten.
Ich aber dachte bei mir: Das ist nun der Dank dafür, daß ein Unschuldiger einem anderen Einfaltspinsel eine Freude machen möchte, indem er so tut, er würde glauben, daß Rosenholz am Ort seiner Kindheit wachse.
Mein Vater suchte nach einem Berg, den er nie aus dem inneren Auge verloren hatte. Und weil wir selten etwas anderes suchen als das, was wir gar nicht zu finden brauchen, weil wir schon ein Bild von ihm haben – das uns allerdings nicht genügt so suche auch ich etwas, das ich nie verloren habe. Ich suche Geschichten, von denen ich weiß, daß sie nicht in ihrer wahren Erscheinung zu finden sind, dabei habe ich sie weder verloren noch verändert, doch müssen sie aus ihrem natürlichen subjektiven Zustand in die unnatürliche Einkleidung der Sprache überführt werden.
Ein Schriftsteller kann überall Stoffe und Geschichten finden, so wie ein Mensch, der an die Allgegenwart Gottes glaubt, ihn nie in der Kirche aufsuchen muß. Es ist nicht nötig, sich an den Schauplätzen auf die Suche nach Geschichten zu begeben, ein Blinder kann sie mit bloßem Auge sehen, und selbst wer sich orientierungslos auf Irrwegen durchs Leben schlägt, kann auf den richtigen Spuren einer Geschichte sein. Ich hätte mich also weitab von den Stätten meiner Kindheit halten können, entschloß mich aber, durch fast wöchentliche Besuche im Haus eine Geschichte nach der anderen aus dem raunenden Brausen des Wetters zu ziehen.
Mein Vater wollte mich nicht wiederhaben oder mir etwas verkaufen, nicht einmal einen kaum begehbaren Keller, in dem ich höchstens meine Zehen schlafen legen konnte.
– Es sollen alle das gleiche Recht haben, ein Angebot für dieses Haus zu machen, sagte er.
Es sah ganz so aus, als stünde er in dieser Frage unter dem Einfluß des marktorientierten Denkens unserer Zeit oder von etwas noch Schlimmerem, etwas, das in der Tiefe väterlicher Seelen schlummert und unerwartet an die Oberfläche bricht. Es ist nur wenigen alten Leuten gegeben, mit ihrer wahren Gesinnung hinter dem Berg zu halten, es sei denn, sie hatten das Glück, ihr Gedächtnis zu verlieren, oder sie haben sich schon früh im Leben eine gewisse Unzuverlässigkeit zugelegt, etwa dadurch, daß sie ständig die Meinung wechselten oder unberechenbar wie ein Tyrann waren. Manchen wurde sowieso nie geglaubt, was sie sagten, wieder andere entschließen sich, die Welt vollständig hinter sich zu lassen. Ein derartiges Verlangen kommt bei alten Menschen recht häufig vor. Anfangs ist es oft nichts anderes als pure Selbstverteidigung im Hinblick auf die eigene Lebensführung, weil sie fürchten, die nachfolgende Generation könnte ihnen im Alter Vorwürfe machen. Wenn sie erst einmal wehrlos wären, käme vielleicht der Tag der Abrechnung, an dem sie für ihre Taten, die sie noch im Vollbesitz ihrer Kräfte verübten, zur Verantwortung gezogen werden sollten. Alte Menschen sind immer auf der Hut, und um ihre Angst zu kaschieren, tun sie so, als könnten sie sich an nichts erinnern oder wären die zerstreutesten Trottel.
– Ein solches Haus sollte man arbeitenden Menschen auf dem freien Markt verkaufen, vielleicht einer kinderreichen Familie oder jemandem, der wirklich ein Dach über dem Kopf braucht und bar bezahlt. Oder man überläßt es einem Bedürftigen kostenlos, sagte Vater manchmal entweder gereizt oder überaus großzügig.
In dieser Sache verhielt er sich wie ein kleiner Junge, der für andere gern eine Besorgung macht, zu Hause aber keinen Handschlag tut, weil es eben mehr Anerkennung einbringt, anderen einen Gefallen zu tun als der eigenen Mutter. Letzteres gilt als selbstverständlich und bringt keine Pluspunkte. Eine Außenstehende hingegen überhäuft den Gefälligen unkritisch mit Lob und steigert seine Beliebtheit bei anderen Frauen; die Mutter aber wird über seine Faulheit schweigen oder vertuscht sie und stimmt in das Lob ein, was ihn auf der Beliebtheitsskala nur noch höher steigen läßt, bis er den Schwindel schließlich selber glaubt und sein ganzes Leben über dreist, aber beliebt bleibt für das, was er in Wahrheit nicht anderen zuliebe, sondern nur um der eigenen Beliebtheit willen tut. Alte Leute wissen aus Lebenserfahrung, daß Popularität immer den gleichen Gesetzen folgt. Den Alten gibt es nicht, der nicht ein Meister auf seinem Gebiet wäre, dem Altsein.
Wäre mein Vater eine positive Figur in einem erbaulichen Roman vom Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, geschrieben für Leser, die sich gern etwas vormachen lassen und sich dabei gut und edel fühlen, dann hätte sein Autor ihn als visionären Alten stilisiert und geschrieben: »Als der alte Mann aus tiefstem Herzen diese offenen Worte sprach, ging ein Leuchten über seine Stirn, und er bot sein Eigentum mit freigebiger Hand alleinstehenden Müttern und anderen Bedürftigen dar. Seine Augen sprühten Funken, seine Worte zeugten von einer Mischung aus Stärke, Überzeugung und Mitleid mit tüchtigen Menschen, denen Gott in seiner Güte nur Unglück beschert hatte, und deshalb sprach er zu seinem verlorenen Sohn: Du wirst dieses Haus nie bekommen, denn es ist für Frauen bestimmt, die einen weinenden Säugling an ihrer Brust nähren.«
Ich hörte ihm brav zu, wie es Söhne bei ihren Vätern und Müttern nach christlichem Gebot tun sollen, erlaubte mir aber gleichwohl zu denken, denn ich ließ mir von ihm nie das eigene Denken verbieten: Jaja, ist er mal wieder in dieser Stimmung. Was kann der Alte sich aufregen! Aber laß ihn mal, früher oder später legt sich der Sturm, und der Wind dreht sich, denn auf die Beständigkeit des Wetters und der Gesinnung darf man in Island nicht viel geben.
Zum Lob des Denkens läßt sich sagen, wenn es in den richtigen Momenten zu schweigen weiß, kann es einen sogar von den eigenen Eltern frei machen, was das Schwierigste von allem ist. Also seufzte ich in meiner Seele und hörte meinem Vater geduldig und ein bißchen müde zu. Ich habe lange genug im Ausland gelebt, um an der sogenannten typisch isländischen Mentalität wenig Gefallen zu finden. Eigentlich fand ich sie eher etwas ermüdend und keinesfalls zur Nachahmung empfohlen, und ich bin überzeugt, daß wenig von ihr Zukunft hat. Der Untergang ist ihr sicher. Natürlich kommt es bis zu einem gewissen Grad auf die Umstände an und darauf, ob wir es schaffen, unser Denken zu ändern, ohne unseren Nationalcharakter und unsere Mentalität zu verlieren.
– Ich bin der Meinung, allein Nachfrage und Kaufkraft der Interessenten sollten zu jeder Zeit den Wert eines Hauses bestimmen, fuhr mein Vater mit neuer Überzeugung fort wie ein frischgebackener Immobilienmakler.
Der Zeitgeist war mächtig über ihn gekommen, und das noch in so fortgeschrittenem Alter und bei einem Menschen, der stets Wert darauf gelegt hatte, im Umgang mit seinen Nächsten eigene Wege zu gehen. Dafür folgt er jetzt um so bereitwilliger den ausgetretenen Pfaden anderer, dachte ich.
Ich hätte geglaubt, daß höchstens ein Apologet der Marktwirtschaft eine solche Rede halten würde, wenn ich ihn nicht schweigend wie üblich auf seiner schmalen Ruheliege vor mir gesehen hätte, den Kopf auf einem Kissen unter einem billigen, gelinde gesagt unkünstlerischen, häßlichen und schäbigen Wandteppich mit schmuddelig grauen Rentieren in einem zweifellos deutschen Wald.
Ich hörte, wie er zur Stützung seiner Argumentation seine Haushaltshilfe anführte, eine ehrenwerte Frau, die ihm im Vertrauen gesagt habe, sie könne sich durchaus vorstellen, das Haus zu übernehmen; nicht für sich selbst – sie sei weder geldgierig noch eigennützig, sondern allein mit Tüchtigkeit durchs Leben gekommen, das wisse er schließlich von allen am besten –, sondern für ihre Tochter und ihre Schwiegertochter. Die Tochter könne dann oben wohnen und die Schwiegertochter unten. Beide wären wie viele junge Leute, besonders junge Mädchen, hätten sich Kinder anhängen lassen und nichts als Ärger mit den Kerlen. Daher bräuchten sie viel Verständnis und ein eigenes Dach über dem Kopf.
– Ich habe die beiden hübschen Dinger gesehen, sagte mein Vater.
– Und, wie sind sie? fragte ich.
– Lassen gute Anlagen erkennen, jede auf ihre Weise. Man sieht, daß sie aus gutem Holz geschnitzt und von Grund auf verläßlich sind.
– Dann sind sie also ganz wie das Haus, sagte ich.
– Oder das Haus ganz wie sie, sagte er.
– Sind sie hübsch? fragte ich.
– Beide haben hübsche Mäulchen und sehen ganz niedlich aus, meinte er. Und wenn sie kommen, um mir ihre Kinder zu zeigen, schwingen sie nicht übertrieben locker mit den Hüften.
– Wo ist denn sonst was locker bei ihnen? fragte ich.
Sie haben Männern zuviel vertraut, die es nicht verdient haben; weder die Kanaillen, die sie gleich nach der Konfirmation schwängerten, noch die Kerle, die ihretwegen ihre Frauen verließen, zu ihnen ins Bett stiegen und ihnen ein weiteres Balg anhängten und sie dann zu allem Überfluß auch noch heirateten.
– Ist es etwas so Schlimmes, die Mutter seines Kindes zu heiraten?
– Nein, sagte er. Aber dann erst haben sie trotz ihrer Unschuld begriffen, daß die beiden Schweinehunde waren.
– Auch der Sohn deiner Haushälterin? fragte ich.
– Der ist der Schlimmste. Das hat er von seinem Vater.
– Ein verläßliches Fundament und gutes Holz scheinen deinen Mädchen nicht viel genützt zu haben, bemerkte ich.
– Bist du schwer von Begriff? fragte mein Vater.
– Wieso?
– Weißt du denn nicht, daß die größten Dreckskerle am leichtesten bei den besten Frauen unter die Decke kommen, die gute Anlagen und Charakter haben?
– Das finde ich schon etwas merkwürdig, sagte ich.
– Nein, das ist ganz natürlich, sagte er. Solche Frauen sind so hilfsbereit, daß sie die Männer nicht durchschauen, weil ihre Gutmütigkeit ihnen den Blick trübt. Gewöhnlich kommen unschuldige Mädchen nicht hinter den schlechten Charakter der Männer, bevor sie ein Kind von ihnen erwarten und dann eins nach dem anderen, mit denen sie sitzengelassen werden.
Vor Entrüstung über die Verantwortungslosigkeit der Männer warf mein Vater die Lippen auf.
– Können sie sie nicht im Hafen der Ehe festmachen?
– Willst du etwa, daß die unschuldigen Kinder von diesen Vätern lernen, sich wie Feiglinge aufzuführen? fragte er. Gute und verantwortungsbewußte Frauen behalten ihre Kinder für sich. Vor allem die Jungen lernen das Gute von den Müttern und springen dann später nie schlecht mit Frauen um.
– Deshalb setzt die Gegenwart so sehr auf Erziehung, sagte ich.
– Hoffentlich wird die Zukunft dementsprechend, meinte er, obwohl ich das ja nicht mehr erleben werde.
– Gute Frauen haben also immer genug zu tun, sagte ich.
– Natürlich, antwortete mein Vater. Frauen arbeiten zu Hause wie draußen an den verschiedensten Dingen. Die zum Beispiel, die ich meine Zugehfrau nenne, hat unheimlich viel um die Ohren. Sie muß sich überall um so vieles kümmern, den Kindern oder anderen Frauen helfen, daß sie es oft nicht zu mir schafft, obwohl ich ihre Hausbesuche natürlich aufschreibe, auch wenn sie gar nicht da war.
– So, tust du das? fragte ich.
– Ich bin doch nicht so gemein und verhindere, daß gute Frauen ihr volles Gehalt von der Gemeinde ausbezahlt bekommen. Sie hat es nur verdient, daß ich ihre Besuche bestätige, antwortete er. So bekommt sie wenigstens etwas für all ihre fürsorgliche Hilfe. Und das hat sie mir zu verdanken.
– Du hast doch ein gutes Herz, sagte ich.
– Das behauptet sie auch. Bergur, sagt sie, täte es dir nicht gut, einmal auch selbst etwas für dich zu tun, mein Bester? Ich bringe dir dann ein paar Pfannkuchen mit, wenn du mir meine Stunden bestätigst. Ich weiß, daß du den Abwasch und das bißchen Putzen auch spielend allein schaffst. Deine Frau hat dir doch nie erlaubt, dich ein bißchen im Haushalt zu betätigen. Du hörst, diese Frau versteht mich. Bei deiner Mutter durfte ich nie Zucker an den Fisch tun. Sie aber sagt: Das bißchen Zucker an dem Essen, das du dir mittlerweile so tüchtig selbst kochst, bringt dich nicht um. Ich bringe dir dann die Pfannkuchen dazu. Nein, es bekommen nicht alle eine so gute Frau. Aber ich bin so weit Realist, daß ich doch eins mitbekomme: Mit all ihrer Fürsorglichkeit schafft sie es höchstens, die miesen Kerle zu einer Entziehungskur zu bewegen. Von der kommen sie als reuige Sünder zurück und wollen unbedingt Theologie studieren. So sind doch eine Menge junger Pastoren, und das bringt die Kirche noch an den Bettelstab. Deshalb wird jeder einsehen, daß es immer noch besser ist, ein jammerndes Weib zur Pastorin zu haben, das von der Kanzel seine Schulaufsätze verliest, als in Alkoholfragen wieder intakte Jungfrauen von Kerlen, die ihren Entzug bei Gott leisten.
Nach dieser Suada machte er eine Pause und fügte dann traurig, als hätte er selbst einschlägige Enttäuschungen durchlitten, hinzu:
– Die größten Schufte bekommen die besten Frauen.
Wollte er damit bekunden, er sei nicht bösartig genug gewesen, um eine anständige Frau zu bekommen?
– Die Schufte schnappen sie einem vor der Nase weg, sagte ich.
– Das können sie, sagte er.
– Sie haben ja sonst nichts zu tun, sagte ich.
– Ich finde, es ist kein Wunder, daß die Welt ist, wie sie ist, bemerkte mein Vater sehr traurig. Die Frauen haben darin nichts zu sagen, weil sie nicht einmal ihre eigene Gutmütigkeit beherrschen können. Ich lasse mal beiseite, daß es natürlich auch schlimme Fuchteln gibt.
Obwohl er seinen Besitz nicht seinen eigenen Kindern verkaufen wollte und sagte: Ihr durftet euch hier aufhalten, als ihr klein wart, das sollte doch wohl reichen, ist es jetzt so weit mit ihm gekommen, daß er nicht mehr über Dinge bestimmt, die er früher ganz allein entschied. Das kommt nicht daher, daß ihm jemand die Entscheidungsgewalt abgenommen hat, sondern er ist einfach zu senil geworden, um noch aus eigener Vernunft zu entscheiden.
– Solange ich es noch kann, will ich das, was mir gehört, auf dem offenen Markt verkaufen, wo jeder ein Gebot auf mein Haus abgeben darf, sagte er mit der Überzeugung, die Menschen mit festem Glauben und gutem Gedächtnis auszeichnet. Sie erinnern sich noch haarklein an das, was ihnen zu ihrer Zeit von ihren »Lehrmeistern« beigebracht wurde – während diese Lehren schon längst Gegenstand eines Glaubenswechsels wurden. Als mein Vater während seiner Lehrjahre beigebogen bekam, wie die Dinge zu sein hätten, wenn alles gut und recht sein solle, legte er einen bedingungslosen Gehorsam an den Tag. Wenn es sich bei solchem Verhalten um einen kleinmütigen Menschen handelt, der seine Freiheit nur dazu nutzt, zu parieren, dann glaubt er am Ende, die Lehren, die er aus seinem langjährigen Gehorsam gezogen hat, seien die richtigen, so daß seine Überzeugungen ebenso unerschütterlich sind wie die seines Herrn. Obendrein finden Herr wie Knecht, es zähle nichts als ihr eigenes Befinden, und sie werden ungeheuer sensibel, ertragen beide nicht die geringste Kritik. Wenn man sich mit solchen Leuten anlegt, bekommen sie bald einen Herzschlag und reden von Verschwörung und Übergriffen, bis der Widersacher die Segel streicht. Kein gewöhnlicher, rechtschaffener Mensch will es sich auf sein Gewissen laden, jemanden mit einem Herzinfarkt ins Jenseits befördert zu haben, und sei es auch ein irregeleiteter Kleingeist oder einer der Wortführer, denn in einer zivilisierten Gesellschaft zählt ebenso wie in einer unzivilisierten das Recht des Kranken – selbst wenn er sich im Irrtum befindet – mehr als das des Richtigdenkenden, und es ist nicht zulässig, ihn durch Widerspruch einem Risiko auszusetzen. Deshalb ist die Welt stets in den Händen von Kranken und wird es auch weiterhin bleiben.
Aufgrund innerer Bedürfnisse, die sich nicht um äußerlichen Profit scheren, ging die Sache schließlich doch gut aus. Statt das Haus Bedürftigen auf dem freien Markt zu verscherbeln, lag es meinem Vater am Ende doch näher, eigene Wünsche zu befriedigen: die Rückkehr zum Ort der Kindheit. Und als er sein Ziel erreicht hatte, sich am richtigen Ort wieder in den Händen guter Frauen befand, da riskierte er es nicht mehr, sich daran zu erinnern, wie die Dinge eigentlich zu sein hatten, wenn man dem Gelernten folgen wollte, und die Zeit im Exil spielte überhaupt keine Rolle mehr. Unter diesem Blickwinkel interessierte ihn das Haus, das er mit allem, was sich darin befand, eigenhändig gebaut hatte, nicht mehr im geringsten. Lediglich das Bild mit dem Berg darauf nahm er von der Wand, den er nun täglich wieder vor Augen haben konnte, wenn er sich denn einmal von der Liege aufrichtete, auf der er in seiner Ehe jahrzehntelang in einem anderen Landesteil gelegen und stets mit Begeisterung von dem geredet hatte, was er lebendig vor seinem inneren Auge sah, während andere es lediglich auf dem Bild erblickten. Als er endlich wieder zu Hause war, konnte er sich zugleich am Anblick vom Tod des inneren wie äußeren Bildes weiden wie auch, bei einem Blick durch das Fenster, an dem Berg selbst, der in seiner ganzen Erhabenheit und Wahrhaftigkeit vor dem Himmel aufragte. War es da ein Wunder, daß er sich glücklich und zufrieden schätzte? Als ich ihn aber vorsichtig fragte, ob er jetzt nicht ständig am Fenster säße, um den Berg zu betrachten, sagte er:
– Nein. Ich habe das Bild aufhängen lassen und sehe ihn mir lieber darauf an. So kann ich ihn auch sehen, wenn ich liege.
– Das ist bequemer, sagte ich.
– Ja, ich weiß nicht, ich bin einfach wieder da, sagte er ein ums andere Mal, wenn ich ihn besuchte.
– Was soll mit dem Haus passieren, wenn du nicht zurückkehrst? Soll es den richtigen Leuten verkauft werden? fragte ich.
– Ich bin nach Hause gekommen, alles andere interessiert mich nicht mehr, das mußt du doch begreifen, wiederholte er ungeduldig und wollte keinen Unsinn mehr hören.
Trotz aller Anstellerei wußte er, daß nicht sein Wille nachließ, sondern sein Körper. Er verstand nicht, weshalb sein Geist sich ähnlich verhielt, obwohl sein Gedächtnis selbst nach einem Schlaganfall kaum beeinträchtigt war. Der Teil seines Geistes, der alles aus den Händen gleiten ließ, war nicht er selbst, sondern so etwas wie sein Lebenswille. Er hatte so gut wie alles Irdische bis auf das Dasein selbst aufgegeben, bis auf die Kunst, noch das zu erleben, was vom Leben nach der Wiederbegegnung mit dem, was er nie wirklich, sondern nur zeitweilig verlassen hatte, noch übrig war. Der Verstand begriff die Zusammenhänge nicht mehr und fand sich nicht mehr zurecht, wie wenn Dummheit die Überhand in ansonsten vernünftigen Dingen gewinnt.
Konnte das Alter womöglich die größte Dummheit des Lebens sein?
Ich saß an seiner Seite und hatte das Gefühl, im stillen seine Gedanken zu lesen.
Oft dämmerte er hinter den Mauern des Altersheims vor sich hin und dachte nicht mehr an den freien Markt, an wunderbare Frauen, die sich wegen ihrer Gutherzigkeit damit abrackern, den Schuften, die sie betrogen haben, wieder Boden unter die Füße zu geben, oder daran, ihnen zu ihrer Unterstützung Häuser zu überlassen. In ihrem hoffnungslosen Kampf der Hilfsbereitschaft gegen die Nichtsnutzigkeit war ihnen nicht mehr zu helfen. Die Frauen mußten zusehen, wie sie mit Tüchtigkeit und Anstand allein zurechtkamen, wie sie es immer getan hatten, und wie sie auf diese Weise leichter zu Gott kamen als die Männer, damit sie dort den Schuften das Himmelreich bereiten konnten.
Manchmal schlug Vater langsam die Augen auf wie nach einer Erleuchtung in seinem Dämmer und sagte:
– Daß die Kirche neuerdings weibliche Pfarrer zuläßt, dürfte den Frauen bei Gott den Vortritt einbringen.
Ich sperrte die Ohren auf und wartete, was jetzt weiter käme.
– Sonst ist ja wenig davon zu erwarten, jetzt Geistliche ohne Beutel den Klingelbeutel halten zu lassen, sagte er beinahe fröhlich.
Dann riß er die Augen auf, grinste über sein Wortspiel und sagte spöttisch:
– Da wird es wohl bald so weit sein, daß der Himmel voll ist von nackten Weibern, die sich Kinder von durchgedrehten Engeln anhängen lassen, denen auf einmal die Natur gekommen ist.
– Weißt du noch, ob du damals geträumt hast, als du dich für einen Himmel nur für Frauen ereifertest, so wie man sich ein eigenes Paradies für Vögel vorstellt? fragte ich.
– Ich vergesse völlig nach Belieben, gab er abwesend zurück.
Bald neunzig, lebt er weiter auf diesem reichlich von Erinnerungen befahrenen Meer der Vergeßlichkeit, auf dem auch er wacker seine letzte Fahrt zurücklegt, oder er hat sich umgekehrt eine passende Gedächtnislücke zugelegt, die ihn vor Enttäuschungen bewahren soll, obwohl ihm von Tag zu Tag klarer werden muß, daß ein Mensch fern von dem Ort, den er einmal verließ, an den er sich aber ein Leben lang zurücksehnte, in seinem Wunschdenken etwas anderes vor sich gesehen haben muß als die Wirklichkeit, die ihm bei seiner Rückkehr ins Gesicht schlug. Alles ist anders als vor seinem inneren Auge. Er kennt niemanden mehr. Doch obwohl ein solcher Mensch enttäuscht ist und sich selbst vielleicht Vbrwürfe macht, mehr auf Träume als auf das Wachsein zu geben, hat er keine andere Wahl mehr als nun dort auszuharren, wohin er auf der letzten Suche gekommen ist, auf die ihn die Trugbilder des Lebens geführt haben. Deshalb versöhnt er sich mit Hilfe der vertrauten Illusionen erschreckend schnell mit dieser schmerzlichen Erfahrung. Der größte Teil des Alters oder des Altwerdens besteht darin, in einer anderen Traumwelt als in der der Jugend zu leben und zu versuchen, sich damit abzufinden, so weit Gedächtnis und Erinnerung erlauben, sowie in der Fähigkeit, die dazu nötige Vergeßlichkeit aufzubringen.
– Ich bin eigentlich mit dem zufrieden, wovon ich immer geträumt habe, sagte er und legte sich nach dem Kaffee mit einem zufriedenen Seufzer auf seine Liege.
Wir waren gerade vom Speisesaal zurückgekommen. Ich hatte durch das Fenster die Berghänge betrachtet oder versucht, eine Konversation über anderes in Gang zu helten als das Alter der übrigen Insassen, wie viele Kandisstücke sie nehmen durften und welche Zipperlein sie quälten.
Ich finde, alles, was ihn selbst angeht, bekommt er noch gut mit.
– Man kann doch nicht anders als zufrieden sein, wiederholte er.
Er war wieder lebhafter geworden, seit er sich hingelegt hatte, und wurde nun wieder ganz der Alte. Ich dagegen setzte mich auf einen Stuhl und wurde ein wenig schläfrig.
– Die Heimbewohner hier sind der älteste Kern der Nation, die letzte verläßliche Generation, die noch am Leben ist, fuhr er unverdrossen fort.
Das sagte er mit der ihm üblichen Entschiedenheit. Dabei hatte er mit den anderen nichts gemeinsam bis auf das hohe Alter, auf keinen Fall aber gemeinsame Erinnerungen oder Interessen, sofern überhaupt noch welche vorhanden waren, und erst recht nicht das Gedächtnis. Das hatte sich bei den meisten längst in Luft aufgelöst. Die anderen vermißten nichts und konnten sich auch über keine Heimkehr freuen, denn sie hatten immer hier gelebt, waren lediglich an die Berghänge am Ortsrand verlegt worden, wo bis auf das Altersheim nichts gebaut worden war – wegen der heftigen Böen und Fallwinde von den Berggipfeln und der Lawinengefahr. Die letzte verläßliche Generation wäre im Schnee erstickt oder auf den Fjord hinausgeweht worden, wenn sie nur einen Fuß vor die Tür gesetzt und mehr Aktionsradius gehabt hätte als den, viermal täglich in den Speisesaal zu schlurfen, um sich den Bauch zu füllen, und dann zurück auf die Zimmer, um sich hinzulegen.
– Alte Menschen werden so wohlversorgt in dieser Gesellschaft der vielen Heime außerhalb des eigenen Heims, sagt mein Vater und grinst.
– Willst du damit sagen, es könne einem gar nicht anders als gutgehen in diesem letzten Heim des Lebens, dem Altersheim? frage ich.
Mein Vater hält oft lange die Augen geschlossen. Das scheint er sich angewöhnt zu haben, seit er an den Ort seiner Kindheit zurückgekehrt ist. Er spricht auch sehr oft mit geschlossenen Augen, doch seine Lider zittern, denn ständig denkt er an etwas.
– Natürlich, antwortet er und lacht in sich hinein. Ein alter Mensch wird zum zweiten Mal Kind, sagt das Sprichwort. Und es gibt genügend Mütter, die auf halben Stellen und mit halber Aufmerksamkeit die alten Leute im Heim bemuttern. So kommen sie wenigstens zehn Meter vor die Tür, und das scheint ihnen zu reichen. Frauen sind so genügsam, was Freude und Freiheit angeht.
Ich hörte ihm aufmerksam zu. Es zeichnet Menschen mit gutem Gedächtnis aus, daß sie sich in ihren Ansichten niemals irren, sofern es ihnen beliebt, welche zu haben. Was das Zwischenmenschliche angeht, können sie jedoch durchaus manches Mal danebenliegen. Doch dem ehernen Gedächtnis gereicht alles zum Vorteil. Wem eines vergönnt ist, der weiß, wovor er sich hüten muß, und tut daher stets das Richtige, denn durch sein gutes Gedächtnis kann er gar nichts falsch machen.
Lerne, indem du auf deinen Vater hörst, sage ich mir, und er redet weiter auf mich ein. Lerne du nicht, zu vergessen, aber laß dem Vergessen seinen Lauf und laß deine Erinnerung nicht Gerechtigkeit fordern, sondern etwas anderes.
– Welchen Lauf und was denn? fragt er und liest meine Gedanken.
Ich sage es ihm, und er verstummt, nachdem er fast vier Stunden ohne Unterlaß geredet hat.
Wenn ich vier Stunden im Bus sitze, um ihn zu besuchen, und wenn ich viereinhalb Stunden bei ihm sitze und behutsam an etwas aus der Vergangenheit rühre, wenn ich, bevor ich mich verabschiede, auf etwas zu sprechen komme, das ich für etwas uns Gemeinsames halte, und wenn ich dann noch einmal vier Stunden für den Heimweg brauche, dann meint er, er dürfe darauf kurz angebunden antworten:
– Ich denke, wenn du nur gekommen bist, um mich daran zu erinnern, brauchst du gar nicht zu kommen.
– Über irgendwas müssen wir doch reden, ehe der Bus fahrt, sage ich.
– Quassel nicht so viel, daß du die Zeit vergißt und ihn verpaßt! Er fährt um halb fünf, sagt er.
– Ich weiß, sage ich geduldig und frage noch einmal, ob er sich jetzt an die Sache erinnere.
– An welche? fragt er erstaunt.
Ich sage noch einmal, was ich vor allem gern wissen möchte und nicht mit dichterischer Phantasie ausmalen will.
– Ich erinnere mich, daß ich das lange vergessen habe, und es wird auch nicht wieder daran gerührt, solange ich lebe, weder von dir noch von anderen, die sich nur an Dinge erinnern, die ihnen selbst am besten passen, sagt er.
– Wie die Autokraten, sage ich.
– Mit mir ist es etwas anderes als mit ihnen. Ich bin noch von altem Schrot und Korn, sagt er. Ich weiß noch ganz genau, was ich zerbrochen, verloren und vergessen habe.
Er macht eine Pause. Seine Lider zittern, doch er öffnet die Augen nicht, als er fortfahrt:
– Das heißt es, ein Isländer zu sein.
Ich mache unzählige Besuche, ich rede endlos mit ihm, manchmal bleibe ich Nacht um Nacht im Hotel, um länger bei ihm zu sitzen oder zu schweigen, um zuzuhören oder zu reden, wenn ich ihn zu einem Gespräch erwärmt habe; ich rede selbst in Gedanken mit ihm, ich rede mit ihm im Bus, auf dem Hin– und auf dem Rückweg, in Gedanken rede ich endlos mit ihm und meiner Mutter, und am Ende weiß ich kaum noch, ob sie durch mich sprechen, ob das Gesagte, das ihnen sehr ähnlich sieht, von ihnen kommt oder von mir.
So muß es sein, denke ich. Der eigene Ursprung kann überall und nirgends sein, aber immer liegt er im Denken und in den Worten.
So eingestimmt, kehrte ich in das Haus meiner Eltern zurück. Das habe ich dem Wunsch meines Vaters nach Heimkehr zu verdanken. Diesmal hatte ich mir das Recht erkauft, durch die Tür auf der Nordseite einzutreten und die steile, enge Stiege hinaufzugehen.
Jetzt sitze ich hier und führe mich selbst in meine eigene Zeit zurück. Damit ich zu jedem beliebigen Ereignis zurückkehren kann, etwa wie das Haus unter den Händen meines Vaters entstand oder wie schief sich meine Mutter hielt oder dachte oder wie ich selbst zum ersten Mal ein Künstler wurde, als mein Vater mir eines Tages eine Holzleiste reichte, eine Art Szepter, das er im Frühjahr 1935 eigenhändig aus einer ungehobelten, mit Sägemehl bestäubten Holzplanke sägte.
Hausbau
Meine Eltern, Jóhanna Guđleif Vilhjálmsdóttir und Bergur Bjarnason, nahmen uns Jungen mit, meinen älteren Bruder und mich, als sie zum zweiten Mal, diesmal vom Hochland herab, mit ihrem ganzen Hausstand ins Ungewisse umsiedelten, wo sie keinerlei Bleibe hatten und nirgends unterkamen, außer in der Dorfschule. Dort wurden wir vorübergehend einquartiert, unser gesamtes Hab und Gut neben uns auf einer Matratze auf dem Boden ausgebreitet. Mama kochte auf einem kleinen Petroleumofen, der »Gasmaschine«, und Wasser bekamen wir entweder von den Nachbarn oder holten es, brackig und von weit her, in einer Milchkanne. In der Fangsaison des folgenden Winters hatte Papa das Glück, auf einem der Boote des örtlichen Reeders anmustern zu dürfen, und Mutter ging bei ihm und seiner Frau in Stellung. Dort war sie das, was man damals eine Saison- oder Teilfrau nannte, und durfte uns Jungen mit zur Arbeit bringen. Das Haus trug einen Namen, Höfn, und das Reederpaar hatte zwei Söhne ungefähr in unserem Alter, die Hafenjungs, wie sie gerufen wurden, obwohl es zwischen ihnen auch noch eine Schwester gab; die aber blieb bei der Namensvergabe unbeachtet. Die Sprache sah so etwas nicht vor, und außerdem war das Mädchen in der Minderheit, obwohl es in Wahrheit in allem den Ton angab. Das Hafenhaus lag draußen auf der Landzunge Nes und somit in einiger Entfernung von den anderen Häusern des Ortes, sechzehn Stück, die sich im sogenannten Þorkatlastađir-Viertel zusammendrängten. Höfn war nicht allzu weit von der Schiffslände entfernt erbaut worden. Und außer ihm standen noch zwei weitere Häuser auf Nes.
Im Frühjahr, als die Fangzeit zu Ende ging, durften wir weiter in Höfn wohnen bleiben. Wahrscheinlich weil die Hausbesitzer so nette Menschen waren, brauchten wir Matratze und Deckbett, den einen Topf zum Kartoffelkochen, die Waschschüssel, Milchkannen, Besteck und zwei Nachttöpfe nicht wieder vorübergehend in die Schule zu tragen, obwohl das nahegelegen hätte, denn von dort war es nicht weit zu der Stelle, an der mein Vater begonnen hatte, das dritte Heim seiner Ehe zu bauen. Wir blieben auch den nächsten Winter noch in Höfn. Bis dahin hatte mein Vater unser Haus sturmsicher unter Dach und abgedichtet und auf diese Weise der Ortschaft ein weiteres Gebäude hinzugefügt, die doch ziemlich weit vom Strand und den Fischerbooten entfernt stand, die am Ende der Saison fein säuberlich auf dem Flutkamm aufgereiht lagen und mit dem Bug zum Sonnenuntergang im Westen, mit dem Heck zum Sonnenaufgang im Osten zeigten.
Jeden Mittag brachte Mutter meinem Vater das Essen. Wir Brüder begleiteten sie in der Regel, um zu sehen, wie sich aus den Bretterstapeln allmählich unser zukünftiges Zuhause erhob und wie aus dem Formlosen eine sinnreiche Form erwuchs. Wir verfolgten jeden von Papas Handgriffen in der Hoffnung, auch einmal für einen kurzen Moment eines seiner Werkzeuge halten zu dürfen, vor allem die Sägen und Hobel, die einem mit ihren Zähnen und Zungen gefährlich werden konnten. Die Versuchung war groß, denn es hieß, man könne sich selbst und andere damit tödlich verletzen, und also waren es ganz besonders faszinierende Instrumente für unschuldige Kinder, die sich Waffen und Mordinstrumente ersehnten. Nicht zu einem besonderen Zweck, sondern einfach nur, um das Böse umzubringen: die anderen Kinder. In der Vorstellung von Kindern sind immer die anderen die Bösen. Liebe Kinder kennen keine berauschendere Vision als den bösen mit Hobeln, Sägen, Hämmern und Stecheisen zwischen Kopf und Schultern zu fahren.
Papa aber war eifersüchtig auf seine Mordwerkzeuge bedacht. Er lachte nur über die natürlichen Instinkte seiner Söhne und meinte, wir sollten mit dem Umbringen warten, bis wir groß genug dazu seien.
Wir wurden ungehalten und mochten nicht glauben, daß Größe und Alter beim siegreichen Einsatz und Töten auf dem Schlachtfeld der Gerechtigkeit eine Rolle spielen sollten.
– Erst müßt ihr mal arbeiten lernen, sagte er und meinte besonders das Arbeiten mit Holz.
Dazu hatte ich keine Lust. Ich merkte schnell, daß ich mich dabei recht geschickt anstellte, und von Kindesbeinen an vermochte ich keinen Grund dafür sehen, das zu tun, was ich bereits konnte. Viel lieber versuchte ich mich an Dingen, die immer wieder neues Bemühen, Geschicklichkeit und Verstand erforderten und gerade das abverlangten, was einem nicht leichtfiel. Durch Arbeit sollte man sich aneignen, was einem abgeht, und sich nicht mit dem zufriedengeben, was man ohnehin und als Geschenk von Gott erhalten hat. Ich war immer der Meinung, nur Dummköpfe wollen das tun, was ihnen sowieso leichtfällt.
– Ihr sollt beide einmal Zimmerleute werden, sagte Vater, obwohl er uns beim Zimmern gerade nicht um sich haben mochte, sondern nur in der Mittagspause.
– Dürfen wir dann die Sägezähne anfassen? fragten wir hinterlistig und meinten so, Interesse an unserem zukünftigen Beruf zu bekunden.
– Aus euch werden einmal armselige Zimmerleute, wenn ihr euch gleich zu Beginn mit Hobeln und Sägen umbringt, meinte er auf seine logische Art und scheuchte uns weg.
Wenn er arbeitete, wollte mein Vater für sich allein sein. Ich bemerkte es schon früh: Wenn er mit anderen Zusammenarbeiten mußte, dann haute er dermaßen rein, daß er sich völlig vergaß und kaum mit seinen Kollegen Pause machte. Der tiefste Beweggrund dafür bestand nicht, wie man annehmen könnte, in einer angeborenen Tüchtigkeit, sondern darin, daß er auf diese Weise auch unter den anderen ganz für sich sein konnte. Die Arbeit allein stillte sein ganzes Bedürfnis nach Gesellschaft. Ich glaube, daß ich daraus meine eigene Einstellung bezogen habe, die größte Gemeinschaftsleistung eines Menschen sollte darin bestehen, die Kunst zu beherrschen, bei der Arbeit ohne Einsamkeitsgefühle oder den Wunsch, etwas kaputtzuschlagen, mit sich allein sein zu können. Mein Vater war ungemein stark; doch ich weiß nicht, ob Kraft und Stärke einen zum Einzelgänger machen oder ob umgekehrt der Wunsch, allein zu sein, Kraft und Stärke verleihen – allerdings nicht solche, die Seele und Gefühl brauchen. Körperlich starke Menschen sind in ihrem Innern erstaunlich weich und ungefestigt und selten von starker psychischer Kraft. Kraft und Muskeln sind die einzigen Freunde und seelischen Genossen des körperlich Starken. So ist es mit den meisten Kraftprotzen auf allen möglichen Gebieten.
Nur während Vater das Essen in sich hineinschlang und ein wachsames Auge auf alles hatte, durften wir das Werkzeug näher betrachten. So konnten wir kaum einmal eines auch nur berühren, ehe er es schon bemerkte und mit dem Suppenlöffel nach uns schlug. Auf diese Weise bekamen wir eingebleut, daß es seine Werkzeuge waren, und das schmierte er uns auch oft genug aufs Butterbrot:
– Faßt nicht mein Werkzeug an! Nehmt die Flossen weg! Ihr könnt damit nicht umgehen und ruiniert mir nur den Schliff, ihr Dussel! Ich sehe schon, daß aus euch nie richtige Zimmerleute werden.
Er änderte schnell seine Meinungen. Seine Wünsche wechselten dauernd das Gesicht und widersprachen sich. Wir wußten nicht, wie wir mit diesem wetterwendischen Aufbrausen umgehen sollten, und wurden steif und übervorsichtig, wagten kaum, uns zu rühren, damit Hobel, Sägen und Stecheisen nicht durch unsere Ungeschicklichkeit oder Zerstörungswut den Schliff verloren. Da legte er gehässig und gemein noch einmal nach:
– Wie könnt ihr euch nur einbilden, daß Burschen wie ihr in einem Dorf, in dem es nicht einmal Möchtegerntischler gibt, etwas von Werkzeug verstehen?
Wäre ich Psychologe, dann würde ich sagen, daß ich mit der Zeit eine Aversion gegen seinen Werkzeugkasten entwickelt hätte. Nachdem das Haus fertig war, lockte es mich nämlich nur noch äußerst selten, mich auf den Dachboden zu schleichen und den Deckel von der Kiste zu heben, um einen Blick auf die vielerlei scharfen und faszinierenden Instrumente zu werfen, die niemand anfassen durfte, wenn ihm sein Leben lieb war. Ein Kind verlangt es nämlich nicht so sehr, täglich einen von Respekt erfüllten Blick auf die Werkzeugkiste seines Vaters zu werfen, sondern es möchte viel lieber hineingreifen, um seinen Eltern Ungehorsam zu zeigen und auf der Stelle unter grauenvollen Umständen und mit schrecklichem Blutverlust als Opfer böser Mächte zu sterben, darauf zu Gott auffahren und sich die Welt von oben aus dem Himmel betrachten, an der Seite dieses höchsten und gütigen Vaters, bei dem es seine Eltern für ihre Verständnislosigkeit und die erlittenen Mißhandlungen im Erdenleben anklagen kann.
– Ja, das verstehe ich gut, mein liebes Kind, sagt Gott dann. Wenn ich dein Papa auf Erden wäre, hättest du den lieben langen Tag hobeln und sägen dürfen wie das Jesuskind in der Werkstatt Josefs, seines Scheinvaters. Glaubst du etwa, ich hätte kein Verständnis für dich? fügt er noch verständnisvoll hinzu.
Im stillen war ich Gott dankbar und begann ungefragt, an ihn zu glauben, an den Vater im Himmel. Und dieser Glaube hatte seine Vorteile; zu wissen, daß jemand besser war als Papa.
An Stelle der Werkzeugkiste machte ich mich daher über die Knopfdose von Mama her, die ihr natürlich nicht weniger gehörte als Papa sein Werkzeugkasten. Der Unterschied zwischen ihnen bestand darin, daß Mutter in ihrer Kindheit immer alles mit ihren Geschwistern teilen mußte, so daß sie früh die Kunst lernte, daß eine oder andere auch ohne alleiniges Eigentumsrecht zu besitzen. Am häufigsten hielt ich mich aber doch draußen unter freiem Himmel auf und beobachtete dort die Wunder des Körpers und der Natur oder meditierte und ging, was das Beste überhaupt war, in eine Art Nirwana ein, fern von den Dingen, der Welt und den Menschen. Vaters große Brechstange zog allerdings immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Sie war eigenartig geformt, wahnsinnig schwer, aus einem besonderen Material und trug einen seltsamen Namen: Kuhfuß. Es mußte sich also wohl um einen Knochen aus Eisen handeln, der aus einer mir unbekannten Kuh stammen mußte. Von daher faßte ich früh Interesse für das Schlachten, denn ich wollte doch zu gern sehen, wo dieser Kuhknochen saß.
– Es ist nur ein Name und kommt nicht wirklich aus einer Kuh, sagte Mutter.
Ich fand auch das Wort Kuhfuß als solches merkwürdig, und es weckte mein Staunen. Der Kuhfuß als Werkzeug verlor darüber keineswegs seinen Wert. Im Gegenteil wurde er noch geheimnisvoller und blieb in meiner Vorstellung präsent. So staune ich noch immer über einen Kuhfuß mehr als über die mir bewiesene Tatsache, die ich als Autor, der Bücher in vier verschiedenen Verlagen veröffentlicht hat, zuerst nicht glauben wollte, daß nämlich Frauen aufgrund ihrer Genauigkeit die besseren Korrekturleser sind. Trotzdem hat es mich nie verlangt, mit Körperkraft einen Kuhfuß zu schwingen, um als gestandener Mann zu gelten. Doch wenn ich einmal bei der Arbeit eins einsetzen muß, durchrieselt mich ein seltsames Gefühl: Ich empfinde eine geheimnisvolle Erleichterung in Körper und Geist. Während die meisten Jungen davon träumten, einen Kuhfuß zu besitzen, um ihn täglich, so wie ein Krückstock einen Hinweis auf das lahme Bein eines Alten liefert, als Beweis ihrer Kraft in einer Hand mit sich herumzutragen, fand ich es viel geheimnisvoller und spannender, an der Hauswand zu sitzen und zu fühlen, wie trockener Sand in meiner geschlossenen Faust kitzelnd zwischen den Fingern hindurchrann, und zwar kitzelte es um so mehr, je leerer die Faust und je schneller das Rinnsal wurden, das meine Hand im Gegenzug mit Leere zu füllen schien. Darin drücken sich ein Gleichgewicht und eine Komplementarität zwischen Stofflichem und Nichtstofflichem aus, zwischen dem, was sich anfassen läßt, und dem, was sich nur mit dem Denken und den Sinnen erfassen läßt. Es ist der Zusammenfall von Form und Inhalt. Ich konnte Stunden so zubringen, manchmal ganze Tage, und dabei das Wohlgefühl genießen, Materie und Nicht-Materielles zugleich in meiner Hand und im Leben zu spüren und vielleicht auch noch die Kunst, den Zusammenklang von Form und Inhalt im Dasein.
Die ständige Anwesenheit des Meeres schlug das Auge in Bann und weckte nicht weniger den Wunsch nach Selbstvergessenheit als der Sand. Diese stets veränderliche und farbige Weite, die irgendeine innere Entsprechung in mir hatte. In meiner Erinnerung meine ich gesehen zu haben, wie sich, wenn wir meinem Vater das Essen brachten, ein weißer Nebel über die weite See legte, der sich dann langsam auflöste. Und das war nicht der gewöhnliche graue Nebel oder die kochende Gischt des Frühjahrs, die das Meer auf dem Weg ständig über uns stäubte, wenn hohe Brecher in die Felsnischen am Ufer rollten, in die Spalten im Fels gesaugt wurden und an den schwarzen Wänden brachen. Die See brüllte dann laut und wütend und schoß in weißen Fontänen gegen den Himmel und über das Land. Dem folgte ein nasser Schleier, der mit bloßem Auge zu sehen war, sobald er wie ein Wolkenbruch auf die Steine niederprasselte.
– Geht nicht zu nah ans Meer, sagte Mutter.
Ich dachte oft, jener mystische Nebel sei nichts anderes als aufsteigender Meeresdunst gewesen, weil er sich auf meine Erinnerungen legte und mich nicht weiter bedrohte. Doch im Lauf der Zeit bin ich dazu übergegangen, diesen Dunst als etwas jenem Nebel Ähnliches zu betrachten, in dem sich der Verstand eines Menschen so gern einmal verliert, weil er hofft, er käme unbeschadet wieder daraus hervor, den Kopf voll mit einem anderen und kreativeren Dunst, dem Meditation innewohnt und in dem umherschweifende Wörter für ein Werk bereitliegen.
Aus irgendwelchen Gründen nahm meine Mutter immer den steinigen Weg am Ufer entlang, obwohl es von Höfn aus auch einen zwar ebenfalls steinigen, aber halbwegs befahrbaren gegeben hätte. Doch den haben wir nie benutzt. Er führte streckenweise durch gespenstisches Gelände, nicht direkt ein Lavafeld, aber doch eine Anhäufung von Geröll, das zu unregelmäßigen Haufen aufgeworfen lag, so daß sich mit der Phantasie, die Kindern zum Ausmalen des Schrecklichen zu Gebote steht, leicht alle möglichen Gespenster darin erkennen ließen. »Die Könige« nannten wir das Gebiet. Einmal wollte ich mich ganz allein dort umsehen, weil ich wissen wollte, was die Könige so trieben, doch meine Mutter verbot uns, dort herumzustromern. Statt den bequemeren Weg zu nehmen, turnten wir also an den Felsnasen über dem Meer entlang, das manchmal nicht zu sehen war, wenn wir uns gerade in einer Mulde befanden; doch sein Tosen war hinter den felsigen Graten stets deutlich zu hören. Mein Bruder war mutiger als ich und wollte auf den Grat stürmen. Ich folgte ihm, nicht ganz so verwegen, um ebenfalls das Meer mit Steinwürfen zu reizen; aber das durften wir nicht.
– Ärgert die See nicht, laßt sie in Frieden! sagte Mutter streng.
– Warum? fragten wir, schon mit einem Stein in der Hand ausholend, um ihn einem Brecher an den Kopf zu werfen, der gerade gegen das Ufer heranschäumte.
– Man darf sie niemals ärgern, ebensowenig wie die Kühe. Denn es kann sein, daß sie dann beide nicht mehr geben.
Jemanden zu hänseln oder zu ärgern – manchmal die einzige Abwechslung, wenn es sonst gar nichts zu tun gab war in den Augen meiner Mutter das reinste Gift. Dabei sah es doch ganz so aus, als freue der Mensch den Menschen nur auf eine Weise, nämlich durch gegenseitige Provokation. Ein Mann fordert den anderen heraus und macht ihn fertig, wenn der es zuläßt und nicht selbst schneller ist. Frauen dagegen beglücken einander mit Eigenlob, ihren Krankheiten, vorgetäuschter Liebenswürdigkeit und übler Nachrede, die sie anstelle eigener Meinungen und Urteile weitergeben und auch in schwierigen Fragen und in der Politik bevorzugen. All diese Eigenschaften waren und sind vor allem der gut verhohlene Drang mancher Männer und Frauen, auf andere loszugehen. Frauen jedoch fühlen sich im Recht und meinen, aus diesem Gefühl heraus besonders Männer und Kinder zurechtweisen zu dürfen, andere Frauen aber mit der heiligen Wahrheit, die im boshaften Klatsch liegt.
Mama entschied sich wie in anderen Dingen gegen das Einfache oder das, was andere taten. Also durften wir das Meer nicht ärgern, ihm nichts Böses andichten, mußten so tun, als wären wir auf unserem täglichen Marsch über den schlechteren Weg in Gefahr geraten, dabei froh den Hang unterhalb des Hafenhauses hinabhüpfend. Dort lag eine tiefe Senke mit flachem Grund, aber steilen und schwer zu erklimmenden Rändern. Hatten wir sie hinter uns, stolperten wir, auf schon ein wenig müden Beinen, den nächsten Abhang hinab. Trotzdem war es bis dahin noch ganz lustig. Dann aber kam nur noch Plackerei. Es war unendlich mühevoll, in die nächste Senke hinab und wieder heraus zu klettern, dann kam der schmale Saumpfad mit Blick aufs Meer, in das wir nicht einmal Steinchen werfen durften.
Es mag ja noch Spaß machen, in so eine Senke hineinzulaufen, aber ihr größter Nachteil ist, daß man auch wieder heraus muß, schließlich will niemand sein Leben lang in einer Senke festsitzen, und die Löcher rund um Höfn waren gräßlich. Dazu kam, daß wir bei jedem Wetter in unförmig steifen schwarzen Regenmänteln gehen mußten, die stets ein paar Nummern zu groß gekauft wurden, damit wir nicht zu schnell aus dieser teuren, aber notwendigen Schutzkleidung herauswuchsen. Wenn sich im Frühling einmal die Sonne sehen ließ und auch ganz sicher kein Wachstuchmantelwetter im Anzug war, wurde Firnis auf den Stoff aufgetragen, damit er wasserdicht blieb. Dann wurden die Mäntel zum Trocknen auf die Leine gehängt. Da baumelten sie am Kragen in blassem Sonnenschein und Sturm und schaukelten hierhin und dorthin oder zappelten heftig wie der Leib eines Gehenkten am Strick. Wenn wir sie wieder überzogen, knarrten sie laut oder quietschten, wenn sich das ölgetränkte Gewebe so am Fleisch festsog, als sollten wir es nie wieder abbekommen und darin sterben, erstickt wie Herkules, der so dumm gewesen war, das Nessusgewand überzuziehen. Die Sagen, von denen man hörte, gewannen an Bedeutung, wenn sie einen Bezug zum eigenen Leben erhielten. Der Regenmantel aber duftete, und es fühlte sich toll an und gab einem ein künstlerisches Gefühl, den Geruch des frisch gewachsten Mantels tief einzuatmen.
Stets mußte man den Mantel anhaben oder ihn wenigstens über dem Arm tragen. Mutter sagte:
– Es kann immer mal einen Schauer geben.
Oder es konnte jederzeit Südwestwind aufkommen und ernsthaft zu regnen anfangen. Wir gehorchten und wußten, daß man allemal leichter im Regenmantel ging als in vollgesogenen und durchgeweichten dicken Wollsachen. Meine gesamte Kindheit verbrachte ich in einer wächsernen Hülle.
Noch immer sehe ich meinen ersten schwarzen Mantel plitschnaß von Niesei oder Regen vor mir. Nicht weil mich auf dem Weg mit dem Essen ein Schauer überraschte, sondern weil es in meiner Erinnerung pausenlos regnete, bis der Zweite Weltkrieg ausbrach und auch armen Leuten etwas Sonnenschein in Form von barem Geld brachte sowie die Kenntnis einer besseren, wenn auch kriegerischen Welt jenseits unseres ruhigen, endlos weiten Meeres. Mit der Ankunft der Soldaten stellten sogar die Kinder fest, daß es erwachsene Menschen in der Welt gab, die nicht nur das eine Vergnügen kannten, Kinder zu ärgern, zu zwicken, an den Ohren zu ziehen, ihnen eine Kopfnuß oder eine Abreibung zu verpassen oder ihnen mit der Schuhspitze in den Hintern zu treten und zu fragen:
– Gefällt dir das und meinst du, ich könnte es deiner Mutter auch mal schnell besorgen?
Das Seltsame, das einen manchmal ganz durcheinanderbrachte,