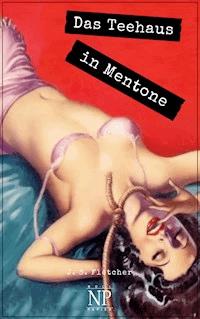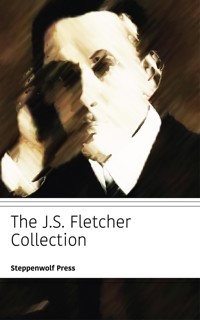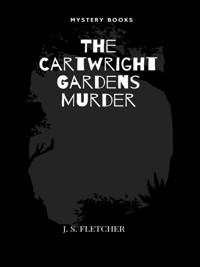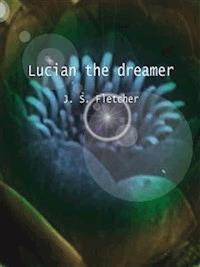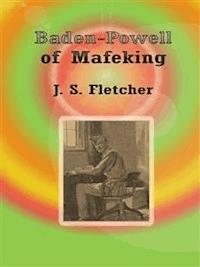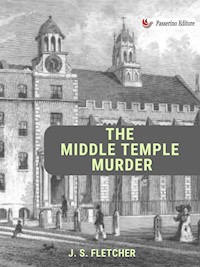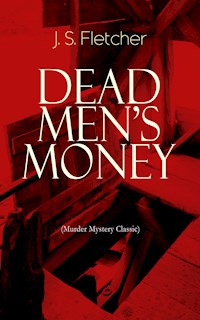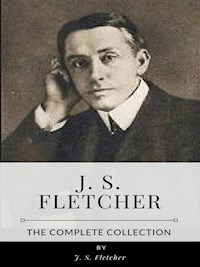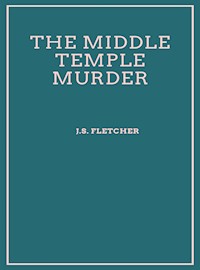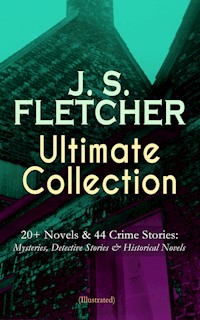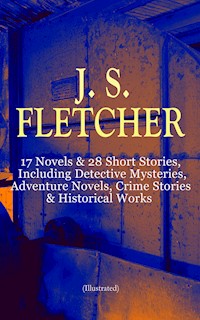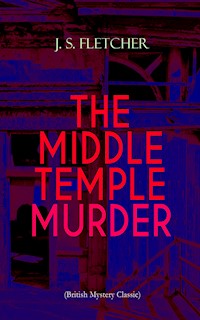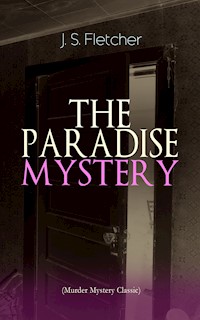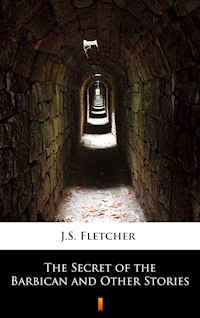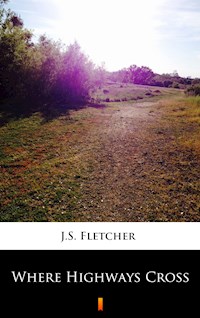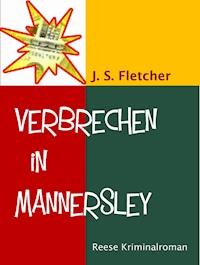
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem Bergbaudorf der Grafschaft Yorkshire wird der durch den Kohleabbau zu Reichtum gekommene verwitwete Sir Robert Mannersley ermordert. Sein Neffe Clinton, kurz zuvor aus einem Gefängnis ausgebrochen, wird festgenommen und des Mordes angeklagt. Bei der ersten Gerichtsverhandlung ist auch Inspektor Cortelyou, Detektiv von Scotland Yard, anwesend, der nach der Zeugenbefragung von der Unschuld des Neffen überzeugt ist und nun in Sherlock-Holmes-Manier ermittelt. Nach einigen überraschenden Ereignissen, Elementen der Spannung und Analyse, kommt es zum Drama im Stollen des Bergwerks. Verbrechen in Mannersley ist eine klassische Detektivgeschichte der 1930er Jahre. J. S. Fletcher, eigentlich Joseph Smith Fletcher (* 7. Februar 1863 in Halifax, West Yorkshire; † 30. Januar 1935) war ein englischer Journalist und Schriftsteller. Neben historischen und wirtschaftlichen Betrachtungen seiner näheren und weiteren Heimat veröffentlichte Fletcher auch über 100 Kriminalromane.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Über den Autor
Impressum
Hinweise und Rechtliches
E-Books im Reese Verlag:
J. S. Fletcher
Verbrechen in Mannersley
1
An einem Spätfrühlingsabend stand Margaret Britten an der offenen Tür ihres Hauses, das einsam am Rand eines Kiefernwaldes lag. Während das ungewisse Zwielicht allmählich in Dunkelheit überging, schaute sie in das Tal hinunter, wo allmählich ein Licht nach dem anderen aufblinkte. Aus jahrelanger Gewohnheit beschattete sie die Augen mit der Hand, obwohl die Sonne längst untergegangen war. Sie versuchte das Halbdunkel mit ihren Blicken zu durchdringen und lauschte auf die Schritte, die den steinigen Weg heraufkommen mußten.
In großen Umrissen konnte sie die Landschaft noch erkennen. Auf der anderen Seite des Tals erhob sich das alte Schloß, und dicht daneben stand die verwitterte Kirche mit dem viereckigen Turm und den grauen Mauern. Auch das alte, malerische Gasthaus mit dem Strohdach und dem schönen Fachwerkgiebel lag dort drüben neben Bauernhöfen, deren Alter nach Generationen und nicht nach Jahren zählte. Aber ganz in der Nähe sah sie die kleine neue Stadt mit ihren roten Backsteinhäusern, die an mathematisch genau abgezirkelten Straßen lagen. In ihrer Jugend hatte keins dieser Häuser gestanden, und auch später, als sie Frau und Mutter wurde, wußte man noch nichts davon. Sie fühlte eine starke Abneigung gegen diese neue Zeit, der man ihre geliebten Wiesen und Wälder geopfert hatte, in denen sie als Kind Blumen pflücken und Pilze und Nüsse suchen konnte. Zwischen diesem neuen Stadtteil und dem Fluß erhoben sich die Tagbauten der Kohlenmine, große, gespenstische Eisengerüste, Schuppen, Maschinenhäuser, Pumpstationen und weite Halden von Schlacke und Kohlen. Niemand hatte etwas von dem Vorkommen der Kohle hier gewußt, bis eines Tages ein Gelehrter, der oft im Schloß zu Besuch war, Sir Robert Mannersley darauf aufmerksam machte, daß sein alter Besitz auf einem reichen Kohlenlager stand.
Margaret Britten wandte den Blick und schaute wieder den Weg hinunter. Wie alle Menschen, die auf diesem Flecken Erde geboren und auf gewachsen waren, hatte sie ein starkes Heimatgefühl und ertrug diese Veränderungen nur schwer. Sie war hier in diesem Hause geboren, hatte hier nach dem Tod ihrer Eltern mit ihrem Manne gelebt und ihre eigenen Kinder aufgezogen. Früher hatten die Leute in dieser Gegend ihren Lebensunterhalt als Bauern, Holzfäller oder Wildhüter verdient, aber der einzige, der von ihrer Familie noch lebte, ihr Sohn Jim, war kein Landmann geworden, der mit dem Pflug die Äcker hinter ihrem Hause bearbeitete, sondern war auf der Zeche als Kontrolleur der Förderwagen beschäftigt und verdiente dort nicht wenig Geld.
Als sie seine Schritte hörte und sein wohlbekannter Pfiff ertönte, eilte sie in die Küche und schaute in den Bratofen. Ein lockender Duft durchzog den ganzen Flur.
„Das riecht gut, Mutter“, sagte Jim, als er kurz darauf eintrat und sie auf beide Wangen küßte. „Was gibt’s denn heute abend?“
„Gebratene Leber mit Speck und Zwiebeln, und eine schöne, dicke Sauce habe ich dazu. Zieh dich rasch um, damit das Essen nicht kalt wird.“
„Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen!“ rief er über die Schulter zurück.
Er wusch sich in dem hinteren Zimmer und kam bald darauf mit geröteten Wangen und frischgebürstetem Haar zurück.
„Ich habe einen Mordshunger, Mutter“, meinte er, als er einen Stuhl an den Tisch schob und vergnügt auf die dampfende Schüssel sah, die sie vor ihn auf den Tisch setzte.
„Also, dann fang nur an.“
Sie setzte sich in ihren Sessel an den Ofen und beobachtete, wie es ihrem Sohn schmeckte. Sie hatte ihre Freude an diesem schmucken, hübschen Jungen von fünfundzwanzig Jahren. Er war so gerade gewachsen wie eine Weidengerte, hatte klare, graublaue Augen, einen offenen, festen Blick und braunes Haar, das sich noch ebenso widerspenstig lockte wie in seiner Kindheit. Obwohl er so stattlich wie kaum ein anderer in der Gegend aussah, hatte er ein bescheidenes und ruhiges Wesen; das war um so mehr zu bewundern, als seine Mutter alles getan hatte, um ihn zu verziehen.
„Gibt’s was Neues, Jim?“ fragte sie als er fertig war.
„Ich habe gehört, daß Sir Robert ein großes Kasino für die Beamten und Bergleute gründen will. Genaueres weiß man allerdings noch nicht, aber es wird schon stimmen.“
„Das ist auch wieder so eine neumodische Idee! Die Leute wissen wirklich nicht, was sie wollen. Warum können sie denn nicht zu Hause essen wie du?“
Jim sah lachend zu ihr hinüber.
„Die meisten von ihnen haben doch nicht ein so gemütliches Heim wie wir, Mutter. Glaube mir, eine solche Einrichtung wäre sehr gut und nützlich.“
„Sicher hat das wieder Miss Phillipa ausgeheckt. Sie hat immer große Pläne, um den Leuten zu helfen. In meiner Jugend hat niemand etwas für die Landarbeiter getan.“
„Die Zeiten haben sich aber auch geändert, Mutter.“
„Ja, das stimmt. Es ist alles anders geworden“, seufzte sie, stand auf und goß ihm noch eine Tasse Tee ein. „Ich habe heute den neuen Direktor gesehen, als ich unten die arme Sarah Dickinson besuchte. Er kam gerade zu Pferde vorbei, als ich am Gartentor stand und mit Jane Dickinson sprach. Ich wundere mich nicht, daß die Leute ihn nicht mögen, Jim. Er ist zwar ein ganz hübscher Bursche, aber solche Augen habe ich noch nie gesehen. Ich hab mich ordentlich vor ihm gefürchtet, so scharf hat er mich betrachtet.“
„Ich weiß wirklich nicht, warum Mr. Bentley nicht beliebt ist“, erwiderte Jim nachdenklich. „Du kannst aber auch nicht sagen, daß er hier neu ist. Er hat den Posten doch nun schon zwei Jahre, und er hat sich auch bewährt. Vielleicht ist er etwas zu streng, aber als Leiter eines so großen Unternehmens muß er auch energisch sein können.“
„Nun, ich möchte nichts mit ihm zu tun haben. Nimm dich nur vor ihm in acht, mein Junge.“
„Du brauchst keine Sorge zu haben, Mutter. Leuten, die ihre Pflicht tun, sagt Mr. Bentley nichts Unangenehmes.“
Er stand auf, räumte das Geschirr zusammen und trug es in die Küche, wo es seine Mutter gleich darauf abwusch. Dann steckte er seine Pfeife an, und nachdem er sich ein wenig ausgeruht hatte, holte er verschiedene Bücher aus einer Schublade, legte sie auf den Tisch und begann zu arbeiten. Jim Britten war ehrgeizig und wollte es in der Welt noch weit bringen.
Aber kaum hatte er ein Buch geöffnet, als sich die
Haustür auftat und eine klare, angenehme Mädchenstimme erklang.
„Mrs. Britten, sind Sie zu Hause? Darf ich hereinkommen?“
Margaret kam geschäftig und freudestrahlend auf Phillipa Mannersley zu.
„So spät kommen Sie noch!“ rief sie. „Aber Sie haben ja schon als Kind immer besondere Einfälle gehabt.“
„Ich wollte noch einen langen Spaziergang vor dem Abendessen machen, Mrs. Britten“, entgegnete Phillipa lachend. „Ich habe Ann Mary in den Wald mitgenommen, und da wir so dicht bei Ihnen waren, wollte ich nur einmal nachsehen, wie es Ihnen geht. Ann Mary ist draußen, Jim“, sagte sie und schaute ihn schelmisch an. „Vielleicht guckt sie gerade durchs Fenster. Wollen Sie nicht zu ihr gehen?“
„Ach, Miss Phillipa“, meinte Margaret, als Jim hinausgeeilt war, „daß Sie die jungen Leute auch noch so unterstützen!“
„Warum denn nicht? Es kann einen doch nur freuen, wenn sich zwei so gerne haben wie Jim und Ann Mary. Wir wollen sie ein wenig miteinander reden lassen. Geben Sie mir bitte inzwischen ein Glas von ihrem selbstgemachten Apfelmost, der hat mir so gut geschmeckt, als ich das letztemal hier war.“
„Sofort! Ich bringe auch ein Stück Mohnkuchen, den ich selbst gebacken habe. Der, wird den Appetit für das Abendbrot nicht verderben.“
Als Phillipa allein war, änderte sich plötzlich ihr Gesichtsausdruck. Kummer lag in dem Blick ihrer dunkelblauen Augen, und ein herber Zug legte sich um ihren sonst so fröhlichen Mund. Sie krampfte die Finger ineinander und sah auf eine große Fotografie, die in einem schönen Rahmen über dem Kamin hing. Es war das Bild eines jungen Mannes, der ihr merkwürdig ähnlich sah. Unverwandt hingen ihre Blicke an seinem Gesicht, bis Mrs. Britten wieder ins Zimmer kam. Als die alte Frau ein Tablett auf den Tisch stellte, war Phillipa wieder die alte, lachte und unterhielt sich eifrig, als ob es überhaupt keine Sorgen für sie auf der Welt gäbe.
Draußen hatte Jim Britten inzwischen seine Verlobte Ann Mary Riley getroffen. Das junge hübsche Mädchen war Phillipas Zofe und Vertraute. Schnell zog sie ihn mit sich den Weg hinunter und blieb erst im Schatten einer großen Hecke stehen.
„Jim, warst du nicht überrascht, daß Miss Phillipa heute abend kam?“ sagte sie leise und geheimnisvoll.
„Ja“, gab er zu.
„Sie möchte dich sprechen. Sie ist in großer Sorge, und ich soll dir sagen, daß du uns ein Stück begleiten sollst, wenn sie nachher herauskommt. Sie hat auf dem Herweg geweint, und das tut sie doch sonst nie. Nur damals als -“
„Dann wollen wir aber gleich wieder zurückgehen“, unterbrach sie Jim, „und draußen am Gartentor warten.“
Zehn Minuten später verabschiedete sich Phillipa von Mrs. Britten, und die alte Frau kam heraus und rief die beiden.
„Ann Mary soll auch ein Glas Apfelmost trinken“, sagte sie. „Jim wird Miss Phillipa nach unten begleiten, und Ann Mary kann dann schnell hinterherlaufen.“
Phillipa ging mit ihrem Begleiter schweigend eine Weile den Weg entlang, dann hielt sie plötzlich an. Ein verstörter Ausdruck lag auf ihrem Gesicht, als sie die Hand auf seinen Arm legte.
„Jim, hat Ihnen Ann Mary gesagt, daß ich Sie sprechen möchte?“
„Ja, Miss.“
Sie schwieg noch einen Augenblick und sah sich um. „Jim, mein Vetter ist geflohen!“
Er starrte sie an, als ob sie ihm gesagt hätte, daß das Kohlenbergwerk in die Luft geflogen sei, und trat einen Schritt zurück.
„Was - Mr. Clinton ist - ausgebrochen?“
„Ja, und ich fürchte, daß er sich in seiner Verzweiflung hierher nach Mannersley wendet, um meinen Vater und mich zu sehen. Ich habe heute morgen einen Brief von einer Freundin aus London bekommen, dem ein Schreiben meines Vetters beigelegt war. Er schrieb mir, daß es ihm gelungen sei, zu entfliehen, und daß er alles daransetzen würde, seine Unschuld zu beweisen. Aus jedem Wort sprach die alte Abneigung gegen meinen Vater. Er beschwor immer wieder seine Unschuld, wie er es stets getan hat. Sie wissen es ja, Jim.“
„Ja, Miss Phillipa, ich weiß es“, sagte er traurig.
„Er schrieb auch wieder, daß man ihn absichtlich ins Unglück gestoßen habe, und all diese alten Geschichten. Ich bin sicher, daß er nach Mannersley kommen will, und zuerst wird er zu Ihnen gehen, Jim, weil Sie sein Freund sind.“
„Das glaube ich auch. Ich dachte gleich daran, als Sie mir sagten, daß er aus dem Gefängnis geflohen ist. Sorgen Sie sich nur nicht, ich benachrichtige Sie sofort, wenn er da ist.“
„Ich danke Ihnen“, sagte sie und gab ihm die Hand.
„Hier kommt Ann Mary, und wir müssen jetzt nach Hause gehen. Leben Sie wohl.“
Jim drückte Phillipas Hand, küßte seine Braut und ging dann zurück. Seine Mutter saß müde im Sessel und unterdrückte ein Gähnen.
„Jim, ich lege mich schlafen. Du bleibst ja doch noch bei deinen Büchern auf.“
„Ja, heute abend wird es wohl spät werden. Ich habe mir viel vorgenommen und bin noch sehr frisch. Gute Nacht, Mutter.“
Aber seine Gedanken wanderten immer wieder von der Arbeit fort, während Stunde um Stunde verging. Ein gespannter, erwartungsvoller Ausdruck lag auf Jims Gesicht, als er am Tisch saß und grübelte. Um Mitternacht hörte er ein Klopfen am Fenster; es war das alte Zeichen, das er von früher her kannte. Er erhob sich langsam, ging zur Tür und öffnete.
2
Aus dem Schatten des großen Holunderbusches neben dem Eingang trat ein Mann und ging rasch hinein. Jim schloß schweigend die Haustür zu.
„Du hast mein altes Zeichen noch verstanden, Jim!“
Das Licht fiel auf die Gestalt eines jungen Mannes von ungefähr vierundzwanzig Jahren. Er hatte hübsche Züge, war schlank, hochgewachsen und geschmeidig. Aber in sein hageres Gesicht hatten sich schwere Sorgenfalten eingegraben.
Jim schob sofort einen Stuhl an den Kamin und brachte warme Milch.
„Setz dich und trink erst. Du brauchst sicher eine Stärkung.“
„Ja, das tut gut. Ich bin auf Nebenwegen durch den Wald gekommen. Vielen Dank. Du hattest mich wohl nicht erwartet?“
„Doch, ich war schon vorbereitet.“ Jim drückte Clinton Mannersley in den Sessel. „Ich wußte bestimmt, daß du kommen würdest.“
„Von wem hast du es denn erfahren? Du hast es doch nicht etwa in der Zeitung gelesen?“
„Deine Kusine war heute abend hier.“
Clinton trank das Glas leer und sah dann ins Feuer. Jim beobachtete ihn verstohlen von der Seite.
Clinton war noch genau so tadellos gekleidet wie früher, aber sein kurzes, dunkles Haar zeigte graue Stellen, und ein müder, zermürbter und bitterer Zug lag auf dem jugendlichen Gesicht. Die traurigen Erlebnisse und Erfahrungen der letzten Jahre hatten sich seinem Wesen unverkennbar aufgeprägt.
„Wohin hätte ich mich auch wenden sollen als zu dir, Jim“, sagte Clinton schließlich. „In den letzten zwei Jahren habe ich dauernd an Mannersley gedacht, und ich mußte hierherkommen. Selbst wenn ich nur einige Stunden bleiben kann, muß ich zwei Menschen sprechen - nachher geht es weiter!“
„Aber Clinton -“
„Ich bin flüchtig - ein entsprungener Sträfling!“
„Ja, das ist leider eine Tatsache“, gab Jim offen zu. „Sie werden auch schon hinter dir her sein.“
„Und gerade deshalb bin ich hier einige Zeit sicher. Sie werden niemals glauben, daß ich nach Mannersley gegangen bin. Vor vierzehn Tagen bin ich entkommen. Ich fürchte mich nicht vor ihnen!“
„Wie hast du das denn eigentlich fertiggebracht?“ fragte Jim verwundert.
Clinton lächelte.
„Ach, das war ganz leicht, abgesehen von den ersten Augenblicken der Flucht. Als Warrinder herausbekommen hatte, daß sie mich nach Dartmoor geschickt hatten, mietete er dort ein kleines Jagdhaus dicht bei der Anstalt, und dann gelang es ihm, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Er hat dort lange auf mich gewartet, Tag und Nacht, und schließlich fand sich eine günstige Gelegenheit. Ich habe allerdings Spießruten laufen müssen, und sie haben auf mich geschossen, Jim. Sieh her.“
Er streifte seinen linken Ärmel hoch und zeigte eine erst kürzlich verheilte Wunde, die über den Vorderarm lief.
„Es ist nur ein Streifschuß, aber es hätte auch anders ausgehen können. Ich bin also glücklich zu Warrinders Jagdhaus gekommen. Der Rest war leicht. Er hat mich auch in seinem Auto hierher gebracht und wartet in Ashford. Morgen abend trifft er mich in Dead Man’s Cross etwa um Mitternacht. Dann will er mich nach Liverpool bringen, dort steht schon eine ganze Ausrüstung bereit. Von da fahre ich nach Kanada.“
Jim hatte in die Flammen gestarrt und sah nun auf.
„Und was willst du hier?“
Clintons Züge verhärteten sich.
„Ich will und muß die beiden sehen“, erwiderte er entschlossen. „Du weißt, wen ich meine: meinen Onkel und meine Kusine. Aber vor allem meinen Onkel Robert.“
„Und warum?“
„Weil er mehr als jeder andere etwas für mich tun kann. Er muß den Verdacht von mir nehmen. Er muß es tun - und er soll es tun!“
Jim legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Wenn nun aber Sir Robert fest von deiner Schuld überzeugt ist?“
Clinton preßte die Lippen aufeinander.
„Dann ist es um so wichtiger, daß ich ihn sehe und ihm meine Unschuld klarmache. Er hat mir niemals Gelegenheit dazu gegeben. Du weißt, wie hart und stolz er ist, und wie er sich zurückzog und kein Wort von mir hören wollte. Ich hatte mir natürlich vorher einen schlechten Namen gemacht, und er hatte viele Sorgen mit mir, als ich in Eton war. Man hat mich in Cambridge von der Universität geschickt, und er mußte zweimal meine Schulden bezahlen. Dann geriet ich in New Market in schlechte Gesellschaft -“
„Gehörte denn dieser Mr. Warrinder nicht auch dazu?“
„Das ist ganz gleich, er hat jedenfalls durch dick und dünn zu mir gehalten. Ich weiß, daß ich früher viel verschuldet habe, und ich hatte ja auch Zeit genug, darüber nachzudenken. Das kann ich dir nur sagen. Aber es ist doch noch ein gewaltiger Unterschied, ob man ausgelassen ist und Spielschulden macht, oder ob man ein gewöhnlicher Dieb ist. Ich bin ebenso unschuldig an der Sache wie deine Mutter. Darauf gebe ich dir mein Wort.“
„Das habe ich immer geglaubt. Und ich weiß auch, daß viele andere Leute so denken.“
„Wer ist bloß dieser gemeine Kerl, für den ich gesessen habe?“ rief Clinton erregt. „Nur weil ich als Junge ein Tunichtgut war, hat mein Onkel gleich alles geglaubt, als man mich anklagte.“
„Sir Robert ist ganz gebrochen. Er ist seitdem niemals mehr der alte gewesen.“
„Auch mein Leben ist verbittert“, erwiderte Clinton empört. „Jim, ich muß meinen Onkel sprechen und ihm beibringen, daß es seine Pflicht ist, sich der Sache anzunehmen. Der einfachste Mensch sieht doch ein, daß er das tun muß!“
„Ich verstehe aber nicht ganz, was du meinst.“
Clinton beugte sich vor.
„Mein Onkel ist doch ein alter Mann und wird sich wahrscheinlich nicht wieder verheiraten.“
„Das wird er sicher nicht mehr tun. An Miss Phillipa hängt doch sein ganzes Herz!“
„Er hat keine Söhne, und es lebt keiner seiner Brüder mehr. Deshalb werde ich als sein Neffe bei seinem Tode den Titel erben; Um der Ehre unseres Familiennamens und des Titels willen, den wir seit dem dreizehnten Jahrhundert tragen, muß er alles daransetzen, daß der Prozeß wieder aufgenommen wird. Der wirklich Schuldige muß gefunden werden! Ich will Sir Robert sehen und ihn zwingen, etwas für mich zu tun. Meine Unschuld werde ich ihm beweisen. Es ist selbst nach diesen zwei Jahren, die ich in Elend und Schande zubringen mußte, seine Pflicht, sich der Sache anzunehmen, damit ich wieder rehabilitiert werde. Wenn es möglich gemacht werden kann, möchte ich ihn heimlich sehen: wenn nicht, werde ich mir meinen Weg zu ihm bahnen. Ich muß dann natürlich alle Folgen tragen.“
Jim Britten schwieg einige Zeit und sah dann Clinton ernst an.
„Es würde sehr schlimm werden, wenn etwas davon in die Öffentlichkeit dränge, daß du einen Wortwechsel mit Sir Robert hattest.“
„Warum?“
„Weil alle Bergleute von deiner Unschuld überzeugt sind und glauben, daß man damals ein falsches Spiel mit dir getrieben hat. Es könnte unter den Arbeitern leicht zu Unruhen kommen.“
Clinton starrte ihn fast ungläubig an.
„Du weißt doch, wie gern dich die Leute hier gehabt haben“, fuhr Jim fort. „Du sprachst mit ihnen und gabst ihnen Tips für die Rennen. Und außerdem -“ Er machte eine Pause.
„Nun - was meinst du, Jim?“
„Denke doch an Miss Phillipa! Sie hat wirklich genug durchgemacht.“
Clinton erhob sich erregt.
„Ja, sie hat genug durchgemacht. Aber geht es nicht uns beiden so? Jim, ich muß Phillipa sehen und mit ihr sprechen. Wenn sich mein Onkel weigern sollte, mir zu helfen, dann soll sie mir nach Kanada folgen. Wir wollen dort in einem neuen Land ein neues Leben beginnen. Wir sind miteinander verlobt, und sie gehört zu mir!“
Jim war aufgestanden. Er sah Clinton traurig an. „Nein, das ist nicht recht. Du mußt zuerst dafür sorgen, daß du dich rehabilitierst. Du hättest nicht aus dem Gefängnis fliehen sollen. Die wenigen Monate wären auch noch vorübergegangen, und dann wärst du ein freier Mann gewesen. Nun bist du gehetzt und kannst dich nirgends sehen lassen. Aber ich werde Miss Phillipa benachrichtigen, daß du* sie morgen abend treffen willst. Dann wirst du ja hören, ob es möglich ist, Sir Robert zu sprechen. Wenn ich dir aber einen Rat geben darf, so stellst du dich wieder freiwillig, wenn du hier alles erledigt hast.“
In diesem Augenblick hörten sie Schritte über sich.
„Das ist meine Mutter“, beruhigte Jim den Freund. „Ich muß ihr sagen, daß du hier bist. Du hast doch nichts dagegen?“
„Wenn du so wenig freundliche Gesichter um dich gehabt hättest, wie ich in den beiden letzten Jahren, dann würdest du verstehen, wie sehr ich mich darauf freue, sie zu sehen.“
Gleich darauf trat Mrs. Britten ins Zimmer. Sie hatte die Stimmen oben gehört und sich rasch angekleidet. Überrascht sah sie auf Clinton, begrüßte ihn dann aber herzlich und aufs freudigste. Seine Mutter war früh gestorben, und Margaret hatte ihn in seinen ersten Lebensjahren betreut.
Die drei hatten in ihrer Wiedersehensfreude nicht bemerkt, daß ein Mann, der Clinton durch den Wald gefolgt war, durch das Fenster schaute und sich nun heimlich nach dem Städtchen davonschlich.
3
Sir Robert Mannersley war der siebzehnte seines Namens und stolz auf seine Vorfahren. Vor der Entdeckung der Kohlenlager auf seinem Grund und Boden war er verhältnismäßig arm gewesen, und der Abbau des Bergwerks kam ihm im Interesse seiner Familie sehr zustatten. Es war erst vor einigen Jahren damit begonnen worden, und der Ertrag ließ sich noch steigern. Sir Robert selbst achtete jedoch darauf, daß das einfache und ehrbare Leben im Schloß fortgesetzt wurde. Das Gebäude war vor Hunderten von Jahren aus den Trümmern einer alten Königspfalz errichtet worden. Trotz seines neuen Reichtums hatte Sir Robert diesen alten Wohnsitz beibehalten. Aus einem schlichten Landwirt hatte er sich in einen Geschäftsmann verwandelt, der allen Anforderungen der Neuzeit Rechnung trug. Jeden Morgen war er pünktlich mit dem Glockenschlag in seinem Büro, aber er fühlte sich doch nur zufrieden und glücklich, wenn er unter seinem eigenen Dache am eigenen Kamin saß und dort seinen Freunden seine Schätze zeigen konnte.
Am Abend nach der Ankunft Clintons saß er am Kamin und zeigte Phillipa und Mr. Bentley eine alte römische Lampe. Neben seinem Sessel stand eine große Schirmlampe, deren Licht voll auf seine feinen Züge, sein schneeweißes Haar und seinen Schnurrbart fiel. Seine langen, wohlgeformten Finger fuhren wie liebkosend über das alte Stück, als er die Besonderheiten daran seiner Tochter und seinem Gast erklärt. Phillipa, die in ihrem Abendkleid wundervoll aussah, neigte sich über den Stuhl ihres Vaters, und Mr. Mark Bentley stand vor ihm. Er schien sich aber mehr für Sir Roberts schöne Tochter als für die römische Antiquität zu interessieren.
Der große, stattliche Mann mochte etwa dreißig Jahre zählen. Gang und Haltung waren fast militärisch, und die festen, ruhigen Gesichtszüge und das starkentwickelte Kinn zeugten von Energie und Willenskraft. Mark Bentley setzte seinen Willen durch, war gewohnt zu befehlen und ging stets seine eigenen Wege. Allein der durchdringende Blick seiner stahlgrauen Augen genügte, um seinen Befehlen Geltung zu verschaffen. Es war bekannt, daß ihm die Leute ohne Murren gehorchten. Aber die Strenge schwand aus seinem Gesicht, und der Blick seiner Augen wurde weich, wenn Phillipa Mannersley in der Nähe war.
„Außer einem Exemplar im Britischen Museum ist dies die einzige Lampe dieser Art“, erklärte Sir Robert. „Vor einigen Jahren wurde eine ähnliche ausgegraben, aber sie war nicht annähernd so alt oder so gut erhalten wie diese.“
„Ja, es ist wirklich ein herrliches Stück“, erwiderte Phillipa. „Aber jetzt muß ich die beiden Herren bitten, sich allein zu unterhalten, denn ich muß noch ausgehen.“
„Um diese Zeit?“ entgegnete Sir Robert erstaunt. „Was hast du denn vor?“
„Es ist nur für kurze Zeit, Vater. Ich muß noch eine kranke, alte Frau besuchen.“
„Hoffentlich gehst du nicht in die Arbeitersiedlung hinüber?“
„Darf ich Sie vielleicht begleiten, Miss Mannersley?“ fragte Bentley. „Es ist schon spät -“
„Vielen Dank für Ihre Liebenswürdigkeit“, unterbrach sie ihn. „Aber meine Zofe Ann Mary begleitet mich ja immer, wie Sie wissen. Ich bin bald wieder da und sehe Sie dann noch.“
Mit einem leichten Kopfnicken verabschiedete sie sich von den beiden und verließ das Zimmer.
Sir Robert erhob sich.
„Da wir gerade über römische Kunst sprechen, muß ich Ihnen noch meine Sammlung von römischen Münzen zeigen. Sie sind wunderbar erhalten. Nehmen Sie einen Augenblick Platz, ich werde sie aus dem anderen Zimmer holen. Bitte nehmen Sie doch noch eine Zigarre.“
Als der alte Herr das Zimmer verlassen hatte, trat Mr. Bentley an einen Seitentisch, um sich dort eine Zigarre zu holen. Neben dem Kasten lag eine kleine, zerknitterte Karte, und ohne daß er es wollte, las er, was darauf stand: „Heute abend um halb zehn in der Eremiten-Kapelle. “
Er nahm eine Zigarre und ging nach dem Kamin zurück. Während er noch überlegte, was diese merkwürdigen Worte wohl bedeuten mochten, trat Phillipa im Straßenkostüm wieder ein. Sie sah etwas nervös aus.
„Sie sind ja allein, Mr. Bentley!“
„Ihr Vater will mir noch einige alte Münzen zeigen.“
„Ach so. Ich will - ich habe hier etwas liegen lassen. Ich bin so vergeßlich - ach, hier ist es - eine Adresse.“
Sie nahm die kleine Karte auf, die er eben gelesen hatte, nickte ihm noch einmal zu und war wieder verschwunden, ehe er etwas sagen konnte.
Fünf Minuten später kam Sir Robert mit den Münzen zurück. Bentley stand noch am Kamin. Sein Gesicht war ernst, und er richtete sich auf.
„Sehen Sie sich einmal meine Schätze an“, begann der alte Herr.
Bentley räusperte sich.
„Sir Robert!“
Der Baronet sah ihn verwundert an, setzte den Kasten mit den Münzen auf den Schreibtisch und ließ sich in seinem Sessel nieder.
„Nun, wollen Sie mir etwas sagen?“ fragte er freundlich.
„Ja. Ich glaube, ich muß von hier fortgehen. Es liegt mir nicht, lange um eine Sache herumzureden, besonders nicht bei Ihnen, Sir Robert. Ich liebe Ihre Tochter.“
„Das habe ich mir schon gedacht, Bentley. Und ich sehe nichts Böses darin. Ihre Familie ist von demselben Rang wie die meine, und ich schätze Sie sehr.“
„Sie würden also Ihre Einwilligung zu einer Heirat geben?“ rief Bentley erregt.
„Ja, gewiß“, entgegnete Sir Robert lächelnd. „Aber ich fürchte, Sie machen sich vergeblich Hoffnungen. Setzen Sie sich doch. Sie kennen wohl die furchtbare Geschichte in unserer Familie“, fuhr er fort, als sich Bentley niedergelassen hatte. „Sicher haben Sie gehört, was mit meinem Neffen passierte, kurz bevor Sie herkamen?“
Bentley neigte nur den Kopf.
„Phillipa und Clinton hatten sich schon als Kinder gern, und sie liebt diesen Menschen heute noch trotz alledem. Bentley, ich zittere vor dem Augenblick seiner Freilassung!“
Bentley sah ihn ernst an.
„Sir Robert, glauben Sie denn wirklich, daß Ihr Neffe schuldig war?“