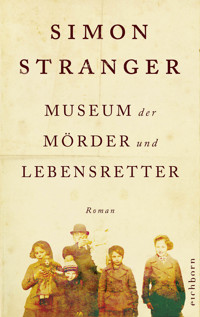9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Eine wahre Familiengeschichte, die zeigt, wie nah Dunkelheit und Hoffnung beieinanderliegen können
In der jüdischen Tradition heißt es, dass ein Mensch zwei Mal stirbt. Das erste Mal, wenn das Herz aufhört zu schlagen und die Synapsen im Gehirn erlöschen wie das Licht in einer Stadt, in der der Strom ausfällt. Das zweite Mal, wenn der Name des Toten zum letzten Mal gesagt, gelesen oder gedacht wird, fünfzig oder hundert oder vierhundert Jahre später. Erst dann ist der Betroffene wirklich verschwunden, aus dem irdischen Leben gestrichen.
Ein auf wahren Begebenheiten basierender Roman, der achtzig Jahre Geschichte und vier Generationen umfasst. Eine Erzählung über den Holocaust, über Familiengeheimnisse und über die Geschichten, die wir an unsere Kinder weitergeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Über den Autor
Simon Stranger wurde 1976 geboren und lebt mit seiner Familie in Oslo.
SIMONSTRANGER
VERGESSTUNSERE NAMENNICHT
ROMAN
Aus dem Norwegischen von Thorsten Alms
EICHBORN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der norwegischen Originalausgabe:
»Leksikon om lys og mørke«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Simon Stranger
First published by H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS
Published in agreement with Oslo Literary Agency
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Barbara Häusler, München
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Einband- / Umschlagmotiv: © Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy Stock Photo; © Łukasz Szwaj / shutterstock
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7843-6
www.eichborn.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
A
A wie Anklage.
A wie Aussage.
A wie Arrest.
A wie alles, was verschwinden und in Vergessenheit fallen wird. Alle Erinnerungen und Gefühle. Alle Habseligkeiten und Besitztümer. Alles, was den Rahmen eines Lebens gebildet hat. Die Stühle, auf denen man saß, und das Bett, in dem man schlief, werden hinausgetragen und in andere Wohnungen gebracht. Teller, mit denen andere Hände einen Tisch decken, und Gläser werden an die Lippen anderer Menschen geführt, die das Wasser oder den Wein trinken, bevor sie sich jemand anderem zuwenden und das Gespräch fortsetzen. Dinge, an denen viele Geschichten hängen, werden irgendwann ihre Bedeutung verlieren und in reine Form verwandelt werden, wie ein Konzertflügel, der von einem Hirsch oder einem Käfer betrachtet wird.
Eines Tages wird es geschehen, eines Tages wird für uns alle der letzte Tag kommen, ohne dass wir wissen, welcher es ist oder auf welche Weise das Leben enden wird. Ich weiß nicht, ob ich die letzten Stunden meines Lebens in einem Pflegeheim zubringen werde, mit röchelndem Husten und mit einer Haut, die mir weiß und schlaff wie Brotteig von den Oberarmen hängt, oder ob ich plötzlich und unerwartet sterben werde, mit fünfundvierzig oder sechsundvierzig, durch eine Krankheit oder bei einem Unfall.
Vielleicht werde ich von einem Eiszapfen getötet, der von der Dachkante eines Häuserblocks fällt, gelockert von den Vibrationen eines Handwerkers, der im darunterliegenden Stockwerk einen Badezimmerboden aufbohrt, oder von einer warmen Meeresbrise, sodass der Eiszapfen an den Fenstern vorbeischießt. An Wohn- und Schlafzimmern vorbei, bis er meinen Kopf trifft, der sich über die Nachrichten in meinem Handy beugt, und das Telefon gleitet mir aus den Händen und bleibt leuchtend auf dem Bürgersteig liegen, während entsetzte Passanten sich in einem Halbkreis um mich scharen. Zufällige Zeugen, die unvermittelt an den Abgrund erinnert werden, der sich stets neben jedem Einzelnen von uns befindet, aber nur selten zum Vorschein kommt: Alles, was wir sind und was wir haben, kann weggerissen werden, direkt aus dem alltäglichen Leben.
In der jüdischen Tradition heißt es, dass ein Mensch zweimal stirbt. Das erste Mal, wenn das Herz aufhört zu schlagen und die Synapsen im Gehirn erlöschen wie in einer Stadt, in der der Strom ausfällt.
Das zweite Mal, wenn der Name des Toten zum letzten Mal gesagt, gelesen oder gedacht wird, fünfzig oder hundert oder vierhundert Jahre später. Erst dann ist der Betroffene wirklich verschwunden, aus dem irdischen Leben gestrichen. Dieser zweite Tod war der Ausgangspunkt für den deutschen Künstler Gunter Demnig, als er die Idee entwickelte, Pflastersteine aus Messing herzustellen und darauf die Namen von Juden einzugravieren, die während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis ermordet wurden, und sie vor den Häusern, in denen diese Familien gewohnt hatten, in den Bürgersteig einzulassen. Er nennt sie »Stolpersteine«. Diese Kunstwerke sind der Versuch, diesen zweiten Tod hinauszuschieben, denn indem er die Namen der Opfer in den Weg ritzt, sorgt der Künstler dafür, dass sich in den folgenden Jahrzehnten Passanten über die Steine beugen und damit die Toten am Leben erhalten, wodurch gleichzeitig die Erinnerung an eines der schlimmsten Kapitel der europäischen Geschichte lebendig gehalten wird, als sichtbare Narben im Gesicht der Städte. Bis jetzt sind 67000 Stolpersteine in zahlreichen Städten Europas eingelassen worden.
Einer von ihnen ist deiner.
Einer der Steine trägt deinen Namen und ist dort in den Bürgersteig versenkt worden, wo du gewohnt hast, in der mittelnorwegischen Stadt Trondheim. Vor ein paar Jahren ging mein Sohn vor diesem Stolperstein in die Hocke und wischte die Kiesbrocken und den Dreck mit seinem Handschuh von dem Metall. Dann las er laut.
»Hier wohnte Hirsch Komissar.«
Mein Sohn war in jenem Jahr zehn geworden, und er ist einer deiner Ururenkel. Wie auch meine Tochter, die in jenem Frühling sechs war und ihre Arme um meinen Hals schlang. Meine Frau Rikke hockte neben uns, und in dem Kreis, der sich wie bei einer Urnenbeisetzung gebildet hatte, standen auch meine Schwiegermutter Grete und ihr Mann Steinar.
»Ja, er war mein Großvater«, sagte Grete. »Genau hier hat er gewohnt, im zweiten Stock«, sagte sie und drehte sich zu den Fenstern in dem Haus hinter uns um, hinter denen du manchmal standst und nach draußen schautest, in einer anderen Zeit, als andere Menschen als wir gelebt haben. Ich hatte immer noch die Arme meiner Tochter um den Hals, während mein Sohn weiter die nüchternen Tatsachen vorlas, die in das Messing graviert waren.
HIER WOHNTE
HIRSCH KOMISSAR
JG. 1887
VERHAFTET 12. 1. 1942
FALSTAD
ERMORDET 7. 10. 1942
Grete sagte etwas über den überraschenden Einmarsch, erzählte noch einmal die Geschichte, wie ihr Vater plötzlich am Morgen des 9. April 1940 die Soldaten sah, die mit graublauen Mänteln und Stiefeln im knallenden Gleichschritt durch die Straßen marschierten. Rikke stand auf, um sich an dem Gespräch zu beteiligen, und meine Tochter stellte sich neben sie. Nur mein Sohn und ich blieben vor dem Stolperstein hocken. Er wischte mit dem Handschuh über die letzte Zeile, bevor er zu mir aufschaute.
»Warum wurde er ermordet, Papa?«
»Weil er Jude war«, antwortete ich.
»Ja, aber warum?«
Ich spürte Rikkes Blick von der Seite, wie sie gleichzeitig an beiden Gesprächen teilnahm.
»Tja … die Nazis wollten alle umbringen, die anders waren. Und sie hassten die Juden.«
Mein Sohn schwieg.
»Sind wir auch Juden?«, fragte er. Die braunen Augen waren ganz klar, konzentriert.
Ich blinzelte mehrere Male, während ich darüber nachdachte, was ich über die Geschichte der Familie wusste. Was wussten meine Kinder überhaupt über den jüdischen Zweig ihrer Familie? Wir hatten bestimmt darüber gesprochen, dass ihre Ururgroßeltern mütterlicherseits vor über hundert Jahren aus unterschiedlichen Teilen Russlands eingewandert waren. Wir hatten über den Krieg gesprochen, über die Flucht ihres Urgroßvaters Gerson, den sie beide noch kennengelernt hatten, bevor er starb.
Rikke holte Luft, um etwas zu sagen, wurde dann aber in das Gespräch mit Tante Grete hineingezogen, und ich schaute meinem Sohn in die Augen.
»Du bist Norweger«, antwortete ich, spürte aber, dass eine Art von Verrat in dieser Antwort steckte, und spürte Rikkes Blick. »Ein Teil von dir ist auch jüdisch, aber wir sind nicht gläubig«, sagte ich und stand auf, hoffte, dass Rikke oder Grete etwas sagen würden, dass sie eine bessere Antwort darauf wüssten, aber ihr Gespräch hatte sich bereits weiterentwickelt, war der Logik der Gedankensprünge gefolgt und hatte sich weit entfernt.
Warum wurde er ermordet, Papa?
Diese Frage verfolgte mich noch monatelang, und es stellte sich heraus, dass sie schwierig zu beantworten war, die vergehende Zeit legt sich in immer dickeren Schichten des Vergessens über das, was vorbei ist. Und dennoch. Je mehr man in verschiedenen Archiven recherchierte und mit anderen Familienmitgliedern über die Vergangenheit sprach, desto deutlicher traten die damaligen Ereignisse hervor.
Bald konnte ich den Schnee im Zentrum von Trondheim sehen.
Den dampfenden Atem der Menschen, die an den kleinen, schiefen Holzhäusern vorbeigehen.
Bald konnte ich sehen, wie an einem Mittwochmorgen das Ende deines Lebens beginnt, mitten im Alltag.
Es ist der 12. Januar 1942. Du stehst hinter dem Ladentisch des Modegeschäfts, das dir zusammen mit deiner Frau gehört, umgeben von Hutständern und Schneiderpuppen mit Mänteln und Kleidern. Du hast gerade die erste Kundin hereingelassen und sie über die aktuellen Angebote informiert, als das Telefon dich zwingt, die Zigarette und das Bestellformular zur Seite zu legen.
»Paris–Wien, wie kann ich Ihnen helfen?«, sagst du, ganz automatisch, wie du es schon tausende Male davor getan hast.
»Guten Morgen«, sagt ein Mann am anderen Ende der Leitung auf Deutsch. »Spreche ich mit Herrn Komissar?«
»So ist es«, antwortest du, ebenfalls auf Deutsch, und denkst für einen Augenblick, dass es einer der Lieferanten aus Hamburg sein könnte. Vielleicht hat es wieder Probleme mit dem Zoll gegeben. Vielleicht geht es um die Sommerkleider, die du bestellt hast, aber dann muss es sich um einen neuen Mitarbeiter handeln, denn diese Stimme ist dir vollkommen unbekannt.
»Hirsch Komissar, verheiratet mit Marie Komissar?«
»Ja …? Mit wem spreche ich denn gerade?«
»Ich arbeite für den Sicherheitsdienst der Gestapo.«
»Aha.«
Du blickst von dem Bestellformular auf. Die Kundin hat offensichtlich bemerkt, dass etwas Ungewöhnliches vorgeht, und du drehst das Gesicht zur Wand, während dein Puls rast. Gestapo?
»Es gibt da etwas, über das wir gerne mit Ihnen reden würden«, sagt der andere Mann leise.
»Aha«, antwortest du knapp, zögerst, bevor du nach dem Grund fragen möchtest, und wirst vorher unterbrochen.
»Wenn Sie sich bitte heute um vierzehn Uhr im Missionshotel einstellen würden, damit wir Ihre Aussage aufnehmen können«, sagt die Stimme am anderen Ende.
Missionshotel. Eine Aussage? Warum um alles in der Welt wollen sie dich vernehmen, denkst du, den Blick auf die Wand gerichtet. Hat es irgendetwas mit Maries Bruder David und seinen kommunistischen Sympathien zu tun? Die Spitze eines kopflosen Nagels ragt aus dem Türrahmen. Du legst den Daumen gegen das Metall, drückst dir die Spitze in die Haut und schließt die Augen.
»Hallo?«, sagt die Stimme am anderen Ende der Leitung in ungeduldigem Ton. »Sind Sie noch dran?«
»Ja, ich bin hier …«, antwortest du, nimmst den Daumen von dem Nagel und siehst den weißen Punkt, an dem das Blut aus dem Fleisch gedrückt worden ist. Die Kundin steht am Ständer mit den Kleidern und betrachtet eines nach dem anderen, als du dich umdrehst und sie ansiehst.
»Einer meiner Kameraden meint, dass ich mit diesem Anruf ein viel zu hohes Risiko eingehe …«, sagt der Mann, und du hörst das Geräusch eines Feuerzeugs, das direkt neben dem Hörer angezündet wird.
»Sie meinen, ich hätte direkt ein Auto schicken und Sie abholen lassen sollen, damit Sie nicht einfach Ihre Söhne nehmen und mit ihnen abhauen können – immerhin sind Sie ja Juden …«, fährt der Mann mit Betonung auf dem letzten Wort fort, bevor er in leiserem, fast vertraulichem Ton hinzufügt: »Aber ich weiß, dass Ihre Frau Marie gerade im Krankenhaus liegt … Sie ist auf dem Eis ausgerutscht, nicht wahr?«
»Ja, das stimmt … Sie ist vor ein paar Tagen auf dem Eis ausgerutscht und gestürzt. Dabei hat sie sich diesen Knochen an der Hüfte gebrochen«, antwortest du, wobei dir der deutsche Begriff für Oberschenkelhals nicht einfällt, vielleicht hast du ihn auch nie gewusst. Der Sinn ist trotzdem klar geworden.
Wie konnte Marie nur so dumm sein und bei diesen Verhältnissen mit hochhackigen Stiefeln auf die Straße gehen, denkst du. Diese Fahrlässigkeit, aber sie will immer so elegant sein und hat diesen unbändigen Drang, alles selbst bestimmen zu wollen. Sobald du auch nur andeutest, dass sie etwas anders machen sollte, dass sie vielleicht etwas vorsichtiger sein und nicht immer diese Beiträge in den Zeitungen schreiben oder zu Hause diese Treffen abhalten sollte, bei denen politische Fragen diskutiert werden, antwortet dir Marie mit einem verächtlichen Schnauben. Dann zieht dieser dunkle Schatten in ihre Augen, der dir sagt, dass sie es auf ihre Weise machen wird. Jetzt sieht sie, was sie davon hat, denkst du, während du hinter deinem Ladentisch stehst, immer noch mit dem Hörer in der Hand. Die Kundin lächelt dir zu und verlässt das Geschäft. Die Ladenglocke klingelt erneut.
»Ein Oberschenkelhalsbruch, ja …«, sagt der gesichtslose Mensch am anderen Ende der Leitung und ruft damit den deutschen Begriff in Erinnerung. »Also kann ich damit rechnen, dass weder Sie noch Ihre Söhne das Weite suchen, nicht wahr? Ansonsten würden wir uns um sie kümmern müssen.«
Um sie kümmern. Du nickst langsam, obwohl niemand deine Körpersprache durch das Telefon registrieren kann, und antwortest schließlich, dass ihr nicht das Weite suchen werdet.
»Sehr gut, Herr Komissar. Dann kommen Sie heute um zwei zu uns. Sie wissen, wo Sie uns finden?«
»Das Missionshotel? Ja, natürlich.«
»Gut. Auf Wiedersehen.«
Es ertönt ein Klicken, als der andere den Hörer auflegt, und du stehst hinter der Ladentheke, und alle möglichen Gedanken flattern wie ein Schwarm Vögel, der von einem Baum aufgescheucht wurde, durch deinen Kopf. Was sollst du jetzt tun? Du schaust zur Uhr hinauf. Bis dahin sind es noch ein paar Stunden. Das ist viel Zeit, genug Zeit, um alles hier hinter sich zu lassen, denkst du und stellst dir für einen Augenblick vor, wie du gebückt in den Hinterraum gehst und dich durch den Lieferanteneingang verdrückst. Dass du in den schmalen Gassen verschwindest und so weit läufst, wie du kannst, ohne anzuhalten, ohne den Blutgeschmack im Mund zu beachten, die Blicke der Fremden oder das Ermüden der Beine auf den langen Steigungen. Du könntest den ganzen Weg bis in den Wald laufen, dich zwischen den Fichten verstecken und dich bis zur Grenze nach Schweden durchschlagen, wo deine Tochter Lillemor bereits in Sicherheit ist. Es könnte funktionieren, denkst du, siehst aber sofort ein, wie falsch diese Idee ist, denn was ist mit Marie? Was ist mit euren beiden Söhnen, Gerson und Jacob? Wenn du verschwindest, werden sie die Leidtragenden sein, denkst du und faltest das Bestellformular mit der freien Hand zusammen. Denn selbst wenn du Jacob über einen Bekannten an der Hochschule vielleicht Bescheid geben könntest, ist Gerson nicht zu erreichen, denn er ist mit Freunden von der Universität auf einer Wandertour, und was wird dann mit ihm geschehen, wenn er von der Wanderung in die Stadt zurückkommt und die Deutschen vor seiner Wohnung auf ihn warten? Und was werden sie mit Marie tun?
Sind die Gerüchte wahr, die seit kurzem in den Läden, bei Abendgesellschaften und in der Synagoge kursieren? Dass die Juden in besondere Lager im Ausland transportiert werden. Oder sind das nur Legenden, Übertreibungen, so wie du als Kind in der Nacht alle möglichen Monster aus der Dunkelheit auf dich zukommen sehen konntest?
Du rufst eine der Angestellten an, die in Teilzeit bei dir arbeitet, und fragst sie, ob sie nach Möglichkeit ins Geschäft kommen und die Arbeit übernehmen könne. Du erzählst ihr, dass du zum Verhör bestellt seist, und fragst sie, ob sie im schlimmsten Fall auch für die kommenden Tage übernehmen könne, falls die Angelegenheit sich hinziehen sollte. Dann rufst du Jacob an, erzählst ihm, was passiert ist und dass er versuchen soll, Gerson zu erreichen. Jacob beginnt zu stottern, wie es ihm gelegentlich passiert, wenn er sich aufregt, also versuchst du ihn zu beruhigen, sagst, dass schon alles gutgehen werde, dass es bestimmt nichts Ernstes sei und dass du es vorher noch schaffst, bei Marie im Krankenhaus vorbeizuschauen, um ihr Bescheid zu geben. Dann legst du auf. Es dauert nicht lange, bis die Angestellte eintrifft, auch sie mit ernster, fast leidender Miene, sodass du dich genötigt siehst, sie zu beruhigen und alles in ein milderes Licht zu tauchen. Dann ziehst du deinen Mantel an, verabschiedest dich und gehst zum Krankenhaus hinauf.
Worum geht es bei dieser Sache eigentlich? Vielleicht geht es um nicht mehr als eine diffuse Beschuldigung, etwas, für das sie dich ohnehin nicht verhaften können, denkst du, als du die Treppe hinaufgehst. Du achtest darauf, nur dort hinzutreten, wo gestreut ist, und hältst dich am Geländer fest, damit du nicht auf den Eisbuckeln ausrutschst, die wie glitschige Ohrenquallen auf den Steinstufen liegen.
Es ist ja gar nicht sicher, dass es etwas Ernstes ist, was sollst du denn getan haben? Nichts. Wahrscheinlich ist es nur eine Formalität, vielleicht wird die jüdische Bevölkerung registriert, oder schlimmstenfalls wollen sie Informationen über Maries Bruder haben, denkst du und erreichst das Krankenhaus.
Ein paar Stunden später wirst du im Missionshotel verhört. Das Gebäude ist voller junger Menschen in Uniform. Ein Getümmel aus sich unterhaltenden, rauchenden und kommandierenden Soldaten. Der Mann, der vor dir hinter dem Schreibtisch sitzt, trommelt mit dem Stift auf die Dokumente, die vor ihm liegen, und sieht dich mit einem kalten und harten Blick an.
»Ich habe gehört, Sie kommen aus Russland, stimmt das?«
»Ja.«
»Und dass Sie fünf oder sechs Sprachen sprechen?«
»Ja?«, antwortest du, unsicher, worauf er hinauswill.
»Das ist ja ungewöhnlich … Sie sind Ingenieur, haben in vielen Ländern studiert, in England, Deutschland, in Weißrussland … Trotzdem betreiben Sie zusammen mit Ihrer Frau einen einfachen Modeladen?«
»Ja, das stimmt, ich …«, antwortest du, wirst aber unterbrochen.
»… und dann sind Sie auch noch Jude«, sagt er und lehnt sich zurück. »Wie ist Ihre Beziehung zu David Wolfsohn?«
»Das ist der Bruder meiner Frau«, antwortest du, weißt jetzt, dass es um ihn gehen wird, aber dann kommt die Überraschung.
»Sie wissen, dass es gegen das Gesetz verstößt, BBC zu hören, nicht wahr?«
»Ja«, antwortest du und merkst, wie sich deine Finger auf dem Schoß ineinanderschlingen.
»Sie wissen, dass es nicht erlaubt ist, Nachrichten aus England zu verbreiten?«
Du nickst.
»Und dass man verpflichtet ist, jeden zu melden, der so etwas tut?«
Woher wissen sie davon?, denkst du und gräbst verzweifelt in deinem Gedächtnis, an welchen Orten ihr über die letzten Nachrichten aus England gesprochen habt, aber dir fällt nicht ein, wo es war und wer etwas davon aufgeschnappt haben könnte.
»Wir haben Beweise, dass diese Nachrichten in einem bestimmten Café namens Kaffistova ausgetauscht wurden.«
Da ist schon die Antwort. Natürlich. Im Kaffistova.
»Wir wissen auch, dass Sie sich ziemlich oft unten im Hafen aufhalten. Können Sie uns erklären, was Sie dort zu tun haben?«, fährt er fort.
»Ich nehme dort Waren in Empfang«, sagst du. Jemand muss dir gefolgt sein. Jemand muss deine Gespräche belauscht haben, auch die im Kaffistova. Jemand, der Norwegisch kann, aber wer?
»Sie müssen hierbleiben, solange wir die Angelegenheit genauer untersuchen«, sagt der Mann hinter dem Schreibtisch und winkt dich mit der Hand fort, während er auf einen der Soldaten an der Tür blickt.
»So weit erst einmal vielen Dank, Herr Komissar«, sagt der Mann, schiebt deine Akte zur Seite und bittet die Wachen, dich in eine Zelle im Keller zu bringen.
Am nächsten Morgen glaubst du immer noch, dass sie dich freilassen werden, dass irgendjemand in diesem System bald einsehen wird, dass du keine Gefahr für das Dritte Reich darstellst, dass es billiger und einfacher für sie wäre, dich einfach so weiterleben zu lassen wie bisher, aber dann kommen drei Soldaten in die Zelle und grüßen freundlich, bevor sie dich bitten, die Hände auf den Rücken zu legen. Das Metall der Handschellen liegt kalt auf deiner Haut.
»Wo geht es hin?«, fragst du auf Deutsch.
»Mitkommen«, antwortet eine der Wachen und führt dich die Treppe hinauf, durch einen Flur und hinaus auf einen Hof, wo es heftig schneit. Ein schwarzes Auto wartet mit laufendem Motor. Du wirst auf den Rücksitz geschoben. Dann fahrt ihr aus der Stadt. Erst nach einer Weile wird dir klar, wohin es geht.
Das Gefangenenlager Falstad.
Eine Stunde außerhalb von Trondheim. Ein weißes Backsteingebäude mit einem Innenhof, umgeben von Baracken und Stacheldrahtzäunen, auf deren gedrillten Metalldrähten eine dünne, weiße Schneeschicht liegt.
Das Tor wird geöffnet, und du wirst durch die Einfahrt gebracht, vorbei an einer nackten Birke, in das Gebäude hinein und die Treppe hinauf in den ersten Stock. Dort reiht sich eine Gefängniszelle an die andere. Holztüren mit gebogenen Gittern vor den Luken. Ein Gesicht erscheint. Ein anderer Gefangener. Zwei Wachen schauen zu, während du dich ausziehst, direkt vor der Zelle, dann wirst du in einen der Räume eingeschlossen. Eine lange, schmale Kammer mit einem Fenster am hinteren Ende und einem Etagenbett. Hinter dir wird der Riegel vor die Tür geschoben, und du spürst, wie die Angst herangekrochen kommt, als dir klar wird, dass du nicht entkommen kannst. Die Angst, als dir klar wird, dass dies wahrscheinlich das Ende ist und dass alles das letzte Mal gewesen sein wird.
A wie der Alkohol, den du während der ersten Wochen im Gefangenenlager vermisst, die Sehnsucht nach einem Rausch, der die Umgebung und die Gedanken weichzeichnet und die Verwirrung, den Zorn und und die Angst dämpft, der alles in einen Schlummer des Vergessens hüllt.
A wie die Assoziationen, die jederzeit auf dem Weg zur Zwangsarbeit, im Speisesaal oder draußen im Wald auftauchen konnten. Augenblicke mit plötzlichen und vollkommen unerwarteten Erinnerungen, als wäre alles, was es gab, ein Zugang zu etwas anderem.
Die tiefen Spuren der Lastwagenräder außerhalb des Lagers können dich plötzlich zu den schlammigen Wegen deiner Kindheit zurückführen, im jüdischen Teil des zaristischen Russlands, mit hellbraunen Hühnern, die hinter den Zäunen herumgackerten, und einem zerzausten Hund, um den du immer einen Bogen gemacht hast.
Der Anblick einer Wache, die den Kopf nach hinten legt und die Augen im Sonnenlicht zukneift, kann dich plötzlich in deine Studienjahre nach Deutschland zurückbringen, zu den überraschenden Glücksmomenten, wenn du eine Pause vom Lesesaal einlegtest und dich auf einer Bank nach hinten lehntest, in einem Land, das noch nicht von den Nazis übernommen worden war.
Ein frisch gewaschenes Hemd, das vor einer der Baracken zum Trockenen aufgehängt ist, aufgespannt wie ein Segel im Wind, kann dich für einen kurzen Augenblick in das Geschäft entführen, das Marie und du aus dem Nichts aufgebaut haben, oder zu dem Flüchtlingslager im schwedischen Uppsala, das ihr dummerweise verlassen habt und in dem die Kleidung vor den Häusern an Wäscheleinen hing und die Kinder dazwischen herumliefen.
A wie der Anblick deiner Familienmitglieder, den du immer wieder aus deiner Erinnerung heraufbeschwörst, wenn das Lager am Abend zur Ruhe kommt und du mit geschlossenen Augen in der Zelle liegst.
A wie der Abhang, an dem du vorbeikommst, wenn ihr zur Zwangsarbeit in den Falstadwald gefahren werdet: eine blank gewetzte, abschüssige Piste vor einem Bauernhof, auf der schwarze Streifen aus Erde von kleinen Kinderkörpern zeugen, die dort hinuntergerutscht sind, mit frostroten Wangen und kreischenden Mündern.
A wie alle Geschichten, die unter einem solchen Stolperstein versteckt waren und in den letzten Jahren ans Licht gekommen sind. Eine unerwartete und überwältigende Zahl von Geschichten, vergleichbar mit dem Insektenschwarm, der unter einem Stein hervorstob, den du als Kind angehoben hattest.
Lieber Hirsch. Dies ist ein Versuch, den zweiten Tod hinauszuschieben und das Vergessen zu verhindern, denn selbst wenn ich niemals alles erzählen kann, was dir zugestoßen ist, kann ich Teile davon hervorheben, sie zusammensetzen und dem, was verschwunden ist, Leben einhauchen. Ich bin kein Jude, aber meine Kinder, deine Ururenkel, haben jüdisches Blut in den Adern. Deine Geschichte ist ihre Geschichte. Wie kann ich ihnen, als Vater, diesen Hass erklären?
Der Vormittag am Stolperstein führte mich bald zu kleinen Städten und Orten, die ich nie zuvor besucht hatte, zu Archiven und Gesprächen, zu Büchern und Familienalben. Aber vor allen Dingen führte er mich zu der Erzählung über ein ganz besonderes Haus am Rande von Trondheim. Zu einer Geschichte, die so makaber und ungeheuerlich ist, dass ich sie zuerst gar nicht für möglich gehalten hatte, denn dieses Einfamilienhaus verknüpft unsere Familiengeschichte mit der Geschichte von Henry Oliver Rinnan, einem jungen Mann, aus dem am Ende der schlimmste aller norwegischen Nazis wurde.
Ein Haus mit einem Spitznamen auf B.
Das »Bandenkloster«.
B
B wie Bande.
B wie Bauwerk.
B wie Bandenkloster, das berüchtigte Haus, das auf einer Hügelkuppe direkt außerhalb der Innenstadt von Trondheim liegt, am Jonsvannsveien 46. Noch Jahrzehnte nach dem Ende des Kriegs wechselten die Leute die Straßenseite, wenn sie an diesem Haus vorbeikamen, als könnte das Böse aus seiner Vergangenheit auf irgendeine Weise in die Luft entweichen und sie infizieren. In diesen vier Wänden haben Henry Oliver Rinnan und seine Bande während des Zweiten Weltkriegs Pläne geschmiedet, Gefangene verhört, sie haben gefoltert, getötet und gefeiert. Ein Journalist, der das Bandenkloster kurz nach der Kapitulation der Nazis besichtigt hatte, schildert seine Erlebnisse folgendermaßen:
Überall im Haus haben sie gewütet, getrieben, so scheint es, von einer wilden Zerstörungswut. Sämtliche Räume scheinen für Schießübungen genutzt worden zu sein – Wände und Decken sind überall durchlöchert –, und wo die Tapeten immer noch ein bisschen zu unbeschädigt aussahen, haben sie sie mit einem Messer zerschlitzt. Sogar die Badewanne und die Badezimmerwand waren von Projektilen durchbohrt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Schüsse Bestandteil des psychischen Terrors waren, dem die Gefangenen in den kleinen, pechschwarzen Kellerlöchern ausgeliefert waren.
Allerdings hat sich herausgestellt, dass dieses Einfamilienhaus auch noch eine andere Erzählung verbarg, die ich erstmals in der Küche eines deiner Enkelkinder hörte: von meiner Schwiegermutter Grete Komissar.
Es war ein Samstag oder Sonntag, ein ruhiger Vormittag, an dem nichts erledigt werden musste und die Zeit eine zähere Form als gewöhnlich annahm. Die Musik einer Jazzplatte strömte aus der Anlage im Wohnzimmer, und das ruhige Klavierspiel vermischte sich mit den Geräuschen der Kinder, die dort auf einem blauen Sitzball balancierten, kleine Ausbrüche von Gelächter und ein kurzes Poltern, wenn einer der Körper auf den Teppich fiel. Ich war mit Grete in der Küche. Sie hatte begonnen, das Mittagessen vorzubereiten, indem sie Birnen schnitt und die langen Stücke zusammen mit Hähnchenkeulen und Gemüse in eine feuerfeste Form legte. Wir mussten über irgendetwas gesprochen haben, das mit der Kindheit zu tun hatte, denn als ihr Mann in der Tür erschien, fragte er mich, ob mir klar sei, dass Grete im Hauptquartier von Rinnan aufgewachsen war. Gretes Hände waren voller Hühnerfett, und sie lächelte verlegen, anscheinend überrumpelt davon, dass Steinar plötzlich hereinkam und gerade das erzählte. Obwohl mir der Name Rinnan bekannt vorkam, wusste ich in dem Augenblick nicht, wer das war. Steinar versuchte, meiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen, indem er den Vornamen hinzufügte – Henry – und dass Rinnan als Doppelagent für die Nazis gearbeitet hatte. Anschließend begann er, das gesamte Ausmaß der Grausamkeiten zu beschreiben, die in jenem Haus begangen wurden. Folter. Mord. Grete strich sich mit dem Unterarm das Haar aus der Stirn, immer noch mit dem Küchenmesser in der einen Hand und dem Hühnerfett an der anderen. Die Situation wirkte seltsam angespannt, als hätte sie am liebsten gar nicht darüber gesprochen. Gleichzeitig wäre es zu auffällig gewesen, wenn sie versucht hätte, sich durch das Wechseln des Themas herauszuwinden. Im Wohnzimmer polterte es, und ich hörte, wie Rikke die Kinder fragte, ob sie nicht lieber im Obergeschoss spielen wollten, bevor sie durch die Türöffnung trat und sich an Steinar vorbeidrückte.
»Und dort bist du aufgewachsen?«, fragte ich verwundert, denn obwohl ich Grete seit über fünfzehn Jahren kannte, hatte sie noch nie davon erzählt.
»Ja, ich habe seit meiner Geburt dort gewohnt – bis ich sieben Jahre alt war«, antwortete sie.
»Was?«, fragte Rikke, die merkte, dass sie etwas verpasst hatte.
»Ich habe nur erzählt, dass ich im Haus der Rinnan-Bande aufgewachsen bin«, wiederholte Grete und halbierte die letzte Birne, als wäre an der ganzen Sache überhaupt nichts Besonderes. Rikkes Gesicht sah ich allerdings an, dass es auch für sie eine Neuigkeit war.
»Wir hatten tatsächlich Theateraufführungen im Keller«, sagte Grete, mit Betonung auf Keller, während sie mit dem Handrücken den Hebel des Seifenspenders hinunterdrückte. »In denselben Räumen, in denen ein paar Jahre zuvor die Rinnan-Bande gehaust hatte.« Grete und ihre große Schwester Jannicke hatten zusammen mit Freunden aus der Nachbarschaft kleine Aufführungen dort unten inszeniert. Sie hatten sich mit Sachen der Eltern verkleidet, ihnen zu große Damenstiefel, Hüte und Ketten angezogen und gesungen. Kinder und Eltern aus der Nachbarschaft waren eingeladen worden, und Gretes Aufgabe hatte darin bestanden, oben an der Treppe zu stehen und die selbstgemalten Eintrittskarten an das Publikum zu verteilen, während die Erwachsenen die Köpfe einzogen und mit unruhigen Blicken nach unten gingen.
Kindertheater im Folterkeller, und das kleine Mädchen oben an der Treppe warf jede Menge Fragen auf: Warum um alles in der Welt zog eine jüdische Familie in eines der bekanntesten Symbole des Bösen, die es in Trondheim gab? Weil das Haus billig war? Oder wollten sie sich ihre Geschichte zurückholen? Wie beeinflusste das Haus diejenigen, die darin wohnten?
Ich bekam Lust, mehr herauszufinden, las alles, was ich über die Rinnan-Bande auftreiben konnte, und fand Bilder des Hauses, in dem meine Schwiegermutter aufgewachsen war. An jenem Vormittag schien sich etwas gelöst zu haben, denn in der Folgezeit begann Grete immer mehr über ihre Kindheit im Bandenkloster zu erzählen.
Als Grete und Steinar die Wohnung verkaufen wollten, die sie immer noch in Trondheim besaßen, fuhren wir hin, um sie ein letztes Mal zu besuchen. Wir schlenderten die Straße entlang, an der das Geschäft Paris–Wien damals lag, und blieben noch einmal an dem Stolperstein mit deinem Namen stehen. Dann setzten wir uns ins Auto und fuhren aus der Innenstadt bis zu der kleinen Straße, in der Grete aufgewachsen war, zum Jonsvannsveien 46. Es war ein niedriges, aber reizendes Haus, weiß gestrichen, mit dunklen Fenstern und grün gestrichenen Rahmen. Davor stand ein altes, rotes Auto aus den Fünfzigerjahren, als wäre die Zeit stehengeblieben.
»Sollen wir mal klingeln?«, fragte Grete. Ich nickte, und da kein anderer die Initiative ergriff, ging ich über den schmalen Kiesweg und drückte auf die Klingel. Ich wartete und wartete und überlegte, wie ich mein Anliegen in Worte fassen sollte, wenn jemand die Tür öffnete.
B wie Bleikugel. Eine kupferfarbene Bleikugel aus einer Wand im Bandenkloster, die zu Hause über meinem Schreibtisch im Regal liegt. Sie ist zusammengesunken wie eine Kochmütze, nachdem sie die Mauer im Keller getroffen hat, vielleicht die Frucht eines der Spiele, die die Mitglieder der Rinnan-Bande gespielt haben sollen, um die Gefangenen weichzukochen: Ein Mann wird unten im Keller an einen Stuhl gefesselt, und dann geht es darum, wer am dichtesten an ihm vorbeischießen kann, ohne ihn zu treffen.
B wie Babys mit Pausbacken. B wie Beine, die nackt auf dem Wickeltisch strampeln, wie brabbelnde Kinder, die mit rudernden Armen über den Boden balancieren und bei jeder Begegnung mit einem Altersgenossen fröhlich kreischen. B wie Beginnen, und die Erzählung über das Bandenkloster beginnt mit einem privaten Kindergarten im Keller des Hauses, betrieben von Else Tambs Lyche in den Jahren vor dem Krieg. Ralph Tambs Lyche, ihr Mann, war Professor an der Technischen Hochschule und gleichzeitig ein Hobbybotaniker, der im gesamten Umland von Trondheim Pflanzen sammelte, sie trocknete und im Obergeschoss ihres Hauses akribisch archivierte, während unten das fröhliche Geschrei der Kinder regierte, lange bevor das Haus mit Stacheldraht eingezäunt und von Soldaten bewacht wurde und die Gewalt dort einzog.
B wie der Blick zurück in die Kindheit, in dieses Land, aus dem jeder von uns stammt, in dem wir noch keine Ahnung haben, wie alle Begebenheiten und Gefühle der ersten Jahren als Sediment auf den Meeresgrund sinken und sich tief in uns ablagern, eine Landschaft und Befindlichkeiten bilden, die uns für den Rest des Lebens prägen, so wie es dieser Wintertag für den damals zehnjährigen Henry Oliver Rinnan tun wird.
Es ist Februar 1927. Schneeflocken wirbeln vor der Schule in Levanger durch die Luft und sammeln sich in kleinen Schneewehen vor dem Fenster, an dem Henry sich über das Schreibheft beugt. Die Haare hängen ihm über die Augen, und er greift nach dem Radiergummi, um den Bogen eines kleinen g wegzurubbeln, mit dem er nicht zufrieden ist, als er plötzlich aufmerkt, weil die Lehrerin mitten im Satz zu sprechen aufhört, Henrys kleinen Bruder betrachtet und ihn fragt, wie es ihm gehe.
Du bist so blass … bist du krank?, fragt sie und geht um den Katheder herum. Henry bemerkt, wie alle anderen Blicke wechseln, kleine Funken, die sich erwartungsvoll entzünden, denn jetzt geht die Lehrerin zwischen den Pultreihen hindurch. Bald wird sie sehen, was er und sein Bruder schon den ganzen Morgen zu verbergen versucht haben: dass der kleine Bruder Damenstiefeletten trägt, schwarze Damenstiefel, die jemand vergessen hat, in der Schuhmacherwerkstatt seines Vaters abzuholen. Henry wusste, dass es deswegen Probleme geben würde, er hatte versucht, seiner Mutter klarzumachen, dass sie ihren Sohn nicht mit Damenschuhen zur Schule schicken könne, aber die Mutter hatte ihm die Winterstiefel des kleinen Bruders vors Gesicht gehalten und das klaffende Loch zwischen Sohle und Leder gezeigt, und mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete, hatte sie ihm geantwortet, dass der Junge nicht mit Winterstiefeln zur Schule gehen könne, die so kaputt seien, dass er schon klatschnasse Füße hätte, bevor sie überhaupt um die erste Ecke waren.
Die Absätze waren zum Glück nicht so hoch, aber trotzdem schien in großen Lettern Damenschuhe darauf zu stehen, und weil die Stiefeletten zu allem Überfluss auch noch ein paar Nummern zu groß waren, musste der Bruder die Zehen krümmen, um nicht zu stolpern, und ging deshalb mit seltsamen, unnatürlichen Schritten. Die Brüder hatten sich an der Jungengruppe vor dem Eingang vorbeigeschlichen, die zum Glück so sehr mit sich selbst beschäftigt war, dass niemand die Schuhe bemerkte. Im Klassenzimmer sah Henry, dass zwei der Mädchen einander anstupsten und zu kichern begannen, aber kurz darauf kam die Lehrerin herein, stellte sich neben ihr Pult und sagte: »Guten Morgen zusammen!«
Sie hatten sich wieder gesetzt, er hatte sich in die Schularbeit vertieft, konzentrierte sich auf die Buchstaben, die zusammengefügt werden sollten, einer nach dem anderen, in hübschen Schleifen, und hatte beinahe alles vergessen, bis die Lehrerin plötzlich den Unterricht unterbrach, und jetzt geht sie mit besorgter Miene durch die Pultreihen. Henry spürt, wie ihm die Wärme ins Gesicht steigt, sieht, wie sein kleiner Bruder die Schuhe zu verstecken versucht, indem er die Beine unter den Stuhl zieht, aber es nützt nichts. Die Lehrerin bleibt vor ihm stehen und ist offensichtlich dermaßen verblüfft, dass die Worte aus ihr herauspurzeln, als hätte sie etwas verpasst.
»Aber … was hast du denn da für Schuhe an?«, fragt sie, und die anderen Schüler beginnen zu kichern. Henry spürt, wie sein Herz schneller schlägt, fühlt die Scham auf den Wangen brennen, und dann schaut er zu seinem Bruder, der ihren Blicken ausweicht und anscheinend nicht weiß, was er antworten soll. Er darf auf keinen Fall die Wahrheit sagen, denkt Henry, dass ihr Vater, der Schuhmacher, sich nicht die Mühe gemacht hat, die Schuhe seiner eigenen Kinder zu reparieren, das darf er auf keinen Fall sagen, lieber irgendeine Notlüge, dass er einfach die erstbesten Schuhe angezogen hätte, zum Beispiel, oder dass er einfach nur ein bisschen Quatsch machen und sehen wollte, ob es jemand merkt, aber das sagt sein Bruder nicht, er bekommt einfach kein Wort heraus. Jetzt muss er aber etwas antworten, denkt Henry, denn sein Schweigen macht alles immer schlimmer und vergrößert die Scham, die über allem liegt, also räuspert sich Henry, um seine Kehle zu reinigen, aber auch, um die Aufmerksamkeit der Lehrerin und aller anderen auf sich zu ziehen. Er spürt ihre Blicke. Diese Aufmerksamkeit lässt sein Herz noch schneller rasen, verunsichert ihn noch mehr, aber das dürfen die anderen nicht mitkriegen, und jetzt muss er etwas sagen, das Ganze auf irgendeine Weise ausbügeln, denkt er und zwingt sich, der Lehrerin in die Augen zu sehen.
»Ach, er findet es einfach nur witzig, Schuhe von daheim aus der Werkstatt anzuprobieren«, antwortet Henry und zwingt sich zu einem Lächeln, will sie glauben machen, dass das nichts weiter als lustige Flausen sind, aber er kann am Gesicht der Lehrerin erkennen, dass sie ihm nicht glaubt, denn sie erwidert sein Lächeln nicht, sondern geht stattdessen neben seinem Bruder in die Knie, legt eine Hand auf seine Schulter und sagt: Oje, wie dünn du geworden bist. Mit besorgter Stimme fragt sie, ob es zu Hause denn so schlimm sei, und natürlich weiß sie, dass das für Henry und seinen kleinen Bruder peinlich sein kann, also spricht sie ganz leise, damit die anderen es nicht verstehen, aber davon wird alles nur noch schlimmer, denn dadurch wird für alle überhaupt erst offensichtlich, dass es tatsächlich um etwas geht, wofür man sich schämen kann und was keiner hören sollte, und dadurch wird es natürlich noch interessanter für die Mitschüler, denn alle können es hören, da ist er sich ganz sicher, denn obwohl sie beinahe flüstert, werden die Worte zu jedem Ohr in diesem Klassenzimmer getragen und verwandeln sich in offene Münder und glotzende Augen.
Jetzt muss sein Bruder endlich antworten, denkt Henry, aber er tut es nicht. Der Bruder sieht nur verwirrt aus und schaut erst seine Lehrerin unglücklich an und dann ihn, während ihm langsam die Tränen in die Augen steigen, sodass er immer wieder blinzeln muss, und er hat immer noch nicht geantwortet. Er schnieft und hebt den Unterarm an die Nase. Es ist still. Ganz, ganz still.
»Danke, daheim ist alles in Ordnung«, sagt Henry mit klarer und deutlicher Stimme. »Er ist in letzter Zeit ein bisschen krank gewesen. Machen Sie einfach mit dem Unterricht weiter, bitte«, fügt er hinzu und richtet seinen Blick auf den Satz, den er gerade schreibt, greift nach dem Radiergummi und radiert den Bogen unter dem kleinen g aus, mit dem er nicht zufrieden war. Dann wischt er die Radierkrümel weg, nimmt den Bleistift und demonstriert mit jeder Bewegung, dass es dazu jetzt nichts mehr zu sagen gebe, dass sie einfach mit dem Unterricht weitermachen solle.
Alle seine Sinne sind geschärft, denn Henry kann spüren, wie die Blicke hinter seinem Rücken verschwinden, und er hört Stühle über den Boden scharren, als seine Mitschüler sich wieder setzen und sie zurechtrücken. Er hört Bleistifte übers Papier kratzen und die Lehrerin, die endlich mit dem Unterricht fortfährt. Gleichzeitig spürt er, wie Lachen in den Brustkörben der anderen aufsteigt und herauswill, wie Dampf in einem geschlossenen Wasserkessel.
Als die Stunde schließlich um ist, geht die Lehrerin erneut zu seinem Bruder und sagt ihm, dass er in den Pausen im Klassenzimmer bleiben dürfe, und Henry ebenfalls.
Henry bedankt sich bei ihr, bleibt am Fenster sitzen und schaut den anderen beim Spielen und Herumtollen im Schnee zu. In den nächsten Stunden klappt es besser. Bald ist der Schultag vorbei, dann kann er seine Bücher in den Ranzen packen und seinen Bruder an die Hand nehmen.
Zuerst müssen sie aber über den Schulhof, vorbei an den anderen Schülern, die seinen Bruder anschauen und kichern. Ein paar ältere Jungen beginnen laut zu lachen und zeigen auf die Stiefeletten.
»Guckt euch mal dieses Mädchen an! Auf Wiedersehen, Fräulein Rinnan!«, sagt einer der ältesten Jungen, und der Kommentar lässt die anderen in seiner Nähe höhnisch grinsen. Henry spürt Wut in sich aufwallen, eine Woge aus Dunkelheit, die ihn vorpreschen lässt, und bevor er darüber nachdenken kann, drischt er diesem Idioten, der seinen kleinen Bruder der Lächerlichkeit preisgibt, seine Faust ins Gesicht. Er hat kein Recht, so etwas zu sagen! Er hat kein Recht, seinen kleinen Bruder zum Gespött zu machen, denkt Henry und spürt das harte Jochbein an seinen Fingerknochen, spürt die Wut durch seine Adern jagen und sieht, wie der Junge sich an die Wange fasst und sich vor Schmerzen krümmt. Nach einem Augenblick der Verwirrung stürzen sich die anderen Jungen auf ihn. Plötzlich ist alles ein Chaos aus wütenden Augen und schreienden Mündern. Hände strecken sich ihm entgegen, Finger zerren an seinen Haaren und am Ranzen auf seinem Rücken, und plötzlich liegt er auf dem Boden, und seine Arme und Beine werden festgehalten, er spürt den Atem und das Herz und die Wut und den Schnee.
»He, ihr dort hinten! Hört auf damit!«, ruft ein Lehrer, der sich mit der Pfeife in der Hand aus einem Fenster lehnt, und sie lassen widerwillig von ihm ab, lassen ihn aufstehen, aber nicht ohne ihm eine Warnung ins Ohr zu flüstern. Warte nur ab, Henry Oliver. So leicht kommst du nicht davon!
Er klopft sich den Schnee von den Hosen, bebt immer noch vor Wut, so heftig, dass es ihm schwerfällt, die Luft tief in die Lungen zu ziehen, als wäre er außer Atem, aber jetzt greift er nach der Hand seines kleinen Bruders und geht, schnell, schnell, schnell, er muss bloß von alldem hier wegkommen, von der Schule und den anderen Kindern, bevor alles noch schlimmer wird und nicht mehr zu reparieren ist, denkt er und sieht das spöttische Grinsen seiner Mitschüler vor sich. Diese dämliche Sache wird an ihm hängenbleiben, eine lächerliche Geschichte, die man sich noch wochenlang an der Schule zuflüstern wird. Allein der Gedanke daran lässt erneut Verzweiflung in ihm aufwallen, denn sie werden eine Gelegenheit finden, sich bei ihm zu revanchieren, ohne dass er weiß, wann oder wo. Denn das hat er gemeint, der Junge, der ihm ins Ohr geflüstert hat, dass er nur abwarten solle, es war eine Warnung, ein Versprechen, dass sie ihn später weiter verprügeln werden, dass sie noch nicht mit ihm fertig waren, denkt Henry und beißt die Zähne zusammen. Die ganze Zeit war er so vorsichtig gewesen, seit er an die Schule gekommen war, hat immer getan, was er sollte, hat sich aus Konflikten herausgehalten, sich die Kunst beigebracht, gefährliche Situationen mit einem höflichen Lächeln zu entschärfen. Er hat die großen Jungen herrschen und bestimmen lassen, hat sich von ihnen ferngehalten, wenn sie geklettert und gekickt und sich zum Spaß geprügelt haben, weil er wusste, dass er sich nicht gegen sie behaupten konnte, dass es nicht in ihm steckte, also ist es besser gewesen, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen, so aufzutreten, dass er in nichts hineingezogen wurde. Das ist seine Strategie gewesen, und jetzt war sie danebengegangen.
Hätte sein Bruder nur nicht angefangen zu heulen, denkt Henry und packt sein Handgelenk etwas fester, ein zu fester Griff, das spürt er, und gleichzeitig geht er schneller über den Kiesweg. Sein Bruder jammert, aber das muss er jetzt aushalten. Er muss lernen, dass er sein Verhalten ändern sollte, wenn er nicht zum Prügelknaben werden will, zu demjenigen, den die anderen Schüler sich aussuchen, wenn sie jemanden quälen wollen, denn dann würde es auch Henry treffen, er würde sich daran anstecken, es würde wie ein Geruch an ihm kleben, und das könnte er überhaupt nicht gebrauchen, wo er doch ohnehin schon so klein ist. Der kleinste von allen Jungen in seinem Alter, und bestimmt auch derjenige, der aus der ärmsten Familie kommt, denkt er. Mit schnellen Schritten gehen sie weiter, er zieht den kleinen Bruder hinter sich her und sieht von der Seite, dass er sein Gesicht zu einer Grimasse verzieht, ihn bittet, den Arm loszulassen, aber Henry hört nicht auf ihn, will ihn bestrafen. Das tut weh, Henry Oliver, wimmert sein kleiner Bruder. Als er die Tränen sieht, die ihm die Wangen hinunterlaufen, lässt Henry ihn sofort los und streichelt ihn so sanft wie möglich über die Stelle, an der er ihn festgehalten hat. Entschuldigung!, sagt er. Mehr als einmal.
Der Bruder schluchzt und reibt sich mit dem Handschuh das Gelenk. Sie gehen nach Hause, und Henry überlegt, dass er seinen Bruder aufmuntern sollte, er muss alle Tränenspuren beseitigen, bevor sie heimkommen, denn wenn ihre Mutter sieht, dass der Bruder geweint hat, wird sie Fragen stellen, und dann muss er ihr alles erzählen, und was wird dann geschehen? Dann würde sie noch mehr Sorgen haben, und das braucht sie wirklich nicht. Er sieht, dass sein Bruder die Handschuhe auszieht, sich in die Hand schnäuzt und sie im Schnee abwischt. Der Bruder tut, was er ihm gesagt hat. Die Hände werden rot von der Kälte, aber der Rotz ist weg. Henry zieht sich selbst die Handschuhe aus, knetet eine Handvoll Schnee und wischt das Gesicht des Bruders mit feuchten Fingern vorsichtig unter den Augen sauber.
Und dann sagt er: »Wir erzählen davon nichts zu Hause, oder?«
»Nein.«
»Mama und Papa haben schon genug Sorgen, nicht wahr?«
»Stimmt«, antwortet sein Bruder, und sie gehen weiter. Henry denkt sich ein paar Spiele für unterwegs aus. Lässt seine Finger auf der Jacke entlang bis zur Armbeuge spazieren, will ihn aus der düsteren und traurigen Stimmung herausholen, ihn ablenken, also lässt er seine Finger unter die Armbeuge seines Bruders gleiten und sieht, wie sein Gesicht sich wieder entspannt, wie die Schlägerei und die Kälte und die Tränen verschwinden und die Möglichkeit schaffen, über andere Dinge zu reden, wie sie es sonst auch immer tun. Nach Hause laufen, gegen einen Eisklumpen treten.
Bald haben sie ihr Elternhaus erreicht, das gegenüber dem Friedhof liegt. Ein grün gestrichenes Holzhaus mit zwei Stockwerken, unten die Werkstatt des Vaters und oben die Wohnung.
Er sieht die Mutter hinterm Küchenfenster vorbeigehen, wahrscheinlich schält sie gleich Kartoffeln, spült die Wäsche oder schnippelt Gemüse, und jetzt sieht Henry, wie die Freude, die er in seinem kleinen Bruder aufgebaut hat, aus dessen Miene weicht und die Ereignisse in der Schule sich wieder zurückmelden.
»Das wird schon gutgehen«, sagt Henry, legt ihm eine Hand auf die Schulter und lässt sie mit einem Lächeln hinuntergleiten. »Komm!«
Daheim riecht es aus der Küche nach gekochten Kartoffeln, und der Flur ist voller Schuhe.
»Hallo?!«, ruft Henry und achtet darauf, genauso zu klingen wie sonst, damit niemand Verdacht schöpft. Die Mutter kommt aus der Küche, sie hat Schweißperlen auf der Stirn und weiße Mehlflecken auf der Schürze. Die jüngste Schwester steht auf unsicheren Beinen hinter ihr und hält sich am Rockzipfel fest, stellt sich auf die Zehenspitzen, um hochgehoben zu werden.
»Na, wie war’s in der Schule? War es nicht schön, warme Füße zu haben?«, fragt sie, und die Worte setzen offensichtlich den Vater im Wohnzimmer in Bewegung, denn Henry hört, wie die Federn in dem alten Sessel quietschen, und kurz darauf taucht der Vater in der Tür zur Küche auf. Er hält die Winterschuhe des kleinen Bruders mit einem zufriedenen Lächeln in die Höhe, um darauf hinzuweisen, dass sie jetzt dicht sind.
»Danke, Papa«, sagt der kleine Bruder und nimmt seine Winterschuhe entgegen.
»Und … hat irgendwer etwas gemerkt?«, fragt der Vater mit einem Augenzwinkern und schaut auf die Damenstiefeletten, aber in diesem Moment greift die kleine Schwester nach dem Tuch auf dem Küchentisch und will fest daran ziehen, sodass alle Teller und Gläser umkippen und herunterfallen würden, und Henry freut sich, dass die Mutter deshalb weder den verräterischen Tonfall in der Stimme seines Bruders noch dessen beschämten Gesichtsausdruck mitbekommt, als er verlegen antwortet:
»Nein, Papa.«
B wie die Bauwerke, die zusammen das Gefangenenlager in Falstad bilden: ein weißes, zweigeschossiges Hauptgebäude aus Backstein mit einem viereckigen Innenhof, dazu ein paar kleinere Baracken, die sich darum gruppieren. Kleine, einfache Hütten für die Wachleute, Schuppen für die Schweine und die Kühe, dazu die Toilettenhäuschen und die Tischlerei, bevor man den Stacheldrahtzaun erreicht, der die gesamte Anlage umschließt.
B wie das Besteck, das auf den Tellern im Speisesaal klappert und in den wenigen Sekunden, in denen die Gefangenen nach der Gabel oder dem Löffel greifen, bevor sie zu essen beginnen, einen ohrenbetäubenden Lärm erzeugt.
B wie die Birke, an der du im Gefängnishof vorbeikommst, wenn du auf dem Weg zur Strafarbeit bist, mit schmutzigweißem Stamm und Blättern, die mittlerweile goldgelb sind, wie die Farbe einiger Stoffproben, die du regelmäßig für dein Geschäft in Trondheim bestellt hast.
B wie die Blätter, die in Bücher geklebt und mit akkurater Schrift von Professor Ralph Tambs Lyche katalogisiert worden sind, dem ersten Besitzer des Hauses im Jonsvannsveien 46, lange bevor es zum Hauptquartier der Rinnan-Bande umgebaut wurde.
B wie der Beschluss, in eine andere Stadt zu ziehen. B wie der Besitz, der im Kofferraum verstaut wird, und wie die Birkenblätter, die sich an diesem Frühlingstag 1948 in Oslo aus ihren Knospen entfalten. Die Sonne scheint über die Hausdächer und lässt die Tropfen glänzen, die von den Dachrinnen fallen. Gerson legt die Hand auf den Griff der Kofferraumklappe, führt alle Bewegungen in einer unnötig hektischen Weise aus, obwohl sie an diesem Tag nichts anderes mehr vorhaben, als vor Einbruch der Dunkelheit Trondheim zu erreichen. Jannicke hat sich auf die Bordsteinkante gehockt und hebt einen Stein auf, um ihn sich in den Mund zu stopfen, aber Ellen nimmt sie hoch und windet ihn ihr aus der Hand, obwohl Jannicke sich wehrt und versucht, sich aus ihrem Griff zu befreien. Dann beginnt sie zu plärren, sie ruft Meiner! Meiner! Meiner!, während Ellen das Mädchen auf der Rückbank platziert und Gerson sich ans Steuer setzt.
Die übrigen Möbel sind bereits am Morgen herausgetragen worden und fahren in einem Lastwagen voraus. Die Entscheidung ist ein paar Monate zuvor gefallen. Erst in Form kleiner Hinweise, denn jedes Mal, wenn Gerson mit seiner Mutter telefonierte, flocht Marie in die Gespräche ein, dass sie Hilfe im Geschäft benötige, dass es viel zu viel Arbeit für sie allein sei. Dann war sie zu Besuch gekommen. Sie reiste mit dem Zug nach Oslo, und Gerson hatte auf dem Bahnsteig auf sie gewartet, sah sie auf hochhackigen Stiefeletten und mit einem Hut aussteigen, der so breit war, dass er den Türrahmen streifte. Sie winkte und machte Platz für einen fremden Mann, der ihr den Koffer hinterhertrug. Seine Mutter war schon immer so gewesen, so gut gekleidet und elegant, und schon der Gedanke, dass sie selbst etwas tragen könnte, wäre absurd gewesen. Also blieb Gerson einfach stehen und schaute zu, wie sie den Mann zur Belohnung auf die Wange küsste, bevor sie ihn mit einem Winken verabschiedete. Dann drehte sie sich zu Gerson um, ohne Anstalten zu machen, ihren Koffer selbst zu tragen, sodass er zu ihr gehen und ihn für sie nehmen musste. Das hätte ich ja ohnehin getan, dachte er und ärgerte sich trotzdem über ihre Art, dies als selbstverständlich zu betrachten. Doch er biss die Zähne zusammen. Lächelte und antwortete knapp auf ihre Bemerkungen, so wie er wusste, dass sie es erwartete, denn selbst wenn sie ihn fragte, wie es ihm gehe, wollte sie nicht mehr hören als ein kurzes gut. Sie wollte nichts darüber hören, wie schwierig es war, eine Arbeit zu finden, über die radikale Umstellung, die die Tochter Jannicke mit sich gebracht hatte, oder wie der Krieg ihm seine Zukunftsaussichten entrissen hatte, als er gerade in sein Erwachsenenleben eintrat. Seine Mutter war mit sich selbst beschäftigt, so war es schon immer gewesen, denkt Gerson und erinnert sich, wie Ellen darüber lachen musste, als er zum ersten Mal erzählte, wie er die Sommerferien verbracht hatte, als er klein war. Wie er und Jacob, obwohl sie noch nicht älter als zwölf waren, für mehrere Wochen ganz allein in einer Pension untergebracht worden waren, weil die Eltern sich ums Geschäft kümmern mussten.
Kaum hatte Marie Gersons und Ellens Wohnung betreten, begann sie auch schon davon zu sprechen, wie klein sie sei und wie beengt sie doch wohnten. Gerson musste mit ansehen, wie Ellen in sich zusammensank, wie das Lächeln auf ihrem Gesicht gefror, denn Ellen sah es natürlich genauso, sie stammte aus einer wohlhabenden Familie und war die Tochter eines Fabrikbesitzers.
»Wir werden umziehen, Mutter. Wir haben ein Grundstück in Holmen gekauft, und wenn das Reihenhaus fertig ist, ziehen wir dort ein«, sagte Gerson und half ihr aus dem Mantel.
»Genau darüber wollte ich mit euch reden«, sagte Marie und ging weiter durch den Flur ins Esszimmer. »Ich habe ein Haus für euch gefunden. Ein Haus in Trondheim, ganz in der Nähe des Zentrums. Ein Haus mit Garten und einer Toilette in der Wohnung statt im Treppenhaus, so wie hier. Ein Einfamilienhaus, Gerson, und eine Arbeit für dich im Paris–Wien.«
Die Mutter hatte sich an Ellen gewandt, die Jannicke auf dem Schoß hatte. Dann erzählte sie vom Geschäft, von all den Kleidern, Stoffen, Hüten und Mänteln, die Ellen selbstverständlich auch ausleihen konnte, wenn sie wollte.
Über die Geschichte des Hauses sagte Marie nichts. Erst ein paar Wochen später rief sie Gerson an und erwähnte es ganz am Ende ihres Gesprächs, kurz bevor sie auflegen wollten, als wäre es die normalste Sache der Welt.
»Ach, übrigens. Das Haus war im Krieg für ein paar Jahre der Wohnsitz der Rinnan-Bande.«
Gerson hatte dem Wohnzimmer den Rücken zugewandt und die Augen zusammengekniffen.
»Hallo?«, hatte seine Mutter gerufen. »Bist du noch da?«
»Aber … Mutter? Warum hast du das nicht schon früher erzählt?«
»Weil ich Angst hatte, dass Ellen das Ganze künstlich aufbläst und eine große Nummer daraus macht«, sagte Marie auf Jiddisch.
»Aber … findest du nicht, dass wir … das gewisst haben sollten?«, antwortete Gerson ebenfalls auf Jiddisch und hörte Ellen im Hintergrund mit Jannicke plappern.
»Gewusst, oder hätten wissen sollen«, berichtigte ihn die Mutter. »Aber was hat das schon zu bedeuten, Gerson? Der Krieg ist vorbei und die Rinnan-Bande längst aus dem Haus raus. Es ist ein schönes Einfamilienhaus mit Garten in einem guten Viertel. Und die einzige Möglichkeit, euch etwas halbwegs Anständiges zu beschaffen, außerdem brauche ich dich hier oben, Gerson.«
Gerson schwieg, und Marie kehrte zum Norwegischen zurück.
»Hätte ich einfach nein sagen sollen? Hätte ich einfach sagen sollen, nein, mein Sohn möchte dieses Haus nicht und kann nicht nach Trondheim ziehen, weil seine Frau und er Angst vor Gespenstern haben?«
»Nein, Mutter«, antwortete Gerson und hörte, wie Ellen mit Jannicke aus dem Wohnzimmer kam.
Er sagte nichts. Jedes Mal, wenn Gerson sich vornahm, Ellen von der Vorgeschichte des Hauses zu erzählen, kam etwas dazwischen. Dazu kam noch ein anderer Grund, ein Wunsch, die Geschichte zurückzuholen, die Macht zurückzugewinnen. Jetzt gehört es uns, die Entscheidung ist getroffen, und sie setzen sich ins Auto. Gerson dreht den Zündschlüssel, und dann fahren sie los, während die zwei Jahre alte Jannicke nach und nach vergisst, warum sie so wütend gewesen ist. Bald sind die Sorgen verschwunden, und sie beginnen zu plaudern. Schauen sich die Gärten und Felder an. Hin und wieder ein Traktor mit Heu beladen. Jannicke zieht ihre kleinen Finger über die Scheibe und drückt die Zunge dagegen. Gerson lächelt in den Rückspiegel. Beginnt sich das Leben in Trondheim vorzustellen, in der Modeboutique Paris–Wien. Er atmet tief ein und spürt, wie Ellen ihre Hand auf seine legt, am Lenkrad. Er schaut kurz zu ihr hinüber und lächelt, schaltet und legt eine Hand auf ihren Oberschenkel, spürt ihre warme Haut direkt unter dem Kleid und beschwört das Bild einer glücklichen Familie im Garten des neuen Hauses herauf. Es muss einfach funktionieren.
B wie die Baritonstimme des Gefangenen, der manchmal eingesetzt wird, um in Falstad für Unterhaltung zu sorgen: Mitten in der Arbeit kann einer der Soldaten auf die Idee kommen, ihn singen zu lassen. Dann verstummen die Sägen, ebenso wie das Hallen der Hammerschläge aus der Tischlerei und das ständige Schwirren von Füßen und Händen, und in jedem Einzelnen wird etwas geweckt. Mit reiner und schöner Stimme singt der Bariton, den Kopf schräg nach hinten gelegt, wie bei einem Klagelied zum Himmel, mit Phrasierungen, die der Umgebung die Härte nehmen. Die Schmerzen in der Muskulatur, das ständige Brennen von kleinen Schnittwunden und Abschürfungen verschwindet innerhalb von Sekunden. Die Gesichter der Wachleute lösen sich auf, entspannen sich, bevor eine innere Stimme ihnen befiehlt, sich zusammenzureißen und wieder in ihre Rolle zurückzukehren.
In Augenblicken wie diesen denkst du darüber nach, ob du vielleicht einen dieser jungen Männer vor zehn Jahren in einer deutschen Stadt getroffen haben könntest. Da waren sie zehn, zwölf Jahre alt und liefen auf knochendürren Beinen durch die Straßen, mit ungelenken Armen und Augen, die vor Neugier und Freude glänzten. Vielleicht hast du einen der Wachleute angelächelt oder dich in einem Park kurz mit ihm unterhalten, als er noch klein war. Aber jetzt? Jetzt hat der Krieg sie in eine andere Form gepresst.
B wie die Bima, wie Bar Mitzwa und wie die Bänke in der Synagoge von Trondheim, die du einst mit in das Gebäude getragen hast. Auf diesen Bänken saßen deine Kinder, als sie klein waren, und zappelten mit den Beinen in der Luft, während sie der eintönigen Stimme lauschten und sich von der ernsten Atmosphäre einnehmen ließen.
B wie die Bilder, die vom Bandenkloster aufgenommen wurden, kurz nachdem der Krieg vorbei war. Es ist Nachmittag, und ich sitze in meinem Arbeitszimmer in Oslo und durchsuche Archive im Internet. Das erste Bild zeigt das Haus von außen. Ein Haus mit einem Rundbogenfenster im ersten Stock und mit Fensterläden im Erdgeschoss, die man vor die Fenster klappen konnte. Der Stacheldraht um das Grundstück war bereits entfernt worden, und die Wachen, die vorher dort standen, waren ebenfalls verschwunden. Das zweite Bild zeigte eines der Schlafzimmer der Rinnan-Bande, dessen Boden von Schubladen, Kleidung, Abfall und Papieren bedeckt war. Die Tapete war zerfetzt.
Auf dem dritten Bild scheint die Sonne durch die Kellerfenster und fällt auf eine Kellerbar voller Flaschen. Auf dem Boden vor der Theke stehen große Tonnen, zwischen denen eine dicke Eisenstange befestigt ist. Die Eisenstange hat einen Knick in der Mitte, wahrscheinlich von dem Gewicht all der Leute, die sich mit gefesselten Händen hinhocken mussten, um dann an der Eisenstange aufgehängt zu werden, bevor die Bandenmitglieder sie abwechselnd auspeitschten, schlugen oder ihnen Brandwunden zufügten. Die Rückseite eines nackten, männlichen Oberschenkels taucht in Schwarzweiß vor mir auf dem Bildschirm auf, mit einem eingebrannten Hakenkreuz gleich unter dem Gesäß. Direkt hinter mir höre ich Schritte, ich muss so tief in diese Materie versunken gewesen sein, dass ich sie nicht habe kommen hören, aber jetzt steht meine Tochter direkt hinter meinem Rücken. Schnell schließe ich das Fenster, doch dahinter liegt ein Bild von drei verschiedenen Peitschen.
»Was ist das, Papa?«, fragt meine Tochter, bevor ich den Browser ganz schließen kann.
»Ich lese nur etwas über den Krieg«, sage ich und drücke meine Wange an ihre. Hebe den kleinen, schmächtigen Körper hoch und trage sie vom Computer weg.