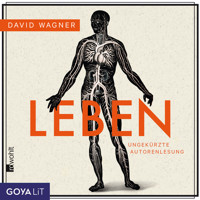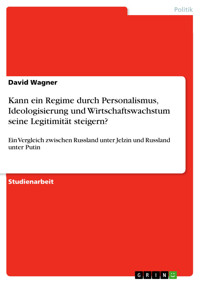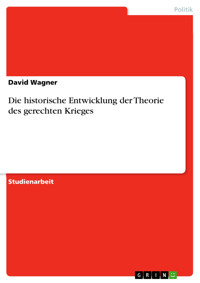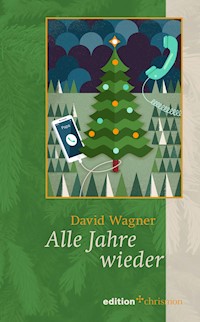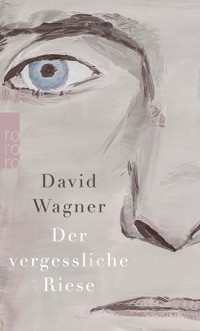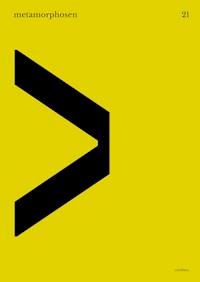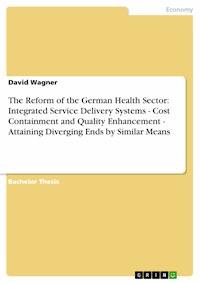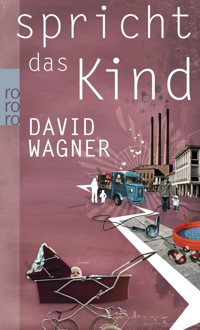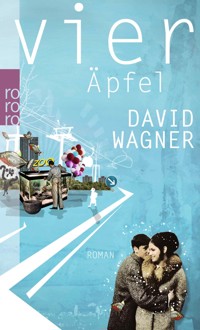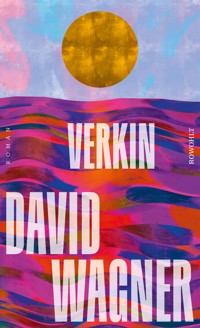
24,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach seinen beiden großen Büchern Leben und Der vergessliche Riese begibt David Wagner sich in seinem neuen Roman auf ein west-östliches Abenteuer, das von Istanbul über drei Kontinente hinweg bis tief in die bewegte Geschichte des 20. Jahrhunderts führt. Verkin ist um die siebzig, Türkin und Armenierin, Kosmopolitin, Unternehmerin, Politikerin. David ist Mitte vierzig, ein Schriftsteller aus Berlin, aufgewachsen am Rhein. Die beiden spazieren durch Istanbul, reisen quer durch Anatolien, an die lykische Küste, zum Vansee nahe der iranischen Grenze. Verkin erzählt von ihrer Kindheit am Bosporus, von ihren Großmüttern, die 1915 den Genozid überlebten. Vom Vater, der den größten Elektrokonzern der Türkei aufbaute. Von Schweizer Internatsjahren, Paris 1968 und lukrativen DDR-Geschäften im geteilten Berlin. Von berühmten New Yorker Künstlerkreisen in den Siebzigerjahren, von ihren Ehemännern, darunter ein Deutscher. Von einem Unfall, der sie auf eine zehn Jahre dauernde Odyssee schickte. Von ihrem Kampf für die armenische Sache und ihrer politischen Arbeit in der AKP. Von einem Land, von einem Leben voller Widersprüche. Verkin ist eine faszinierende Spurensuche zwischen Orient und Okzident, eine Erzählung über das Erzählen und ein Roman über eine große, ungewöhnliche Freundschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
David Wagner
Verkin
Roman
Über dieses Buch
David Wagners neuer Roman ist ein Abenteuer, das vom Bosporus durch die Türkei und über drei Kontinente führt, eine Spurensuche zwischen Orient und Okzident, tief hinein ins bewegte 20. Jahrhundert. Es ist die Geschichte einer besonderen Freundschaft und einer außergewöhnlichen Frau.
Eine Katze vom anatolischen Vansee, das eine Auge blau, das andere braun, wird nach Berlin gebracht. Auf einem für sie organisierten Willkommensfest lernt der Erzähler dieses Romans die Überbringerin kennen und fragt sich: Wer ist diese türkisch-armenische Frau namens Verkin, die in ihrem metallisch glitzernden Kleid wie eine Raumfahrerin wirkt?
Wenig später reist er nach Istanbul, um an einem neuen Buch zu schreiben, im Gepäck deutsche Wurstwaren, die er Verkin als Dank für die Katze mitbringen soll. Kaum angekommen, wird er schon verführt: von den Geschichten aus ihrem geradezu märchenhaften Leben.
Gemeinsam fahren die beiden durch die Stadt und über den Bosporus, sie reisen an die lykische Küste, besuchen verfallene Thermalbäder, rollen im Speisewagen durch Anatolien und kommen bis an den Vansee nahe der Grenze zum Iran.
Verkin erzählt von ihrer Kindheit in Istanbul, von ihrer uralten armenischen Familie, von ihrem Vater, der den größten Elektrokonzern der Türkei aufbaute. Von Schweizer Internaten, Paris 1968, lukrativen Geschäften in Ost-Berlin, Künstlerkreisen im New York der siebziger Jahre, von ihren Männern, darunter zwei Deutsche. Von einem fast tödlichen Unfall, der sie auf eine jahrelange Irrfahrt schickte, ihrem Einsatz für das armenische Erbe, dem Kampf gegen das Patriarchat und ihrer politischen Arbeit. Von einem Land, von einem Leben voller Widersprüche.
Vita
DAVID WAGNER, 1971 in Andernach geboren, debütierte 2000 mit dem Roman «Meine nachtblaue Hose». 2009 folgte sein zweiter Roman «Vier Äpfel», der im selben Jahr auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. 2013 wurde ihm für sein Buch «Leben» der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen, 2014 der Best Foreign Novel of the Year Award der Volksrepublik China. Ebenfalls 2014 erhielt er den Kranichsteiner Literaturpreis und war erster Friedrich-Dürrenmatt-Gastprofessor für Weltliteratur an der Universität Bern. 2019 erschien «Der vergessliche Riese», ein Roman über seinen demenzkranken Vater, ausgezeichnet mit dem Bayerischen Buchpreis. 2023 wurden seine gesammelten Berlin-Geschichten «Ich geh’ so gern durch diese Stadt» veröffentlicht. David Wagners Bücher sind in viele Sprachen übersetzt. Er lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Kate Segal
ISBN 978-3-644-00887-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Sage mir, Muse, die Taten der vielgewanderten Frau,
Welche so weit geirrt …
PrologWillkommensfest für eine Katze
Weit im Norden von Istanbul, dort, wo der Bosporus sich bald zum Schwarzen Meer hin öffnet, begann vor einigen Jahren meine seltsame Reise, die mich kreuz und quer durch Istanbul, die Türkei und die vielen Leben einer Armenierin führen sollte, der ich auf einer frühsommerlichen Gartenparty in Berlin zum ersten Mal begegnet war, dem Willkommensfest für eine weiße türkische Vankatze, die sie für eine gemeinsame Bekannte nach Deutschland geschmuggelt hatte.
Verkin stand in einem metallisch glitzernden Paillettenkleid unter einem blühenden Lindenbaum, hielt die Katze im Arm und erinnerte mit ihrem silberfarbenen Haar und den gold-grau gemusterten Stiefeln an eine Raumfahrerin, die im Südwesten von Berlin gelandet war. Die schnee- oder kalkweißen Vankatzen, erzählte sie meiner Freundin und mir, stammten aus dem anatolischen Hochland um den Vansee, aus dem Osten der heutigen Türkei, einer Gegend, die Tausende von Jahren von Armeniern besiedelt gewesen sei, bis diese vor hundert Jahren umgebracht oder vertrieben worden seien. Nur die armenischen Katzen sind geblieben, sagte sie, heute gelten sie als türkisches Kulturgut.
Wir streichelten das weiche Fell der außerirdischen Schönheit und hörten, dass Vankatzen schwimmen könnten und tauchen und Fische fangen, weshalb sie auch Schwimmkatzen genannt würden. Verkin wies uns auf die verschiedenfarbigen Augen der Wunderkatze hin, das eine hellblau wie der Himmel über dem Vansee, das andere braun wie die Erde Persarmeniens, auf der die armenischen Kirchen noch stünden, die meisten von ihnen Ruinen. Und die Katze schaute aus ihren heterochromen Augen, als wollte sie mir etwas sagen.
Acht oder neun Wochen später flog ich nach Istanbul, weil ich ein Buch über den Großen Basar und den türkischen Shopping-Mall-Boom schreiben wollte, fuhr aber bald nach meiner Ankunft in Beyoğlu zu Verkin nach Tarabya hinaus, ich hatte den Auftrag, ihr als Dank für die nach Berlin geschmuggelte Katze einen Stoffbeutel voller deutscher Wurstwaren zu überbringen. Ich war der Wurstbote, der sie in dem ehemals griechischen Fischerdorf besuchte und nicht ahnte, dass er bereits in den Roman geraten war, den er viel später würde schreiben müssen.
1Tarabya
Der freundliche Gendarmenhund / Deutsche Wurstwaren / Blau über Grün / Gruppenbild im Bademantel
Ein Hund bellt hinter der Mauer, die das frühmoderne, über dem Bosporus schwebende Haus und den steil abfallenden Hang zur Straße hin abschirmt. Das Tor öffnet sich wie von selbst, und ich denke, es muss ein großer Hund sein, da springt mir schon ein schwarzbrauner Dobermann entgegen und beschnuppert mich und die Tasche über meiner Schulter.
Báron!, höre ich es rufen. Báron!
Verkin steht in einem schlichten schwarzen Kleid und silberfarbenen Sandaletten im einige Meter entfernten Eingang. Sie hält eine dunkle Sonnenbrille in der Hand und sieht aus, als hätte sie gleich einen Auftritt im Fernsehen.
Mein dekadenter Gendarmenhund scheint dich zu mögen, sagt sie. Báron leckt meine Hand. Sein Fell glänzt und hat einen rostroten Streifen.
Er riecht die Geschenke für die Katzenschmugglerin, sage ich und spaziere mit dem freundlichen Zerberus an blühenden Rosenstöcken und einem kaum wahrnehmbar plätschernden Marmorbrunnen vorbei auf die von abstraktem Schnitzwerk umgebene Haustür zu.
Nein, nein, er riecht, dass du Deutscher bist, sagt Verkin.
Es dauert, bis ich verstehe, dass sie Deutsch gesprochen hat, fehlerlos und akzentfrei, aber da stellt sie mir schon, nun auf Englisch, ihre Assistentin Nevin vor, eine elegante, ebenfalls schwarz gekleidete Frau mit grauen Locken, die mich auf Türkisch begrüßt und ins Haus hineinbittet. Ich antworte ihr mit den drei Worten, die ich in ihrer Sprache sagen kann, und bemerke, dass sie und ich ähnliche Hornbrillen tragen.
Sie verschwindet in den Tiefen des Hauses, während Verkin mich und den Hund durch eine marmorgeflieste Vorhalle und einen gewölbten Durchgang in einen Saal mit über Eck umlaufender Fensterfront führt. Wir stehen nun hoch über dem Bosporus, und ich sehe nur tiefblau bewegtes Wasser und viel hellblauen Himmel zwischen Europa und Asien. Und sage erst mal nichts. Ich sage nichts, weil ich nichts sagen kann, ich falle in die Aussicht, ich fliege, ich segele über der Wasseroberfläche bis ins Schwarze Meer, es glitzert so unglaublich blau, grün, grau, türkis, silberfarben und wieder blau.
Verkin scheint den Moment meiner Sprachlosigkeit zu genießen. Als Báron an den Stoffbeutel stößt, fasse ich mich und frage, seit wann ihr Haus über dieser Aussicht schwebe.
Sie erzählt, dass ihr Vater das Gelände Ende der vierziger Jahre gekauft habe, den halben Berg einschließlich der Ufergrundstücke, ein großes Areal, das zuvor der Familie des ägyptischen Königs Faruk gehört hätte.
Ich streichle über Bárons großen Kopf und seine kupierten Ohren, er lässt es sich gefallen.
Niemand wollte hier bauen, fährt sie fort, aber meinen Vater, er hatte immer ein Gespür für gute Geschäfte, schreckte das nicht ab. Er ließ den Hang parzellieren, legte die steile Straße an und betonierte dieses und ein weiteres Haus ein kleines Stück weiter oben erdbebensicher in die Felsen.
Ich sehe ein riesiges, mit Hunderten, nein Tausenden bunten Containern beladenes Schiff, es fährt auf uns zu.
Zu osmanischer Zeit hatten die Botschafter der europäischen Großmächte ihre Sommerresidenzen in dieser Gegend, sagt Verkin. In Büyükdere, einmal quer über die Bucht – sie zeigt auf das gegenüberliegende Ufer –, siehst du die der Russen. Die deutsche Sommerresidenz liegt ein Stück in die andere Richtung, sie ist die größte, schönste und gepflegteste von allen. Die Yalılar der Franzosen und Briten sind abgebrannt und nicht wieder aufgebaut worden. In einem von Pierre Lotis Büchern kannst du nachlesen, wie die Botschaften zu Sommerbeginn mit Sack und Pack und allem Personal auf Booten nach Therapiá, heute Tarabya, gerudert wurden, weil es in Péra, jetzt Beyoğlu, ohne Klimaanlagen viel zu heiß war.
Und dahinten, frage ich und deute auf die zwei Pylone, die in einiger Entfernung aufragen, auf jeder Uferseite einer, soll das die dritte Brücke über den Bosporus werden?
Die Tragseile hängen, nur die Fahrbahn fehlt noch, antwortet Verkin. Die dritte Brücke wird den neuen Flughafen anbinden und die bisher vernachlässigte Schwarzmeerküste erschließen.
Er soll der größte Flughafen der Welt werden, habe ich gelesen.
Mindestens, sagt Verkin. Und eines Tages wird er Recep-Tayyip-Erdoğan-Havalimanı heißen.
Noch keine fünf Minuten da, und schon ist sein Name gefallen, denke ich, drehe mich zum Zimmer um und sehe einen antiken, mit Intarsien verzierten Spieltisch, zwei Ledersofas, geschnitzte Beistelltische, auf denen sich Bücher und Bildbände stapeln. Ich sehe einen Flachbildfernseher, einige abstrakte Ölgemälde,blau-graue und orange-blaue Farbfeldmalerei, vermutlich amerikanisch. Ich sehe ein angeschlagenes Metallobjekt, das an ein antikes Bidet erinnert, zwei Teppiche mit eingeknüpften Kampfhubschrauber- und Panzermotiven, wahrscheinlich aus Afghanistan, und über dem reich verzierten Marmorkamin Verkin, den Hund und mich selbst in einem großen Spiegel mit geschnitztem Rahmen, der dem Ornament um die Tür ähnelt, durch die ich eben eingetreten bin.
Verkin erzählt, dass sie mit Unterbrechungen seit früher Kindheit in diesem Haus wohne, es die ersten Jahre für ihre Eltern aber nur ein Sommerhaus gewesen sei, die Stadt, die Altstadt und Beyoğlu, waren damals noch weit weg, sagt sie, es gab keine Autobahn, keine Metro und unten am Wasser nur eine schmale, staubige Straße.
Ein weiteres Gemälde fällt mir auf, das Porträt einer Frau, die an eine Stummfilmschauspielerin erinnert, ich vermute, es wurde in den zwanziger Jahren gemalt. Daneben hängt eine gerahmte Farbfotografie, auf der Verkin und Papst Benedikt XVI. einander die Hand geben, zwischen ihnen ein beeindruckender Bart, der einem orthodoxen Geistlichen in dunklem Ornat gehört.
Verkin bemerkt, dass ich die Fotografie betrachte, und erklärt, dass sie für einige Jahre die Beraterin des armenisch-apostolischen Patriarchen von Konstantinopel gewesen sei. Er war ein guter Freund, sagt sie, das Foto ist kurz nach Ratzingers Wahl zum Papst entstanden. Eine seiner ersten Reisen führte ihn gleich zum Antrittsbesuch nach Istanbul, wir haben uns angeregt unterhalten.
Ich öffne den Stoffbeutel und präsentiere die Bio-Wurstspezialitäten aus deutschen Landen, Leberwurst Pfälzer Art, Hausmacher Leberwurst, Mettwurst und Blutwürste vom Blutwurst-Weltmeister aus Berlin-Neukölln.
Verkin gibt Freudenlaute von sich, ich weiß nicht, in welcher Sprache.
Wir verlassen die Kommandobrücke über dem Bosporus, betreten einen fensterlosen, mehrfach verwinkelten und ebenfalls marmorgefliesten Gang und kommen an geschlossenen Türen und einer Galerie großformatiger, gerahmter Schwarz-Weiß-Fotos vorbei. Auf einem von ihnen erkenne ich eine vielleicht fünfzehnjährige Verkin, auf einem anderen ist sie als Kind mit geflochtenen Zöpfen zu sehen. Báron, der große Grubenhund, ist an meiner Seite, seine Pfoten tapsen über den Stein, und ich habe das Gefühl, als würde ich in den Berg unter dem Haus hineinwandern – dann aber öffnet Verkin eine Tür, und wir betreten eine nicht allzu große Küche, in der zwei Frauen am Herd beschäftigt sind. Eine dritte, ältere Frau mit Kopftuch sitzt an einem kleinen Tisch, der vor ein Fenster zum Garten gerückt ist. Sie grüßt, Verkin sagt etwas, das ich nicht verstehe, und ich grüße zurück, schließlich gelangen wir durch eine weitere Tür in einen gläsernen Anbau, eine Art Sommerküche mit Kamin und einem größeren runden Tisch, auf dem eine mit Rosenmotiven bestickte Spitzentischdecke liegt. Kleine taillierte und bereits gefüllte Teegläser stehen auf einem Tablett, daneben eine puderzuckerbestäubte, mit dem typischen Teiggitter verzierte Linzer Torte. Draußen auf der Terrasse, die halb in den grünen Steilhang gegraben worden sein muss und halb auf Stelzen über dem Abgrund ruht, befinden sich fünf, nein sechs Personen. Drei von ihnen stecken in flauschig-weißen Bademänteln, zwei Frauen tragen aus Handtüchern geschlungene Turbane, eine dritte Frau trägt ein großes Pflaster im Gesicht, eine vierte Hijab. Hinter ihnen blühen Lilien, ich sehe Pflaumenbäume, eine Palme, Pinien und Feigenbäume und erfahre von Verkin, dass heute Badetag ist, die Gäste besuchen ihr Hamam.
Die Frau mit dem Kopfverband ist meine Malerfreundin Susan, sagt sie, sie hat sich hier in Istanbul gerade ihr Gesicht liften lassen. Susan war mal meine Nachbarin in New York, wir kennen uns seit 1979. Die Schönheit neben ihr heißt Sevgi und ist die Tochter meines plastic surgeon, sie managt seine Klinik, sag mir, wenn du etwas verändern möchtest, Augenlider, Nase, Kinn, Sevgi kann dir helfen. Die Frau mit Hijab ist meine älteste Parteifreundin, wir haben uns als freiwillige Helferinnen beim ersten Wahlkampf der AKP kennengelernt, heute arbeitet sie für den Innenminister. Ihr gegenüber sitzt meine Anwältin, und der drahtige Mann mit dem Joint in der Hand heißt Tarek und ist ein Ex-Ehemann. Sein Großvater war ein berühmter Imam, sein Großonkel ein Held in der Schlacht von Galipoli, und sein Ururururgroßvater kam 1453 mit Mehmed dem Eroberer nach Konstantinopel. Er stammt also von einem Neuankömmling ab, wir Armenier und meine Familie leben schon tausend Jahre länger am Bosporus.
Sie lacht über ihre kleine Übertreibung, die vielleicht gar keine ist, und sagt, ich solle mir ein Glas Tee vom Tablett nehmen.
Tarek sei heute Heiler und Biobauer, berichtet Verkin, er bewirtschafte ihre kleine Farm am Schwarzen Meer, praktiziere Akupunktur und sei auch als Chiropraktiker gefragt.
Falls dir etwas wehtut oder fehlt, könnte er dir Nadeln setzen oder dich schröpfen, er hat gerade eine Lieferung frischer, hungriger Blutegel aus Sivas bekommen.
Klingt verlockend, sage ich, vielleicht ein anderes Mal.
Nevin ist wiederaufgetaucht und nimmt Verkin die Tasche mit den Wurstwaren ab, gibt sie an eine der Frauen in der Hauptküche weiter und reicht mir einen Teller mit einem Stück Linzer Torte.
Wir treten hinaus ins große Blau über dem satten Gartengrün, Verkin stellt mich dem Gruppenbild am Marmortisch vor, und ich erzähle, dass ich ein Buch über Istanbuler Shopping Malls schreiben möchte.
Ob ich denn gerne einkaufe, werde ich gefragt.
Nein, sage ich, eigentlich nicht.
Nach zwei oder drei Gläsern Tee, bei denen ich viel über Schönheitsoperationen, Vankatzen, die anstehende Wahl, New Yorker Lofts und das Schröpfen mit Blutegeln erfahre, verabschiede ich mich wieder, frage aber vorher noch nach dem Buch von Pierre Loti, in dem Tarabya beschrieben sein soll.
Es ist nicht das mit der schwülstig-orientalistischen Liebesgeschichte, sagt Verkin, sondern ein anderes, späteres, in dem der Autor einen Schriftsteller um 1900 nach Istanbul zurückkehren lässt, um über zwei im Harem eingesperrte osmanische Schwestern zu schreiben, es heißt, es heißt …
Meinst du Les Désenchantées? Ich habe den Roman auf meinem Telefon gefunden, der deutsche Titel lautet Die Entzauberten. Ich kann ihn gleich herunterladen.
2Bosporus
Türkische Gesänge / Verkin ist eine kara kartallar / Mein Vater hätte Huber Kösku kaufen können / Schwimmen im Bosporus / Die Hochzeit in Çankaya / Die Männer meiner Großmutter
Einige Tage später sitze ich neben Verkin im Auto. Sie fährt selbst, weil Nevin, sonst ihre Chauffeurin, in Verkins Stadt- und Geschäftshaus Suma Han geblieben ist, das wir eben gemeinsam besichtigt haben. Verkin steuert durch Karaköy und telefoniert, rechts fließt der Bosporus, links rollt die Straßenbahn. Verkin spricht Türkisch in ihr Telefon, nein, sie singt, denke ich, und dass ich keine Ahnung hatte, wie melodisch, harmonisch und schön Türkisch klingen kann. Die Freisprechanlage nutzt Verkin nicht, sie hat nur eine Hand am Lenkrad.
Schau, Dolmabahçe Palast, von einem Armenier erbaut, unterbricht sie ihren Gesang und erzählt mir, nun auf Deutsch, dass fast alle Architekten, die im Osmanischen Reich irgendetwas von Belang und Bedeutung erbaut hätten, Armenier gewesen seien.
Das habe ich schon mal gehört, denke ich, wahrscheinlich von einer Armenierin oder einem Armenier.
Hinter Kabataş unterbricht Verkin ihr Telefonat erneut, zeigt zum schwarz-weiß beflaggten Stadion am Fuß des Abhangs und verrät mir, dass sie eine kara kartallar sei, ein schwarzer Adler, Anhängerin des Fußballclubs Beşiktaş.
Mir fällt auf, dass ich die Strecke schon zu Fuß gegangen bin, ein Stück unter großen alten Platanen und an der rückwärtigen Mauer des Dolmabahçe Sarayı entlang.Wo die Bebauung den Blick nicht versperrt, sind die Schiffe auf dem Bosporus nun auch aus dem Auto zu sehen, das Wasser, durch das sie sich bewegen, hat die Farbe feuchter Tinte. Ich glaube, eine Fähre und ein Tankschiff kommen schneller voran als wir.
Eigentlich ist es Blödsinn, die Straße am Ufer zu nehmen, sagt Verkin, ihr Telefon hat sie in das Fach unterhalb der Mittelkonsole gelegt. Nevin hätte es nie erlaubt, wir stehen hier nur aus szenischen Gründen im Stau. Damit du siehst, wie schön der Bosporus ist. Und seine Dörfer, die keine mehr sind.
Ihr Telefon klingelt erneut, und der Gesang hebt wieder an, neue Strophen erklingen, und ich frage mich, was und wovon Verkin da eigentlich erzählt.
Stau in Ortaköy, Stau unter der ersten Brücke, die Europa mit Asien verbindet, Stau in Arnavutköy, dann aber rollen wir durch Bebek, und Verkin berichtet mir von der Arbeit ihrer Stiftung, der es vor einigen Jahren gegen große Widerstände gelang, armenische Altertümer, sprich Ruinen, im Osten der Türkei zu renovieren, darunter auch die berühmte Kirche zum Heiligen Kreuz auf der Insel Aghtamar im Vansee, dem See, an dem die schneeweißen Schwimmkatzen zu Hause sind.
Neben uns fließt das Wasser vom Schwarzen Meer Richtung Marmara, es kommt uns entgegen. Wir bewegen uns also gegen die Strömung, sage ich, lerne dann aber, dass es im Bosporus neben der sichtbaren Strömung an der Oberfläche auch eine Unterströmung in die entgegengesetzte Richtung gibt, eine zum Schwarzen Meer, und dass diese schon in der Antike von Booten mit Treibankern genutzt wurde, die sich mit ihrer Hilfe gegen die sichtbare Strömung Richtung Schwarzes Meer schieben ließen, der Bosporus ein Förderband.
Nicht weit hinter Emirgan, wir sind schon unter der zweiten Bosporusbrücke hindurchgefahren, macht die Straße eine weite Kurve nach links und führt in die Bucht von İstinye. Den Berg hinauf, das weiß ich von meinen Erkundungen, liegt İstinye Park, eine der größten Shopping Malls Europas. Rechts legt eine Autofähre an. Es geht hinauf und wieder hinunter, und wir rollen nach Yeneköy hinein, hohe Platanen stehen Spalier, ich sehe die Niederlassung eines Luxusautohändlers, Restaurants, ein Café neben dem anderen, Tische auf den Bürgersteigen und einen etwa dreizehnjährigen, in Lumpen gekleideten Jungen, der einen meterhoch mit flach gelegten Pappkartons beladenen Handkarren an frisch polierten SUVs vorbeizieht. Verkin weist auf die Bebauung rechts der Straße und sagt, dass die meisten der schönen alten Häuser am Ufer, in denen heute viele türkische Telenovelas gedreht würden, einst Griechen oder Armeniern gehört hätten. Wieder eine weite Kurve, wieder eine Bucht, wieder der Blick auf die Berge am gegenüberliegenden Ufer, und ich sage, es sehe hier aus wie in meiner Kindheit am Mittelrhein, kurz vor Bad Godesberg, mir fehlt nur der Drachenfels auf der asiatischen Seite. Verkin lacht und sagt, Römer sind wir dort wie hier.
Das Gefühl, die Fahrbahn könnte nach einer Kurve ins Wasser führen, kenne ich ebenfalls, sage ich und erzähle Verkin von der Landschaft, in der ich aufgewachsen bin, in der die Berge am Ufer nicht ganz so hoch und die Schiffe im Strom deutlich kleiner sind.
Wir fahren eine weitere sanfte Kurve – Steuerleute müssen während der Bosporuspassage achtunddreißigmal den Kurs ändern –, und vor uns taucht ein riesiger cremefarben gestrichener Holzpalast auf, ein Schützenpanzer steht davor, mindestens vier türkische Flaggen wehen von Fahnenstangen vor, über und neben dem Gebäude.
Was ist das denn?, frage ich.
Huber Köşkü, sagt Verkin, die Residenz des Präsidenten der Türkischen Republik in Istanbul. Seinen Namen hat das Hausvon den Gebrüdern Huber, deutschen Waffenhändlern, die dem Osmanischen Reich Gewehre und Kanonen verkauften, und zwar die guten von Krupp. Sie dürften nicht schlecht verdient haben, wie du siehst.
Steht der Panzer deshalb da? Weil dort Waffenhändler wohnen?
Nein, heute bewachen die Soldaten die Anlage, weil er sich ab und zu dort aufhält.
Er?
Na er, der reis. Der Kapitän. Huber Kösku und der Komplex auf dem Berg, den wir von hier nicht sehen können, ist seine Residenz in Istanbul.
Das Sommerschloss deutscher Waffenhändler als Palast des türkischen Präsidenten? Das ist eine Pointe. Das Ding sieht aus, als wäre es essbar. Wie eine überdekorierte Torte. Wie ein Millefeuille aus Holz.
Mein Vater hätte Huber Köşkü einmal kaufen können, sagt Verkin. Die ägyptisch-koptischen Nonnen, denen der Palast nach den deutschen Waffenhändlern gehörte, boten ihm das Areal samt allen Gebäuden – damals in einem desolaten Zustand – sehr günstig an. Sie beknieten ihn geradezu, es zu übernehmen, sie wollten es meinem Vater quasi schenken, weil sie wussten, er verfügte über die Mittel, es zu renovieren.
Und, hat er es sich schenken lassen?
Nein, mein Vater war viel zu klug, sich mit einem so auffälligen Objekt zu exponieren. Er wusste, dass man ihm eine solche Liegenschaft eines Tages nur wieder wegnehmen würde. Und so ist es gekommen, derjenige, der den Palast übernommen und saniert hat, musste ihn hergeben, als die Republik einen repräsentativen Sitz für ihren Präsidenten in Istanbul suchte.
Es wirkt wie frisch gestrichen, dieses Schloss aus Holz.
Yalılar müssen ständig gestrichen werden, jedes Jahr, wie Schiffe. Ihr Unterhalt ist teuer, die meisten Familien können sie sich nur eine Generation lang leisten.
Verkin setzt den Blinker, bremst etwas abrupt und lenkt ihren BMW auf den Parkplatz eines Cafés direkt am Bosporus.
Wir setzen uns in ein halb offenes Zelt am Wasser, außer uns sind kaum Gäste da. Ein Kellner kommt aus dem benachbarten Flachbau zu uns an den Tisch, wir bestellen Tee und schauen auf die Schiffe, die dicht vor uns vorbeifahren, wieder ein Tanker, eine Fähre und ein kleinerer Stückgutfrachter, der ohne die Begleitung eines Lotsenbootes Richtung Schwarzes Meer fahren darf.
Siehst du den Kasten dort? Verkin zeigt auf ein etwa zweihundert Meter entferntes Gebäude, das über dem Bosporus zu schweben scheint. Heute befindet sich dort ein Kettenrestaurant, in meiner Kindheit war da eine Badeanstalt mit Sprungtürmen, einer Bar und weiß lackierten Badehütten zwischen den Felsen. Als Kind bin ich vor unserem Haus in den Bosporus gesprungen und habe mich von der Strömung dorthin treiben lassen. Und mir den Eintritt gespart.
Du hättest ihn dir aber doch leisten können, oder?
Es ging mir darum, nicht zu bezahlen, sagt Verkin. Ich fand es absurd, Eintritt für Felsen und Wasser zu verlangen.
Meine Mutter ist als Kind, kurz nach dem Krieg, im Rhein geschwommen. Ich vermute, sie hat im Rhein schwimmen gelernt. Sie ist ein Stück flussaufwärts gewandert, von einer Buhne ins Wasser gesprungen und mit der Strömung nach Hause geschwommen. In meiner eigenen Kindheit war das unvorstellbar, der Fluss war viel zu verschmutzt.
Wie lang ist deine Mutter tot?, fragt Verkin dann, was mich überrascht, denn ich erinnere mich nicht, ihr von meiner Mutter erzählt zu haben.
Woher weißt du, dass sie nicht mehr lebt?
Das sehe ich dir an, sagt Verkin.
Ich möchte ihr das vielleicht sogar glauben, bin mir aber nicht sicher, ob ich den frühen Tod meiner Mutter nicht vielleicht doch schon erwähnt habe. Tatsächlich, sage ich, ist sie so lange tot, dass ich mich kaum an sie erinnern kann. Ich war zwölf, als sie gestorben ist. Und oft kommt es mir vor, als wäre ich seither nicht einen Tag älter geworden.
Ich will dich nicht verunsichern, mein Lieber, aber wie zwölf siehst du nicht mehr aus. Vielleicht solltest du an ein Lifting denken. Für Botox ist es leider zu spät.
Der Kellner – wie in fast allen Istanbuler Cafés oder Restaurants, die ich bisher besucht habe, ein Mann, weibliche Servicekräfte sind selten zu sehen – bringt uns Tee, und Verkin erzählt, dass der vorherige Besitzer dieses Lokals vor langer Zeit einmal Erdoğans Chauffeur gewesen sei. Damals, als der noch Bürgermeister von Istanbul war. Eine Verbindung, die sicherlich geholfen hat, diesen umsatzstarken Ort zu übernehmen.
Ein Kreuzfahrtschiff, viel zu groß und viel zu hoch, schleicht von gleich zwei Lotsenbooten begleitet vorbei. Erdoğans ehemaliger Chauffeur habe sich später, so Verkin, ins organisierte Verbrechen verstrickt und mit seinen vier Frauen verzettelt, er sei in Russland gestorben, und zwar nicht eines natürlichen Todes.
Das unproportionierte Kreuzfahrtschiff könnte umfallen, denke ich, umfallen und durchkentern. Oder im Bosporus stecken bleiben. Es bewegt sich langsam Richtung Schwarzes Meer.
Mir fällt auf, dass das gegenüberliegende asiatische Ufer fast unbebaut ist, die bewaldeten Berge wirken unberührt und schimmern in diversen Grünschattierungen. Verkin verrät, dass dieser Abschnitt der Marine gehört, die türkischen Streitkräfte seien die heimlichen Großgrundbesitzer im Lande und putschten alle paar Jahre, und im verblauten Dunst kann ich nun einige ankernde Kriegsschiffe ausmachen, trotz ihres seegrauen Tarnanstrichs.
An unserem Ufer, ein Stück vor dem Kettenrestaurant auf den Felsen, zwischen denen sich mal eine Badeanstalt befunden hat, wie ich jetzt weiß, springen zwei Jungen von der Promenade ins Wasser, zwei weitere hüpfen jauchzend hinterher, es spritzt, sie lachen, sie planschen und freuen sich wie junge Hunde.
Meine Großmutter ist auch gern in den Bosporus gesprungen, sagt Verkin. Vor hundert Jahren sorgte das jedes Mal für einen kleinen Volksauflauf, die Menschen blieben stehen und wollten nicht glauben, dass eine Frau schwimmen kann.
Die Jungs lassen sich einige Meter mit der Strömung treiben, klettern über eine Leiter zurück auf die Promenade und springen erneut hinein, wieder mit Anlauf.
Deine Großmutter muss eine bemerkenswerte Frau gewesen sein, sage ich.
Meine beiden Großmütter waren bemerkenswerte Frauen, sagt Verkin, ich denke oft an sie.
Waren beide Armenierinnen?
Durch und durch, de soucheet jusqu’au bout des ongles, und mit Familiengeschichten, die sich über tausend Jahre zurückverfolgen lassen, sagt Verkin. Die Mutter meines Vaters hieß Verkin, ich bin nach ihr benannt, und war die mittlere von drei Töchtern eines armenischen Serafs, eines Bankiers und Goldhändlers, der seine Geschäfte aus einem großen Haus in Péra führte, in dem die Familie auch wohnte. Er starb unerwartet und sehr überraschend im Jahr 1897 unter derart seltsamen Umständen, dass der Verdacht aufkam, er könnte von einem seiner Schuldner vergiftet worden sein, einem seiner türkischen Schuldner, die ihm große, teils immense Summen schuldeten – was allerdings nie aufgeklärt werden konnte. Meine Urgroßmutter saß plötzlich ohne Geld und mit drei unverheirateten, minderjährigen Töchtern in dem riesigen Haus in der Grande rue de Péra, die heute İstiklal Cadessi heißt, denn die feinen Geschäftsfreunde meines Urgroßvaters und seine säumigen Schuldner zahlten nicht, weil sie glaubten, an eine Frau nicht zurückzahlen zu müssen. Ein Armenier aus Smyrna, jetzt İzmir, gab vor, die älteste Tochter heiraten zu wollen, und entpuppte sich als Schwindler, der sich mit dem letzten Geld davonmachte. Meine Urgroßmutter begann, ihren Schmuck zu verkaufen, es sah nicht gut aus für die kluge, hübsche, blonde vierzehnjährige, vielleicht auch sechzehnjährige Verkin mit den blaugrünen Augen, ihre Aussichten, standesgemäß verheiratet zu werden, waren weiter gesunken – dann aber, ein Wunder, flatterte ein Heiratsantrag aus Angora ins Haus, dem heutigen Ankara, ein Heiratsantrag aus dem Hause Kasapian, der berühmten armenischen Gold-, Schmuck- und Wollhändlerdynastie, die seit dem frühen sechzehnten Jahrhundert die Fell- und Wollfilzmützen-Fabrikation für die osmanische Armee besorgten. Einer der Söhne des Hauses sollte Verkin heiraten, Bilder wurden getauscht, alles wurde abgemacht und vertraglich geregelt, meine Urgroßmutter verkaufte noch mehr Schmuck, sodass die Braut, meine Großmutter, die ihr wahres Alter nie verraten hat, mit einer bescheidenen Aussteuer von Konstantinopel nach Angora reisen konnte, damals eine kleine Weltreise. Sie kam in den Çankaya-Palast,den die Kasapians seit dreihundert Jahren bewohnten, sie sah ihren schönen Verlobten – und erfuhr am Tag der Hochzeit, unmittelbar vor der kirchlichen Zeremonie, dass sie nicht, wie gedacht und vereinbart, den schönen Ohannes, sondern seinen älteren, an Syphilis erkrankten Bruder Rokos heiraten sollte, das Faktotum der Familie. Sie war allein in einer fremden Stadt bei einer ihr fremden Familie, sie konnte nicht weglaufen und nicht zurück nach Istanbul, sie war verkauft worden. Sie heiratete also, was blieb ihr übrig, sie war noch ein Kind, das Faktotum Rokos, dem die ganze Affäre, die seine Eltern sich ausgedacht hatten, anscheinend selbst unangenehm war, ja, es stellte sich heraus, dass der Mann, mit dem sie nun verheiratet war, kein Idiot, kein Arschloch war, wie so viele armenische Männer, die beiden arrangierten sich und begannen, in derselben Villa, die fünfundzwanzig Jahre später Atatürk bewohnen sollte, eine Art Josefsehe zu führen, bis meine Großmutter eines Tages verschwand. Ob sie als Mann verkleidet an den Vansee und weiter bis nach Isfahan reiste, wie sie hin und wieder behauptet hat? Ich weiß es nicht. Sicher ist nur, dass sie eines Tages, im Jahr 1902, hochschwanger in Istanbul auftauchte und einige Wochen später mein Vater geboren wurde. Meine Großmutter hat nie verraten, wer der Vater meines Vaters war, und ich habe es nicht herausfinden können, trotz all der Nachforschungen, die ich angestellt habe. Vielleicht war mein Vater ein Kind ihres Schwagers, also des Kasapians, den sie eigentlich zu heiraten glaubte? Sie sollen verliebt gewesen sein, oder aber, so würde es realistischer und weniger romantisch klingen, sie wurde bloß vergewaltigt, von ihm oder irgendeinem anderen Armenier, mit Sicherheit lässt es sich nicht herausfinden, weil der schöne Ohannes und ein großer Teil der Familie 1915 umgebracht wurden, wie so viele anatolische Armenier. Nur Rokos, der meiner Großmutter nach Istanbul gefolgt war, sowie zwei Schwestern, die ebenfalls nach Istanbul gezogen waren, überlebten. In Istanbul bekam meine Großmutter vier weitere Kinder, und zwar jedes von einem anderen Mann, sie war, was das Kinderkriegen anging, eine moderne, selbstständig handelnde Frau. Ich selbst habe nur je ein Kind von zwei Männern geschafft, und die waren beste Freunde. Die Erzeuger der vier Geschwister meines Vaters habe ich alle ausfindig machen können, es gab einen armenischen Pelzhändler, einen armenischen Priester, der an der Schule unterrichtete, die mein Vater als Kind besucht hat, einen armenischen Zahnarzt und einen Seidenhändler, ebenfalls Armenier. Nur die Identität meines Vaters blieb das bittere oder süße, ich weiß es nicht, Geheimnis meiner Großmutter, das sie bis zu ihrem Tod nicht gelüftet hat. Und auch danach tauchten keine Hinweise auf, kein geheimes Tagebuch, keine Briefe, nichts, was auf meinen Großvater väterlicherseits hätte hinweisen können.
Wäre sie nicht nach Istanbul zurückgekommen, hätte sie das Jahr 1915 wohl kaum überlebt, oder?
Wahrscheinlich nicht, nein. Nur in Istanbul ist 1915 eher wenig geschehen, aus Rücksicht auf die ausländischen Gesandten in der Stadt. Überall sonst, in allen anatolischen Provinzen und weit im Osten, wo die Vankatzen wohnen, wurden Armenier auf offener Straße abgeschlachtet oder in die Wüste getrieben, um dort zu verdursten.
Wäre das nicht geschehen und wäre deine Großmutter nicht von Ankara zurück nach Istanbul gezogen, hätte sie ihr Leben also in dem Haus zugebracht, das in den zwanziger Jahren Atatürks Wohn- und Dienstsitz wurde. Das ist ja verrückt!
In dem Haus, das bis zur Fertigstellung des neuen Präsidentschaftspalasts in Ankara auch Tayyips Amtssitz gewesen ist.
Und das erzählst du nur einen Steinwurf von der Istanbuler Residenz entfernt, die dein Vater hätte kaufen können.
Willkommen im türkischen Surrealismus, mon cher.
Ein etwa siebenjähriges Mädchen in einem löchrigen, ausgewaschenen bunten T-Shirt tritt an unseren Tisch heran, Verkin versteht sofort, dass es sich um ein syrisches Flüchtlingskind handelt und steckt ihm einige Scheine zu, schnell und diskret, sie hat Übung.
Die Kellner in diesem Café sind barmherzig, sagt sie, sie erlauben den syrischen Kindern, hier zu betteln. Anderswo sind sie nicht so nett.
Wie viele aus Syrien Geflüchtete gibt es in der Türkei?, frage ich.
Vier oder fünf Millionen? Niemand weiß es genau. Anderthalb Millionen oder mehr allein in Istanbul. Und wenn ihr Deutschen nicht brav zahlt, lassen wir sie nach Europa spazieren, die syrischen Flüchtlinge sind unsere zweite Armee.
Ich schaue dem Mädchen hinterher, auch an einigen anderen Tischen erhält sie ein Almosen, dann sehe ich sie im steten Strom der sonnenbebrillt telefonierenden türkischen Powerwalkerinnen in Lauftights und leuchtenden Sneakers verschwinden. Einige der Walkerinnen tragen Kopftuch, fällt mir auf, und boxen bei jedem Schritt mit überaktiven Armbewegungen in die Luft, links rechts, links rechts.
Meine Großmutter ließ sich nichts gefallen, sie ließ sich nicht vertreiben, sie lebte ihr ganzes Leben in Istanbul. Sie schlief, mit wem sie wollte, sie sprang in den Bosporus und steuerte ihre eigene Kutsche, eine Kutsche, die von einem weißen Pferd gezogen wurde – wie heißen die auf Deutsch? Ich müsste es eigentlich wissen, die letzte Schule, die ich besucht habe, war ein deutsches Pferdeinternat.
Schimmel oder Apfelschimmel, sage ich.
Schimmel wie die Klaviere?
Ja, wie die Flügel aus Braunschweig, sage ich.
Vielleicht hing die Selbstermächtigung meiner Großmutter, ihre Kutsche durch Péra und Galata zu lenken, aber auch damit zusammen, dass sie kein Geld für einen Kutscher hatte, sagt Verkin.
In Pierre Lotis Buch lästern die im Harem eingesperrten Osmaninnen über die Armenierinnen aus Péra, die sich freier durch die Stadt bewegen und Dinge unternehmen, von denen sie selbst nur träumen können. Sie nennen sie abfällig Péroten, deine Großmutter müsste in ihren Augen eine Pérote gewesen sein, oder?
Ach, du hast Les Désenchantées schon gelesen, sagt Verkin und schaut auf ihr Telefon, während ich versuche, die Aufmerksamkeit des Kellners zu erlangen, um eine weitere Runde Tee zu bestellen, çay kann ich schon sagen.
Verkin ist weiter mit ihrem Telefon beschäftigt, beantwortet Nachrichten, ruft jemanden zurück – und mir kommt es auf einmal vor, als wäre ich in den Bosporus gefallen, die Strömungen nehmen mich mit, oben in die eine, unten in die andere Richtung, und ich sehe nicht, wo ich ans Ufer klettern, sehe keine Leiter, an der ich aus dem Wasser steigen könnte, ich treibe ab, ich werde fortgetragen, dann aber wache ich auf, nehme mein Telefon in die Hand und versuche, die Bosporuseuphorie zu fotografieren, zum dritten, vierten oder fünften Mal heute. Ich schicke das Foto nach Hause, nach Berlin, und schreibe, dass ich wahrscheinlich länger in Istanbul bleiben muss, es gibt so viele Malls zu besuchen, und dann sei da Verkin, die unglaubliche Geschichten erzähle. Ich habe das Telefon noch in der Hand, da erhalte ich eine Mitteilung, dass Verkin zwei Storys gepostet habe, ich klicke und sehe einen Kameraschwenk über Huber Köskü und den Blick auf den Bosporus vom Hayrola Café aus, dem Ort, an dem wir sitzen. Sieh an, denke ich, selbst sie, die diese Aussicht seit ihrer Kindheit kennt, kann sich der Schönheit dieser Ufer nicht entziehen und muss sie wieder und wieder aufnehmen. Verkin telefoniert noch, weshalb ich Wikipedia-Einträge über die Çankaya-Villa in Ankara suche, der deutsche ist ausführlicher als der englische, aber in beiden finde ich Verkins Familiennamen. Als sie ihr Telefonat beendet hat, lese ich ihr vor: Bis zum Völkermord an den Armeniern 1915 lag um die Çankaya-Villa ein Weinbaugebiet, das dem armenischen Juwelier und Wollhändler Ohannes Kasapian gehörte. Nachdem die Überlebenden der Kasapian-Familie aus Ankara geflüchtet waren, konfiszierte der osmanische Staat das Haus und übergab es der Bulgurluzâde-Familie.
Interessant und nicht ganz und gar falsch, sagt Verkin. Wer hat das geschrieben?
Das ließe sich herausfinden, antworte ich und frage, ob ich das mit dem Völkermord in der Türkei überhaupt zitieren dürfe. Ob mir nun nicht eine Gefängnisstrafe drohe.
Mir gegenüber darfst du alles zitieren, sagt sie. Und solange wir befreundet bleiben und du keine ganz große Dummheit begehst, wirst du nicht verhaftet, ich habe einen Draht zum Innenminister.
Oh, jetzt fühle ich mich gleich viel sicherer, sage ich. Dabei könnte ich, das sage ich Verkin nicht, die Wikipedia-Seite ohne VPN-Trickserei gar nicht aufrufen, Wikipedia ist in der Türkei blockiert, weil dort auch andere Dinge zu lesen sind, die der Regierung nicht gefallen. Weiter heißt es übrigens, sage ich: Mustafa Kemal kaufte das Gebäude 1921 für 4500 türkische Lira von Bulgurluzâde Tevfik Efendi. Klingt, als hätte er verkaufen müssen.
Ironischerweise, sagt Verkin, hatte Atatürk – mein Vater bewunderte und verehrte ihn zeit seines Lebens – ein gutes Verhältnis zu den überlebenden Kasapians und wohnte, das ist fast kurios, während der zwanziger Jahre auch in Istanbul in einem Kasapian-Haus auf der İstiklal Caddesi, das einer meiner Tanten gehörte. Mustafa Kemal Atatürk war ihr Mieter.
Das ist ja verrückt, sage ich.
Und ich heiße dich erneut willkommen im türkischen Surrealismus.
Bist du je in Çankaya gewesen? Hast du die Villa besucht?
Nein, aber eines Tages werde ich es tun, und du kannst mitkommen, wenn du willst. Ich werde Çankaya betreten, und wenn ich dazu Präsidentin der Türkischen Republik werden muss!
Zu den vier Jungs ist ein fünfter hinzugekommen, und alle fünf springen nun gleichzeitig in den Bosporus, Wasser spritzt bis auf die Promenade, zwei Powerwalkerinnen bekommen einige Tropfen ab.
Einer der letzten Liebhaber meiner Großmutter war Eisverkäufer auf der İstiklal, sagt Verkin, der Straße, die für sie ihr Leben lang die Grande rue de Péra geblieben ist. Immer wenn ich an seinem Stand vorbeikam, mit ihr oder allein, bekam ich ein Eis.
Wann ist sie gestorben?, frage ich.
1962. Sie ist auf dem armenischen Friedhof in Şişli begraben, wir können sie gern mal besuchen.
Liegt dein Vater auch dort?
Ja, fast die ganze Familie.
3Şişli
Marmor / Mein Vater bringt das Licht / Die Grabsteinreiniger / Das armenische Schmugglerpärchen / Mein Vater engagiert ein Double / Lucy bewegt sich nicht mehr / Eine Erscheinung
Nevin, Verkin und ich stehen in einem Meer aus Hunderten, nein Tausenden weißer Gräber auf dem armenischen Friedhof von Şişli, und Verkin erzählt von einem Foto ihres Vaters, das wahrscheinlich 1916 aufgenommen wurde.
Er sitzt am Steuer eines offenen Wagens, ein Junge mit hellen Haaren, der nicht sehr armenisch und nicht besonders türkisch aussieht. Er sitzt da, als wollte er ausprobieren, wie es sich anfühlt, das Lenkrad in der Hand zu halten. Und um sich fotografieren zu lassen natürlich. Voller Überlebensentschlossenheit schaut er in die Kamera und scheint zu sagen, jetzt erst recht.
Den Blick kenne ich, sage ich, den hast du auch.
Der Marmorquader glitzert mich an, und ich frage mich, ob die Vor- und Familiennamen aller hier bestatteten Kasapians, Kasapoğlus und Kapmanns vielleicht in einen großen Block aus Eiskristall geschlagen wurden.
Mein Vater war Unternehmer und Überlebenskünstler, sagt Verkin, er ließ sich nicht aus der Stadt vertreiben, in der er zur Welt gekommen war, er blieb. Er überlebte das traurige Jahr 1915, verließ die armenische Priesterschule, weil sie geschlossen wurde, und fand eine Lehrstelle im ersten Elektrizitätswerk von Istanbul, einem Kohlekraftwerk mitten in der Stadt, das seit 1914 Strom für die Tünel-Bahn und den Topkapı-Palast lieferte. Das Foto muss auf dem Gelände der Elektrik Santralı aufgenommen worden sein.
Verkin steht in einem schwarzen T-Shirt, einer knielangen schwarzen Hose, silberfarbenen Sneakers und einer ebenfalls schwarzen Kappe mit dem Logo der New York Yankees vor dem gleißend weißen Grabstein, sein Marmor hat diesen besonderen weichen Schmelz, er scheint von innen zu leuchten.
In der Elektrik Santralı lernte mein Vater, dass Strom überall hinfließen kann, es braucht nur eine Leitung. Mit sechzehn hatte er ein Unternehmen gegründet und half dabei, erst Istanbul und bald die ganze Türkei zu elektrifizieren, er war die New Economy seiner Zeit. Atatürk setzte das Land unter Strom, mein Vater verlegte die Kabel und baute die Stecker, Schalter und Sicherungen ein, die nötig waren, um auch im hintersten Anatolien Glühbirnen leuchten zu lassen, Glühbirnen, die nur mein Vater liefern konnte. Als er achtzehn Jahre alt war, besaß er zwei der etwa dreihundert Autos, die in Istanbul zugelassen waren, und kaufte seiner Mutter ein neues Haus.
Verkin hat ihre Sonnenbrille abgenommen, heute eine mit weißer Fassung. Nevin, auch sie in Schwarz und mit Sonnenbrille, ist um den Grabstein herumgegangen und inspiziert seine Rückseite.
Warum ist hier kein Mensch? Warum sind wir allein auf diesem riesigen Friedhof?, frage ich.
Hier sind doch sehr, sehr viele, schau dich um, sagt Verkin. Sie ruhen in der Erde, unter ihren großen weißen Steinen.
Lebende, meine ich. Lebende und Angehörige.
Es gibt kaum noch Armenier in Istanbul. Und die meisten, die hier liegen, haben keine Angehörigen mehr, zumindest nicht in Istanbul. Der Friedhof gehört einer Stiftung, die ihn pflegt. Im Grunde ist dieser Friedhof ein Museum. Zweitausend Jahre waren wir hier, und nun ist es vorbei, fast alle sind vertrieben, ausgewandert oder umgebracht worden. Oder sie wissen nicht mehr, dass sie Armenier sind. So viele Armenier wie auf diesem Friedhof wirst du nirgendwo in Istanbul finden.
Plötzlich, mir ist nicht klar, woher sie kommen, nähern sich uns zwei Männer in staubiger Arbeitskleidung. Der eine trägt einen aufgerollten Gartenschlauch über der Schulter und hält Eimer, Schrubber, Besen und Kehrblech in der Hand, der andere hat ein Steinbeil und einen Hammer im Gürtel. Sie bewegen sich so auffallend langsam und mechanisch, dass ich die beiden Gestalten einen Moment für Untote halte, die sich aus einem der vielen Gräber erhoben haben.
Nach Verkins Begrüßung und einigen schneidigen Worten von Nevin entfalten die beiden Angestellten der Friedhofsstiftung eine überraschende, fast hektische Aktivität. Nevin zeigt auf eine Stelle hinter dem Stein, wo etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, der Gärtner rollt den Schlauch aus, schließt ihn an einen Wasserhahn an und beginnt, Pflanzen zu wässern, die mir bisher gar nicht aufgefallen sind, ja, es wirkt, als wollten die Männer durch demonstratives Verrichten ihrer Arbeit gefallen, wahrscheinlich wissen sie, dass die Herrscherin dieser Grabstätte sich später großzügig zeigen und ihnen einige Geldscheine zustecken wird.
Verkin und der Steinmetz, der den Grabstein nun mit einer Bürste schrubbt, wechseln vom Türkischen ins Istanbuler Hocharmenisch, vermutlich, um sich gegenseitig zu beweisen und selbst zu vergewissern, dass sie es noch beherrschen. Ich versuche derweil, den Grabstein zu zeichnen, worüber ich mich selbst ein wenig wundere. Ich skizziere ein Rechteck, male den in armenischen Buchstaben geschriebenen Familiennamen ab und beginne, die Vor- und Zunamen samt Geburts- und Sterbedaten abzuschreiben, die im Gegensatz zum Familiennamen in lateinischen Lettern in den Stein gehauen wurden, Namen, die ich wie einen Besetzungszettel lese, wie das Verzeichnis der Protagonisten des Familienromans, von dem Verkin mir bereits Bruchstücke erzählt hat. Ich bin fast fertig mit meiner Kopistentätigkeit, da fällt mir ein, dass ich den Stein einfach hätte fotografieren können, aber da ich den Füller nun schon in der Hand halte, kritzele ich zusätzlich einige Wörter aufs Papier, mit denen ich diesen Friedhof im Fall des Falles beschreiben könnte. Ich notiere Eindrücke so, wie ich es in den Malls mache, die ich überall in Istanbul besuche. Ich war mehrfach im Großen Basar, ich war im Zorlu Center, in İstinye Park und der Kanyon Mall, mich interessieren die architektonischen Besonderheiten und welche Läden und welche Filialen welcher Ketten es gibt, mich interessieren vermeintliche Banalitäten: wie die Handläufe sich anfassen, wie die Mülleimer aussehen, wie oft wo gekehrt, gewischt und wie das Moos aus den Ritzen der Pflasterplatten im Eingangsbereich gepult wird, mich interessieren die Sitzbänke, wenn es welche gibt, ich möchte wissen, wie es im Food Court riecht und wie diese neuen Übersichts- und Orientierungsdisplays vor den Rolltreppen funktionieren, die an riesengroße iPhones erinnern und sich genauso bedienen lassen. Ich war einmal, fällt mir ein, in einer von Daniel Libeskind entworfenen Mall, die fast so marmorweiß war wie dieser Friedhof, ich kritzele marmor- undvankatzenweiß auf die eher elfenbeinfarbene, nicht weiße Seite meines Notizbuchs, Weiß ist die wahre Farbe der Trauer, denke ich, und dann, was ist das für ein Satz, warum schreibe ich ihn auf und wo habe ich ihn her? Ich komme mir hilflos vor mit dem Stift in der Hand, ich wüsste nicht, wie ich das grelle Licht, die Helligkeit, das arktische Weiß und die Reflexionen auf dem Marmor beschreiben sollte – aber, fällt mir zu meiner Erleichterung ein, muss ich ja nicht, ich schreibe ein Buch über Shopping Malls und nicht über armenische Friedhöfe.
Der Steinmetz wischt mit einem Lappen über die Vertiefungen der Lettern, und ich muss daran denken, dass ich erst vor zwei Wochen mit meinem Vater am Grab meiner Mutter gestanden, Moos von ihrem Stein entfernt und ihren Namen freigekratzt habe. Eine Bürste hatte ich nicht dabei, ich benutzte den Autoschlüssel des Mietwagens, mit dem ich meinen Vater herumkutschierte, der nicht sagen konnte, der nicht wusste, an welchem Grab wir standen, geschweige denn, welche seiner Frauen dort begraben lag. Das Moos über dem Namen meine Mutter musste ich allerdings nicht von weißem Marmor, sondern von einem Findling pulen, von einem von Wasser und Eis rund geschliffenen Felsen, den ein Eiszeitgletscher wohl aus dem Norden nach Mitteleuropa transportiert hatte, bevor er einige Zehn- oder Hunderttausend Jahre im Rhein hin und her gerollt, bewegt und geglättet worden war. Ich glaube, dieser Stein war ein Wunsch meiner Mutter, sie hatte vor ihrem Tod genug Zeit, darüber nachzudenken, wie ihr Grab aussehen sollte.
Die beiden Angestellten haben ein üppiges Trinkgeld erhalten und schlurfen davon, der Marmorkubus glänzt und glitzert heller als zuvor.
Dein Vater ist ganz schön alt geworden, sage ich zu Verkin. Fast ein Jahrhundert.
Ja, scheint so, als hätte er nicht gehen wollen. Es gefiel ihm zu gut in seinem Istanbul, er wollte es nicht verlassen. Und wie du siehst, er hat es nie verlassen, ist immer noch da – und das ist vielleicht seine größte Leistung. Er hatte viele Nachahmer und Neider, wurde immer wieder angegriffen und eingesperrt, musste sich wehren, sich behaupten, zurückschlagen, kämpfen. Je älter ich werde, desto mehr bewundere ich ihn für sein Geschick, mit dem er sich, uns und unser Unternehmen durch dieses verrückte Jahrhundert manövriert hat. Und das in diesem verrückten Land, in dem er stets Hintertüren und Fluchtwege im Auge behalten und sich stets doppelt und dreifach absichern musste, denn die Verhältnisse ändern sich schnell in Türkiye, kaum siehst du dich um, hat es wieder einen Putsch gegeben, und die Politiker, mit denen du eben noch befreundet warst, sitzen im Gefängnis, und die, die eben noch im Gefängnis saßen, regieren. Mein Vater wusste, warum er Geld in der Schweiz und in England deponierte und in Immobilien in Paris investierte. Der türkische Staat dachte sich immer wieder neue Sondersteuern aus, Varlık Vergisi hieß eine, look it up, sie wurde während des Zweiten Weltkriegs erhoben. Armenier, Griechen und Juden mussten sie entrichten, und immer, wenn die Republik Geld brauchte, wurde eine neue von Armeniern, Griechen und Juden zu zahlende Sondersteuer erhoben, absurd hohe Sondersteuern, der Satz für Armenier betrug beispielsweise zweihundertdreiunddreißig Prozent des vorhandenen Vermögens, für Griechen hundertsechsundfünfzig Prozent. Das waren Forderungen, die selbstverständlich kaum jemand erfüllen konnte, die niemand erfüllen können sollte, denn Ziel und Zweck dieser staatlich organisierten Ausplünderungs- und Enteignungsmaßnahme, der damalige Ministerpräsident Saracoğlu sagte es ganz offen, war die Existenzvernichtung aller Nichttürken. Armenier, Griechen und Juden – er nannte uns Ausländer – sollten beseitigt werden und ihre Geschäfte in türkische Hände übergehen. In Istanbul wechselten Tausende Immobilien die Besitzer, darunter fast alle Häuser auf der İstiklal Caddesi, auch meine Tante, die zwanzig Jahre zuvor Atatürk eine Wohnung vermietet hatte, verlor ihre Häuser. Und obgleich mein Vater einer der wenigen war, der bezahlen konnte, obwohl er alle exorbitanten Forderungen erfüllte, obwohl er sein Lösegeld bezahlte, wurde er 1942 in die Steinbrüche von Aşkale verbannt, in ein Straf- und Arbeitslager in der Provinz Erzurum, eine Art türkisches KZ für Armenier. Mein Vater, ich war noch nicht auf der Welt, verbrachte fast ein ganzes Jahr dort und hatte großes Glück,er musste nicht viele Tage im Steinbruch verbringen, er konnte die Aufseher und die Lagerleiter bestechen, indem er ihnen die Elektrifizierung ihrer Dörfer, Strom für ihre Hütten versprach. Der Witz ist, dass er am Ende seiner Verbannung einen talentierten jungen Mann aus der Umgebung von Aşkale, der für ihn gearbeitet hatte, mit nach Istanbul nahm, einen begabten Siebzehnjährigen, der bald die Bauprojekte meines Vaters leitete, sich einige Jahre später selbstständig machte und einer der erfolgreichsten Bauunternehmer der Türkei wurde. Seine Firma entwickelte sich zu einem der größten Mischkonzerne im Land, du kennst den Namen dieses jungen Mannes wahrscheinlich von Bauschildern, die noch heute überall in der Türkei herumhängen, er hieß İbrahim Polat, look him up. Wegen angeblicher Steuerschulden oder irgendwelcher anderen fabrizierten Anschuldigungen saß mein Vater noch einige Male im Gefängnis, mal kürzer, mal länger, fast neun Monate verbrachte er im Sultanahmet Cezaevi, dem alten Gefängnis in Eminönü, das, zwei Jahrzehnte nachdem mein Vater dort eingesperrt war, in ein Luxushotel umgewandelt wurde, aus der Besserungsanstalt wurde das Four Seasons, weshalb mein Vater, immer wenn wir an diesem hässlichen neoklassizistischen Bau vorbeifuhren, den Witz machte, er hätte dort einst eine Suite mit Vollpension bewohnt, bezahlt vom türkischen Staat. Um spontanen Verhaftungen durch irgendwelche subalternen Knallchargen zu entgehen, die sich mit übereifrigen Aktionen gegen Armenier profilieren wollten, hatte mein Vater während der vierziger Jahre einen Schauspieler engagiert, der, ausstaffiert mit allen Insignien eines Fabrikdirektors, den Chef spielte, während mein Vater selbst in unauffälliger Kleidung zwischen seinen Angestellten saß oder sich unter die Arbeiter mischte, die im formaldehydvernebelten Keller von Suma Han die Bakelitpressen bedienten. Kam jemand unangemeldet und fragte nach Monsieur Antoine, blieb meinem Vater immer genug Zeit, die Situation einzuschätzen, der Schauspieler-Direktor, das war seine Aufgabe, vertröstete, antwortete ausweichend, verzögerte, sagte, das wissen wir nicht, was kann ich ausrichten, ich bin gerne behilflich.
Dein Vater beschäftigte einen decoy, wie Queen Padmé Amidala vor dem Ausbruch der Clone Wars?
Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber ja, mein Vater hatte einen decoy. Einmal, da war er ohne unterwegs, wurden mein Vater und meine Mutter gemeinsam von der Fähre herab verhaftet, als sie gerade aus Italien zurückkamen, wohin mein Vater in den späten vierziger und frühen fünfziger Jahren jeden Sommer fuhr, in einem Jahr mit meiner Mutter, im nächsten mit seiner anderen Frau. Und zwar immer mit dem Auto, in dem er auf dem Hinweg ein oder zwei Kilogramm Gold versteckt hatte. Die Verhaftung meiner Eltern war eine große Story, es gab fette Schlagzeilen in allen Zeitungen: Armenisches Schmugglerpärchen festgesetzt, bla, bla, bla. Meinem Vater wurden absurde Vergehen vorgeworfen, angeblich hatte er Geld ausgeführt und bei der Einreise einen Schinken und italienische Würste nicht deklariert. Sie wollten an sein Geld im Ausland, aber so leicht machte mein Vater es den staatlichen Räubern natürlich nicht, die Zollbeamten konnten ihm nichts nachweisen und erfuhren nicht, wo sein Geld versteckt war. Meine Mutter wurde nach zwei Tagen entlassen, mein Vater nach vier, und das vermeintliche armenische Schmugglerpärchen kehrte zurück in sein mehr oder minder bürgerliches Leben. Ich war damals vier oder fünf Jahre alt und selbstverständlich ein bisschen aufgeregt, denn die ganze Stadt, die damals allerdings viel kleiner war als heute, sprach von meinen Eltern. Was mir gefiel, ich fand es großartig. Verunsichert war mein Vater nicht, er rechnete stets mit solchen Aktionen, war vorbereitet, hatte immer irgendjemanden großzügig eingeladen, beschenkt oder auf andere Art verpflichtet, sprich gekauft. Seine Lebensversicherung war, dass nicht wenige Bewohner dieser Stadt ihm einen Gefallen schuldeten, auch deshalb, aber nicht nur deshalb, lud er gern ein. Wer mit dir isst, betrügt dich nicht, sagte er, mein Vater war ein großzügiger Mensch, er bot einen offenen Mittagstisch und liebte es, andere Menschen um sich zu haben. Ich habe noch Jahre, ach was, Jahrzehnte später von Personen profitiert, die mein Vater durchgefüttert hatte, der armenische Patriarch von New York war beispielsweise einer seiner Kostgänger gewesen, mein Vater hatte ihm mit einem Stipendium sein Studium ermöglicht. Als ich in Manhattan wohnte, lud er mich ein und half mir, eine große Auftragsarbeit für meine beiden beschäftigungslosen Bildhauer Hippo und Orhan zu ergattern. Und als Kind saß ich sonntags im Trio Palace oft auf dem Schoß des späteren Papstes Papa Roncalli, der damals apostolischer Legat in Konstantinopel war, ein lustiger Mann, den ich sehr mochte. Mein Vater und er waren befreundet, er aß oft bei uns, und natürlich freuten wir uns, als er, Giuseppe Roncalli, Papst Johannes XXIII. wurde, genannt il papa buono. Bis zu seinem frühen Tod besuchte mein Vater ihn fast jedes Jahr in Rom. Mein Vater war ein mysteriöser Mann, der gern Verstecken spielte. Er tauchte auf und verschwand wieder, was meine Mutter ihr Leben lang wahnsinnig machte. Er hatte mehrere Wohnungen in der Stadt und zwei Sommerhäuser, vielleicht sogar ein weiteres Haus am Bosporus, nie wussten wir, wo er war. Er hatte viele Affären, die er, da war er ganz Armenier, nicht sonderlich respektierte, fuck them and forget them, fuck them and let them go, lauteten seine beiden Devisen, dabei war er kein großer Verführer, kein Eroberer, die Frauen waren einfach da, und meine Mutter, obwohl sie selbst es anders sah, war nur eine seiner Freundinnen, eine unter vielen. Als sie merkte, dass sie mit mir schwanger war, musste sie ihm nach Paris schreiben, wo er sich seit Kriegsende aufhielt, die Gelegenheit, Geschäfte zu machen, war günstig, er kaufte mehrere Häuser. Wieder in Istanbul war es zu spät für eine Abtreibung, und als er das nächste Mal aus Paris zurückkehrte, war ich auf der Welt und habe ihn anscheinend verführt, denn mich hat er nicht mehr verlassen. Meine Mutter erzählte selbstverständlich eine andere Version dieser Geschichte, für sie war es eine vom Schicksal bestimmte Verbindung zweier uralter armenischer Familien, obwohl sie nie geheiratet haben, mein Vater hat keine seiner Frauen geheiratet, nicht mal meine Mutter, mit der er zwei Kinder hatte.
Stimmt, du hast ja einen Bruder, das vergesse ich immer, sage ich.
Er ist nicht wichtig. Zwischen ihm und mir war es ganz einfach: Ich war der Junge, er das kleine Mädchen meiner Mutter. Und das ist so geblieben. Falls du mal ein Buch über mein Leben schreiben solltest, kannst du ihn weglassen, er spielt keine Rolle.
Verkin hat gerade eine Figur aus ihrem ungeschriebenen Familienroman gestrichen, denke ich, da sagt sie, halt, ich habe mich geirrt, mein Vater hat sehr wohl geheiratet, sehr spät, im hohen Alter, meine Mutter war schon einige Jahre tot. Er hat Fifi geheiratet, die Griechin, mit der er mindestens so lange zusammen war wie mit meiner Mutter, wenn nicht länger. Sie liegt ebenfalls hier begraben.
Ist er weich geworden, hat er sich überreden lassen?
Nein, er hat sie geheiratet, damit sie nicht ausgewiesen werden konnte, denn sie hatte keinen türkischen Pass. Er hat sie geheiratet, damit sie in Istanbul bleiben konnte, der Stadt, in der sie zur Welt gekommen und aufgewachsen war. Mein Vater hingegen besaß die türkische Staatsangehörigkeit, glücklicherweise, und hatte seinen Namen 1923 von Kasapian in Kasapoğlu turkisiert. In seiner Jugend wäre es für einen Armenier wie meinen Vater gesellschaftlich inakzeptabel und kaum vorstellbar gewesen, eine Griechin zu heiraten, ein Armenier heiratete keine Griechin – aber auch das hatte sich, wie so vieles, erledigt, es gab kaum noch Griechinnen und Armenier in Istanbul, Fifi war eine der letzten, eine Übriggebliebene. Sie und mein Vater wohnten zuletzt in dem Haus in Büyükdere, das mein Vater für sie gebaut hatte, ein schönes vierstöckiges Gebäude mit Bosporusblick, direkt am Wasser, vielleicht ziehe ich dort eines Tages hin, dann muss ich nicht mehr den Steilhang hinunter, wenn ich im Bosporus schwimmen möchte. Als mein Vater das Haus bauen ließ, lebte meine Mutter noch und konnte, wenn sie in Tarabya war, mit einem Fernglas über die Bucht hinwegsehen, ob die Fenster erleuchtet waren oder nicht, und spekulieren, ob mein Vater bei seiner anderen Frau war. Und dann, zwei Jahre nachdem mein Vater und Fifi still und leise geheiratet hatten, vier Monate vor ihrem Tod, machte Fifi, die ihr ganzes Leben als verarmte griechische Großbourgeoise ohne Einkommen in Istanbul zugebracht hatte, völlig unerwartet eine gigantische Erbschaft: Häuser und Gewerbeimmobilien in Athen und Land auf Kefalonia – ein Vermögen, das nach ihrem Tod, sie hatten ja geheiratet, an meinen Vater fiel. Nicht nur deshalb liegt sie nun in unserem Familiengrab begraben, Seite an Seite mit meinem Vater und meiner Mutter, worüber Letztere sicherlich nicht erfreut wäre, wie du dir denken kannst,sie lebten ja keinen ménage à trois, die zwei Frauen sind sich offiziell nie begegnet. Mein Vater aber freute sich, sie beide neben sich zu wissen. Und was das Heiraten anging, war mein Vater anscheinend auf den Geschmack gekommen, er war nicht lange Witwer, da wollte er wieder heiraten, und zwar Lucy, seine Haushälterin. Das heißt, Lucy, ebenfalls Griechin und um die sechzig Jahre alt, wollte unbedingt seine Frau werden, sie vergraulte alle anderen Hausangestellten und versuchte, meinen Vater dazu zu bringen, sie zu heiraten. Sie kochte ihm nichts mehr und ließ ihn kaum trinken, um ihn gefügig zu machen – es dauerte eine Weile, bis ich all das bemerkte, ihren Plan durchschaute und mir zu überlegen begann, wie ich diese Person loswerden könnte. Sollte ich sie kidnappen lassen oder in den Bosporus schubsen, bevor sie sich das Vermögen meines Vaters überschreiben lassen konnte? Dann aber, eines Sonntags, rufe ich meinen Vater gegen Mittag an und frage, wie geht es dir, was hast du gegessen und so weiter. Mir geht es gut, sagte er, ich bin schon lange wach, habe gelesen und etwas aus dem Kühlschrank gegessen; Lucy aber geht es nicht gut, sie ist noch nicht aufgestanden. Was ist mit ihr?, fragte ich. Nun ja, sie liegt im Bett und bewegt sich nicht. Nevin und ich fuhren sofort zu ihm und stellten fest, sie war tot. Hatte sich das also erledigt.
Dein Vater hat gleich drei Frauen überlebt. Respekt. Mein Vater hat erst zwei beerdigt, meine Mutter und meine Stiefmutter, aber sie liegen nicht im selben Grab.
Bist du schon älter, als deine Mutter geworden ist?, fragt Verkin, und ich muss rechnen, um festzustellen, dass mir noch zwei, nein drei Jahre fehlen. Und ich gebe zu, dass ich wieder und wieder versucht habe, ein Buch über die Beerdigung meiner Mutter zu schreiben, es sollte auf dem Friedhof und während der Beerdigungsfeier spielen, die in einem Hotel am Rhein stattfand, in einem Saal am Wasser, eine Beerdigungsfeier, deren zunehmende Ausgelassenheit mich als Kind sehr verwirrte, weil ich noch nicht verstehen konnte, warum es nach Beerdigungen so fröhlich zugehen kann.
Und, ist das Buch fertig?, fragt Verkin.
Nein, sage ich. Bisher nicht. Und die Shopping Malls brauchen auch ihre Zeit.
Mein Vater hat mir mal ein Zeichen gegeben, sagt Verkin, genau hier, wo wir jetzt stehen.
Was meinst du damit, ein Zeichen?
Ich stand hier am Grab und habe ihn um Hilfe gebeten, gib mir ein Zeichen, habe ich gesagt, gib mir ein Zeichen, dass ich nicht aufhören, sondern weitermachen soll mit diesem sinnlosen Leben, von dem ich damals wieder einmal so überfordert war, dass ich am liebsten gestorben wäre. Und dann, es war unglaublich, ist ein heller Strahl erschienen, plötzlich stand eine Säule aus Licht auf dem Grabstein, es leuchtete aus der Erde und aus dem Marmor. Du kannst nun sagen, na gut, die Sonne schien, eine Reflexion, aber so war es nicht, der Himmel war bedeckt an dem Tag, und ich habe tatsächlich einen hellen Körper gesehen, seine Präsenz gespürt, mein Vater war da, ich habe ihn gerochen. Nevin war dabei, sie stand neben mir, hat ihn ebenfalls gesehen und war so geistesgegenwärtig, ein Foto zu machen.