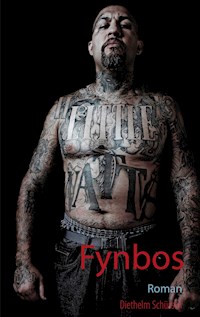Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihren Exfreund nach seinem Gedächtnisverlust zu verführen fällt Petra leicht, dafür kennt sie ihn gut genug. Nach seinem Surfunfall auf Maui hat er aber inzwischen eine Affäre mit der eifersüchtigen Nalu begonnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis:
Dieses Buch sollte von meinen wunderbaren Töchtern nicht vor ihrer Volljährigkeit gelesen werden.
Zum Autor
Diethelm Schüssler wurde 1963 in Krefeld geboren. Nach einer kaufmännischen Ausbildung und dem Wehrdienst absolvierte er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Köln und arbeitete als Unternehmer fast 20 Jahre, bis er seine Firmen verkaufte.
Heute verbringt er sein Leben in seiner Wahlheimat Cape Town oder in Köln. Er ist verheiratet und hat 2 Töchter.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Konfuzius
Kapitel 1: Erwachen
Kapitel 2: Zurück ins Leben
Kapitel 3: Nalu
Kapitel 4: Wer bin ich
Kapitel 5: Leben
Kapitel 6: Tiefseefischen
Kapitel 7: Vergangenheit
Kapitel 8: Köln
Kapitel 9: Auf der Jagd
Kapitel 10: Allein im Paradies
Kapitel 11: Deja vu
Kapitel 12: Nachtleben
Kapitel 13: Die Geister die ich rief
Kapitel 14: Mottengleich (oder: Am Haken)
Kapitel 15: Verliebt
Kapitel 16: Erkenntnis
Kapitel 17: Gewitter
Kapitel 18: Liebe
Kapitel 19: Warum
Kapitel 20: Da wo alles begann
Kapitel 21: Schluss
Mein Herz, mein Herz ist traurig.
Anhang
Vorwort
Meine ewige Liebe zum Meer, zu tropischen Inseln und dem Wassersport wurden sichtbar in diesem Buch verarbeitet.
Zudem zieht sich mein Wunsch verschiedene Leben zu leben und dazu meinen Weg immer wieder umzugestalten durch den Roman.
Vermutlich gelingt es kaum einem Autor, seinem ersten Buch keinerlei autobiographische Züge zu verleihen. Zumindest gelingt es mir nicht.
Trotzdem möchte ich deutlich machen, dass dieser Roman und seine Darsteller mit allen ihren Eigenarten ein Produkt meiner Phantasie sind!
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewünscht!
Von der Entwicklung der Idee bis zur Beendigung dieses Werkes zog sich meine Arbeit über 13 Jahre, da meine Lebensumstände mir nicht immer genug Raum oder Muße ließen.
Konfuzius
Wir haben alle zwei Leben.
Das Zweite beginnt, wenn wir bemerken, dass wir nur ein Leben haben.
Kapitel 1 Erwachen
Unter mir klatscht die Dünung schwer gegen die zerklüfteten Lavafelsen. Die Gischt schießt weiß, Fontänen gleich in die Höhe. Ich fliege weiter entlang der schroffen Steilküste. Das dunkle Blau des tiefen Meeres, das nur durch weiße Wellenkämme unterbrochen wird, geht nun hinter der Riffkante in das azurblau der flachen Sandküste über. Der frische Wind im Rücken treibt mich weiter. Die hoch am Himmel stehende Sonne durchdringt das Wasser so tief, dass mir kaum etwas auf dem von Korallen unterbrochenen Meeresgrund verborgen bleibt.
Ich gleite weiter über mein Element, in meinem Element....
Piep.piep.piep.piep.piep
Das elektronische Geräusch stört meinen Flug und holt mich in eine andere Realität.
Es ähnelt dem medizinischer Apparaturen. Und nun meldet sich plötzlich ein stechender Kopfschmerz.
Was ist mit mir geschehen?
Der Schmerz raubt mir jede Konzentration.
Ich drifte wieder weg... Nicht wieder einschlafen... Piep.piep.piep.piep
Langsam öffne ich meine schweren Augenlieder, mein Blick ist zunächst getrübt, ich sehe weiße Wände und weiße Schränke.
Wo bin ich nur?
Es riecht nach Desinfektionsmitteln.
Bin ich im Krankenhaus? Ich bewege meinen Körper Glied für Glied, meine Hände, meine Füße, alles funktioniert, nur mein Schädel scheint lädiert... Eine fremdländische Frau im weißen Kittel beugt sich über mich und schaut mir besorgt in die Augen. Ihr Blick macht mir Angst, muss ich mich sorgen?
<Was ist mit mir passiert?>, frage ich sie und empfinde meine raue, krächzende Stimme als fremd.
<Sorry, don’t you speak englisch?>, entgegnet die Dame freundlich und lächelt mich mit ihrem asiatischen Gesicht an.
<Yes, please tell me, what am I doing here?>, frage ich jetzt auf Englisch.
<You are in the hospital, please wait, I am your nurse, I call the doctor.>, antwortet sie und huscht aus dem Raum.
Wenig später erscheint sie mit einem gebräunten, sportlichen Mann in weißer Kleidung und quietschenden Sohlen. Er schaut erst auf eine Akte, die sie ihm reicht, dann runzelt er die Stirn und schaut zu mir während er sein Kinn mit Daumen und Zeigefinger reibt.
Er begrüßt mich auf Englisch:
<Guten Tag, ich bin ihr behandelnder Arzt Doktor Freeman, wie ist ihr Name bitte?>
Ich versuche mich zu erinnern, stochere aber nur im Nebel und ärgere mich über meine Vergesslichkeit. Zweimal setzte ich zur Antwort an, bleibe aber in einem sinnlosen <Ähh...> stecken.
Verzweifelt wühle ich im letzten Winkel meines Hirns aber bleibe erfolglos.
Also antworte ich verstört: <Ich weiß nicht, bitte erklären sie mir warum ich hier bin.>
<Sie wurden im Wasser treibend am Hookipa Beach von einem Surfer gesehen der sie sofort ans Ufer zog und wiederbelebte. Bewusstlos wurden sie gestern Nachmittag hier in das Maui Memorial Hospital eingeliefert. Sie haben ein Schädeltrauma mit einer mächtigen Beule am Hinterkopf. Wir haben sie geröntgt, sie haben keinen Schädelbruch, aber scheinbar eine retrograde Amnesie. Mehr kann ich ihnen auch nicht sagen. Sie haben 17 Stunden geschlafen, sind kurz aufgewacht und waren wieder weg, erinnern Sie sich an gar nichts?> <Nein, an gar nichts.>, antworte ich und lasse meine Augen durch den weißen Raum kreisen, als ob das mir helfen würde.
<Ich weiß weder wer ich bin, dass ich auf Maui bin, noch dass ich Surfen war.>
<Gut, schlafen sie jetzt, sie brauchen Ruhe, morgen früh sehen wir weiter.>, rät mir der Arzt noch im Gehen.
Nichts scheint mir gut. Ich merke noch, dass ich Wasser lassen muss, spüre den warmen Fluss über meine Schenkel laufen und versinke wieder in komatösem Schlaf.
Durch ein ungewohntes Gefühl an meinen Beinen wache ich aus dem Tiefschlaf auf. Zunächst meine ich, es sei Teil meines Traumes, dass jemand mich mit einem nassen Lappen abreibt. Dann öffne ich verschämt die Augen gerade soweit, um die Schwester heimlich bei der Arbeit zu beobachten. Mir geht es weit besser. Ich genieße die erfrischende Feuchtigkeit, die sich von meinen Füßen über die Waden an den Oberschenkeln entlang, zu meiner Körpermitte vorarbeitet. Endlich nimmt sie ihn in die Hand, wischt geschickt erst um meine Hoden, indem sie den Penis an der Eichel festhält. Dann reinigt sie ihn, indem sie mit der anderen Hand die Eier festhält. Schließlich zieht sie geübt mit der einen Hand die Vorhaut zurück. Mit der andern Hand, über die sie den Waschlappen gezogen hat, umschließt sie mit Daumen und Zeigefinger zunächst die Eichel, um sie dann mit sanftem Druck durch den Lappen gleiten zu lassen.
Trotz des leichten Kopfschmerzes genieße ich, nun etwas peinlich berührt, das einsetzende wohlige pulsieren.
Jetzt erst schlage ich die Augen vollends auf und sehe in das freundlich lächelnde Gesicht der asiatischen Schwester, die weiter nun an meinem Oberkörper arbeitet, wohl wissend, dass mein Bewusstsein wiedergekehrt sein muss. Komapatienten bekommen wahrscheinlich sonst keine Erektion durch ihre Reinigungsprozedur. Ihr Namensschild auf dem Sattelpunkt ihrer üppig gewölbten Brust verrät mir ihren Namen: Li Akamu
Langsam beginnt mein Hirn zu kreisen, ich muss mich erinnern. Leider komme ich nicht weiter als zuvor. Was ich von mir weiß ist, dass ich ein männlicher, schlanker Weißer mittleren Alters bin, der nach einem Unfall leicht verletzt in einem hawaiianischen Krankenhaus liegt und sich gerne mit nassen Waschlappen reinigen lässt. Erst jetzt bemerke ich das bohrende Hungergefühl. Es signalisiert mir, dass mein Organismus wieder arbeitet.
<Guten Morgen Eddie>, begrüßt mich der gut gelaunte freundliche Surfer-Doc, als er den Raum betritt. <Ich nenne sie Eddie, da wir ihren Namen nicht kennen, oder erinnern sie sich heute?>
Er gibt mir ein paar Sekunden Zeit und schaut mir in die Augen, als ob da meine Fortschritte abzulesen wären.
Ich habe gegen Eddie nichts einzuwenden.
Dann spricht er weiter: <Vorgestern waren so hohe Wellen, dass ich am Strand geblieben bin. „Eddie would go“, sagen die Locals bei solchen Bedingungen in Erinnerung an Eddie Aikau, daher Eddie. Also, wie geht es ihnen?>
<Bis auf den Kopfschmerz, den Hunger und meine Amnesie gut.>, erwidere ich frustriert ironisch.
<Wir machen jetzt noch einige Untersuchungen, heute Nachmittag kommt jemand von der Polizei und dann sollten sie in ein paar Tagen nach Hause können, wenn sie sich bis dahin erinnern, wo das ist.>, protokolliert der Arzt noch im Rausgehen lakonisch.
Langsam wird mir seine frischgewaschene Fröhlichkeit unsympathisch.
Noch etwas zittrig stehe ich in meinem Krankenhemd auf und frage die Schwester nach meiner Kleidung. Kichernd gibt mir Schwester Li eine Surfshort mit Orchideenmuster, das einzige, was ich wohl bei meiner Einlieferung trug. Zusätzlich reicht sie mir einen beigen Bademantel. Mit der Kleidung in der Hand gehe ich gespannt ins Bad um mich im Spiegel zu sehen, doch schließe ich erst die Türe hinter mir ohne das Licht anzuknipsen. Ich taste nach dem Lichtschalter und zögere doch noch einen Augenblick aus Angst vor dem Unbekannten.
Schließlich drücke ich den Schalter... und sehe in das skeptisch dreinblickende gebräunte Gesicht eines Mannes um die 40 mit dunkelblondem Dreitagebart, sonnengebleichten Augenbrauen und wasserblauen Augen. Sein Haar ist bis auf wenige Millimeter rasiert. Ich betrachte mich und bin mir so fremd, dass ich erwarte, dass mein Spiegelbild in eine andere Richtung läuft, oder eine unerwartete Bewegung macht.
Seine Gesichtszüge sind markant und wirken vielleicht interessant. Auf jeden Fall sind sie nicht klassisch gutaussehend. Du meinst wohl so den fortgeschrittenen Haarausfall zu kaschieren, denke ich kritisch, als ich den Haaransatz mustere. Außerdem ist die Nase definitiv zu groß und nicht gerade, stelle ich nörgelnd fest. Beim Versuch ein Lächeln zu simulieren zeigen sich unzählige Lachfalten, möglicherweise die Zeichen eines humorvollen Charakters. Sie geben etwas bubenhaftes zum Ausdruck, dass vielleicht charmant wirken kann. Mein Mund ist geschwungen und eigentlich ansprechend, wenn da nicht ein gewisser spöttischer Ausdruck wäre. Meine Zähne fallen mir auf, die Eckzähne sind spitz und die Schneidezähne kräftig und weiß. Das gibt mir etwas raubtierhaftes. Ich habe das Gefühl, dass meine beiden Gesichtshälften asymmetrisch sind. Jetzt sehe ich auch warum. Die Narben rechts und links auf den Augenbraunen haben die Augen leicht deformiert, das Rechte ist größer als das Linke.
Was hab ich denn nur mit meinem Kopf angestellt, frage ich mich besorgt. Du hast offensichtlich wild gelebt und zwar nicht nur am Schreibtisch. Ein bisschen sehe ich aus wie ein Boxer, nur bin ich dazu zu schmal. Ich versuche grimmig dreinzuschauen, was mir auch sofort gelingt.
Neugierig ziehe ich mir das Krankenhaushemd über den Kopf und stehe nun nackt vor dem Spiegel. Als mein Blick über den kräftigen Hals weiter nach unten wandert, stelle ich fest, dass ich zu dünn bin. Etwas mehr Gewicht könnte auf die Rippen. Ich bin zwar groß und die Bräune gibt mir den Eindruck von Vitalität, aber ich bin zu sehnig und die Rippenbögen stehen zu weit vom Brustkorb ab. Auf meinen Armen und Beinen habe ich blonden Flaum und die heraustretenden Venen zeigen einen guten Trainingszustand an.
Ich stelle fest, dass ich zu viel UV-Bestrahlung in meinem Leben bekam. Mein fast bronzefarbener Teint sieht zwar ganz gut aus, passt nicht zu meinem nordeuropäischen Hauttyp, ich habe dementsprechend zu viele Leberflecken und Runzeln. Ich werde früh aussehen wie eine Mumie. Um die Augen herum sehe ich jetzt schon so aus.
Ein zweites Mal schaue ich mir in die Augen, die ich zunächst vernachlässigte. Diese Augen passen nicht zum Rest des Gesichtes, zumindest nicht bei genauerer Betrachtung. Zunächst strahlen sie blau auf dunkler Haut und geben meinem Gesicht trotz der Schlupflieder den Hauch von Liebenswürdigkeit. Auf den zweiten Blick sehen sie abgekämpft aus, vielleicht sogar etwas verzweifelt. Das kann auch mit meiner momentanen Lage zusammen hängen, rechtfertige ich mich vor mir selber.
Dann hole ich tief Luft, hebe meine Schultern und stelle mich aufrecht mir gegenüber, als ob ich mir imponieren müsste. Ich versuche es mit einem geringschätzenden Blick, auch der gelingt mir bestens.
Abschließend gehe ich noch mal einen Schritt zurück und resümiere meine erste oberflächliche Inspektion, nackt mit baumelndem Gemächt: Alles in allem bist du nicht begeisternd, aber es hätte mich auch deutlich schlechter treffen können. Du wirkst nicht unbedingt vertrauenserweckend, aber dafür schubst dich auch keiner in der Kneipe. Und langweilig wirkst du auch nicht.
Dann entscheide ich mich zu duschen, ich habe das Gefühl mich zum ersten Mal zu berühren. Ich seife mich gründlich ein und ertaste meinen glitschigen Körper, wobei ich keinen Winkel auslasse. Beim Abtrocknen habe ich mich schon fast mit mir angefreundet.
Das folgende Frühstück im Bett gibt mir wieder Energie und bessert meine Laune. Die Unsicherheit über die Dinge, die mich erwarten, weicht langsam der Neugierde.
Ich fühle mich wie eine frisch geschlüpfte Raupe, die nun ihre Umgebung erkundet. Vor meinem Fenster sehe ich den Krankenhausgarten, dort wuchert üppige tropische Vegetation und ich genieße die Pracht. Ich lasse meinen Blick schweifen entlang der leuchtend roten Bougainvillaehecke, die mich fast blendet, über verschiedenfarbige Blüten von Oleanderbüschen und die fetten grünen Wedel von Bananenstauden, bei denen sich das Auge nach dem vorherigen Farbenrausch etwas ausruhen kann.
Dabei unterbricht mich Schwester Li, um mich zu weiteren Untersuchungen abzuholen. Ich laufe folgsam barfuß hinter ihr her über den glänzenden Linoleumboden des Krankenhauses, von einem Raum zum anderen.
Zum Schluss, im letzten Zimmer, treffe ich den Arzt wieder. Erst testet er noch meine Reflexe, indem er mit einem Hämmerchen auf meine Knie klopft. Danach läßt er sich auf seinen Drehsessel mir gegenüber fallen, schaut mir auf die Stirn, holt tief Luft und setzt zu der lang erwarteten Diagnose an. Ich würde ihn am liebsten schütteln um schneller zu erfahren, was mit mir los ist.
<Außer einer Gehirnerschütterung konnte ich glücklicherweise keine weiteren problematischen Verletzungen feststellen>, stößt er mit dem ersten Atemzug aus, <Ihr Gedächtnis wird wahrscheinlich kurzfristig wieder zurückkehren.>
Dann stirnrunzelnd, fährt er fort: <Es gab aber schon Fälle, in denen Bereiche des Gedächtnisses unwiederbringlich verloren blieben. Dabei kann es sich um Gedächtnislücken handeln, die einen Zeitraum der Vergangenheit einnehmen. Es kann aber auch wie in ihrem Fall die gesamte Vergangenheit betreffen. Konfrontieren sie sich mit ihrer Vergangenheit, wir nennen das „gestützte Erinnerung“. Das ist meist hilfreich um dem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Ihr Sprachzentrum ist nicht gestört und die Motorik auch nicht, das ist schon viel wert!>
Das alleine reicht mir allerdings nicht aus, um mich in einen Freudentaumel zu stürzen. Lauter Fragen schießen mir durch den Kopf. Ich schaue wahrscheinlich etwas verstört aus meinem Bademantel, in Erwartung mehr zu erfahren.
Wieder holt er Luft und setzt zu einem erneuten Vortrag an. Während er doziert hält er nun zunächst die Hände gefaltet auf der Brust und schaut mir fortwährend bohrend auf die Stirn. Dann beginnt er mit seinen Händen kreisende Bewegungen, die in etwa die Rundungen eines Kopfes umfassen. Dabei schaut er dann auf den imaginären Kopf.
<Das explizite Gedächtnis speichert bewusst das „Weltwissen“ oder Fachwissen sowie die eigenen Erlebnisse. Das implizite Gedächtnis speichert die unbewussten Erinnerungen, zum Beispiel prozessuale Inhalte wie Bewegungsabläufe aber auch die perzeptuellen Fähigkeiten wie das Wiedererkennen von Personen. In ihrem Fall scheint es eine Lücke im expliziten Gedächtnis zu geben.>
Nach einer kurzen Pause, bei der er die Augen zunächst bedeutsam schließt, kommt er zum Ende seines Vortrages.
<Und nun die gute Nachricht, die Funktionsweise ihres Hirns scheint wieder normal zu sein, Ed!>
Mit diesem Schlusssatz schaut er mich nun freudestrahlend an wie ein Motivationstrainer.
Ob ich es merken würde, wenn mein Hirn nicht normal arbeitet? In der Psychiatrie halten sich die Patienten auch für normal und suchen die Ursache ihrer Probleme in ihrer Umgebung. Aber auch bei kritischer Betrachtung meiner selbst bin ich nicht in der Lage, ein auffälliges Verhalten an mir zu Erkennen. Ich sitze mit übergeschlagenen Beinen einem Fremden in seinem Büro gegenüber und höre aufmerksam zu. Ich meine allen seinen Auslassungen folgen zu können. Nur dadurch, dass der Fremde ein Arzt ist, über mein defektes Hirn referiert und ich einen Bademantel trage, unterscheidet sich diese Gesprächssituation von einer alltäglichen.
Der Arzt steht auf, reicht mir die Hand und signalisiert mir, dass das Gespräch für ihn beendet ist.
<Viel Glück Eddie, halten sie sich ruhig in den nächsten Tagen und suchen sie einen Spezialisten auf, wenn sich die Gedächtnislücken nicht kurzfristig schließen.>
Schwester Li eskortiert mich gesengten Hauptes in mein Krankenzimmer zurück. In meinem Kopf hallen Worte nach wie „unwiederbringlich“ und „wiedererkennen“.
Ein uniformierter Polizist sitzt schon in meinem Zimmer und wartet auf mich. Der dunkelbraune Hawaiianer ähnelt mit seinen geschätzten 3 Zentnern Gewicht einem Sumoringer. Die Fleischmaßen lassen den Lehnstuhl winzig und ungeeignet erscheinen. Stöhnend wuchtet er sich in die Höhe, wobei er zunächst im Stuhl stecken bleibt und sich erst von den Klammern der Lehnen befreien muss. Er streckt mir die Hand entgegen und stößt völlig geschafft seine Begrüßung aus:
<Hi Eddie, ich bin Joe Kamahamaho. Wie geht es ihnen?>
Seine Hand fühlt sich an wie ein riesiges Puddingteilchen. Ohne eine Antwort abzuwarten spricht er weiter:
<Ihr Arzt rief mich an und erzählte mir von ihrer Amnesie. Ich habe heute Morgen am Strand recherchiert. Sie sind wohl schon häufiger am Hookipa Beach gesehen worden. Dort steht auch ein alter roter Pick-up seit vorgestern. Die Einheimischen sagten, der Deutsche hat es eigentlich verdient Wasser zu schlucken, wenn er an solchen Tagen stört. Nett, dass sie dich trotzdem gerettet haben!>, beendet er glucksend seinen Sermon, nur selbst amüsiert über seinen Humor.
Ich frage mich ob er ernsthaft meint, dass Revierplänkeleien unter Surfern ausreichend seien, um einen Menschen in Not sterben zu lassen. Den Kommentar spare ich mir vorerst und melde dem Ordnungshüter gewissenhaft:
<Es gibt leider nichts zu erzählen als das, was sie nicht schon vom Arzt wissen. Ich wäre froh, wenn Sie mir auf schnellst möglichem Weg zu meiner Identität zurück verhelfen würden. Können Sie mich zu meinem Wagen fahren, falls es denn mein Wagen ist?>
<Sicher, wann immer der Arzt sie gehen lässt.>, entgegnet Officer Joe.
Der Arzt verordnet mir allerdings streng dreinschauend einen einwöchigen Bettaufenthalt. Ich könne ihn nur durch die Unterschrift unter eine schriftliche Belehrung abkürzen. So unterschreibe ich und verspreche später zur Bezahlung wiederzukehren. Ich kann hier nicht einfach weiter herumsitzen und hoffen, dass mit dem Blütenduft von draußen auch meine Erinnerungen wieder hineingeweht werden.
Schwester Li leiht mir freundlicherweise noch ein weißes T-Shirt eines Kollegen unter der Bedingung, es ihr persönlich zurückzugeben. Dem stimme ich gerne zu, nicht ganz ohne Hintergedanken. Ich habe das Gefühl, dass unser Verhältnis über das zwischen Schwester und Patienten hinausgeht. Vielleicht ist es auch nur ein Wunschgedanke und ich überschätze etwas die Intimität unseres Kontaktes, denke ich mit einer gewissen Selbstironie. Zum Abschied halte ich einen Moment zu lange ihre Hand und sie lächelt mich an. Ich versuche es mit dem Lachen zu erwidern, dass mir vorhin im Spiegel vorteilhaft erschien. Es scheint mir fast dass es wirken würde, denn Li senkt schnell verlegen ihren Blick und ihrer Wangen erröten.
Wenig später machen Joe und ich uns auf dem Weg. Als ich nach draußen trete blendet mich das grelle Mittagslicht und mir wird etwas schwindelig. Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen. Auf dem Weg zum Auto säumen riesige Hibiskus Büsche den Weg. Die pinke und gelbe Farbenpracht ist überwältigend und ein lauwarmer Wind weht mir angenehm entgegen.
Das ist mein erster Eindruck von Maui.
Dann rollen wir schon in der schwarzen Polizeilimousine durch eine anonyme amerikanische Stadt über einen breiten Boulevard, nichtssagend wie wahrscheinlich die meisten amerikanischen Städte. Wie in einem Hollywoodfilm geben allerdings der blaue Himmel und die wiegenden, die Straße säumenden Palmen der Stadt ein freundliches Gesicht. Meine Gemütsverfassung hellt sich zusehends auf.
Ich frage Jo um etwas Konversation zu machen: <Sagen sie, wer war denn dieser Eddie Aikau, dessen Namen ich vermacht bekam?>
Er antwortet fast schon empört: <Sie kennen Eddie nicht? Dann können sie kein Surfer sein oder noch nicht lange auf dieser Insel. Ach, ich vergaß ihre Amnesie. Eddie ist eine Legende hier auf den Inseln. Er war der erste Lifeguard in Waimea und rettete mehr als 500 Menschenleben. Dann war er der beste Bigwavesurfer seiner Zeit und gab sein Leben für seine Bootscrew, als ihr Boot kenterte und er mit seinem Surfboard Hilfe holen wollte. Er ist auf dem Meer mit 31 Jahren verschollen. Daher kennt hier jeder das Sprichwort „Eddie would go“.>, beendet er jetzt lachend seinen Vortrag.
Wir fahren durch endlose Zuckerrohrfelder, die hier soweit das Auge reicht den Fuß des Vulkanes bedecken. Die Insel ist ein riesiger Vulkankegel, dessen Hänge hier zum Strand hin abflachen. Als wir schließlich durch eine kleine Westernstadt namens Paia fahren, beschleicht mich ein unbestimmtes Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Konkret kann ich mich aber an nichts erinnern. Es ist, als ob ich immer wieder an eine verschlossene Türe gelange, die ich nicht in der Lage bin zu öffnen. Ich fange an zu schwitzen und versuche nicht an die Konsequenzen zu denken, die eine andauernde Amnesie mit sich bringen würde. So beobachte ich weiter die mir fremde aber wunderbare Landschaft, die an mir vorbeizieht.
Wir folgen weiter der Straße parallel zum Meer und ich sehe eine kleine Kirche von Palmen umgeben auf einer Wiese am Strand stehen. Welch ein idyllisches Beieinander von geistlichem und weltlichem, denke ich versonnen. Dann halten wir an einer Parkbucht, der Highway bietet von seiner Anhöhe einen Blick auf das türkise Meer. Die Zeit scheint stillzustehen, der Horizont legt sich in Falten und das Wasser eilt dem Ufer zu. Wie mit dem Lineal gezogen laufen hohe, endlos lange Wellen auf die Bucht zu, bilden auf dem dunklen Riff glasklare, konkave Wasserwände und brechen sich donnernd kurze Zeit später gleichmäßig von rechts nach links, wobei nur noch ausrollende Gischtfinger den Strand erreichen. Ich kann meinen Blick nicht vom Meer abwenden, es zieht mich in seinen Bann, mein Herz schlägt schneller, ich schmecke das Salz auf meinen Lippen und möchte mich am liebsten unmittelbar in die Brandung stürzen.
Dieses Element muss eine dominante Rolle in meinem Leben gespielt haben.
Nach dem Schild „Hookipa Beach Park“ fahren wir hinunter zum Strand und parken neben einem roten, völlig verrosteten Pick-up. Beim Aussteigen reißt mir der Wind fast die Türe aus der Hand. Wie ein warmer Föhn schüttelt der Passat die dickblättrigen, gedrungenen Bäume am Ufer, die den Surfern Schatten spenden. Das Bild dieser Bucht ist mir vertraut. Überall fläzen sich athletische braungebrannte Menschen in Surfshorts und Sonnenbrillen im gleißenden Licht. Sie sitzen im Sand oder auf der Ladefläche ihrer Trucks, blicken im Gespräch immer wieder suchend auf das Wasser und verfolgen die Wellenreiter, die in unmittelbarer Strandnähe auf hohen Wellenwänden hinabschießen.
Die Atmosphäre hier ist mir sympathisch. Objektiv betrachtet ist sie surreal. Ein Haufen halbnackter erwachsener Menschen spielt im Wasser, andere beobachten sie dabei mit einem Interesse, dass sie den Rest der Welt vergessen lässt. Es wirkt, als wollten diese Menschen nicht erwachsen werden, als hätten sie es sich in ihrer Jugend gemütlich gemacht.
Intuitiv fühle ich mich hier zu Hause.
Der Officer verfällt kurz ins private und begrüßt einige der Surfer im vorbeigehen lachend mit dem Surfergruß, bei dem er den Daumen und den kleinen Finger abspreizt. Besonders die kräftigeren Männer dunklerer Hautfarbe und hawaiianischen Ursprungs scheinen ihn zu kennen und grüßen ihm freundlich zurück. Mich ignorieren sie. Mir fällt auch auf, dass die anderen Surfer weißer Hautfarbe meist unter sich bleiben.
Mit zusammengekniffenen Augen verfolgt der Officer einen Surfer, der gerade eine mächtige Welle angepaddelt hat und schon fast in freiem Fall den Hang herabsaust. Unten am Fuße setzt er zur Kurve an, schießt wieder zur brechenden Wellenlippe hoch, katapultiert sich in die Luft und verliert dabei den Halt zu seinem Brett. Nach dem Eintauchen ins Wasser wird er zunächst den Wellenhang nach oben gesaugt und von der brechenden Welle nach vorne geworfen. Dann erfasst ihn die weiße rollende Schaummasse und schleudert ihn lange, bis er in Ufernähe wieder auftaucht.
Die Zuschauerriege kommentiert den Wellenritt zunächst durch ein begeistertes ohhhh, den folgenden Waschgang durch ein mitleidiges mmhh. Dass er unverletzt aus dem Wasser steigt, wird respektvoll durch Händeklatschen und gelegentliches Johlen honoriert.
Ich spüre Erinnerungsfetzen in mir aufsteigen und sehe meine letzten Sekunden vor dem Unfall aufblitzen. Allerdings registriere ich, dass ich ein Segel in der Hand halte und auf einer Welle epischen Ausmaßes das gleiche Manöver versuche. Plötzlich taucht ein Wellenreiter vor mir auf. Um ihn nicht zu rammen, weiche ich aus und stürze. Ich werde von der Welle begraben, alles dreht sich und reißt gewaltig an mir. Ich weiß nicht mehr wo oben und unten ist. Wahrscheinlich bin ich dann mit dem Riff in Berührung gekommen, denn hier reißt der Erinnerungsfaden ab.
Noch etwas abwesend schüttele ich dem aus dem Wasser gestiegenen Surfer die nasse Hand, als er auf uns zukommt und sich als Laird vorstellt. Er entspricht jedem Klischee eines Surfers, ist blond, braungebrannt und hat einen muskulösen Stiernacken.
Ich nenne mich Ed, da mir nichts Besseres einfällt.
<Dafür, dass du versuchtest mich mit deiner Finne zu zerteilen, hätte ich dich ertrinken lassen sollen.>, raunzt er mich mit einem nassen Grinsen an,
<Ich weiß nicht, warum ich dich dort rauszog. Wellenreiter fahren rechts in der Bucht, euch Windsurfern gehört der linke Teil. Dass du allerdings draußen warst, verdient Respekt. Vorgestern war einer der höchsten Tage des Jahres.>
<Was soll ich sagen, ich verdanke dir wohl mein Leben. Kann ich mich revanchieren?>, versuche ich der Situation entsprechend bescheiden zu reagieren.
<Hoffentlich niemals!> erwidert er, schon wieder konzentriert auf das Meer blickend.
<Ich finde einen Weg, wo wohnst du?> frage ich den schon Davoneilenden.
<In Paia, direkt hinter der Paipala Church.>, ruft er noch auf dem Weg zum Wasser.
Der Officer watschelt zu dem roten Pick-up, stützt sich mit der einen Hand am Spiegel ab und hält sich mit der anderen am Dach fest um durch die verschmutzten Scheiben zu blicken. Ich folge ihm und spähe auch ins Wageninnere. Dabei beschleicht mich ein unangenehmes Gefühl. Es ist, als ob ich im Leben eines Fremden herumwühle in dem ich nichts verloren habe.
Der rostige Ford ist bestimmt 30 Jahre alt. Aus der einteiligen, durchgesessenen Sitzbank quillt teilweise das Futter und es gibt keine Nackenstützen. Solche Oldtimer werden hier bestimmt nicht mehr vermietet. Ich werde ihn wahrscheinlich gekauft haben, da ich bestimmt geplant habe für längere Zeit zu bleiben. Auf der Ladefläche liegen offen Windsurfutensilien. Die Surfer scheinen ein ehrliches Volk zu sein. Offensichtlich haben sie meine Ausrüstung nach meinem Unfall dorthin gepackt und nachts hat sie keiner stehlen wollen.
Ich spüre, dass der Wagen irgendwie zu mir gehört, ohne dass ich das Fahrzeug als mein Eigentum wiedererkenne. An dich werde ich mich gewöhnen müssen, sage ich mir und tätschle seinen warmen Kotflügel.