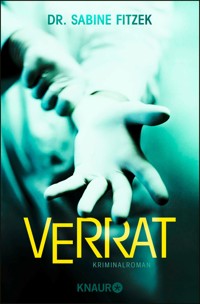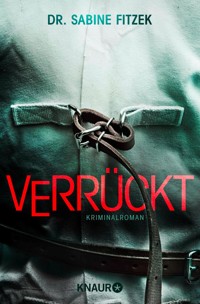9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kammowski ermittelt
- Sprache: Deutsch
Wenn Leben nimmt, wer Leben retten soll: Im dritten Teil der Medizin-Krimi-Reihe von Sabine Fitzek ermittelt der Berliner Kommissar Kammowski im Krankenhaus Moabit. Seit einem Jahr landen immer wieder Eingaben bei der Berliner Staatsanwaltschaft: Kerstin Lauterbach unterstellt dem Pfleger Maik Thomasson, im Krankenhaus Moabit ihre Mutter getötet zu haben – nur hat sie dafür keinerlei Beweise. Als gegen Thomasson anonym neue Vorwürfe vorgebracht werden, die von medizinischen Kenntnissen zeugen, wird Kommissar Kammowski gebeten, diskret ein paar Nachforschungen anzustellen. Der Fall scheint zunächst nicht besonders dringend zu sein, doch dann geht erneut eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ein. Das Opfer, eine bereits etwas verwirrte alte Dame, hat eine Reanimation im Moabiter Krankenhaus nur knapp überlebt und beschuldigt nun einen Pfleger mit "krüppeligen Ohren". Maik Thomasson hat tatsächlich auffällige Ohren, aber der Pfleger gilt als kompetent und ist am Arbeitsplatz angesehen. An diesen bizarren Vorwürfen wird doch nichts dran sein. Oder etwa doch? Aktuell, brisant und hochkompetent: Sabine Fitzek ist Neurologin und hat 10 Jahre als Chefärztin gearbeitet. In ihrer Krimi-Reihe setzt sie sich spannend und informativ zugleich mit den Missständen in unserem Gesundheitssystem auseinander. Die Medizin-Krimis mit Kommissar Kammowski aus Berlin sind in folgender Reihenfolge erschienen: • »Verrat« • »Verrückt« • »Verstorben«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dr. Sabine Fitzek
Verstorben
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Seit einem Jahr landen immer wieder Eingaben bei der Berliner Staatsanwaltschaft: Eine Angehörige unterstellt dem Pfleger Maik Thomasson, im Krankenhaus Moabit ihre Mutter getötet zu haben – nur hat sie dafür keinerlei Beweise.
Als anonym neue Vorwürfe vorgebracht werden, die von medizinischen Kenntnissen zeugen, wird Kommissar Kammowski hellhörig. Das Opfer, eine bereits etwas verwirrte alte Dame, hat eine Reanimation nur knapp überlebt und beschuldigt nun einen Pfleger mit »seltsamen Ohren«. Doch wer sollte es wagen, diesen bizarren Vorwürfen gegen einen der erfahrensten Lebensretter der Klinik nachzugehen?
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Nachwort
Prolog
Die Nacht ging allmählich in die Dämmerung über. In den hell erleuchteten, im Innern des Gebäudes liegenden Arbeitsräumen der Intensivstation war davon nichts zu bemerken. Der Mann betrat den Raum, betätigte den Hebel des Desinfektionsmittelspenders an der Wand und gab mehrere Hübe in seine linke Hand. Dann desinfizierte er sorgfältig: zunächst die Handinnenflächen, die Außenseiten, die Finger, auch die Zwischenfingerräume, dann die Fingerspitzen und Fingernägel, achtete darauf, dass alles reichlich mit der Flüssigkeit benetzt war, und vergaß auch die Daumenballen nicht, ganz so, wie er es gelernt hatte. Es war ihm zur Routine geworden. Nachdem die Hände getrocknet waren, zog er sich Einmalhandschuhe über, öffnete die Medikamentenschublade und entnahm ihr vier Ampullen. Mit der Eleganz eines Barkeepers, der nachts um vier noch Cachaca, Limette, Rohrzucker und crushed Eis zu einem perfekten Drink mixt, prüfte er die Haltbarkeitsdauer und den Inhalt der Ampullen auf Schwebstoffe, die auf Verunreinigungen hinweisen konnten, indem er jede Ampulle gegen das Licht hielt. Keine Beanstandungen. Aus einem der oberhalb der Ablage angebrachten Kippfächer entnahm er nun zwei 10-ml-Spritzen. Vorsichtig zog er die beiden Papierstreifen am Ende der Verpackung auseinander, um diese so aufreißen zu können, dass der Konus der Spritze beim Herausnehmen steril blieb. In einem zweiten Kippfach waren die grünen 22-Gauge-Kanülen gelagert. Er entnahm eine und verfuhr mit ihr ebenso wie mit der Spritze. Nachdem er Kanüle und Spritze konnektiert hatte, drehte er die erste Ampulle so, dass der rote Punkt, der anzeigte, dass die Sollbruchstelle optimal positioniert war, ihn direkt ansah. Als er den Kopf der Ampulle brach, gab es einen leisen Plopp, als wäre eine Sektflasche entkorkt worden. Mit den übrigen drei Ampullen verfuhr er ebenso. Während er das Metallröhrchen vorsichtig in die Ampulle einführte, achtete er darauf, nicht mit der Kanüle den unsterilen Rand der soeben erbrochenen Glasampulle zu berühren. Mit über Jahren trainierten Fingern zog er den Stempel an und sog damit den Inhalt erst der einen, dann der zweiten Ampulle in die Plastikspritze. Ein schlürfendes Geräusch zeigte jeweils an, dass der gesamte Inhalt einer Ampulle in den Spritzencontainer überführt worden war. Es war nicht ganz zu vermeiden, dass man gegen Ende des Vorgangs auch etwas Luft mit anzog. Prüfend hielt er die Spritze senkrecht gegen das Licht. Mit schnippendem Zeigefinger klopfte er kleine Luftbläschen aus der klaren Flüssigkeit ans obere Ende der Spritze, wo sich die Luft sammeln konnte. Schließlich bewegte er den Stempel der Spritze ein wenig, um das Medikament in den Konus zu drücken. Gerade so viel, dass die Luft entweichen konnte, aber keine Flüssigkeit austrat. Luft zu injizieren, war gefährlich. Es konnte zu Luftembolien kommen. Zwar reichten ein paar kleine Bläschen in einer Spritze dafür nicht aus – es bedurfte schon einer größeren Menge, um einen Tod durch Luftbolus auszulösen –, aber gelernt war nun einmal gelernt. Nachdem er den Inhalt der zwei übrigen Ampullen in eine zweite Spritze aufgezogen und die Kanüle in den Spezialcontainer entsorgt hatte, versah er beide Spritzen mit sterilen Plastikverschlüssen, steckte sie in die Brusttasche seines Kasacks, griff nach einer Hautdesinfektionsflasche, verließ den Arbeitsraum und begab sich ans Bett der Patientin.
Sie schlief, soweit man bei einer komatösen Patientin von Schlaf sprechen konnte. Ihr Brustkorb hob und senkte sich im Rhythmus der pumpenden Geräusche, die die Beatmungsmaschine neben ihrem Bett von sich gab. Kurz betrachtete er die Frau. Ihre Augen waren geschlossen, das Gesicht geschwollen, der gewaltige Körper wölbte sich unter der dünnen Bettdecke. Unter dem kittelartigen Gewand, das man ihr angelegt hatte, war sie nackt. Das war notwendig, um all die Schläuche, die in den Körper hinein- und aus ihm herausgingen, überwachen zu können. Der Monitor oberhalb des Bettes übersetzte die ruhige Herzaktion in einen regelmäßigen 2/2-Rhythmus.
Ein routinierter Blick auf weitere Parameter zeigte dem Mann, dass Sauerstoff- und CO2-Sättigung im Normbereich lagen, die Beatmungsparameter passten, er regulierte nur den Beatmungsdruck etwas herunter. Erst eine halbe Stunde zuvor hatte er aus dem arteriellen Zugang am Handgelenk eine Blutprobe entnommen, um die Blutgase und die Elektrolyte zu überprüfen: Alles in Ordnung.
Noch einmal desinfizierte er die jetzt behandschuhten Hände, dann trat er an das Bett, ordnete die Schläuche, die zum zentralen Venenkatheter am Hals führten, griff den Dreiwegehahn, nahm den Verschluss, eine kleine rote Plastikkappe, ab, desinfizierte die Ansatzstelle mit dem Sprühdesinfektionsmittel, setzte die Spritze an, drehte den Dreiwegehahn so, dass der Weg von der Spritze zum Venenkatheter frei war, und verabreichte den Inhalt der ersten, dann der zweiten Spritze. Durch Öffnen des Ventils an der laufenden Infusion und erneutes Betätigen des Dreiwegehahns, sodass jetzt der Weg von der laufenden Infusion zum Patienten freigegeben war, sorgte er dafür, dass das Medikament rasch in den Kreislauf gespült wurde und nicht im Schlauch des zentralen Venenkatheters verweilte. Dann verschloss er den Zugang mit einem frischen Stopfen, regulierte das Ventil der Infusion wieder auf weniger Durchfluss, löschte das Licht und verließ den Raum.
Wenige Minuten später riss der gellende Ton des Notfallalarms die Intensivstation aus dem Schlaf.
Kapitel 1
Die Nachtbeleuchtung ließ nur seine Umrisse erkennen. Nahezu reglos kauerte er neben dem Bett auf einem Sessel. Die Vorhänge am Fenster waren nicht geschlossen, aber von draußen drang kein Licht in den Raum. Das Blinken der Überwachungsgeräte, die hygienisch glatten Oberflächen aus Metall und Kunststoffen, das Pfeifen der Beatmungsmaschinen, ein gelegentlicher Alarm oder ein kurzes Stöhnen in einer ansonsten stillen und fremden Welt. Manchmal hatte Martin das Gefühl, dass ihm die Wirklichkeit zusehends entglitt. War er hier tatsächlich in einem Krankenhaus? Es hätte auch ein Raumschiff sein können, irgendwo im Weltraum, da, wo Raum und Zeit ineinander übergingen und die Realität nur eine von vielen Parallelwelten war.
Martin Langer sah auf sein Smartphone: kurz vor zwei Uhr. Er fröstelte trotz der Einmaldecke, die ihm jemand gereicht hatte. Um diese Zeit war es immer am schwersten, wach zu bleiben. Die Augen fielen automatisch zu, und er nickte immer wieder ein, träumte wirres oder beängstigendes Zeug. Trotz seiner Müdigkeit wäre er lieber wach geblieben. Mehr als einmal hatte ihm eine besorgte Krankenschwester geraten, doch nach Hause zu gehen, ein paar Stunden zu schlafen und dann erfrischt wiederzukommen.
Wenn er das nur gekonnt hätte! Er wusste, zu Hause angekommen, würde er kein Auge zutun, er wäre in Gedanken immer hier bei ihr am Krankenbett, hätte Sorge, genau in diesem Moment etwas Wesentliches zu verpassen, wobei er sich nicht gestattete, darüber nachzudenken, was »das Wesentliche« denn genau wäre.
Begonnen hatte das Drama vor Monaten. Franka hatte sich nicht fit gefühlt, aber sie hatten das auf die Arbeit, auf das Wetter und auf alles andere geschoben, was einem so als Ausrede einfiel, wenn sich etwas ereignete, das man nicht wahrhaben wollte. Er quälte sich mit dem Gedanken, dass er als Arzt es doch besser hätte wissen müssen. Im Nachhinein lag alles unverkennbar auf der Hand: die Kurzatmigkeit beim Treppensteigen, das Fieber, das kam und ging. Nicht, dass er sie nicht gedrängt hätte, zum Arzt zu gehen. Das hatte er, aber nicht mit genug Nachdruck. Der war in der Geschäftigkeit des eigenen Alltags untergegangen. Außerdem fehlte einem im Privaten die Distanz zu den Dingen. Die brauchte man aber, um die medizinischen Fakten zu einem Bild zusammenzufügen. Nicht umsonst hieß es, dass man nie seine eigenen Angehörigen behandeln sollte. Dennoch. Er konnte sich das nicht verzeihen. Er hätte sich durchsetzen müssen, mehr Druck aufbauen. Hatte er aber nicht.
Es war eine bakterielle Herzklappenentzündung gewesen, und als Franka endgültig zusammenbrach, waren die Herzklappen nicht mehr zu retten gewesen. Man hatte sie zwar durch eine Operation restaurieren können, aber es war zu großen septischen Infarkten im Gehirn gekommen. Embolien hatten sich von den entzündeten Herzklappen gelöst, waren vom Blutstrom ins Gehirn verschleppt worden und hatten dort verheerenden Schaden angerichtet. Als die beiden großen Krisen, die Operation und die Sepsis, überstanden waren und es ihr immer noch nicht besser ging, waren schließlich MRT-Bilder vom Kopf angefertigt worden, die das Ausmaß der Schäden begreifbar machten. Franka würde sich nie wieder ganz erholen können.
In den folgenden Tagen hatte Martin quälende Zwiegespräche geführt. In seinen Träumen waren sie durch Wälder und Wiesen gelaufen, und er hatte auf sie eingeredet wie auf einen lahmen Gaul. Mit dem Mut der Verzweiflung hatte er versucht, ihr einen Kuhhandel aufzuzwingen: Mit wie viel Behinderung im Alltag wäre sie bereit, sich abzufinden? Mit einer Lähmung? Mit dem Rollstuhl? Mit einer Sprachstörung? Aber Franka hatte in diesen Albträumen nie geantwortet, sie war einfach lachend weitergegangen. Einmal hatte sie ihm den Finger auf den Mund gelegt und ihm bedeutet zu schweigen.
Irgendwann waren diese Träume einfach weggeblieben. Und nun ging es nur noch ums nackte Überleben. Franka lag seit mehr als vier Wochen im Koma, wurde von einer Maschine beatmet und war, obwohl sie schon eine Woche lang keine Betäubungsmittel mehr erhielt, noch nicht wieder aufgewacht. Jeder weitere Tag, der verstrich, das wusste Martin, minderte ihre Chancen. Noch hatte ihn keiner der Kollegen auf die Frage des Organspendens angesprochen. Der nüchterne Anteil in ihm wusste, das würde kommen. Ein anderer, irrationaler Teil rebellierte heftig und sagte, dass das ein gutes Zeichen sei, weil es eben noch nicht so schlecht um sie stehe.
Er stand auf und strich Franka sanft über die Wangen. Wie schmal sie geworden war. Franka war immer schlank gewesen, klein und zartgliedrig, aber jetzt brachte sie wohl kaum noch 45 Kilo auf die Waage. Wie eine Elfe lag sie da in dem für sie zu großen Bett, blass, schon fast ein Wesen aus einer anderen Welt, und jeder einzelne der vielen Schläuche, die aus ihr heraus- und in sie hineingingen, quälte ihn, ein Martyrium, das sie nicht gewollt hätte. Er litt mit ihr, und jeder neue Stich durch ihre wunderbar zarte und weiche Haut, um ihr eine weitere Infusion, eine arterielle Blutdrucküberwachung, oder was sonst für notwendig erachtet wurde, zu legen, schmerzte ihn. Und stach wieder einmal ein Anfänger oder ein ungeschickter Kollege, ohne nachzudenken, vier-, fünfmal zu, bis er endlich traf, hätte Martin ihn erwürgen können. Ausgerechnet er, der als Anästhesist und Intensivmediziner genau dies bei fremden Menschen, ohne mit der Wimper zu zucken, selbst Tag für Tag getan hatte, musste jetzt wegsehen oder das Zimmer verlassen, wenn sie sich an seiner Frau zu schaffen machten.
Martin ging auf den Gang hinaus, um sich etwas die Beine zu vertreten. Die Füße waren ihm in der unbequemen Sesselposition eingeschlafen und zwiebelten. Zwölf Betten wies die Interdisziplinäre Intensivstation auf, in sechs Räumen aufgereiht und von einem langen Gang aus erschlossen. Am Ende des Ganges folgten der Schwesternsitz und dahinter der Arbeitsraum mit den Medikamenten und Vorräten. Auf der anderen Seite des Ganges lagen Toiletten, Bäder, Arztzimmer, weitere Versorgungsräume, Treppenhaus und Aufzug. Die einzelnen Patientenzimmer waren untereinander und vom Flur durch Glaswände abgetrennt. Man hatte bei der Konzeption wohl beabsichtigt, dass wenig Personal die gesamte Station überblicken konnte. Es gab zwar Jalousien vor den Glasscheiben, aber die blieben meist hochgezogen. Im Angesicht des Leids, das sich hier abspielte, rückten Fragen der Diskretion zugunsten der Praktikabilität in den Hintergrund. Wenn man mehrere Patienten in mehreren Räumen zu versorgen hatte, dann musste man den Überblick bewahren.
Martin hatte festgestellt, dass er dünnhäutiger war als früher. Manche Ärzte und Pflegekräfte achteten trotz der üblichen Hektik einer solchen Station auf Diskretion. Sie zogen bei Verrichtungen am Patienten die Jalousien zu oder stellten Paravents auf. Andere verschwendeten an solche Dinge keinen Gedanken. Martin befürchtete, dass er bisher zur zweiten Gruppe gehört haben könnte. Manchmal fragte er sich, ob er überhaupt jemals wieder als Arzt auf einer Intensivstation würde arbeiten können.
Von der Decke hingen gewaltige Ampeln, die die Infusomaten und alles, was man direkt am Bett benötigte, aufnahmen. Überall fehlte es an Platz, wie auf fast allen Intensivstationen, die ja meist nachträglich in alten Gebäuden eingerichtet wurden. Aber selbst neu gebaute Räumlichkeiten waren nicht selten unzulänglich, weil sich die Vorgaben der Architekten mehr an finanziellen Eckpfeilern, an Hygiene- und Brandschutzvorschriften und an Raumnormen für öffentliche Gebäude orientierten als an alltagsarbeitstechnischen Notwendigkeiten. Martin hatte schon auf vielen Intensivstationen gearbeitet, aber keine war optimal konzipiert gewesen. Hier war der viel zu weit entfernte Arbeitsplatz der Pflege das Problem. Die liefen sich die Füße wund, weil die Medikamente und viele der notwendigen Pflegeutensilien am anderen Ende des Flures gelagert wurden. Um sich zu behelfen, hatten sie in jedem Raum einen kleinen Rollschrank mit den notwendigsten Dingen sowie Notfall- und Tagesmedikamenten für den jeweiligen Patienten abgestellt. Eigentlich durften Medikamente nicht frei zugänglich sein, aber irgendwie musste man sich ja den Alltag erträglich einrichten, und die Patienten dieser Station waren in der Regel nicht in der Lage, aufzustehen und Medikamente zu entwenden.
Kapitel 2
Mittlerweile kannte Martin Langer jeden Pfleger, jede Schwester, jeden Arzt, jede Putzfrau und die meisten Patienten. Da war zum Beispiel der unstete Pfleger Maik, ganz der Technik- und Computerfreak, immer dabei, wenn es etwas zu erklären oder zu managen gab. Mit sämtlichen medizinischen Apparaten kannte er sich exzellent aus. Am liebsten hatte er es, wenn er eine Gruppe von Gesundheits- und Krankenpflegern in Ausbildung oder ganz junge Ärzte um sich scharen konnte. Dann konnte er glänzen, konnte auch gegenüber dem Arzt den Ton angeben, der frisch von der Uni kam, in der Praxis noch kaum Erfahrung hatte und froh war, wenn ihn jemand an die Hand nahm. Auch unter seinen Kollegen war dieser Maik geachtet, wenngleich nicht unbedingt beliebt, wie Martin meinte beobachtet zu haben.
Martin hatte sich längst seinen Reim auf ihn gemacht: einer von den geltungsbedürftigen Männern, die in der Intensivmedizin oder im Rettungsdienst zu kleinen Königen wurden. Das begrenzte Spezialwissen über Reanimation und die Geräte einer Intensivstation konnte man sich aneignen, und die Kehrseite der Medaille war ja: Zauderer konnte man im Notfall eben nicht brauchen. Hier waren Menschen gefragt, die nicht zögerten und diskutierten, sondern rasch Entscheidungen trafen. Das allerdings förderte einen bestimmten Typ Mensch, den Martin unsympathisch fand.
Er hatte mehr beobachtet und gehört, als ihm lieb war. Wenn Maik zur Pflege bei seiner Frau eingeteilt war, war er unruhig. Dann ging er gar nicht nach Hause. Er fand ihn in der Pflege zu ruppig, zu wenig zartfühlend.
Schwester Mareike war das genaue Gegenteil. Martin hatte sie ins Herz geschlossen. Sie ging sanft mit den Patienten um, nahm sich Zeit bei der Versorgung, ihre Maßnahmen hatten mehr von Meditation als von Arbeit. Ihre ruhige Art, die sie umgab wie eine Aura, schien auf die Patienten abzufärben. Bei der Körperpflege stellte sie leise Musik an. Sie wusch mit ruhigen und sicheren Handgriffen, und anschließend massierte sie mit Aromaöl: Rosenholz, Kamille oder Lavendel zur Entspannung am Abend, Lemongras, Limette oder Myrrhe zur Anregung am Morgen. Wenn Mareike Nachtdienst hatte, dann warf nicht selten eine Snoezellampe wechselnde Farbringe an die Decke. Das sollte beim Einschlafen helfen.
Martin, der als Arzt solch psychedelisches Arbeiten früher immer als Hokuspokus abgetan hatte, hatte es jetzt zu schätzen gelernt. Er konnte ja beobachten, wie Franka darauf reagierte. Als Schulmediziner wusste er, dass all diese Maßnahmen nicht evaluiert waren, aber schließlich gab es auch in der Schulmedizin reichlich Dinge, die immer schon so gemacht wurden und die noch nie jemand überprüft hatte. Dankbar ließ er sich von Mareike kühlendes Pfefferminzöl geben, um Franka damit zu massieren, wenn sie wieder einmal von Fieber geschüttelt wurde, das die Medikamente nur für kurze Zeit senken konnten. Vielleicht war es auch einfach das Gefühl, etwas tun zu können. In einer Situation, der man ansonsten hilflos ausgeliefert war, gab einem das Einreiben mit Pfefferminzöl ein klein wenig Autonomie und ein Quäntchen Selbstwirksamkeit zurück. Das war erbärmlich, er wusste es. Aber es half.
Martin griff nach der Hemdtasche. Er hatte Zigaretten und Feuerzeug vergessen. Also machte er kehrt, um sie zu holen. Aus dem Nachbarzimmer winkte ihm Frau Wohlgemut einen matten Gruß zu. Gestern Vormittag noch hatten sie sich unterhalten können, jetzt kämpfte sie mit ihrer Atmungsunterstützung durch die Maskenbeatmung. NIV nannte man das, »non-invasive ventilation«. Anstrengend und unangenehm, weil die Maske sehr fest auf Mund und Nase sitzen musste und der Patient dabei wach war. Aber viel schonender für die Lungen als eine richtige Beatmung, bei der der Patient in ein künstliches Koma versetzt wurde und die Maschine über einen Plastikschlauch, der in der Luftröhre platziert war, mit Überdruck Luft in die Lunge pumpte.
Erst heute Morgen hatte man Frau Wohlgemut den Tubus aus den Luftwegen entfernt. Nach dem Rückfall gestern Abend konnte man jetzt noch nicht mehr erwarten, aber warum war es überhaupt zu diesem Rückfall gekommen? Martin, der hier Angehöriger war, hatte keinen Einblick in fremde Krankenakten und konnte nur auf seine Beobachtung vertrauen, aber die hatte etwas anderes prognostiziert. Frau Wohlgemuts Zustand hatte sich in der vergangenen Woche kontinuierlich gebessert. Sie war bereits einige Schritte ums Bett gegangen, hatte stundenweise im Sessel sitzen können, und er hatte immer wieder einmal ein Schwätzchen mit ihr gehalten.
»Ich werde bald von der Intensivstation entlassen«, hatte sie ihm noch gestern Morgen zugeraunt. Sie freute sich so sehr auf zu Hause. Sie hatte sich auf ihre alten Tage ein neues Auto geleistet, und die Kinder hatten versprochen, sie damit vom Krankenhaus abzuholen.
»Stellen Sie sich vor, Herr Langer, da wird man alt wie ’ne Kuh und hat noch nie ein nagelneues Auto gehabt.« Dabei hatte sie laut gelacht, ein noch etwas krächzendes, heiseres und trotzdem ansteckendes Lachen. Eine fröhliche Frau mit einer netten Familie, die sich liebevoll um sie kümmerte. Jeden Tag war jemand da gewesen, und Martin hatte amüsiert beobachtet, wie Frau Wohlgemut selbst noch vom Krankenbett die Fäden in der Hand behielt. Sie war eindeutig das Oberhaupt dieser Sippe.
Eigentlich hatte sie nur eine Hüftoperation gehabt. Aber danach war es ihr nicht gut gegangen. Wahrscheinlich lag es an ihrem Lungenemphysem, mutmaßte Martin. Jedenfalls war sie nun schon seit Wochen auf dieser Intensivstation. Gestern dann die überraschende Verschlechterung. Man hatte sie in der Nacht reanimieren müssen. Maik hatte wohl wieder einmal einen großen Auftritt gehabt, das hatte Martin Schwestern hinter vorgehaltener Hand flüstern hören. Er selbst war zu dieser Zeit einige Stunden zu Hause gewesen, und als er wiederkam, hing Frau Wohlgemut schon wieder am Beatmungsgerät. Was nur die Ursache dieser Verschlechterung gewesen war, die sich andererseits so rasch hatte beheben lassen, dass man Frau Wohlgemut heute schon wieder hatte extubieren können? Martins berufliches Interesse war geweckt, aber er hatte nichts aufschnappen können, und fragen wollte er nicht, der Fall ging ihn nichts an.
Kapitel 3
Martin schlenderte über den Flur zu der überdachten Stahlplattform, wo er eine Zigarette rauchen konnte. Sie führte über eine Treppe in den Garten. Eigentlich hatte Martin sich das Rauchen vor Jahren abgewöhnt, aber jetzt war er rückfällig geworden und rauchte mehr als je zuvor. Trotz eines unübersehbaren Verbotsschildes trafen sich hier vor allem nachts fast alle Schwestern und Pfleger in kurzen Pausen, um eine zu schmöken, bei einer Tasse Kaffee in den Himmel zu schauen und den neuesten Klatsch auszutauschen. Nicht, dass sie viel mit ihm gesprochen hätten, aber sie störten sich auch nicht an seiner Anwesenheit. Meist schien es so, als hätten sie vergessen, dass er da stand, und er war viel zu zurückhaltend und zu sehr mit sich und seinen eigenen Gedanken beschäftigt, um ein Gespräch anzufangen.
Offenbar war heute die Reanimation der letzten Nacht Gesprächsthema. »Das kann mir jetzt doch keiner erzählen, das ist doch nicht normal …«, hörte er eine Schwester aufgeregt zischen. Alles Weitere ging im Gemurmel unter. Martin nahm sich einen der Plastikstühle, setzte sich etwas abseits der Schwestern und Pfleger und versuchte, nicht mitzubekommen, worüber sie redeten.
Die Nacht war für die Jahreszeit angenehm warm, eigentlich zu warm. Von einer Strauchgruppe zur Rechten wehte der Duft von blühendem Flieder herüber und versetzte ihm einen Stich. Warum erinnerte ihn alles immer an Franka? Manchmal schien es ihm, als würde er sich so von ihr verabschieden. Von dem gemeinsamen Leben, den gemeinsamen Erinnerungen. Musste er das alles noch einmal in Gedanken durchleben, um sie gehen lassen zu können? Oft waren es Dinge, die keine besondere Bedeutung hatten, irgendwelche alltäglichen Gespräche oder Begebenheiten. So wie die Sache mit dem Flieder. Sie hatte vor einigen Jahren unbedingt einen Flieder im Garten pflanzen wollen. Warum ausgerechnet jetzt noch einen Flieder?, hatte er gefragt. Der Garten ist doch so, wie er ist, perfekt! Wo soll denn da noch ein Flieder Platz finden?
Ich mag den Geruch, hatte Franka lachend geantwortet und das Platzproblem durch Nichtbeachtung vom Tisch gefegt. Er erinnert mich an meine Kindheit.
Ihn hatte der intensive Fliedergeruch jetzt an diesen Streit erinnert. Der Garten war ihr Refugium. Da nahm er nur Aufträge entgegen, für grobe Arbeiten, die ihr schwerfielen. Bäume fällen, Kompost umschichten und so weiter. Aber er liebte es, mit ihr zu streiten. Sie waren in vielen Dingen so unterschiedlich, und es war ihnen ein Vergnügen, das immer wieder festzustellen, sich an der Andersartigkeit zu erfreuen und sie als Bereicherung zu begreifen. Aus seiner eher sachlichen Betrachtungsweise heraus war der Garten komplett, da war nirgendwo mehr Platz für eine neue Pflanze. Und wenn er etwas hätte umgestalten wollen, was ihm nicht in den Sinn gekommen wäre, dann hätte er erst einmal einen Plan gemacht. Nicht so Franka. Sie kaufte nach Gefühl und überlegte dann, wo die Pflanze noch Platz finden könnte. Und wo kein Platz war, wurde welcher geschaffen, in tagelangen Grabe- und Pflanzorgien, aus denen sie erschöpft, aber glücklich hervorging.
Martin lächelte. Schade, dass auf der Intensivstation keine Blumen erlaubt waren. Sonst hätte er ihr morgen einen Strauß Flieder mitbringen können. Vielleicht würde er einfach einen kleinen Zweig mitbringen und sie heimlich daran riechen lassen. Oder hatte Schwester Mareike auch Fliederduftöl in ihrem Repertoire? Vielleicht konnte Franka dann wenigstens im Traum in ihre glückliche Kindheit wandern. Der Gedanke gefiel ihm.
Gegen vier, er hatte längst wieder in seinem Sessel neben Frankas Bett Platz genommen, schreckte Martin aus einem kurzen, aber tiefen Schlaf hoch und schaute sich irritiert um. Im ersten Moment wusste er nicht, wo er war. Im Nachbarzimmer war das Licht angegangen. Offenbar sah Pfleger Maik nach der schlafenden Frau Wohlgemut, deren Atmungsparameter sich nach der Maskenbeatmung so weit gebessert hatten, dass sie ohne weitere Atemhilfe hatte einschlafen können. Es schien alles in Ordnung zu sein, denn das Licht ging wieder aus, und Maik verließ den Raum. Wenig später schrillte der Alarm. Ein sirenenartiger, durchdringender Ton erfüllte die Station. Und dann ging alles sehr schnell. Im Nachbarraum entstand professionelle Betriebsamkeit. Schwestern und Pfleger kamen angelaufen. Das Reanimationsbrett wurde aus dem Flur, wo es griffbereit an der Wand hing, herbeigeholt und unter Frau Wohlgemut geschoben. Jemand begann mit der Herzdruckmassage, Pfleger Maik kam mit dem Notarztrucksack angerannt und rief: »Weg da, mein Patient!« Die anderen wichen zurück. Binnen weniger Sekunden verwandelte sich die Station von einem ruhig in der Ewigkeit dahingleitenden Raumschiff in einen Hexenkessel. Alle kämpften um das Leben der Frau.
Martin wandte sich traurig ab. Da hatte Frau Wohlgemut es offenbar doch nicht geschafft. Er hatte unzählige Reanimationen gesehen und selbst durchgeführt. Jetzt und hier hatte er eine andere Position. Die des Beobachters, die des Angehörigen, die des Mitleidenden, und der wollte sich abwenden und die Augen schießen, wollte die Brutalität des Wiederbelebungsaktes, der auf brechende Rippen keine Rücksicht nehmen konnte, nicht mehr sehen.
Sein Blick fiel auf Frankas Gesicht. Sie hatte die Augen weit offen, als hätte der Notfall sie geweckt und beunruhigt. Ein trügerischer, scheinbarer Blick, hinter dem am Ende doch wieder nur das endlose Koma lag; ein Blick ohne Seele, aus Augen, die langsam von einer Wand zur nächsten schauten, als wollten sie die Situation erfassen oder kommentieren, die aber doch nicht sahen. »Schwimmende Bulbi« hieß das in der medizinischen Fachsprache, und es besagte nichts Gutes. Jetzt sagte es ihm: Es ist genug.
Wieder wanderte sein Blick in den Nebenraum, wo die Reanimation noch im vollen Gange war. Mit einem Mal fühlte Martin sich ruhig und klar. Während er das hektische Kommen und Gehen im Nachbarzimmer mit neuer Distanz aus den Augenwinkeln beobachtete – trotz aller Routine sah es von außen betrachtet aus wie das organisierte Chaos –, erledigte er letzte Dinge am Bett seiner Frau, zog die Bettdecke glatt, strich ihr noch einmal über das ehemals volle, gelockte dunkle Haar, das jetzt in fettigen Strähnen an ihrem Kopf klebte, küsste sie und verabschiedete sich mit einem letzten zärtlichen Blick. Schließlich wandte er sich ab und verließ die Intensivstation ohne Hast. Niemand sah ihn, niemand hätte zu sagen gewusst, wann er gegangen war, ob er überhaupt da gewesen war. Zu sehr war er in den letzten Wochen mit der Station verschmolzen, war Teil von ihr geworden. Martin Langer hatte Abschied genommen. Er würde nicht wiederkommen. So lange hatte er mit dieser Entscheidung gerungen, jetzt konnte er seinen Frieden damit machen.
Erneut durchbrach der schrille Ton der Notrufalarmanlage der Intensivstation die Stille. Wieder ein Notfall! Martin zögerte kurz, dann zog er die Tür der Intensivstation energisch hinter sich ins Schloss. Es war ihm, als streife er die Erlebnisse der vergangenen Wochen wie eine alte Haut ab. Draußen vor dem Haupteingang zündete er sich eine letzte Zigarette an. Er würde wieder aufhören zu rauchen. Die noch kühle Morgenluft tat ihm gut. Auf einmal spürte er die Müdigkeit der letzten Wochen. Er sehnte sich nach seinem Bett, wollte jetzt nur noch nach Hause. Auf halbem Weg zum Parkplatz besann er sich, drehte um und suchte einen Weg über die Grünanlagen zur Rückseite des Gebäudes. Er musste nicht lange suchen, der Fliederduft wies ihm den Weg. Er brach einen Ast. Der intensive, beinahe strenge Duft nahm ihm fast den Atem, ein Geruch von Tod, Abschied und von Trost.
Kapitel 4
Als gegen sechs Uhr das Telefon klingelte, ahnte Kerstin Lauterbach sofort, dass etwas Schlimmes passiert war. Warum sollte sonst jemand um diese Uhrzeit anrufen?
»Hier ist Schwester Laura von der Intensivstation des Moabiter Krankenhauses. Spreche ich mit Frau Kerstin Lauterbach?«
»Ja«, antwortete Kerstin, »ist etwas mit meiner Mutter?«
Eine kurze Stille entstand.
»Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Mutter vor wenigen Minuten gestorben ist. Sie hatte einen Herzstillstand. Es tut mir sehr leid. Wir haben alles versucht, sie aber nicht mehr zurückholen können.«
Zurückholen, ein unpassender Begriff, dachte Kerstin. Er suggerierte, dass der Mensch eigentlich schon »drüben« gewesen war, »auf der anderen Seite des Jordans, im Reich des Hades«. Sie war selbst ausgebildete Krankenschwester. Sie wusste, dass man niemanden, der die Schwelle des Todes einmal überschritten hatte, »zurückholen« konnte. Allenfalls in der Übergangsphase konnte man das Segel noch herumreißen. Aber was sollte die Haarspalterei in diesem Moment, in dem sie von der Flut ihrer Gefühle fast mitgerissen wurde?
Aber warum? Es ging ihr doch schon wieder so gut, dachte sie immer wieder, während sie ihren Bruder Manfred und die Schwägerin anrief, um sie zu informieren. Noch am Abend, bevor sie selbst schlafen gegangen war, hatte sie auf der Station angerufen, um der Mutter eine gute Nacht zu wünschen. Wenn die Pflege nicht zu beschäftigt war, dann reichten sie ihr manchmal das mobile Stationstelefon ans Ohr, damit sie kurz miteinander sprechen konnten. »Geht leider nicht, sie schläft schon«, hatte Pfleger Maik gesagt, »alle Parameter sind so weit im Normbereich, aber sie war sehr müde, das ›Niven‹ hat sie sehr angestrengt.«
Dafür hatte Kerstin Verständnis gehabt, sie wusste, wie unangenehm der Mutter die Maskenbeatmung war. Und wenn sie schlief, dann war das sehr gut. Sie hatte nicht gewollt, dass man ihre Mutter extra weckte. Jetzt wünschte sie sich nichts mehr, als dass sie darauf bestanden hätte, sie zu sprechen.
Kerstin Lauterbach war eine etwas stämmige, nicht sehr große Frau Ende dreißig, die von Fremden oft falsch eingeschätzt wurde. Sie wirkte durchsetzungsstark, ja rabiat. Der kräftige Körperbau, der zweifarbige Raspelhaarschnitt, die vielen Tattoos auf brauner Lederhaut, wie sie nur intensives Nutzen eines Bräunungsstudios hervorrufen konnte, die Piercings in Zunge, Nase und Ohren und die Narben auf den Unterarmen – Relikte aus Zeiten in ihrer Jugend, als sie sich geritzt hatte – gaben ihrer Gesamterscheinung etwas Hartes, Wehrhaftes, und ihre Vorliebe für schwarze Kleidung und derbe Stiefel trug erst recht zu dieser Fehlwahrnehmung bei. In Wirklichkeit war Kerstin von sanftem, scheuem Wesen und kämpfte zeit ihres Lebens damit, sich gegen andere durchzusetzen, von ihnen als eigenständige Person mit eigenen Bedürfnissen wahrgenommen zu werden. Wobei das Hauptproblem wohl darin bestand, dass sie sich selbst lange nicht als ein solches Wesen hatte sehen können. Nach mehreren gescheiterten Beziehungen zu Männern, die sie ausgenutzt und missbraucht hatten, unglücklichen Versuchen auch mit Frauen, zwei Psychotherapien, Bergen von Antidepressiva und einigen einsamen Jahren hatte sie endlich Tom kennengelernt, ihren jetzigen Ehemann, der ihre Leidenschaft für Heavy Metal und Labradore teilte, aber auch nichts gegen eine dauerhafte Beziehung und Kinder einzuwenden gehabt hatte. Ein Mann, der sich um ihr Wohlergehen sorgte – ein Umstand, der sie immer wieder in Erstaunen versetzte. Wenn Kerstin morgens aufwachte, dann suchte ihr erster Blick im Nachbarbett nach ihm. Sie konnte ihr Glück noch immer nicht fassen und befürchtete insgeheim, eines Morgens feststellen zu müssen, dass alles nur ein schöner Traum gewesen war.
Zu ihrer Mutter hatte Kerstin ein enges Verhältnis. Die Mutter hatte genau wie sie selbst unter dem brutalen Ehemann, Kerstins Vater, gelitten und war, im Gegensatz zu anderen Familienmitgliedern, die Einzige, die verstanden hatte, dass Kerstin diese Rüstung brauchte, um in der Welt zu überleben. Es verging kein Tag, an dem die beiden nicht telefonierten. Eigentlich war die Mutter mit ihren siebzig Jahren noch nicht alt und recht gesund. Sicher, sie rauchte seit ihrer Jugend, und ihre Stimme hörte sich an wie ein Reibeisen, rau und laut, aber sie war nie ernsthaft krank gewesen, und die Hüftoperation war ein Routineeingriff, zu dem Kerstin, die Krankenschwester in der Familie, sie hatte überreden müssen. Zu lange hatte sie sich schon mit diesen Schmerzen geplagt, und so eine OP war doch heute keine große Sache mehr. Das hatten sie jedenfalls gedacht. Kerstin wurde einfach das Gefühl nicht los, dass sie schuld war am Tod ihrer Mutter. Ohne ihr ständiges Drängen hätte die sich nie operieren lassen.
Zwei Stunden später fand sich die Familie, Kerstin, ihr Mann, ihr Bruder und ihre Schwägerin, deren Töchter und ihre eigenen zwei Söhne, auf der Intensivstation ein, um Abschied zu nehmen.
»Wir haben wirklich alles nur Mögliche getan«, bestätigte ihnen der Oberarzt. »Gestern Abend ging es ihr eigentlich wieder ganz gut. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir nicht, was in der Nacht passiert ist. Vielleicht eine Lungenembolie, vielleicht ein Herzinfarkt. Jedenfalls hat das Herz plötzlich aufgehört zu arbeiten, und trotz sofortiger Reanimation hat es nicht wieder zu schlagen begonnen. Wir haben eine Stunde lang um sie gekämpft, mussten aber irgendwann aufgeben. Wenn wir wirklich wissen wollen, was zu ihrem Tod geführt hat, müssten wir eine Obduktion beantragen. Dafür bräuchten wir Ihr Einverständnis.«
Die Angehörigen sahen einander fragend an. Jetzt, in diesem Moment, fühlten sie sich von dieser Entscheidung überfordert. Schließlich sagte Kerstins Bruder Manfred: »Das bringt sie uns doch auch nicht zurück.«
Seine Frau Petra stimmte ihm zu.
»Ich glaube nicht, dass sie das gewollt hätte«, stieß die Nichte Lisa hervor. Man konnte sie kaum verstehen, sie kämpfte mit den Tränen.
Wahrscheinlich haben sie recht, dachte Kerstin und unterdrückte ein leises Unbehagen, das sie nicht recht einordnen konnte, dem sie jetzt aber auch nicht nachgeben wollte. Im Augenblick forderte erst einmal die Trauer ihren Tribut.
Kapitel 5
Kriminalhauptkommissar Kammowski stand vor seinem Toaster und überlegte, wie er den Toast in den Schlitz bekommen sollte. Da er nicht oft Toastbrot aß, pflegte er den geschnittenen Laib einzufrieren und portionsweise aus dem Gefrierschrank zu nehmen. Bei dieser Scheibe, und auch bei fast allen anderen, wie er mit einem kurzen Blick auf die Packung feststellen musste, war eine Ecke komplett umgeknickt, und sie war in dieser Position gefroren. Da hatte jemand, mutmaßte Kammowski, indem er die gesichteten Fakten messerscharf analysierte, noch bevor das Toastbrot richtig gefroren war, eine Plastikdose Eis in den Gefrierschrank gequetscht, ohne jede Rücksicht auf seinen Toast!
Als »jemand« kamen genau zwei Personen seines Haushalts in Betracht, zwei Personen, die einander oft bis aufs Messer zu hassen schienen, sich aber nichts darin nahmen, ihre – und damit seine – Umgebung in Chaos und Unordnung zu verwandeln und das auch noch für ihr gutes Recht zu halten beziehungsweise alle, die das anders sahen, also ihn, als kleinbürgerlich und spießig abzutun.
Vorsichtig versuchte Kammowski, den inzwischen angetauten Toast zurechtzubiegen. Dabei brach die Ecke ab. Resignierend nahm er eine zweite gefrorene Scheibe aus der Verpackung, schnitt hier die umgeklappte Ecke mit dem Messer ab und steckte die beiden Restteile in das Gerät.
In einem geschlossenen System nimmt die Entropie zu. Alles auf der Erde strebt den Zustand der Unordnung an, pflegte sein Freund Klaus zu sagen. Lohnt sich nicht, dagegen anzukämpfen, war seine Empfehlung. Der Mann hatte gut reden. Schließlich hatte er seinen Junggesellenhaushalt noch nie für länger als eine Nacht aufgegeben. Seufzend belud Kammowski das Tablett mit seinem Kaffeepott, der Schwarze-Johannisbeer-Marmelade, dem Honig, der Butter und dem Smartphone, auf dem er die Online-Version des Tagesspiegels bereits geladen hatte, um es sich auf dem von der Morgensonne beschienenen Balkon gemütlich zu machen. Es war wirklich albern, sich über solche Kleinigkeiten aufzuregen.
Dann fiel sein Blick auf das Marmeladenglas. Hatte sich da etwa Schimmel gebildet? Irgendetwas Weißliches war dort zu sehen. Kammowski öffnete das Glas und trat näher ans Licht, um die Oberfläche genauer in Augenschein nehmen zu können. Nein, kein Schimmel, wie auch, das Glas war ja kürzlich erst geöffnet worden. Nein, »jemand« hatte Butterspuren in »seiner« Marmelade hinterlassen.
Seit Herbst des letzten Jahres lebte seine Tochter nun bei ihm; seit sie einen Medizin-Studienplatz in der Charité bekommen hatte. Nach der Scheidung hatte Charlotte bei ihrer Mutter, seiner Ex-Frau Elly, in Köln gewohnt, war dort zur Schule gegangen und hatte ihr Abi gemacht. Und eigentlich hatte sie nur vorübergehend bei ihm bleiben wollen, bis sie ein Zimmer in einer WG gefunden hätte, aber nun waren fast zehn Monate vergangen, und sie war immer noch da und machte keine Anstalten, sich etwas Eigenes zu suchen. Worüber Kammowski froh war – einerseits. In den vergangenen Jahren hatte er von seinen beiden Kindern nicht viel mitbekommen. Er hatte sich gefreut, jetzt mit Charlotte etwas Gemeinsamkeit nachholen zu können. Aber es war doch manchmal herausfordernd für ihn, dem seine Bequemlichkeit und Rituale wichtiger waren, als ihm bewusst gewesen war.
Zudem war der Einzug von Charlotte in eine kritische Phase seiner Beziehung zu Christine gefallen. Lange hatte Christine sich dagegen gesträubt, mit ihm zusammenzuziehen, sie hatte ihre eigene Wohnung bis heute nicht aufgegeben, baute sie im Streit immer wieder als Drohkulisse vor ihm auf, und manchmal, wenn sie ihre Ruhe brauchte, zog sie sich auch für Tage ganz dahin zurück. Aber schließlich hatte sie seinem Drängen doch nachgegeben und war bei ihm eingezogen. Kurz bevor Charlotte ihr Studium aufnahm und sich ebenfalls bei ihm einquartierte. Die Wohnung war riesig, ohnehin eigentlich zu groß für einen Menschen allein. Typischer Berliner Altbau, 3,80 Meter hohe Räume, Parkett, »Berliner Zimmer«, ehemalige »Gesinderäume« im Seitenflügel mit eigenem Aufgang. Sollte er sich später einmal verkleinern wollen, würde man die Wohnung teilen können. Kammowski wohnte hier schon seit dreißig Jahren, hatte einmal in seinem Leben etwas richtig gemacht, wie er gern sagte, und zugeschlagen, als die Wohnung Anfang der Neunzigerjahre verkauft werden sollte. Damals war ihm der Kaufpreis gigantisch hoch erschienen, hatte ihm schlaflose Nächte bereitet und vorübergehend zu einem Verarmungswahn geführt. Heute war die Wohnung das Vierfache wert, aber selbstverständlich wäre es Kammowski nie in den Sinn gekommen, sie zu verkaufen, geschweige denn, woanders leben zu wollen.
Christine hatte Verständnis dafür, dass auch Charlotte ihre Rechte hatte, wie auch dafür, dass er das Gefühl hatte, im Zusammensein mit seiner Tochter etwas nachholen zu müssen. Und die beiden waren einander durchaus auch sympathisch, wenngleich vielleicht auf eine etwas verquere Art, die sich jedenfalls nicht dadurch auszeichnete, dass sie nett und zuvorkommend oder wenigstens höflich miteinander umgegangen wären. Vielleicht waren sie sich auch einfach in vielen Dingen zu ähnlich und rieben sich deshalb aneinander. Jedenfalls hatten beide eine leidenschaftliche, zum Theatralischen neigende Art – in der Kombination ein explosives Gemisch.
Christine hatte selbst keine Kinder, und wenn sie es auch nie so direkt aussprach: In ihren Augen war Charlotte eine verzogene Göre, die sein schlechtes Gewissen ausnutzte und mit ihr »aus purer Freude am Kampf« rivalisierte.
Erst gestern hatten sie beim Abendessen wieder über etwas gestritten, hatten sich am Ende beide beleidigt in ihre Zimmer verzogen, und Kammowski war mit seinem kaum angerührten Lammeintopf mit Äpfeln, dem selbst gebackenen Baguette und dem Abwasch allein geblieben.
Christine war freie Journalistin und arbeitete gerade an einer Dokumentation über Sterbehilfe. Sie hatte in dem Gespräch die Meinung vertreten, dass es moralisch nicht vertretbar sei, dieses Feld professionalisierten und naturgemäß am Gewinn orientierten Vereinen zu überlassen, und sie hatte schreckliche Dinge darüber berichtet, wie die Not todkranker Menschen und ihrer Angehörigen von skrupellosen Verbrechern ausgenutzt wurde. Charlotte hatte lautstark und energisch für das Recht des Menschen, den Zeitpunkt seines Todes selbst zu bestimmen, votiert, und beide hatten offenbar überhaupt nicht gemerkt, dass sie eigentlich gar keine gegensätzlichen Standpunkte vertraten. An Kammowskis Versuchen, zu schlichten und Gemeinsamkeiten herauszustellen, waren sie jedenfalls nicht interessiert gewesen. Sie hatten seine Einwände vom Tisch gefegt und waren wie die Furien erst aufeinander, dann auf ihn losgegangen und hatten sich anschließend wie Diven in ihre Zimmer zurückgezogen.
Kammowski seufzte und schmiss die verbrannten und rauchenden Toasthälften in die Mülltonne. Dann öffnete er das Küchenfenster, um den Qualm hinauszulassen. Es war noch früh am Morgen, und die Sonne tauchte das erwachende Berlin in schräg einfallendes warmes Licht. Es würde wieder ein sehr heißer Tag werden. Sosehr die Landwirte sich auch nach Regen sehnten, für die Berliner waren die warmen und trockenen Tage und Nächte ein Segen. Sein Blick fiel auf den Balkon im Seitenflügel. Die Wohnung lag überwiegend im Vorderhaus, erstreckte sich aber noch über einen Teil des Seitenflügels. Der Küchenbalkon war nach Osten ausgerichtet, dort ließ er sich gern zum Frühstücken nieder. Der Nordbalkon war der Katze und den Vögeln vorbehalten. Hier pickten Meisen die im Futterhaus ausgelegten Haferflocken und Rosinen auf. Sicher saß Kater Churchill gerade auf der Fensterbank und beobachtete sie. Aber er würde sie nicht fangen können, das schienen die Vögel zu wissen, jedenfalls ließen sie sich durch die Katze nicht davon abhalten, das Vogelhaus aufzusuchen. Kammowski hatte es hoch auf einem Stab montiert, der an der Brüstung angebracht war, und den Balkon selbst mit einem Netz umgeben, das er mit wenigen Griffen öffnen konnte, um das Vogelhaus zu reinigen und Futter nachzulegen. So hatte der Kater auf dem Balkon zwar etwas Auslauf, konnte aber nicht herunterspringen und kam vor allem nicht an das Futterhaus heran. Charlotte hatte ihrem Vater Sadismus vorgehalten, weil er Vögel anlockte, die Churchill nie würde fangen können. Das sei Tierquälerei, denn es liege in der Natur einer Katze, dass sie Vögel fangen wolle. Typisch Charlotte. Sie allein entschied, auf wessen Seite das Recht und sie standen. Dass man auch mit den Vögeln hätte Mitleid haben können, kam ihr offenbar nicht in den Sinn. Churchill war eben ihr alter Familienkater.
»Was überlegst du?«, fragte Christine, die ihn plötzlich von hinten umarmte. Sie verströmte noch die Wärme des Bettes und kuschelte sich, nur mit einem Slip bekleidet und weich, wie sie war, an ihn.
»Ich frage mich, ob ich das Futterhaus entferne. Vielleicht ist es wirklich nicht richtig, dem armen Churchill seine Beute immer vor Augen zu locken, ohne dass er jemals eine Chance hat, seinem Jagdinstinkt nachzugeben.«
»Ja, aber ohne das wird es ihm vielleicht langweilig. Man muss nicht immer alle Sehnsüchte ausleben, aber ohne Sehnsüchte ist das Leben vielleicht etwas trist.«
»Man könnte ihm wenigstens einmal im Monat einen Vogel gönnen«, schlug Charlotte vor, die unbemerkt hinzugetreten war, sich den Kaffeepott ihres Vaters schnappte und austrank. »Gibt’s noch mehr?«, fragte sie strahlend und drückte ihrem Vater einen lauten Schmatz auf die Wange und die leere Tasse in die Hand.
»Schicker Pyjama«, sagte sie mit einem Grinsen zu Christine, die den Scherz gut gelaunt aufgriff: »Kannste haben, hab noch mehr davon.« Dann verschwand Christine im Bad.