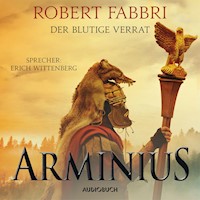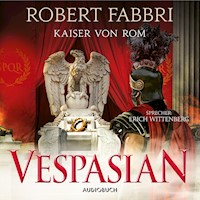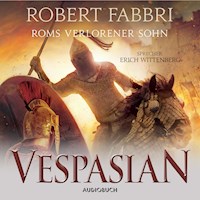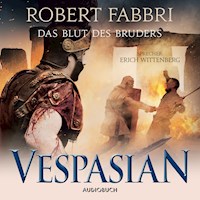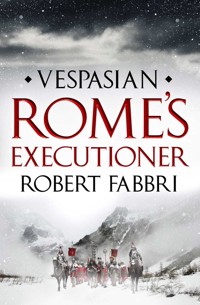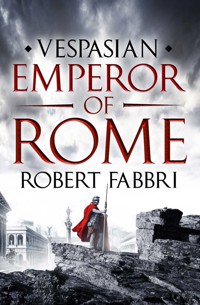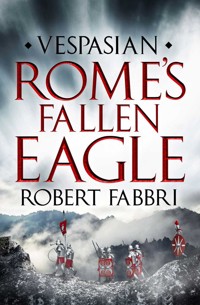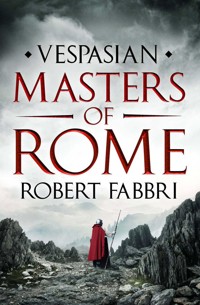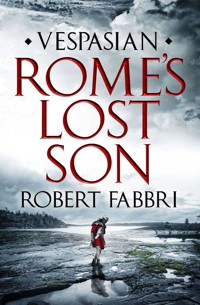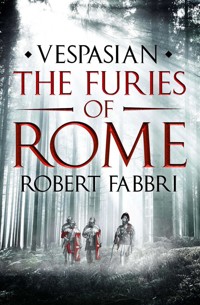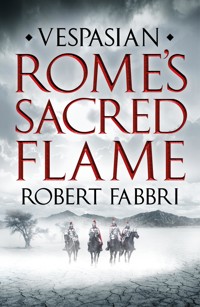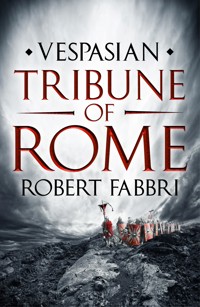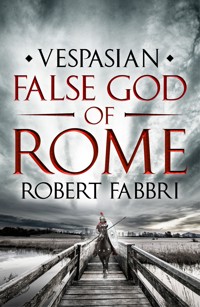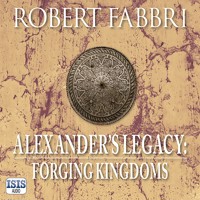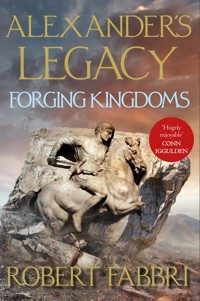9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Vespasian-Reihe
- Sprache: Deutsch
Rom, im Jahr 30 n. Chr. Nur ein Mann kann Seianus zu Fall bringen, den Kommandeur der Prätorianergarde, der alle Macht in Rom an sich gerissen hat: der thrakische Priester Rhotekes. Nur ein Mann kann ihn heimlich nach Rom bringen: Vespasian, dem der Verräter einst bei der Niederschlagung des thrakischen Aufstands entkam. Vespasian überwindet Festungsmauern. Hinterhalte in verschneiten Bergen. Piraten auf hoher See. Seianus' Spione. Doch die schlimmste Gefahr lauert im Herzen des römischen Reiches selbst, im verkommenen Hof von Tiberius, dem paranoiden und lasterhaften Kaiser von Rom.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Robert Fabbri
Vespasian. Das Tor zur Macht
Historischer Roman
Über dieses Buch
Rom, im Jahr 30 n.Chr. Nur ein Mann kann Seianus zu Fall bringen, den Kommandeur der Prätorianergarde, der alle Macht in Rom an sich gerissen hat: der thrakische Priester Rhotekes. Nur ein Mann kann ihn heimlich nach Rom bringen: Vespasian, dem der Verräter einst bei der Niederschlagung des thrakischen Aufstands entkam. Vespasian überwindet Festungsmauern. Hinterhalte in verschneiten Bergen. Piraten auf hoher See. Seianus‘ Spione. Doch die schlimmste Gefahr lauert im Herzen des römischen Reiches selbst, im verkommenen Hof von Tiberius, dem paranoiden und lasterhaften Kaiser von Rom.
Vita
Robert Fabbri, geboren 1961, lebt in London und Berlin. Er arbeitete nach seinem Studium an der University of London 25 Jahre lang als Regieassistent und war an so unterschiedlichen Filmen beteiligt wie «Die Stunde der Patrioten», «Hellraiser», «Hornblower» und «Billy Elliot – I Will Dance». Aus Leidenschaft für antike Geschichte bemalte er 3500 römische Zinnsoldaten – und begann schließlich zu schreiben. Mit seiner epischen historischen Romanserie «Vespasian» über das Leben des späteren römischen Kaisers wurde Robert Fabbri in Großbritannien Bestsellerautor.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel «Vespasian. Rome’s Executioner» bei Corvus/Atlantic Books, Ltd., London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Vespasian. Rome’s Executioner» Copyright © 2012 by Robert Fabbri
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Karten © Peter Palm, Berlin
Umschlaggestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
nach der Originalausgabe von Atlantic Books Ltd.
Umschlagillustration Tim Byrne
Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-40478-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Tante Elisabeth Woodthorpe,
die immer für mich da ist
Prolog
Das Staccato genagelter Sandalen auf feuchtem Pflaster hallte von den rußgeschwärzten Ziegelmauern einer unbeleuchteten Gasse auf dem Viminal-Hügel wider, die zwei verhüllte Gestalten durcheilten. Zum ersten Mal in diesem Winter war schon am Abend Nebel aufgezogen, der die mondlose Nacht noch finsterer machte. Rauchschwaden aus den zahllosen Feuerstellen der dichtbevölkerten Subura verwandelten den Nebel in feinste Tröpfchen, die die wollenen Kleider der beiden Männer durchdrangen und hinter ihnen in der Luft verwirbelten. Mehr als das spärliche Licht ihrer zischelnden Fackeln hatten sie nicht, um den Weg durch diese Finsternis zu finden.
Den Männern war bewusst, dass sie beschattet wurden, sie schauten sich aber nicht um; es hätte sie nur aufgehalten, und Gefahr drohte nicht wirklich. Die heimliche Art, mit der ihnen die Verfolger nachsetzten, ließ vermuten, dass es sich nicht um Diebe handelte, sondern um Spione.
Sie eilten so schnell sie konnten, hasteten an Bergen von Unrat vorbei, einem toten Hund, Exkrementen und dem unglücklichen Opfer eines Überfalls, das leise stöhnend in einer Blutlache lag. In der Hoffnung, nicht einem ähnlichen Schicksal zu begegnen, ließen sie den Sterbenden zurück und strebten der Kuppe des Viminal zu. Dank der mit Knuten bewaffneten Vigiles waren die Straßen dort sicherer. Trotzdem hüteten sich die beiden, den Nachtwachen in die Arme zu laufen. Sie konnten es sich nicht leisten, angehalten und befragt zu werden. Deshalb hatten sie den kürzesten Weg vom Palatin-Hügel gewählt, ihrem Ausgangspunkt, durch die gesetzlosen Gassen der Subura zum Viminal. So lange es nur irgend ging, wollten sie die breiteren, stärker patrouillierten Straßen meiden. Spät in der Nacht unterwegs zu sein, zumal ohne Begleitschutz, musste Verdacht erregen. Der Erfolg ihrer Mission hing aber nicht zuletzt auch davon ab, dass sie ihr Ziel unbehelligt erreichten.
Um die Verfolger abzuschütteln, bogen sie im Laufschritt um die nächste Ecke nach rechts ab, dann wieder nach links, doch auch die Schritte hinter ihnen beschleunigten sich. Sie waren jetzt deutlich zu hören, und das trotz der vom Nebel gedämpften Schreie und des auch in der Nacht unablässigen Klapperns von Pferdehufen und Wagenrädern, der Geräusche von Verzweiflung und Elend aus der Subura.
Als sie um eine weitere Ecke bogen, warf der eine dem anderen einen Blick zu. «Ich finde, wir sollten sie uns schnappen», zischte er und zog seinen Begleiter in einen Hauseingang.
«Wie Ihr meint, Herr», antwortete der andere gleichmütig. Er war älter und trug einen dichten schwarzen Bart, der sich im Fackelschein unter der Kapuze andeutete. «Und wie sollen wir das machen? Mir scheint, sie sind zu viert.»
Auf dem Gesicht des jüngeren Mannes zeigte sich Unsicherheit. Er kannte seinen Gefährten seit nunmehr fast vier Jahren und war gewöhnt an dessen tadellose Manieren und Ergebenheit. Immerhin war er nach wie vor ein Sklave.
«Einen Plan habe ich nicht. Wir warten einfach, bis sie vorbeikommen, und fallen über sie her», erwiderte er und zog unter dem Umhang leise seinen Gladius aus der Scheide. In der Stadt durften nur Prätorianer und die Cohortes urbanae ein Schwert tragen. Auch deshalb wollten die beiden lieber unentdeckt bleiben.
Der ältere Mann grinste über die Frechheit seines Freundes, zog aber sein Schwert ebenfalls. «Die einfachsten Pläne sind oft die besten, Herr. Dürfte ich vielleicht trotzdem einen Vorschlag machen?»
«Sprich.»
«Ich bleibe hier mit beiden Fackeln zurück, und Ihr versteckt Euch auf der anderen Straßenseite. Wenn sie mich angreifen, könnt Ihr sie von hinten überfallen. So haben wir eher eine Chance gegen sie.»
Der Jüngere ärgerte sich ein wenig, dass er nicht selbst auf diese simple List gekommen war, und folgte dem Rat des Gefährten. Mit einem kurzen Dolch in der linken und seinem Schwert in der rechten Hand ging er in einem Hauseingang auf der anderen Seite in Deckung und wunderte sich, wie es der andere schaffte, den Schein der Fackeln abzuschirmen.
Kurz darauf waren am Ende der Gasse Stimmen zu hören. «Sie sind hier rein, da bin ich mir sicher», knurrte der Anführer dem Mann zu, der neben ihm ging. «Sie wissen, dass wir ihnen auf den Fersen sind, und haben einen Schritt zugelegt. He, was …»
Es verschlug ihm die Sprache, als plötzlich eine brennende Fackel auf ihn zuflog und seine Haare wie auch den Kragen des geölten Umhangs streifte. Beides fing sofort Feuer. Schreiend ließ er sich auf die Knie fallen, als die Flammen von seinem Kopf hochschlugen und sich in der ohnehin schon stickigen Luft der Gestank brennender Haare und Fasern verbreitete. Der andere hatte keine Zeit mehr zu reagieren, denn schon spürte er, wie sich eine messerscharfe Metallspitze unmittelbar unter dem Kinn durch seine Kehle bohrte und am linken Ohr wieder austrat. Seine Luftröhre füllte sich mit heißem Blut, und Schmerzen von ungeahnter Heftigkeit zwangen ihn zu Boden. Mit beiden Händen umklammerte er den aufgetrennten Kiefer, und vor seinem Mund bildete sich mit dem gurgelnden Schrei, den er ausstieß, zäher schwarzer Schaum.
Der jüngere Mann sprang aus seinem Versteck und rannte auf die beiden anderen Spitzel zu, die noch ein paar Schritte zurückhingen. Sie waren es gewohnt, überraschend aus dem Hinterhalt zuzuschlagen, und die Bedrohung überforderte sie. Sie ließen ihre Dolche fallen, gingen auf die Knie und ergaben sich im Schein der Flammen, die von dem Umhang ihres Anführers aufloderten.
«Ihr feigen Maden», höhnte der jüngere Mann. «Wer hat euch auf uns angesetzt?»
«Erbarmen, Meister, wir führen nichts Übles im Schilde», flehte der eine.
«Ach, nein?», entgegnete der Jüngere. «Dann ist das wohl auch nicht von Übel.» Mit einem geraden Stoß rammte er dem Spion sein Schwert durch den Hals. Der sackte lautlos in sich zusammen und war wenige Augenblicke später tot.
Sein Kumpan starrte entsetzt auf den Leichnam, verlor die Kontrolle über seine Blase und fing an zu schluchzen.
«Du könntest mit heiler Haut davonkommen», flüsterte der jüngere Mann. «Verrate uns, wer euch geschickt hat.»
«Livilla.»
Der junge Mann nickte. Sein Verdacht hatte sich bestätigt.
«Danke für den Hinweis», sagte sein bärtiger Gefährte und trat hinter den am Boden knienden Spitzel. «Aber laufenlassen können wir dich nicht.» Er packte ihn bei den Haaren, schlitzte ihm blitzschnell mit dem Messer die Kehle auf und warf ihn aufs Pflaster. «Gebt ihm den Rest, Herr», sagte er und zeigte auf den Anführer, der sich immer noch am Boden wälzte, obwohl sein Umhang nur noch schwelte. «Und dann nichts wie weg.»
Ohne weitere Probleme erreichten sie nach einer Viertelmeile ihr Ziel: eine eisenbeschlagene Holztür in der Straße der Lampenmacher nahe dem Viminal-Tor. Der Bärtige klopfte dreimal an, wartete eine Weile und wiederholte das Signal. Wenig später öffnete sich eine kleine Luke in der Tür. Ein umschattetes Gesicht zeigte sich im Ausschnitt.
«Was wollt ihr?»
Die beiden Männer streiften ihre Kapuzen vom Kopf und gaben sich im Licht der Fackeln zu erkennen.
«Ich bin Titus Flavius Sabinus, und das ist Pallas, der Diener der Matrona Antonia», antwortete der jüngere. «Wir sind hier mit Quintus Naevius Cordus Sutorius Macro verabredet, in einer Angelegenheit, die nur ihn, den Tribun, und die Matrona etwas angeht.»
Die Klappe vor der Luke wurde zugeschlagen, und die Tür öffnete sich knarrend. Sabinus und Pallas steckten ihre Fackeln in Halterungen an der Wand und betraten einen spärlich beleuchteten Raum, der ihnen im Vergleich zu der Düsternis, die draußen herrschte, warm und einladend vorkam. Mehrere Faltschemel standen ungeordnet auf den nackten Holzdielen, dazu zwei Tische, auf denen Öllampen flackerten. Vor einem Vorhang, der anscheinend einen Durchgang verbarg, befand sich ein schlichtes Schreibpult. Auch darauf brannten zwei Öllichter.
«Der Tribun wird gleich kommen», sagte der Pförtner kurz angebunden. Er trug die Uniform der Prätorianergarde, wie immer, wenn er im Dienst innerhalb der Stadtmauern war: eine weiß gesäumte, gegürtete Tunika, darüber eine weiße Toga, unter der ein Schwert in einem über die Schulter geschlungenen Bandelier steckte. «Eure Waffen, ich bitte darum.»
Widerstrebend händigten sie ihre Schwerter und Dolche dem Wachposten aus, der diese außer Reichweite auf das Pult legte. Weil er sie nicht gebeten hatte, Platz zu nehmen, blieben Sabinus und Pallas schweigend stehen. Der Prätorianer stellte sich vor den verhängten Durchgang, legte die Hand ans Heft seines Schwerts und starrte die beiden aus blassblauen Augen an, die unter zusammengewachsenen Brauen kalt hervorblitzten.
Hinter dem Vorhang waren unmissverständlich die Lustäußerungen einer Frau zu vernehmen. Der Wachposten ließ sich keine Gemütsregung anmerken, während das anfangs sanfte Seufzen eskalierte, lauter und heftiger wurde und in einem schrillen Schrei kulminierte, der plötzlich abbrach, als in schneller Folge harte Klatschlaute zu hören waren. Die Frau fing nun zu schluchzen an, verstummte aber sogleich. Ein krachender Schlag ließ vermuten, dass sie die Besinnung verloren hatte. In der folgenden Stille warf Sabinus einen nervösen Blick auf Pallas, der so ungerührt zu sein schien wie der Wachposten. Als Sklave war er daran gewöhnt, wie ein Möbelstück behandelt zu werden, und hütete sich davor, Gefühle zu zeigen.
Mit einem Ruck wurde der Vorhang beiseitegeworfen. Der Wachposten stand stramm. Naevius Sutorius Macro trat in Erscheinung, ein stämmiger, wohl über sechs Fuß großer Mann, der Ende vierzig sein mochte. Er trug ein gegürtetes Prätorianerkleid, sonst nichts. Seine kräftigen, muskulösen Unterarme und die Beine waren dicht behaart; auch unter dem Halsausschnitt der Tunika quollen schwarze, drahtige Locken hervor. Seine kantigen Kieferknochen, die dünnen Lippen und hellwachen Augen, die militärisch kurz geschorenen Haare, ja seine ganze Erscheinung zeugten von Autorität und Machtwillen.
Pallas verriet keinerlei Regung, lächelte aber innerlich. Er sah, dass sich seine Herrin für ihren Plan an den Richtigen herangemacht hatte. Sabinus nahm unwillkürlich Haltung an, obwohl er der Disziplin des Militärs nicht länger unterstand. Macro grinste flüchtig. Er war es gewohnt, dass andere so auf ihn reagierten, und genoss das Gefühl von Überlegenheit.
«Rührt euch, Cives», sagte er, belustigt wegen des sichtlichen Unbehagens des jüngeren Mannes und der strammen Haltung, mit der dieser sich zum Narren gemacht hatte. «Ihr wisst, wer ich bin, sonst wärt ihr wohl nicht gekommen. Stellt euch vor und dann lasst hören, mit welcher Botschaft Antonia einen jungen unbedeutenden Mann und einen Sklaven zu mir geschickt hat.»
Sabinus schluckte seine Wut über die gezielte Beleidigung herunter, straffte die Schultern und blickte Macro ins Gesicht. «Ich bin Titus Flavius Sabinus, und das ist …»
«Ich weiß, wer der Sklave ist», fiel ihm Macro ins Wort und setzte sich hinter das Pult. «Du interessierst mich mehr. Woher kommt deine Familie?»
«Wir sind aus Reate. Mein Vater war Centurio in der zweiten Kohorte der Zwanzigsten Legio Valeria Victrix und kämpfte unter der Führung unseres geliebten Kaisers in Germania, bevor er aus gesundheitlichen Gründen ausgemustert wurde. Der Bruder meiner Mutter, Gaius Vespasius Pollo, steht im Senatorenrang und war sieben Jahre Prätor.» Sabinus stockte. Wieder einmal wurde ihm bewusst, wie medioker der Stand seiner Familie war.
«Ja, ich kenne Senator Pollo. Ich hatte kurze Zeit mit ihm zu tun. Allerdings war er zu schwach und konnte mir nicht nützlich sein, weshalb ich ihn ablehnen musste. Willst du mir einen Vorwurf daraus machen?»
Sabinus schüttelte den Kopf. «Ich bin einzig im Auftrag Antonias hier.»
«Und in welchem Verhältnis stehst du, Neffe eines Exprätors, zu ihr?» Macros Blicke bohrten sich in Sabinus’ Augen.
«Mein Onkel steht ihr zu Diensten», antwortete er ausweichend.
«Aha, der kleine Exprätor sucht also den Schutz einer hohen Herrin und macht sich ihr zum Handlanger, und sein Neffe steigt auf in den gewichtigen Rang eines Boten. Nun, Bote, setz dich und trage deine Nachricht vor.»
Sabinus nahm Platz, froh darüber, nicht länger wie ein dummer Schuljunge behandelt zu werden, der sich seinem Grammaticus erklären musste. «Ich selbst habe keine Nachricht für Euch und bin lediglich mitgekommen, um der Stimme eines Sklaven Gewicht zu verleihen. Pallas hat Euch etwas zu sagen.»
«Gewicht?», grummelte Macro. «Glaubt deine Herrin, ich würde einem Sklaven kein Gehör schenken? Nun, recht hat sie, warum sollte ich ihm zuhören, ob seinen Worten nun Gewicht verliehen wird oder nicht?»
«Wenn Ihr es nicht tätet, würde Euch womöglich eine interessante Gelegenheit entgehen», antwortete Pallas ruhig, den Blick geradeaus gerichtet.
Macro starrte ihn an, zitternd vor Erregung. «Du wagst es, mich anzusprechen, Sklave?», knurrte er. Und wieder an Sabinus gewandt: «Eine interessante Gelegenheit? Sprich!»
«Ich kann Euch leider nichts dazu sagen, Tribun. Meine Herrin hat ihre Nachricht einzig und allein Pallas anvertraut. Ihr solltet ihn hören, sonst erfahrt Ihr nicht, worum es geht.» Dem jungen Mann klopfte das Herz bis zum Hals, als ihm bewusst wurde, dass er zu weit gegangen war und Macro in die Ecke gedrängt hatte.
Macro blieb ruhig. Natürlich war er neugierig zu erfahren, was die mächtigste Frau Roms ihm mitzuteilen hatte, er mochte sich aber nicht dazu herablassen, einem so niederen Mann seine Aufmerksamkeit zu widmen. Doch seine Wissbegier gewann die Oberhand. «Sprich, Sklave», sagte er schließlich, «und fass dich kurz!»
Pallas warf einen Blick auf den Wachposten, der hinter ihm stand.
«Satrius Secundus bleibt!», sagte Macro, der die Geste des Sklaven verstand. «Er wird mein Vertrauen nicht brechen. Er ist mir mit Haut und Haar ergeben, nicht wahr, Secundus?»
«Wie Ihr wünscht», erwiderte Pallas und merkte sich den Namen, um ihn seiner Herrin kundtun zu können. «Antonia lässt grüßen und sich dafür entschuldigen, dass sie Euch nicht in ihr Haus eingeladen und die Höflichkeit erwiesen hat, unter vier Augen mit Euch zu reden. Sie hofft jedoch, Ihr werdet verstehen, dass man Euch beide nicht in Zusammenhang bringen darf. Euer beider Sicherheit wäre bedroht.»
«Ja, ja, kommt zur Sache», entgegnete Macro, der an der gesetzten Sprache des Griechen Anstoß nahm.
«Die Fehde zwischen meiner Herrin und Seianus dürfte Euch kein Geheimnis sein, Eminenz. Sie sieht nun endlich eine Möglichkeit, ihr ein Ende zu setzen, indem sie Seianus dem Kaiser als Verräter anzeigt, der nach der Macht schielt.»
Macro runzelte die Stirn. «Das wäre allerdings ein gewagter Vorstoß. Hat sie Beweise für eine solche Unterstellung?»
«Sie hegt schon seit langem Verdacht gegen ihn, hatte aber bislang nichts Konkretes gegen Seianus in der Hand. Aber nun gibt es einen Zeugen.»
Macro merkte auf. «Und was könnte der bezeugen?»
«Das hat mir meine Herrin natürlich nicht anvertraut.»
Macro nickte.
«Er ist jedoch kein Bürger», fuhr Pallas fort. «Er wird nicht unter Eid aussagen, sondern unter Folter, und Tiberius persönlich wird anwesend sein.»
«Wie will deine Herrin diesen Mann vor den Kaiser bringen, wenn wir, die Prätorianer, sämtliche Zugänge zum Palast bewachen?»
«Genau deshalb braucht Antonia Eure Hilfe. Sie macht Euch folgenden Vorschlag: Helft Ihr dabei, Seianus zu Fall zu bringen, wird sie dafür sorgen, dass Ihr der nächste Präfekt der Prätorianergarde werdet.»
Macros Augen leuchteten kurz auf. Er fasste sich sogleich wieder und lächelte dünn. «Wie garantiert sie mir das?»
«Wenn Euch das Wort der Schwägerin des Kaisers nicht reicht, bedenkt dies: Sollte es gelingen, Seianus zu stürzen – und es wird gelingen –, wird der neue Präfekt sofort einschreiten müssen, um Ordnung in seine Reihen zu bringen und sie von all jenen zu säubern, die der alten Führung treu sind. Eine solche Umstellung wird Geld kosten, sehr viel Geld, das Ihr nicht habt. Antonia ist bereit, Euch mit den nötigen Mitteln auszustatten, die Ihr brauchen werdet, um Euch die Loyalität der wichtigsten Offiziere zu erkaufen, sobald die Zeit dazu gekommen ist. Bis dahin könntet Ihr Euch Gedanken darüber machen, wer gekauft werden müsste und wie Ihr Euch alle gefügig macht.»
Macro wiegte bedächtig seinen Kopf. «Woher nimmt Antonia die Gewissheit, dass dieser Zeuge in ihrem Sinne vor dem Kaiser aussagt?»
«Bei allem Respekt, diese Frage erachtet meine Herrin als ihr Problem. Sie hat allerdings angedeutet, dass sie einen Weg finden wird, Euch nach Capreae versetzen zu lassen.»
«Hört, hört», höhnte Macro. «Als wäre das so einfach und mit einem Antrag zu bewerkstelligen.» Er fixierte Pallas mit eisigem Blick und musterte ihn für eine Weile. Wie immer ließ sich der Grieche nichts anmerken. «Und wenn ich ihr zuvorkomme, jetzt gleich zu Seianus gehe und ihm berichte, was mir hier und heute zu Ohren gekommen ist? Um dich wär’s geschehen, auch um den Neffen des Exprätors und seine Familie. Glaubst du nicht auch?»
«Nein, Herr, denn wenn Ihr ihm das sagtet, hättet Ihr Euer Leben verwirkt.»
«Was soll das heißen?»
«Allein der Umstand, dass Ihr uns empfangen habt, wird ihn an Eurer Treue zweifeln lassen. Er wird annehmen, dass man Euch einfach nicht genug Geld geboten hat und Ihr mit einer höheren Summe durchaus bereit gewesen wärt, ihn zu verraten.»
Macro stand auf und schlug mit der flachen Hand aufs Pult. «Secundus, mach dich bereit!», brüllte er und griff selbst nach einer der Waffen auf dem Pult. Der Wachposten zog seinen Gladius und stürzte auf Sabinus und Pallas zu.
«Ennia!», rief Pallas.
Macro hob die Hand und gebot seinem Mann Einhalt. «Lass ab», befahl er. Secundus gehorchte. «Was hat meine Frau mit dieser Sache zu tun?», knurrte Macro.
«Vorerst nichts, Herr», antwortete Pallas unaufgeregt. «Sie ist in guter Gesellschaft und amüsiert sich bestimmt.»
«Was willst du mir damit sagen, Sklave?», fragte Macro aufgebracht.
«Kurz nachdem Ihr heute Abend Euer Haus verlassen habt, ließ Antonia Eure Frau Ennia mit einer Sänfte abholen, um mit ihr und ihrem Enkel Gaius zu Abend zu essen. Eine solche Einladung konnte sie natürlich nicht ausschlagen. Wir sind aufgebrochen, als sie ankam, und sie wird bis zu unserer sicheren Rückkehr Antonias Gast sein. Ihr tätet gut daran, uns von Secundus eskortieren zu lassen.»
Es schien, als wollte Macro über Pallas herfallen. Er beherrschte sich aber und nahm wieder auf dem Stuhl Platz. «Mir bleibt wohl keine Wahl», sagte er leise. Mit hasserfülltem Blick schaute er zu ihm auf. «Wie dem auch sei, du wirst für deine Frechheit büßen, Sklave.»
Pallas war klug genug, um seine Ansichten zu diesem Thema für sich zu behalten.
«Also gut», sagte Macro, als er sich wieder halbwegs gefasst hatte. «Secundus wird euch geleiten. Sag deiner Herrin, dass ich auf ihren Vorschlag eingehe, aber nicht ihr zuliebe, sondern im eigenen Interesse.»
«Etwas anderes hat sie von Euch auch nicht erwartet, Herr. Sie ist sich darüber im Klaren, dass sie mit Euch nur ein Zweckbündnis eingehen kann. Mit Eurer Erlaubnis würden wir jetzt gern gehen.»
«Ja, geht, raus mit euch!», blaffte Macro. «Ach, eine Frage noch: Wann genau will Antonia den Zeugen vor den Kaiser bringen?»
«In frühestens sechs Monaten.»
«Ist er etwa nicht in Rom?»
«Nein, Herr, er ist nicht einmal in Italien. Man hat ihn auch noch nicht gefangen genommen.»
«Wo ist er dann?»
«In Moesien.»
«Moesien? Wer will ihn da ausfindig machen und nach Rom bringen?»
«Macht Euch darum keine Gedanken, Herr», antwortete Pallas und wandte sich ab. «Dafür sorgen andere.»
Teil I
I
Vorsichtig verlagerte Vespasian sein Gewicht auf den linken Fuß. Er versuchte, möglichst leise über den Waldboden zu gehen, der von welkem Laub, Zweigen und Schneeflecken übersät war. Mehrere Dutzend Schritte hatte er schon nahezu geräuschlos zurückgelegt. Die ausgeatmete Luft verdampfte vor seinem Gesicht, und nach der langen Hetzjagd pochte sein Herz rasend schnell. Er war allein. Seine beiden Jagdgehilfen, zwei Sklaven, die er sich aus den königlichen Ställen ausgeliehen hatte, hatte er zurückgelassen. Sie sollten mit den Pferden langsam folgen, während er dem waidwunden Hirsch zu Fuß nachsetzte. Er hatte ihn mit einem Pfeil am Hals getroffen und eine Wunde geschlagen, die heftig blutete. An den frischen Spuren erkannte er, dass er dem geschwächten Tier sehr nahe war. Er legte einen Pfeil auf, spannte den Bogen und spürte die Befiederung des Pfeils an der Wange. Kaum wagte er zu atmen, pirschte weiter und spähte durch die Lücken der Bäume auf der Suche nach der lohgrauen Beute inmitten der erdbraunen und rostroten Farben des Winterwalds.
Eine kleine Bewegung am rechten Blickfeldrand ließ ihn erstarren. Er hielt die Luft an und wandte sich der Stelle zu, die seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Knapp zwanzig Schritt entfernt, halb verdeckt vom Dickicht, stand der Hirsch, bewegungslos und mit blutverschmiertem Widerrist, den Blick klagend auf seinen Jäger gerichtet. Als Vespasian sein Ziel ins Auge fasste, sackte das Tier in sich zusammen. Vespasian fluchte, verärgert darüber, um den genugtuenden Todesstoß betrogen worden zu sein. Es kam ihm wie ein Gleichnis für die vergangenen dreieinhalb Jahre vor, die er in Ausübung seiner Garnisonspflichten in Thrakien seit der Niederschlagung des Aufstands hatte zubringen müssen. Bislang war jede Aussicht auf ein Gefecht im Sande verlaufen; stets war er frustriert ins Lager zurückgekehrt, das Schwert ohne Blut, aber die Füße wund von der Jagd auf ein paar Banditen. Die bittere Wahrheit war, dass im römischen Klientelkönigreich Thrakien Frieden herrschte und er sich langweilte.
Anfangs, im ersten Jahr, hatte er noch durchaus interessante Tage erlebt. Nachdem die Rebellen vernichtend geschlagen waren, hatte sich Pomponius Labeo mit der Legio V Macedonica, einem Großteil der IIII Scythica und den Alae der Kavallerie samt Hilfskohorten auf den Rückmarsch zu ihrem Stützpunkt an den Danuvius in Moesien gemacht. Publius Iunius Caesennius Paetus, der Präfekt der illyrischen Kavalleriekohorte, war als Kommandant der Garnison zurückgeblieben. Vespasian hatte nominell den Oberbefehl über die zwei restlichen Kohorten der Legio IIII Scythica, die zweite und fünfte, war aber de facto dem Centurio Lucius Caelus, dem amtierenden Präfekten des Lagers, unterstellt. Der tolerierte ihn zwar, ließ aber keinen Zweifel daran, was er von jungen Aufsteigern hielt, die ihre Führungsposition einzig und allein ihrer gesellschaftlichen Stellung verdankten.
Immerhin hatte Vespasian einiges von Caelus und den anderen Centurien gelernt, die ihre Männer mit Manövern auf dem Feld, mit dem Bau von Straßen und Brücken und mit der Wartung ihrer Ausrüstung und des Lagers beschäftigten. Aber das waren Pflichten in Friedenszeiten, und nach einer Weile war er ihrer überdrüssig. Er sehnte sich nach dem Kitzel des Kriegs, den er bislang allzu selten erfahren hatte, nur in den ersten zwei Monaten seines Aufenthalts in Thrakien. Doch der Krieg kam nicht zurück, allenfalls als schaler Vorgeschmack in Form endloser Paraden und militärischen Drills.
Häufiger als es seinem Bauchumfang guttat, musste er im Palast an Festgelagen mit Königin Tryphaina und verschiedenen regionalen oder aus Rom angereisten Würdenträgern teilnehmen. Seine Versuche, der Königin oder ihren Gästen Neuigkeiten aus Rom zu entlocken, fruchteten kaum – selbst in der Ferne zögerte man, seiner Meinung frei Ausdruck zu verleihen oder auch nur anzudeuten, wie angespannt die Lage in der Stadt war. Seianus war immer noch Prätorianerpräfekt und ein Günstling Tiberius’, der sich offenbar in seinem selbst gewählten Exil auf der Insel Capreae eingerichtet hatte. Wie es seiner Herrin Antonia in ihrem politischen Streit mit Seianus um die legitime Herrschaft über Rom erging, wusste er nicht. Schon so lange abgestellt im Hinterhof der Macht, kam sich Vespasian vor wie eine vergessene Figur am Rand des Spielfelds. Er sehnte sich nach Rom zurück, wo er Antonia wieder dienen und mit ihrer Hilfe weiter Karriere machen könnte. Hier gab es für ihn nur Stillstand.
Das einzig Gute seiner Zeit in Thrakien war, dass er nun fließend Griechisch sprach, die Lingua franca des Ostens. Auch den thrakischen Dialekt beherrschte er inzwischen. Nicht aus Neigung hatte er ihn erlernt, sondern weil es von ihm verlangt worden war. Vergnügen bereitete ihm nur noch die Jagd, doch auch die hatte, wie an diesem Morgen, ihre Tiefpunkte.
Gereizt wie er war, schoss Vespasian einen Pfeil auf das leblos am Boden liegende Reh. Der durchbohrte seinen Hals und nagelte es am Waldboden fest. Sogleich aber bereute er, seiner Wut freien Lauf gelassen und keinen Respekt gegenüber dem Tier gezeigt zu haben, das ihm so tapfer widerstanden hatte. Er drang durch das Dickicht zu seiner Beute vor, murmelte ein an Diana, die Jagdgöttin, gerichtetes Dankgebet, zückte sein Messer und machte sich daran, den noch warmen Körper auszuweiden. Es tröstete ihn der Gedanke, dass seine vierjährige Militärzeit endlich vorbei war. Der März ging zu Ende, und die Schifffahrtslinien würden nach dem Winter ihren Betrieb wieder aufnehmen. Bald käme Ersatz für ihn an. Er würde nach Rom zurückkehren mit der Aussicht auf Beförderung in den Rang eines Magistratus Minores; er würde vielleicht das Amt eines Vigintivir bekleiden und, was ihn besonders freute, Antonias Sekretärin Caenis endlich wiedersehen. Während er mit der Klinge die Decke des Hirschs aufbrach, hatte er ihr Bildnis vor Augen, ihre vollen, feuchten Lippen und die strahlend blauen Augen, die, als sie ihm Lebewohl gesagt hatte, voller Liebe gewesen waren, ihren schlanken Körper, im schwachen Licht einer einzigen Öllampe, nackt in der ersten und einzigen Nacht, in der sie miteinander geschlafen hatten. Er wollte sie wieder in die Arme schließen, ihren Duft in sich aufsaugen und sie ganz für sich haben. Aber wie sollte das möglich sein? Sie war Sklavin und konnte dem Gesetz nach frühestens im Alter von dreißig Jahren freigelassen werden. Ohne seine Arbeit am Kadaver zu unterbrechen, sann er über die Vergeblichkeit dessen, was ihn erwartete, nach. Selbst wenn sie frei wäre, könnte er sie nicht heiraten, wie er es sich als Sechzehnjähriger in seiner Naivität erträumt hatte. Für einen Mann in seiner Position und mit seinen Ambitionen war es ausgeschlossen, eine Freigelassene zur Frau zu nehmen. Sie konnte allenfalls seine Konkubine sein, aber was würde sie davon halten? Nun, sie müsste sich damit abfinden, beschloss er und schabte das restliche Gekröse aus der Bauchhöhle.
«Ich hätte in der Zeit, die ich hier nun schon herumsitze, gut und gern ein Dutzend Pfeile auf Euch abschießen können.»
Vespasian fuhr herum und schnitt sich dabei mit dem Messer in den Daumen. In zwanzig Schritt Entfernung thronte Magnus grinsend auf seinem Pferd und hielt seinen Jagdbogen auf ihn gerichtet.
«Beim Hades, hast du mich erschreckt», rief Vespasian und schüttelte die verletzte Hand.
«Schlimmer würde es Euch jetzt ergehen, wenn ich ein thrakischer Rebell wäre und Euch einen Pfeil in den Hintern verpasst hätte.»
«Na ja, bist du aber nicht und hast es auch nicht getan», erwiderte Vespasian und lutschte an seinem Daumen, auf dem sich sein Blut mit dem des Hirsches mischte. «Wie kommst du überhaupt dazu, dich hinterrücks anzuschleichen?»
«Ich habe mich nicht angeschlichen, im Gegenteil, ich habe so viel Lärm gemacht wie eine Centurie von Rekruten, die sich von ihren Müttern verabschieden.» Magnus senkte den Bogen. «Ihr wart offenbar ganz und gar in Eurer eigenen Welt versunken und habt mich nicht bemerkt. Verdammt gefährlich ist das, wenn ich Euch darauf aufmerksam machen darf.»
«Ja, ich weiß, dumm von mir. Aber mir geht so einiges durch den Kopf», gestand Vespasian und erhob sich.
«Bald wird Euch noch mehr durch den Kopf gehen.»
«Wieso?»
«Ihr habt Besuch. Heute Vormittag ist Euer Bruder in der Garnison angekommen.»
«Was?»
«Was ich sage.»
«Sabinus? Was will er hier?»
«Das würdet Ihr wohl gern wissen? Vermutlich ist er den weiten Weg nicht gekommen, um sich nett mit dem Brüderchen zu unterhalten. Er hat mir aufgetragen, nach Euch zu suchen und Euch so schnell wie möglich ins Lager zu bringen. Also los. Wo ist Euer Pferd?»
Als die Jagdgehilfen eingetroffen waren und die Beute auf sein Pferd gebunden hatten, war es schon weit nach Mittag. Dichte Wolken sorgten für eine frühe Dämmerung im Wald, und sie waren gezwungen, die Pferde am Zaumzeug zu führen, um im Dunkeln nicht zu stürzen. Vespasian ging an Magnus’ Seite und fragte sich, was seinen Bruder bewogen haben mochte, Hunderte von Meilen zurückzulegen, um mit ihm zu sprechen. Ihm schwante Schlimmes. Vor zwei Jahren hatte sein Vater geschrieben und ihn von dem nicht unerwarteten Tod seiner geliebten Großmutter Tertulla unterrichtet. Immer noch schmerzte es ihn, wenn er daran dachte, wie sie wohl ihren letzten Trunk aus dem silbernen Becher genommen hatte, der ihr lieb und teuer gewesen war.
Es musste wohl ein Elternteil gestorben sein, dachte er und hoffte, dass es nicht der Vater war. «Was für einen Eindruck macht er auf dich, Magnus? Ist er niedergeschlagen?»
«Im Gegenteil, er brennt darauf, Euch zu sehen. Hätte er schlechte Nachrichten, wäre er doch wohl zurückhaltender damit. Er war sehr enttäuscht, als ich ihm sagte, dass Ihr nicht da seid.»
«Klingt vielversprechend.» Vespasian lächelte verstohlen. Er und Sabinus hatten sich als Kinder ständig in den Haaren gelegen. Vespasian war von seinem um mehrere Jahre älteren Bruder immer wieder verprügelt worden. Damit war es erst vorbei gewesen, als Sabinus sich zum Militärdienst gemeldet hatte. Seither pflegten sie ein halbwegs friedliches Verhältnis, und doch konnte sich Vespasian kaum vorstellen, dass sein Bruder enttäuscht gewesen sein sollte, ihn nicht sofort nach seiner Ankunft im Lager anzutreffen.
«Na ja, ich werde wohl noch früh genug erfahren, worum es geht», sagte Vespasian und verrückte den über die Schulter geschlungenen Bogen, weil die Sehne seine Haut reizte. «Der Wald lichtet sich, wir können jetzt reiten.» Er machte sich daran, in den Sattel zu steigen. «Das Licht müsste reichen –» Ein scharfes Zischen, unmittelbar gefolgt von einem heftigen Aufprall, schnitt ihm das Wort ab. Zwei Pfeile trafen gleichzeitig auf den Kiefer seines Pferds, genau da, wo kurz vorher Vespasians Kopf gewesen war. Das Tier bäumte sich wiehernd auf und warf ihn zu Boden. Ein dritter Pfeil bohrte sich dem Pferd in die Schulter, gleich darauf ein vierter in die Brust. Es stürzte.
«Verdammt!» Magnus warf sich schützend über Vespasian. Sein eigenes Pferd scheute. «Schnell, in Deckung hinter Euren Gaul!»
Sie sprangen über das am Boden ausgestreckte Tier, als zwei weitere Pfeile in dessen Bauch einschlugen. Es warf den Kopf in die Höhe, schrie und trat mit allen vier Hufen aus, vergeblich darum bemüht, sich wieder aufzurichten. Die beiden Jagdgehilfen kamen herbeigerannt und suchten hinter ihnen Deckung. Schreiend wirbelte einer wie ein Kreisel um die eigene Achse; sein Umhang schlang sich um seinen Leib, als er in den Knien einknickte und mit beiden Händen den Pfeil ergriff, der ihm im blutenden Auge steckte. Sein Gefährte hechtete durch die Luft und kam neben Vespasian und Magnus zu liegen. Von einem weiteren Geschoss getroffen, schüttelte sich das Pferd noch einmal in Krämpfen, bevor seine Kräfte erlahmten.
«Was machen wir jetzt?», zischte Magnus, als weitere Pfeile über sie hinwegsurrten und sich fünf Schritte hinter ihnen in den Waldboden bohrten. Danach blieb es still.
«Mir scheint, man hat es auf mich abgesehen», flüsterte Vespasian. «Alle Pfeile gingen in meine Richtung, dann erst auf die Sklaven, als wir in Deckung waren.» Er warf einen Blick zurück auf die Gefährten, zog sein Messer und schnitt die Beute von dem toten Pferd. «Die Angreifer sind wohl zu zweit. Ich schlage vor, ich laufe jetzt in die eine und du in die andere Richtung. Wenn wir Glück haben, stellen sie mir nach, und du könntest sie von hinten überraschen. Wie heißt du?», fragte er den Gehilfen, der noch auf den Beinen war, einen Mann mittleren Alters mit dichten schwarzen Locken und einem griechischen Sigma, das ihm auf die Stirn gebrannt war.
«Artebudz, Herr», antwortete der Sklave.
«Hast du jemals einen Mann getötet?» Die Schnüre waren gekappt, und der Hirsch glitt zu Boden. Zwei weitere Pfeile trafen auf das Pferd.
«In meiner Jugend, Herr, ehe ich versklavt wurde.»
«Töte die beiden hier und jetzt, und du wirst ein freier Mann sein. Ich sorge dafür.»
Der Sklave nickte. Hoffnung und Entschlossenheit zeigten sich auf seinem Gesicht, als er den Jagdbogen vom Gehenk seines Gurtes nahm. Vespasian gab ihm einen Klaps auf den Arm, packte dann den Hirsch bei den Vorderläufen und warf ihn sich über die Schulter.
«Bei drei richte ich mich auf. Das Tier ist mein Schild. Sobald sie ihre Pfeile abgeschossen haben, lauf los. Sie werden eine Weile brauchen, um neu aufzulegen. Verstanden?» Der Sklave nickte. Vespasian kauerte sich über sein rechtes Knie, bereit aufzustehen. «Also dann – eins, zwei, drei!»
Er hob den Hirsch über die Flanke des toten Pferds. Unmittelbar darauf spürte er den Aufprall zweier Pfeile, die wieder fast gleichzeitig im Kadaver seiner Beute einschlugen. Dann richtete er sich mit ihr auf und lief, so schnell er konnte, auf eine dickstämmige Eiche zu, die er nach zwanzig Schritten erreichte. Zwei heftige Schläge von hinten brachten ihn ins Taumeln, aber er blieb auf den Beinen und spürte keinen Schmerz. Die Pfeile hatten erneut das erlegte Tier in seinem Rücken getroffen. Die kalte Luft kratzte ihm in der Kehle, als er hinter dem Baum in Deckung ging und zwei weitere Pfeile zitternd in den Stamm einschlugen.
Vespasian lehnte den Hinterkopf an die mit weichem Moos gepolsterte Borke und füllte seine Lungen mit kalter Winterluft. Der Kopf des Hirschs rollte von seiner Schulter wie der eines betrunkenen Zechbruders. Vorsichtig spähte er um den Baum herum auf das tote Pferd und die Bäume dahinter. Magnus und Artebudz waren nirgends zu sehen. Er hielt den Atem an und lauschte. Um die Angreifer auf sich aufmerksam zu machen, während sich die beiden Gefährten in Stellung brachten, ließ er den Hirsch zu Boden gleiten, nahm den Bogen zur Hand und legte einen Pfeil auf. Er kniete sich ins Laub und berechnete anhand der Flugbahnen der bislang abgeschossenen Pfeile die Richtung, in die er zielen musste. Mit seiner Schätzung zufrieden, holte er tief Luft, riss den Bogen herum und löste den Pfeil, worauf einen Wimpernschlag später ein Geschoss im Abstand von einer Handbreite an seinem Kopf vorbeistrich. Vespasian grinste. Die Angreifer hatten sich offenbar aufgeteilt, was die Sache für seine Gefährten einfacher machte. Zehn Schritte zu seiner Linken lag eine gefallene Eiche, die ihm Schutz bieten mochte. Er legte einen zweiten Pfeil auf, fixierte ihn über dem Griff mit dem Zeigefinger der linken Hand, hob mit der rechten den Hirschkopf und stand vorsichtig auf, den Rücken an den Stamm gepresst.
Ein gedämpfter Schrei war im Hintergrund zu vernehmen, dann ein Ruf.
«Einer weniger!»
Es war Magnus. Um nicht aus Versehen den Freund zu treffen, ließ Vespasian seinen Bogen sinken. Da dem Gegner ohnehin bekannt war, wo er sich befand, vergab er sich nichts, indem er rief: «Sind’s Römer oder Thraker?»
«Weder noch. Wilde Vögel, wie sie mir noch nie zu Gesicht gekommen sind», antwortete Magnus. «Sie tragen seltsame Beinkleider.»
«Hoffen wir, dass sie kein Latein verstehen. Kannst du das tote Pferd sehen?»
«Ja, in fünfzig Schritt Entfernung. Wenn ich richtig vermute, seid Ihr ein Stück links davon.»
«Gib acht, du müsstest ganz in der Nähe des anderen sein. Wenn ich mich jetzt bewege, wird er sich vielleicht zeigen. Duck dich, ich gebe einen Pfeil in Kopfhöhe ab. Artebudz, sieh, ob sich da was rührt.»
Vespasian rüstete sich für einen neuerlichen Kraftakt. Er stieß den Hirsch nach rechts, hörte ein scharfes Zischen und einen Einschlag in den Kadaver, hechtete nach links auf den am Boden liegenden Baumstamm zu und löste blitzschnell einen Pfeil. Sofort ging er wieder in Deckung, worauf sich ein Pfeil auf der anderen Seite in den Stamm bohrte. Gleich darauf vernahm er das unmissverständliche Geräusch eines heiseren, heftigen Atemstoßes. Jemand war getroffen worden.
«Ich hab ihn erwischt», brüllte Artebudz, und vor Aufregung überschlug sich seine Stimme.
«Ist er tot?», fragte Magnus.
Nach einer Weile tönte es: «Jetzt ja.»
«Iuppiter sei Dank.»
Vespasian sah Magnus und Artebudz vor der Leiche eines Bogenschützen stehen.
Magnus rümpfte die Nase, als er näher kam. «Nicht zu fassen, dass wir sie nicht schon gerochen haben, bevor sie uns entdecken konnten. Unglaublich, wie diese Wilden stinken. Der Wind muss günstig für sie gestanden haben.»
Von dem Toten ging tatsächlich ein strenger Geruch aus, eine Mischung aus Männer- und Pferdeschweiß und Exkrementen, die sich womöglich über Jahre in der schlecht gegerbten Lederhaut von Kleidern konzentriert hatten, die wahrscheinlich nie gewechselt worden waren.
Vespasian wich unwillkürlich einen Schritt zurück. «Was für einer ist das?»
«Keine Ahnung. Artebudz, weißt du’s?»
«Nein, Herr. Der Mütze nach könnte es ein Thraker sein, aber der rote Bart …?»
Vespasian musterte die Aufmachung des Toten. Die Mütze schien tatsächlich nach thrakischer Tradition gefertigt zu sein. Eine Lederhaube mit Ohrenklappen und Nackenschutz, wie sie von Mitgliedern der Stämme im Norden Moesiens getragen wurde, anders als im Süden Thrakiens, wo man sich Kappen aus Fuchsfellen auf den Kopf setzte. Aber in den Rand dieser Mütze waren mit gefärbtem Garn die kruden Umrisse von Pferden eingestickt, und die Ohrenklappen waren unter dem Kinn zusammengebunden. Von den kniehohen Stiefeln abgesehen, war die restliche Kleidung eindeutig nicht thrakisch: lederne Beinkleider, deren abgewetzte Innenseiten darauf schließen ließen, dass ihr Träger viel Zeit im Sattel verbracht hatte, eine Tunika aus ungefärbter Wolle und darüber ein verschlissener Lederkittel, der bis zu den Oberschenkeln reichte.
«Ein Skythe vielleicht», meinte Magnus. Er bückte sich und hob einen aus Horn und Holz gefertigten Bogen vom Boden auf.
«Wohl eher nicht», entgegnete Vespasian. «Skythen kenne ich. Sie sind dunkler und haben merkwürdige Augen. Der hier sieht ganz normal aus. Wie dem auch sei, das sollte uns jetzt nicht kümmern. Ich will endlich meinen Bruder begrüßen. Morgen kann Artebudz mit ein paar Sklaven hierher zurückkommen und die Leichen bergen, vor allem meinen Jagdgehilfen.»
Artebudz grinste, sichtlich froh darüber, schon bald ein freier Mann zu sein.
Vespasian wandte sich ab. «Fangen wir die Pferde ein.»
Es war schon dunkel, als sie das Garnisonslager unmittelbar vor den Stadttoren von Philippopolis erreichten. Vespasian schickte Artebudz in die königlichen Stallungen und ermahnte ihn, kein Wort über den Vorfall im Wald zu verlieren, bevor er selbst mit seiner Herrin, der Königin, gesprochen haben würde. Zusammen mit Magnus setzte er seinen Weg fort, erwiderte den Gruß des Centurios der Wachen am Garnisonstor und ritt im Galopp über die von flachen Ziegelbauten gesäumte Via Praetoria hin zu der vornehmeren Residenz an der Kreuzung der Via Principalis. So aufgeregt war er, dass er die gedämpfte Stimmung und Rastlosigkeit, die im Lager herrschten, nicht zur Kenntnis nahm. Die Soldaten fassten gerade ihr Essen, das sie mit dem in großzügiger Ration verteilten Wein und einem stärkeren, vor Ort gebrauten Gesöff herunterspülten. Vespasian war mit anderen Gedanken beschäftigt: Was wollte sein Bruder? Wie würden sie nach vierjähriger Trennung aufeinander reagieren? Und warum hatten diese beiden Barbaren ihn zu töten versucht?
«Die Jungs haben heute offenbar schlechte Laune», unterbrach Magnus seinen Gedankenfluss.
«Was?»
«Ist mir schon früher mal aufgefallen, dazu kann es schnell kommen. Wenn sie nichts zu tun haben und sich gegenseitig anstänkern, werden sie leicht reizbar und fragen sich, was sie hier eigentlich verloren haben und wie lange sie noch in diesem Drecksloch herumlümmeln müssen. Sie sind Legionäre und haben seit über drei Jahren nicht mehr anständig gefochten, während sich die Jungs, die nach Moesien versetzt wurden, tüchtig rumschlagen können, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf.»
Vespasian schaute sich unter den Männern um, die an ihren Kohlenpfannen hockten, und bemerkte, dass etliche ihn über den Rand ihrer Weinkrüge hinweg verächtlich beäugten. Der eine oder andere hielt sogar seinem Blick stand, was als Aufmüpfigkeit gedeutet werden konnte, die sich Vespasian unter normalen Umständen nicht hätte gefallen lassen.
«Ich werde mich morgen bei Centurio Caelus erkundigen und ihn fragen, was Sache ist», entgegnete Vespasian lustlos, obwohl es im Grunde zu Caelus’ Pflichten gehörte, zu ihm zu kommen und Bericht zu erstatten, wenn es unter den beiden Kohorten, die er befehligte, zu Unstimmigkeiten kam. Dass Caelus das noch nicht getan hatte, war wohl ein weiteres Beispiel für seine subtilen Versuche, Vespasians Autorität zu untergraben.
Vor seinem Quartier angekommen, stieg Vespasian vom Pferd. Der Bau war den Kasernen der Mannschaften ganz ähnlich, nur etwas größer, und Vespasian brauchte seine zwei Räume nicht mit sieben anderen Männern zu teilen.
«Danke dir. Wir sehen uns später.» Vespasian holte tief Luft und trat durch die Tür.
«Ah, mein kleiner Bruder. Zurück aus dem Schmollwinkel der Wälder?», tönte die vertraute Stimme ohne jede Spur von Zuneigung oder Freundschaft. Sabinus lag ausgestreckt auf dem Sofa. Offenbar hatte er sich im Badehaus der Offiziere frisch gemacht, denn seine Kleider waren frei von Schmutz und Staub. Er trug eine weiße Reitertoga über einer sauberen Tunika.
«Auch als der jüngere Bruder bin ich nicht mehr klein, seit ich mich den Adlern angeschlossen habe», entgegnete Vespasian. «Und ich schmolle auch nicht, hab ich noch nie getan.»
Sabinus stand auf. Seine dunklen Augen schimmerten im Licht der zwei Öllampen, als er mit spöttischer Miene den Bruder betrachtete. «Spielst wohl den großen Soldaten, oder? Willst du mir auch noch weismachen, dass du keine Maulesel mehr bumst?»
«Hör zu, Sabinus, wenn du die weite Reise gemacht hast, um dich mit mir anzulegen, sollten wir es gleich hinter uns bringen. Danach kannst du dich wieder verpissen. Es sei denn, du versuchst, höflich zu sein, und sagst, was du mir zu sagen hast.» Vespasian ballte seine Hände zu Fäusten und straffte die Schultern. Sabinus lächelte dünn. Er hatte, wie Vespasian bemerkte, ein wenig zugenommen, was wohl auf die vier Jahre Müßiggang in Rom zurückzuführen war.
«Wie du meinst, kleiner Bruder», sagte er und setzte sich auf einen Stuhl. «Alte Gewohnheiten sind zählebig. Ich bin nicht hier, um mit dir zu kämpfen, sondern im Auftrag Antonias. Willst du mir nichts zu trinken anbieten?»
«Wenn du mit deinen Beleidigungen fertig bist, gern.» Vespasian durchquerte den Raum und nahm einen Krug, der auf einer grob gezimmerten Truhe neben der Tür zum Schlafzimmer stand. Er füllte zwei Becher mit hiesigem Wein und reichte einen seinem Bruder, nachdem er einen Schluck Wasser hinzugegossen hatte. «Wie geht es unseren Eltern?»
«Beide sind wohlauf. Ich habe Briefe von ihnen für dich dabei.»
«Briefe?» Vespasians Augen leuchteten auf.
«Ja, und auch einen von Caenis. Du kannst sie später lesen. Jetzt solltest du dich erst einmal waschen und umziehen. Wir müssen Königin Tryphaina einen Brief von Antonia aushändigen. Wir haben ein Problem und brauchen ihre Hilfe.»
«Was für ein Problem?»
«Eins, neben dem sich die Rettung von Caenis wie ein angenehmer Spaziergang durch Lucullus’ Gärten ausgemacht haben dürfte. Weißt du von den thrakischen Stämmen der Geten?»
«Nie davon gehört.»
«Ich weiß auch nicht viel darüber, nur dass sie außerhalb des Reichs, jenseits des Danuvius beheimatet sind. Sie liegen ständig im Streit mit Stämmen im Norden, ziehen aber seit einiger Zeit auch plündernd durch Moesien, und das immer häufiger und in größerem Stil. Die Fünfte Macedonia und die Vierte Scythica haben alle Hände voll zu tun, die Räuberbanden zurückzuschlagen. Der Kaiser macht sich Sorgen und denkt daran, Poppaeus Sabinus wieder als Statthalter einzusetzen.»
«Was können wir in dieser Sache tun?», fragte Vespasian, dem die Vorstellung widerstrebte, in Poppaeus’ Nähe zu geraten, weil er wusste, dass er ein Verbündeter Seianus’ war.
«Antonia will nicht, dass wir irgendetwas gegen die Überfälle unternehmen, die sind nicht ihr Problem. Vielmehr interessiert sie sich für eine Information, die ihr vor ein paar Monaten von einem ihrer Spione aus Moesien zugespielt wurde.»
«Sie hat Spione in Moesien?»
«Ja, überall. Wie dem auch sei, dieser besagte Spion berichtete, dass an den letzten drei oder vier Überfällen ein Mann beteiligt war, mit dem sich unsere gute Domina einmal gern unter vier Augen unterhalten würde, in Rom.»
«Und wir sollen ihn für sie einfangen?»
Sabinus grinste. «Wie hast du das erraten?»
Vespasian hatte ein flaues Gefühl in der Magengrube. «Um wen handelt es sich?», fragte er, obwohl er die Antwort schon ahnte.
«Um einen Mittelsmann von Seianus, den thrakischen Hohepriester Rhotekes.»
II
Königin Tryphaina legte Antonias Brief auf dem polierten Eichentisch ab und betrachtete die beiden Brüder. Wie Sabinus trug Vespasian eine Toga wie zu einem persönlichen Treffen. Sie saßen in ihrem prächtigen, von warmem Licht durchfluteten Arbeitszimmer, das zu ihren Privatgemächern gehörte und in einem hinteren Teil des Palastkomplexes gelegen war, abgeschieden von den formellen Räumlichkeiten, in denen es von neugierigen Amtsträgern und Sklaven nur so wimmelte. Freien Zutritt zu ihrem Bereich hatten nur ihr Sekretär und ihre Leibsklavin. Sogar ihr Sohn, König Rhoimetalkes, hatte draußen vor der Tür zu warten und über eine der vier Wachen, die den einzigen Eingang schützten, um eine Audienz zu bitten. Wegen seiner engen Beziehungen zu Antonia wurde Vespasian jedoch immer schnell vorgelassen.
«Meine Verwandte hat also den Priester ausfindig gemacht, der meinem Sohn und mir nach dem Leben trachtet und in Gottes Namen über Thrakien zu herrschen vorhat», sagte sie und richtete ihre scharfen blauen Augen mal auf den einen, mal auf den anderen Bruder. «Und sie bittet darum, dass ich euch Männer zur Verfügung stelle, die dabei helfen sollen, ihn gefangen zu nehmen. Das will ich gern tun, aber ob sie euch auch gegen die Geten von Nutzen sein können, kann ich natürlich nicht vorhersagen.»
«Wie ist das zu verstehen, Herrin?», fragte Vespasian und beugte sich in seinem dick gepolsterten Sessel vor, um dem beißenden Rauch aus dem Kohlenbecken auszuweichen, das hinter ihm stand.
«Meine Männer sind in der Mehrzahl Fußsoldaten. Nur wenige können sich Pferde leisten. Die Geten aber sind ein Reitervolk aus dem Grasland nördlich des Danuvius. Sie kämpfen ausschließlich zu Pferde. Unsere kleine Kavallerie käme nicht gegen sie an, und für unsere Infanterie wären sie viel zu schnell. Als ranghöchster römischer Bürgerin in Thrakien wäre es mir zwar durchaus möglich, euch die beiden hier stationierten Kohorten zu unterstellen, aber auch sie könnten gegen eine so mobile Streitmacht nichts ausrichten. Habt ihr je von der Schlacht bei Carrhae gehört?»
«Dann müssten wir also warten, bis sie zu uns kommen», sagte Sabinus in Gedanken an die Strategie, mit der die Legio VIIII Hispana, der er angehört hatte, die numidische Revolte in Afrika niedergeschlagen hatte. «Wir ziehen in den Norden, sprechen mit Pomponius Labeo und versuchen herauszufinden, wo diese Räuberbanden gerade sind und in welche Richtung sie sich bewegen. Dann schneiden wir ihnen den Weg ab und fallen über sie her. Wenn wir Glück haben, reitet der Priester wieder mit ihnen wie während der letzten Raubzüge.»
Vespasian warf dem Bruder einen kritischen Blick zu. «Dein Plan setzt ein bisschen viel aufs Geratewohl, wie mir scheint.»
«Hast du einen besseren Vorschlag, kleiner Bruder?», entgegnete Sabinus. «Willst du ihnen eine Einladung zu den Spielen mit anschließendem Festmahl zukommen lassen?»
«Dein Bruder hat recht, Vespasian», beeilte sich die Königin einzugreifen, bevor es zum Streit käme. «Es könnte eine Weile dauern, ehe ihr sie aufspürt, und wenn es so weit ist, müsst ihr darauf hoffen, dass Fortuna euch eine günstige Gelegenheit bietet.»
«Verzeiht, Herrin.» Vespasian beruhigte sich. Sein Bruder hatte recht, sosehr ihn das auch ärgerte. Schnell schluckte er seinen Unmut herunter und führte Sabinus’ Plan weiter aus. «Wir brauchen Männer, aber nicht viele, allenfalls ein halbes Dutzend ausgewählter Kämpfer. Wenn wir sie nicht auf offenem Feld schlagen können, dann vielleicht überraschend aus dem Hinterhalt.»
«Na bitte, kleiner Bruder, du bist offenbar endlich auf den Trichter gekommen.»
«Wenn Überraschung der Schlüssel zum Erfolg ist, meine Herren, schlage ich vor, dass Harmonie das Losungswort ist.»
Die Brüder sahen einander an, nickten kurz und besiegelten damit ein unausgesprochenes Abkommen.
«Gut», fuhr Tryphaina fort, «das wäre also geregelt. Ich werde den Hauptmann meiner Garde auffordern, sechs seiner besten Männer für euch abzukommandieren, die in allen Waffengattungen erfahren sind und insbesondere mit Pfeil und Bogen umzugehen verstehen, denn ihr werdet es mit den besten Bogenschützen zu tun haben.»
«Aber Ihr sagtet doch, es seien hauptsächlich Reiter», entgegnete Vespasian. «Soweit ich weiß, haben Thraker keine berittenen Bogenschützen.»
«Dieser Stamm schon. Seine Kämpfer haben manche Gewohnheit der nördlichen Nachbarn angenommen, der Sarmaten und Skythen. Wie diese tragen sie sogar Beinkleider.»
Vespasian sperrte die Augen auf. «Beinkleider? Ich glaube, ein paar dieser Vögel sind mir heute über den Weg gelaufen.»
Tryphaina lächelte. «Unmöglich, es gab hier keine Zwischenfälle mit Geten, seit Moesien römische Provinz ist, also seit über fünfzig Jahren.»
Vespasian berichtete auf die Schnelle, was sich am Nachmittag zugetragen hatte, hob ausdrücklich Artebudz’ Einsatz hervor und erklärte, was er ihm versprochen hatte. Als er fertig war, ließ sich die Königin mit einer Antwort Zeit.
«Deiner Beschreibung nach könnte es sich tatsächlich um Geten gehandelt haben», bestätigte sie. «Bist du sicher, dass sie es auf euch abgesehen hatten?»
«Daran kann kein Zweifel bestehen.»
«Dann scheint es, als habe unser Freund Rhotekes euch nicht verziehen, dass ihr ihn daran gehindert habt, meinen Sohn zu töten. Es könnte sein, dass er dir Mörder auf den Hals geschickt hat, um sich zu rächen.»
«Aber warum erst nach fast vier Jahren?»
«Nach seiner Flucht zu den Geten wird er eine Weile gebraucht haben, um sich bei den Stammesältesten beliebt zu machen. Sie werden ihn anfangs mit Argwohn betrachtet haben.»
«Aber wenn dem so wäre – wie ist es möglich, dass diese Kerle wussten, wie mein Bruder aussieht?», fragte Sabinus.
«Das weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass Rhotekes ein Fanatiker ist und jeden beiseiteräumt, der sich ihm in den Weg stellt. Er wird nicht aufhören, euch nach dem Leben zu trachten. Ihn nach Rom zurückzuführen dürfte spannend werden. Aber zuerst müsst ihr ihn gefangen nehmen. Ihr solltet gleich morgen aufbrechen. Der Schnee in den Haimos-Bergen geht zurück, und der Succi-Pass nach Moesien ist wieder offen. Gegen Mittag werden die Männer vor dem Lager für euch bereitstehen. Ich lasse den Präfekten Paetus wissen, dass du nicht mehr zurückkommst, Vespasian.»
«Aber wir haben durchaus vor zurückzukommen, Herrin», entgegnete Vespasian.
«Natürlich, aber nicht hierher zurück. Diesen Mann in meinem Königreich zu haben kann ich nicht riskieren. Viele meiner Untertanen sehen in ihm einen Helden, der sie vor dem zunehmenden Einfluss Roms beschützt. Würde bekannt, dass er sich in Thrakien aufhält und ich euch dabei helfe, ihn nach Rom zu überführen, drohen Unruhen, die nur eins zur Folge hätten: Es käme zu einem Blutbad, und Rom würde uns annektieren.»
«Was machen wir dann mit ihm?», fragte Vespasian.
«Ihr zieht mit ihm nach Tomoi ans Schwarze Meer. Ich werde veranlassen, dass im Hafen meine Quinquereme ab Anfang Mai auf euch wartet. Ihre Mannschaft ist mir treu ergeben. Sie wird euch nach Ostia bringen. Ich schätze, ein Monat auf See, mit dem Priester im Frachtraum angekettet, ist besser, als über Land zu reisen, wo ihr ihn Tag und Nacht im Auge behalten müsstet.»
«Ihr seid sehr großzügig, Herrin», sagte Sabinus, ein wenig erleichtert durch die Aussicht, dass die Rückkehr von überschaubarer Dauer sein und er nicht mehr als einen Monat unter Übelkeit würde leiden müssen.
«Ja, aber bin ich auch großzügig genug, um meinen kostbarsten Jagdsklaven freizusetzen?» Sie lächelte, als sie Vespasian erröten sah, hatte er sich doch erdreistet, über fremden Besitz zu verfügen, ohne dessen Wert zu kennen.
«Ich werde für Euren Verlust aufkommen, Herrin.»
«Ich bezweifle, dass du dir einen Ersatz für Artebudz leisten kannst. Er ist ein kleines Vermögen wert. Er ist nicht nur ein hervorragender Fährtenleser, sondern weiß auch besser als jeder andere mit dem Bogen umzugehen. Darum werde ich ihn freilassen, aber nur unter der Bedingung, dass er euch begleitet. Nun, bevor ich noch den Rest meines Königtums abtrete, sag mir, Sabinus, wie Antonia in der Sache gegen Seianus vorankommt. Sie macht in ihren Briefen nur vage Andeutungen, wohl aus Angst, sie könnten abgefangen werden.»
Sabinus verzog das Gesicht und rutschte unruhig auf seinem Sitz hin und her. «Leidlich, Herrin. Seianus konnte seine Position stärken. Er ist nunmehr fast die einzige Person, die Kontakt zum Kaiser auf Capreae hält. Offenbar hat er Tiberius eingeflüstert, dass nicht er, sondern die kaiserliche Familie gegen ihn intrigiert. Kurz bevor ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, wurden Antonias ältester Enkel Nero Germanicus und seine Mutter Agrippina auf Seianus’ Befehl wegen des Verdachts auf Hochverrat festgenommen. Sie sitzt im Gefängnis auf der Insel Pandateria, er auf Pontia. Antonia macht sich jetzt Sorgen um die beiden anderen Enkel und zukünftigen Kronerben Drusus und Caligula. Seianus geht äußerst vorsichtig vor und wählt seine Ziele mit Bedacht.»
Die Königin nickte, während sie die Nachricht sacken ließ. «Verstehe. Will Seianus erfolgreich sein, muss er alle potenziellen Nachfolger Tiberius’ beiseiteschaffen, die zu alt sein werden, um ihn ins höchste Amt zu heben. Denn darauf hat er es wohl angelegt: an der Seite eines jüngeren Kaisers zu stehen, der dann auf tragische Weise ums Leben kommt, sodass der Senat vor der Wahl steht, entweder ihn zum Herrscher zu küren oder einen weiteren Bürgerkrieg zu riskieren.»
Vespasian wurde bang bei dem Gedanken, dass sein Freund Caligula den Machenschaften des Seianus ausgeliefert war. «Was ist mit Seianus’ Briefen an Poppaeus, die beweisen, dass die beiden unter einer Decke stecken? Ich weiß, sie wurden vernichtet, aber hat Antonia sie nicht als Druckmittel verwenden und Poppaeus zwingen können, mit ihm zusammenzuarbeiten?»
Sabinus ließ den Kopf hängen. «Leider nein. Poppaeus war zwar eine Weile sehr besorgt, und es schien, dass er sich besinnt, aber dann zweifelte er an der Existenz der Briefe und verlangte, sie zu sehen. Schließlich verschwanden die Liktoren, die den Anschlag auf Asinius überlebt hatten. Anscheinend war die Wahrheit über seinen Tod aus ihnen herausgefoltert worden, denn in einem Brief an Antonia schrieb Poppaeus, dass er sich nun sicher sei, dass sie nichts von ihm erfahren habe.»
Tryphaina dachte einen Moment lang nach und schüttelte dann den Kopf. «Asinius wäre also für nichts und wieder nichts gestorben. Nun, sorgen wir dafür, dass sein Tod nicht ungesühnt bleibt.» Sie erhob sich und gab zu verstehen, dass die Audienz beendet war. «Geht, meine Gebete werden euch begleiten.»
Die Brüder standen auf. «Danke, Herrin», sagten sie im Gleichklang.
«Ich danke euch, denn wenn ihr Erfolg habt, werde ich meinen ärgsten Feind los sein, und ihr helft meiner Verwandten, die Macht unserer Familie in Rom zu festigen.» Sie umarmte die beiden. «Viel Glück. Liefert Antonia diesen Priester aus, damit sie Seianus zu Fall bringen kann.»
Vespasian schwirrte der Kopf, als er mit Sabinus durch die hohen, schwach beleuchteten Korridore des Palastes ging. Ihre Schritte hallten von den Marmorwänden wider. Die Aussicht auf Taten und das Ende der Langeweile, die ihn hier schon so lange geplagt hatte, waren ihm herzlich willkommen. Ebenso beflügelte ihn der Gedanke, den Tod Asinius’ rächen zu können, des Mannes, dem er seinen Posten als Militärtribun verdankte. Und zwar indem er denjenigen Zeugen nach Rom brachte, der bestätigen konnte, dass die thrakische Rebellion von Hasdro finanziert worden war, dem Freigelassenen Seianus’. Ob dessen Aussage Seianus vor den Augen des Kaisers verdammen würde, war ungewiss, aber da Antonia seine Auslieferung verlangte, glaubte er doch sicher zu sein, dass sich der Einsatz und das Risiko lohnen würden. Aber wie lange würde es dauern? Er hatte gehofft, schon im nächsten Monat wieder zurück in Rom und bei Caenis zu sein, musste aber nun die entgegengesetzte Richtung einschlagen und einen Mann gefangen nehmen, von dem er nicht einmal wusste, wo genau er sich aufhielt.
«Mist, ich dachte, es ginge bald wieder nach Hause», murmelte er.
«Du wirst schon morgen aufbrechen, kleiner Bruder.» Sabinus lachte. «Allerdings werden wir einen Umweg einschlagen.»
Vespasian ging auf den Scherz nicht ein. «Ja, einen Umweg, der uns womöglich ein halbes Jahr kostet.»
«Hoffentlich nicht. Ich muss rechtzeitig zu den Wahlen zurück in Rom sein. Antonia hat beim Kaiser für mich erwirkt, dass ich auf der Liste der Kandidaten für ein Quästorenamt stehe. Mit ihrer Unterstützung habe ich eine gute Chance, gewählt zu werden, zumal diesmal nur der Senat votieren wird und nicht die Vollversammlung.»
«Schön für dich», erwiderte Vespasian grummelnd. Er tat sich schwer damit, dem Bruder Beifall zu spenden.
«Danke für den großzügigen Vorschuss an Glückwünschen, kleiner Bruder.»
«Hör auf, mich kleiner Bruder zu nennen.»
«Mach dir nicht ins Hemd.»
«He, he, meine Herren!» Es war Magnus, der da rief. Er stand vor dem Palasteingang und wurde von zwei gepanzerten und mit Speeren bewaffneten Wachposten zurückgehalten.
«Magnus, was ist?»
«Die Mistkerle wollen mich nicht durchlassen», antwortete er und musterte die Wachen, die beide rote Bärte trugen.
«Vorsicht, Römer», knurrte der größere der beiden. Er überragte Magnus um mehr als einen Kopf. «Rom hat hier nichts zu sagen.»
«Piss doch deiner Mutter in den Mund, du Fuchsficker!»
Der riesige Thraker zielte mit dem Schaft seines Speers auf Magnus’ Gesicht. Der aber duckte sich, stellte ihm ein Bein und stieß ihn zu Boden.
«Es reicht!» Vespasian griff ein und zerrte Magnus zurück. «Schluss jetzt!» Und an den Wachposten gewandt: «Ich entschuldige mich für meinen Mann.»
Sabinus baute sich vor dem zweiten Wachposten auf, der seinen Speer erhoben hatte und Vespasian damit drohte. Sein am Boden liegender Kamerad warf Magnus einen giftigen Blick zu und nickte langsam. Er war offenbar gescheit genug, sich nicht mit zwei Römern anzulegen, die von hohem Rang zu sein schienen.
Vespasian führte Magnus über den abschüssigen, von Fackeln beleuchteten Platz vor dem Palast. «Was fällt dir ein, mit diesen Wachen Streit anzufangen? Das war dumm von dir.»
Magnus zeigte keine Reue. «Sie hätten mich durchlassen sollen. Ich hatte es eilig. Paetus hat mich zu Euch geschickt mit der dringlichen Meldung, dass die Situation im Lager außer Kontrolle zu geraten droht.»
Schon als sie das uralte Stadttor von Philippopolis passierten, hörten sie Gebrüll und Lärm aus dem römischen Lager, das rund eine halbe Meile entfernt war. Im Laufschritt machten sie sich im spärlichen Licht eines Halbmonds auf den Weg über raues Gelände. Den Grund für die Unruhen hatte Magnus den Brüdern nicht erklären können. Er wusste nur, dass Streit ausgebrochen war und eine Delegation wütender Männer Paetus zu sprechen verlangt hatte. Bevor er sie zu empfangen gedachte, wollte er, der Präfekt der Garnison, sich mit Vespasian beraten, dem Befehlshaber zweier Kohorten der Legio IIII Scythica.
Es standen nicht wie sonst Legionäre der Garde vor dem Prätorianertor Wache, sondern nur ein Centurio, der Vespasian mit grimmigem Blick bedachte, als sie sich näherten.
«Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist, Herr», sagte er und salutierte. «Aber seit wir die Toten gefunden haben, braut sich was zusammen.»
«Was für Tote, Albinus?», fragte Vespasian, den Salut erwidernd.
«Drei unserer Männer wurden heute Morgen im Wald aufgefunden, Herr. Wir haben sie seit zwei Tagen vermisst. Sie wurden übel zugerichtet, mit Messern, wie man mir sagte. Selbst habe ich sie nicht gesehen. Zwei von ihnen sind tot, der dritte ist in ziemlich schlimmem Zustand.»
«Danke, Centurio», sagte Vespasian und trat durch das Tor der Via Praetoria, gefolgt von Sabinus und Magnus.
Im Lager hatten sich überall kleine bis größere Gruppen heftig diskutierender Legionäre gebildet, die einen im Licht flackernder Fackeln, die anderen im Schatten zwischen den Zelten. Hier und da kam es zu Handgreiflichkeiten mit Centurionen, die mit Hilfe ihrer Stellvertreter, der Optiones, die Streitereien zu schlichten versuchten. Immerhin schien es, dass sie die Oberhand behielten und sich mit ihren Rebstöcken Respekt verschaffen konnten.