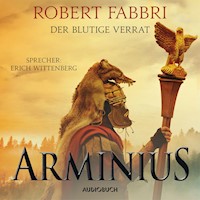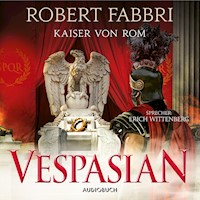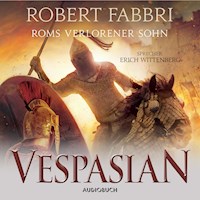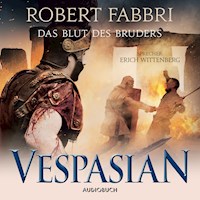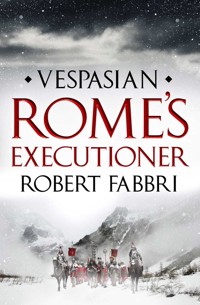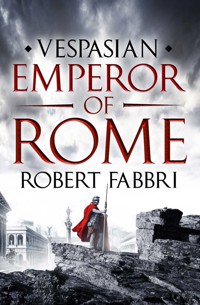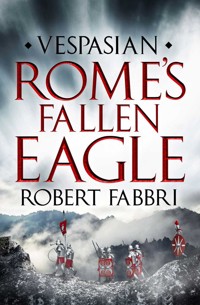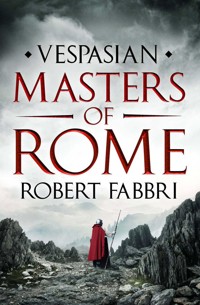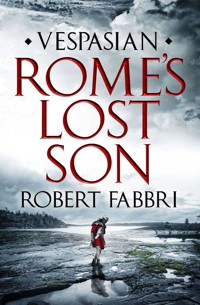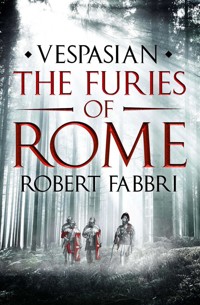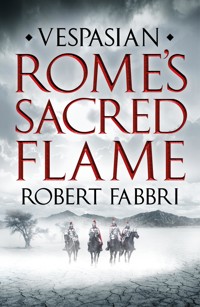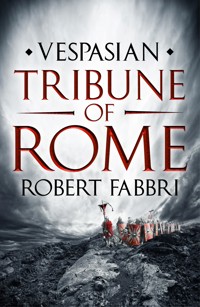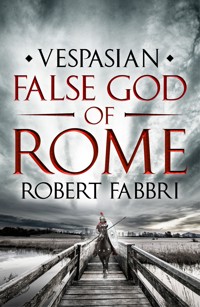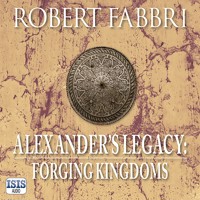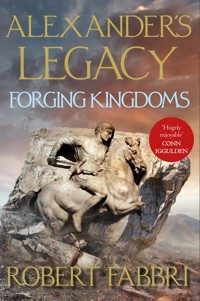9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Vespasian-Reihe
- Sprache: Deutsch
Rebellion in den Provinzen Ein Kaiser, blutdurstig und hemmungslos Vespasians Auftrag: der Diebstahl eines der größten Artefakte des Altertums Das Jahr 34 n. Chr.: Vespasian dient am Rande des Imperiums, bis er endlich nach Rom zurückkehren darf. Unerwartet ereilt Kaiser Tiberius der Tod, und Caligula ergreift die Macht – doch die leuchtende Hoffnung Roms verkommt zu einem unkontrollierbaren Despoten, der sich als Gott huldigen lässt. Verschwenderische Bauten, endlose Spiele, ein verängstigter Senat verblassen neben Caligulas gewagtestem Plan: eine Brücke über die Bucht von Neapel, über die er dekoriert mit dem Brustpanzer Alexanders des Großen reiten will. Kein anderer als Vespasian soll die legendäre Rüstung rauben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Robert Fabbri
Vespasian. Der falsche Gott
Historischer Roman
Über dieses Buch
Rebellion in den Provinzen
Ein Kaiser, blutdurstig und hemmungslos
Vespasians Auftrag:
der Diebstahl eines der größten Artefakte des Altertums
Das Jahr 34 n. Chr.: Vespasian dient am Rande des Imperiums, bis er endlich nach Rom zurückkehren darf. Unerwartet ereilt Kaiser Tiberius der Tod, und Caligula ergreift die Macht – doch die leuchtende Hoffnung Roms verkommt zu einem unkontrollierbaren Despoten, der sich als Gott huldigen lässt. Verschwenderische Bauten, endlose Spiele, ein verängstigter Senat verblassen neben Caligulas gewagtestem Plan: eine Brücke über die Bucht von Neapel, über die er dekoriert mit dem Brustpanzer Alexanders des Großen reiten will. Kein anderer als Vespasian soll die legendäre Rüstung rauben …
«Ein Wahnsinnsbuch.» Classic FM
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel «Vespasian. False God of Rome» bei Corvus/Atlantic Books, Ltd., London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Vespasian. False God of Rome» Copyright © 2013 by Robert Fabbri
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Karten © Peter Palm, Berlin
Umschlaggestaltung
Umschlagabbildung
Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-40479-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Anja Müller,
ohne die dieses Buch nicht entstanden wäre.
Willst du mich heiraten, meine Liebste?
Prolog
Ein Klopfen an der Tür riss Titus Flavius Sabinus aus dem Schlaf. Als er die Augen aufschlug, wusste er im ersten Moment nicht, wo er sich befand. Er hob hastig den Kopf von der Tischplatte und schaute sich im Raum um. Durch ein schmales, offenes Fenster drang noch genügend Dämmerlicht herein, sodass er die fremde Umgebung ausmachen konnte: seine Amtsstube im Turm der Burg Antonia. Draußen vor dem Fenster ragte der Tempel hoch in den Himmel auf. Seine mit weißem Marmor verkleideten Mauern waren in rötliches Licht getaucht, und das Blattgold, mit dem das Dach verziert war, glänzte in der untergehenden Sonne. Das heiligste Bauwerk der Juden war so gewaltig, dass die mächtigen Säulen um den rechteckigen Hof dagegen klein wirkten. Diese wiederum ließen die zahlreichen Gestalten, die zwischen ihnen herum und kreuz und quer über den riesigen Hof liefen, winzig wie Ameisen erscheinen.
Der Blutgeruch von Tausenden Lämmern, die im Tempelkomplex für das Pessachmahl an diesem Abend geschlachtet wurden, durchzog die kühle Luft. Sabinus fröstelte; während seines kurzen Schlummers war er ausgekühlt.
Es klopfte wieder, diesmal nachdrücklicher.
«Quästor, seid Ihr da?», rief jemand.
«Ja, herein», erwiderte Sabinus und schob rasch die Schriftrollen auf dem Tisch so zurecht, dass es aussah, als wäre er in seine Arbeit vertieft gewesen, statt sich bei einem spätnachmittäglichen Nickerchen von der zweitägigen Reise von Caesarea – der Provinzhauptstadt von Judäa – nach Jerusalem zu erholen.
Die Tür wurde geöffnet, ein Auxiliarcenturio marschierte herein und stand vor dem Schreibtisch stramm, den Helm mit dem quer verlaufenden Helmbusch steif unter dem linken Arm. «Centurio Longinus von der Kohorte Prima Augusta, zu Diensten, Herr», bellte er. Sein Gesicht war vom jahrelangen Dienst im Osten gebräunt und faltig wie altes Leder.
«Was gibt es, Centurio?»
«Zwei Juden bitten um eine Audienz beim Präfekten, Herr.»
«Dann bringt sie zu ihm.»
«Er speist mit einem jüdischen Prinzen aus Idumäa und mehreren Parthern, die gerade in die Stadt gekommen sind. Er ist betrunken wie ein Legionär beim Ausgang und sagte, Ihr solltet Euch um sie kümmern.»
Sabinus knurrte. Seit er vor zehn Tagen nach Judäa entsandt worden war, um auf Geheiß seines Vorgesetzten – des Statthalters von Syrien, der die oberste Amtsgewalt über Judäa innehatte – die Steuereinnahmen zu prüfen, hatte er bereits genug mit dem Präfekten Pontius Pilatus zu tun gehabt, um ohne weiteres zu glauben, was der Centurio berichtete. «Sagt ihnen, sie sollen morgen wiederkommen, wenn der Präfekt zugänglicher ist», befahl er abwehrend.
«Das habe ich, Herr, aber einer von ihnen ist ein Hauptmann der Tempelwache, der vom Hohepriester Kajaphas geschickt wurde. Er hat nachdrücklich betont, er habe Informationen über etwas, das angeblich heute Abend nach dem Pessachmahl geschehen soll.»
Sabinus seufzte. Obgleich neu in der Provinz, war er über die komplexen politischen Fehden zwischen Roms unbotmäßigen Untertanen schon genügend im Bilde, um zu wissen, dass Kajaphas seine Position der Gunst Roms verdankte und daher gewissermaßen ein Verbündeter war. Der beste, den er unter der überwiegend feindseligen jüdischen Bevölkerung dieser spannungsgeladenen Stadt finden würde. Jetzt, da Jerusalem anlässlich des Pessachfestes zum Bersten voll mit Pilgern war, wäre es politisch äußerst ungeschickt, einen Verbündeten zu brüskieren. Wegen ebendieses Festes waren er und der Präfekt überhaupt hierhergekommen, um die Lage in der Stadt im Auge zu behalten.
«Also gut, Centurio, führt sie herauf.»
«Es wäre besser, wenn Ihr herunterkommt, Herr, damit wir dafür sorgen können, dass sie Euch nicht zu nahe kommen.» Longinus zog zwei kurze Krummdolche aus seinem Gürtel. «Diese haben wir bei dem anderen Mann gefunden, sie waren in seiner Kleidung versteckt.»
Sabinus nahm die Waffen und betrachtete die rasiermesserscharfen Klingen. «Was sind das für Dolche?»
«Sicae, Herr. Das bedeutet, dass er ein Sicarius ist.»
Sabinus schaute den Centurio verständnislos an.
«Die Sicarii sind Meuchelmörder, die aus religiösen Gründen töten, Herr», erklärte Longinus. «Sie glauben, das Werk ihres Gottes zu tun, indem sie jene beseitigen, die sie für unrein und für Gotteslästerer halten – und das ist so ziemlich jeder, der nicht ihrer Sekte angehört. Ein solcher Mann würde nicht vor einem Mordanschlag auf Euch zurückschrecken, auch wenn es ihn selbst das Leben kosten würde. Diese Leute glauben, wenn sie bei einem heiligen Werk ihr Leben lassen, würden sie am sogenannten Ende der Tage, wenn dieser langersehnte Messias endlich erscheint, gemeinsam mit allen anderen verstorbenen Gerechten auferstehen und in einem irdischen Paradies unter den Gesetzen ihres Gottes ewig leben.»
«Dagegen scheinen ja selbst die Zeloten ganz vernünftige Leute zu sein», bemerkte Sabinus, womit er die jüdische Sekte meinte, die bislang der unvernünftigste Haufen religiöser Eiferer war, von denen er gehört hatte.
«In diesem Arschloch des Imperiums gibt es nun mal keine Vernunft.»
Sabinus schwieg kurz, um über die Richtigkeit dieser Aussage zu sinnieren. «Also gut, Centurio», sagte er schließlich, «ich komme nach unten. Geht und kündigt mich an.»
«Jawohl, Herr!» Longinus salutierte und marschierte forsch hinaus.
Sabinus machte sich kopfschüttelnd daran, die Dokumente über Jerusalems Steuereinnahmen im vergangenen Jahr einzurollen, richtete seine Toga und verließ ebenfalls den Raum. Zwar verletzte es seine Dignitas, sich hinunterzubemühen, um mit den Juden zu sprechen, statt sie zu sich führen zu lassen. Doch er kannte sie gut genug, um den Rat des erfahrenen Centurios zu befolgen, denn er wollte nicht irgendeinem selbstmörderischen religiösen Eiferer zum Opfer fallen.
«Mein Name ist Gaius Iulius Paulus», verkündete der kleinere der beiden Juden in ungeduldigem Ton, sobald Sabinus in die große Halle der Burg trat. «Ich bin ein römischer Bürger und Hauptmann der Tempelwache, und ich verlange, den Präfekten zu sprechen, nicht seinen Untergebenen.»
«Der Präfekt ist indisponiert, also wirst du mit mir sprechen», versetzte Sabinus scharf. Er konnte diesen wichtigtuerischen, krummbeinigen kleinen Juden auf Anhieb nicht leiden. «Und du wirst mir den Respekt zollen, der mir als Quästor des Statthalters von Syrien gebührt, des Präfekten der Provinz, der Judäa direkt untersteht, sonst lasse ich dich mit der Peitsche aus der Burg prügeln, römischer Bürger hin oder her.»
Paulus schluckte und fuhr sich mit einer Hand durch das schüttere Haar. «Verzeiht mir, Quästor, ich wollte Euch nicht beleidigen», sagte er, und plötzlich troff seine Stimme von Unterwürfigkeit. «Ich komme mit einem Ersuchen vom Hohepriester, betreffend den Aufrührer und Gotteslästerer Jeschua bar Joseph.»
«Nie gehört», versetzte Sabinus trocken. «Was hat er angestellt?»
«Er ist einer von denen, die sich als der Messias ausgeben, Herr», erklärte Longinus. «Wir versuchen, ihn wegen Aufwiegelung zu verhaften, denn er hat einen Aufruhr verursacht, als er vor vier Tagen in die Stadt gekommen ist. Er hat sich gegen die Autorität des Kaisers aufgelehnt, indem er behauptete, ein König zu sein. Eine ganze Menge Leute sind bei dem Aufruhr umgekommen, darunter auch drei meiner Soldaten. Dann hat er den Hohepriester gegen sich aufgebracht, indem er in den Tempel ging, so ziemlich alle dort beleidigte und die Tische der Geldwechsler umstieß.»
«Was machen denn Geldwechsler im Tempel?», erkundigte sich Sabinus mit aufrichtiger Neugier.
«Die Juden betrachten unsere Münzen als Götzenbilder, weil der Kopf des Kaisers darauf geprägt ist. Deshalb gestatten wir ihnen ihre eigene Tempelwährung, mit der sie Opferschafe und dergleichen kaufen können. Und wie Ihr Euch wohl denken könnt, machen die Geldwechsler beim Umtausch einen ganz ordentlichen Gewinn.»
Sabinus zog die Augenbrauen hoch. Allmählich überraschte ihn bei diesem Volk nichts mehr. Er wandte sich wieder den beiden Juden zu. Der zweite Mann, hochgewachsen, mit Vollbart und geöltem schwarzem Haar, das unter dem Tuch um seinen Kopf hervorquoll, stand reglos da und starrte Sabinus mit hasserfülltem Blick an. Seine Hände waren vor dem Körper gefesselt. Augenscheinlich war er kein roher Bauer vom Lande. Sein langärmeliges, hellblaues Gewand, das bis zu den Knöcheln reichte, war sauber und sichtlich kostbar, in einem Stück gewebt – die Kleidung eines wohlhabenden Mannes. Der hochwertige schwarz-weiße Mantel, den er um die Schultern trug, verstärkte diesen Eindruck.
«Was hat dieser Mann mit Jeschua zu tun?», fragte Sabinus, an Paulus gewandt.
«Er ist einer seiner Anhänger», erwiderte Paulus mit kaum verhohlener Abneigung. «Er war bei ihm während der zwei Jahre, in denen Jeschua oben in Galiläa Unfrieden gestiftet hat. Er behauptet, nach dem Pessachmahl werde Jeschua verkünden, dass das Ende der Tage bevorsteht; er werde sich selbst zum lange erwarteten Messias erklären und einen Aufstand gegen Rom und die Tempelpriester anführen. Kajaphas ersucht um die Erlaubnis des Präfekten, ihn wegen Gotteslästerung zu verhaften und vor dem Sanhedrin, dem geistlichen Gericht, anzuklagen. Dieser Mann hier sagt, er werde uns heute Abend zu ihm führen.»
Sabinus wandte sich wieder dem anderen zu. «Wie heißt du, Jude?»
Der Mann starrte ihn Augenblicke lang weiter an, ehe er sich zu einer Antwort herabließ. «Jehudah», antwortete er und nahm eine noch aufrechtere Haltung an.
«Wie ich hörte, bist du ein Sicarius.»
«Es ist eine Ehre, Gott zu dienen», erwiderte Jehudah gleichmütig in fast akzentfreiem Griechisch.
«Also, Jehudah der Sicarius, was verlangst du dafür, dass du den Mann verrätst, dem du zwei Jahre lang gefolgt bist?»
«Ich bin nicht auf Belohnung aus, ich habe meine eigenen Gründe, es zu tun.»
Sabinus schnaubte verächtlich. «Ein Mann mit Prinzipien, wie? Sage mir, warum du es tust, damit ich glauben kann, dass das Ganze keine Falle ist.»
Jehudah starrte Sabinus ausdruckslos an, dann wandte er langsam den Blick ab.
«Ich könnte dich foltern lassen, um es aus dir herauszupressen, Jude», drohte Sabinus. Er verlor allmählich die Geduld mit diesem Mann, der keinerlei Achtung vor der Autorität Roms zeigte.
«Das könnt Ihr nicht, Quästor», warf Paulus rasch ein. «Ihr würdet Kajaphas und die Priester gegen Euch aufbringen, die Euch um Hilfe ersucht haben, um einen Aufrührer zu verhaften. Jetzt, da zum Pessachfest mehr als tausend Pilger hier sind, ist Rom auf die Unterstützung der Priester angewiesen, um Ruhe und Ordnung zu wahren. In den vergangenen Tagen hat es bereits genug Unruhe gegeben.»
Sabinus funkelte den stämmigen kleinen Soldaten der Tempelwache erbost an. «Wie kannst du es wagen, mir, einem römischen Quästor, zu sagen, was ich tun kann und was nicht?»
«Er hat aber recht, Herr», mischte sich Longinus ein, «und ein Hilfsersuchen der Priester kann man nicht einfach ablehnen. So laufen die Dinge hier nicht, zumal wir ihnen einen Gefallen schulden.»
«Wofür?»
«Direkt nach dem von Jeschua angestifteten Aufruhr haben sie uns die Mörder der drei Soldaten unserer Auxiliartruppe ausgeliefert. Einer von ihnen – er heißt auch Jeschua, Jeschua bar Abbas – ist beim Volk fast so beliebt wie sein Namensvetter. Der Präfekt hat gestern bei seiner Ankunft alle drei zum Tode verurteilt. Sie sollen morgen hingerichtet werden.»
Sabinus erkannte, dass Longinus wahrscheinlich recht hatte: Ihm blieb nichts anderes übrig, als Kajaphas’ Ersuchen stattzugeben. Er verfluchte Pilatus dafür, dass er ihn in diese Lage brachte, indem er sich selbst betrank und seine Pflicht vernachlässigte. Doch dann sagte er sich, dass wahrscheinlich die unerträgliche Situation in dieser Provinz den Präfekten dazu trieb.
«Also gut», grollte er, «richte Kajaphas aus, ihr dürft den Mann verhaften.»
«Er bittet darum, dass ein römischer Offizier uns begleitet», erwiderte Paulus. «Sonst fehlt es uns an der nötigen Amtsbefugnis.»
Sabinus warf einen Blick zu Longinus, der bestätigend nickte. «Nun gut, ich gehe mit. Wo treffen wir uns?»
Paulus wandte sich an Jehudah. «Sag es ihm.»
Der Sicarius hob den Kopf und schaute Sabinus verächtlich an. «Wir werden das Pessachmahl in der Oberstadt einnehmen. Der Raum wurde mit Bedacht gewählt: Es führt nur eine Treppe hinauf, sodass er leicht zu verteidigen ist. Aber später werden wir außerhalb der Stadtmauern neue Anhänger treffen. Seid zu Beginn der zweiten Wache beim Schaftor, dann führe ich Euch zu ihm.»
«Warum verhaften wir ihn nicht einfach auf der Straße, wenn er das Haus verlässt?»
«In Gethsemani ist es ruhiger.»
«Ihr habt zugelassen, dass die Tempelwache diesen Aufrührer verhaftet hat!», brüllte Präfekt Pilatus Sabinus lallend an. «Damit seine jüdischen Glaubensbrüder ihm den Prozess machen. Dann habt Ihr seine bewaffneten Anhänger ihrer Wege gehen lassen, sodass sie nach Herzenslust Unheil stiften können. Und das gerade jetzt, wo diese dreckige Stadt zum Bersten voll mit den kriegerischsten religiösen Eiferern ist, die Rom jemals unseligerweise unterworfen hat!»
«Die Tempelwache hat sie gehen lassen, nachdem Jeschua festgenommen war. Ihr Hauptmann hatte bereits die Hälfte seines rechten Ohrs eingebüßt, und sie wollten einen Kampf vermeiden. Ich hatte sonst keine Soldaten bei mir.»
«Warum nicht?» Pilatus’ blutunterlaufene Augen traten vor Wut hervor, seine knollige Trinkernase war rot wie ein Brandeisen, und Schweißtropfen liefen ihm über die schlaffen Wangen.
Sabinus’ Bericht über Jeschuas Verhaftung hatte ihn, gelinde gesagt, enttäuscht. Die drei Männer, die bei ihm zum Abendessen zu Gast waren, tranken schweigend ihren Wein, während er sich auf sein Speisesofa fallen ließ und sich die Schläfen rieb. Er griff nach seinem Becher, leerte ihn in einem Zug, schmetterte ihn wieder auf den Tisch, starrte Sabinus boshaft an und wandte sich dann an einen eleganten Mann mittleren Alters, der auf dem Sofa zu seiner Linken lag.
«Herodes Agrippa, ich brauche Euren Rat. Der Quästor hat zugelassen, dass dieser Rebell uns überlistet hat.»
Herodes Agrippa schüttelte den Kopf, dass seine geölten Locken wippten, die bis knapp unter den kurzgestutzten Bart reichten. Sein hageres Gesicht mit dem festen Kinn hätte attraktiv sein können, wäre da nicht die große Hakennase gewesen, die wie der Schnabel eines Habichts unter den dunklen Augen vorsprang. «Ihr habt recht, Präfekt», sagte er und hielt seinen Becher mit unsicherer Hand dem Sklaven hin, der ihm nachschenkte. «Die Priester sind in Jeschuas Falle getappt, ohne …» Er hielt inne, als der Sklave Wein über seine zitternde Hand goss. «Eutyches! Du bist fast so nutzlos wie dieser Quästor. Schere dich hinaus!»
Sabinus erhob sich und starrte finster geradeaus. Er machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen Herodes.
«In unserem Land würde ein Mann für die Inkompetenz des Quästors sein Augenlicht verlieren», bemerkte der ältere der zwei Männer, die zur Rechten von Pilatus lagen, und strich sich über den langen, lockigen Bart.
Herodes warf seinen Becher nach dem Sklaven, der sich entfernte. «Leider, Sinnakes, haben sie hier nicht die gleichen Freiheiten wie Ihr in Parthien, Schwachköpfen ihre gerechte Strafe zu erteilen.»
Sabinus warf Herodes einen bitterbösen Blick zu. «Ich möchte Euch daran erinnern, Jude, dass ich Senator bin, also hütet Eure Zunge.» Er wandte sich wieder an Pilatus. «Die Priester haben uns eine Gelegenheit geboten, diesen Mann verhaften zu lassen, deshalb habe ich die Initiative ergriffen. Ihr wolltet Euch ja nicht mit der Angelegenheit befassen, da Ihr … anderweitig beschäftigt wart.»
«Ich war nicht ‹anderweitig beschäftigt›, ich war betrunken, und jetzt bin ich noch betrunkener. Aber selbst in diesem Zustand hätte ich genügend Verstand aufgebracht, diesen Wahnsinnigen hierher in römischen Gewahrsam zu bringen und ihn nicht den Juden zu überlassen, ganz gleich, wie viele verdammte Priester ich damit verärgert hätte. Ich scheiße auf sie alle, Quästor, hört Ihr? Ich scheiße auf sie alle.»
«Aber die Priester werden ihm den Prozess machen und ihn schuldig sprechen, das ist in ihrem eigenen Interesse», wandte Sabinus ein.
«Der Prozess ist bereits im Gange, und sie brennen darauf, ihn zum Tode zu verurteilen. Ihnen liegt so viel daran, dass sie sogar ihren Schabbath zum Pessach gebrochen haben, um ihn unverzüglich vor Gericht zu stellen. Kajaphas hat mir eine Nachricht geschickt mit der Bitte, gleich morgen früh zum Palast zu kommen, um ihr Urteil zu bestätigen, ehe sie ihn steinigen.»
Sabinus schaute seinen Vorgesetzten verständnislos an. «Und wo liegt dann das Problem?»
Pilatus seufzte ungeduldig, schloss die Augen, fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar und bog dabei den Kopf zurück. «Ihr seid neu in diesem Drecksloch, deshalb will ich versuchen, es mit einfachen Worten zu erklären», sagte er mit nicht geringer Herablassung. «Wie Ihr in Eurem Bericht selbst eingeräumt habt, hat Jeschua seine eigene Verhaftung inszeniert. Er hat Jehudah als Verräter zu den Priestern geschickt, weil er wollte, dass sie ihn schuldig sprechen, nicht wir. Weil er beim gemeinen Volk so beliebt ist, setzt er darauf, dass es sich aufgrund des Todesurteils gegen die Priester und die ganze Tempelhierarchie und auch gegen Rom erhebt, weil wir das Urteil bestätigt haben. Mit einem einzigen gewaltigen Patzer habt Ihr es Jeschua ermöglicht, einen Keil zwischen das Volk und die einzige Macht zu treiben, die diese Leute respektieren: die Priester, die ihre Stellung Rom verdanken und deshalb durch einen Aufstand nichts zu gewinnen haben.»
Plötzlich erkannte Sabinus das Ausmaß seiner Fehleinschätzung. «Hätten dagegen wir ihn verurteilt, dann könnten die Priester zum Frieden aufrufen und erwarten, dass man auf sie hört. Das hätte zusammen mit einer Machtdemonstration unsererseits genügt, um einen Aufstand im Keim zu ersticken.»
«Ganz genau», bestätigte Pilatus spöttisch, «Ihr habt es endlich erfasst. Nun, Herodes, ich muss diese Situation schnell entschärfen, ehe Jeschuas Anhänger anfangen, das Volk aufzuhetzen. Was soll ich tun?»
«Ihr müsst gleich morgen früh zum Palast gehen.»
«Um das Urteil aufzuheben?»
«Nein, Ihr könnt diesen Mann nicht am Leben lassen, jetzt, da er endlich gefasst ist. Aber Ihr müsst die Priester wieder mit dem Volk einen, damit sie ihren Einfluss geltend machen können.»
«Ja, aber wie?»
«Indem Ihr eine jüdische Steinigung in eine römische Kreuzigung umwandelt.»
«Dieser Mann muss sterben», zischte der Hohepriester Kajaphas durch seinen langen grauen Vollbart Pilatus zu. In seinen prächtigen Gewändern und mit dem seltsamen, edelsteinbesetzten hohen Hut aus Seide wirkte er auf Sabinus eher wie ein Klientelkönig aus dem Osten denn wie ein Priester. Doch nach der Größe und Pracht des jüdischen Tempels zu urteilen, war das Judentum wohl eine sehr reiche Religion, und die Priester konnten es sich leisten, verschwenderisch mit dem Geld umzugehen, das die Armen ihnen in der Hoffnung zahlten, vor ihrem Gott als Gerechte dazustehen.
«Und das wird er, Priester», erwiderte Pilatus. Er war offenbar in den ersten Stunden nach Tagesanbruch nicht gerade bester Laune, und im Augenblick fiel es ihm besonders schwer, nicht die Beherrschung zu verlieren. «Aber er wird nach römischer Sitte sterben, nicht nach jüdischer.»
Sabinus stand neben Herodes Agrippa und verfolgte interessiert die Auseinandersetzung zwischen den beiden mächtigsten Männern der Provinz. Die Zusammenkunft war von Bitterkeit geprägt, erst recht, nachdem Pilatus genüsslich erörtert hatte, welche Falle Jeschua Kajaphas gestellt hatte und wie dieser aus Mangel an politischem Geschick darauf hereingefallen war.
«Um einen Aufstand zu verhindern», fuhr Pilatus fort, «den Jeschuas Anhänger Berichten zufolge bereits anzetteln, müsst Ihr sofort tun, was ich befohlen habe.»
«Und wie kann ich sicher sein, dass Ihr Euer Versprechen halten werdet?»
«Stellt Ihr Euch absichtlich dumm?», fuhr Pilatus ihn an. Er verlor nun tatsächlich die Geduld angesichts dieses eigennützigen Priesters. «Wir stehen in dieser Angelegenheit auf derselben Seite. Die Vorbereitungen sind getroffen, die Befehle erteilt. Und nun geht!»
Kajaphas wandte sich ab und schritt so würdevoll, wie er es nach dieser rüden Abfuhr vermochte, aus dem herrschaftlichen Empfangszimmer im Herzen des Palastes, den der verstorbene Herodes der Große an der Westseite der Oberstadt hatte erbauen lassen.
«Was denkt Ihr, Herodes?», erkundigte sich Pilatus.
«Ich denke, er wird seine Rolle spielen. Sind die Soldaten bereit?»
«Ja.» Pilatus richtete seine blutunterlaufenen Augen auf Sabinus. «Dies ist Eure Chance, Euren Fehler wiedergutzumachen, Quästor. Tut einfach, was Herodes gesagt hat.»
Der Lärm der aufgebrachten Menge wurde immer lauter, je näher Sabinus und Herodes dem Haupteingang des Palastes kamen. Als sie durch die hohen Türen aus poliertem Zedernholz traten, sahen sie einen riesigen Menschenauflauf vor sich, der die ganze Agora vor dem Palast erfüllte und bis in die breite Straße am anderen Ende reichte, die zum Tempel und der Burg Antonia führte.
Die Schatten waren lang, und die Luft war zur ersten Stunde des Tages noch kalt. Als Sabinus nach links schaute, entdeckte er auf dem Hügel Golgotha hinter dem Alten Tor in der Stadtmauer ein Kreuz, das zwischen den Hinrichtungen dauernd dort stand, um die Leute an das Schicksal zu gemahnen, das sie erwartete, wenn sie sich der Macht Roms zu widersetzen versuchten.
Kajaphas blieb am oberen Ende der Treppe vor dem Palast stehen und hob die Arme in dem Versuch, die Menge zum Schweigen zu bringen. Er war von einem Dutzend weiterer Priester umgeben; hinter ihnen, von Paulus und einem Trupp der Tempelwache bewacht, stand Jeschua mit gefesselten Händen und einem blutfleckigen Verband um den Kopf.
Allmählich verebbte der Lärm, und Kajaphas ergriff das Wort.
«Was sagt er?», erkundigte sich Sabinus bei Herodes.
«Er hat um Ruhe gebeten, und jetzt erklärt er, aufgrund seiner Beliebtheit beim gemeinen Volk werde Jeschua begnadigt und aus dem jüdischen Gewahrsam entlassen, als Gnadengeste zum Pessachfest.»
Sobald Kajaphas verstummte, erhob sich aus der Menge lauter Jubel. Nach ein paar Augenblicken gebot der Hohepriester erneut mit erhobenen Armen Schweigen, dann fuhr er fort.
«Jetzt fordert er die Leute auf, nach Hause zu gehen», übersetzte Herodes, «und er sagt, Jeschua werde unverzüglich freikommen.»
Sabinus verfolgte die Szene aufmerksam und wartete auf seinen Einsatz. Kajaphas wandte sich um und nickte Paulus zu, der widerstrebend begann, die Handfesseln seines Gefangenen zu lösen.
«Jetzt!», zischte Herodes. «Und bemüht Euch, nichts Dummes zu sagen.»
«Dieser Mann ist jetzt ein Gefangener des römischen Senats», rief Sabinus laut und marschierte auf Jeschua zu. Hinter ihm führte Longinus eine halbe Centurie einer Auxiliartruppe aus dem Palast, die rasch die Tempelwache und den Mann umstellte, der bis eben ihr Gefangener gewesen war. Über die Straße zur Burg Antonia kam eine Kohorte anmarschiert und ging hinter der Menge in Stellung, sodass die Straße versperrt war und niemand entkommen konnte.
«Was hat das zu bedeuten?», schrie Kajaphas Sabinus an. Er spielte seine Rolle wirklich sehr theatralisch.
«Der Senat fordert, dass dieser Mann, Jeschua, vor dem Statthalter des Kaisers, dem Präfekten Pilatus, angeklagt wird», erwiderte Sabinus mit lauter, klarer Stimme, die über die Agora scholl.
Aus der Menge ertönten zornige Ausrufe, da diejenigen, die Griechisch verstanden, Sabinus’ Worte für die anderen übersetzten. Als der Lärm der Menge anschwoll, zogen die Männer der Kohorte dahinter ihre Schwerter und begannen, damit rhythmisch auf die Schilde zu schlagen.
Pilatus trat aus dem Palast, begleitet von einem zerlumpten, ziemlich mitgenommen aussehenden Juden. Er schritt an Sabinus vorbei und stellte sich neben Kajaphas. Die Rufe und der Waffenlärm erstarben.
«Mir sind die Hände gebunden», verkündete er und hob die Arme mit gekreuzten Handgelenken über seinen Kopf. «Quästor Titus Flavius Sabinus hat im Namen des Senats gefordert, dass ich Jeschua den Prozess mache, weil er sich selbst zum König erklärt und einen Aufstand gegen den Kaiser angestiftet hat. Als Diener Roms kann ich mich einer solchen Forderung nicht widersetzen. Sollte er schuldig gesprochen werden, dann hat Rom ihn verurteilt, nicht ich, euer Präfekt. Ich bin am Blut dieses Menschen nicht schuldig, denn dies ist nicht mein Werk, sondern der Wille des Senats.» Er hielt inne und zog den Juden nach vorn, der ihn begleitete. «Doch als Zeichen des guten Willens und zum Beweis, dass Rom gnädig ist, will ich zu Ehren eures Pessachfestes einen anderen Jeschua freilassen, der euch am Herzen liegt: diesen Mann, Jeschua bar Abbas.» Pilatus schob den Mann die Stufen vor dem Palast hinunter, wo er in der jubelnden Menge verschwand.
«Ihr habt ihnen einen Brocken zum Trost hingeworfen, Priester, jetzt nutzt Eure Autorität und bringt die Leute dazu, sich zu zerstreuen, ehe ich sie allesamt abschlachten muss», zischte Pilatus Kajaphas zu, ehe er sich zum Gehen wandte. «Herodes, kommt mit mir.»
«Ich denke, mit Eurer Erlaubnis werde ich mich jetzt entfernen, Präfekt. Es wäre nicht gut, wenn ein jüdischer Prinz mit dem Tod dieses Mannes in Verbindung gebracht würde, und außerdem muss ich mich um meine parthischen Gäste kümmern.»
«Wie Ihr wünscht. Longinus, bringt den Gefangenen zu mir, nachdem Ihr ihn ein wenig mürbe gemacht habt.»
«Du bist also der Mann, der sich selbst König der Juden nennt?», stellte Pilatus fest und blickte auf den geschundenen Mann hinunter, der im Audienzzimmer vor seinem kurulischen Stuhl auf dem Boden kniete.
«Das sind deine Worte, nicht die meinen», entgegnete Jeschua und hob unter Schmerzen den Kopf, um seinem Ankläger in die Augen zu blicken. Blut aus den Wunden von der Dornenkrone, die man ihm zum Spott auf den Kopf gedrückt hatte, verklebte sein Haar und lief ihm übers Gesicht. Auf seinem Rücken sah Sabinus die frischen Striemen von einer heftigen Geißelung.
«Und doch leugnest du nicht.»
«Mein Königreich ist nicht von der materiellen Welt.» Jeschua hob die gefesselten Hände an seinen Kopf. «Es ist hier drin, wie bei allen Menschen.»
«Ist es das, was du predigst, Jude?», fragte Sabinus und erntete einen zornigen Blick von Pilatus, weil er sich in seine Befragung einmischte.
Jeschua richtete die Aufmerksamkeit auf ihn. Sein eindringlicher Blick ging Sabinus durch und durch. «Alle Menschen tragen das Königreich Gottes in sich, Römer, selbst heidnische Hunde wie ihr. Ich predige, dass wir uns durch die Taufe reinigen sollen, um unsere Sünden abzuwaschen. Dann werden wir, indem wir der Torah folgen und unsere Glaubensbrüder mit Mitgefühl behandeln – indem wir ihnen tun, wie wir wünschen, dass uns getan wird –, am Ende der Tage, das bald kommen wird, für gerecht und würdig befunden werden, zu unserem Vater zu gehen.»
«Genug von diesem Unfug», fuhr Pilatus ihn an. «Leugnest du, dass du mit deinen Anhängern das Volk dazu angestiftet hast, sich gegen die römische Herrschaft zu erheben?»
«Kein Mensch ist Herr über einen anderen», erwiderte Jeschua schlicht.
«Da irrst du, Jude, ich bin Herr über dich. Dein Schicksal liegt in meinen Händen.»
«Das Schicksal meines Leibes, ja, aber nicht mein Schicksal, Römer.»
Pilatus stand auf und versetzte Jeschua eine heftige Ohrfeige. Mit höhnischem Grinsen hielt Jeschua ihm demonstrativ die andere Wange hin. Aus der aufgeplatzten Lippe rann Blut in seinen Bart. Pilatus folgte der Aufforderung und versetzte ihm noch eine schallende Ohrfeige.
Jeschua spuckte Blut auf den Boden. «Du kannst mir körperlichen Schmerz zufügen, Römer, aber du kannst nicht das verletzen, was ich in mir trage.»
Sabinus war unwillkürlich fasziniert von der Willensstärke des Mannes. Er spürte, dass dieser Wille unmöglich zu brechen war.
«Es reicht mir», wütete Pilatus. «Quästor, lasst ihn unverzüglich zusammen mit den zwei anderen Gefangenen kreuzigen.»
«Welches Verbrechens ist er für schuldig befunden, Herr?»
«Ich weiß es nicht – irgendeines. Aufwiegelei, Rebellion oder von mir aus einfach, dass ich ihn nicht leiden kann. Was immer Euch beliebt. Jetzt schafft ihn fort und sorgt dafür, dass er tot und begraben ist, ehe bei Sonnenuntergang der Schabbath beginnt, damit wir nicht gegen das jüdische Gesetz verstoßen. Er hat schon lebend genug Ärger gemacht, ich will nicht, dass er im Tod noch mehr verursacht.»
Der Himmel hatte sich grau verfärbt. Erste Regentropfen fielen und vermischten sich mit dem Blut aus den Wunden der drei Gekreuzigten. Es war die neunte Stunde des Tages. Sabinus und Longinus gingen den Hügel von Golgotha wieder hinunter. Von fern ertönte Donnergrollen.
Sabinus blickte sich nach Jeschua um, der am Kreuz hing. Sein Kopf war auf die Brust gesunken, und Blut lief ihm aus einer Wunde in der Seite, die Longinus ihm mit dem Speer beigebracht hatte, um sein Leiden schneller zu beenden, ehe der Schabbath begann. Sechs Stunden zuvor war er mit Peitschenhieben den Hügel hinaufgetrieben worden, wobei er sein Kreuz hatte mitschleifen müssen. Ein Mann aus der Menge hatte ihm geholfen. Dann hatte Jeschua schweigend erduldet, dass die Nägel durch seine Handgelenke getrieben wurden. Er schien kaum wahrzunehmen, wie auch seine Füße an das Holz geschlagen wurden. Während die Kreuze aufgerichtet wurden, steigerte das heftige Rucken die Schreie der zwei anderen Gekreuzigten ins Unmenschliche, doch seinen Lippen entwich nur ein leises Stöhnen. Als Sabinus ihn jetzt anschaute, wirkte er friedlich.
Sabinus ging durch die Kette der Soldaten, die die kleine Gruppe Trauernder von den Gekreuzigten fernhielt. Da bemerkte er Paulus, der bei ein paar Männern der Tempelwache stand und zu Jeschua hinaufblickte. Er trug einen Verband um den Kopf, durch den Blut von einer Wunde an seinem Ohr gesickert war.
«Was machst du hier?», fragte Sabinus.
Paulus schien in Gedanken versunken und nahm ihn zuerst gar nicht wahr, dann blinzelte er mehrmals, als ihm bewusst wurde, dass die Frage an ihn gerichtet war. «Ich bin gekommen, um mich zu vergewissern, dass er tot ist, seinen Leichnam fortzubringen und ihn anonym zu bestatten, damit das Grab nicht zur Pilgerstätte für seine häretischen Anhänger wird. Kajaphas hat es angeordnet.»
«Warum hattet ihr alle solche Angst vor ihm?», wollte Sabinus wissen.
Paulus starrte ihn an, als wäre er nicht recht bei Verstand. «Er hätte große Veränderungen bewirken können.»
Sabinus schüttelte verächtlich den Kopf und drängte sich an den Wachen vorbei. Da kamen zwei Männer und zwei Frauen auf ihn zu, von denen die jüngere hochschwanger war und ein Kind auf dem Arm trug.
Der ältere Mann, ein augenscheinlich wohlhabender Jude Anfang dreißig mit dichtem schwarzem Bart, verbeugte sich. «Quästor, wir möchten Jeschuas Leichnam mitnehmen, um ihn zu bestatten.»
«Die Tempelwache ist hier, um ihn abzuholen. Welchen Anspruch habt ihr auf seinen Leichnam?»
«Mein Name ist Joseph, ich bin ein Verwandter von Jeschua», erwiderte der Mann und legte der älteren der beiden Frauen einen Arm um die Schultern, «und diese Frau ist Mirjam, seine Mutter.»
Diese schaute Sabinus flehentlich an, Tränen liefen ihr über die Wangen. «Bitte überlasst ihn nicht denen, Quästor, gebt mir meinen Sohn, damit ich ihn heim nach Galiläa bringen und dort begraben kann.»
«Ich habe den Befehl, dass er vor Sonnenuntergang bestattet werden muss.»
«Ich habe eine Familiengruft hier ganz in der Nähe», sagte Joseph. «Wir werden den Leichnam vorerst dort hineinlegen und ihn dann am Tag nach dem Schabbath überführen.»
Mit boshaftem Lächeln drehte Sabinus sich zu Paulus um. «Diese Leute haben als Verwandte Anspruch auf den Leichnam.»
Paulus war sichtlich entrüstet. «Das könnt Ihr nicht tun, Kajaphas fordert seinen Leichnam.»
«Kajaphas ist ein Untertan Roms! Longinus, lasst diesen widerlichen kleinen Mann von hier fortbringen.»
Während der widerstrebende Paulus unter Protest davongeführt wurde, wandte Sabinus sich wieder Joseph zu. «Du darfst den Leichnam mitnehmen, Rom ist mit ihm fertig.» Er wandte sich zum Gehen.
Joseph neigte den Kopf. «Ich werde Euch Eure Güte nicht vergessen, Quästor.»
«Quästor», sagte der jüngere Mann und hielt Sabinus zurück. «Rom mag jetzt unser Herr sein, aber seid gewarnt, das Ende der Zeiten ist nah, und Jeschuas Lehren sind Teil davon. Ein neues Königreich wird erstehen, neue Männer mit neuen Ideen werden herrschen, und die alte Ordnung wird allmählich vergehen.»
Sabinus fühlte sich an Tiberius’ Astrologen Thrasyllos erinnert, der zwei Jahre zuvor den Beginn eines neuen Zeitalters vorausgesagt hatte. Er starrte den jungen Mann an und erkannte ihn wieder. Es war derselbe, der Jeschua am Morgen geholfen hatte, das Kreuz zu tragen. «Was macht dich da so sicher, Jude?»
«Ich komme aus der Kyrenaika, Römer, das war einst eine Provinz des Königreichs Ägypten. Dort erwarten sie die Wiedergeburt des Feuervogels. Sein fünfhundertjähriger Zyklus nähert sich dem Ende. Nächstes Jahr wird der Phönix in Ägypten zum letzten Mal wiedergeboren, und alles wird beginnen, sich zu wandeln, denn es geht auf das Ende der Tage zu.»
Teil I
I
«Hast du es?», fragte Vespasian, sobald Magnus die Laufplanke eines großen Handelsschiffes herunterkam, das gerade in den Hafen von Apollonia eingelaufen war.
«Nein, Herr, ich fürchte nicht», antwortete Magnus und schulterte sein Bündel. «Der Kaiser verweigert derzeit jegliche Genehmigungen, nach Ägypten zu reisen.»
«Warum?»
Magnus ergriff den dargebotenen Arm seines Freundes. «Laut Caligula geschieht es auf den Rat von Tiberius’ Astrologen Thrasyllos. Nicht einmal Antonia konnte ihn umstimmen.»
«Warum hast du dir dann überhaupt die Mühe gemacht herzukommen?»
«Ist das eine Art, einen Freund zu begrüßen, der Hunderte Meilen weit auf diesem verdammten Kahn gereist ist, und das zu einer Jahreszeit, zu der sich die meisten Seeleute miteinander im Bett vergnügen?»
«Tut mir leid, Magnus. Ich hatte darauf gezählt, dass Antonia mir die Genehmigung verschaffen würde. Seit Ataphanes’ Tod sind vier Jahre vergangen, und wir haben versprochen, sein Gold zu seiner Familie in Parthien zu bringen.»
«Na, dann kommt es auf ein paar Jahre mehr wohl auch nicht an, wie?»
«Darum geht es nicht. Ägypten ist die Nachbarprovinz, ich hätte auf meinem Heimweg im März einen kleinen Abstecher nach Alexandria machen können. Ich hätte den Alabarchen ausfindig gemacht, ihm Ataphanes’ Truhe übergeben, dafür gesorgt, dass das Geld zu seiner Familie in Ktesiphon gebracht wird, und wäre immer noch vor nächstem Mai wieder in Rom gewesen.»
«Nun müsst Ihr es eben irgendwann später erledigen.»
«Ja, aber von Rom aus ist es eine viel weitere Reise. Vielleicht habe ich nicht die Zeit dazu, ich muss mich um das Landgut kümmern. Außerdem beabsichtige ich, im übernächsten Jahr zum Ädil gewählt zu werden.»
«Dann solltet Ihr keine Versprechen geben, die Ihr nicht halten könnt.»
«Er hat meiner Familie viele Jahre lang treu gedient. Ich bin es ihm schuldig.»
«Dann seid nicht so knauserig mit Eurer Zeit.»
Vespasian knurrte und wandte sich ab, um zurück über den Kai zu gehen, zwischen Scharen von Hafenarbeitern hindurch, die die eben eingelaufene Handelsflotte entluden. Seine Senatorentoga wirkte einschüchternd genug, damit die Leute ihm auswichen, sodass er ohne Schwierigkeiten die hundert Schritt zu seiner wartenden Ein-Mann-Sänfte zurücklegen konnte.
Magnus folgte ihm auf dem Fuß und genoss es, welche Achtung die einheimische Bevölkerung seinem jungen Freund zollte. «Ich hätte nicht gedacht, dass Quästoren in den Provinzen so respektvoll behandelt werden», bemerkte er, als einer der vier Sänftenträger Vespasian unnötigerweise auf seinen Sitz half.
«Das liegt daran, dass die Statthalter so ungern herkommen, und das aus gutem Grund – es ist, als würde man in einem Backofen leben, nur dass es nicht so gut riecht. Sie halten sich im Allgemeinen die meiste Zeit in der Provinzhauptstadt auf, Gortyn drüben auf Kreta, und schicken ihre Quästoren hierher, damit sie die Kyrenaika in ihrem Namen verwalten.»
Magnus kicherte. «Ah, das fördert natürlich den Respekt der Leute, wenn Ihr die Macht über Leben und Tod habt.»
«Nicht ganz, als Quästor habe ich kein Imperium inne, keine eigene Machtbefugnis. Ich muss all meine Entscheidungen vom Statthalter absegnen lassen, und das dauert ewig», erklärte Vespasian düster. «Aber ich habe die Macht, Pferde zu beschaffen», fügte er dann grinsend hinzu, als ein dunkler junger Sklave ein gesatteltes Pferd zu Magnus führte.
Der nahm das Reittier dankbar in Empfang und lud sein Bündel auf, ehe er sich in den Sattel schwang. «Woher wusstet Ihr eigentlich, dass ich heute ankommen würde?»
«Gar nicht, aber ich hoffte es», erwiderte Vespasian. Seine Sänfte setzte sich in Bewegung, vorbei an einem Theater mit Blick auf das Meer. «Als die Flotte heute Morgen gesichtet wurde, beschloss ich, auf gut Glück herzukommen, da es wahrscheinlich die letzte Flotte aus Rom in dieser Saison war. Ohnehin ist es nicht so, als hätte ich viel Sinnvolleres zu tun.»
«Dann ist es hier wirklich so schlimm?» Magnus zog belustigt eine Augenbraue hoch, als der Sklave begann, Vespasian mit einem breiten Fächer aus geflochtenen Palmwedeln an einem langen Stiel Luft zuzufächeln.
«Es ist schrecklich: Die einheimischen Libu bringen ihre Zeit damit zu, die wohlhabenden griechischen Bauern auszurauben; die Griechen amüsieren sich damit, die jüdischen Kaufleute fälschlich des Betrugs oder Diebstahls zu bezichtigen; die Juden hören nicht auf, gegen gotteslästerliche Statuen oder irgendwelche angeblichen religiösen Frevel zu protestieren, bei denen Schweine eine Rolle spielen; und die durchreisenden römischen Kaufleute schließlich haben nichts anderes zu tun, als sich darüber zu beklagen, dass sie von den Juden, den Griechen und den Libu übers Ohr gehauen wurden, in dieser Reihenfolge. Und darüber hinaus leben alle in Angst vor Überfällen durch Sklavenjäger, entweder durch die Garamanten aus dem Süden oder die nomadischen Marmariden im Osten. Es brodelt hier nur so vor Hass zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Das Einzige, was sie mehr hassen als einander, sind wir. Das hindert einige Leute allerdings nicht daran, mich mit Geld zu überhäufen, damit ich in Gerichtsprozessen zu ihren Gunsten entscheide.»
«Ich hoffe doch, Ihr nehmt das Geld an?»
«Anfangs nicht, aber inzwischen schon. Ich weiß noch, wie entsetzt ich war, als mein Onkel mir erzählte, er habe während seiner Zeit als Statthalter von Aquitanien Bestechungsgelder angenommen, doch jetzt verstehe ich das System besser und habe begriffen, dass es von mir erwartet wird. Außerdem sind die meisten der reichen Einheimischen so unliebsame Zeitgenossen, dass es mir ein Vergnügen ist, von ihnen Geld zu nehmen.»
«Klingt ganz ähnlich wie das, was Sabinus über Judäa erzählt», bemerkte Magnus. Sie kamen jetzt auf eine von Menschen wimmelnde Agora zwischen halbverfallenen Tempeln, die den griechischen Göttern geweiht waren. Am Hang darüber ragten Profanbauten auf.
«Glaub mir, es ist schlimmer», erwiderte Vespasian, der sich an seine Gespräche mit seinem Bruder erinnerte, als dieser aus dem Osten zurückgekehrt war und erzählt hatte, was für ein ganz und gar unmögliches Unterfangen es sei, die Juden zu regieren. Sie beide hatten sich für zwei Tage in Rom getroffen, ehe Vespasian Ende März per Schiff nach Kreta aufgebrochen war. «Dort hatte er es nur mit den Juden zu tun; die konnte man mit der Hilfe ihrer Priester und durch kleine Zugeständnisse einigermaßen friedlich halten. Aber wenn man hier einer Gruppe Zugeständnisse machen würde, dann würden alle anderen auch welche fordern, bis man am Ende die ganze Provinz verschenken müsste und bei seiner Rückkehr nach Rom vor den Senat gezerrt würde oder Schlimmeres. Darum bekommt von mir überhaupt niemand etwas, außer wenn er mich gut dafür bezahlt. So können sich die anderen Parteien nicht beklagen, dass ich Günstlingswirtschaft betreibe, weil sie wissen, dass ich bestochen wurde. Erstaunlicherweise scheint das für alle in Ordnung zu sein.»
«Ich wette, Ihr wünscht, Ihr wärt wieder in Thrakien», bemerkte Magnus, während er anerkennend die Bemühungen des jungen Sklaven beobachtete, dem es gelang, seinem Herrn unentwegt Luft zuzufächeln, ohne dabei auf dem schadhaften Pflaster zu stolpern – die Stadt hatte schon bessere Zeiten erlebt.
«Wenigstens hatten wir da anständige Truppen, mit denen wir die Einheimischen einschüchtern konnten. Hier haben wir nichts als eine Kohorte unberittener einheimischer Auxiliartruppen, bestehend aus Männern, die zu dumm sind, um als Diebe zu überleben. Dann gibt es noch die Stadtmiliz, in der die Männer dienen, die selbst für die Auxiliartruppe zu dumm sind, und schließlich eine Ala einheimischer Kavallerie, die uns eigentlich vor den Nomaden schützen soll, aber das ist ein Witz, denn die meisten von denen haben Kamele.»
«Was sind Kamele?»
«Sie sehen aus wie große, braune Ziegen mit langem Hals und einem Buckel auf dem Rücken. Pferde hassen ihren Geruch.»
«Ah, solche habe ich mal im Circus gesehen. Sie haben das Publikum zum Lachen gebracht, aber besonders wehrhaft waren sie nicht.»
«Das brauchen sie auch nicht zu sein. Laut dem Kavalleriepräfekten Corvinus können sie den ganzen Tag durch die Wüste rennen. Unsere Kavallerie kommt kaum jemals auch nur in ihre Nähe.»
Ihr kleiner Trupp zog jetzt durch das Stadttor, das zu beiden Seiten von marmornen Löwen bewacht wurde. Sie begannen den sanften Anstieg zur Stadt Kyrene, die acht Meilen entfernt auf einem höher gelegenen Kalksteinplateau erbaut war. Vespasian versank in düsteres Schweigen und verlor sich in Gedanken über die Aussichtslosigkeit seines Postens in diesem Teil der vereinigten Provinz Kreta und Kyrenaika. Während der sieben Monate, die er jetzt hier war, hatte er nichts erreicht – hauptsächlich, weil es kaum Geld gab, mit dem er irgendetwas hätte erreichen können. Jahrhundertelang hatte Silphium die Kyrenaika reich gemacht, eine Pflanze mit dicken Wurzeln und langem, kräftigem Stängel, deren eingedickter Saft als aromatisches Gewürz sowie als Arznei gegen unterschiedliche Krankheiten verwendet wurde, darunter Halsschmerzen und Fieber. Das Fleisch von Tieren, die von der Pflanze gefressen hatten, erzielte besonders hohe Preise. Sie wuchs in der trockenen Küstenebene, während auf dem Plateau von Kyrene eher Obst und Gemüse gediehen. Doch seit einigen Jahren war rätselhafterweise die Ernte immer schlechter ausgefallen. Da die Pflanze nun knapp war, wurde sie nicht mehr als Viehfutter verwendet, sodass die Fleischproduktion zum Erliegen kam, und in den letzten Jahren hatte allen Bemühungen zum Trotz die Qualität mit jeder Ernte weiter nachgelassen.
Vespasian hatte versucht, die einheimischen Bauern dazu zu bewegen, etwas anderes anzubauen, doch auf dem kargen Boden und bei dem spärlichen Regen wuchs nicht viel, und außerdem glaubten die Bauern fest daran, das Silphium werde wieder gedeihen, wenn sie nur regelmäßig genügend Göttern opferten. Entsprechend versiegten auch die Steuereinnahmen, da diejenigen, die Geld besaßen, es heimlich horteten und nur wenig ausgaben, um Waren von denen zu kaufen, die ärmer waren. Da wenig Geld im Umlauf war, hatte sich das Getreide, das aus den fruchtbareren Nachbarprovinzen Ägypten und Africa eingeführt wurde, extrem verteuert, denn gierige Spekulanten beherrschten den Handel. Als Vespasian sie zur Rede stellen wollte, leugneten sie allesamt und behaupteten, aus Ägypten sei im vergangenen Jahr nun einmal weniger Getreide gekommen. Doch von Ernteausfällen in Ägypten war nichts bekannt. Das alles führte dazu, dass die Armen, ob Griechen, Juden oder Libu, am Hungertuch nagten und die Region somit dauernd von Unruhen bedroht war.
Ohne genügend Truppen, um einen Aufstand der fast eine halbe Million zählenden Bevölkerung der sieben größten Städte der Kyrenaika niederzuschlagen, und ohne die Befugnis, eigenständig Entscheidungen zu treffen, fühlte Vespasian sich machtlos und frustriert. Jetzt steigerte sich dieses Gefühl erst recht, da Kaiser Tiberius sich weigerte, ihm die Einreise in die kaiserliche Provinz Ägypten zu gestatten, eine Provinz, die so reich war, dass Senatoren sie nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Kaisers persönlich besuchen durften. Ein Verstoß gegen diesen Erlass stellte ein Kapitalverbrechen dar.
Vespasian schalt sich selbst dafür, dass er sich solchen selbstmitleidigen Gedanken hingab, und wandte sich wieder an seinen Gefährten, der neben ihm herritt. «Ist es Sabinus endlich gelungen, zum Ädil gewählt zu werden?»
«Ja, wenn auch nur knapp», erwiderte Magnus. «Aber wie Euer Bruder immer sagt, das genügt ja. Allerdings war er erleichtert, dass die Wahl zum Prätor für ihn erst nächstes Jahr ansteht – die Posten wurden sämtlich mit den Söhnen von Macros Kumpanen besetzt.»
«Dann haben wir also wieder einmal einen Prätorianerpräfekten, der sich in die Politik einmischt? Man hätte denken sollen, Macro hätte aus dem verfrühten Ableben seines Vorgängers etwas gelernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich damit bei Antonia besonders beliebt macht. Nach ihrer Überzeugung ist es das Vorrecht des Kaiserhauses, sich in die Politik einzumischen, und insbesondere ihr eigenes.»
Magnus deutete auf die Sänftenträger.
«Um die brauchst du dir keine Gedanken zu machen, sie verstehen kein Latein», beruhigte Vespasian ihn, «und der Junge ist taubstumm.»
«Gut. Also, seit Ihr im März aufgebrochen seid, sind ein paar seltsame Dinge geschehen. Antonia macht sich schon ernste Sorgen.»
«Ich dachte, sie redet nicht mit dir, außer, um dir Befehle zu erteilen.»
«Nein, das meiste erfahre ich von Eurem Onkel, Senator Pollo. Auch wenn ihr hin und wieder etwas rausrutscht – nachher, wenn Ihr versteht, was ich meine?»
«Du alter Bock!» Vespasian grinste, und es kam ihm vor, als wäre es das erste Mal seit seiner Ankunft in der Kyrenaika. Er amüsierte sich über die unwahrscheinliche und ungleiche sexuelle Beziehung zwischen seinem alten Freund und der ehrfurchtgebietendsten Frau in Rom, seiner Patronin Antonia, der Schwägerin des Kaisers Tiberius.
«Na ja, ich kann zu meiner Freude berichten, dass es in letzter Zeit nicht mehr so häufig vorkommt. Sie ist nicht mehr die Jüngste, wisst Ihr, da hängt so einiges. Wie auch immer, sie macht sich Sorgen über Caligulas Beziehung zu Macro, oder besser gesagt, über Caligulas neue Beziehung mit dessen Frau Ennia, die Macro selbst zu fördern scheint.»
Vespasian grinste wiederum und winkte ab. «Caligula hatte schon vor längerer Zeit ein Auge auf sie geworfen. Zweifellos wird er sie bald wieder leid. Er ist einfach unersättlich. Macro betrachtet die Angelegenheit eben nüchtern. Er weiß, wenn er jetzt Aufhebens davon machen würde, dann fände er sich in einer äußerst prekären Lage wieder, wenn Caligula Kaiser wird.»
«Mag sein, aber Euer Onkel denkt, hinter Macros Verhalten steckt mehr als bloße Höflichkeit. Er vermutet, dass Macro darauf bedacht ist, sich Caligulas Gunst zu sichern, weil er etwas von ihm will, falls Caligula denn Kaiser wird.»
«Als Prätorianerpräfekt ist er nach den Angehörigen des Kaiserhauses der mächtigste Mann in Rom – nach was kann er noch streben, wenn nicht gleich danach, selbst sein Erbe zu werden? Man kann Caligula so manches nachsagen, aber dumm ist er nicht.»
«Eben das bereitet Antonia Sorge. Sie versteht nicht, worauf er aus ist, und sie kann es absolut nicht leiden, wenn sie Dinge nicht versteht und somit nicht steuern kann.»
«Das kann ich mir denken, aber ich finde nichts Seltsames daran.»
«Nein, das Seltsame ist, um wessen Gunst Macro sich außerdem noch bemüht», sagte Magnus mit Verschwörermiene. «Um die von Herodes Agrippa. Er war ein Freund von Antonia und hat sich öfter von ihr Geld geliehen, es jedoch nie zurückgezahlt. Er fand, als Günstling von Tiberius und guter Freund seines Sohnes Drusus – die beiden wurden zusammen erzogen – hätte er einen Anspruch auf Unterhalt. Wie dem auch sei, als Drusus starb, floh er aus Rom und vor seinen Schulden und kehrte in seine Heimat Idumäa zurück.»
«Wo ist das?»
«Keine Ahnung, aber da er Jude ist, wahrscheinlich nicht weit von Judäa. Egal, von dort musste er auch bald wieder verschwinden, wiederum wegen Schulden, und dann hat er seine Zeit damit zugebracht, sämtliche Kleinkönige und Tetrarchen im Osten zu vergrätzen, indem er eine Machtposition oder ein Darlehen forderte, nur weil er der Enkel Herodes des Großen ist. Vor ein paar Monaten ist er nach Rom zurückgekehrt und hat es erreicht, dass Tiberius ihn wieder in seine Gunst aufnahm. Laut Eurem Onkel hat er es eingefädelt, dass nächstes Jahr eine Gesandtschaft aufständischer parthischer Edelmänner nach Rom kommt. Sie wollen, dass Tiberius ihnen hilft, ihren König abzusetzen. Zum Lohn hat Tiberius Herodes Agrippa zum Erzieher seines Enkels Tiberius Gemellus ernannt.»
«Und was ist nun so seltsam daran, dass Macro sich mit ihm anfreundet?»
«Die Tatsache, dass Macro einerseits versucht, sich bei Caligula beliebt zu machen, und sich andererseits an Herodes heranmacht, den Mann, der den größten Einfluss auf einen weiteren möglichen Erben hat, Gemellus.»
«Er setzt also auf beide Gespanne?»
Magnus grinste und schüttelte den Kopf. «Nein, Herr, anscheinend setzt er sogar auf alle drei. Herodes Agrippa hat einen weiteren Kontakt, einen sehr guten Freund aus Kindertagen, der zusammen mit ihm und Drusus erzogen wurde: den dritten möglichen Erben aus der kaiserlichen Familie, Antonias Sohn Claudius.»
Die Sonne neigte sich bereits gen Westen, und das Meer funkelte bronzefarben, als Vespasian und Magnus durch das Haupttor von Kyrene in die Unterstadt kamen. Die Sänftenträger mussten sich ihren Weg zwischen Dutzenden Bettlern hindurchbahnen – Flüchtlinge von den bankrottgegangenen Silphium-Plantagen, die auf milde Gaben von neueingetroffenen Kaufleuten hofften, ehe diese es leid wurden, von den unzähligen Armen bedrängt zu werden, die jetzt auf Almosen angewiesen waren.
«Allmählich hasse ich diese Stadt wirklich», bemerkte Vespasian, während er ihm bittend entgegengestreckte Hände abwehrte. «Sie führt mir vor Augen, dass meine Familie einen geringen Stand im Senat hat – hierher werden nur die unbedeutendsten Quästoren entsandt.»
«Ihr habt doch das Los gezogen.»
«Ja, aber nur die unbedeutendsten Quästoren bekommen ihre Posten zugelost. Die aus den hochgestellten Familien erhalten die begehrten Ämter in Rom. Sabinus hatte letztes Jahr Glück, Syrien zu ziehen.»
Magnus verjagte ein allzu beharrliches altes Weib mit einem Fußtritt. «Ich habe einen Brief von Caenis in meinem Bündel, hoffentlich heitert der Euch auf. Ihr scheint es wahrhaft nötig zu haben.»
«Ein bisschen wird es sicher helfen», rief Vespasian über den Schwall von Beschimpfungen hinweg, mit denen das zu Boden gestürzte Weib Magnus bedachte, «aber wahre Heiterkeit werde ich wohl erst wieder empfinden, wenn im März die Schiffe wieder fahren und mein Nachfolger eintrifft. Ich muss zurück nach Rom, ich brauche das Gefühl, voranzukommen, statt in diesem Arschloch des Imperiums zu verschimmeln.»
«Nun, bis dahin haben wir noch vier Monate totzuschlagen. Ich leiste Euch Gesellschaft. Ehrlich gesagt, als es Antonia nicht gelang, die Genehmigung für Eure Reise nach Ägypten zu erwirken, habe ich mich freiwillig bereit erklärt, trotzdem herzukommen, um die schlechte Nachricht persönlich zu überbringen. Zurzeit ist das Pflaster in Rom für mich etwas zu heiß. Euer Onkel wird die Angelegenheit in Ordnung bringen, während ich fort bin.»
«Was hast du angestellt?»
«Nichts, nur ein paar Geschäfte gemacht und mich um die Interessen meiner Bruderschaft der Straße gekümmert. Ich habe Servius, meinem besten Mann, das Kommando übertragen, er wird sich um alles kümmern.»
Vespasian hütete sich, zu viele Fragen zu stellen, wenn es um Magnus’ Leben in der Unterwelt ging, als Anführer der Bruderschaft vom südlichen Quirinal. Bruderschaften wie diese lebten hauptsächlich von Schutzgelderpressung. «Du kannst gern hierbleiben, aber es gibt nicht viel zu tun.»
«Wie ist es um die Jagd bestellt?»
«In der Nähe der Stadt gibt es wenige Möglichkeiten, aber ich habe gehört, ein paar Tagesritte weiter südlich im Vorgebirge soll es Löwen geben.»
«In ein paar Tagen ist Euer Geburtstag. Wir könnten zur Feier des Tages einen Löwen erlegen», schlug Magnus vor.
Vespasian sah seinen Freund bedauernd an. «Geh du nur feiern, ich fürchte, ich kann nicht mitkommen. Ich darf die Stadt außer zu offiziellen Amtsgeschäften nicht verlassen.»
Magnus schüttelte den Kopf. «Mir scheint, das werden ein paar sehr langweilige Monate.»
«Willkommen in meiner Welt.»
«Wie sind die Huren?»
«Hübsch alt, habe ich mir sagen lassen, genau, wie du sie magst, allerdings ziemlich verschwitzt.»
«Ich bitte Euch, Herr, macht Euch nicht über mich lustig, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich tue nur, was die werte Dame mir befiehlt. Und wie ich schon sagte, in letzter Zeit kommt es nicht mehr oft vor.»
Vespasian grinste wieder. «Ich bin sicher, mein Buchhalter Quintillius kann etwas Passendes beschaffen, um dich zu trösten.»
Die Straße mündete in die belebte große Agora der Unterstadt.
«Was ist da los?» Magnus zeigte auf eine Menge überwiegend jüdischer Männer, die einen großen, breitschultrigen jungen Mann verhöhnten, welcher von einem Sockel aus zu ihnen zu sprechen versuchte. Neben ihm stand eine junge Frau mit einem einjährigen Mädchen auf dem Arm; ein dreijähriger Junge hockte zu ihren Füßen und schaute die Leute verängstigt an.
«Wahrscheinlich wieder so ein jüdischer Bekehrer», erwiderte Vespasian seufzend. «Neuerdings scheint es einen großen Zustrom von denen zu geben. Sie predigen irgendeinen neuen jüdischen Kult. Ich habe mir sagen lassen, den Ratsältesten gefällt er nicht, aber solange sie keinen Aufruhr verursachen, lasse ich sie in Ruhe. Wenn ich hier eines gelernt habe, dann ist es, dass man sich aus den Angelegenheiten der Juden besser heraushält – die sind unmöglich zu durchschauen.»
Da sie nun nicht mehr von Bettlern aufgehalten wurden, kamen die Sänftenträger leichter voran. Sie folgten der breiten Hauptstraße der Unterstadt, die von alten und heruntergekommenen, aber noch immer eindrucksvollen zweigeschossigen Häusern der reicheren Kaufleute gesäumt war. Bald begannen sie den kurzen Anstieg in die Oberstadt.
Durch die Aussicht auf Caenis’ Brief ein wenig aufgemuntert, richtete Vespasian die Gedanken auf seine Liebste, die er seit mehr als sieben Monaten nicht gesehen hatte. Sie war noch immer eine Sklavin im Hause der Dame Antonia. In drei Jahren würde sie dreißig sein, und er lebte in der Hoffnung, dass sie dann freigelassen würde, denn das war das gesetzliche Mindestalter für die Manumissio von Sklaven. Zwar durfte laut Gesetz ein Mann von Senatorenrang keine Freigelassene ehelichen, doch er hoffte, sie würde seine Mätresse werden, sobald sie über sich selbst verfügen konnte. Er wollte ihr ein kleines Haus in Rom einrichten. Immerhin häufte er rasch Geld an – Bestechungen und Geschenke von Bewohnern der Provinz, die sich die Gunst des höchstrangigen römischen Beamten in der Region sichern wollten. Nun, da er seine Skrupel beiseitegeschoben hatte und die Bestechungen annahm, wollte er bis zu seiner Rückkehr nach Rom genug beisammenhaben, um nicht nur ein Haus für Caenis kaufen zu können, sondern auch eines für sich selbst und die Ehefrau, die er sich bald nehmen musste, um seine Pflicht gegenüber seiner Familie zu erfüllen. Wie wichtig es war, einen Erben und Stammhalter zu zeugen, hatten seine Eltern ihm in einer Reihe von Briefen eindringlich klargemacht. Sie lebten jetzt in Aventicum in der Germania Superior, wo sein Vater ein Bankgeschäft gekauft hatte.
Bald erreichten Vespasian und Magnus die Straße in der Oberstadt, die nach König Battos benannt war und an deren östlichem Ende sich das römische Forum befand. An dessen hinterem Rand stand die Residenz des Statthalters – ein viel moderneres Gebäude, das die Römer vor hundert Jahren zu diesem Zweck gebaut hatten, nachdem die Kyrenaika römische Provinz geworden war.
Vespasians Sänfte wurde vor der Residenz abgestellt. Er wehrte die Versuche seiner Träger ab, ihm zu helfen, stieg herunter, richtete seine Toga und ging die Stufen hinauf.
Magnus folgte ihm. Als die vier Soldaten der Auxiliartruppe, die unter dem Vorbau Wache standen, ungeschickt Haltung annahmen, verzog er das Gesicht. «Ich sehe, was Ihr meint», kommentierte er, während er und sein Freund durch die Eingangstür in ein großes Atrium traten, an dessen einer Seite Schreiber an Pulten arbeiteten. «Die sind ein verdammt unorganisierter Haufen; nicht mal ihre Mütter könnten stolz auf sie sein.»
«Und das sind noch einige der Besten aus der ersten Centurie», erwiderte Vespasian. «Manche Centurien sind nicht mal in der Lage, ordentlich in Reih und Glied zu stehen. Die Centurionen haben einen immensen Verbrauch an Rebenstäben.»
Ehe Magnus seine Meinung dazu äußern konnte, wie aussichtsreich es war, unfähigen Soldaten Disziplin einprügeln zu wollen, kam ein gepflegter Buchhalter des Quästors in einer Toga auf sie zu.
«Was gibt es, Quintillius?», erkundigte sich Vespasian.
«Da ist eine Frau, die Euch sprechen möchte, sie wartet seit drei Stunden. Ich wollte mit ihr einen Termin vereinbaren, damit sie zu einem günstigeren Zeitpunkt wiederkommt, aber sie ließ sich nicht vertrösten. Sie sagte, als römische Bürgerin habe sie ein Recht darauf, Euch zu sprechen, sobald Ihr zurückkehrt. Und sie sagte auch, es sei Eure Pflicht, sie zu empfangen, da ihr Vater der Schreiber Eures Onkels gewesen sei, als dieser Quästor in Africa war.»
Vespasian seufzte. «Also schön, lasst sie in mein Amtszimmer führen. Wie heißt sie?»
«Das ist ja das Seltsame, Quästor: Sie behauptet, eine Verwandte von Euch zu sein, ihr Name ist Flavia Domitilla.»
«Und nun sind schon anderthalb Monate vergangen, seit er nach Südosten aufgebrochen ist, und er hat mir doch versprochen, nicht länger als vierzig Tage fortzubleiben.» Flavia Domitilla schluchzte in ein seidenes Taschentuch, dann tupfte sie sich behutsam die Augen, um den dicken schwarzen Lidstrich nicht zu verwischen.
Ob sie wirklich so verzweifelt war oder ob es sich um weibliche List handelte, konnte Vespasian nicht erkennen, und es kümmerte ihn auch nicht sonderlich. Er war wie gebannt von dieser eleganten jungen Frau und ihrer makellosen Erscheinung. Ihr Körper war herrlich anzusehen, groß, mit geschwungenen Hüften, einer schlanken Taille und festen, vollen Brüsten. Sie hatte kluge, funkelnde dunkle Augen, eine schmale Nase, volle Lippen und dichtes schwarzes Haar, das sie hoch aufgesteckt trug, und Flechten fielen ihr zu beiden Seiten des hübschen Gesichts bis auf die Schultern. Abgesehen von ein paar Sklavenmädchen hatte Vespasian keine richtige Frau mehr gehabt, seit er sich von Caenis verabschiedet hatte, und Flavia Domitilla war zweifellos eine richtige Frau. Ihre Kleidung und der Schmuck zeugten von Wohlstand, und ihre Frisur und die Schminke zeigten, dass sie Zeit hatte, diesen Wohlstand zu genießen. Sie war außerordentlich. Während sie leise in ihr Taschentuch wimmerte, starrte Vespasian sie an, sog ihren weiblichen Duft ein, der durch die Hitze verstärkt wurde und in den sich ein Hauch von Parfüm mischte. Er fühlte, wie das Blut in seinen Lenden pulsierte, und musste die Falten seiner Toga zurechtrücken, um nicht in Verlegenheit zu geraten. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft in der Provinz war er froh darum, dieses Kleidungsstück zu tragen. Um seine Gedanken von fleischlichen Gelüsten abzulenken, zwang er sich, den Blick zu heben und ihr Gesicht zu betrachten. Abgesehen von der rundlichen Gesichtsform konnte er nichts erkennen, das auf eine nähere Verwandtschaft mit ihm selbst hingedeutet hätte. Dennoch war ihr Name unleugbar die weibliche Form von Flavius.
Plötzlich wurde ihm bewusst, dass er zu sehr in ihren Anblick versunken war, um überhaupt wahrzunehmen, was sie gesagt hatte. Er räusperte sich. «Wie war noch gleich sein Name?»
Flavia sah von ihrem Taschentuch auf. «Das sagte ich doch bereits: Statilius Capella.»
«Ach ja, natürlich. Und er ist Euer Ehemann?»
«Nein, ich bin seine Mätresse, habt Ihr mir denn gar nicht zugehört?» Flavia runzelte die Stirn. «Seine Frau hält sich in Sabrata in der Provinz Africa auf. Er nimmt sie nie auf Geschäftsreisen mit, er findet, dass meine Reize weitaus besser auf seine Klienten wirken.»
Das glaubte Vespasian ohne weiteres. Ganz benommen von der Begierde, die ihr sinnlicher Duft und ihr üppiger Körper entfacht hatten, musste er sich zwingen, die Armlehnen seines Stuhls zu umklammern und sich auf ihre Worte zu konzentrieren. «Und in welchen Geschäften war er noch gleich unterwegs?»
Flavia schaute ihn ungeduldig an. «Ihr habt die ganze Zeit nur auf meine Brüste gestarrt, nicht wahr? Denn offenkundig habt Ihr kein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe.»
Vespasian öffnete den Mund, um den Vorwurf zu bestreiten – er hatte durchaus nicht nur auf ihre Brüste gestarrt –, besann sich jedoch eines Besseren. «Es tut mir leid, wenn Ihr den Eindruck habt, ich sei unaufmerksam. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann», fuhr er auf, und unwillkürlich blieben seine Augen erneut für einen Moment an der prächtigen Rundung des genannten Körperteils hängen.
«Nicht zu beschäftigt, um dazusitzen und den Körper einer Frau anzustarren, statt anzuhören, was sie zu sagen hat. Er handelt mit wilden Tieren, die er an die Circusse von Sabrata und Leptis Magna verkauft. Er hat einen Abstecher in die Wüste gemacht, weil er versuchen wollte, ein paar Kamele zu beschaffen. Diese Tiere sind zwar nicht besonders wehrhaft, aber sie sehen komisch aus und reizen das Publikum zum Lachen. In der Provinz Africa haben wir keine, aber hier gibt es einen Stamm, der sie hält.»
«Die Marmariden.»
«Ja, ich glaube, so heißen sie, Marmariden», bestätigte Flavia, erfreut, dass er ihr endlich richtig zuhörte.
«Euer, äh, Mann ist also losgezogen, um Kamele von einem Stamm einzukaufen, der die Vorherrschaft Roms in seinem Gebiet nicht anerkennt, weil wir die Stammesangehörigen nie in der Schlacht schlagen konnten, da sie Nomaden und fast unmöglich aufzuspüren sind?»
«Ja, und er hätte vor fünf Tagen zurück sein sollen», fügte Flavia mit zitternder Unterlippe hinzu.
Vespasian biss auf die seine und versuchte, sich nicht vorzustellen, was er mit der ihren tun könnte. «Ihr solltet hoffen, dass er nicht mit ihnen in Kontakt gekommen ist.»
Flavia sah ihn erschrocken an. «Wie meint Ihr das?»
«Sie sind berüchtigte Sklavenjäger. Sie machen Gefangene, wo sie nur können, und verkaufen sie Hunderte Meilen weiter im Süden an die Garamanten. Diese brauchen offenbar Unmengen an Arbeitskräften für die umfangreichen Bewässerungsanlagen, die ihnen dort die Landwirtschaft ermöglichen.»