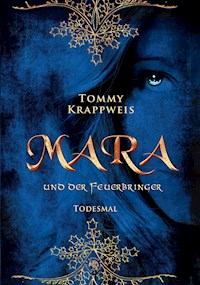8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Wilde Westen mitten in Bayern. Geht nicht? Von wegen! Jahrelang lockte No Name City eingefleischte Western-Fans in die tiefste Provinz. »Häuptling« Heinz J. Bründl und Stuntman Tommy Krappweis erzählen von ihrem wilden Leben in der Westernstadt: von unzähligen Raufereien und Schießereien, unfreiwilligen Explosionen zu stark gestopfter Schrotflinten bis hin zu den heimlichen und unheimlichen Liebschaften des Totengräbers. Von einem Goldsucher mit Realitätsverlust, der in der Münchner S-Bahn dem Sicherheitsdienst Feuerschutz gab. Und von zwei unverbesserlichen Cowboys, die entgegen aller Konventionen ihren Traum verwirklicht und zur Not auch mit der Flinte verteidigt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Tommy Krappweis / Heinz J. Bründl
Vier Fäuste für ein blaues Auge
Wie der Wilde Westen nach Deutschland kam
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Wilde Westen mitten in Bayern. Geht nicht? Von wegen! Jahrelang lockte No Name City eingefleischte Western-Fans in die tiefste Provinz. »Häuptling« Heinz J. Bründl und Stuntman Tommy Krappweis erzählen von ihrem wilden Leben in der Westernstadt: von unzähligen Raufereien und Schießereien, unfreiwilligen Explosionen zu stark gestopfter Schrotflinten bis hin zu den heimlichen und unheimlichen Liebschaften des Totengräbers. Von einem Goldsucher mit Realitätsverlust, der in der Münchner S-Bahn dem Sicherheitsdienst Feuerschutz gab. Und von zwei unverbesserlichen Cowboys, die entgegen aller Konventionen ihren Traum verwirklicht und zur Not auch mit der Flinte verteidigt haben.
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel 1: »Dein depperter Hut …« oder: Wie ich zum Cowboy wurde
Kapitel 2: 60 Steaks pro Woche oder: Vom Boxen zum Büffel
Kapitel 3: Das erste Council oder: Wildwest am Chiemsee
Kapitel 4: Zähne pflastern seinen Weg oder: Tantiemen vom Zahnarzt
Kapitel 5: Ein Indianer kennt keinen Schmerz oder: Ich bin ja auch ein Cowboy
Kapitel 6: Die Zeugenvernehmung oder: Der Österreicher
Kapitel 7: Samantha oder: Die Büffelballade
Kapitel 8: Harte Schule, weiche Rippen oder: Schmerzwochen in No Name City
Kapitel 9: Spezielles Personal oder: Ganz natürliche Profis
Kapitel 10: Parkplatz-Django oder: I hob a System
Kapitel 11: Fahrgeschäfte oder: Wenn die Grenzen verschwimmen
Kapitel 12: Der innere Film oder: Eine Stadt voller Djangos
Kapitel 13: Die fast tödliche Schwingtür oder: Beiß auf dieses Holz …
Kapitel 14: Ein Haufen Originale oder: 420 Pfund Authentizität
Kapitel 15: »Gullugullugullu« oder: Ein Jedi im Schrank
Kapitel 16: Der Vollprofi oder: WuiWui forever
Kapitel 17: Messerwerfer Heinz oder: Das Naturtalent
Kapitel 18: Eine Faust geht ihren Weg oder: Freikarten fürs Gehirnkino
Kapitel 19: Kannst du auch reiten, Cowboy? Oder: Klischee & Klischee gesellt sich gern
Kapitel 20: Initiativ-Verhaftung oder: Wo bleiben die Handschellen, Baby!
Kapitel 21: Das Geburtstagsgeschenk oder: Gefährliche Inhaltsstoffe in Torten
Kapitel 22: Die Schrotflinte oder: »Poing, Poing«
Kapitel 23: Crocotex Dundee oder: A Katz! A Katz!
Kapitel 24: Harro hat den Schlüssel oder: Der rätselhafte Container
Kapitel 25: Der Volker oder: Sample, Gong und Bottich
Kapitel 26: Der Xylamon oder: Was alles so versickert
Kapitel 27: Socken im Ofen oder: Der perfekte Undertaker
Kapitel 28: Duell am Samstag oder: Wie deppert kann man sein
Kapitel 29: Hopfen und Malz oder: Gott versalz
Kapitel 30: Mad Dog oder: Der erste Eindruck zählt
Kapitel 31: Das kleine Bestiarium oder: Kleinvieh macht auch Stink
Kapitel 32: Mississippi Jim oder: Kein Whiskey für den Pianospieler
Kapitel 33: Wozu hat man Freunde oder: Das Liebesleben des Cyrus T.
Kapitel 34: Hallo-wie-heißt-du-schöner- Name oder: Der Nici
Kapitel 35: Der Krenzola oder: Geier, Gänse und Konsorten
Kapitel 36: Jean-Luc oder: ’at disch dör Chili geschmeeeck’?
Kapitel 37: Der Wamblee oder: Ein Indianer im KVR
Kapitel 38: Der Fotograf oder: Method Acting Deluxe
Kapitel 39: Eine Westernstadt? Oder: Da ist die Tür
Kapitel 40: Die Band, die Band! Oder: Earl and Pam eat Toejam
Kapitel 41: Ein Erdhaus für den Nici oder: Mehr Balken bitte
Kapitel 42: Ingekaaf oder: Missemagugge
Kapitel 43: Aslan Dschinotrii oder: Der singende Löwe
Kapitel 44: Der Das Hemd Teil 1 oder: Haben Sie meinen Kanarienvogel gesehen?
Kapitel 45: Der Das Hemd Teil 2 oder: »Heeeiiiiinz!«
Kapitel 46: Indianer hüben und drüben oder: Steine oder Sockel
Kapitel 47: Anfang und Ende oder: Ende und Anfang
Kapitel 48: Hey, Red Grizzly growl oder: Ein Westernzirkus in Deutschland
Bonusmaterial
Bildteil
Prolog
Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen ersten Besuch in No Name City – und auch an diesen ungewöhnlichen Claim: »Die authentischste Westernstadt Europas« …
Mal abgesehen davon, dass es gar nicht so einfach ist, das Wort »authentischste« im Verbund mit dem direkt folgenden Wort »Westernstadt« auszusprechen, lässt einen die Behauptung zunächst ein bisschen grübeln. Schließlich gibt es in ganz Europa historisch und kulturell bedingt keine einzige wirklich echte Westernstadt. Somit muss auch die allerauthentischste Westernstadt in Europa zwingend künstlich geschaffen sein. Allerdings kann ja auch etwas, das künstlich ist, trotzdem das authentischste Exemplar aller anderen künstlichen Exemplare sein. Und hier setzt entweder der Kopfschmerz ein, oder man lässt es einfach auf sich beruhen.
Meine Eltern störte all das nicht. Warum auch? Denn schließlich gab es mit No Name City in Poing bei München einen Ausflugsort, den tatsächlich beide ihrer Kinder ganz wahnsinnig toll fanden. Wenn Sie mein Buch »Das Vorzelt zur Hölle« gelesen haben, dann wissen Sie, dass ich als Kind kaum etwas toller fand, als zu Hause Lego zu bauen oder Bücher zu lesen, und in gewisser Weise trifft das auch heute noch zu. Doch mit einem Besuch in einer Westernstadt könnte man mich tatsächlich immer noch recht einfach motivieren, die Wohnung zu verlassen.
Es gibt sogar zwei Fotos von diesem ersten Besuch in No Name City anlässlich des Geburtstags meines kleinen Bruders Nico. Auf dem ersten Foto stehen wir einander gegenüber wie bei einem Duell. Auf dem zweiten Foto schießt mich mein Bruder mit seiner Spielzeugpistole über den Haufen. Die imposanten Qualmwolken auf dem Foto stammen nicht aus dem armseligen Zündkapselring, der nur in unseren Köpfen BAMM machte und in Wirklichkeit so etwas Ähnliches wie petsch, petsch, petsch. In den Achtzigern gab es aber noch keine App für solche Fotoeffekte und auch noch keine Digitalfotografie. Die Veteranen unter den Lesern erinnern sich vielleicht noch an diese Zeit: Fotos wurden meistens weggeschickt und maschinell entwickelt, und man wusste nie so genau, was man in ein paar Tagen zurückbekommen würde. Die einzige Alternative war, dass man die Fotos selbst von Hand entwickelte. Glücklicherweise hatte ich im Fotolabor der Fachoberschule für Gestaltung die Möglichkeit dazu. Also legte ich beim Entwickeln des Fotos ein paar Wattefetzen auf das Fotopapier, was dafür sorgte, dass diese Stelle mehr oder weniger weiß blieb und somit einigermaßen qualmige Formen entstanden. Sollte es mir zu denken geben, dass das erklärte Lieblingsfoto meines jüngeren Bruders ein Bild ist, auf dem er seinen großen Bruder über den Haufen schießt? Ich hoffe mal auf ein »Nein«…
Ansonsten weiß ich noch sehr genau, wie lustig wir es fanden, dass hier pro Tag zweimal die Bank überfallen wurde. Immer pünktlich um 11.30 Uhr und um 15.30 Uhr. Und falls der Sheriff mal vergessen hatte, seinen Wecker zu stellen, um das Ersparte seiner Schutzbefohlenen vermittels doppelläufiger Schrotflinte zu verteidigen, konnte er sich darauf verlassen, dass ihn eine sonore Stimme fünfzehn Minuten vorher via Lautsprecher daran erinnerte: »Um 11.30 Uhr wird in No Name City die Bank überfallen. Die Wildwest Stuntshow mit Banküberfall um 11.30 Uhr auf der Mainstreet.« Praktisch.
Somit standen wir also überpünktlich hinter der sekundenschnell errichteten Absperrung und warteten gespannt. Musik von Ennio Morricone ertönte, und die Spannung stieg. Mein kleiner Bruder fingerte nervös an seinem Colt herum, jederzeit bereit, sich mit petsch, petsch, petsch in die Schießerei zu stürzen. Ich stand daneben, mit dem betont skeptischen Blick eines sechzehnjährigen Möchtegern-Showmans, der kaum etwas gut finden kann, bei dem er nicht selbst möglichst ursächlich beteiligt ist. Einerseits war ich total fasziniert von den so unglaublich echt wirkenden Gebäuden und der fast schon schmerzhaften Detailverliebtheit in der Ausstattung. Nicht ohne Grund hatte No Name City immer wieder als Filmset für Werbespots und dergleichen hergehalten. Andererseits wollte ich so sehr Teil dieser ganzen Sache sein, dass ich kaum klar denken und erst recht keine Show passiv genießen konnte.
Allerdings machte ich mir da keine Hoffnungen. Denn auch die Mitwirkenden sahen aus, als hätte man sie extra designt. Da konnte ich beim besten Willen nicht mithalten. Nie zuvor hatte ich eine solche Ansammlung ungewöhnlicher Gesichter und Gestalten auf so kleinem Raum gesehen. Der hakennasige Halbindianer, der Sheriff mit dem mächtigen Schnauzbart, der Totengräber mit einem Gesicht, als hätte ihn während der Zahn-OP ein Lastwagen überfahren. Alles, was man in den Lucky-Luke-Comics gezeichnet vor sich sah, lief hier mehr oder weniger lebendig herum und verkörperte all diese Klischees so perfekt, dass zu keiner Sekunde der Verdacht kam, dies alles wäre nur gespielt. Was vermutlich daran lag, dass hier eben niemand spielte. Zumindest nicht so, wie ich das aus dem Schultheater kannte. Diese Leute verkörperten das, was sie hier darstellten, so sehr, dass sie vermutlich außerhalb von No Name City mehr spielen mussten, um halbwegs den Eindruck normaler Staatsbürger zu erwecken. Hier auf dem Gelände dieses ungewöhnlichen Freizeitparks waren diese Menschen ganz bei sich, authentisch, wie einem überdrehten Spaghetti-Western entsprungen und trotzdem einfach »echt«.
Dass ich nur zwei Jahre später einer von ihnen sein sollte, ahnte ich damals nicht.
---
Dieses Buch entstand zunächst in Form eines mehrtägigen Gesprächs zwischen dem Initiator, Erbauer und Ausstatter von No Name City namens Heinz Bründl und mir. Gemeinsam tauschten wir Erinnerungen aus, Heinz erzählte mir, wie alles begann, lange bevor ich zu der Truppe stieß, und wir versuchten zusammen, ein paar der verrücktesten Geschichten zu rekonstruieren. Daraus wurde dann eine etwa tausendseitige Abschrift angefertigt, die ich auf den nun folgenden deutlich weniger Seiten versucht habe, so zusammenzufassen, dass man es flüssig lesen kann.
Dieses Buch ist ein etwas ungewöhnliches Experiment, von dem ich hoffe, dass Sie es genauso genießen werden wie wir. Manche Geschichten erzähle ich, und andere erzählt der Heinz. Die Kommentare des jeweils anderen habe ich fettgedruckt eingefügt. Manchmal waren wir auch beide vonnöten, um die Anekdoten zusammenzuklauben.
Viel Spaß mit den Erinnerungen an eine Zeit, die mir heute wie ein seltsamer, staubiger Traum vorkommt.
Tommy Krappweis
November 2012
Kapitel 1: »Dein depperter Hut …« oder: Wie ich zum Cowboy wurde
von Tommy Krappweis
Ich war etwa achtzehn oder neunzehn Jahre alt, als ich meine erste eigene Wohnung bezog. Die Miete war kein Problem, denn ich hatte mir ausgerechnet, dass ich nur einmal pro Woche in der Münchner Fußgängerzone Straßenmusik machen musste und zusätzlich an jedem Wochenende einen Auftritt mit meiner Band brauchte, um locker alle laufenden Kosten zu decken. Easy-peasy.
Der erste Monat verging wie im Flug, ich hatte viermal in der Fußgängerzone gespielt – öfter war auch nicht erlaubt –, dabei richtig gut verdient und immerhin einen Gig mit der Band gehabt. Geld hatte ich irgendwie trotzdem keins.
Der zweite Monat verging noch schneller, ich hatte wieder wöchentlich einmal alte Rock-’n’-Roll-Songs zur Gitarre quer über den Marienplatz geplärrt, diesmal sogar zweimal mit der Band gespielt und am Ende des Monats 100 DM Schulden bei unserem Schlagzeuger.
Im dritten Monat wurde mir langsam klar, dass irgendetwas an meiner Rechnung nicht stimmte. Die Antwort war einfach: Alles stimmte nicht. Was ich verdient hatte, ging drauf für Essen, U-Bahn-Fahrkarten und Gitarrensaiten. Miete hatte ich noch keine überwiesen, und die Chancen standen schlecht, dass sich dieser Zustand bessern würde. Verschlechtern ja, verbessern nein.
Im vierten Monat schließlich beschloss die Vermieterin, mit mir ein ernstes Wort zu reden. Ich wäre natürlich bereit gewesen, jeder Person auf diesem Erdenrund irgendwas von einem reichen Onkel aus Liechtenstein zu erzählen, der mir demnächst all seine Reichtümer überweisen würde, nur nicht dieser. Denn die Vermieterin war meine eigene Mutter. (Hier dräuenden Tusch einsetzen.)
»Sohn …«, hub sie an zu sprechen, teilte das Brot, gab mir zu Essen und sprach: »Sohn, warum gehst du keiner Arbeit nach.«
»Mutter …«, sprach ich, nahm das Brot, schlang es gierig hinunter, hub an zu antworten, wurde jedoch sofort unterbrochen. »Da, schau«, resolutete sie mir dazwischen und knallte mir den Stadtanzeiger vor die Nase. Ich weiß noch wie heute, dass die Stellenanzeigen bereits aufgeschlagen und passende Jobs grün eingekringelt waren. Vor meinem geistigen Auge sah ich mich bereits irgendwo Kartons an einem Fließband füllen.
Ein Blick genügte, und ich wusste, dass keines dieser Angebote die Dienste eines Straßenmusikanten oder Leadsängers erforderte. Ich hatte zwar auch schon ein paar Mal fürs Fernsehen als Darsteller und kurioserweise auch als mein eigenes Stuntdouble gearbeitet, in Hörspielen gesprochen und ein bisschen Theater gespielt, aber selbst diese weiträumigen Betätigungsfelder fanden sich in den Anforderungen der diversen Jobofferten nicht wieder.
Wir diskutierten ein wenig über das Spannungsfeld von Realität und Lebenslüge und über die Tatsache, dass ich kurz vor Einzug in die eigenen vier Wände noch meinen gutbezahlten Job in der Tonträgerabteilung vom Hugendubel gekündigt hatte. Damit hatte ich mich selbst positiv unter Druck setzen wollen, endlich die Musikkarriere zu starten. Der Druck war da, aber das positive Element ließ auf sich warten.
Es ging eine Weile hin und her, und schließlich sprach meine Mutter den Satz aus, der meine kommenden Jahre – und wenn man so will mein gesamtes folgendes Leben – maßgeblich beeinflussen sollte:
»Du hast doch den depperten Hut, gehst halt nach No Name City.«
In der Tat trug ich schon seit der siebten Klasse Realschule einen Cowboyhut und hatte mir dafür auch schon ein paar saubere Fressepolituren abgeholt. Denn damals gab es in unserem sozialen Brennpunkt mit dem hübschen Namen Neuperlach nur drei Arten von Jugendlichen: Rapper, Popper oder Heavys. Wer außerhalb dieser Kategorien versuchte, zu existieren oder gar irgendeine Art von Individualität zur Schau zu tragen, hatte es mitunter verdammt schwer. Da ich aber erstens einen Dickkopf hatte, mit dem man Wände einschlagen konnte, und zweitens durch mein langjähriges Judotraining nicht ganz wehrlos war, hatte ich am Ende triumphiert, und man ließ mich als eine Art Sonderling durchgehen. Außerdem spielte ich ab der achten Klasse in der Schulband und durfte trotz meiner episch beschissenen Zensuren mehrfach das Amt des Schülersprechers bekleiden, was es mir ermöglichte, noch weniger Zeit in der Klasse und noch mehr Zeit mit Planungen für die Faschingsfeier und diverse Aktionstage zu verdödeln. Und das alles und noch mehr absolvierte ich mit ebendieser Kopfbedeckung, die meine Mutter schon seit Jahren »den depperten Hut« nannte. Diesen trug ich also auf meinem Haupt, als ich mit der S-Bahn schnurstracks raus nach Poing in die Westernstadt No Name City fuhr.
Und plötzlich passte der Hut. Und ich auch.
Na ja, a bissl sehr normal hast du schon ausgeschaut.
Das war nicht so günstig …
Nein, das war nicht so günstig.
Aber du hast trotzdem gesagt, ich kann übermorgen anfangen.
Weil mir grad wer abgesagt hatte und wir übermorgen die Saison eröffnen wollten.
Ach so, drum.
Ja, drum.
Vor mir stand ein Mann, der mich nicht nur um einen Kopf überragte, sondern auch ansonsten deutlich mehr Schatten auf die staubige Mainstreet warf als ich. Sein Name war Heinz Bründl, und er war hier der Chef. Wie ich bald erfuhr, hatte dieser Mann mit der Statur eines Ex-Boxers, dem Bauch eines Metzgers und dem Schnauzbart eines Bankräubers unter anderem gearbeitet als Boxer, Metzger und Bankräuber. Letzteres Gott sei Dank nur innerhalb der Stuntshow von No Name City. Allerdings kamen auch die anderen beiden Berufsbereiche immer mal wieder zur Anwendung – doch davon später mehr vom Heinz persönlich.
Ich zählte also auf, was ich bisher so gemacht hatte, der Heinz brummte irgendwas in tiefstem Bayrisch, nickte, und ich war eingestellt. Und das zu einem Gehalt, das mir im Vergleich zu meinen bisherigen Jobs geradezu unglaublich vorkam. So viel Geld für so viel Spaß? Mit einem dümmlichen Grinsen im Gesicht unterschrieb ich den hingehaltenen Wisch, jemand machte ein Foto von mir – auf dem ich bitte etwas bankräuberischer dreinschauen sollte … noch ein bisschen mehr … noch ein bisschen … na ja, passt schon – und ich war ab sofort ein Cowboy.
Dann ist aber ein paar Tage später gleich deine Mutter zu mir gekommen.
Bitte was?! Davon weiß ich gar nix!
Ja mei, sie wollt halt wissen, ob das nicht gefährlich wär und ob dir da auch nichts passiert und so. Und ich hab gesagt: Naa, selbstverständlich nicht.
Ja, und dann kam gleich am ersten Wochenende eine Busladung voll betrunkener Österreicher.
Richtig. Aber dir is’ ja nix passiert.
Nix, was nicht wieder verheilt ist.
Genau.
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, was für ein Depp ich war. Nicht wegen der Unterschrift oder weil ich den Job angenommen hatte. Nein, das war die prägende richtige Entscheidung meiner frühen Lebensjahre. Vielmehr meine ich das Gespräch unmittelbar danach, in dem es darum ging, was ich denn nun konkret beitragen konnte. Der Heinz zählte in den folgenden Minuten ein paar mögliche Betätigungsfelder auf, und ich schrie alle zwei Sätze: »Mach ich!« Weil ich ein Depp war. Und was für einer.
Somit war ich nun in der Stuntshow als Bankräuber eingeteilt und hatte mich zweimal am Tag auf der Mainstreet zu prügeln, herumzuballern und möglichst effektvoll in den Staub zu werfen. Kein Problem! Was ein Spaß!
Außerdem war ich Teil der Saloonshow, in der ich mehrere Lieder mit Gesang und Gitarre zum Besten geben sollte. Kein Problem! Was ein Spaß!
Dann hatte ich zusammen mit den beiden Saloongirls und Kollege Long John eine Westernpolka zu tanzen, bei dem ich am Ende in einen Spagat sprang, um dann am Ende in Frauenkleidern als »Miss Annie Oakley, die Scharfschützin« aufzutreten und mit einem Gewehr über der Schulter und einem Taschenspiegel rückwärts drei Ballons kaputt zu schießen. Dabei musste ich eine halbe Zigarre rauchen, einen Flachmann in einem Zug leeren, wie ein Brett nach vorne aufs Gesicht fallen und am Ende von einem Tisch aus kopfüber durch eine Saloontür in den Gambling Room nebenan stürzen. Dort stand ein Stapel Stühle, die ich umzutreten hatte, um auch ein entsprechendes Poltern zu erzeugen. Kein Problem! Was ein Spaß …
… am ersten Tag.
Kapitel 2: 60 Steaks pro Woche oder: Vom Boxen zum Büffel
Von Heinz Bründl
Bevor wir gleich in die vielen Anekdoten und Erinnerungen abtauchen, würde ich gerne erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass von 1987 bis 1995 eine Westernstadt in Poing bei München stand.
Eigentlich hatte ich ja Metzger gelernt. Der Vater eines damaligen Freundes von mir hatte einen Lebensmittelmarkt, und der fragte mich irgendwann mal: »Magst du Kaufmann oder Metzger werden?« Ich dachte mir, Kaufmänner gibt’s schon so viele, also hab ich mich recht pragmatisch für Metzger entschieden. Aber kaum hatte ich ausgelernt, zog es mich mehr in den kreativen Bereich.
Und deswegen bist du dann erst mal Boxer geworden?
Ich war ein kreativer Boxer.
Für mich hat das immer gleich ausgesehen: »Batsch«, und da liegt er.
Aber die lagen immer anders.
Hab ich nicht drauf geachtet.
Für so was muss man auch einen Sinn haben.
Ich hatte relativ früh angefangen zu boxen, weil mein Bruder ein sehr bekannter deutscher Mittelgewichtler war. Ich selbst war dann mit siebzehn Jahren deutscher Vize-Meister im Mittelgewicht, Bayerischer Meister und so weiter. Bald hatte ich so gut wie alles erreicht, was man als Amateur in Deutschland so erreichen konnte, und dann war das für mich erledigt. Ich war eh immer recht trainingsfaul, sonst wäre ich vielleicht noch weiter gekommen. Aber nach sechzig Kämpfen hatte ich keine Lust mehr.
Zählen da die Kämpfe auf der Mainstreet in No Name City dazu?
Das waren keine Kämpfe. Das waren Diskussionen über die Hausordnung in einem Freizeitpark.
Selbstverständlich.
Zum Wilden Westen kam ich aber durch meine Arbeit als Metzger. Denn da gab es einen Kunden, der holte jeden Freitag immer achtzig Steaks. Irgendwann war ich einfach neugierig und fragte ihn, wozu man so viele Steaks braucht. Er antwortete mir: »Ich bin im Cowboy-Club. Magst mal mitgehen?« Und von diesem Moment an nahm das Ganze seinen Lauf.
Denn ich bemerkte sehr schnell, dass dort eine große Marktlücke klaffte. Fast jeder machte sich damals ja seine Ausrüstung selbst. Und das war manchmal recht gelungen, viel öfter aber eben überhaupt nicht. Und außerdem war es 1976 noch ganz schön schwierig, an das richtige Zubehör und das Material zu kommen. Um den Mangel zu beheben und natürlich auch aus geschäftlichen Überlegungen gründete ich schließlich die erste »Hudson’s Bay Indian Trading Post« in München. Ich glaube sogar, dass das der erste Laden dieser Art in Europa war.
Entsprechend den Vorbildern aus dem Wilden Westen konnte man dort alles kaufen, was man brauchte, um sich authentisch auszurüsten. Ich besorgte originalgetreue Decken aus England, Büffelfelle aus den USA oder Glasperlen aus Italien – und zwar aus Murano. Dort war ich pro Jahr sicher fünfmal, denn daher stammten auch viele Glasperlen der damaligen Indianer. Natürlich auch in den richtigen Farben, denn gewisse Perlfarben waren damals recht selten und kaum zu bekommen.
Ich weiß noch, wie ich den Namen meines Ladens auf die Fenster malte und ein älteres Ehepaar vorbeikam. Sie schauten sich lange den Schriftzug an, und irgendwann fragte er dann seine Frau: »Ja, was wird jetzt des?« Daraufhin las sie – natürlich deutsch ausgesprochen – vor: »Hudsons Bai Indian Traading Post.« Und er nickte und sagte: »Aha, ein Postamt.«
Das war damals schon alles recht ungewöhnlich für München – aber eben auch recht erfolgreich. Und so konnte ich bald meinen ursprünglichen Beruf an den Nagel hängen und mich nur noch dem Handel mit Wildwest- und Indianermaterial widmen. Mein Sohn schrieb daraufhin in einem Schulaufsatz: »Mein Vater ist Indianerhändler.« Und ich durfte mal wieder in der Schule antanzen.
In einem anderen Aufsatz schrieb mein Sohn, dass er auf einem Berg irgendwo in Frankreich als Trapper verkleidet zusammen mit mehreren Indianern gecampt hätte. Dort sei ihm nachts ein Wiesel über die Hände gelaufen, und außerdem habe es auf dem Berg gespukt. Daraufhin erteilte ihm die Lehrerin eine Sechs und zitierte mich wieder einmal zu sich, weil das Thema nicht »Fantasiegeschichte« gewesen sei, sondern »Meine Ferien mit der Familie«. Als ich ihr dann erklärte, dass Christian nichts als die Wahrheit aufgeschrieben und noch ein paar Details aus meinem Beruf hinzugefügt hatte, musste ich nie wieder in die Schule. Vielleicht hatte sie Angst.
Heute gibt es ja viele Familien, die zusammen »Reenactment« als Hobby betreiben, egal ob als Cowboys, Ritter oder Wikinger. Damals war das nicht nur ungewöhnlich, sondern oft auch irgendwie verdächtig.
Im Cowboy-Club war am Wochenende immer Remmidemmi und eine Mordsgaudi, aber ich wollte tiefer in die Materie einsteigen.
In der Bibliothek des Clubs fand ich das berühmte Buch von Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied über seine Reise 1832 nach Nordamerika. Also zu einer Zeit, als die Indianerstämme noch weitestgehend frei und ungebunden lebten. Sein Bericht faszinierte mich so sehr, dass ich im Jahr 1974 zum ersten Mal selbst nach Amerika reiste, um die Stationen von Prinz Maximilians Reise zu besuchen. Gleichzeitig war das auch der Beginn meiner Sammlerleidenschaft für Originalstücke der Indianer.
Da man diesen Stücken in den Siebzigern noch keine sonderliche Bedeutung beimaß, war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich auch um Originale handelte. Erst viel später erzielten Kunstobjekte oder Ausrüstungsgegenstände dann wahnwitzige Preise in schwindelnden Höhen. Und damit hielten natürlich auch die Fälschungen Einzug in das Geschäft. Davon war man damals noch weitestgehend verschont.
Manche Originale verkaufte ich in meiner Trading Post in München, andere behielt ich. Aber das Hauptgeschäft war nach wie vor …
… Glasperlen für die Westernfans.
Na ja, eher für die Indianerhobbyisten.
Es gab in Deutschland damals etwa 300 Vereine mit Schwerpunkten unter anderem in Köln und Freiburg. Und einmal im Jahr zu Pfingsten fand das sogenannte »Indian Council« statt, zu dem Cowboys, Indianer und Trapper aus ganz Deutschland anreisten. Ich hatte eine mobile »Trading Post« und machte dort immer ein recht gutes Geschäft.
Nun war es so, dass das Council jedes Jahr von einem anderen Verein ausgerichtet wurde, und wir Münchner wollten eben etwas Besonderes machen.
Und damit nahm sozusagen das Schicksal seinen Lauf …
Kapitel 3: Das erste Council oder: Wildwest am Chiemsee
Von Heinz Bründl
Im ersten Jahr, 1984, waren wir mit unserem Council in Ising am Chiemsee. Und als die Clubs dann aus ganz Deutschland anreisten, fielen den Leuten natürlich die Augen aus dem Kopf: Sie standen auf der Mainstreet einer Westernstadt, mit Blick auf einen Platz, auf dem sich nach und nach über 300 Indianerzelte sammelten.
Man kann davon ausgehen, dass bis dahin auch in Amerika noch nie so viele Tipis auf einem Haufen versammelt waren wie damals im bayrischen Ising. Wir hatten die Kulissen schon damals sehr originalgetreu gestaltet und man darf nicht vergessen, dass damals auch die Goldsucherstädte ähnlich aus dem Boden gestampft wurden. Mein Stiefvater war Zimmermannsmeister, und wir hatten das alles mit zwanzig Mann aufgebaut, inklusive Deko, Requisiten, Pferden und …
… und Matsch.
Und wie. Auf der Mainstreet versanken wir teilweise bis über die Knöchel im Schlamm.
Sehr originalgetreu.
Sehr.
Das Gelände gehörte einem der größten Großgrundbesitzer am Chiemsee. Er war ein riesiger Westernfan und hatte einen Mordsspaß, seinem Freundeskreis etwas zu präsentieren, was die nicht hatten. Geld hatten alle mehr als genug, aber eine Westernstadt und Hunderte Indianertipis – das hatte nur er. Entsprechend durften seine Freunde und Bekannten das Gelände auch nur in seiner Begleitung betreten, vorausgesetzt, sie hatten originalgetreue Kostüme. Ich weiß noch, dass er nicht einmal seinen eigenen Bruder auf den Platz ließ, bevor der sich nicht ein Trapperhemd und ein Bowiemesser gekauft hatte.
Bei dir.
Logisch, bei mir.
Traurigerweise starb der Mann dann zwischen zwei Councils, sonst hätte No Name City höchstwahrscheinlich nicht in Poing, sondern in Ising am Chiemsee gestanden.
Insgesamt lief das Ganze damals noch recht gesittet ab, vor allem wenn man bedenkt, dass von den zweitausend Besuchern bestimmt ein Drittel mit scharfen Waffen im Holster durch die Gegend lief. Wäre irgendeine brenzlige Situation entstanden, hätte das natürlich schnell eskalieren können. Vermutlich war allen bewusst, dass echte Leichen auf der Mainstreet keinen sonderlich krönenden Abschluss eines Vereinstreffens darstellen würden, und so passierte in der Tat rein gar nichts.
Was soll ich sagen, heute ist dieses Council 84 so etwas wie eine Legende. Bis dahin hatte noch niemand so einen Aufwand betrieben.
Diese Mühe und die Liebe zum Detail waren allerdings nicht ansatzweise kostendeckend zu betreiben. Es waren zwar tatsächlich zweitausend Menschen da, aber natürlich nur Vereinsmitglieder. All das war sozusagen eine gigantische »geschlossene Veranstaltung« für geladene Gäste. Also wiederholten wir das Ganze ein Jahr später und hofften ehrlich gesagt auch darauf, ein bisschen was von den Verlusten wieder reinzuholen.
Spätestens beim zweiten Mal bemerkte ich, dass unser Spektakel für die Außenstehenden, die Anwohner, die Touristen und so weiter, unheimlich attraktiv war. Nicht nur, weil sie nicht aufs Gelände durften, sondern schlichtweg weil auch jemand, der nicht in einem Verein organisiert ist, Spaß und Freude am Thema »Western & Indianer« haben kann.
In meinem Kopf wuchs also die Idee, eine Westernstadt zu bauen, die jeder betreten durfte. Zunächst dachte ich gar nicht an einen Freizeitpark, sondern einfach an eine begehbare Goldgräberstadt. Nur fehlten mir dazu natürlich die finanziellen Mittel. Keines der Councils hatte sich so gerechnet, dass ich davon ein derartiges Investment hätte stemmen können. Ehrlich gesagt, sogar ganz im Gegenteil. Also setzte ich kurzerhand ein skurriles Inserat in die Zeitung. Es lautete: »Saloon zu verkaufen«…
»Saloon zu verkaufen«? Wer kauft sich denn einen Saloon?
Der, der sich daraufhin gemeldet hat, kaufte nicht nur den Saloon, sondern sogar auch noch viele andere Gebäude.
Ich sag schon nix mehr.
Glaub ich dir nicht.
Der Immobilienhändler Wilhelm P. hatte zwei seiner Geschäftsführer auf das Gelände geschickt und …
… die durften dann ohne Kostüm auf den Platz?
Nix da. Die haben wir natürlich vorher auch in originalgetreue Kostüme geschossen. Du wolltest aber eigentlich auch nix mehr sagen.
Nicht möglich.
Die beiden Herren waren schließlich so begeistert, dass dieser Wilhelm P. schließlich eine ganze Westernstadt kaufte, ohne sie vorher selbst einmal gesehen zu haben, geschweige denn ein Gelände zu besitzen, auf dem er seine Errungenschaft aufstellen konnte.
Wenig später aber stellte sich heraus, dass der Baugrund eines geplanten Hotels in Miesbach zumindest vorübergehend geeignet war, um so etwas wie einen Probelauf zu starten. Also stellten wir dort, wo später das Hotel Bayerischer Hof Miesbach stand, unsere Kulissen auf. Und das, was dann folgte, war wirklich »Wilder Westen«.
Alles war ganz genau so, wie man es sich vorstellt. Nicht nur die Gebäude und die Ausstattung, auch das Gefühl, die Atmosphäre und natürlich der unvermeidliche Schlamm. Authentischer konnte man sich zumindest in diesem Land nicht in den Wilden Westen hineinversetzen. Außerdem machte es so auch geschäftlich endlich Sinn. Wir schenkten pro Wochenende etwa 100 Hektoliter Bier aus, und die Brauereien waren einfach nur baff.
Aber es gab dann doch auch ein paar Schwierigkeiten, oder?
Ja, schon klar. Da hat’s jedes Wochenende geknallt. Aber nicht so wie heute, sondern …
Mehr so »nett«?
Ja, die wollten rankeln.
Rankeln??
Ja, rankeln. Aber ich verstand damals keinen Spaß und hab …
… mitgerankelt?
Ja, ich hab mitgerankelt.
Und da kam dann nicht die Polizei?
Doch schon, aber die hatten ja ihre Waffen abgegeben.
W…
Die Miesbacher Polizei kam immer gegen Abend geschlossen bei uns an und gab dann ihre Waffen im Saloon zur sicheren Aufbewahrung an der Theke ab – ganz so wie früher auch. Somit war ein gewisses Gleichgewicht hergestellt, und es gab auch keine ausrüstungstechnischen Vorteile beim Rankeln. Und währenddessen schraubten die Miesbacher Burschen draußen dem Polizeiwagen alle vier Räder ab.
Fanden die Polizisten das dann lustig?
Ganz ehrlich, ich glaub, ein bisschen schon. Aber da gab’s auch andere Situationen …
Raus damit.
Kapitel 4: Zähne pflastern seinen Weg oder: Tantiemen vom Zahnarzt
Von Heinz Bründl und Tommy Krappweis
Also, Heinz, wer stand wo? Du standst in der Mitte …?
Ja, wir standen an der Theke, und ich stand in der Mitte. Ein Polizist stand links neben mir und ein anderer Typ rechts.
Links von dir stand ein Polizist?
Ja, das war noch in Miesbach, bei unserem Probelauf. Da war ja oft die Polizei da …
… zum »Rankeln«.
Nein, der wirkte eigentlich eher entspannt.
Aber der andere Typ hat dann angefangen, mich zu beschimpfen. Da war natürlich auch der Alkohol verantwortlich, aber dann darf man eben nicht so viel saufen, wenn man es nicht verträgt. Ich weiß noch, wie der Polizist zu mir gesagt hat: »Sie müssen sich hier ja ganz schön was gefallen lassen.« Aber was sollte ich machen, als Geschäftsführer sollte man schon die Fähigkeit haben, ruhig zu bleiben. Und ruhig bleiben kann ich wirklich gut bis zu einem gewissen Punkt.
Der war dann allerdings irgendwann überschritten. Nicht wegen der Beleidigungen, da steh ich drüber. Aber plötzlich spür ich schräg hinter mir eine Bewegung und wusste sofort: Da holt grad einer zum Schlag aus. Ich bin sofort ausgewichen, so dass er mich nur gestreift hat, und bevor ich nachdenken konnte, lag er auch schon am Boden, und ihm hat ein Schneidezahn gefehlt. Ich hatte einfach nur reflexartig reagiert, vermutlich wegen meiner Zeit als Boxer.
Der Typ rappelt sich aber sofort wieder auf, holt noch mal aus, ich tauch unter dem Schlag weg, hinter mir macht’s »batsch«, und neben mir fällt der Polizist ins Bild.
Da war der Polizist wohl nicht mehr so entspannt …
Nein, war er nicht. Und er wollte wohl auch nicht nur rankeln.
Der Beamte steht auf, seufzt und gibt mir dann in aller Seelenruhe sein Funkgerät. Dann zieht er sich die Jacke zurecht, dreht einmal den Kopf, um seinen Hals zu lockern … und dann serviert er dem Typen eine dermaßene Watschn, dass der sich fast zweimal um die Achse dreht. Es hat nur ein paar Sekunden gedauert, und schon rollen sich die zwei am Boden. Irgendwer brüllt »Schlägerei!«, und schon kommen alle angelaufen und feuern die beiden an.
Arg viel mehr Wilder Westen geht eigentlich kaum.
Ja, das stimmt. Das war schon echt wild.
Du hast einmal gesagt, der Zahnarzt von Miesbach müsste dir eigentlich Tantiemen zahlen.
Der hat gut an mir verdient.
Es hatte sich dann auch irgendwann rumgesprochen, dass es da in diesem Saloon einen gibt, der irgendwie nie umfällt. Dafür aber eine hohe Trefferquote hat. Ich glaub, nach zwei Wochen war kaum einer in der Burschenschaft, dem nicht mindestens ein paar Zähne gewackelt haben. Die hatten angeblich sogar Wetten abgeschlossen, wer mich »packt«. Es war schon wirklich grenzwertig. Ich war dauernd auf der Hut, und meine Leute haben natürlich auch rund um die Uhr patrouilliert. Trotzdem haben die mich dann doch immer wieder erwischt, wenn grad niemand neben mir stand.
Hat ihnen aber dann auch nix geholfen.
Nein. Nix.
Ich hatte dann nur die Chance, entweder wegzugehen oder eben zu schauen, wer gerade ausholt. Und dann schneller zu sein. Oft wurde auch mit irgendwas potenziell Schmerzhaftem ausgeholt, wie zum Beispiel mit Bierkrügen, Aschenbechern oder eben auch mit Stühlen, Brettern, was gerade da war. Dafür hab ich genau gewusst, wo ich hinhauen muss. Und so haben wir eben nachts nach der Sperrstunde beim Saubermachen auch immer mal wieder ein paar Schneidezähne rausgekehrt.
Ich hab mir schon mal überlegt, ob ich vielleicht anstatt einer Trading Post lieber einen Barbershop hätte aufmachen sollen. Der Friseur hat ja damals auch die Zähne gezogen, und da war ich anscheinend recht geschickt drin.
Aber etwa nach vier Wochen wurde es dann doch nervig. Es ging nur noch drum: »Wer packt den Dicken im Saloon?«, und ich hab das ganze Wochenende über Watschn verteilt. Klar, wenn dir drei so Burschen am Kragen hängen und du die nacheinander aus dem Saloon raus in den Schlamm schmeißt, dann kommst du dir erst einmal vor wie der Bud Spencer von Miesbach. Aber irgendwann hab ich mich dann doch gefragt, ob ich das mein Leben lang machen will.
Deine Boxerkarriere hattest du ja schließlich aufgegeben.
Die Metzgerlaufbahn auch, und das war manchmal nicht viel anders.
Also hab ich dann mit unserem Finanzier und Besitzer, dem Wilhelm P., geredet, und wir haben einen Sicherheitsdienst engagiert, der aufpassen sollte. Das hat nur leider nicht so viel gebracht, weil es denen ja schon lang nicht mehr darum ging, mit irgendwem zu rankeln, sondern mit mir.
Der Alkohol war natürlich oft der hochprozentige Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Gib ihnen etwas zu viel, und die Leute werden laut, gib ihnen viel zu viel, und sie werden aggressiv …
Gib ihnen noch viel mehr, und die Leute werden wieder still.
Ja, das stimmt. Ach, da erinnere ich mich noch an was …
Die damalige Bardame in der »Mexican Cantina« hat mal für einen unvergesslichen Anblick gesorgt. Allerdings nicht so, wie man das nun vielleicht falsch verstehen könnte, sondern deutlich anders.
Ich war wirklich nur kurz unten in Miesbach gewesen, und als ich wiederkam, krochen mir die Leute auf der Mainstreet entgegen. Mehrere Menschen krabbelten da auf allen vieren, brachen immer wieder zusammen und landeten mit ihren Gesichtern im Schlamm, wo sie leise blubbernd liegen blieben. Ich versuchte, einen zur Rede zu stellen, und er lallte nur: »Tequillaaa …«
Sofort stellte ich die Frau an der Bar der Cantina zur Rede. Sie rechnete mir seelenruhig vor, wie viele 0,1-l-Schnäpse in einer Flasche Tequila enthalten seien und dass sie daraufhin dazu übergegangen sei, das Zeug flaschenweise zu verkaufen: für 7 DM die Flasche. Das Zeug kostete damals schon 20 DM im Einkauf, insofern hatte sie sich geradezu epochal verrechnet. Die Besucher der Cantina allerdings konnten – zumindest eine halbe Stunde zuvor – noch recht gut kopfrechnen, und somit setzte sofort ein Ansturm auf die Bar ein, der innerhalb kürzester Zeit zu einem Besäufnis führte, das mit ebendiesen Alkoholleichen auf der Mainstreet sein vorläufiges Ende fand. Ebenso wie das Arbeitsverhältnis zu der Bardame.
Na ja, drei Monate später war der Probelauf dann beendet, wir waren um viel Erfahrung reicher und Miesbach um viele Schneidezähne ärmer. Wir hatten trotz allem ein irres Geschäft gemacht. Die Brauerei war völlig aus dem Häuschen. Darum war klar: Wir suchen jetzt einen festen Platz für unsere Westernstadt – No Name City, die authentischste Westernstadt Europas. Aber: Wir machen einen Zaun drum und verlangen Eintritt.
Weise Entscheidung.
Allerdings.
Kapitel 5: Ein Indianer kennt keinen Schmerz oder: Ich bin ja auch ein Cowboy
Von Tommy Krappweis
Wie oben schon mal erwähnt, hatte ich als Double für Bodystunts gearbeitet, und mein langjähriger Judounterricht mit der fürchterlich nervigen, immer gleichen Fallschule hatte sich hier wirklich ausgezahlt. Ich konnte mich schon als Kind ganz wunderbar jede beliebige Treppe hinunterstürzen, ohne nennenswerten Schaden zu nehmen. Bei Handgreiflichkeiten in der Schule mit übermächtigen Gegnern war mir das mehrmals ein guter Ausweg gewesen. Denn wenn der kleine Junge mit dem Cowboyhut plötzlich recht verdreht und mit rasselndem Keuchen am unteren Ende einer Betontreppe lag, dachte keiner mehr an irgendetwas anderes als SCHEISSESCHEISSESCHEISSE und WEGWEGWEGWEGWEG.
Wenn ich gewusst hätte, dass du auch Treppenstürze machst …
Gott sei Dank hab ich da ausnahmsweise meinen Mund gehalten.
Schade, dabei hatten wir so eine schöne Treppe am Caféhaus. Der Mad Dog ist vor deiner Zeit in jeder Stuntshow einmal da runtergefallen. Das war super.
Ich hätt’ mir mit meiner »Technik« irgendwann alles gebrochen, was man sich brechen kann.
Ja mei, das ist halt das Showgeschäft.
Ja, irgendwie stimmt das sogar. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob man sich an einem einzigen Drehtag fünf- bis sechsmal in einen Müllhaufen fallen lässt und danach ein paar Wochen lang den kleinen Kratzer ausheilen darf oder ob man tagaus, tagein immer und immer wieder hinfällt, aufsteht, hinfällt, schlägt, blockt, pariert, erschossen wird …