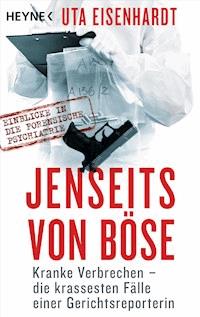Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Leben auf einem Hausboot ist zweifellos Kult und ein geheimer Traum unzähliger Menschen. So auch von Uta Eisenhardt, die mehr oder minder aus Zufall zur Hausbootbesitzerin wurde . In "Vier Küche, Zimmer, Boot" erzählt Sie, wie sie auf ihrem Hausboot "Helene" – mitten in Berlin – heimisch wurde. Wer ein Hausboot kauft, muss Mut mitbringen. Mut, sich auf Unbekanntes einzulassen und Mut, für seine Wohnform nicht nur beneidet, sondern auch belächelt oder gar bekämpft zu werden. So sah sich auch Uta Eisenhardt plötzlich mit Problemen konfrontiert, die sie vorher nie hatte, denen sie aber samt und sonders mit einer großen Portion Humor und Pragmatismus zu Leibe rückte. Uta Eisenhardt lernt schnell, warum ein Supermagnet zum wichtigsten Gegenstand auf dem Boot wird (hilfreich gegen Schlüsselverlust direkt vor der Haustür), wie wichtig die richtige Gummizusammensetzung bei Schläuchen sein kann (wer mag schon feststellen, dass seine Wohnung unbeabsichtigt zur Klärgrube wird?) und welche Macht die friedliche Szene der Wohnbootbesitzer auf ein Stadtviertel haben kann (so viel, dass eine verrufene Neonazi-Gegend zum beliebten Stadtviertel wird). "Vier Zimmer, Küche, Hausboot" erzählt vom Spannungsfeld zwischen einem eigentlich normalen Alltagsleben mit Mann und zwei Kindern und den Besonderheiten des Lebens auf einem Hausboot . Daneben gibt das Buch auch Antworten auf zahlreiche praktische Fragen: • Wie kommt man auf die Idee, auf einem Schiff zu leben? • Ist ein Leben auf einem Hausboot im Winter nicht zu kalt? • Gibt es auf Hausbooten auch Ratten? • Schaukelt das Hausboot nicht zu stark? • Kann man mit einem Hausboot auch fahren? Für alle, die selbst mit der Idee spielen, auf einem Hausboot zu leben, ist dieses Buch nicht nur ein reichhaltiger Erfahrungsschatz – im Anhang gibt Uta Eisenhardt zudem Tipps und Antworten vom Finden eines Hausbootes bis hin zur energieautarken Ausstattung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorweg
Erstes Date mit »WS 3454«
Genesis
Neue Anschrift gesucht
Kredit-Mathematik
Dschunken unerwünscht
»Helene« entert Berlin
Schiffsspezialitäten
TV-Stars
Do it yourself
Willkommen auf Unbewohnbar
Auf Montage
Hausboot-Romantik
»Helenes« Tierleben
Heimatlos
Ice Age
Energiewende
Der kleine Knattermann
Auf Stralau
Odyssee
Aufgegeben
Das Kettensägen-Massaker
Achtung, Gefahr!
Plötzenseer Kolk
Versunkene Schätze
»Helenes« Refit
Abgebrannt
Behörden, Paragrafen, Gutachten
St.-Pauli-Piraten
Im Sog der Tiefe
Elf Freunde
Zwei Hausboote laufen aus
Schöne neue Hausboot-Welt
Der Hausboot-Schamane
Ab in den Urlaub!
Nerds an Bord
Die Moral von der Geschichte
Nützliches
Danke
Impressum
Mit dem Beiboot: Kurs »Helene«.
Für unsere Mütter – meine Mutter und meineSchwiegermutter –, die unser Hausboot-Projektvorbehaltlos unterstützt haben.
Vorweg
Heute beginne ich ein »Alfred«-Buch, schrieb meine Freundin Sylvi in einer kreativen Nacht auf ein weißes DIN-A4-Blatt. Seit zwei Jahren haben wir »Alfred«, unser Hausboot, und das kam so: Die ersten Hausboote habe ich in Oxford gesehen. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, was ich im Englischunterricht antworten sollte, wenn man mich fragt: »Was würdest du kaufen, wenn du sehr viel Geld hättest?« Ich würde mir sofort ein Hausboot kaufen, um darauf zu leben.
Später zeigte ich meinem Freund die Wohnschiffe in Berlin. Er war sofort begeistert. Wir strolchten immer wieder dorthin, schauten uns auf dem Gebrauchtboote-Markt um und träumten. Alles war vollkommen fremd, wir wussten nichts. Einmal wollten wir ein 40 Meter langes Schiff in Hamburg kaufen. Es wäre jedoch sehr teuer gewesen, das nach Berlin zu bringen, und wir hatten natürlich keine Ahnung, wo wir es lassen sollten.
Wir sind sehr naiv an die Sache herangegangen. Darin lag aber auch unsere Chance. Wir hätten »Alfred« nie gekauft, hätten wir damals ein bisschen Durchblick gehabt und gewusst, was auf uns zukommt. Außerdem gibt es die Wahrheit über Hausboote gar nicht. Alle, die wir gefragt haben, waren verschiedener Meinung.
An dieser Stelle endet das »Alfred«-Buch, für längere Texte fehlt meiner Freundin die Geduld. Dennoch bringen ihre wenigen Zeilen die Sache auf den Punkt: Wer ein Hausboot kauft, muss Mut aufbringen. Mut, sich auf Unbekanntes einzulassen, und Mut, für seine Wohnform nicht nur beneidet, sondern auch belächelt oder gar bekämpft zu werden.
Insbesondere seitens der Stadtplaner weht ein scharfer Gegenwind: Flussufer sind öffentliche Räume für Erholung und Naturschutz. Dieser Umstand sei mit der Anwesenheit von Hausbooten nicht in Einklang zu bringen, so die Beamten. Die Realität ist anders: Spaziergänger und Wassersportler reagieren auf die Wohnschiffe mit Neugier, die Tiere nutzen sie als Brutstätte, als geschütztes Versteck sowie als Algen- und Muschellieferanten.
Stadtplaner halten das Wohnen auf einem Hausboot für elitär und nicht für eine Form selbstbestimmten Lebens, die möglichst vielen Menschen zugänglich sein sollte. Dementsprechend heißt es in der Uferkonzeption für den Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick: »Solange in der Stadt noch Flächen für Wohnen vorhanden sind, kann eine Notwendigkeit, auf Wasserflächen auszuweichen, nicht abgeleitet werden.« Eine solche Wohnungsnot bestand das letzte Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, als in Berlin etwa 4000 Menschen Zuflucht auf Schiffen fanden.
Dabei finden die Beamten alternative Wohnformen durchaus berechtigt, diese bereichern schließlich das Stadtbild. Nur sollten Hausboote ihrer Ansicht nach vorzugsweise an privaten Ufern liegen. Uns ist nach langem Suchen in der wasserreichen Hauptstadt bislang nur einmal ein Grundstücksbesitzer begegnet, der sich offen für eine – zeitlich befristete – unkonventionelle Nutzung seines Eigentums gezeigt hat.
»Vier Zimmer, Küche, Hausboot« berichtet von diesem Spannungsfeld. Außerdem beschreibt es skurrile und abenteuerliche Erlebnisse mit, auf und neben unserer »Helene« und enthält Geschichten, die andere Berliner Hausbootbesitzer mir anvertrauten.
Das Buch soll die vielen Fragen beantworten, die uns immer gestellt werden, angefangen bei »Wie kommt man auf die Idee, auf einem Schiff zu leben?« über »Ist es im Winter nicht zu kalt?« und »Gibt es auf dem Schiff auch Ratten?« bis hin zu »Schaukelt das Schiff stark?« und »Könnt ihr mit eurem Schiff auch fahren?«
Ich will die schönen und weniger schönen Momente dieser Wohnform schildern, will meinen Lesern das Leben auf dem Boot näher bringen, das einerseits normal und alltäglich verläuft, andererseits ganz anders ist als das Leben in einem Haus.
Einige wird das Buch ermutigen, sich selbst den Traum vom Leben auf dem Wasser zu erfüllen. Manchem Romantiker mit zwei linken Händen wird es vielleicht von dieser Idee abhalten und dazu bewegen, sich nach einer passenderen umzusehen.
Allen jedoch wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen!
Uta Eisenhardt
Sommer 2010, »Helene« von innen – aufgeräumt und vorzeigbar.
Winter 2003, Arneburg. WS 3454 wartet auf Käufer.
Erstes Date mit »WS 3454«
Mein Blick fiel auf unsern Kleinsten. Ein übler Gestank kroch aus Oscars Windel, dessen Inhalt sich bereits in Richtung Halskrause bewegte. »Vollschiss«, dachte ich. »Gerade jetzt!« Seufzend schaute ich meinen Mann an. Felix stand im Türrahmen unseres Pensionszimmers – seine Tasche mit Lampe und Werkzeug umgehängt –, an der Hand unseren ältesten Sohn Tom. Keine Frage, er wollte los. Keine volle Windel der Welt würde ihn stoppen.
»Ich komme nach«, seufzte ich, schnappte mir den Hosenscheißer und ging ins Bad. Verschmutzte Montur ausziehen, den kleinen Kerl abbrausen, abtrocknen, wieder neu anziehen – 20 Minuten würde es wohl dauern. Ich brauchte Glück, wenn ich noch einen kurzen Blick ins Innere des Schiffes werfen wollte.
Eine halbe Stunde später saß der frisch gesäuberte Oscar auf meinen Schultern, während ich zum Ufer der vereisten Elbe stapfte. Dort lag das Schiff an mächtigen Dalben vertäut, ein 32 Meter langer und fünf Meter breiter grüner Stahlkasten mit quietschroten Lüftern, die sich auf dem Dach drehten. Eine kleine Rauchwolke stieg in den wintergrauen Himmel, sie kringelte sich aus einem Schornstein empor, der sich ebenfalls auf dem Schiffsdach befand. Wie in einem Haus. Mein Blick fiel auf die weißen Gardinen aus Plastiktüll, die an der Steuerbordseite hinter sieben kleinen Fenstern hingen. Dieses Schiff wirkte schon von außen recht wohnlich, ganz anders als das Peilschiff oder der Tonnenausleger, die wir im Sommer besichtigt hatten und in deren Innern wir über riesige Motorblöcke und Aggregate geklettert waren. Ein Leben mit zwei kleinen Kindern konnten wir uns darauf nicht vorstellen.
Aber dieses hier – »WS 3454« – war anders. Es war schon immer zum Wohnen bestimmt gewesen, wenn auch dessen bisherige Bewohner keine besonders großen Ansprüche an die Schönheit ihrer quadratisch-praktischen Unterkunft gestellt hatten. Es waren Bauarbeiter, die im Schichtdienst die Wasserstraßen der Deutschen Demokratischen Republik instand gehalten hatten. Im Dezember 2003 sollte das 23 Jahre alte Bauhüttenschiff verkauft werden.
Zehn Interessenten hatten es sich bereits angeschaut. Vier Stunden vor Auktionsschluss war Felix der Letzte, der durch »WS 3454« gegangen und unter dessen Deck gekrochen war, seinen prüfenden Blick auf den Stahl geheftet, mit dem Schraubenzieher mal hier und mal dort kratzend, um zu prüfen, wie tief sich der Rost in das Material gefressen hatte.
Als ich mit Oscar am Flussufer erschien, verabschiedete er sich gerade von dem Verkäufer, der »bedauerlicherweise, leider, leider« die Schiffstür nicht länger geöffnet halten konnte. Mein Mann ging mit Tom von Bord, ich musste mich mit der Außenansicht begnügen. Wieder seufzte ich, schon das zweite Mal an diesem Morgen.
»Und, wie war’s da drinnen?«, erkundigte ich mich bei meiner Vorhut.
»Ganz viele Zimmer sind da«, berichtete Tom. »Und ganz viele Betten. Jeder bekommt drei oder vier.«
Felix fasste sich kürzer: »Wir brauchen ein Faxgerät.«
»Wir bieten?«, fragte ich.
»Ja, das Schiff hat ziemlich viel Rost, aber nur oberflächlich. Die Substanz ist gut.«
»Okay. Und wir erfahren wirklich erst hinterher, wie viel die Konkurrenz geboten hat?«
»Ja«, sagte Felix. »Dann wissen wir, ob wir uns ärgern dürfen. Entweder zahlt der glückliche Käufer nur ein paar Euro mehr, als wir aufgerufen haben, oder wir sind die glücklichen Käufer, haben aber viel mehr gezahlt, als nötig gewesen wäre, um die andern auszustechen. Das nennt sich ›blind bieten‹.«
»Die Chancen, sich zu ärgern, stehen also ziemlich gut«, fasste ich zusammen. »Hast du den Verkäufer mal gefragt, von welchem Preis er ausgeht?«
»Er rechnet mit mindestens 7000 Euro.«
»Also müssen wir 10 000 bieten.«
»Ich würde es wie bei Ebay-Auktionen machen und lieber eine krumme Summe nehmen«, meinte Felix. »Was hältst du von 10 076?«
»Dann bin ich für 10 137 Euro.«
Es war Montag und mittlerweile zehn Uhr. Bis 13 Uhr musste unsere Offerte beim Verkäufer eingegangen sein – per Fax. Ob wir es pünktlich zu unserem Faxgerät im heimatlichen Berlin schaffen würden?
»Wir fahren auf eine Autobahnraststätte«, entschied Felix. »Die werden wohl ein Faxgerät haben!« Ich war fest davon überzeugt, dass man uns selbst in der lausigsten Frittenbude ein Faxgerät servieren würde. Wenn Felix ein Ziel verfolgt, zählen keine Hindernisse.
Heck mit Ankerwinde. Die drei Türen führen zum Aggregatraum, zum Heizungsraum und ins Schiffsinnere.
In dieser Nacht schliefen wir unruhig. Das »WS 3454« war ein tolles Angebot, eines, das nicht alle Tage auf dem Bootsmarkt auftauchte. Wir hatten uns schon einige Schiffe angesehen, auf dem Rhein und der Spree, an der Ost- und Nordsee, Kutter und Barkassen, Schlepper und Fährschiffe. Die meisten hätte man erst aufwendig umbauen müssen, zu aufwendig für den Preis, den ihre Besitzer verlangten.
Zuletzt hatten wir über den Kauf der »Anastasia« verhandelt, einer kleinen Schiffspension mit einem bestechend schönen runden Bug. Der aus der Kaiserzeit stammende ehemalige Lastkahn war ein richtiges Schmuckstück. Seinen wohnlichen Aufbau hatte er zu DDR-Zeiten bekommen, Ende der Neunzigerjahre hatte ihn eine junge Frau zur Pension umgestaltet. Nun wollte sie zu ihrem Freund ziehen und ihr Leben als Schiffspensionsbetreiberin aufgeben.
Auf »Anastasia« hätte man sofort wohnen können. Die fünf Duschen, die in den fünf Gästezimmern eingebaut worden waren, wollte Felix zu Kleiderschränken umbauen plus einen Schrank für meine Schuhkollektion. Den Gedanken, mir mit dem Kauf dieses Schiffes eine lange Bauphase zu ersparen, fand ich äußerst sympathisch. Doch »Anastasia« war lediglich mit Styropor gedämmt worden. Man würde im Winter frieren und im Sommer schwitzen. Ein Umstand, den wir trotz meiner Abneigung gegen Baumaßnahmen künftig hätten ändern müssen und der sich im Preis niederschlagen sollte, wie wir fanden. Die Verkäuferin sah das anders. Dann entdeckte Felix »WS 3454«, und wir beschlossen, die Verhandlung um »Anastasia« vorerst auszusetzen.
Nun lagen wir wach und fantasierten über den Ausgang des Bieterverfahrens. Welches Schiff würde das Rennen machen? Die hübsche »Anastasia« oder das schlichte »WS 3454«? Sofort einziehen oder monatelange Bauarbeiten? In wenigen Stunden würden wir es wissen.
Am nächsten Vormittag jubelte Felix mir dann in den Telefonhörer: »Wir haben den Zuschlag bekommen! Uta, wir sind jetzt Schiffsbesitzer! Und stell dir vor, wir lagen nur 50 Euro über dem nächsthöheren Bieter!«
Neue Schiffsbesitzer. Verantwortung für rund 100 Tonnen Stahl.
50 Euro? Also hatte mein Vorschlag den Ausschlag dafür gegeben, dass dieses große Schiff nun uns gehören sollte? Ich konnte es noch nicht glauben. Bis jetzt war alles lediglich eine Fantasie gewesen, ein Spiel mit den Möglichkeiten. Erst jetzt wurde mir klar, dass wir nun auch Verantwortung übernehmen würden, Verantwortung für rund 100 Tonnen Stahl.
Genesis
Die Idee mit dem Hausboot basierte eigentlich auf einem Missverständnis. Dieses entstand, weil Felix eine politische Willensbekundung ernst genommen hatte, eine Überlegung, die zwei Jahre zuvor in einem Sitzungssaal geäußert worden war. Drehen wir die Zeit dorthin zurück, lauschen und spähen durch ein Schlüsselloch in einen holzgetäfelten Saal in der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft. Dort haben sich im Frühling 2002 etwa 60 Menschen versammelt, die in ihrem Berufsleben auf irgendeine Weise mit den Berliner Gewässern zu tun haben – beschlipste Beamte und Geschäftsführer, hemdsärmelige Tankstellenbetreiber, Bootsvermieter und Schiffsgastronomen, Mitarbeiterinnen aus Ämtern und Verwaltungen in Kostümen und Hosenanzügen. Die Sitzung hat bereits begonnen, gerade spricht der Präsident eines Sportverbandes.
»Ich erwarte, dass bei Ihrer neuen Konzeption nicht nur motorbetriebene Boote berücksichtigt werden, sondern auch muskelbetriebene. Das Wasser- und Schifffahrtsamt verbietet nämlich uns Ruderern und Kanuten auf vielen Kanälen die Durchfahrt!«
»Natürlich, Herr Präsident, werden wir auch die muskelbetriebenen Boote berücksichtigen«, versicherte der moderierende Staatssekretär.
»Es gibt viel zu wenig Liegeplätze in der Stadt«, beschwerte sich ein Hotelier.
»Da gebe ich Ihnen recht«, sagte der Staatssekretär.
»Die Genehmigungsverfahren für öffentliche Liegestellen sind schwierig und langwierig«, bemängelte die Dame von der Industrie- und Handelskammer.
Auch das bestritt der Staatssekretär nicht. »Ja, es ist notwendig, an dieser Stelle mehr Transparenz walten zu lassen.«
Berlin ist reich an Wasser, aber arm an Liegeplätzen für Hausboote.
Jetzt schaltete sich der Vermieter von Motoryachten ein: »Die Tourismus-Werber müssen mehr Wasserkarten von Berlin verteilen.«
Ein Stadtplaner entgegnete: »Aber man darf doch das Wasser nicht nur als Wirtschaftsfaktor sehen. Es hat viele Funktionen, und die sind nicht alle gleichberechtigt! Bedenken Sie, dass der Naturschutz immer noch Vorrang hat!«
»In der Tat müssen wir da abwägen«, bestätigte der Staatssekretär.
Freiweg durfte jeder der Anwesenden seine Vorstellungen äußern, wie man die Berliner Gewässer in ein touristisches Lockmittel verwandeln könnte. Kein Gedanke sollte zu abwegig sein, um ihn nicht aussprechen zu dürfen. Auch Felix, der damals Veranstaltungen für die Stadt Berlin organisierte, saß in dieser illustren Runde. Anschließend holte ich ihn ab. Die Sitzung schien ihn völlig euphorisiert zu haben.
»Stell dir vor, die wollen Liegestellen für Hausboote schaffen!« Er zog ein paar Blätter aus seiner Tasche und hielt sie mir unter die Nase.
»Die Stadt muss sich stärker zum Wasser hin öffnen«, las ich. »Alternative Wohn- und Lebensformen an und auf dem Wasser wie etwa Hausboote, Restaurantschiffe oder Floating Apartments tragen zur Vernetzung von Wasser und Stadt bei. Beispiele aus den USA oder den Niederlanden verdeutlichen, wie solche Nutzungsformen integrative Bestandteile von Stadtentwicklung sein können.«
»Hm, ja«, machte ich, verstand aber nicht, was das mit mir zu tun haben sollte.
»Hej, stell dir vor, du liegst im Bett und hörst die Wellen, wie sie gegen dein Schiff klatschen. Dann wachst du auf, und an deinem Fenster schwimmen Enten und Schwäne vorbei!«, begeisterte sich Felix. »Oder du putzt dir die Zähne und siehst aufs Wasser, in dem sich das Sonnenlicht spiegelt! Das ist doch geil!«
Wir wohnten damals in einer Dachgeschosswohnung in Berlin-Mitte. Von unserer Terrasse schaute man auf den Mariannenplatz – die Wiege der Kreuzberger Hausbesetzerszene –, auf grüne Bäume und die malerische Kulisse der Thomaskirche. Wir fühlten uns hier wohl, wussten aber, dass die Wohnung für uns vier allmählich zu klein wurde.
Über das Wohnen auf dem Wasser hatte ich bis dahin niemals nachgedacht. Ich bin keine Wasserratte, Schwimmen finde ich langweilig, und bei hohem Seegang wird mir schlecht. Felix dagegen liebt die Wellen und das Meer, auf das er gern hinaussegelt, weil er nur hier die unendliche Freiheit empfindet, die zu seinem querdenkenden Geist passt. Und in diesen nistete sich nun eine Idee ein, die Idee vom eigenen Hausboot.
Nordufer des Rummelsburger Sees: »Das ist doch ein schöner Platz!«
Neue Anschrift gesucht
Schon von Weitem hatte Tom seinen Vater erspäht, der mit einem kleinen Motorboot auf die Schillingbrücke zusteuerte, an der wir uns verabredet hatten. Tom freute sich auf unseren kleinen Ausflug, wild hüpfend winkte er seinem Vater vom Ufer zu, sprang die Böschung herunter, wo Felix mit dem gemieteten Boot wartete. Vorsichtig kletterte ich mit unserem Baby auf dem Arm und dem Picknick auf dem Rücken hinterher. Einigermaßen wohlwollend ließ sich Oscar seine Rettungsweste umschnallen, dann schaukelten wir spreeabwärts.
Es war nicht einfach nur ein netter Ausflug, den wir an diesem heißen Augustsonntag unternahmen. Felix und ich hielten nach einem Liegeplatz Ausschau, nach einem Liegeplatz für ein Schiff, das wir noch nicht einmal besaßen. Wir suchten nach einer Stelle, an der das Ufer bereits zu einer Kaikante umgebaut worden war, damit wir mit unserem Schiff kein Schilf und keine Nist- oder Laichplätze zerstörten. Außerdem sollte unser Heim niemanden behindern, vor allem nicht den Verkehr auf dem Wasser. Wir waren optimistisch, solche Plätze in einer Stadt mit 195 schiffbaren Flusskilometern zu finden. Tatsächlich konnten wir uns unseren neuen Wohnort an etlichen Stellen vorstellen, an denen wir vorüberfuhren. Nach jedem »Guck mal, dort ist es doch schön!«-Ausruf drückten wir auf den Auslöser der Kamera.
Unterdessen hatte die Sonne ihren Zenit erreicht, es wurde heißer und heißer. Oscar, der in seiner kleinen Rettungsweste fürchterlich schwitzte, schrie und ließ sich kaum noch beruhigen. Auch ich war völlig entnervt von der Hitze und dem Gebrüll. Dabei wollten wir uns doch noch einiges anschauen!
Wie die Astronauten an Bord der havarierten »Apollo 13« gingen wir die Liste unserer mitgebrachten Gegenstände durch. Wie immer hatten wir für den Kleinsten die größte Ausstattung dabei, sodass unser improvisiertes Sonnensegel schließlich aus einem Handtuch, einigen Stoffwindeln und einer Schnullerkette bestand. Rasch legte sich die Meuterei, die eigenwillige Konstruktion war der Durchbruch für unsere wichtige Mission.
Wir passierten Schleusen und Kanäle, bis wir durch den alten Wehrgraben an der Tiergartenschleuse fuhren, vorbei an den 13 Schiffen, die zu Berlins ältester und bekanntester Hausbootsiedlung gehören. In Schleichfahrt passierten wir die auf Pontons gelagerten Bungalows und Schiffsrümpfe mit skandinavisch inspirierten Holzaufbauten. Jedes Schiff sah anders aus. Neugierig schauten wir in manchen Innenraum und sahen Bewohner, die ihre Beine von der Terrasse aus ins Wasser baumeln ließen. Diese Bilder waren so romantisch, sie strahlten so viel Glück und Zufriedenheit aus, dass ich das erste Mal wirklich begriff, welchen Traum wir verfolgten. Uns fehlten nur noch ein Schiff und ein Liegeplatz.
Südufer des Rummelsburger Sees mit dem ehemaligen Palmkernöl-Speicher: unrealisierte Stadtplanungs-Idee von »Floating Homes«.
Mittlerweile hatten wir herausbekommen, dass es grundsätzlich zwei Möglichkeiten gab, einen Liegeplatz zu bekommen. Wir konnten bei Marinas und Häfen nachfragen. Dort ist die Versorgung mit Strom und Wasser kein Problem, allerdings sind diese Liegeplätze in der Regel sehr teuer. Deutlich preiswerter ist ein Platz, an dem man nicht die Untermieterposition einnimmt. Für dessen Genehmigung sollten wir drei Behörden um Erlaubnis fragen: das zuständige Bezirksamt, Herrin des Uferbereiches, den Berliner Senat für Stadtentwicklung mit all seinen Unterabteilungen und schließlich das Wasser- und Schifffahrtsamt, denn die Spree ist eine Bundeswasserstraße, auf der die Schifffahrt nicht behindert werden darf.
Wir brauchten also ein dreifaches »Ja«, eines vom Bezirk, eines von der Stadt und eines vom Bund. Wer jemals mit Behörden verhandelt hat, weiß, wie unrealistisch dieses Ergebnis ist. Dennoch probierten wir es.
Rummelsburger Bucht, Nordufer. Das könnte unser Blick nach Osten sein …
Optimistisch reichten wir unsere zahlreichen Vorschläge bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz ein. Eine Reaktion blieb aus. Wir schrieben nun an den Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, dort besuchten unsere Kinder den Kindergarten. Der verwies uns zurück an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Wir beantragten also nochmals einen Liegeplatz, diesmal nur einen, der sich in der zu Friedrichshain gehörenden Rummelsburger Bucht befand – einem Seitenarm der Spree, der auf seiner westlichen Seite verlandet ist.
Wir erhielten sogar eine Antwort: »Für den gesamten Bereich der Rummelsburger Bucht wurde in meiner Verwaltung die Abstimmung getroffen, dass zunächst die bereits vorgestellte Konzeption eines Interessenten geprüft wird. Eine darüber hinausgehende weitere Inanspruchnahme der Gewässerflächen für bauliche Anlagen kann derzeit nicht berücksichtigt werden.«
… und das unser Blick nach Westen.
Bei dem Interessenten handelte es sich um die Wasserstadt GmbH, einen treuhänderischen Entwicklungsträger des Landes Berlin. Dieser sollte innerstädtisch und am Wasser gelegene Industriebrachen aufwerten und an Investoren verkaufen. Eines dieser Entwicklungsgebiete war die Rummelsburger Bucht, in der an einem Kai von 100 Metern Länge eine Siedlung mit acht schwimmenden Häusern entstehen sollte, die sogenannten Floating Homes.
2002 initiierte die Wasserstadt GmbH einen Architekturwettbewerb: Die Entwürfe zeigten eine futuristisch anmutende Wassersiedlung aus Glas und Beton, die von Seerosen, Wasserstoff-Atomen, Kapitänsbrücken und Bootshäusern inspiriert wurde. Bis zu 540 000 Euro sollte so ein Schwimmhaus kosten, keine Preisklasse für unangepasste Hausboot-Romantiker.
Diejenigen, die der Preis nicht schreckte, wurden von den Behörden gestoppt. Diese wollten kein unbefristetes Wohnen auf dem Wasser garantieren, was die finanzierenden Banken zur Bedingung erhoben hatten.
2004, Osthafen mit »Helene«: Mit zwei kleinen Kindern in einen Industriehafen?
Mehrere Investoren versuchten sich an diesem einzigartigen Vorhaben. Einen von ihnen traf ich Jahre später zufällig auf einer Party. Er musste lachen, als er erzählte, dass er mit keinem seiner erfolgreichen Bauprojekte auf so viel Medieninteresse gestoßen war, wie mit den gescheiterten »Floating Homes«. Weit über die Landesgrenzen war die Kunde von den schwimmenden Häusern gedrungen, die letztlich nur eine Vision blieben. Nach Meinung meines Gesprächspartners habe den Behörden die Begeisterung für dieses Projekt gefehlt.
Wir hatten jedenfalls Anfang 2003 bei der Wasserstadt GmbH gefragt, ob wir uns mit einem eigenen Hausboot zu den »Floating Homes« gesellen dürften. Von dort hieß es, man befände sich noch »in der Klärung von Grundsätzen, die für die Vergabe von Liegeplätzen gelten sollten« und bitte um Geduld.
Was war aus der Idee von der »stärkeren Öffnung der Stadt zum Wasser« und den »transparenten, schnellen Genehmigungsverfahren« geworden?
Felix recherchierte weiter. Im März 2003 zeigte er mir freudestrahlend ein Fax.
»Bootsliegeplatz im Osthafen«, las ich.
»Ich habe einen Liegeplatz für uns gefunden!«
»Du hast was?«
»Ich habe beim Osthafen angerufen und gefragt. Die haben einen Liegeplatz für uns. Die Miete ist moderat, Wasser und Strom gibt’s auch. Dort könnten wir liegen, bis wir etwas anderes gefunden haben.«
Osthafen. Liegeplatz mit Briefkasten und Fahrrad-Stellplatz..
»Das ist ein Industriehafen! Dort fahren Lkw und eine Bahn, da stehen Container und Kräne, die ständig Sand und Steine verladen. Dort willst du wohnen? Mit zwei kleinen Kindern?«
Für seine bahnbrechende Nachricht fiel ich meinem Mann nicht um den Hals. Das lag an der Rollenverteilung, die im Lauf der Zeit in unserer Beziehung stattgefunden hatte. Felix ist jemand, der jeden Tag Ideen entwickelt, gute und schlechte, tragfähige und unausgereifte, geniale und absurde – immer wieder neue. Ich bin diejenige, die davon als Erste erfährt, die sie sortiert und bewertet. Und da es so viele Ideen sind, liegt die Messlatte für das Qualitätssiegel »darüber sollte man nachdenken« sehr hoch.
Da ich mich in der Rolle der Ideen-Killerin nicht wohlfühle, gab ich nach. Schon bald inspizierten wir unsere potenzielle neue Wohngegend, den Osthafen in Berlin-Friedrichshain. Hier, wo sich einst Europas größter Binnenhafen befunden hatte, wo 40 mit jeweils 600 Tonnen beladene Schiffe gleichzeitig festmachen konnten, hier siedelten sich seit zwei, drei Jahren neben ein paar verbliebenen Baustoffund Logistikfirmen zunehmend Medienunternehmen wie »Universal«, »MTV« und die »Berliner Fernsehwerft« an. Als wir zur Besichtigung eintrafen, sahen wir zwar noch einige Verladekräne und Schienen für die Transportbahn, die quer übers Gelände führten. Doch dem 90 Jahre alten Hafen war deutlich anzumerken, dass er immer weniger als Güterumschlagplatz genutzt wurde. Zwei Jahre später wurde der Betrieb gänzlich eingestellt und die Filetgrundstücke mit Flussblick an Investoren verkauft – eine Entwicklung, die für uns nicht positiv sein sollte.
An diesem Tag aber waren wir einfach glücklich, dass uns der Hafen freundlicher erschien als angenommen. Wir stellten uns vor, wie wir hier festmachen würden – kurz vor der Oberbaumbrücke mit ihren pittoresken Türmchen über einem mittelalterlich anmutenden Kreuzgang und vis-a-vis dem Badeschiff, einem mit fast 400 Kubikmetern Wasser gefüllten Ponton, sowie den »Molecule Men«, drei überdimensionalen Silhouetten aus durchlöcherten Aluminiumplatten, die das Verschmelzen menschlicher Moleküle symbolisieren und den in der Nähe befindlichen Punkt markieren, an dem die drei Stadtbezirke Friedrichshain, Kreuzberg und Treptow aneinanderstoßen.
Endlich hatten wir einen Liegeplatz gefunden. Fehlte nur noch ein Schiff.
Abgeblätterte Farbe. Rost und alter Anstrich müssen in einer Werft entfernt werden.
Kredit-Mathematik
Kurz vor Weihnachten 2003 ging »WS 3454« in unseren Besitz über. Wir nannten es »Helene«, das war der Mädchenname, den wir am Anfang meiner ersten Schwangerschaft ausgesucht hatten und der nach der Geburt unserer beiden Söhne quasi übrig geblieben war. Es bedurfte keiner langen Diskussion ihn nun als Schiffsnamen zu verwenden, schließlich war auch das Hausboot ein gemeinsames Baby.